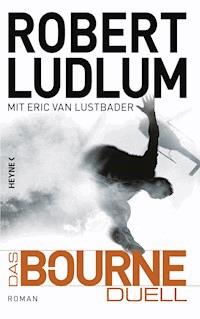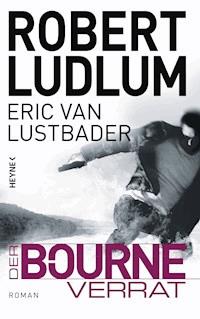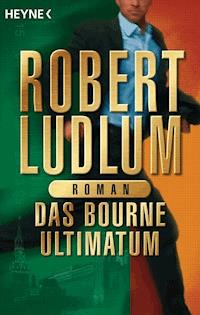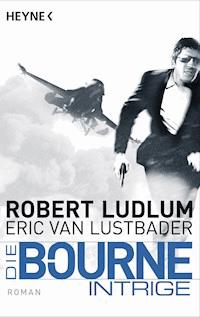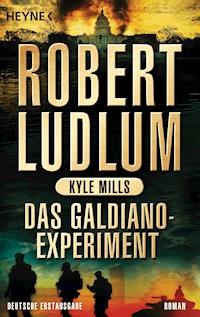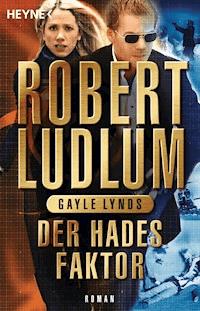
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: COVERT ONE
- Sprache: Deutsch
Drei Menschen werden Opfer eines unbekannten Virus. Als auch die Molekularbiologin Dr. Sophia Russel daran stirbt, glaubt Colonel Smith nicht mehr an einen Unfall. Er kommt den teuflischen Machenschaften eines Pharmagiganten auf die Spur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 719
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
HEYNE 〈
Die Autoren
Robert Ludlums Romane wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt und erreichten weltweit eine Auflage von über 200 Millionen Exemplaren. Der Autor verstarb im März 2001. Die Romane aus seinem Nachlass erscheinen bei Heyne.
Gayle Lynds arbeitete mehrere Jahre beim amerikanischen Geheimdienst, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. Als Co-Autorin mehrerer Ludlum-Romane machte sie sich einen Namen in der Thrillerszene. Mit ihrem Mann lebt sie in Santa Barbara, Kalifornien. Bei Heyne erschien außerdem ihr Roman Nautilus-Plan, ein weiterer Roman ist in Vorbereitung.
Das Buch
Nach mehreren mysteriösen Todesfällen wird die junge und schöne Wissenschaftlerin Dr. Sophia Russel damit beauftragt, nach deren Ursache zu forschen. Schon bald ist sie sich sicher, es mit einem bisher unbekannten Virus zu tun zu haben. Als ihr Verlobter Colonel Jon Smith eine verdeckte Warnung erhält, schenkt er ihr zunächst keine Beachtung – bis es zu spät ist und Sophia ebenfalls erkrankt. Kurz darauf verstirbt sie. Smith, der inzwischen davon überzeugt ist, dass Sophia nicht durch Zufall infiziert wurde, beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Alle Spuren weisen zu einem Pharmagiganten und seinen dunklen Machenschaften. Doch wird es Smith rechtzeitig gelingen, die Herkunft des Virus zu identifizieren und eine weltweite Pandemie zu verhindern?
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
Freitag, 10. Oktober, 19 Uhr 14Boston, Massachusetts
Mit einem Eindollarschein in einer seiner zitternden Hände stolperte Mario Dublin durch eine belebte Straße der Innenstadt. Der taumelnde Stadtstreicher, der sich mit der freien Hand den Kopf hielt, ließ die energische Entschlossenheit eines Mannes erahnen, der sein Ziel genau kannte. Er wankte in einen Discount-Drugstore mit Sonderangebotsplakaten in beiden Schaufenstern.
Zitternd schob er den Dollarschein über die Theke. »Advil. Aspirin verträgt mein Magen nicht. Ich brauche Advil.«
Der Verkäufer schürzte verächtlich die Lippen, als er den unrasierten Mann in der zerlumpten Armeeuniform sah. Aber Geschäft war Geschäft. Er griff in ein Regal mit Schmerzmitteln und hielt dem Kunden die kleinste Packung Advil hin. »Sie müssen schon drei Dollar drauflegen, wenn Sie die Tabletten mitnehmen wollen.«
Dublin ließ den Geldschein auf die Theke fallen und griff nach der Schachtel.
Der Angestellte zog die Hand zurück. »Sie haben gehört, was ich gesagt habe, Kumpel. Noch drei Dollar. Ohne Moos gibt’s nichts.«
»Ich habe nur einen Dollar, und mein Schädel explodiert!« Mit erstaunlicher Geschwindigkeit streckte sich Dublin über die Theke und griff nach der kleinen Schachtel.
Der Verkäufer versuchte, sie zurückzuziehen, aber Dublin war hartnäckig. Während sie miteinander rangen, stießen sie ein Glas mit Süßigkeiten und ein Regal mit Vitamintabletten zu Boden.
»Lass los, Eddie!«, brüllte der Besitzer vom hinteren Teil des Raums, bevor er zum Telefon griff. »Lass ihm die Tabletten!«
Der Angestellte gehorchte, während der Besitzer eine Nummer wählte.
Hektisch riss Dublin die versiegelte Schachtel auf, fummelte an dem kindersicheren Verschluss herum und schüttete die Tabletten in seine Hand, wobei einige auf dem Boden landeten. Dann steckte er die Pillen in den Mund. Würgend versuchte er, sie alle auf einmal hinunterzuschlucken. Von den Schmerzen geschwächt, sank er zu Boden und presste seine Hände schluchzend gegen die Schläfen.
Ein paar Augenblicke später fuhr ein Streifenwagen vor dem Drugstore vor und der Inhaber winkte die Polizisten herein. »Schaffen Sie diesen stinkenden Penner aus meinem Laden! Sehen Sie nur, was er angerichtet hat. Ich werde Anzeige wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Diebstahl erstatten!«
Die Polizisten zogen ihre Schlagstöcke hervor. Neben dem geringfügigen Sachschaden und den verstreuten Tabletten fiel ihnen auch der Alkoholgestank auf.
Der Jüngere half Dublin auf die Beine. »Okay, Mario, wir machen jetzt eine kleine Spritztour.«
Sein Kollege packte Dublins anderen Arm und dann schoben sie den Betrunkenen, der keinen Widerstand leistete, zum Streifenwagen. Als der zweite Polizist die Wagentür öffnete, drückte der jüngere die Hand auf Dublins Kopf, um ihn ins Innere des Autos zu bugsieren.
Schreiend schlug Dublin um sich und wich vor der Hand auf seiner pochenden Schläfe zurück.
»Schnapp ihn dir, Manny!«, brüllte der jüngere Streifenbeamte.
Manny versuchte es, aber Dublin konnte sich befreien. Der jüngere Polizist packte ihn, und Manny holte mit seinem Schlagstock aus und streckte ihn zu Boden. Schreiend und am ganzen Körper zitternd, rollte Dublin über den Bürgersteig.
Die beiden Polizisten erbleichten und starrten sich an.
»So hart habe ich ihn auch wieder nicht getroffen«, meinte Manny.
Der Jüngere bückte sich, um Dublin aufzuhelfen. »Guter Gott, der macht schlapp!«
»Schaff ihn ins Auto!«
Nachdem sie den keuchenden Obdachlosen hochgehoben hatten, bugsierten sie ihn auf den Rücksitz des Polizeiautos. Mit heulender Sirene raste der Streifenwagen durch die nächtlichen Straßen. Nachdem sie mit kreischenden Bremsen vor der Notaufnahme gehalten hatten, stieß Manny die Tür auf und stürmte ins Krankenhaus, um Hilfe zu rufen.
Der andere Polizist rannte um den Wagen herum und öffnete die Fondtür.
Als die Ärzte und Krankenschwestern mit einer Bahre herauskamen, starrte der jüngere Cop wie gelähmt auf den Rücksitz, wo Mario Dublin in einer Blutlache lag und Blut auf den Boden tropfte.
Der Arzt atmete tief durch. Dann stieg er in das Auto, fühlte Dublins Puls, horchte das Herz ab und kletterte kopfschüttelnd aus dem Streifenwagen heraus. »Er ist tot.«
»Unmöglich!« Die Stimme des älteren Polizisten wurde lauter. »Wir haben die Sau kaum angerührt! Das können die uns nicht anhängen.«
Weil die Polizei in den Fall verwickelt war, bereitete ein Arzt bereits vier Stunden später in der Leichenhalle im Keller des Krankenhauses alles für die Autopsie des verstorbenen Mario Dublin vor, dessen Wohnsitz unbekannt war.
Die Tür flog auf. »Schlitz ihn noch nicht auf, Walter.«
Dr. Walter Pecjic blickte auf. »Stimmt was nicht, Andy?«
»Vielleicht hat es ja nichts zu bedeuten«, antwortete Dr. Andrew Wilks nervös, »aber das viele Blut in dem Streifenwagen macht mir Sorgen. Akutes Lungenversagen dürfte nicht zu Blutungen aus dem Mund führen. Solch eine exzessive Hämorrhagie habe ich nur bei der Behandlung einer tropischen Fieberkrankheit gesehen, als ich in der UN-Friedenstruppe in Afrika diente. Dieser Typ hatte einen Behindertenausweis der Veteranen bei sich. Eventuell war er in Somalia oder irgendwo sonst in Afrika stationiert.«
Dr. Pecjic starrte auf den Toten, den er obduzieren wollte. Dann legte er das Skalpell weg. »Vielleicht sollten wir doch den Chef anrufen.«
»Und das Institut für Infektionskrankheiten«, fügte Dr. Wilks hinzu.
Dr. Pecjic nickte. Sein Blick verriet nackte Angst.
19 Uhr 55Atlanta, Georgia
In der Aula der Highschool herrschte angespannte Stille im Publikum, das aus Eltern und Freunden der Schüler bestand. Auf der hell erleuchteten Bühne stand ein wunderschönes Mädchen im Teenageralter vor einem Bühnenbild, das die Restaurantszene aus William Inges Drama Bus Stop darstellte. Ihre Bewegungen waren unbeholfen, und die Wörter, die sie sagte, klangen nicht wie üblich fröhlich und ungezwungen, sondern leblos und steif.
Doch das irritierte die resolute, mütterliche Frau in der ersten Reihe nicht, die ein silbergraues Kostüm trug, wie man es bei der Brautmutter auf einer Hochzeitsfeier erwarten mochte, dazu ein feierliches Ansteckbukett aus Rosen. Sie strahlte das Mädchen an, und als am Ende der Szene höflicher Beifall gespendet wurde, applaudierte sie heftig.
Nach dem letzten Vorhang sprang sie auf, um erneut zu klatschen. Dann ging sie zum Bühneneingang und wartete, bis die Schauspieler in Zweier- und Dreiergrüppchen erschienen, um sich zu ihren Eltern, Freundinnen und Freunden zu gesellen. Es war die letzte Aufführung des alljährlichen Schuldramas gewesen und die Schauspieler hatten vor lauter Stolz errötete Gesichter. Sie freuten sich auf die Party, die bis spät in die Nacht dauern würde.
»Ich wünschte, dein Vater hätte dich heute Abend sehen können, Billie Jo«, sagte die stolze Mutter, während die Highschool-Schönheit ins Auto stieg.
»Ich auch, Mama. Lass uns nach Hause fahren.«
»Nach Hause?«, fragte die Mutter verwirrt.
»Ich muss mich etwas hinlegen. Danach ziehe ich mich für die Party um, okay?«
»Du klingst ziemlich heiser.« Die Mutter betrachtete das Gesicht ihrer Tochter und fädelte sich dann in den Verkehr ein. Seit über einer Woche litt Billie Jo an Husten und Schnupfen, aber sie hatte darauf bestanden, in der Aufführung mitzuspielen.
»Es ist nur eine Erkältung«, sagte das Mädchen leicht irritiert.
Als sie das Haus erreicht hatten, rieb sie sich stöhnend die Augen. Auf ihren Wangen sah man zwei rote Fieberflecken. Ihre verängstigte Mutter schloss hektisch die Haustür auf und wählte die Notrufnummer. Der Beamte riet ihr, das Mädchen im warmen Wagen sitzen zu lassen. Innerhalb von drei Minuten waren die Notärzte da.
Während der Krankenwagen mit heulender Sirene durch die Straßen von Atlanta raste, wand sich das Mädchen auf der Bahre und rang stöhnend nach Luft. Die Mutter strich ihrer fiebernden Tochter übers Gesicht und brach dann verzweifelt in Tränen aus.
In der Notaufnahme des Krankenhauses ergriff eine Krankenschwester die Hand der Mutter. »Wir werden alles Nötige veranlassen, Mrs. Pickett. Ich bin sicher, dass es ihr bald besser gehen wird.«
Zwei Stunden später begann Billie Jo, Blut zu spucken. Kurz darauf starb sie.
17 Uhr 12Fort Irwin, Barstow, Kalifornien
Anfang Oktober war das Wetter in der kalifornischen Hochwüste so unsicher und wechselhaft wie die Befehle, die ein frisch gebackener Unteroffizier seiner ersten Truppe erteilt. An diesem Tag war es klar und sonnig gewesen, und als Phyllis Anderson in der Küche ihres komfortablen, zweistöckigen Hauses im besten Teil des National Training Center das Abendessen vorzubereiten begann, war sie optimistisch. Nach dem heißen Tag hatte ihr Mann Keith ein langes Nickerchen gehalten. Seit zwei Wochen hatte er mit einer schweren Erkältung zu kämpfen, und sie hoffte, dass die Sonne und Wärme die Krankheit ein für alle Mal vertreiben würden.
Vor ihrem Küchenfenster waren die Rasensprenger eingeschaltet. Die Schatten des Spätnachmittags wurden immer länger. Auf den Beeten blühten Spätsommerblumen, die sich von der rauen Wildnis mit den dornigen, graugrünen Mesquitbäumen, Yucca, Kreosoten und Kakteen abhoben, die zwischen den schwarzen Felsen der beigefarbenen Wüste wuchsen.
Während sie die Makkaroni in die Mikrowelle schob, summte Phyllis vor sich hin. Sie lauschte auf die Schritte ihres Mannes, der die Treppe herunterkam. Heute musste der Major zu einem nächtlichen Manöver. Aber das Geräusch der stolpernden Schritte klang eher nach ihrem Sohn Keith Junior, der aufgeregt die Treppe herunterturnte, weil sie die beiden Kinder ins Kino mitnehmen wollte, da der Vater zur Arbeit musste. Es war schließlich Freitag.
»Hör auf damit, Jay-Jay«, rief sie.
Aber es war nicht Keith Junior.
Ihr Mann taumelte in die warme Küche, schon halb in seiner Wüstentarnkleidung. Er schwitzte stark und presste beide Hände gegen den Kopf, als ob er verhindern wollte, dass er explodierte.
»Ins Krankenhaus …«, keuchte er. »Ich brauche Hilfe …«
Vor ihren Augen brach er auf dem Küchenboden zusammen. Sein Brustkorb hob und senkte sich, während er mühsam nach Atem rang.
Phyllis starrte ihn entsetzt an, handelte dann aber mit der Schnelligkeit und Zielstrebigkeit der Soldatenfrau. Sie schoss aus der Küche, riss ohne anzuklopfen die Seitentür des Nachbarhauses auf und stürmte in die Küche.
Captain Paul Novak und seine Frau starrten sie mit weit aufgerissenem Mund an.
»Wo brennt’s denn, Phyllis?« Novak stand auf.
Sie verlor keinen Augenblick Zeit. »Ich brauche Ihre Hilfe, Paul. Passen Sie bitte auf unsere Kinder auf, Judy. Schnell!«
Phyllis wirbelte herum und rannte los, gefolgt von Captain Novak und dessen Frau. Ein Soldat stellte keine Fragen, wenn er einen Einsatzbefehl erhielt.
In der Küche der Andersons begriffen die Novaks die Situation sofort. »Soll ich den Notarzt rufen?« Judy Novak griff nach dem Telefonhörer.
»Keine Zeit!«, schrie ihr Mann.
»Wir nehmen unseren Wagen!«, brüllte Phyllis.
Judy Novak rannte die Treppe nach oben, wo die beiden Kinder sich in ihren Zimmern fürs Kino fertig machten. Phyllis Anderson und Novak hoben den keuchenden Major, aus dessen Nase Blut tröpfelte, vom Boden hoch. Er war halb bewusstlos, stöhnte und konnte nicht mehr sprechen. Über den Rasen eilten sie zum Wagen.
Novak setzte sich hinter das Lenkrad und Phyllis stieg mit ihrem Mann hinten ein. Sein Kopf ruhte an ihrer Schulter und sie drückte ihren Mann fest an sich. Während er nach Luft schnappte, starrten seine Augen sie gequält an. Hupend raste Novak durch den Militärstützpunkt, und der Verkehr teilte sich wie bei einem Infanterietrupp, der den Panzern Platz macht.
Doch als sie das Weed Army Community Hospital erreichten, hatte Major Keith Anderson bereits das Bewusstsein verloren.
Drei Stunden später war er tot.
Im Falle eines plötzlichen, rätselhaften Todes wurde im Bundesstaat Kalifornien eine Autopsie angeordnet. Wegen der ungewöhnlichen Umstände wurde der Leichnam des Majors sofort in die Leichenhalle gebracht. Als der Militärarzt seinen Brustkorb öffnete, schoss eine große Menge Blut heraus.
Sein Gesicht wurde kalkweiß. Er sprang zurück, streifte die Gummihandschuhe ab und rannte aus dem Obduktionsraum in sein Büro.
Dort griff er nach dem Telefonhörer. »Verbinden Sie mich mit dem Pentagon und dem USAMRIID. Sofort! Es ist dringend !«
ERSTER TEIL
1
Sonntag, 12. Oktober, 14 Uhr 55London, England
In Knightsbridge fiel ein kalter Oktoberregen. Der stetige Strom von hupenden Autos, Taxen und roten Doppeldeckerbussen an der Kreuzung Brompton Road und Sloane Street bewegte sich stockend auf Sloan Square und Chelsea zu. Weder der Regen noch die Tatsache, dass die Unternehmens- und Regierungsbüros am Wochenende geschlossen waren, verringerte den dichten Verkehr. Die Weltwirtschaft lief gut, die Läden waren voll, und die neue Labour-Regierung hatte das Land nicht ruiniert. Heutzutage besuchten die Touristen London zu jeder Jahreszeit und an diesem Sonntagnachmittag kamen die Autos nur im Schneckentempo voran.
Ungeduldig sprang Dr. Jonathan »Jon« Smith, Lieutenant Colonel der U. S. Army, zwei Straßen vor seinem Ziel elegant vom Trittbrett des langsam fahrenden, altmodischen Busses der Linie 19. Jetzt hatte der Regen etwas nachgelassen. Smith machte ein paar große Schritte auf den nassen Bürgersteig neben dem Bus und lief dann eilig weiter.
Er war ein großer, durchtrainierter, athletischer Mann Anfang Vierzig mit zurückgekämmtem Haar und ebenmäßigen Gesichtszügen. Automatisch beobachteten seine marineblauen Augen Fahrzeuge und Passanten. Er trug ein Tweed-Jackett, eine Baumwollhose und einen Trenchcoat. An seiner äußeren Erscheinung war nichts ungewöhnlich, dennoch schauten sich viele Frauen nach ihm um. Gelegentlich registrierte er es lächelnd, aber er setzte seinen Weg unbeirrt fort.
Am Wilbraham Place trat er aus dem Nieselregen in die Halle des alten, eleganten Wilbraham-Hotels, wo er immer ein Zimmer mietete, wenn das USAMRIID ihn wegen eines medizinischen Symposions nach London schickte. Auf der Treppe nahm er zwei Stufen auf einmal, um zu seinem Zimmer im zweiten Stock zu gelangen. Dort durchwühlte er seine Koffer und suchte die Berichte über den Ausbruch hohen Fiebers bei in Manila stationierten amerikanischen Soldaten. Er hatte versprochen, sie Dr. Chandra Uttam zu zeigen, der für die Abteilung für Viruserkrankungen bei der Weltgesundheitsorganisation tätig war.
Schließlich fand er sie unter einem Haufen getragener Kleidungsstücke, die er in den größeren Koffer geworfen hatte. Er seufzte und grinste. Leider hatte er die schlechten Angewohnheiten nicht ablegen können, die er während jener Jahre angenommen hatte, als er bei Vor-Ort-Einsätzen in Zelten gelebt und sich auf diese oder jene Krise konzentriert hatte.
Während er die Treppe hinunterrannte, um wieder zu der von der WHO veranstalteten Konferenz über Epidemien zurückzukehren, rief der Rezeptionist nach ihm.
»Hier ist ein Brief für Sie, Colonel. Es steht ›dringend‹ drauf.«
»Ein Brief?« Wer sollte ihm hierher schreiben? Smith blickte auf seine Armbanduhr, die auch den Wochentag anzeigte. »An einem Sonntag?«
»Er wurde persönlich abgegeben.«
Plötzlich war Smith beunruhigt. Er nahm den Umschlag entgegen und riss ihn auf. Auf dem weißen Papier stand weder ein Briefkopf noch ein Absender.
Smithy,
wir treffen uns Montag um Mitternacht auf dem Pierce-Mill-Picknickplatz im Rock-Creek-Park in Washington. Die Sache ist dringend. Sprich mit niemandem darüber.
B.
Smith’ Herz setzte für einen Schlag aus. Auf dieser Welt gab es nur einen Menschen, der ihn Smithy nannte – Bill Griffin. Er hatte ihn in der dritten Klasse der Hoover-Grundschule in Council Bluffs in Iowa kennen gelernt. Sie waren schnell Freunde geworden und hatten gemeinsam die Highschool, das College der Universität von Iowa und später die Graduate School der Uni Kalifornien in Los Angeles besucht. Erst nachdem Smith in Medizin und Bill in Psychologie promoviert hatte, trennten sich ihre Wege. Als beide in die Armee eintraten, erfüllten sie sich einen Jugendtraum. Bill arbeitete für den militärischen Geheimdienst. Seit mehr als zehn Jahren hatten sie sich nicht gesehen, aber trotz ihrer beruflichen Pflichten in der Fremde den Kontakt nie abreißen lassen.
Stirnrunzelnd und wie angewurzelt stand Smith in der prächtigen Halle und starrte verständnislos auf die geheimnisvollen Wörter.
»Stimmt etwas nicht, Sir?«, fragte der Rezeptionist höflich.
Smith blickte sich um. »Nein, alles in Ordnung. Ich muss schnell zurück, wenn ich das nächste Seminar nicht verpassen will.«
Nachdem er den Brief in die Tasche seines Trenchcoats gesteckt hatte, trat er in den regennassen Nachmittag hinaus. Woher wusste Bill, dass er in London und ausgerechnet in diesem abgelegenen Hotel war? Und warum dieses Getue wie in einem Spionageroman, das so weit ging, dass er einen Spitznamen aus ihrer Jugendzeit benutzte?
Keine Adresse, keine Telefonnummer.
Nur der Anfangsbuchstabe eines Vornamens.
Und warum um Mitternacht?
Smith betrachtete sich gern als einfachen Menschen, aber er wusste, dass das meilenweit von der Wahrheit entfernt war. Seine Laufbahn bewies, wie es in Wirklichkeit aussah. Er war Militärarzt in mobilen Armeekrankenhäusern gewesen und arbeitete jetzt in der Forschung. Auch er hatte kurzzeitig für den militärischen Geheimdienst gearbeitet. Dann war er eine Zeit lang Kommandeur einer Truppe gewesen. Die Rastlosigkeit gehörte so selbstverständlich zu seiner Persönlichkeit, dass er sie kaum noch wahrnahm.
Und doch hatte er während des letzten Jahres eine Art von Glück kennen gelernt, durch das er eine Konzentrationsfähigkeit wie nie zuvor erreicht hatte. Das lag nicht nur daran, dass er seine Arbeit beim USAMRIID als herausfordernd und aufregend empfand. Der eingeschworene Junggeselle hatte sich außerdem verliebt. Richtig verliebt. Es war nicht wie bei den Highschool-Affären, als Frauen wie durch eine Drehtür in sein Leben eingetreten und wieder daraus verschwunden waren. Sophia Russel bedeutete ihm alles. Auch sie war Wissenschaftlerin. Sie war seine Partnerin bei der Forschungsarbeit und eine blonde Schönheit.
Es kam vor, dass er von seinem Elektronenmikroskop aufblickte, um sie anzustarren. Immer wieder fragte er sich, wie sich diese zerbrechliche Schönheit mit so viel Intelligenz und eisernem Willen verbinden konnte. Der bloße Gedanke an sie ließ ihn jetzt spüren, wie sehr er sie vermisste. Morgen früh sollte er in Heathrow losfliegen. Dann würde ihm gerade noch genug Zeit bleiben, nach Maryland heimzufahren und mit Sophia zu frühstücken, bevor sie beide ins Labor mussten.
Aber jetzt hatte er diese verwirrende Botschaft von Bill Griffin erhalten.
Seine inneren Alarmglocken schrillten. Aber er empfand es auch als interessante Abwechslung. Trocken lächelte er vor sich hin. Offensichtlich war seine Rastlosigkeit immer noch nicht gezähmt.
Während er ein Taxi rief, schmiedete er schon Pläne.
Er würde seinen Flug auf Montagabend umbuchen lassen und sich um Mitternacht mit Bill Griffin in Washington treffen. Er kannte Bill schon zu lange, als dass er anders hätte handeln können. Dies bedeutete, dass er erst am Dienstag an seinem Arbeitsplatz erscheinen würde, einen Tag zu spät. General Kielburger, der Direktor des USAMRIID, würde rotsehen. Der General fand seine unabhängige, bei Vor-Ort-Einsätzen erprobte Methode, Probleme zu lösen, gelinde gesagt, ärgerlich.
Kein Problem – er würde sich dafür doppelt ins Zeug legen.
Gestern hatte er am frühen Morgen Sophia angerufen, einfach nur, weil er ihre Stimme hören wollte. Ihr Gespräch war aber unterbrochen worden, weil sie durch einen anderen Anruf gestört worden waren. Sie sollte sofort ins Labor kommen und einen Virus identifizieren, der in Kalifornien aufgetreten war. Es war gut möglich, dass Sophia die nächsten sechzehn oder vierundzwanzig Stunden durcharbeiten musste. Vielleicht würde es im Labor so spät werden, dass sie morgen früh noch gar nicht aufgestanden war, wenn er mit ihr frühstücken wollte. Smith seufzte enttäuscht. Das einzig Gute an der Sache war, dass sie zu beschäftigt sein würde, um sich um ihn Sorgen zu machen.
Er könnte eine Nachricht auf ihrem Anrufbeantworter hinterlassen, dass er einen Tag später zurückkommen würde und dass sie sich nicht beunruhigen solle. Ob sie es Kielburger erzählte oder nicht, war ihre Sache.
Und das Ganze lohnte sich für ihn auch noch. Die Verzögerung betrug zwar nur ein paar Stunden, aber das gab den Ausschlag: Er konnte sich noch mit Tom treffen. Tom Sheridan war der Chef des U. K.-Microbiological-Research-Establishment-Teams, das an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen alle Hantaviren arbeitete. Am heutigen Abend würde er sich nicht nur Toms Vortrag anhören, sondern ihn auch überreden, mit ihm essen zu gehen und einige Drinks zu nehmen. Er würde die Interna und Details seiner Forschungsarbeit aus ihm herauspressen, die Tom noch nicht veröffentlichen wollte, und es so deichseln, dass er ihn morgen – vor seinem abendlichen Rückflug – zu einem Besuch nach Porton Down einlud.
Nickend und beinahe lächelnd sprang Smith über eine Pfütze und riss die Tür des schwarzen Taxis auf, das neben ihm gehalten hatte. Er nannte dem Fahrer die Adresse, wo die Konferenz der WHO abgehalten wurde.
Doch als er sich zurücklehnte, verschwand sein Lächeln. Er zog den Brief von Bill Griffin aus der Tasche und las ihn erneut, weil er hoffte, Hinweise zu finden, die ihm bei der ersten Lektüre entgangen waren. Am bemerkenswertesten war, was nicht in dem Brief stand. Die Furche zwischen seinen Augenbrauen wurde tiefer. Während er über die Vergangenheit nachdachte, versuchte er herauszufinden, was geschehen sein mochte, dass Bill plötzlich auf diese Art und Weise Kontakt zu ihm aufnahm.
Wenn Bill Hilfe in wissenschaftlicher Hinsicht oder irgendeine Form der Unterstützung durch das USAMRIID brauchte, hätte er sich an die offiziellen Regierungskanäle gehalten. Mittlerweile war Bill Spezialagent des FBI und stolz darauf. Wie jeder andere Agent würde er den Direktor des USAMRIID um seine, Smith’, Dienste bitten.
Wenn es andererseits um etwas Privates ging, wäre das geheimnisvolle Getue überflüssig gewesen. In diesem Fall hätte er im Hotel anrufen und eine Telefonnummer hinterlassen können, damit Smith zurückrief.
In dem kühlen Taxi zuckte Smith mit den Achseln. Dieses Treffen war nicht nur inoffiziell, sondern geheim, und zwar sehr geheim. Das bedeutete, dass Bill das FBI, das USAMRIID und alle Regierungsbehörden übersprang.
Offenbar hoffte er, ihn in diese geheime Angelegenheit hineinziehen zu können.
2
Sonntag, 12. Oktober, 9 Uhr 57Fort Detrick, Maryland
Fort Detrick lag in Frederick, einer von den grünen Hügeln des westlichen Maryland umgebenen Kleinstadt, und war die Heimat des United States Army Medical Research Institute for Infectious Diseases, kurz USAMRIID oder einfach »das Institut« genannt. In den Sechzigerjahren hatte das Institut zur Erforschung von Infektionskrankheiten wie ein Magnet gewalttätige Proteste angezogen, weil damals dort im Auftrag der Regierung chemische und biologische Waffen entwickelt und getestet wurden. Als Präsident Nixon diese Programme 1969 beendete, verschwand das USAMRIID aus dem Scheinwerferlicht und wurde zu einem wissenschaftlichen Zentrum, wo Therapiemethoden entwickelt wurden.
Dann kam das Jahr 1989. Der hochgradig ansteckende Ebola-Virus schien für den Tod einiger Affen verantwortlich zu sein, die in einer Quarantäneeinrichtung in Reston in Virginia gestorben waren. Militär- und zivile Ärzte sowie Veterinärmediziner des USAMRIID waren herbeigeeilt, um eine Gefahr einzudämmen, die sich zu einer furchtbaren Epidemie unter den Menschen hätte ausweiten können.
Noch besser aber war, dass sie beweisen konnten, dass der in Reston aufgetretene Virus in genetischer Hinsicht minimal andersartig war als der tödliche Ebola-Virus, den man im damaligen Zaire und im Sudan identifiziert hatte. Am wichtigsten aber war, dass sich der Virus für Menschen als ungefährlich erwies. Diese aufregende Entdeckung katapultierte die USAMRIID-Wissenschaftler landesweit in die Schlagzeilen. Plötzlich war Fort Detrick wieder ein Thema, aber diesmal als Amerikas bestes militärisch-medizinisches Forschungsinstitut.
In ihrem USAMRIID-Büro dachte Dr. Sophia Russel über diesen Anspruch nach und hoffte auf eine Inspiration, während sie ungeduldig auf einen Anruf wartete. Sie wollte mit einem Mann sprechen, der vielleicht einige Antworten parat hatte, um bei der Bewältigung einer Krise zu helfen, die sich, wie sie fürchtete, zu einer ernsthaften Epidemie auswachsen könnte.
Sophia hatte in Zell- und Molekularbiologie promoviert und war ein wichtiges Rädchen in dem Uhrwerk, das durch den Tod von Major Keith Anderson weltweit in Bewegung gesetzt worden war. Seit vier Jahren arbeitete sie für das USAMRIID und wie jene Wissenschaftler aus dem Jahr 1989 kämpfte auch sie gegen eine medizinische Notfallsituation an, für die ein unbekannter Virus verantwortlich war. Schon jetzt waren sie und ihre Zeitgenossen in einer sehr viel prekäreren Lage – dieser Virus war tödlich. Er hatte drei Opfer gefordert, den Major und zwei Zivilisten. Augenscheinlich waren alle innerhalb weniger Stunden plötzlich an akutem Lungenversagen gestorben.
Aber nicht der Zeitpunkt der Todesfälle oder das akute Lungenversagen hatten beim USAMRIID Aufmerksamkeit erregt. Jedes Jahr starben überall auf der Welt Millionen an akutem Lungenversagen – aber weder junge noch gesunde Menschen oder solche, die zuvor keine Probleme mit pulmonaler Insuffizienz oder anderen dazu beitragenden Faktoren gehabt hatten. Und sie starben nicht mit heftigen Kopfschmerzen und blutgefüllten Brustkörben.
Jetzt waren an einem einzigen Tag drei Menschen mit identischen Symptomen gestorben, und zwar in verschiedenen Regionen des Landes: der Major in Kalifornien, das junge Mädchen in Georgia und der Obdachlose in Massachusetts.
Der Direktor des USAMRIID, Brigade General Calvin Kielburger, zögerte, wegen dreier Todesfälle, über die sie erst gestern informiert worden waren, weltweiten Alarm auszulösen. Er hasste es, für Aufruhr zu sorgen oder als ängstlicher Panikmacher dazustehen. Aber noch mehr war es ihm zuwider, den Lorbeer mit konkurrierenden Stufe-Vier-Laboratorien, besonders den Centers for Disease Control in Atlanta, teilen zu müssen.
Beim USAMRIID war die Spannung mittlerweile spürbar.
Sophia, die ein Team von Wissenschaftlern leitete, hatte am Samstagmorgen um drei Uhr die erste Blutprobe erhalten. Sofort war sie in ihr Stufe-Vier-Laboratorium gegangen, um mit den Tests zu beginnen. In dem kleinen Umkleideraum hatte sie ihre Kleidung, ihre Uhr und den Ring abgelegt, den Jon Smith ihr geschenkt hatte, nachdem sie seinen Heiratsantrag angenommen hatte. Nur einen Augenblick lang blickte sie lächelnd auf den Ring und dachte an Jon. Vor ihrem geistigen Auge sah sie sein Gesicht mit den fast an einen Indianer erinnernden hohen Wangenknochen, aber sehr dunkelblauen Augen. Diese Augen hatten sie von Anfang an fasziniert, und manchmal stellte sie sich vor, was für ein Vergnügen es wäre, sich in ihrer Tiefe zu verlieren. Sie liebte seine flüssigen Bewegungen, die an ein Tier aus dem Dschungel erinnerten, das nur aufgrund einer freien Entscheidung gezähmt worden war. Sie liebte sein Feuer und seine Erregung beim Sex. Aber am meisten liebte sie ganz einfach ihn – leidenschaftlich und unwiderruflich.
Weil sie schnell ins Labor musste, hatte sie ihr letztes Telefonat abgebrochen. »Ich muss weg, Darling. Auf der anderen Leitung hat mich jemand vom Labor angerufen. Es ist dringend.«
»Um diese Uhrzeit? Hat das nicht bis morgen Zeit? Du brauchst ein bisschen Ruhe.«
Sie lächelte. »Du hast mich angerufen. Ich war gerade dabei, mich auszuruhen, und habe sogar geschlafen, bis das Telefon geklingelt hat.«
»Ich habe gespürt, dass du mit mir reden willst. Du musst ununterbrochen an mich denken.«
Sie lachte. »Genau. Ich möchte zu jeder Tages- und Nachtzeit mit dir reden, und du fehlst mir in jedem einzelnen Augenblick, den du in London bist. Ich bin glücklich, dass du meinen gesunden Schlaf gestört hast und ich dir das sagen konnte.«
Jetzt lachte er. »Ich liebe dich auch, Darling.«
Im Umkleideraum des USAMRIID seufzte Sophia und schloss die Augen. Dann verdrängte sie Jon aus ihren Gedanken. Sie musste arbeiten – dies war ein Notfall.
Schnell zog sie sterile grüne Chirurgenkleidung an. Wegen des Unterdrucks, der keine infektionserregenden Substanzen aus den Hochsicherheitslaboratorien nach draußen dringen ließ, musste sie die Tür zum Bio-Safety-Bereich Level-Two barfuß aufstemmen. Sicherheitsstufe zwei, drei, dann vier. Als sie endlich angekommen war, ging sie durch eine Trockendusche in eine Art Badezimmer, wo saubere weiße Strümpfe aufbewahrt wurden.
Nachdem sie die Socken angezogen hatte, eilte sie in den Materialraum, streifte Chirurgenhandschuhe aus Latex über und befestigte sie mit Klebestreifen an den Ärmeln, um ihre Haut völlig zu schützen. Mit den Socken und den Hosenbeinen wiederholte sie die Prozedur. Danach zog sie ihren hellblauen Synthetikanzug für biologische Laboratorien an, der ein wenig wie das Innere eines Plastikeimers roch. Sorgfältig überprüfte sie den Stoff auf mögliche Löcher. Dann setzte sie den Plastikhelm auf und zog den Reißverschluss zwischen Helm und Anzug zu, der garantierte, dass sie völlig geschützt war.
Schließlich nahm sie einen gelben Luftschlauch von der Wand und steckte ihn in ihren Anzug. Mit einem leisen Zischen entwich die Luft in das weit geschnittene, an einen Astronautenanzug erinnernde Kleidungsstück. Nachdem sie den Schlauch wieder entfernt hatte, schleppte sie sich durch eine Stahltür in die Luftschleuse des Stufe-Vier-Labors, wo sich an beiden Seiten Hähne für Wasser und Chemikalien für die Dekontaminationsduschen befanden.
Schließlich drückte sie die Tür zum Stufe-Vier-Labor auf, der »Hot Zone«.
Jetzt ließ sie sich Zeit. Bei jedem Schritt durch die ausgeklügelten Sicherheitsvorrichtungen musste sie sehr vorsichtig sein. Ihre einzige Waffe waren effiziente Bewegungen, und je effizienter sie waren, desto schneller kam sie voran. Geschickt winkelte sie ihren Fuß an, ließ ihn in einen der schweren gelben Gummistiefel gleiten und wiederholte das Ganze mit dem anderen Fuß.
Endlich watschelte sie durch die engen Schlackensteinkorridore zu ihrem Labor. Dort streifte sie ein drittes Paar Latexhandschuhe über, nahm die Blut- und Gewebeproben vorsichtig aus dem Tiefkühlbehälter und machte sich daran, den Virus zu isolieren.
Während der nächsten vierundzwanzig Stunden dachte sie weder an Essen noch an Schlaf. Sie lebte im Labor, mit dem Virus, den sie durch ein Elektronenmikroskop untersuchte. Zu ihrer Überraschung konnten sie und die Mitglieder ihres Teams einen Ebola-, Marburg- oder sonstigen Filovirus ausschließen. Dieser hier hatte die bei den meisten Viren übliche runde und etwas ausgefranste Form eines Tennisballs. Da bei den drei Opfern akutes Lungenversagen die Todesursache gewesen war, dachte sie zuerst an einen Hantavirus, wie etwa denjenigen, dem 1993 die jungen Sportler im Navajo-Reservat zum Opfer gefallen waren. Bei der Erforschung von Hantaviren war das USAMRIID führend. Karl Johnson, einer der legendären Wissenschaftler des Instituts, hatte in den Siebzigerjahren den ersten Hantavirus entdeckt, isoliert und identifiziert.
Während sie daran dachte, hatte sie den unbekannten Krankheitserreger ohne Resultat mit tiefgefrorenen Proben aus der USAMRIID-Blutbank verglichen, die von Opfern verschiedener Hantaviren auf der ganzen Welt stammten. Irritiert versuchte sie, mittels einer Polymerase-Kettenreaktion einen Teil eines DNS-Strangs aus dem Virus zu extrahieren, der aber an keinen bekannten Hantavirus erinnerte. Dennoch legte sie für künftige Nachforschungen eine vorläufige Ausschlussliste an. Jetzt wünschte sie sich am sehnlichsten, dass Jon bei ihr wäre und nicht auf der WHO-Konferenz im fernen London.
Weil sie immer noch kein definitives Resultat hatte, verließ sie das Labor frustriert. Die Mitglieder ihres Teams hatte sie bereits schlafen geschickt, und jetzt wollte auch sie sich hinlegen. Nachdem sie ihren Raumanzug abgelegt und die Dekontaminationsprozeduren hinter sich gebracht hatte, zog sie wieder ihre normale Kleidung an.
Nach vier Stunden Schlaf – sie redete sich ein, dass ihr das genüge – eilte sie wieder ins Büro. Nachdem die anderen Teammitglieder erwacht waren, schickte sie sie ebenfalls wieder an die Arbeit.
Sie hatte Kopfschmerzen und ihre Kehle war ausgetrocknet. In ihrem Büro nahm sie eine Wasserflasche aus dem kleinen Eisschrank und setzte sich an ihren Schreibtisch. An der Wand hingen drei gerahmte Fotos. Sie trank und beugte sich vor, um die Bilder zu betrachten, die sie anzogen wie das Licht die Motten. Ein Bild zeigte Jon und sie in Badekleidung. Wie viel Spaß sie in ihrem einzigen gemeinsamen Urlaub auf Barbados im letzten Herbst gehabt hatten! Auf dem zweiten Foto, das am Tag von Jons Beförderung zum Lieutenant Colonel aufgenommen worden war, trug er Uniform. Auf dem letzten Bild war ein noch jüngerer Captain mit ungebändigtem schwarzem Haar, verschmiertem Gesicht und stechenden blauen Augen in einer staubigen Uniform vor dem Zelt eines mobilen Militärhospitals irgendwo in der irakischen Wüste zu sehen.
Weil sie ihn vermisste und ihn im Labor brauchte, griff sie nach dem Telefonhörer, um ihn in London anzurufen, legte dann aber wieder auf. Der General selbst hatte Jon in die britische Hauptstadt geschickt und bei ihm musste alles nach Plan laufen und jeder Auftrag erledigt werden. Keinen Tag zu spät, keinen zu früh. Jon würde erst in ein paar Stunden ankommen. Dann begriff sie, dass er wahrscheinlich ohnehin bereits im Flugzeug saß – und dass sie nicht in seinem Haus auf ihn warten konnte. Sie unterdrückte ihre Enttäuschung.
Sophia hatte ihr Leben der Wissenschaft gewidmet und war damit sehr glücklich. Nie im Leben hätte sie erwartet, dass sie eines Tages heiraten würde. Sie hatte geglaubt, sich zu verlieben – aber heiraten? Nein. Nur wenige Männer wünschten sich eine Frau, die von ihrer Arbeit besessen war, aber Jon verstand das. Tatsächlich genoss er es, dass sie in plastischen, farbigen Wörtern mit ihm über Zellen diskutieren konnte, und sie fand seine grenzenlose Neugier inspirierend. Sie glichen zwei Kindern, die bei einer Feier im Kindergarten den passenden Spielkameraden gefunden hatten, und passten nicht nur in beruflicher Hinsicht, sondern auch von ihrem Temperament her gut zusammen. Beide waren einsatzfreudig und mitfühlend, liebten das Leben und den anderen.
So ein Glück hatte sie nie gekannt und sie musste Jon dafür dankbar sein.
Mit einem ungeduldigen Kopfschütteln schaltete sie den Computer ein, um die Aufzeichnungen des Labors nach etwas zu durchsuchen, das ihr vielleicht entgangen war, aber sie fand nichts von Bedeutung.
Als weitere DNS-Daten eintrafen und sie alle klinischen Fakten überprüfte, die es bis jetzt über den Virus gab, befiel sie ein merkwürdiges Gefühl.
Irgendwo hatte sie diesen Virus – oder einen, der ihm unglaublich ähnlich war – schon einmal gesehen.
Sie zermarterte sich das Gehirn und durchsuchte ihr Gedächtnis, kam aber nicht darauf.
Schließlich las sie den Bericht eines der Mitglieder ihres Teams, in dem vermutet wurde, dass der neue Virus mit Machupo verwandt war, einer der ersten, wiederum von Karl Johnson entdeckten Fieberkrankheiten mit exzessiven inneren Blutungen.
Beim Gedanken an Afrika fiel ihr nichts ein. Aber Bolivien …?
Peru!
Die Anthropologieexkursion, als sie noch Studentin gewesen war, und …
Victor Tremont.
Ja, so hieß er. Der Biologe, der in Peru unterwegs gewesen war, um Pflanzen und Erdproben für die Entwicklung von Medikamenten zu sammeln. Für ein Pharmaunternehmen namens Blanchard Pharmaceuticals.
Nachdem sie sich wieder ihrem Computer zugewandt hatte, klinkte sie sich schnell ins Internet ein und suchte nach Blanchard Pharmaceuticals. Fast sofort wurde sie fündig – der Unternehmenssitz war in Long Lake im Staat New York. Victor Tremont war inzwischen Präsident und Chief Operating Officer des Unternehmens. Sie griff nach dem Telefon und wählte die Nummer.
Es war Sonntagmorgen, aber in großen Unternehmen waren die Telefone das ganze Wochenende für wichtige Anrufe besetzt. So auch bei Blanchard Pharmaceuticals. Eine menschliche Stimme antwortete, und als Sophia nach Victor Tremont fragte, bat man sie zu warten. Sie trommelte mit den Fingern auf die Schreibtischplatte und versuchte, ihre Ungeduld zu zähmen.
Nach einer Pause und einer Reihe von klickenden Geräuschen am anderen Ende der Leitung meldete sich eine andere Stimme, die neutral und tonlos klang. »Darf ich Sie nach Ihrem Namen fragen und erfahren, was Sie von Dr. Tremont wollen?«
»Ich heiße Sophia Russel. Sagen Sie ihm, dass wir uns auf einer Exkursion nach Peru kennen gelernt haben.«
»Bleiben Sie bitte dran.« Dann, nach einer erneuten Pause: »Ich stelle Sie jetzt zu Mr. Tremont durch.«
»Mrs. Russel …?« Offensichtlich dachte Tremont über den Namen nach, den man ihm vermutlich auf einem Notizblock aufgeschrieben hatte. »Was kann ich für Sie tun?« Seine Stimme war tief und angenehm, aber er sprach im Befehlston. Der Mann war augenscheinlich daran gewöhnt, Verantwortung zu tragen.
»Mittlerweile Dr. Russel«, entgegnete sie sanft. »Erinnern Sie sich nicht an meinen Namen, Dr. Tremont?«
»Kann ich nicht behaupten. Aber Sie erwähnten Peru – daran kann ich mich erinnern. Das ist zwölf oder dreizehn Jahre her, oder?« Er gab zu erkennen, warum er mit ihr sprach, gab aber nichts preis, weil sie ja eventuell nur einen Job suchte oder das Ganze irgendein Scherz war.
»Dreizehn Jahre, und ich erinnere mich deutlich an Sie.« Sie versuchte, den Plauderton beizubehalten. »Mich interessiert die Zeit auf dem Cairibo-Fluss. Ich war mit einer Gruppe von Anthropologiestudenten aus Syracuse auf einer Exkursion, während Sie potenziell nützliches medizinisches Material sammelten. Ich rufe Sie an, um Sie nach dem Virus zu fragen, den Sie bei den isoliert lebenden Eingeborenen entdeckt haben, die man ›Affenblut-Volk‹ nannte.«
In seinem großen Eckbüro wurde Victor Tremont von einer plötzlichen Angst erfasst, aber ebenso schnell unterdrückte er sie wieder. Er drehte sich mit seinem Schreibtischsessel herum und starrte auf den See hinaus, der im frühen Morgenlicht wie Quecksilber schimmerte. An seinem hinteren Ufer erstreckte sich ein dichter Kiefernwald bis zu den in der Ferne gelegenen Bergen.
Tremont war verärgert, weil sie ihn mit einer möglicherweise gefährlichen Erinnerung überrascht hatte. Er drehte sich weiter.
»Jetzt erinnere ich mich an Sie«, sagte er in freundlichem Tonfall. »Sie sind die eifrige, junge blonde Frau, die so von der Wissenschaft fasziniert war. Ich habe mich gefragt, ob Sie Anthropologin werden würden. Sind Sie es geworden?«
»Nein. Ich habe in Zell- und Molekularbiologie promoviert. Deshalb brauche ich Ihre Hilfe. Ich arbeite für das Medizinische Institut der Armee zur Erforschung von Infektionskrankheiten in Fort Detrick. Wir haben es mit einem Virus zu tun, der dem aus Peru sehr ähnlich zu sein scheint – mit einem unbekannten Virentyp, der Kopfschmerzen, Fieber und akutes Lungenversagen bei ansonsten gesunden Menschen auslösen und durch exzessive Blutungen der Lunge zum Tod führen kann. Läuten bei Ihnen die Alarmglocken, Dr. Tremont?«
»Nennen Sie mich Victor. Jetzt erinnere ich mich, glaube ich, an Ihren Vornamen. Susan oder Sally …?«
»Sophia.«
»Ja, natürlich. Sophia Russel. Fort Detrick.« Es klang, als ob er mitschreiben würde. »Ich bin glücklich, dass Sie der Wissenschaft erhalten geblieben sind. Manchmal wünschte ich, wieder im Labor arbeiten zu können und nicht im Chefsessel sitzen zu müssen. Aber das ist Schnee von gestern.« Er lachte.
»Erinnern Sie sich an den Virus?«
»Nein, kann ich nicht behaupten. Schon bald nach der Reise nach Peru habe ich mich dem Verkauf und dem Management zugewandt. Wahrscheinlich habe ich den Vorfall deshalb vergessen. Wie gesagt, es ist lange her. Aber nach meinen Erinnerungen an meine molekularbiologischen Forschungen scheint mir Ihr Szenario unwahrscheinlich zu sein. Sie müssen an eine Reihe unterschiedlicher Viren denken, von denen wir auf dieser Reise gehört haben. An solchen Nachrichten gab es keinen Mangel. Daran erinnere ich mich noch.«
Sophia presste frustriert den Hörer gegen ihr Ohr. »Nein, ich bin mir sicher, dass es ein Mittel gab, das wir durch die Arbeit mit dem ›Affenblut-Volk‹ kennen gelernt haben. Damals habe ich der Sache nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, Biologin zu werden, von der Zell- und Molekularbiologie ganz zu schweigen. Dennoch ist es mir in Erinnerung geblieben.«
»Das ›Affenblut-Volk‹? Seltsam. Ich bin sicher, dass ich mich an einen Stamm mit einem so außergewöhnlichen Namen erinnern könnte.«
»Hören Sie bitte zu, Dr. Tremont«, sagte Sophia in eindringlichem Tonfall. »Es ist sehr wichtig. Wir haben gerade im Zusammenhang mit drei Fällen von einem Virus gehört, der mich an den in Peru erinnert. Diese Eingeborenen verfügten über ein Heilmittel, das in fast achtzig Prozent aller Fälle wirkte: Sie tranken das Blut einer bestimmten Spezies von Affen. Ich erinnere mich, dass Sie deshalb erstaunt waren.«
»Das wäre ich immer noch.« Die Genauigkeit ihrer Erinnerung machte Tremont nervös. »Primitive Indios mit einem Heilmittel gegen einen tödlichen Virus? Davon weiß ich nichts«, log er. »Wenn es so war, wie Sie es beschreiben, bin ich mir sicher, dass ich mich erinnern würde. Was sagen denn Ihre Kollegen dazu? Einige von ihnen haben doch bestimmt auch in Peru gearbeitet.«
Sophia seufzte. »Ich wollte zuerst mit Ihnen reden. Fehlalarm gibt es bei uns häufig genug und auch für mich liegt Peru lange zurück. Aber wenn Sie sich nicht erinnern …« Ihre Stimme versagte. Sie war fürchterlich enttäuscht. »Ich bin sicher, dass ein solcher Virus existierte. Eventuell werde ich Kontakt nach Peru aufnehmen. Dort muss es Akten über ungewöhnliche Heilmittel der Indios geben.«
Victor Tremonts Stimme wurde etwas lauter. »Vielleicht wird das nicht notwendig sein. Ich habe noch ein Journal von der damaligen Reise. Es enthält Notizen über Pflanzen und möglicherweise neu zu entwickelnde Pharmazeutika. Vielleicht habe ich auch etwas über Ihren Virus niedergeschrieben. Ich werde nachsehen.«
Sofort ging Sophia auf seinen Vorschlag ein. »Das wäre sehr nett von Ihnen.«
Tremont lächelte. Jetzt hatte er sie. »Die Notizbücher sind irgendwo in meinem Haus, wahrscheinlich auf dem Dachboden oder im Keller. Ich rufe Sie morgen zurück.«
»Ich stehe in Ihrer Schuld, Victor. Vielleicht wird bald die ganze Welt in Ihrer Schuld stehen. Bitte denken Sie morgen sofort an mich. Sie haben keine Ahnung, wie wichtig es sein könnte.« Sie gab ihm ihre Telefonnummer.
»Ich glaube schon, dass ich das weiß«, versicherte Tremont dann. »Spätestens morgen früh werde ich es wissen.«
Nachdem er aufgelegt hatte, drehte er sich erneut in seinem Schreibtischsessel und blickte auf den jetzt heller strahlenden See und die hohen Berge, die plötzlich nah und unheildrohend aufzuragen schienen. Tremont stand auf und ging zum Fenster hinüber. Er war ein großer Mann mit mittelstarkem Körperbau und unverwechselbaren Gesichtszügen. Die Natur hatte es gut mit ihm gemeint. Der Jugendliche mit der übergroßen Nase, den unförmigen Ohren und hohlen Wangen hatte sich zu einem gut aussehenden Mann entwickelt. Mittlerweile war er Mitte Fünfzig und hatte voll ausgeprägte Gesichtszüge. Sie waren adlerartig, sympathisch und aristokratisch. Seine Nase hatte genau die richtige Größe – sie war gerade und stark und passte zu seinen sehr englischen Zügen. Mit seiner gebräunten Haut und dem dichten, stahlgrauen Haar zog er überall die Aufmerksamkeit auf sich. Aber er wusste, dass die Leute ihn nicht wegen seiner Würde und Attraktivität anziehend fanden, sondern wegen seines Selbstvertrauens. Er verströmte eine Aura der Macht und weniger selbstsichere Menschen fanden das faszinierend.
Im Gegensatz zu dem, was er Sophia Russel erzählt hatte, machte Victor Tremont keinerlei Anstalten, in sein abgelegenes Haus zurückzukehren. Stattdessen starrte er gedankenverloren auf die Berge und kämpfte gegen die Anspannung an. Er war wütend und verärgert.
Sophia Russel. Mein Gott, Sophia Russel!
Wer hätte das gedacht? Anfangs hatte er sich nicht einmal an ihren Namen erinnert. Tatsächlich konnte er sich an keinen Namen der Mitglieder dieser unbedeutenden Studentengruppe erinnern und er bezweifelte, dass seiner irgendjemandem von ihnen noch etwas sagte. Aber Sophia Russel hatte sich an ihn erinnert. Was für ein Gehirn behielt so ein Detail? Offensichtlich war ihr das Triviale zu wichtig. Angewidert schüttelte er den Kopf. In Wahrheit stellte sie kein Problem dar, sondern nur eine Belästigung. Dennoch musste man sich um sie kümmern. Nachdem er die Geheimschublade seines mit Schnitzereien verzierten Schreibtischs aufgezogen hatte, zog er ein Handy hervor und wählte.
»Ja?«, fragte eine emotionslose Stimme mit leichtem Akzent.
»Wir müssen uns treffen«, sagte Victor Tremont. Er beendete das Gespräch, legte das Handy wieder in die Schublade und griff nach seinem normalen Telefon. »Muriel? Verbinden Sie mich mit General Caspar in Washington.«
3
Montag, 13. Oktober, 9 Uhr 14Fort Detrick, Maryland
Als die Angestellten an diesem Montagmorgen im USAMRIID eintrafen, verbreitete sich auf dem Gelände der Forschungseinrichtung schnell die Nachricht, dass die Bemühungen des Wochenendes, die Gefahr zu bannen, die von dem Killervirus ausging, erfolglos geblieben waren. Die Presse hatte noch nicht Wind von der Story gekriegt und aus dem Büro des Direktors kam die Anordnung, den Medien gegenüber Stillschweigen zu bewahren. Niemand sollte mit einem Journalisten reden und nur die Mitarbeiter der Labors wurden über die quälende Suche auf dem Laufenden gehalten.
Unterdessen mussten die Routinetätigkeiten weiterhin erledigt werden. Formulare waren auszufüllen, Geräte zu warten, Anrufe zu beantworten. Im Vorzimmer des Sergeant Major saß Hideo Takeda an seinem durch Zwischenwände abgetrennten Arbeitsplatz und sortierte die Post. Er öffnete einen offiziell wirkenden Briefumschlag, auf dem das Logo des amerikanischen Verteidigungsministeriums prangte.
Nachdem er den Brief zweimal gelesen hatte, beugte er sich über die Trennwand, die seinen Arbeitsplatz von dem seiner Kollegin Sandra Quinn abgrenzte. »Ich werde nach Okinawa versetzt.«
»Sie machen Witze.«
»Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben.« Takeda grinste. Seine Freundin Miko war in Okinawa stationiert.
»Sagen Sie es der Chefin besser sofort«, warnte Sandra. »Das bedeutet, dass sie einer neuen Kraft beibringen muss, wie man mit den gottverdammten zerstreuten Professoren hier umgehen muss. Es wird sie ankotzen. Wegen des neuen Virus sind sie heute sowieso alle von der Rolle.«
»Sie soll mich doch mal am Arsch lecken«, meinte Takeda gut gelaunt.
»Nicht in meinem schlimmsten Alptraum.« Sergeant Major Helen Daugherty stand in der Tür ihres Büros. »Würden Sie bitte eintreten, Mister Takeda?«, fragte sie übertrieben höflich. »Oder soll ich Sie lieber gleich k. o. schlagen?«
Daugherty war eine imposante, über einen Meter achtzig große blonde Frau, deren weibliche Rundungen den Männern ein bewunderndes Pfeifen entlockten. Mit dem Lächeln eines Piranhas blickte sie auf den einen halben Kopf kleineren Takeda herab. Der gehorchte und eilte mit einem nervösen, ängstlichen Gesichtsausdruck, der nicht gänzlich gespielt war, in das Büro seiner Vorgesetzten. Bei Helen Daugherty, die sich wie jeder gute männliche Sergeant Major verhielt, wusste man nie genau, ob man sich in Sicherheit wiegen konnte.
»Schließen Sie die Tür und setzen Sie sich.«
Takeda befolgte ihre Anweisungen.
Helen Daugherty fixierte ihn mit einem stechenden Blick. »Wie lange wissen Sie schon von einer möglichen Versetzung, Hideo?«
»Die Nachricht kam heute Morgen aus heiterem Himmel. Ich habe den Brief gerade geöffnet.«
»Und wir haben die Versetzung für Sie beantragt … War das nicht vor fast zwei Jahren?«
»Vor zweieinhalb Jahren, gleich nach meiner Rückkehr aus Okinawa. Wenn Sie mich noch eine Weile hier brauchen, Sergeant Major …«
Helen Daugherty schüttelte den Kopf. »Selbst wenn ich es wollte, es sieht nicht so aus, als ob das möglich wäre.« Mit einem Finger tippte sie auf ein Schriftstück auf ihrem Schreibtisch. »Diese E-Mail habe ich ungefähr zur selben Zeit erhalten, als Sie den Brief geöffnet haben. Es sieht so aus, als ob Ihre Nachfolgerin bereits hierher unterwegs ist. Sie kommt aus der Führungsetage des Militärischen Nachrichtendiensts im Kosovo. Darunter tun sie es nicht.« Helen Daughertys Gesichtsausdruck war nachdenklich. »Sie muss bereits im Flugzeug gesessen haben, bevor der Brief bei Ihnen landete.«
»Wollen Sie damit sagen, dass sie bereits heute kommen wird?«
Helen Daugherty blickte auf die Uhr auf ihrem Schreibtisch. »In zwei Stunden, um genau zu sein.«
»Meine Güte, das geht ja schnell.«
»Allerdings«, stimmte sie zu. »Für Sie gibt es genaue Anordnungen. Sie haben einen Tag, um Ihren Arbeitsplatz aufzuräumen. Morgen früh sitzen Sie im Flugzeug.«
»Einen Tag?«
»Machen Sie sich besser an die Arbeit. Und viel Glück, Hideo. Ich habe gern mit Ihnen zusammengearbeitet und werde eine positive Beurteilung für Ihre Akte schreiben.«
»Jawohl, Sergeant Major. Vielen Dank.«
Immer noch etwas verwirrt verließ Takeda das Büro seiner Vorgesetzten, die weiter über die ihr zugegangene Nachricht nachdachte. Sie rollte einen Stift zwischen den Händen hin und her und starrte geistesabwesend ins Leere, während Takeda begeistert seinen Schreibtisch ausräumte und dabei einen Triumphschrei unterdrückte. Er hatte es satt, nicht bei Miko sein zu können. Vor allem aber war er es leid, in diesem USAMRIID-Hexenkessel leben zu müssen. Er hatte hier jede Menge Krisensituationen miterlebt, aber diese beunruhigte, ja verängstigte alle mehr als jede andere zuvor. Er war froh, von hier wegzukommen.
Drei Stunden später salutierte Takedas Nachfolgerin Adele Schweik vor dem Schreibtisch von Sergeant Major Helen Daugherty. Schweik war eine kleine Frau mit dunkelbraunem, fast schwarzem Haar, einer steifen Körperhaltung und wachen grauen Augen. Ihre Uniform war makellos und sie trug zwei Reihen von Ordensbändern, die bewiesen, dass sie in vielen Ländern und bei vielen militärischen Einsätzen in Übersee gedient hatte. Sogar in Bosnien hatte sie einen Orden erhalten.
»Rühren.«
Schweik gehorchte. »Danke, Sergeant Major.«
Helen Daugherty las ihre Papiere und sprach, ohne aufzusehen. »Das ging ja ziemlich schnell, was?«
»Vor ein paar Monaten habe ich darum gebeten, aus persönlichen Gründen in die Nähe von Washington versetzt zu werden. Mein Colonel hat mir erzählt, dass in Fort Detrick plötzlich eine Stelle frei geworden ist. Da habe ich die Gelegenheit beim Schopf ergriffen.«
Helen Daugherty blickte zu ihr auf. »Sind Sie nicht ein bisschen überqualifiziert? Dies ist ein Job in der Provinz, bei einer kleinen Kommandobehörde, wo nicht viel zu tun ist. In Übersee werden wir nie aktiv.«
»Ich weiß nur, dass es Detrick ist. Über Ihre Einheit ist mir nichts bekannt.«
»Wie bitte?« Helen Daugherty hob eine ihrer blonden Augenbrauen. Irgendwie war diese Miss Schweik zu kühl und beherrscht. »Sie befinden sich im USAMRIID, dem Medizinischen Institut der Armee zur Erforschung von Infektionskrankheiten. Hier geht’s um wissenschaftliche Forschung. Alle unsere Offiziere sind Ärzte, Veterinärmediziner oder medizinische Spezialisten. Bei uns arbeiten sogar Zivilisten. Keine Waffen, keine Manöver, kein Ruhm.«
»Hört sich friedlich an, Sergeant Major«, entgegnete Schweik lächelnd. »Eine nette Luftveränderung nach dem Einsatz im Kosovo. Nebenbei – ich habe gehört, dass das USAMRIID an vorderster Front gegen ziemlich tödliche Krankheiten kämpft. Hört sich aufregend an.«
Helen Daugherty neigte den Kopf. »Das ist Sache der Ärzte. Bei uns geht’s nur um Bürokram. Wir sind für die Organisation zuständig. Am Wochenende hat es eine Art Notfall gegeben. Stellen Sie keine Fragen, das geht Sie nichts an. Sollte Sie irgendein Journalist ansprechen, verweisen Sie ihn an die Pressestelle. Das ist ein Befehl. Ihr Arbeitsplatz ist neben dem von Miss Quinn. Richten Sie sich ein bisschen ein, dann wird sie Sie einarbeiten.«
Schweik salutierte. »Danke, Sergeant Major.«
Erneut drehte Helen Daugherty den Stift zwischen ihren Händen und starrte auf die Tür, die sich gerade hinter ihrer neuen Untergebenen geschlossen hatte. Dann seufzte sie. Sie hatte nicht ganz die Wahrheit gesagt. Wenngleich jede Menge Routinearbeit anfiel, gab es doch auch Augenblicke wie diesen, in denen man nichts mehr verstand. Sie zuckte mit den Achseln. Nun, sie hatte schon seltsamere Dinge miterlebt als einen plötzlichen Personalwechsel, mit dem beide Seiten glücklich waren. Nachdem sie Quinn angerufen und um eine Tasse Kaffee gebeten hatte, verdrängte sie die Viruskrise und die seltsame Versetzung aus ihren Gedanken.
Um kurz nach halb sechs verschloss Helen Daugherty ihre Tür und wollte das leere Büro verlassen. Aber das Büro war nicht leer.
»Ich würde gern noch bleiben und so viel wie möglich über meine neue Arbeit lernen«, sagte Adele Schweik. »Hoffentlich ist Ihnen das recht.«
»Okay. Ich werde dem Sicherheitsdienst Bescheid sagen. Haben Sie einen Büroschlüssel? Schließen Sie ab, wenn Sie gehen. Sie werden nicht allein im Gebäude sein. Der neu entdeckte Virus treibt die Ärzte zum Wahnsinn. Wahrscheinlich werden einige von ihnen die ganze Nacht über auf dem Gelände bleiben. Wenn das noch länger so weitergeht, werden sie stinkig werden. Sie mögen keine Rätsel, durch die Menschen ums Leben kommen.«
»Das habe ich schon gehört.« Die kleine Frau nickte lächelnd. »Sehen Sie, in Fort Detrick ist doch jede Menge los.«
»Ich muss mich korrigieren«, sagte Helen Daugherty lachend, bevor sie das Büro verließ.
An ihrem Schreibtisch in dem stillen Büro las Schweik Memoranden und machte sich Notizen. Als sie sich nach einer halben Stunde sicher war, dass weder Helen Daugherty zurückkehren noch die Leute vom Sicherheitsdienst auftauchen würden, um sie zu überprüfen, öffnete sie den Diplomatenkoffer, den sie während ihrer ersten Kaffeepause ins Büro gebracht hatte. Als sie am Morgen auf dem Flugplatz der Andrews Air Force Base gelandet war, hatte er in dem für sie bereitstehenden Wagen gelegen.
Aus dem Koffer zog sie ein schematisches Diagramm der Telefoninstallationen im USAMRIID-Gebäude hervor. Der Kasten mit den Anschlüssen für alle internen Nebenstellen und persönlichen Leitungen nach draußen befand sich im Keller. Sie studierte das Diagramm lange genug, um sich zu merken, wo er sich befand. Dann legte sie den Plan in den Koffer zurück, verschloss ihn und trat damit in den Korridor.
Mit einem unschuldig-neugierigen Gesichtsausdruck blickte sie sich vorsichtig um.
Der Wachposten am Haupteingang las. An ihm musste sie vorbei. Nachdem sie tief durchgeatmet hatte, schlich sie leise durch den Korridor zur Kellertür.
Dort wartete sie. Der Wachposten bewegte sich nicht. Obwohl für das Gebäude die höchste Sicherheitsstufe angeordnet war, war der Schutz weniger dafür bestimmt, Leute am Eindringen zu hindern, als vielmehr dafür, die Öffentlichkeit vor dem Ausströmen tödlicher Giftstoffe, Viren, Bakterien und anderer gefährlicher wissenschaftlicher Materialien zu bewahren, die im USAMRIID analysiert wurden. Zwar war der Wachposten gut ausgebildet, aber er ließ die Aggressivität seiner Kollegen vermissen, die ein Labor bewachten, wo geheime Kriegswaffen hergestellt wurden.
Erleichtert stellte sie fest, dass der Wachposten weiterhin in sein Buch vertieft war. Sie versuchte, die schwere Stahltür zu öffnen, doch sie war verschlossen. Aus dem Diplomatenkoffer zog sie einen Schlüsselbund hervor. Der dritte Schlüssel passte. Geräuschlos schritt sie die Kellertreppe hinab und schlängelte sich unten zwischen riesigen Maschinen hindurch, die das Gebäude heizten oder kühlten, keimfreie Luft und Unterdruck für die Labors lieferten, das Lüftungs- und Abgassystem funktionsfähig hielten, für Wasser und chemische Lösungen für die Duschen sorgten und für alle anderen Wartungsarbeiten in dem medizinischen Institut zuständig waren.
Als sie den Kasten mit den Telefonanschlüssen gefunden hatte, war sie bereits ins Schwitzen geraten. Nachdem sie den Diplomatenkoffer auf den Boden gelegt hatte, nahm sie einen kleineren Werkzeugkoffer mit Drähten, bunten Kabeln, Messgeräten, Schalteinheiten, Abhöreinrichtungen und winzigen Aufnahmegeräten heraus.
Wenn man von dem gelegentlichen Klicken, Gurgeln und Summen in den Rohrleitungen und Schächten absah, war es im Keller des Gebäudes ruhig. Dennoch lauschte sie eine Weile, um sicher zu sein, dass niemand in der Nähe war. Ihre Nervosität ließ sie frösteln. Aufmerksam beobachtete sie den grauen Raum. Als sie den Kasten mit den Telefonanschlüssen schließlich geöffnet hatte, begann sie, sich an den Leitungen zu schaffen zu machen.
Zwei Stunden später war Schweik wieder in ihrem Büro, wo sie ihr Telefon überprüfte, einen Minikopfhörer anschloss und einen Schalter auf der versteckten Kontrolleinheit in ihrer Schreibtischschublade bediente. Dann lauschte sie: »Ja, es tut mir Leid, aber ich werde mindestens noch zwei Stunden hier bleiben müssen. Sorry, Darling, es lässt sich nicht ändern. Dieser Virus ist ein harter Brocken. Das ganze Team arbeitet an der Sache. Okay, ich werde versuchen, zu Hause zu sein, bevor die Kinder ins Bett gehen.«
Befriedigt darüber, dass ihr Abhörsystem funktionierte, schaltete sie es aus. Dann wählte sie eine Nummer. »Ja?«, fragte eine männliche Stimme, die während der letzten Nacht Kontakt zu ihr aufgenommen und Anweisungen gegeben hatte.
»Die Installation ist abgeschlossen«, berichtete sie. »Ich bin mit der Telefonzentrale verbunden, bekomme ein Zeichen, wenn in einem der für Sie interessanten Büros telefoniert wird, und kann dann mithören.«
»Man hat Sie nicht beobachtet und verdächtigt Sie nicht?«
Sie war stolz auf ihr gutes Gehör für Stimmen und ihre Sprachkenntnisse. Dies war die Stimme eines gebildeten Menschen – er beherrschte die englische Sprache gut, aber nicht perfekt. Das Sprachmuster war nicht englischer Provenienz, sondern hatte einen minimalen Akzent, der auf den Nahen Osten schließen ließ. Nicht auf Israel, den Iran oder die Türkei, aber möglicherweise auf Syrien oder den Libanon. Wahrscheinlicher waren aber Jordanien oder der Irak.
Sie prägte sich diese Entdeckung für die Zukunft ein.
»Natürlich nicht«, antwortete Schweik.
»Gut. Achten Sie auf alle Entwicklungen, die den unbekannten Virus betreffen. Hören Sie unbedingt alle Telefonate von Dr. Russel, Lieutenant Colonel Smith und General Kielburger ab.«
Dieser Job durfte nicht allzu lange dauern, oder er würde zu riskant werden. Obwohl man die Leiche der echten Adele Schweik wahrscheinlich nie finden würde. Diese hatte offenbar keine Angehörigen und nur wenige Freunde außerhalb der Armee gehabt. Deshalb hatte man sich ja für sie entschieden.
Aber Schweik hatte den Eindruck, dass Sergeant Major Helen Daugherty misstrauisch und durch ihre Ankunft etwas irritiert war. Wenn man sie zu genau im Auge behielt, konnte alles auffliegen.
»Wie lange werde ich hier bleiben?«
»Bis wir Sie nicht mehr brauchen. Erregen Sie auf keinen Fall irgendwie Aufmerksamkeit.«
Das Freizeichen summte in ihrem Ohr. Sie legte auf, beugte sich vor und fuhr fort, sich mit der Büroarbeit vertraut zu machen. Zugleich hörte sie ein- und ausgehende Telefonate ab und achtete auf das Licht auf ihrem Telefon, das sie über Gespräche von Dr. Sophia Russel informieren sollte. Einen Augenblick lang überlegte sie neugierig, warum diese Frau so wichtig war. Dann verdrängte sie diesen Gedanken. Manches wusste man besser nicht.
4
MitternachtWashington, D. C.
Washingtons herrlicher Rock-Creek-Park ist ein keilförmiges Stück Wildnis im Herzen der Stadt. Vom Potomac in der Nähe des Kennedy Center verbreitert sich der enge Streifen zu großen Wäldern im oberen Nordwesten der Stadt. In dem natürlichen Wald gibt es viele Wander-, Rad- und Reitwege, daneben Picknickplätze und historische Sehenswürdigkeiten. Pierce Mill, an der Kreuzung von Tildon Street und Beach Drive gelegen, war einer dieser historisch bedeutsamen Orte. Die alte Mühle stammte aus der Zeit vor dem Amerikanischen Bürgerkrieg, als eine Reihe solcher Getreidemühlen am Ufer des Bachs gestanden hatten. Jetzt war sie ein vom National Park Service geführtes Museum, ein vom Mondlicht erleuchtetes Relikt jener längst vergangenen Zeit.
Nordwestlich der Mühle, im dichten Unterholz in der Dunkelheit des Waldes, wartete Bill Griffin, der einen hochgradig wachsamen Dobermann an der Leine hielt. Obwohl es kalt war, schwitzte Griffin. Aufmerksam beobachtete er die Mühle und die Picknickplätze. Als der schlanke Hund Witterung aufnahm, drehten sich seine aufgerichteten Ohren.
Von rechts, aus der Richtung der Mühle, näherte sich jemand. Schon lange vor Griffin hatte der Hund die schwachen Geräusche knisternden Herbstlaubs gehört. Als Griffin die Schritte vernahm, befreite er den Hund von der Leine. Der Dobermann blieb gehorsam sitzen, aber seine angespannten Muskeln zitterten.
Schweigend gab Griffin dem Hund ein Handzeichen.
Wie ein schwarzes Phantom schoss der Dobermann in die Nacht und umrundete in einem großen Kreis den Picknickplatz. In dem unheildrohenden Dunkel zwischen den Bäumen war das Tier nicht zu sehen.
Griffin sehnte sich verzweifelt nach einer Zigarette. Jeder einzelne seiner Nerven war bis zum Zerreißen gespannt. Hinter ihm lief irgendein wildes Tier raschelnd durch das Unterholz. In einem Baum schrie eine Nachteule. Doch Griffin nahm weder die Geräusche noch die Anspannung seiner Nerven wahr. Er war ein bestens ausgebildeter Vollprofi und deshalb blieb er wachsam und rührte sich nicht. Weil er sich in der kalten Luft nicht durch weißen Hauch vor dem Mund verraten wollte, atmete er behutsam. Obwohl er sein Temperament unter Kontrolle hielt, war er zornig und beunruhigt.
Als er Lieutenant Colonel Jonathan Smith im Mondlicht über die freie Fläche auf sich zukommen sah, rührte sich Griffin immer noch nicht. Auf der anderen Seite des Picknickplatzes legte sich der Dobermann nieder, wie Griffin wusste, obwohl das Tier nicht zu sehen war.
Jon Smith, der auf dem Pfad herankam, zögerte. »Bill?«, flüsterte er heiser.
In der Dunkelheit zwischen den Bäumen konzentrierte sich Bill Griffin auf seine Wahrnehmung. Er lauschte auf den Verkehr der nahen Straße und die Geräusche der nächtlichen Stadt. Ihm fiel nichts Ungewöhnliches auf. In diesem Teil des riesigen Naturparks hielt sich niemand auf. Er wartete auf eine Reaktion des Hundes, aber der Dobermann blieb, wo er war, und gab keinen Laut von sich.
Griffin seufzte und ging zum Rand des Picknickplatzes, wo das Mondlicht und die Dunkelheit zusammentrafen. »Hierher, Smithy«, sagte er mit tiefer und eindringlicher Stimme.
Nervös wandte sich Jon Smith um. Er sah nur eine vage Silhouette im Mondlicht. Als er darauf zuging, fühlte er sich ungeschützt und verletzbar. »Bist du das, Bill?«, knurrte er.
»Der unerwünschte Freund«, erwiderte Griffin leichthin und zog sich wieder in die Finsternis zurück.
Smith trat zu ihm und blinzelte, damit sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnten. Schließlich sah er, dass ihn sein alter Freund anlächelte. Obwohl er zehn Pfund abgenommen zu haben schien, hatte er noch immer dasselbe runde Gesicht und dieselben sanften Gesichtszüge. Aber seine Wangen waren weniger dick und die Schultern wirkten breiter, weil sein Bauch und seine Taille schlanker waren. Sein braunes, halblang geschnittenes Haar hing ungepflegt herab. Er war fünf Zentimeter kleiner als der über einen Meter achtzig große Smith und kräftig.
Smith hatte es schon erlebt, dass Bill Griffin sich benahm wie ein unauffälliger und gewöhnlicher Mann, der gerade von seiner Arbeit in einer Computerfabrik zurückkam oder auf dem Weg ins nächste Café war. Sein Erscheinungsbild kam ihm beim militärischen Geheimdienst und bei verdeckten Operationen des FBI zugute, da sich hinter diesem unscheinbaren Äußeren ein scharfer Verstand und ein eiserner Wille verbargen.
Für seinen alten Freund Smith war Griffin immer so etwas wie ein Chamäleon gewesen, aber in dieser Nacht war alles anders. Jetzt blickte er ihn an – und sah den Footballstar aus Iowa und einen Mann, der eine eigene Meinung hatte. Er hatte sich zu einem aufrichtigen, bescheidenen und zugleich wagemutigen Kerl entwickelt – dies war der wahre Bill Griffin.