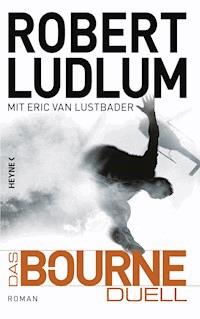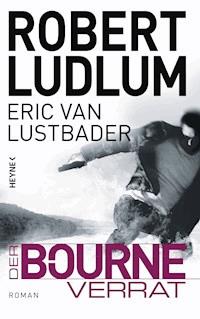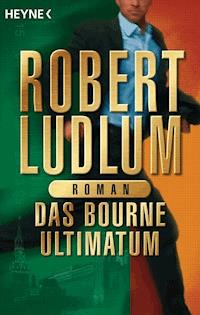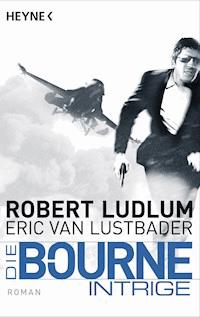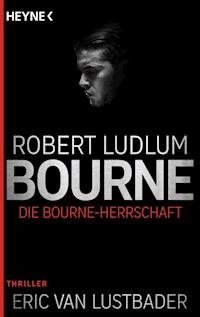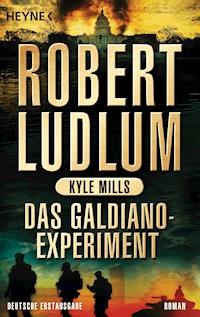
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: COVERT ONE
- Sprache: Deutsch
Das Team von Covert One verteidigt Amerika gegen einen technologisch überlegenen Feind
Die neue Erfindung des genialen Wissenschaftlers Christian Dresner schlägt ein wie eine Bombe. Der Merge ist ein hochleistungsfähiger Mini-Computer, gegen den selbst die modernsten Smartphones und Tablet-PCs wie Kinderspielzeug wirken. Lieutenant Jon Smith von der Spezialeinheit Cover One erkennt das verheerende militärische Potenzial des Geräts. Für ihn steht fest: Der Merge darf auf keinen Fall in die falschen Hände geraten! Doch die Hinweise verdichten sich, dass seine Warnung bereits zu spät kommt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 607
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Buch
Christian Dresner, der Gründer des Technikunternehmens Dresner Industries, stellt seine neueste Erfindung vor: Der Merge ist ein überlegener Mini-Computer, der das Smartphone ablösen soll. Lieutenant Colonel Jon Smith von der Spezialeinheit Covert One erhält den Auftrag, eine erweiterte Version des Geräts auf sein militärisches Potenzial hin zu prüfen.
Zur gleichen Zeit entdeckt CIA-Agentin Randi Russell ein Dorf in Afghanistan, dessen komplette Bevölkerung ausgelöscht wurde – allem Anschein nach ohne jede Gegenwehr. Sämtliche Toten sind mit einer Version des Merge ausgerüstet. Smith und Russell versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Doch schon bald funkt ihnen jemand dazwischen. Jemand, der offensichtlich über Kontakte zu den höchsten Militärkreisen verfügt. Jemand, von dem nicht einmal der Präsident etwas weiß …
Die Autoren
Robert Ludlum erreichte mit seinen Romanen, die in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurden, weltweit eine Auflage von über 280 Millionen Exemplaren. Er verstarb im März 2001. Die Romane aus seinem Nachlass erscheinen bei Heyne. Ein ausführliches Werkverzeichnis finden Sie am Ende des Buchs.
Kyle Mills, Jahrgang 1966, steht mit seinen Romanen in den USA regelmäßig auf den Bestsellerlisten und gilt neben Tom Clancy, Frederick Forsyth oder David Baldacci als Erneuerer des intelligenten Politthrillers. Mills lebt in Jacksonville, Wyoming.
ROBERT LUDLUM
KYLE MILLS
DAS GALDIANO-EXPERIMENT
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Norbert Jakober
Wilhelm Heyne Verlag
München
Die Originalausgabe The Utopia Experiment erschien 2013 bei Grand Central Publishing, New York
Vollständige deutsche Erstausgabe 12/2014
Copyright © 2013 by Myn Pyn, LLC
Copyright © 2014 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Alexandra Klepper
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,
unter Verwendung eines Motivs von © Shutterstock
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN: 978-3-641-14450
www.heyne.de
Prolog
Erfurt, DDR
Dezember 1972
»Wir sind spät dran. Für das Wetter kann ich nichts.«
Christian Dresner nickte und starrte durch die verschmierte Windschutzscheibe des Trabants. Überall hingen dicke Eiszapfen. Die schmale Straße war von heruntergekommenen Häusern gesäumt, und das Kopfsteinpflaster glänzte im Licht der Autoscheinwerfer.
»Wir sollten gleich zum Treffpunkt fahren«, schlug der Fahrer nervös vor. »Es ist fast Mitternacht.«
»Sie haben unser Geld genommen«, erwiderte Dresner. »Wir machen es so, wie wir es vereinbart haben.«
Der Mann beugte sich missmutig über das schmierige Lenkrad und stieg aufs Gas, um ein paar Stundenkilometer mehr aus dem Wagen zu kitzeln, ohne ins Schleudern zu geraten.
Ein leises Rascheln kam vom Rücksitz, dann eine Stimme, die im Dröhnen des schwachbrüstigen Motors kaum zu hören war. »Christian?«
Dresner drehte sich zu dem dünnen Mann um, der eine Aktentasche an die Brust gedrückt hielt. Mit seinen sechsundzwanzig Jahren war Gerhard Eichmann zwei Jahre älter als Dresner, wirkte jedoch mit seiner schmächtigen Statur und seinem vorsichtigen Auftreten nicht wirklich erwachsen. Das Äußere trog jedoch: Er war ein brillanter Psychologe und damit sehr wertvoll für Ostblockpolitiker, denen es um die totale Kontrolle über das Leben der Menschen ging. Eichmann war davon abgesehen auch ein echter Freund – ein seltenes Gut in einer Welt der ehrgeizigen Apparatschiks, Geheimpolizisten und Spitzel. Der schmächtige Mann war vielleicht der einzige Freund, den er je haben würde. Doch das war nicht schlimm. Einer wie er genügte. Es war mehr, als den meisten vergönnt war.
»Keine Sorge, Gerd. Bald werden wir in einem warmen Bett im Westen aufwachen. Wir können endlich tun, was wir wollen, das verspreche ich dir.«
Eichmann lächelte schwach und drückte die Aktentasche noch fester an sich. Es war das Einzige, was sie mitnahmen, das einzig Wertvolle, das sie besaßen. Die Tasche enthielt Material über Forschungsarbeiten in einer abgelegenen Anlage, in der sie die letzten vier Jahre quasi eingesperrt gewesen waren. Damit würden sie sich den Start in ihr neues Leben erkaufen.
Der Wagen wurde langsamer, und Dresner blickte wieder nach vorn, als sie eine gewundene Straße hochfuhren. Der kleine Hügel erwies sich bald als zu steil für die abgefahrenen Reifen.
Dresner stieg aus, noch bevor der Wagen zum Stehen gekommen war, und marschierte los, während der Schnee Eichmanns ängstliche Zurufe schluckte.
Als er die Hügelkuppe erreichte, erkannte er das Haus mit seiner schäbigen Fassade und dem Turm, der sich wie alles andere unter der Last des Schnees zu beugen schien.
Das schwache Licht im oberen Fenster sah genauso aus wie an dem Tag, als sie ihn von hier weggeholt hatten. Er wandte sich ab, als könnte ihn der bloße Anblick in die Vergangenheit zurückwerfen, in die Angst und Verzweiflung seiner Kindheit.
Das Tor, an das er sich erinnerte, war nicht mehr da, und sein Atem wurde flacher, als er die Stelle überschritt, an der es sich befunden hatte. Die Schaukel stand noch im gefrorenen Schlamm des Hofes, dazu eine in der Mitte gebrochene Wippe und einige Kletterstangen. In seiner Kindheit war die Farbe noch nicht abgeblättert gewesen; damals war alles noch bunt bemalt – ein Überbleibsel aus der Zeit vor dem Krieg. Vor den Sowjets. An den seltenen klaren Nachmittagen hatte er sich an den fröhlichen Farben erfreut und versucht, sich in eine Zeit zurückzuversetzen, als hier noch Kinder mit einem Zuhause und einer Familie gespielt und gelacht hatten.
Jetzt war sogar die Farbe verschwunden, vom Rost gefressen oder vom Ruß der Kohleöfen geschwärzt.
Er zog sich den Mantel enger um den Hals und schritt über den stillen Hof, blieb vor der Haustür stehen und klopfte mit der Faust dagegen. Nichts rührte sich. Also packte er die Schaufel, die am Geländer lehnte, und hämmerte mit dem Stiel gegen die massive Holztür. Seine Atemwölkchen vernebelten ihm die Sicht, während er auf die Haustür einschlug. Seine ganze unterdrückte Wut und Hilflosigkeit brachen hervor.
Ein Licht ging im Haus an, und er trat zurück und hielt die Schaufel in der zitternden Hand.
Doch als sich die Tür öffnete, stand nicht der Mann vor ihm, dessentwegen er gekommen war. Es war die Frau, die ihn vor über fünfzehn Jahren weggebracht hatte. Ihre biedere Frisur und Kleidung waren unverändert, doch die Haut unter dem Kinn war schlaff geworden, und sie schien nicht mehr gut zu sehen.
»Hallo, Marta.«
Nun erkannte sie ihn, und zu seinem Erstaunen blitzte sofort Angst in ihrem Gesicht auf. Damit hatte er nicht gerechnet. Dresner wollte ihr keine Angst machen und schämte sich augenblicklich. Sie war keine böse Frau gewesen. Nur schwach und abgestumpft.
Er stürmte an ihr vorbei, und die Kälte wich nicht, als er an der breiten Treppe vorbeikam, die in den ersten Stock führte. Dort oben hielten sich die Kinder in den dunklen Winkeln ihres Gefängnisses verborgen, so wie er selbst es immer getan hatte, wenn ein unerwarteter Besucher kam. Mit angehaltenem Atem warteten sie ab und sagten sich, dass es diesmal bestimmt ihr Vater, ihre Mutter oder ein anderer Verwandter sei. Jemand, der sie von hier wegholen würde.
Er tauchte in die Dunkelheit ein, wich den Möbelstücken aus, an die er sich noch erinnern konnte, und stieg leise die Wendeltreppe zum Turm hinauf. Die Tür ganz oben war von grauem Licht umrahmt, das durch einen schmalen Spalt herausdrang. Er stand einige Augenblicke davor und versuchte, sich nicht von der Erinnerung überwältigen zu lassen.
»Was willst du?«, hörte er eine Stimme von der anderen Seite. »Verschwinde, sonst …!«
Doch Dresner packte den Türgriff und trat ein. Augenblicklich spürte er die Wärme des Kerosinofens, von dem sie alle gewusst und geträumt hatten. Er wandte sich nicht sofort dem massigen, halb bekleideten Mann auf dem Sofa zu, sondern sah sich zuerst im Zimmer um, das vom Leuchten eines kleinen Schwarz-Weiß-Fernsehers erhellt wurde. Er war so wie die anderen nie hier drin gewesen, doch in ihrer Fantasie hatten sie sich den Raum voller Gold, Juwelen und Süßigkeiten vorgestellt. In Wahrheit war er auch nur ein schäbiger Überrest eines Deutschlands, das nicht mehr existierte.
Schließlich fiel Dresners Blick auf den Stock in der Ecke, der an manchen Stellen noch schwarz war, während an anderen das blanke Holz durchkam. Er fragte sich, wie stark sein eigener Rücken dazu beigetragen hatte, dass das Holz seine Farbe verloren hatte. Und ob die Spitze damals abgebrochen war, als das achtjährige Mädchen im Bett gestorben war – an den Prügeln, die sie bezogen hatte, weil sie eine alte, ohnehin schon kaputte Lampe umgeworfen hatte.
»Wer …« Der Mann erhob sich mit der gleichen Wut wie früher, wenn auch nicht so schnell und energisch. Im Gegensatz zu Marta erkannte er ihn nicht sofort.
Was verständlich war. Dresners Augen – etwas vergrößert von den dicken Brillengläsern – waren das Einzige an ihm, das sich nicht verändert hatte. Die anderen Wissenschaftler in der Anlage hatten nicht verstanden, warum er das Programm der Athleten, die sie trainierten, teilweise mitmachte. Er hatte ihnen erklärt, er tue es aus wissenschaftlichen Gründen, doch das war gelogen. In Wahrheit hatte er es für diesen Moment getan. Er hatte aus seinem schwächlichen, halb verhungerten Körper ein Werkzeug geformt, das für diesen Zweck geeigneter war.
»Christian?«, fragte der Mann schließlich, und seine Augen öffneten sich so weit, wie es der Wodka zuließ, den er, nach der halb leeren Flasche auf dem Tisch zu schließen, bereits getrunken hatte.
Dresner nickte schweigend. Er hatte sich so viele Jahre auf diesen Tag vorbereitet und wusste dennoch nicht, was er sagen sollte.
»Du bist stark geworden.« Der Mann klopfte sich auf die Brust. »Das verdankst du mir. Ich habe dich stark gemacht.«
Zum ersten Mal blitzte Angst in seinen Augen auf. Er hatte allen Grund dazu. Er war nur noch ein abgehalfterter Soldat, der sich in einem abgelegenen Kinderheim zu Tode soff. Dresner hingegen war von der Partei gefördert worden. Er gehörte zu der Generation, die der Welt die Überlegenheit des kommunistischen Systems demonstrieren sollte. Er war die Zukunft. Dieser alte Mann gehörte zu einer fernen Vergangenheit, die nicht mehr zählte.
»Keine Angst.« Dresner ging zu dem Stock in der Ecke. »Ich hetze dir nicht die Stasi auf den Hals.«
»Deine Eltern haben Mist gebaut …«, stammelte der Mann. »Ich musste dich auf die Welt vorbereiten … damit du dich gegen deine Feinde wehren konntest.« Er hielt einen Moment inne und fügte rasch hinzu: »Für die warst du genauso schuldig, obwohl du gar nichts dafür konntest.«
»Tust du das immer noch?« Dresner griff sich das abgenutzte Stück Holz. So wie an den Spielplatz draußen erinnerte er sich noch genau an den Zustand des Stocks, als er das Haus verlassen hatte. Er strich mit der Hand über die Kratzer und Unebenheiten, die seither dazugekommen waren. »Bereitest du sie immer noch auf die Welt vor?«
Der Alte sah es kommen, war jedoch nicht mehr schnell genug, um rechtzeitig auszuweichen. Der Stock krachte gegen seine Wange, und er wurde herumgewirbelt und stürzte auf die schmuddelige Armlehne des Sofas. Als der Stock erneut niedersauste, diesmal auf seinen Rücken, entwich ihm ein leises Stöhnen.
Dresner dachte nicht mehr nach, was er tat – er schlug nur noch drauflos. Der Mann sank zu Boden, hob schützend den Arm, doch die spröden Knochen brachen beim ersten Schlag. Auch als er sich nicht mehr rührte, prügelte Dresner weiter auf ihn ein.
Erst als seine Schulter schmerzte, hielt er inne und starrte auf den Alten hinunter. Er nahm seine Kraft zusammen, um weiterzumachen, doch es gab nichts mehr zu tun. Das Blut strömte um seine Schuhe herum, und die toten Augen des Mannes starrten durch ihn hindurch, als könnten sie das verängstigte Kind sehen, das er einst gewesen war.
Dresner warf den Stock weg und wankte die Treppe hinunter. Unten hatten sich ein paar Kinder aus ihrem Versteck hervorgewagt. Er blinzelte, um die Benommenheit zu vertreiben, und bemühte sich, seinen Atem zu beruhigen, der hier unten, ohne die Wärme des Ofens, wieder Nebelwölkchen bildete.
»Ich wünschte, ich könnte euch helfen«, sagte er schließlich. »Aber irgendwann werde ich etwas für euch tun, versprochen.«
Kapitel eins
Provinz Chost
Afghanistan
Aditya Zahid lag hinter dem verlassenen Steingebäude und spähte an der bröckelnden Hausecke auf das Dorf Sarabat hinunter.
Die kleine Ansammlung sandfarbener Häuser war sogar für diese ländliche Gegend Afghanistans spärlich, und er schämte sich genauso wie sein Vater und sein Großvater, dass es ihnen noch immer nicht gelungen war, das Dorf auszulöschen. Die Fehde zwischen diesen Leuten und seinen eigenen währte länger, als irgendjemand zurückdenken konnte, und der Grund dafür war längst vergessen. Manche meinten, es sei um Vieh gegangen, andere behaupteten, ein gebrochenes Heiratsversprechen sei der Auslöser gewesen. Die Fehde hatte jedenfalls die Zeit überdauert.
In Wahrheit war der Grund längst unwichtig. Viel gravierender war, dass sie trotz ihrer deutlichen zahlenmäßigen Überlegenheit nicht gewinnen konnten – es lief immer wieder auf eine blutige Pattstellung hinaus. Die Dorfältesten glaubten, dass diese Schmach bald ein Ende haben würde. Zahid war sich da nicht so sicher.
Er zog sich in die sichere Deckung zurück, schloss die Augen und dachte an das Bild, das sich ihm geboten hatte. Er hatte sieben Leute gezählt: zwei Frauen, ein Kind und vier Männer, die ihre Ziegen an einem Brunnen tränkten, den ihre guten amerikanischen Freunde für sie gebaut hatten.
Die Sonne stand hoch am Himmel, und er kniff die Augen zusammen, während er die Wände der niedrigen Schlucht absuchte. Seine Kameraden mussten das Dorf inzwischen umstellt haben, auch wenn er sie nicht sehen konnte. Sie waren mit der Wüste verschmolzen.
Die anonymen Ausländer, die diesen Moment möglich gemacht hatten, bestanden darauf, dass der Angriff zu dieser Tageszeit stattfand – nicht im Schutz der Dunkelheit, nicht einmal im Schatten, den die Klippen in einigen Stunden bieten würden. Deswegen konnte Zahid die Zuversicht seiner Leute auch nicht teilen, dass es ihnen endlich gelingen würde, diese Hundesöhne zu vernichten.
Immerhin hatten die Unbekannten bisher alle Zusagen eingehalten. Zahid war mit einer neuen AK-47 bewaffnet, zudem hatten sie ihm ein schallgedämpftes amerikanisches Jagdgewehr gegeben, mit dem er den Wachposten ausgeschaltet hatte, der jetzt neben ihm lag.
Er blickte auf den Toten hinunter und setzte ihn an einen zertrümmerten Mauerrest. Sein Kopf ragte über die Kante, sodass ihn die Leute unten im Dorf sehen konnten und beruhigt waren.
Die ebenfalls neue Digitaluhr an seinem Handgelenk zeigte nicht die Uhrzeit an, sondern einen Countdown. Noch knapp zwei Minuten, dann würden sie vielleicht den entscheidenden Sieg erringen.
Erneut schloss Zahid die Augen. Er war von Anfang an skeptisch gewesen. Leuten ohne Gesicht traute er nicht, ebenso wenig ihren Waffen und ihrem Geld. Es roch nach einer Falle, einem Trick der CIA. Doch die Ältesten verstanden die heutige Welt nicht mehr ganz, und ihr Hass gegen die Leute von Sarabat brannte stärker als der gegen einen Eindringling, der bald besiegt abziehen und vergessen sein würde. So wie all die anderen vor ihnen.
Er legte die Hand um sein neues Sturmgewehr und betete noch einmal zu Allah, als er das leise Klicken hörte, mit dem der Countdown null erreichte. Seine Männer würden nun ihren Angriff starten – die jüngeren zu schnell und ungeduldig, vom Adrenalin und den ruhmreichen Geschichten angetrieben, die man ihnen von Geburt an erzählt hatte. Er selbst pirschte sich langsam und tief geduckt an das Dorf heran und suchte den Bergkamm nach amerikanischen Soldaten und den Himmel nach Kampfhubschraubern ab. Doch da war nichts.
Die Stille wurde schließlich vom Schrei eines Kindes durchbrochen, gefolgt vom scharfen Krachen von Gewehrfeuer. Eine Frau wurde in den Rücken getroffen, als sie zu fliehen versuchte. Sie fiel mit ausgebreiteten Armen vornüber und rührte sich nicht mehr. Einer seiner Männer tauchte hinter einem Haus auf und legte auf einen flüchtenden Dorfbewohner an, als ein Junge von acht oder neun Jahren seinen Gewehrlauf zur Seite schlug. Zahid sprintete los, um dem Fliehenden den Weg abzuschneiden, während sein Kamerad dem Jungen mit dem Gewehrkolben den Kopf zertrümmerte.
Der Mann, den Zahid verfolgte – etwa Mitte zwanzig, schlank und kräftig –, zögerte plötzlich, wurde langsamer und blickte zurück auf das Massaker, das in seinem Dorf vor sich ging. Er griff nach dem alten Gewehr, das er auf dem Rücken trug, konnte sich jedoch nicht entschließen, es abzunehmen.
Zahid ließ sich auf ein Knie nieder, legte die AK-47 an und gab eine gezielte Salve ab. Der verwirrte Mann taumelte, sank auf die Knie und starrte zum Himmel hinauf. Doch er griff noch immer nicht nach seiner Waffe.
Zahid fürchtete einen Trick und näherte sich vorsichtig, während er sich in der kahlen Landschaft umblickte. War er in einen Hinterhalt geraten? Warum zögerten sie und ließen sich abschlachten wie Tiere?
Er blieb zwei Meter vor dem Mann stehen, sein Gewehr auf das faltenlose Gesicht des Feindes gerichtet. Er blutete stark aus einer Wunde am Bein, und der Boden unter ihm verfärbte sich bereits dunkel von seinem Blut. Er würde nicht mehr lange leben.
»Warum kämpfst du nicht?«
Der Mann gab keine Antwort und sah Zahid mit seinen leeren Augen an, die weder Hass noch Furcht erkennen ließen.
»Warum kämpfst du nicht?«, wiederholte Zahid und blickte sich um, während das Gewehrfeuer nachließ und die Schreie verstummten. Die Amerikaner waren nicht gekommen. Das Dorf Sarabat war vom Angesicht der Erde getilgt. Nach so vielen Jahren war die Ehre endlich wiederhergestellt. Aber wie war das möglich gewesen?
»Gott ist groß«, sagte Zahid und wandte sich mit dem Finger am Abzug wieder dem Feind zu.
Der schwer verletzte Mann hob das Kinn und starrte in die glühende Sonne Afghanistans. »Es gibt keinen Gott.«
Claude Géroux schwenkte seine Kamera nach Norden und beobachtete einen der letzten lebenden Bewohner von Sarabat: eine alte Frau, die vergeblich versuchte, einem Reiter zu entkommen, der mit einem primitiven Knüppel auf sie einprügelte. Blut spritzte auf das Fell des Pferdes, und sie fiel zu Boden und bedeckte ihren Kopf mit den Händen, als sie unter die Hufe geriet.
Géroux überblickte das Schlachtfeld, wenn man es so nennen konnte. Er hatte unter anderem im Kongo, im Irak und in Bosnien gekämpft und miterlebt, wie die Leute einander auf jede nur erdenkliche Weise töteten – aber so etwas hatte er noch nie gesehen.
Er schwenkte die Kamera auf einen Angreifer, der bei einem toten Dorfbewohner hockte. Der Tote war bewaffnet gewesen, hatte sein Gewehr jedoch nicht benutzt. Manche waren geflüchtet, doch die meisten hatten nur dagestanden und sich und ihre Familien niedermetzeln lassen.
Als das Gewehrfeuer verstummte, filmte Géroux noch einige Sekunden weiter. Er hielt jedoch kein Triumphgeschrei und keine Jubelposen fest. Die siegreichen Kämpfer gingen in ungläubigem Staunen zwischen den Leichen der gefallenen Feinde hin und her.
Schließlich schaltete er die Kamera aus, doch die aufgenommenen Bilder gruben sich tief in sein Gedächtnis. So wie viele andere würde er sie niemals vergessen.
Kapitel zwei
Las Vegas, Nevada
USA
Jon Smith schritt durch das Konferenzzentrum von Las Vegas auf eine dichte Menschentraube zu. Die Klimaanlage trocknete bereits den Schweiß, der sein Hemd am Rücken durchnässt hatte, während er in der heißen Wüstensonne gestanden hatte. Er hatte nicht mit derart strengen Sicherheitskontrollen gerechnet: Metalldetektoren, mehrfache Ausweiskontrollen, Bombenspürhunde. Im Vergleich dazu nahm sich der Secret Service fast nachlässig aus.
Als er die Gruppe erreichte, wurde der Grund für die strengen Maßnahmen ersichtlich. Hier waren die Spitzenvertreter der IT-Branche versammelt. Er erblickte bekannte Gesichter von Amazon und Facebook, daneben den neuen CEO von Apple, in eine hitzige Debatte mit zwei schlaksigen, salopp gekleideten jungen Männern vertieft, die ebenfalls zu den Stars der Branche zu zählen schienen.
Smith fühlte sich ziemlich fehl am Platz, während er die Menge umrundete und die etwa hundert Stühle überblickte, die vor einer Bühne mit einem um die zwanzig Meter hohen Bildschirm aufgereiht waren. Schließlich fand er sein Ziel: einen riesigen Tisch mit einer spektakulären Eisskulptur und einer nicht minder imposanten Auswahl an exotischen Speisen.
Seine erste Kostprobe erwies sich als ziemlich unglückliche Kombination von Datteln und Kaviar, und er eilte zur Bar, um den Geschmack mit irgendetwas Flüssigem wegzuspülen.
»Ein Bier«, wandte er sich an einen der Männer an der gut zehn Meter langen Reihe von Zapfhähnen.
»Gern. Wir haben Fat Tire, Snake River Lager, Sam Adams, Corona …«
Smith hob die Hand, damit ihm der Mann nicht die ganze Palette aufzählte. Er hatte es eilig, den Geschmack der Datteln loszuwerden. »Ich vertraue ganz Ihrem Urteil.«
Die Stimme einer Frau hinter ihm erhob sich aus dem allgemeinen Gemurmel. »Ich würde Sie als Budweiser-Typ einschätzen.«
Er drehte sich um, und ihre roten Lippen krümmten sich zu einem strahlenden Lächeln. Sie war etwa Mitte zwanzig, schlank, aber wohlgeformt, mit einem frechen Kurzhaarschnitt und Stirnfransen, die sie sich aus den Augen strich, um ihn zu begutachten. Auf ihrem Namensschild las er »Janine Redford/Wired Magazine«. Auf seinem eigenen stand nur »Jon Smith«, wie ihr bestimmt nicht entgangen war.
»Ich habe Sie beobachtet.«
»Mich?« Er nahm das Bier entgegen und kämpfte sich zwischen den Leuten hindurch, die die Bar belagerten. Sie folgte ihm. »Warum? Ich gehöre nicht zu den bekannten Namen hier.«
Sie deutete auf sein Namensschild. »Klingt jedenfalls nicht so.«
»In unserer Familie werden die Vornamen von Generation zu Generation weitergegeben. Ich hätte es aber schlimmer treffen können. Zum Glück hatte mein Vater kurz vor meiner Geburt Streit mit meinem Onkel Gomer.«
Sie wirkte nicht überzeugt. »Ich kenne fast alle hier. Sie passen irgendwie nicht dazu.«
»Nicht?«
»Nein. Hier finden Sie jede Menge Computerfreaks, Businesstypen und hagere Internet-Multimillionäre …« Sie verstummte für einen Augenblick. »Und dann Sie.«
Es ließ sich nicht leugnen. Seine Schultern waren etwas zu breit, sein schwarzes Haar etwas zu zweckmäßig geschnitten, und auf seiner dunkel getönten Haut hatten Sonne, Wind, Frost und so manche Explosion ihre Spuren hinterlassen.
»Vielleicht haben sie mir die Einladung versehentlich geschickt?«, überlegte er. Diese Möglichkeit schien ihm tatsächlich die wahrscheinlichste zu sein. Aber einem geschenkten Gaul schaute man nicht ins Maul. Ein Viertel der Menschheit hätte sich den kleinen Zeh abhacken lassen, um heute hier sein zu können. Und diesem Viertel gehörte auch er an.
Sie beäugte ihn mit einem argwöhnischen Lächeln und nahm einen Schluck von ihrem Martini. »Christian Dresner macht nichts versehentlich.«
»Okay. Dann sagen Sie mir, warum ich hier bin.«
»Sie sind vom Militär.«
»Ich bin Arzt«, wich er aus. »Mikrobiologe. Aber heute arbeite ich vor allem mit körperlich beeinträchtigten Menschen.«
»Okay, mag sein. Dann sind Sie Militärarzt, und die beeinträchtigten Leute, mit denen Sie arbeiten, sind Soldaten mit schweren Verletzungen. Sie brauchen es gar nicht zu leugnen – in so was bin ich Expertin.«
Er überlegte einen Augenblick und hielt ihr schließlich die Hand hin. »Lieutenant Colonel Jon Smith.«
»Dann weiß die Army schon etwas?« Ihr Händedruck war erstaunlich fest. »Zum Beispiel, was Dresner heute präsentieren wird?«
»Ich habe keine Ahnung.«
Ihr Schmollmund und ihre hängenden Schultern machten deutlich, dass sie ihm kein Wort glaubte. »Dresner gehört eigentlich mehr zu den Leuten, die die Welt zu retten versuchen, nicht zu denen, die sie in die Luft jagen wollen …«, sagte sie schließlich wie zu sich selbst.
»Und ich arbeite auch nicht mit Waffen, Janine. Ich bin wirklich Arzt. Wenn ich nicht aus Versehen hier bin, dann würde ich vermuten, dass es um irgendeinen medizinischen Durchbruch geht. Seine Antibiotika haben uns bei vielen Einsätzen geholfen, und ehemalige Soldaten profitieren sehr von seinen Hörgeräten.«
Sie rümpfte die Nase. »Mein Opa war bei der Artillerie in Vietnam und hat auch so ein Hörgerät.«
»Die Technologie ist wirklich toll.«
»Ja. Früher hab ich ihm ins Gesicht geschrien: ›Hallo, Opi!‹, und er hat geantwortet: ›Fünf vor elf.‹ Heute hört er eine Nadel im Nebenzimmer runterfallen.«
Dresners System wurde fälschlicherweise oft mit einem Cochleaimplantat verglichen, doch die Technologie war um vieles fortgeschrittener. Dresner hatte einen Weg gefunden, das Ohr völlig zu umgehen und mithilfe eines Magnetfeldes direkt das Gehirn anzusprechen. Kinder, die heute zur Welt kamen, würden sich unter Schwerhörigkeit nicht mehr viel vorstellen können.
Sie deutete auf die linke Seite ihres Kopfes. »Das Problem ist, dass er eine Glatze hat und sich diese beiden silbernen Empfänger in seinen runzligen alten Schädel stecken ließ. Ich liebe den alten Kerl, aber das sieht grauenhaft aus.«
»Das Veteranenministerium übernimmt die Kosten für die Sondervariante in Hautfarbe.«
»Er meint, die Regierung kann das Geld besser verwenden als dafür, ihn hübscher zu machen.«
Smith erhob sein Glas auf den alten Soldaten und nahm einen kräftigen Schluck.
»Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass es hier nicht um ein besseres Hörgerät geht«, fuhr sie fort. »Aber was dann?«
»Das weiß ich nicht, aber ich kann Ihnen verraten, was ich mir wünsche. Ich arbeite bei der Entwicklung von besseren Prothesen für Soldaten mit Kriegsverletzungen mit. Es geht in die Richtung, diese Dinger mit Gedanken zu steuern, aber die Technologie ist noch nicht ausgereift. Wenn jemand diese Nuss knacken kann, dann Christian Dresner.«
Sie überlegte einige Augenblicke. »Wir haben vor einiger Zeit eine Geschichte über einen Affen gebracht, der einen großen mechanischen Arm mit seinem Gehirn steuert. Er scheint gar nicht zu wissen, dass es nicht sein eigener ist. Irgendwie gruselig.«
»Ich habe diesen Affen gesehen«, sagte Smith. »Wirklich unglaublich.«
Sie schüttelte den Kopf. »Darum geht es hier aber nicht.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Erstens sind Sie der einzige Arzt hier – alle anderen sind IT-Spezialisten. Und zweitens hat Dresner vor einigen Jahren eine spanische Firma übernommen, die sich mit erweiterter Realität fürs Handy beschäftigt.«
»Augmented Reality? Wie die Astronomie-App, die ich auf meinem iPhone habe? Man hält es einfach zum Nachthimmel, und schon zeigt es einem die Sterne mit den Namen an. Echt toll.«
Sie wirkte nicht sehr beeindruckt. »Dresner ging es nicht um die Firma, sondern um ihren Technologieguru, einen alten Hacker namens Javier de Galdiano.«
»Was macht Galdiano heute?«
»Das kann keiner so genau sagen. Ich weiß nur, dass Dresner eine ganze Reihe von Hardwarefirmen und Patenten gekauft hat, die mit Javiers Projekten zu tun haben.«
»Sie wissen eine ganze Menge.«
»Es gehört zu meinem Job, über Dresners Aktivitäten auf dem Laufenden zu sein. Und ich sage Ihnen, er beschäftigt sich zunehmend mit Informationstechnologie.«
»Der Markt scheint mir ziemlich gesättigt zu sein. Was heute neu herauskommt, ist irgendwie immer eine größere, kleinere oder leichtere Version von etwas, das es bereits gibt. Steve Jobs hat es großartig verstanden, aus vorhandener Technologie etwas Nützliches zu machen. Aber Dresner ist doch eher jemand, der uns mit Dingen verblüffen will, an die wir noch nicht mal im Traum gedacht haben. Der Mann hat unser Verständnis davon, wie Körper und Geist zusammenarbeiten, total verändert. Allein seine Arbeit in der Immunologie hat schon Hunderttausende Menschenleben gerettet. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier wieder um etwas ganz Großes geht.«
Sie hakte sich bei ihm unter und zog ihn zu den Sitzplätzen vor dem Podium. »Dann kämpfen wir uns mal durch die Menge und setzen uns in die erste Reihe. Ich würde mich sicherer fühlen mit einem Soldaten neben mir. Für den Fall, dass die Russen einmarschieren.«
Er lächelte und sagte ein paar Worte auf Russisch, während sie an einem der Gründer von Google vorbeigingen.
»Interessant. Was haben Sie gesagt?«
Es hatte sich um ein altes russisches Sprichwort über die Vorzüge schöner junger Frauen gehandelt, doch das behielt er lieber für sich.
»Ich habe gefragt, ob Sie wissen, wo es hier zur Toilette geht. Das ist so ziemlich der einzige russische Satz, den ich kann.«
»Es hat aber sehr überzeugend geklungen – und darauf kommt es an.«
Kapitel drei
Provinz Chost
Afghanistan
»Was zum Teufel ist da unten passiert?«
Randi Russell ließ den Hubschrauber in etwa 120 Metern Höhe über dem Dorf kreisen und flog durch die Rauchwolke der niedergebrannten Häuser. Sie konzentrierte sich auf die Steuerung der Maschine und überließ es dem rothaarigen Soldaten neben ihr, die Szene mit dem Fernglas zu überblicken. Etwas tiefer zu gehen hätte die Sache erleichtert, doch in der Schlucht herrschten starke Windböen, und sie wusste, dass sie nicht die beste Pilotin im Mittleren Osten war.
»Was siehst du, Deuce?«
»Ein verdammtes Schlachtfeld, also eigentlich das Übliche. Ich würde sagen, wir fliegen zurück zur Basis, trinken ein Glas und vergessen das Ganze. Es ist fast Happy Hour.«
Randi riskierte einen Blick auf die Toten, die da unten im Sand lagen. Bei manchen war nur eine große Blutlache an der Stelle zu erkennen, an der sich der Kopf befinden sollte. Deuce hatte recht: ein verdammtes Schlachtfeld – und doch irgendwie anders als sonst.
»Ich möchte es mir genauer ansehen.«
Der Soldat wandte sich ihr beunruhigt zu. »Also wirklich, Mädchen, du willst doch nicht etwa tiefer gehen, oder?«
Sie warf ihm einen vernichtenden Blick zu. »Ich habe eher an Landen gedacht.«
»Was soll das, Randi. Da unten hat nicht mal ’ne Eidechse überlebt, und diese Schlucht ist ein Paradies für Scharfschützen. Happy Hour. Ich lade dich ein.«
»Seit wann bist du so ein Weichei?«
In Wahrheit war Lieutenant Deuce Brennan einer der besten jungen Soldaten der amerikanischen Sondereinsatzkräfte. Anfangs hatte er sie mit seiner etwas großspurigen Art nicht gerade beeindruckt, doch inzwischen war ihr sehr daran gelegen, ihn bei möglichst jedem Einsatz an ihrer Seite zu haben.
»Ich mag dich wirklich, Randi. Seit ich dich kenne, habe ich wieder ein bisschen Respekt vor euch nichtsnutzigen CIA-Typen. Aber ich würde gern irgendwann in einem Stück wieder von hier weggehen. Und je länger ich dich kenne, umso unwahrscheinlicher kommt mir das vor.«
»Fünf Minuten«, beharrte sie und ließ den Hubschrauber über dem Dorf schweben. »Dafür gehen die Margaritas auf mich.«
Es war für ihre Verhältnisse gar keine schlechte Landung, wenngleich es ihr der weiche Sand etwas leichter machte. Sie sprangen sofort hinaus – ein etwas seltsames Gespann: er in voller Kampfausrüstung und sie in Cargohose und T-Shirt.
Ein Tuch verhüllte ihr kurzes blondes Haar, mit dem sie in diesem Teil der Welt so schrecklich auffiel. Sie rückte das Tuch zurecht, um sicherzugehen, dass keine Strähne hervorguckte, während Deuce nach Norden marschierte. Seine Augen suchten die dunklen Schatten der ausgebrannten Häuser ab. Gestern war all das hier noch ein blühendes Dorf gewesen, dessen Bewohner den im Rückzug begriffenen amerikanischen Besatzungstruppen einigermaßen wohlwollend gegenüberstanden.
In dem Wissen, dass ihr Begleiter die Augen offen hielt, hockte sich Randi zur Leiche einer jungen Frau und untersuchte die Schusswunde in ihrer Brust. Ihr erstarrtes Gesicht zeigte noch den Ausdruck der Angst.
Die nächste Leiche lag zehn Meter weiter und war ihr schon aus der Luft aufgefallen. Der Tote hatte ebenfalls eine Schusswunde in der Brust, doch er war enthauptet, und statt des Kopfes war da nur noch ein großer dunkler Blutfleck im Sand.
Sie ging von einem Toten zum nächsten und zog schließlich ihre Beretta, als sie die geschwärzten Häuser erreichte. Deuce stand etwa hundert Meter entfernt und gab ihr ein Daumen-hoch-Zeichen. Offenbar fand er nur das Gleiche wie sie vor: Tod und Zerstörung.
Randi trat durch die Tür eines kleinen Hauses und hielt die Luft an, als ihr der Gestank von verbranntem Menschenfleisch entgegenschlug. Zwei verkohlte Leichen lagen in den glimmenden Trümmern, nach der Größe zu schließen Kinder.
Sie trat in die frische Luft und die Sonne hinaus und sah sich weiter um. Sie fand nirgends Waffen, und die Leichen der Männer waren im Gegensatz zu denen der Frauen und Kinder alle enthauptet.
Es war Fred Klein, der sie hergeschickt hatte, um einen Vorfall zu untersuchen, den er in seiner typisch vagen Art als »auffällige Söldneraktivität« bezeichnet hatte.
Sie fand dafür jedoch keinerlei Hinweise. Die Angreifer hatten traditionelles Schuhwerk der Region getragen, und die Abdrücke von Pferdehufen im Sand deuteten ebenfalls nicht auf das Werk von Söldnern hin.
Damit war allerdings noch nicht bewiesen, dass es sich tatsächlich um eine typische Fehde handelte, wie es sie in der Gegend seit über tausend Jahren gab. Abgesehen von den bizarren Enthauptungen war da noch etwas anderes, das sie stutzig machte. Einige Dorfbewohner schienen den Spuren zufolge ein Stück gelaufen zu sein, aber nicht in vollem Tempo, wie es die Situation erfordert hätte. Und es deutete nichts darauf hin, dass auch nur einer versucht hätte, sich oder seine Familie zu verteidigen. Wie passte das zu einem Volk, das allen Eindringlingen getrotzt hatte – von Alexander dem Großen bis zur Sowjetunion?
Zu ihrer Rechten hörte sie ein leises Knirschen. Sie wirbelte herum und hob ihre Pistole.
»Nicht schießen! Ich bin’s«, sagte Deuce und trat hinter einer Lehmwand hervor.
Sie steckte die Waffe ins Holster. »Was gefunden?«
»Der Überfall muss völlig überraschend gekommen sein«, sagte er kopfschüttelnd. »Die Angreifer haben ihnen die Waffen abgenommen und ihre eigenen Toten mitgenommen – falls sie welche hatten. Es gibt jedenfalls keine Spuren, die darauf hindeuten, dass Angreifer getroffen worden wären.«
»Hast du die Köpfe gefunden?«
»Nein.«
Sie atmete langsam aus und schirmte die Augen vor der Sonne ab, die sich allmählich dem Horizont entgegensenkte. Sie hatte diese Leute gekannt und sich sogar persönlich dafür eingesetzt, dass die Agency ein Brunnenprojekt finanzierte. Sie waren gute Muslime, hegten aber keine Sympathien für die Taliban.
»Kaum zu glauben, dass sie sich so abschlachten ließen«, meine Deuce.
»Absolut unglaublich. Sie waren gute Kämpfer und wussten genau, dass sie Feinde hatten – manche davon uralt, andere erst, seit sie uns ein paarmal geholfen haben. Es will mir nicht in den Kopf, dass hier jemand einfach so aufkreuzt und sie auslöscht.«
»Aber genau danach sieht es aus.«
Ein Gewehrschuss krachte, und sie duckte sich instinktiv und zog ihre Waffe, während die Kugel gegen Metall prallte.
»Shit!«, stieß Deuce aus. »Das kommt von der Südwand der Schlucht. Sie haben es auf den Helikopter abgesehen!«
Randi drückte sich mit dem Rücken an das rußige Haus, während weitere Schüsse fielen. Der Wind wurde stärker, und der Scharfschütze traf nur mit jedem zweiten oder dritten Schuss ins Ziel, doch der Hubschrauber verfügte über so gut wie keine Panzerung. Ein Glückstreffer – und sie konnten wählen zwischen der Schmach eines Hilferufs oder einem langen, gefahrvollen Marsch zurück.
Sie trat an die Hausecke und spazierte ganz langsam zum nächsten Haus hinüber. Der aufreizend langsame Gang hatte die gewünschte Wirkung: Etwa einen Meter neben ihr schlug eine Kugel in den Sand ein. Hoffentlich verlor der Schütze das Interesse am Hubschrauber, wenn auch Ziele aus Fleisch und Blut in Reichweite waren.
»Der Typ hat bestimmt Freunde«, rief Deuce. Er feuerte eine Salve in Richtung des Angreifers ab, doch seine Waffe war nicht für solche Entfernungen geeignet. »Es wird sich schnell herumsprechen, dass wir hier sind.«
Randi deutete auf einen enthaupteten Toten, der zwischen ihnen und dem Helikopter lag. »Wir starten auf mein Kommando. Aber die Leiche nehmen wir mit. Ich will eine Autopsie.«
»Eine Autopsie?«, erwiderte Deuce ungläubig. »Ich habe zwar nicht Medizin studiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Todesursache entweder die Kugel in der Brust ist oder die Tatsache, dass er keinen Kopf mehr hat!«
»Ich bin nicht hergekommen, um mit leeren Händen wieder abzuziehen.«
Er feuerte noch ein paarmal, mehr aus Frust als in der Hoffnung, den Scharfschützen davon abzuhalten, auf sie zu schießen. »Ich schwöre dir, Randi, irgendwann, wenn keiner hinguckt, bring ich dich eigenhändig um.«
Kapitel vier
Las Vegas, Nevada
USA
Janine schaffte es tatsächlich, zwei Plätze in der vierten Reihe zu ergattern. Sie verfügte über eine natürliche Durchsetzungsfähigkeit, die ihr zusammen mit ihrem guten Aussehen einen Weg durch jede noch so dichte Menschenmenge bahnte.
»Ich frage mich, ob er endlich eine neue Brille hat.« Janine legte die Hand auf Smiths Unterarm. »Wir haben im Büro eine Wette laufen.«
Sie erhielt ihre Antwort wenige Augenblicke später, als Christian Dresner auf die Bühne stieg und ans Rednerpult trat. Er trug noch die gleiche dicke Brille wie in den Achtzigern. Anzug und Krawatte schienen aus derselben Zeit zu stammen.
Im Grunde wirkte Dresner in dieser Umgebung genauso fehl am Platz wie Smith. Es lag nicht nur an seiner Kleidung – er trug seine ergrauenden blonden Haare so wirr und zerzaust, dass sich mancher fragte, ob er sie selbst schnitt. Smith kam es jedoch so vor, als wäre das alles Absicht, um von dem kantigen Kinn, den kräftigen Schultern und der immer noch schmalen Taille abzulenken. Mit Kontaktlinsen, einem guten Schneider und einem flotten Haarschnitt hätte er wie ein Musterbeispiel der nationalsozialistischen Vorstellungen von einem Arier ausgesehen.
Unter freundlichem Applaus versuchte Dresner etwas verlegen, ein Bluetooth-Headset an seinem Ohr zu befestigen. Tatsächlich war dies erst der vierte öffentliche Auftritt des als medienscheu bekannten Genies.
Während viele ihn mit Steve Jobs verglichen, zeigte er für Smith mehr Ähnlichkeit mit dem exzentrischen Schokoladenfabrikanten Willy Wonka aus dem Film Charlie und die Schokoladenfabrik: ein schrulliges Genie, das unglaubliche Dinge schuf, sich aber am wohlsten in der Zurückgezogenheit seiner Fabrik fühlte.
»Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind«, begann er mit seinem leichten deutschen Akzent, den er nie ganz abgelegt hatte. »Ich hoffe, Sie werden meine Begeisterung für mein neues Projekt teilen.«
Der Bildschirm hinter ihm erwachte zum Leben und zeigte eine Hand mit einem Gerät, das wie ein graues iPhone ohne Display aussah.
»Ein elektrisches Zigarettenetui?«, fragte Janine und stieß Smith leicht mit dem Ellbogen an, während sich ringsum verwirrtes Gemurmel erhob.
Smith hatte keine Ahnung. Auf der rechten Seite hatte das Gerät einen kleinen Schalter und eine blaue Leuchtanzeige, ansonsten war es einfach ein elegantes Kunststoffteil.
Dresner zog sein Jackett zurück und präsentierte ein Exemplar des Geräts an seinem Gürtel. »Ich möchte Ihnen den Merge vorstellen. Die nächste und vielleicht letzte Generation des Personal Computers.«
»O Gott«, stöhnte Janine und schlug sich die Hand vor die Stirn. »Weiß er nicht, dass das Handy schon erfunden ist?«
»Wie viele von Ihnen benutzen Systeme für erweiterte Realität?« Dresner hatte Janines sarkastische Reaktion zum Glück nicht mitbekommen. »Sie wissen schon – Astronomie-Apps oder etwas, das Ihnen verrät, wie gut das Restaurant ist, vor dem Sie gerade stehen … solche Dinge.«
Mehr als die Hälfte der Anwesenden hoben die Hand, darunter auch Smith. Janine verschränkte missmutig die Arme vor der Brust. »Und wie viele von Ihnen finden diese Dinge wirklich praktisch?«
Smith nahm die Hand herunter, alle anderen ebenso. So toll er die Software auch fand – letztlich tat man doch nicht mehr als ein Handy hochzuhalten und in den Nachthimmel zu schauen.
»GPS hat diese Technologie sicher vorangebracht, aber die Schnittstelle unterscheidet sich kaum von der der ersten PCs vor über dreißig Jahren. Das – und nicht die Software – ist es in Wahrheit, was die Technologie bremst. Wir sehen alle, welches Potenzial in Augmented Reality steckt, aber niemand schöpft es wirklich aus, weil die entsprechende Hardware fehlt. Ich hoffe, ich kann das nun ändern.«
Er trat wieder ans Rednerpult. »Ich möchte Ihnen nun zeigen, was ich sehe.«
Der Bildschirm hinter ihm wechselte zu einer Darstellung der Menschenmenge, die er überblickte. An der linken Seite erschien eine Reihe von Icons, die in unterschiedlichen Rot- und Grüntönen leuchteten. Oben waren allgemeine Daten eingeblendet, darunter die Innen- und Außentemperatur sowie verschiedene Abkürzungen und Zahlen, die Smith nichts sagten.
Janine beugte sich zu ihm. »Das sieht doch richtig gut aus. Ich habe Google Glass ausprobiert, aber da bekommt man nur ein mattes Head-up-Display.«
Smith nickte. »Ich habe den Prototyp einer britischen Firma getestet, der das Bild auf die Netzhaut projiziert, um das gesamte Sichtfeld zu nutzen. Tolle Idee, nur leider war das Bild unscharf, besonders wenn sich die Brille bewegte. Vielleicht hat Dresner das Problem gelöst.«
»Ich muss zugeben, es sieht cool aus, aber ich laufe sicher nicht den Rest meines Lebens mit einer Brille herum, die aussieht, als würde ich mit der Kettensäge arbeiten.«
Dresners Blick fiel auf einen Mann in der zweiten Reihe, dessen überraschtes Gesicht plötzlich den Bildschirm ausfüllte. »Wie wär’s mit einem Telefongespräch? Bob, würden Sie sich bitte erheben?«
Die Verlegenheit des Mannes wirkte sehr echt. Falls das Ganze abgesprochen war, musste er ein verdammt guter Schauspieler sein.
»Bob hat, so wie es sich gehört, sein Handy ausgeschaltet, bevor er reinkam. Dürfte ich Sie bitten, es wieder einzuschalten?«
Dresner blickte ins Publikum, während das Telefon-Icon am Bildschirmrand hervortrat und im Adressbuch unter dem Buchstaben S der Name »Stamen, Bob« angezeigt wurde. Im nächsten Augenblick ertönte der blecherne Sound von Blondies »Call Me«.
Der zunehmend nervös wirkende Mann meldete sich, und seine Stimme wurde von Dresners Merge über Lautsprecher übertragen: »Hallo?«
»Hi, Bob. Wie geht’s?«
»Gut.«
Janine beugte sich vor und beobachtete Dresner beim Plaudern. »Wie steuert er diese Icons, und wie scrollt er durch die Namen? Reagiert das System auf seine Augenbewegungen?«
Smith hatte sich gerade das Gleiche gefragt. »Ich glaube nicht. Dann würde sich das Bild mehr bewegen. Er hat direkt ins Publikum geschaut, als er diese App startete.«
»Vielleicht hat er das alles vorher eingestellt, und das System ist in einer Art Demonstrationsmodus.«
»Mag sein …«
Dresner nahm sein Bluetooth-Headset ab und legte es aufs Pult, ehe er in die Mitte des Podiums trat. »Ich habe diese Dinger immer gehasst. Mir tut das Ohr davon weh. Wie geht’s Ihnen damit, Bob?«
»Ähm …« Stamen stellte sich offenbar die gleiche Frage wie alle anderen: Wie konnte Dresners Gerät nach wie vor seine Stimme übertragen? »Ich mag sie nicht besonders.«
»Das wundert mich gar nicht. Also dachte ich mir: Könnte ich nicht ein winziges Mikrofon an einem Zahn anbringen? Und mir die Geräusche von außen über eine viel kleinere und weiterentwickelte Version meines Hörimplantats direkt ins Gehirn leiten lassen?«
Einige Sekunden herrschte absolute Stille unter den Zuhörern, bevor alle gleichzeitig zu sprechen begannen. Es war jedoch nicht reine Begeisterung, was aus den Stimmen herausklang; so wie die junge Journalistin neben Smith schienen die meisten beeindruckt, aber auch skeptisch zu sein.
»Okay, das klingt alles ziemlich cool, aber wenn es nur um ein unbequemes Headset geht, gibt es bestimmt genügend Firmen, die einen maßgeschneiderten Ohrstöpsel anfertigen können. Das käme allemal billiger als ein Mikrofon am Zahn und ein Implantat am Schädel.«
»Ich weiß nicht«, gab Smith zurück. »Ich habe mit vielen gearbeitet, die Dresners Hörsystem verwenden, und sie sagen alle, es tut zwar am Anfang ein bisschen weh, aber nach ein paar Tagen vergisst man die Implantate ganz, bis man sie irgendwann aufladen muss. Und er sagt ja, sie seien jetzt noch kleiner.«
Sie lehnte sich mürrisch auf ihrem Stuhl zurück und verschränkte erneut die Arme. Ihre Generation war offenbar von nichts mehr zu beeindrucken, wenn es um neue Technologien ging.
»Danke, Bob. Wir unterhalten uns später weiter«, sagte Dresner. Das Telefon-Icon verblasste und zog sich auf die Seite des riesigen Bildschirms zurück.
Er begann auf der Bühne auf und ab zu gehen, und die Anwesenden verfolgten jede seiner Bewegungen. »Ich habe mein Leben lang schlecht gesehen, und ich weiß, ich sehe lächerlich aus mit diesen dicken Gläsern, aber an Kontaktlinsen habe ich mich nie gewöhnen können.«
Er nahm seine Brille ab und ließ sie in der Hand baumeln. Der Bildschirm hinter ihm zeigte jedoch nicht plötzlich den Boden, wie man es vielleicht erwartet hätte, sondern weiterhin die Zuhörer, wenn auch verschwommen.
»Ich kapier’s nicht«, murmelte Janine, doch Smith schwieg. Er verstand sehr wohl, was hier passierte, wenngleich er es nur schwer glauben konnte.
Unleserliche Worte erschienen am oberen Bildschirmrand, und er verfolgte gebannt, wie sie allmählich schärfer wurden.
SEHKORREKTUR WIRD VORGENOMMEN
Es herrschte verwirrtes Schweigen, während Dresner ans Rednerpult zurückkehrte und sich aufstützte. »Also dachte ich mir, wenn ich die Geräusche ins Hörzentrum in meinem Gehirn schicken kann, warum soll ich dann nicht auch die Bilder ins Sehzentrum schicken können?«
Es herrschte Schweigen im Saal, während hundert Leute fieberhaft ihre Handys bearbeiteten: Jeder wollte der Erste sein, der die Botschaft von Dresners Wunderwerk in die Welt hinausschickte.
Kapitel fünf
Marrakesch
Marokko
Gerhard Eichmann rückte seinen Stuhl etwas weiter in den Schatten und versuchte erneut, einen hartnäckigen Schuhputzer abzuwimmeln. Ein paar strenge Worte eines Kellners hatten schließlich die gewünschte Wirkung, und der Junge schlängelte sich durch den dichten Verkehr, um sich nach einem willigeren Kunden umzusehen.
Obwohl Eichmann seit über zehn Jahren in Marrakesch lebte, besuchte er dieses Straßencafé zum ersten Mal. An den meisten Tischen saßen Einheimische und tranken Tee. Die einzigen hellen Gesichter, die er sah, gehörten einem französischen Paar, das mit dem überteuerten einheimischen Bier gegen die Mittagshitze ankämpfte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!