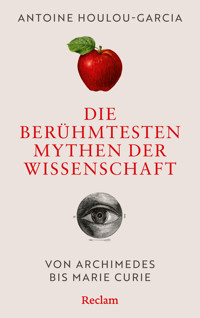
Die berühmtesten Mythen der Wissenschaft. Von Archimedes bis Marie Curie E-Book
Antoine Houlou-Garcia
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Antworten auf Fragen, die Sie sich vermutlich noch nie gestellt haben Einstein war schlecht in der Schule? Newton entdeckte die Schwerkraft, als ihm ein Apfel auf den Kopf fiel? Die Geschichte wissenschaftlicher Entdeckungen ist voller amüsanter Anekdoten – und viele von ihnen sind schlicht erfunden. Dieses Buch enttarnt die bekanntesten Mythen der Naturwissenschaft und erzählt, wie es wirklich war. Mit Kapiteln zu Archimedes, Pythagoras, Galileo Galilei, Albert Einstein, Marie Curie und vielen anderen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Antoine Houlou-Garcia
Die berühmtesten Mythen der Wissenschaft
Von Archimedes bis Marie Curie
Reclam
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
RECLAM Nr. 962438
2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Kosmos Design, Münster
Coverabbildung: Rawpixel / Creative Commons
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2025
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962438-9
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011505-3
reclam.de | [email protected]
Inhalt
»Wenn ich irre, kann ...
1 Ein kleiner Schlag auf den Kopf, eine große Theorie für die Menschheit
Die offizielle Version der Geschichte
Wer war der Erste?
Wofür der Apfel steht
Was der Apfel uns vergessen lässt
2 Heureka!
Ein Bad – und der Fall ist gelöst
Köstliche Anekdoten zuhauf
Archimedes und seine Legenden
Das (wahre) Rätsel des Archimedes
Was die Anekdoten verschleiern
Nach mir die Sintflut
3 Von der Forscherin zum Vorbild
Der Mythos Marie Curie
Der erste Nobelpreis – fast wäre sie leer ausgegangen
Der zweite Nobelpreis – fast hätte sie ihn abgelehnt
Die absurde Kehrseite der Amerikareise
Marie Curie und ihre Mythen
4 Ein Wohltäter der Menschheit und seine kleinen Experimente
Eine gewagte öffentliche Präsentation
Die ersten Tollwutimpfstoffe
Vergessene Vorgänger
Mythen und Lügen
5 Und er neigt sich doch!
Das Experiment auf dem Turm von Pisa
Galileis Experiment
Theorie und Beweis
Der Turm von Pisa als rhetorisches Kunststück
6 Eine ganz gewöhnliche Hexe?
Die wahre Geschichte (und die Legende)
Viele Facetten eines Symbols
Hypatias mathematisches Werk ist schwer zu fassen
Ein Mythos, der das Wichtigste übersieht
7 Die Erde ist platt wie eine Orange
Kopernikus und Galilei gegen die Kirche
Die Erde ist eine Kugel – schon lange!
Dass die Erde rund ist, war auch im Mittelalter bekannt
Wie der Mythos vom scheibengläubigen Mittelalter entstand
Der tiefere Sinn des Mythos
8 Gebrauchsanweisung für einen Tiefbegabten
Einsteins Spracherwerb
Der schlechte Schüler
Ein einfacher Beamter im Patentamt
Die Atombombe
Die Relativitätstheorie: Einstein gegen Poincaré?
Der Fall Mileva Marić
Das Los des Gelehrten: anerkannt, aber ungehört?
9 Somewhere, over the rainbow …
Schlecht erfunden
Die Kunst, Äpfel mit Birnen zu vergleichen
Die Theorie retten oder die Phänomene
Die Verwestlichung der Geschichte
10 Unter der Sonne Griechenlands
Die Griechen wissen sehr genau, in wessen Schuld sie stehen
Thales an der Pyramide
Der Satz des Pythagoras in Keilschrift
Ein hellenistischer Pränationalismus?
Das antike Griechenland und der Kampf der Kulturen
Die Naturwissenschaften sind genuin menschlich
11 Noch dreimal auf Holz geklopft
Barometer und Hufeisen
Der Traum eines Lebens
Femme de lettres – typisch Frau
Schlussbemerkung
»Wenn ich irre, kann es jeder bemerken, wenn ich lüge, nicht.«1
Johann Wolfgang Goethe
»Man muss beim Irrtum ansetzen und ihn in die Wahrheit überführen.
D. h. man muss die Quelle des Irrtums aufdecken, sonst nützt uns das Hören der Wahrheit nichts. Sie kann nicht eindringen, solange //wenn// etwas anderes ihren Platz einnimmt.
Einen von der Wahrheit zu überzeugen, genügt es nicht, die Wahrheit zu konstatieren, sondern man muss den Weg vom Irrtum zur Wahrheit finden.«2
Ludwig Wittgenstein
1Ein kleiner Schlag auf den Kopf, eine große Theorie für die Menschheit
»Als Newton einen Apfel fallen sah,
Fand er in diesem Apfel, (wie es heißt,
Verbürgen kann ich’s nicht,) er fand allda
Die Formel, die aufs deutlichste beweist,
Daß diese Welt (man nennt es ›Schwerkraft‹ ja)
In einem Wirbel ganz natürlich kreist;
Der erste Mensch seit Adam, dem’s auf Erden
Gelang durch Fall und Apfel groß zu werden.«3
Lord Byron
Es ist die berühmteste Anekdote in der Geschichte der Naturwissenschaften: Während Newton unter einem Baum ein Nickerchen hielt, fiel ihm ein Apfel auf den Kopf. Es folgte ein genialer Geistesblitz: Dass der Apfel nach unten fällt, liegt an der Schwerkraft der Erde, die den Apfel in Richtung ihres Mittelpunkts anzieht.
Es lässt sich gar nicht beziffern, wie oft diese Geschichte zitiert wurde. Auch die Newton-Statue im History of Science Museum der Universität Oxford bezieht sich darauf: Da steht er, die Hand am Kinn, den Blick gerichtet auf … einen Apfel zu seinen Füßen! Besagter Apfelbaum steht bis heute hinter einem kleinen Holzzaun im Garten des Gutshauses von Woolsthorpe, wo Newton 1642 zur Welt kam. Zwar wurde der Baum 1816 von einem Sturm niedergerissen, soll aber aus den erhaltenen Wurzeln neu emporgewachsen sein, womit er heute beinahe 400 Jahre alt wäre!
Und damit nicht genug: Von Newtons Baum wurden zahlreiche Ableger gezüchtet, weshalb seine »Klone« heute im Trinity College in Cambridge stehen, im Instituto Balseiro in Argentinien, im Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA sowie in der Pekinger Beihang University, um nur einige der um die dreißig weltweit verzeichneten Ableger zu nennen. Diese Geschichte ist so berühmt, dass sie als Titel oder Coverillustration auf zahllosen Büchern über Newton, die Gravitationstheorie, aber auch über die ganze Physik oder gleich die gesamte Wissenschaftsgeschichte erscheint.
Noch extravaganter: 2010 reiste ein Zweig des Apfelbaums an Bord der Raumfähre Atlantis zur Internationalen Raumstation ISS; Anlass war das 350. Gründungsjubiläum der Royal Society, der Newton seinerzeit vorsaß. 2014/15 schickte die Europäische Weltraumorganisation ESA Samen des Apfelbaums zur ISS, wo sie ein halbes Jahr lang herumschwebten, bevor sie auf die Erde zurückkehrten.
Und zuletzt sei erinnert (eine vollständige Aufzählung würde den Rahmen sprengen), dass das erste Logo des Apple-Konzerns Newton unter seinem Apfelbaum zeigte. Diese Zeichnung, später durch den berühmten angebissenen Apfel ersetzt, stammte von Ronald Wayne, einem der drei Gründer des Unternehmens neben Steve Wozniak und Steve Jobs.
Die offizielle Version der Geschichte
Doch woher stammt die Anekdote? Wer sich mit Geschichte beschäftigt, muss sich immer auf seine Quellen berufen können. Gibt es einen Text aus Newtons Lebenszeit, der von diesem Apfel berichtet?
Merkwürdigerweise ist der Erste, bei dem die Episode auftaucht, Voltaire. Offenbar hat er über Newtons Nichte Catherine Barton davon gehört. Noch erstaunlicher ist, dass er darüber in einem Werk berichtet, das er 1727, also in Newtons Todesjahr, auf Englisch verfasste:
»Der erste Gedanke zu seinem Gravitationssystem kam Sir Isaac Newton, als er bei einem Gang durch seinen Garten einen Apfel von einem Baum fallen sah.«4
Die Anekdote wird wie nebenbei erwähnt und liefert nur spärliche Informationen. Glücklicherweise findet sich eine sehr viel ausführlichere Version in den Memoirs of Sir Isaac Newton’s Life seines Freundes und Biographen William Stukeley:
»Am 15. April 1726 stattete ich Sir Isaac einen Besuch ab […]. Nach dem Abendessen gingen wir, da es warm war, in den Garten und tranken unseren Tee im Schatten der Apfelbäume, nur er und ich allein. Im Gespräch sagte er mir unter anderem, er sei jetzt an eben demselben Ort wie damals, als ihm der Begriff der Gravitation in den Sinn kam. ›Warum eigentlich fällt dieser Apfel immer senkrecht zu Boden?‹, dachte er bei sich selbst, als ein herabfallender Apfel ihn ins Grübeln brachte: ›Könnte er nicht auch zur Seite oder nach oben fallen? Der Grund ist sicherlich, dass die Erde ihn anzieht. In der Materie muss eine Anziehungskraft liegen. Und die maximale Anziehungskraft in der Materie der Erde muss im Erdmittelpunkt liegen, nicht auf einer der Seiten. Deswegen fällt dieser Apfel senkrecht beziehungsweise auf den Mittelpunkt zu. Wenn aber Materie Materie anzieht, muss das proportional zu ihrer Menge geschehen. Daher zieht der Apfel die Erde an und die Erde den Apfel.‹ […] So begann er schrittweise diese Eigenschaft der Gravitation auf die Bewegung der Erde und der Himmelskörper anzuwenden; er betrachtete ihre Abstände, ihre Größe, ihre periodischen Umdrehungen; er stellte fest, dass diese Eigenschaft gemeinsam mit einer Vorwärtsbewegung, in die sie von Beginn an gesetzt wurden, vollständig ihre kreisförmigen Bahnen erklärte, die die Planeten davon abhalten, aufeinander zu stürzen oder alle gemeinsam in einer Mitte zusammenzufallen. Und damit enthüllte er das Universum. Dies war der Ursprung dieser erstaunlichen Entdeckungen, durch die er die Philosophie auf festen Boden stellte und damit ganz Europa in Staunen versetzte.«5
Die Geschichte mit dem Apfel stammt also von Newton selbst. Allerdings mit der Einschränkung, dass ihm die Frucht nie auf den Kopf gefallen ist: Der Gedanke kam ihm einfach nur beim Betrachten eines fallenden Apfels (wie ja auch Lord Byron im oben zitierten Gedicht es darstellt). Damit müssen wir ein wichtiges Detail der Anekdote korrigieren, auch wenn wir damit die Illustratoren enttäuschen müssen, die so gerne mit der ihr eigenen Komik spielen.
Eine weitere Überlieferung dieser Begebenheit aus Newtons Leben finden wir bei John Conduitt, seinem Assistenten in der Königlichen Münze und Gatten von Catherine Barton. In den Notizen zu einer geplanten Biographie über Newton hält er fest:
»[…] als er sich im Jahr 1665 wegen der Pest auf sein Landgut zurückzog, dachte er erstmals an sein System der Gravitation, das er entdeckte, als er beobachtete, wie ein Apfel von einem Baum fiel.«6
Sowie an einer anderen Stelle:
»1666 zog er sich erneut aus Cambridge zu seiner Mutter in Lincolnshire zurück. Während er gedankenversunken im Garten spazieren ging, kam ihm in den Sinn, dass die Schwerkraft (die einen Apfel vom Baum auf den Boden befördert) nicht auf einen bestimmten Abstand von der Erde begrenzt ist, sondern dass diese Kraft viel weiter reichen muss, als gewöhnlich angenommen. Warum nicht hinauf bis zum Mond, überlegte er im Stillen, und wenn das der Fall ist, so muss sie seine Bewegung beeinflussen und ihn vielleicht auf seiner Kreisbahn halten, woraufhin er eine Berechnung anstellte, welches die Auswirkungen dieser Annahme wären […].«7
Halten wir also fest: Newton selbst berichtet 1726, ein Jahr vor seinem Tod, eine Anekdote aus dem Jahr 1665/66, die demnach bereits sechzig Jahre zurückliegt. Ist es nicht erstaunlich, dass er sie nicht schon früher erzählt hat? Doch weder in seinen Briefen noch in seinen Notizbüchern findet sich eine Spur davon. Richtig ist, dass Newton sich seit (mindestens) 1664 mit der Schwerkraft beschäftigte, wie ein Heft mit Notizen und Berechnungen aus dieser Zeit bezeugt;8 vor allem aber setzte er sich mit der Frage ab 1684 auf Bitten von Christiaan Huygens auseinander. 1687 veröffentlichte er dann seine große Abhandlung Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Die mathematischen Prinzipien der Physik), die als eines der zentralen Werke der Wissenschaftsgeschichte gilt; darin legt er insbesondere das allgemeine Gravitationsgesetz dar.
Wer war der Erste?
Wie jede wissenschaftliche Arbeit reiht sich auch die von Newton in eine Geschichte mit Vorgängern (unter anderen Roger Bacon, Ismaël Boulliau, Johannes Kepler und Giovanni Alfonso Borelli) und Zeitgenossen ein, die manchmal als Rivalen empfunden werden. Ganz besonders gilt das für Gottfried Wilhelm Leibniz und Robert Hooke.
Newton bringt in seinen Principia eine von ihm selbst entwickelte mathematische Technik zur Anwendung, die wir heute als Infinitesimalrechnung bezeichnen (es geht also um sehr kleine Größen).9 Nun entwickelt aber genau in der Zeit, in der Newton seine Methode einführt, Leibniz ein sehr ähnliches Verfahren. Der größte Unterschied besteht darin, dass Leibniz seine Ergebnisse bereits 1684, also drei Jahre vor der Publikation von NewtonsPrincipia, veröffentlichte.10
Dieses bahnbrechende Gesetz der klassischen Physik lässt sich in zwei Sätzen zusammenfassen: Zwei Körper A und B ziehen sich gegenseitig mit gleicher Kraft an. Diese Kraft ist proportional zum Produkt der beiden Massen und umgekehrt proportional zum Quadrat ihres Abstands.
Dieses Gesetz erklärt zum Beispiel, warum ein Apfel senkrecht zur Erde fällt oder wie die Anziehungskraft von Mond und Sonne sich auf die Gezeiten auswirkt. Es erklärt auch, warum der Mond andauernd auf die Erde »fällt« und doch am Himmel bleibt, so wie eine Kanonenkugel, die mit ausreichender (nicht zu hoher) Geschwindigkeit vom Himalaja aus abgeschossen würde, in eine Umlaufbahn geraten und dauerhaft auf die Erde »fallen« würde, ohne je einzuschlagen – dank der Schwerkraft. Dieses Gesetz, so notiert Stephen Hawking, hätte es Newton sogar erlaubt, die Ausdehnung des Universums vorauszusagen (wenn er sich ein begrenztes Universum mit einer begrenzten Anzahl von Sternen vorgestellt hätte).11 Und schließlich beweist Newton damit exakt das 1609 von Johannes Kepler formulierte Gesetz, nach dem die Umlaufbahnen der Planeten nicht kreisförmig, sondern elliptisch verlaufen: Kepler hatte das aus seinen Beobachtungen geschlossen, Newton lieferte den mathematischen Beweis.
Zumindest anfangs ist die Frage der Priorität kein großes Problem: In der ersten Ausgabe der Principia von 1687 hält Newton fest, er habe vor zehn Jahren mit Leibniz, einem »sehr kundigen Geometer« und »sehr illustren Manne«,12 korrespondiert, und beide hätten festgestellt, dass ihre Methoden nahezu identisch waren. Mit dieser sogenannten Scholie, einer erklärenden Randbemerkung, konstatiert Newton also, dass die beiden Männer gleichzeitig dasselbe herausgefunden haben.
Sehr bald aber wird Leibniz von Mitgliedern der Royal Society des Plagiats beschuldigt: Die Frage der Priorität ist eben auch eine Frage des Nationalstolzes. Tatsächlich verfasst Newton, ebenfalls Mitglied der Royal Society, selbst ganze Passagen mit heftigen Vorwürfen gegen Leibniz für eine 1711 von der Gesellschaft veröffentlichte Studie, die nachweisen soll, dass die Erfindung der Infinitesimalrechnung allein auf Newton zurückgeht.
Daraufhin ändert Newton in der zweiten Ausgabe der Principia von 1713 seine Scholie ab und erklärt, seine Methode unterscheide sich von der Leibniz’schen in einem bedeutenden technischen Punkt, und in der dritten Ausgabe von 1726 verschwindet der Name Leibniz ganz.13 Durchsetzen wird sich natürlich diese dritte Ausgabe.
Es ist nicht das erste Mal, dass im Lauf von Wiederauflagen ein Name aus der Wissenschaftsgeschichte getilgt wird (das werden wir auch bei Kopernikus sehen, vgl. S. siehe hier) – und zwar immer mit dem Ziel, den gesamten Ruhm selbst einzustreichen. Hier also stellt sich nun Newton als alleiniger Erfinder der Infinitesimalrechnung dar.
Dabei ist diese Auseinandersetzung weder die einzige noch die wichtigste: Noch bedeutender ist der Prioritätsstreit mit Robert Hooke, denn er betrifft das Gravitationsgesetz selbst. Ganze Bücher wurden darüber geschrieben. Wir wollen hier gar nicht entscheiden, ob Hooke das Gesetz nun vor Newton entdeckte oder nicht, sondern lediglich fragen, welche Wirkung diese Kontroverse auf Newton hatte. Genau das nämlich wird uns zu der Geschichte mit dem Apfel zurückführen.
Ganz knapp zusammengefasst: Edmond Halley (nach dem später ein berühmter Komet benannt wurde) stattete Newton im Sommer 1684 einen Besuch ab, um ihm ein Problem aus dem Kontext der planetaren Umlaufbahnen vorzulegen, für das er selbst und Hooke14 keine Lösung fanden. Zufällig hatte aber Newton genau dieses Problem in seinen mathematischen Arbeiten gewissermaßen bereits gelöst. Er begann mit der Niederschrift seiner Principia. Halley verfolgte die Entstehung des Werks aus der Nähe, war begeistert und präsentierte einige Ergebnisse bereits vor der Veröffentlichung des Werks vor der Royal Society. Hooke wiederum, der Sekretär der Gesellschaft war, stellte schockiert fest, dass Newton sich die Idee der allgemeinen Gravitationstheorie zuschrieb und für ihre Berechnung die Umkehrung vom Quadrat der Entfernung verwendete, die Hooke ihm einst vorgeschlagen hatte.
Umgekehrt befand Newton, er habe nicht nur Hooke gar nicht gebraucht, um seine Idee zu entwickeln (deren Gültigkeit für verschiedene physikalische Phänomene bereits seit dem Mittelalter bestätigt war), sondern Hooke sei außerdem gar nicht in der Lage, das Ergebnis mathematisch zu beweisen; ebendiese Leistung habe aber er, Newton, erbracht.15
Abgesehen von dieser Argumentation ist es interessant zu beobachten, wie emotional Newton reagierte: Er war so erschüttert von Hookes Einlassungen, dass er sogar erwog, das dritte Buch der Principia zu streichen, in dem er sich dem Gravitationsgesetz und den kosmologischen Aspekten widmete. Außerdem überlegte er, den Titel zu ändern und sein Werk De Motu corporum libri duo (Zwei Bücher über die Bewegung der Himmelskörper) zu nennen.16
Im Übrigen bestand die Rivalität zwischen Hooke und Newton schon seit Jahren (sie hatten sich bereits zu verschiedenen wissenschaftlichen Themen in den Haaren gelegen), und im Unterschied zu Leibniz lebte Hooke ebenfalls in England. So ging es den beiden Gelehrten um den intellektuellen Vorrang im Land, aber auch darum, politisch zu punkten (Hooke war Sekretär der Royal Society, Newton später ihr Präsident).
Wofür der Apfel steht
Was Leibniz betraf, lagen die Dinge im Grunde ziemlich einfach: Ganz England, das heißt in Newtons Augen die Royal Society, stand auf seiner Seite. Er brauchte lediglich in den späteren Ausgaben des Buchs den Namen Leibniz zu tilgen. Bei Hooke aber, der selbst ein bedeutendes Mitglied der Gelehrtengesellschaft war, war die Lage komplexer und zugleich heikler, denn der Streit wurde nicht nur schriftlich ausgetragen, sondern auch im direkten Gegenüber.
Nun fällt die erste bestätigte Erwähnung der Geschichte mit dem Apfel in das Jahr 1726, die Auseinandersetzung mit Hooke hatte aber schon vierzig Jahre früher begonnen. Wahrscheinlich hatte Newton bereits kurz vor 1726 mit seiner Nichte Catherine Barton darüber gesprochen, die die Anekdote an Voltaire weitergab. Vor allem aber hätte Newton die Geschichte, wenn sie sich ganz so zugetragen hätte, doch wohl bereits vorher irgendwann verwendet; denn damit hätte er beweisen können, dass er alles schon viele Jahre früher ganz allein herausgefunden hatte und dass Hooke keinerlei Verdienst zukam.
Dass Newton diese Apfelgeschichte kurz vor seinem Lebensende hervorholt, aber auf seine jungen Jahre datiert, dürfte darauf hindeuten, dass er einen Beweis für seine Genialität liefern möchte und vor allem dafür, dass er niemandem etwas schuldig ist. 1726 sind beide Prioritätsfragen geklärt: Leibniz taucht in der dritten Ausgabe der Principia nicht mehr auf, und dank der Apfelgeschichte gerät auch Hooke aufs historische Abstellgleis.
In Zeiten der sozialen Netzwerke und der nie verstummenden Nachrichtenkanäle wissen wir besser denn je, dass ein Bild stärker ist als tausend Worte: Es prägt sich fest und dauerhaft im Gedächtnis ein. Genau das ist Newton mit dem Apfel gelungen: Um die Konkurrenz auszuschalten und an seinem eigenen Mythos zu arbeiten, schuf er ein Narrativ von solcher Schlagkraft, dass es bis heute das wichtigste Symbol der Wissenschaftsgeschichte geblieben ist.
Damit eine Story sich aber so gut verkauft, müssen die Kunden auch bereit sein, sie zu glauben. Diese Kunden sind zunächst die Wissenschaftler und Philosophen, die in dieser Geschichte ein Gleichnis für die Naturwissenschaft an sich sehen: Ein Mensch wird Zeuge eines Naturphänomens (ein Apfel fällt vom Baum) und staunt darüber. Diese Verwunderung ist, so notiert bereits Aristoteles, fundamental:
»Denn Verwunderung war den Menschen jetzt wie vormals der Anfang des Philosophierens, in dem sie sich anfangs über das nächstliegende Unerklärte verwunderten, dann allmählich fortschritten und auch über Größeres Fragen aufwerfen, z. B. über die Erscheinungen an dem Mond und der Sonne und den Gestirnen und über die Entstehung des Alls.«17
Die Kunden sind aber auch die einfachen Bürger. Wir mögen die Vorstellung vom Genie, dem »Berufenen«. In der Naturwissenschaft wie in der Politik, in der Religion oder im Krieg richten wir unsere gesammelte Bewunderung gerne auf eine einzelne Person, einen Helden, einen Propheten. Nicht nur, weil wir die Dinge gerne vereinfachen (bis hin zur Verfälschung), sondern auch wegen unserer natürlichen Sehnsucht nach Helden gefällt uns die Vorstellung, in der Geschichte (und besonders in der der Wissenschaft) gäbe es Wendepunkte und Umbrüche, für die sich Ort, Zeitpunkt und vor allem die Protagonisten ganz präzise bestimmen lassen.
In ihrer volkstümlichen Version, in der der Apfel Newton auf den Kopf fällt, schafft es diese Anekdote paradoxerweise zugleich, den genialen Wissenschaftler (der doch gerade als höheres Wesen gilt) zu entsakralisieren – so wie einst Thales, von dem schon in der Antike erzählt wurde, er habe beim Gehen stets den Kopf in den Sternen gehabt und sei daher einmal in einen Brunnen gefallen.18 Dass wir über diese Menschen, die in unserer Vorstellungswelt zu ehrfurchterregenden Geistesgrößen mutieren, auch lachen können, hat etwas Beruhigendes. Ja, sie sind unerreichbar in ihrer Genialität, aber sie erdrücken uns doch nicht, weil sie sich in all ihrer Intelligenz am Ende selbst lächerlich machen.
Außerdem weckt dieser konkrete, komische Aspekt auch Hoffnung: »Falls mir einmal ein Apfel auf den Kopf fällt, werde ich vielleicht auch ein Genie!« Genau deshalb wurden in so vielen Universitäten weltweit so viele Ableger von Newtons Baum gepflanzt (obwohl man wusste, dass der Apfel Newton nicht auf den Kopf, sondern vor seinen Augen auf den Boden gefallen war). Sie gaukeln eine symbolische Verbindung zu dem vor, was (angeblich) einem Genie als Inspirationsquelle gedient hat und somit auch uns anderen einen genialen Geistesblitz eingeben könnte. Dazu müssten wir nur Zeuge eines Phänomens wie des fallenden Apfels werden. So schreibt die Universität York, ebenfalls Besitzerin eines der Baumklone, auf ihrer Website:
»Unser Baum in der University of York bleibt im Jetzt verwurzelt, erinnert uns aber daran, dass es zu außerordentlichen Entdeckungen führen kann, wenn man das Konventionelle infrage stellt. Unser Apfelbaum ist ein Stück Geschichte, doch Isaac Newtons Denken findet bis heute Nachhall.«19
Was der Apfel uns vergessen lässt
Obwohl die Universität York das behauptet, hat Newton »das Konventionelle« keineswegs über die Maßen »infrage gestellt«. Vielmehr bestand seine Meisterleistung darin, zahlreiche Ideen und Vermutungen, die zu seiner Zeit existierten und an denen seit Langem gearbeitet wurde, in einer mächtigen Gesamtstruktur zusammenzufassen. Was die Geschichte vom Apfel eher verdeckt (und genau das war Newtons Absicht), ist die Tatsache, dass Wissenschaft vor allem im Lesen, Debattieren, im langsamen Durchdenken, im Berechnen und in der Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Theorien besteht. Das einsame Genie, das ganz allein eine Theorie aufstellt, ohne etwas von seinen Vorgängern und Konkurrenten gelesen zu haben, gibt es nicht.
Die Geschichte vom Apfel verweist also auf die Brutalität des wissenschaftlichen Milieus – bis heute und vielleicht sogar mehr denn je, weil Forschung heute nach den Regeln des Markts funktioniert: So mancher will sich fremde Verdienste aneignen (das kann man von Hooke genauso sagen wie von Newton), aus Stolz, dem Streben nach Ruhm und Anerkennung, der Karriere zuliebe oder um sich einen Platz in der Geschichte zu sichern.
Dabei ist Wissenschaft nie der Verdienst eines einsamen Genies, sondern sehr vieler Menschen, von denen die Geschichte beim breiten Publikum am Ende nur einige wenige Namen behalten wird, so wie wir in der Schule bis heute die Abfolge von Königen und Schlachten auswendig lernen, obwohl die Geschichte sehr viel reicher – und sehr viel interessanter – ist als das.
Sollte die Anekdote vom Apfel entgegen aller Wahrscheinlichkeit aber doch wahr sein, so hätte Newton von dem Moment, in dem er angeblich den mythischen Apfel fallen sah, bis zur Fertigstellung und Veröffentlichung seiner darauf fußenden Arbeit über zwanzig Jahre gebraucht. In unserer Vorstellung hingegen (und auch das wollte Newton uns wohl suggerieren) war der Apfel kaum gefallen, als er bereits sein System fertig entworfen und all seine Gleichungen aufgestellt hatte.
Schließlich verdeckt der Apfel einen für die Wissenschaft entscheidenden Punkt, der auch charakteristisch für die Auseinandersetzung zwischen Hooke und Newton ist. Gibt man keinem von beiden recht, sondern konzentriert sich auf das, was Newton getan hat und Hooke nicht zu tun wusste, so kommt man zu dem, was Alexis Clairaut 1756 in einer Beilage zur ersten französischen Übersetzung der Principia durch Émilie du Châtelet (von ihr wird in Kapitel 11 die Rede sein, vgl. S. siehe hier) notierte:
»Das Beispiel von Hooke und von Kepler zeigt, wie groß der Abstand zwischen einer erahnten und einer erwiesenen Wahrheit ist und zu wie wenig die größten Geister der Wissenschaft dienlich sind, wenn sie sich nicht mehr von der Geometrie leiten lassen.«20
2Heureka!
»Die Lösung überkam ihn, als er in der Badewanne lag. Er sprang auf, rannte durch die Straßen in Richtung Palast und schrie: Heureka! Heureka! (Ich habe es gefunden, ich habe es gefunden!) Wenn wir wüssten, welcher Tag das war, so sollten wir ihn feiern als Geburtstag der mathematischen Physik; erwachsen wurde diese Wissenschaft, als Newton sich in seinen Garten setzte.«21
Alfred North Whitehead
Heureka: der altbekannte Ausruf des Archimedes beim Sprung aus der Badewanne, der zum Synonym für einen Geniestreich geworden ist, eine plötzliche Erleuchtung angesichts eines Problems, aber auch allgemeiner für die Bedeutung der Intuition beim wissenschaftlichen Fortschritt.
Wie der große Mathematiker, Logiker und Philosoph des beginnenden 20. Jahrhunderts Alfred Whitehead es hervorhebt, sind das Heureka des Archimedes und Newtons Apfel die beiden wichtigsten Kristallisationspunkte in der Geschichte der Physik als exakter, auf mathematische Strenge gegründeter Wissenschaft.
Archimedes war ein leidenschaftlicher Forscher, der in Gedanken ständig Probleme löste. Der Drang nach Wissen trieb ihn sein Leben lang an, und glaubt man dem griechischen Historiker Plutarch, trieb sie ihn gar in den Tod:
»Dieser [Archimedes] betrachtete eben für sich allein eine geometrische Figur und hatte auf diese seine Gedanken und seine Augen so sehr gerichtet, daß er weder das Hin- und Herlaufen der Soldaten noch die Einnahme der Stadt bemerkte. Auf einmal trat ein Soldat vor ihn und befahl, ihm sogleich zu Marcellus zu folgen. Archimedes wollte nicht eher, als bis er das Problem aufgelöst und zum Beweise gebrachte hätte. Darüber geriet jener sehr in Zorn, zog das Schwert und tötete ihn auf der Stelle.«22
Ob in der Badewanne oder im Angesicht eines römischen Schwerts, Archimedes war beseelt von dieser enthusiastischen Ruhelosigkeit, die einen treibt, eine Lösung zu finden, einen Beweis zu vollenden, eine neue Methode zu entwickeln. Plutarchs Beschreibung hat zahlreiche Gemälde und Illustrationen inspiriert, denn sie zeigt uns einen Archimedes von erhabener intellektueller Größe im Vergleich zu gewöhnlichen Sterblichen wie etwa dem Soldaten, der ihn angreift (zu den Gründen dafür später mehr); die Anekdote mit der Badewanne dagegen ist zu einem der großen Symbole der Wissenschaftsgeschichte geworden und inspirierte den Titel für diverse populäre Sachbücher zur Physik.
Doch woher stammt sie? Und warum eigentlich steigt Archimedes plötzlich aus der Badewanne und läuft nackt drauflos wie ein Verrückter?
Ein Bad – und der Fall ist gelöst
Archimedes lebte im 3. Jahrhundert v. Chr. in Syrakus auf Sizilien. Beherrscht wurde die Stadt von Hieron, einem »Tyrannen« – der Titel ist heute nicht ganz einfach zu übersetzen und bedeutete im Grunde nur (und ohne negativen Beigeschmack) so etwas wie »König«. Von dem berühmten Heureka berichtet der römische Architekt Vitruv (1. Jh. v. Chr.), der als Meister seines Faches gilt und nach der Wiederentdeckung seiner Abhandlung De Architectura die gesamte Renaissance inspirierte:
»Obwohl aber Archimedes viele verschiedene, bewundernswerte Entdeckungen gemacht hat, scheint von allen diese, von der ich nun berichte, auch mit unendlich großem schöpferischem Geist erarbeitet zu sein. In Syrakus nämlich hatte sich Hieron der Jüngere zu einer starken Königsmacht emporgeschwungen. Als er nach seinen Siegen den unsterblichen Göttern in einem Heiligtum einen goldenen Kranz als Weihgabe niederzulegen beschlossen hatte, verdingte er die Anfertigung um einen Arbeitslohn und wog dem Unternehmer das Gold genau nach Gewicht zu. Dieser legte zur gegebenen Zeit das schön handgearbeitete Werkstück zur Abnahme vor, und er schien das Gewicht des Kranzes genau abgeliefert zu haben. Später wurde Anzeige erstattet, es sei Gold weggenommen und dem Kranz ebensoviel Silber beigemischt worden. Hieron war darüber erbost, daß er betrogen war. Da er jedoch kein Mittel ausfindig machen konnte, wie er die Unterschlagung nachweisen konnte, bat er Archimedes, er sollte es übernehmen, sich darüber Gedanken zu machen. Während dieser darüber nachdachte, ging er zufällig in eine Badestube, und als er dort in die Badewanne stieg, bemerkte er, daß ebensoviel wie er von seinem Körper in die Wanne eintauchte, an Wasser aus der Wanne herausfloß. Weil (dieser Vorgang) einen Weg für die Lösung der Aufgabe gezeigt hatte, hielt er sich daher nicht weiter auf, sondern sprang voller Freude aus der Badewanne, lief nackend nach Haus und rief mit lauter Stimme, er habe das gefunden, was er suche. Laufend rief er nämlich immer wieder griechisch: ›Ich hab’s gefunden! Ich hab’s gefunden!‹«23
Hier schreibt Vitruv, wie bei den Römern üblich, direkt auf Griechisch und nicht auf Lateinisch, was Archimedes rief: »εὕρηκα«, das klingt wie »heureka« und tatsächlich bedeutet: »Ich hab’s gefunden.« Und was er da gefunden hatte, war eine kriminaltechnische Ermittlungsmethode zur Überführung des Handwerkers.
Jeder weiß, dass ein Kilogramm Federn ein sehr viel größeres Volumen besitzt als ein Kilogramm Blei. Bei Silber und Gold ist es im Prinzip dasselbe. Archimedes goss also zwei Barren mit demselben Gewicht (nämlich dem Gewicht der Krone), einen aus Gold und einen aus Silber. Er tauchte sie nacheinander in einen Behälter mit Wasser und sah, dass der Silberbarren den Wasserspiegel stärker ansteigen ließ als der Goldbarren. Daraus konnte er ableiten, um wie viel größer bei gleichem Gewicht das Volumen des Silberbarrens ist.





























