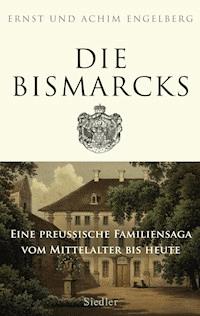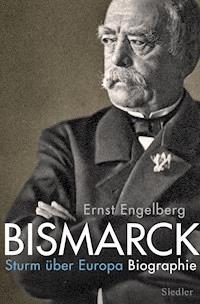Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1 – Klaus von Bismarck und das Machtspiel Karls IV.
Stendaler Patrizier
Schlossgesessener Bürger-Aristokrat
KAPITEL 2 – Reformation und Gegenreformation
Im Windschatten der Geschichte
Die erste Revolution der Bourgeoisie
Machtspiele im Staube Brandenburgs
Erzwungener Tausch
Nach dem Frieden, vor dem Krieg
Dunkle Wolken über den Bismarcks
KAPITEL 3 – Im Dreißigjährigen Krieg
Streiflichter aufs große Morden
Eine Familie in Kriegswirren
KAPITEL 4 – In Europa nach dem Westfälischen Frieden
Im zersplitterten Land
Im blutigen Spiel großer Mächte
Landleben I
KAPITEL 5 – Glanz und Elend des Absolutismus
Könige in Preußen
Im Zeichen der Vernunft
Im Zeichen des Militarismus
Mit der Sicherheit des Gutsbesitzes
KAPITEL 6 – In revolutionärer Zeitenwende
Geistige Höhenflüge, aber was kam unten an?
Große Revolution der Franzosen und die Bismarcks im Krieg
Landleben II
Residenzleben
Preußens Fall und Aufstieg
Die Bismarcks während des Beginns der Revolution von oben
Kampf mit Napoleon
KAPITEL 7 – Revolutionär von oben: Otto von Bismarck
Urpreuße in der Zeitenwende
Kindheitsmuster
Landleben III
Und die Frauen
Ein Gutsherr geht in die Politik
Eheleben und Kinder
Ministerpräsident und Außenminister
Lotse im Sturm
Familienleben und -drama
Außenpolitik und Sturz
Rastlos im Ruhestand
KAPITEL 8 – Der Kaiser verlässt den Raum
Erster Weltkrieg und Revolution
Im Banne des Bismarck-Mythos
Weltwirtschaftskrise
KAPITEL 9 – Der Führer betritt die Bühne
Die Enkel des Reichskanzlers
Hochzeit mit Stahlhelm
Traumwein und Gift
KAPITEL 10 – Fall und Aufstieg
Vertreibung und Aufbruch
Im geteilten Europa
Medienrevolution
Verbrechen der Wehrmacht
Ein Ende und doch keines
Nachwort
ANHANG
Personenregister
Bildnachweis
Copyright
Bild 16
KAPITEL 1
Klaus von Bismarck und das Machtspiel Karls IV.
Stendaler Patrizier
Lang ist die Ahnenreihe der Bismarcks, bis sie sich im Schatten der Vergangenheit verliert. Der Erstgenannte in diesem bislang weit über siebenhundert Namen umfassenden Stammbaum ist Herbordus de Bismarck.1 Einen Lichtstrahl ins Dunkel bringt eine Urkunde aus dem Jahr 1270, die ihn als einen der zwei Magister der Gewandschneidergilde zu Stendal ausweist. Über sein Geburtsdatum herrscht Unklarheit, als sein Todestag ist der 9. Juni 1280 angegeben.
Ob die Bismarcks bereits bei der Gründung Stendals um 1160 als Ministeriale, also als dienende Adelsleute des brandenburgischen Markgrafen, in diese Stadt kamen, bleibt ungewiss; ausgeschlossen ist es nicht, dass sie zu den Burgmannen der vormaligen Burg Stendal gehörten. Diese Geschlechter der städtischen Ministerialen verloren erst allmählich die Merkmale ihrer sozialen und persönlichen Unfreiheit.
Wie viele andere wuchsen die Bismarcks werkend und schachernd in die Gruppe der Händler und Patrizier hinein. Immer häufiger erscheinen sie als führende Mitglieder der Gewandschneidergilde und des Stadtrats, 1309 und 1312, erst recht in den folgenden dreißig Jahren bis 1345, ihrem merkwürdigen Schicksalsjahr, in dem sie vom brandenburgischen Markgrafen mit dem Schloss Burgstall im Süden der Altmark belehnt werden. Bald danach verjagten sie rebellierende Handwerker aus Stendal.
Was bedeutete es, Mitglied der Gewandschneidergilde zu sein? In einer landesherrlichen Verfügung für Frankfurt an der Oder, die um 1287 erlassen wurde, hieß es ebenso anschaulich wie präzise: »Wer Tuch macht, soll es nie ausschneiden; wer es ausschneidet, soll nie Tuch machen.«2 Damit wurde für den östlichen Teil der Mark Brandenburg nur das übernommen, was man Jahrzehnte vorher bereits für den wesentlichen Teil des Landes, die Altmark, festgelegt hatte. Schon 1231 war den Gewandschneidern in Stendal das Alleinrecht auf Tuchschnitt und Verkauf gewährt worden. Dieses Recht beförderte ein feudales Ausbeutungsverhältnis zwischen Schneidern und Tuchmachern. Die Gewandschneider verhielten sich gegenüber den Produzenten der Ware, den Tuchmachern, fortan nämlich äußerst schroff und zwangen die Weber, ihnen einen Teil des produzierten Warenwerts zu überlassen, und sicherten sich so mit Hilfe des Verkaufsmonopols einen Gewinn, der ihnen ökonomisch gar nicht zustand. Indem sie das alleinige Recht zum Warenverkauf erhielten, wurden sie im 13. Jahrhundert endgültig zu Tuchhändlern.
Die Ausbeutungs- und Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Tuchhändlern und Tuchmachern waren so ausgeprägt, dass sie sich ständisch-rechtlich verfestigten. Als der Stendaler Tuchmacher Arnold Portitz und sein Sohn im Jahr 1325 in die Gewandschneidergilde eintraten, mussten sie vorher ihrem Handwerk abschwören. Arnold von Portitz, der sich oft mit Rule (Rudolph) von Bismarck zusammen zeigte, wurde schon ein Jahrzehnt später Ratsherr und 1344 Aldermann der Gewandschneidergilde.3
Der robuste Kampf um Gebote und Verbote lohnte sich für die Tuchhändler, da infolge technischer Neuerungen in der Textilherstellung (Trittwebstuhl, Walkmühle und Handspinnrad) und des steigenden Bedarfs große Gewinnchancen im Textilhandel lockten.
Der außerökonomische Zwang, den die Stendaler Gewandschneider mit juristischen Mitteln ausübten, schuf ein Monopol von feudalem Zuschnitt. Es war ein vom übergeordneten Feudalherrn abgesegnetes Privileg, das die Gewinnspanne der Gewandschneider zu Lasten der Weber von vornherein garantierte und – im Großen und Ganzen – gleichsam fixierte; die Größe des Gewinns war nicht dem freien Spiel von Angebot und Nachfrage auf dem Markt überlassen. In Ansätzen mochte ein solches allenfalls im Fernhandel wirksam gewesen sein.
Als Groß- und Fernhändler legten die Stendaler Bismarcks – wie ihresgleichen – einen Großteil ihrer beträchtlichen Gewinne im Lehnsbesitz auf dem Lande an, was ihnen wiederum gestattete, von den Bauern Grundrenten in Form von Naturalien und Geld zu verlangen. Somit waren sie auch als Lehnbürger mit dem ökonomischen, sozialen und politischen Geflecht des Feudalismus verwoben.
Bild 14
Am 15. Juni 1345 wurden die Bismarcks mit Schloss Burgstall im Süden der Altmark belehnt, das sich bis zum 16. Dezember 1562 in ihrem Besitz befand.
Um 1300 lief die etwa anderthalb Jahrhunderte währende Bewegung der Städtegründungen aus; von nun an differenzierten sich die sozialen Gruppierungen weiter und entfalteten sich oft in turbulenter Weise. Dabei entwickelte sich eine so ausgeprägte Arbeitsteilung zwischen Land und Stadt und in der Stadt selbst, dass Geld allgemeines Austauschmittel werden musste. Dennoch konnten die Ware-Geld-Beziehungen die Naturalwirtschaft noch lange nicht vollkommen zurückdrängen, geschweige denn den Feudalismus sprengen; vielmehr waren feudale Gewalten selbst Akteure in diesen Beziehungen, kämpften um Geld und manipulierten damit. Das alles schuf innerhalb des Wirrwarrs feudaler Kräftekonstellationen zusätzliche Komplikationen. Die unterprivilegierten Handwerker schufen die Werte, die privilegierten Kaufleute häuften das Geld an.
Die patrizischen Kaufleute und Lehnsbesitzer personifizierten den Übergang von der Natural- zur Geldwirtschaft; indem sie auf der Basis der zunehmenden Arbeitsteilung die Ware-Geld-Beziehungen förderten, modifizierten sie die feudale Produktion. Das führte im 14. Jahrhundert dazu, dass der Feudalismus in ganz Europa auf diese oder jene Weise eine Krise durchmachte, keine existenzielle, aber eine der Anpassung an neue ökonomische, soziale und politische Entwicklungen. Die überfälligen Umschichtungen in und zwischen den Machtpositionen der verschiedenen Gewalten, von denen keine mehr hinreichend selbstsicher und gesichert war, vollzogen sich oft genug in turbulenten Kämpfen.
Sichtbarster Ausdruck der allgemeinen, alles durchdringenden Krise war der erneut ausbrechende Kampf zwischen Papst und Kaiser, also zwischen den alten, teils realen, teils fiktiven Universalgewalten, aber auch zwischen diesen und den neu heraufkommenden Zentralgewalten in den Ländern Europas. Der Fortschritt ruhte ökonomisch auf der städtisch-gewerblichen Produktion im Übergang von der Natural- zur Geldwirtschaft, politisch zeigte er sich im Drang zur Beherrschung der feudalen Zersplitterung durch königliche oder fürstliche Zentralisation.
Mit der Krise, die in Deutschland und ganz Europa immer größere Dimensionen annahm und bedrohliche Verwicklungen heraufbeschwor, hatten auch Patrizier wie die Stendaler Bismarcks fertig zu werden; sie konnten sich nicht darauf beschränken, die feudale Herrschaft nur in ihrer Stadt und ihren Lehnsbesitzungen auszuüben, so unumgänglich dies für die Mehrung ihres Reichtums und für die Verteidigung ihres Patriziats war. Unweigerlich wurden sie in die altmärkisch-brandenburgische, ja sogar in die Reichspolitik hineingezogen. Das begann mit dem Aussterben der askanischen Dynastie in der Mark Brandenburg.
Woldemar, der letzte Markgraf des askanisch-brandenburgischen Hauses, hinterließ bei seinem Tod 1319 ein innerlich zersetztes Herrschaftssystem. Jene Vergangenheit der Askanier, die als ruhmwürdig galt, war längst dahin. Die lieben Nachbarn und feudalen Herrschaftsbrüder aus Sachsen-Wittenberg, Mecklenburg, Pommern, Schlesien und Böhmen nutzten die vorübergehende Herrenlosigkeit und andauernde Schwäche in der Mark Brandenburg aus, um Herrschaftsrechte in diesen oder jenen Gebieten, etwa in der Prignitz, der Uckermark und der Neumark, an sich zu reißen; auch die Altmark mit Stendal, ihrer wichtigsten Stadt, war Objekt der Begehrlichkeit freundnachbarlicher Feudalherren.
Unter diesen Umständen war es so ruchlos auch wieder nicht, dass der König und bald auch zum Kaiser gekrönte Ludwig der Bayer die Markgrafschaft Brandenburg im Jahre 1323 zum erledigten Reichslehen erklärte und seinem damals allerdings erst siebenjährigen gleichnamigen Sohn übertrug, der solchermaßen Markgraf Ludwig der Brandenburger wurde, später Ludwig der Älteste genannt. Als oberster Lehnsherr dieses Territoriums hatte er die Aufgabe, die zentrifugalen Kräfte, die dem Feudalismus eigen sind, zusammenzuhalten. Aber der junge, noch unter Vormundschaft stehende Markgraf war noch gar nicht Herr des ihm von Reichs wegen überantworteten Gebietes, und die lehnsrechtlichen Besitzverhältnisse waren derart verworren, dass bei den nach 1323 anhebenden Verhandlungen, Vertragsabschlüssen und Vertragsbrüchen die sich streitenden, versöhnenden und erneut streitenden Parteien immer wieder mit Fiktionen, ja ausgemachten Schwindeleien arbeiteten.
All diese Auseinandersetzungen beschränkten sich nicht auf die Mark Brandenburg, vielmehr war sie mit der Altmark nun tief in die unmittelbare Reichspolitik verwickelt. Ludwig der Bayer, der Wittelsbacher, der seinen Gegenkönig, den Habsburger, 1322 bezwungen und gefangen genommen hatte, weigerte sich nämlich, um die päpstliche Bestätigung seiner Königswürde nachzusuchen, und er kam auch nicht der Aufforderung des Papstes nach, die Vergabe der Mark Brandenburg an seinen Sohn Ludwig den Brandenburger rückgängig zu machen. Jetzt folgten Schlag und Gegenschlag: Papst Johannes XXII. verhängte über den selbstherrlich auftretenden König Ludwig den Kirchenbann. Dieser antwortete mit der bald berühmten Sachsenhäuser Appellation von 1324, worin er den Papst der Ketzerei beschuldigte und ein allgemeines Konzil forderte.
Es blieb nicht bei diplomatischen Noten und Proklamationen von allerhöchster Seite. Was an Spannung im Volk latent vorhanden war, brach allenthalben aus, manchmal mit programmatischem Bewusstsein, da und dort geradezu in mörderischen Formen. Man tötete papsttreue Kleriker in Basel und Berlin. 1324 wurde der Propst Nikolaus von Bernau gejagt, niedergeschlagen und verbrannt. Ein Jahr später brachten die der Altmark benachbarten Magdeburger ihren seit langem verhassten Erzbischof Burchard um, was König Ludwig insofern gelegen kam, als zwischen ihm und dem Erzstift die Lehnsrechte über altmärkische Städte strittig waren.
Wie allen politischen und ideologischen Bewegungen großen Stils lagen der antikurialen Bewegung der zwei Jahrzehnte von 1325 bis 1345 handfeste Interessen recht unterschiedlichen moralischen Gewichts zugrunde. In dem Aufruhr, der die Reformationszeit des 16. Jahrhunderts – wie wir heute übersehen – ankündigte, vermengten sich Altruismus und Egoismus, Weitsicht und Borniertheit, Ruhe der Betrachtung und emotionale Unbeherrschtheit.
Unterstützt von der ersten Welle der Opposition gegen die Kurie in und um Deutschland, zog König Ludwig nach Rom und folgte damit dem Vorbild vieler deutscher Kaiser und Könige, die dies ebenfalls getan hatten; manches machte dabei den Eindruck, als wolle man unbedingt Gespenster wecken. Im Januar 1328 ließ Ludwig sich in der heiligen Stadt im Namen des Volkes zum Kaiser krönen.
Auf die Bestrebungen der Könige und Fürsten nach staatlicher Zentralisation und damit auch Unabhängigkeit reagierte der Papst mit seiner Kurie sensibel und zugleich maßlos. Das Papsttum übersteigerte seine Weltherrschaftsansprüche materiell und moralisch derart, dass die Abwehrbewegung in Frankreich, England und Deutschland die Tendenzen zu nationaler Unabhängigkeit und Zentralisation verstärkte. Sichtbarster Ausdruck für den Sieg des französischen Königs über den Papst war die Verlegung der Kurie von Rom nach Avignon, wo die Päpste, durch die französische Krone ebenso kontrolliert wie politisch benutzt, von 1309 bis 1377 residierten.
Auch in England führte der antikuriale Kampf innerhalb weniger Jahre zur weitgehenden Unabhängigkeit vom Papsttum. In Deutschland hingegen tobte über drei Jahrzehnte die Auseinandersetzung zwischen Kaiser- und Königtum, repräsentiert durch den Wittelsbacher Ludwig den Bayern, und dem trotz oder wegen seiner »babylonischen« Gefangenschaft gefährlichen Papsttum. Bedeutendster Gegenspieler Ludwigs war Johannes XXII., einer jener avignonesischen Päpste, die sich den ökonomischen Wandlungen am besten anpassten und das kuriale Finanz-, Besteuerungs- und Verwaltungssystem vollendeten.
Der Machtkampf zwischen den beiden höchsten Feudalgewalten, deren supranationale Ansprüche schon recht fragwürdig geworden waren und gerade deshalb, insbesondere von Seiten der Kurie, recht militant vorgetragen wurden, berührte in Deutschland die Interessen der Kurfürsten, der Fürsten, des Hochadels überhaupt, aber auch die der verschiedenen Schichten in den Städten. Sollten sie sich alle der Papstkirche, die sich wie keine andere Institution des Spätmittelalters zentralisierte und damit alle Bereiche von Gesellschaft und Staat mehr denn je zu klerikalisieren versuchte, unterwerfen? Sollten sie sich auch noch steuerlich von ihr ausbeuten lassen? Inwieweit galt es, Kaiser und König zu verteidigen? Müsste seine Macht, indem sich die des Papstes schwächte, gestärkt werden? Auf diese Fragen gaben die einzelnen Klassenfraktionen, deren Interessenlagen je nach Stadt und Territorium wechseln konnten, in Wort und Tat verschiedene Antworten. Vordringlich schien jedoch allen die Abwehr der päpstlich-klerikalen Machtansprüche und deren materielle Auswirkungen.
Die antikuriale und antiklerikale Bewegung wühlte vor allem Süd-, Südwest- und Westdeutschland auf, doch auch die Altmark wurde in den Strudel der Ereignisse hineingerissen. Zunächst standen in der nordöstlichen Ecke des damaligen Deutschland die dynastischen Interessen der Wittelsbacher im Vordergrund des Parteienstreits – für oder wider den Kaiser, für oder wider den Kaisersohn, den Markgrafen Ludwig der Brandenburger, für oder wider den Papst. Wie der kaiserliche Vater wurde auch der markgräfliche Sohn Ludwig mit dem päpstlichen Bann belegt. Mag sein, dass die kirchliche Ächtung es dem jungen Ludwig erschwert hat, die Mark Brandenburg mit ihren unzähligen, recht unterschiedlichen, häufig auch noch umstrittenen Lehnsrechten und -verpflichtungen in Provinzen, Städten, Flecken und Dörfern in Besitz zu nehmen. Wo es gelang, geschah es in Form von allerlei Treueversprechen und Huldigungen.
In der Altmark, dem ältesten Teil der Mark Brandenburg mit den Städten wie Stendal, Tangermünde und Salzwedel, stieß Markgraf Ludwig auf besondere Schwierigkeiten, denn dort machten benachbarte Feudalherren oberste Lehnsrechte für diese Provinz geltend. Es bildete sich schließlich ein um die Oberherrschaft über die Altmark konkurrierendes Trio aus dem Herzog Otto von Braunschweig, dem Erzbischof von Magdeburg und dem Markgrafen Ludwig. Das Wechselspiel aus lauernder Freundschaft und offener Feindschaft unter den drei hohen Herren zog sich bis 1343 hin, als schließlich der Kaisersohn über den Braunschweiger Herzog den Sieg davontrug.
Die Patrizier Stendals mussten während dieses zwanzigjährigen Wechselspiels recht umsichtig lavieren, konnten aber auch profitieren, indem sie sich für die zumeist finanzielle Unterstützung der einen oder anderen Partei etwa Zollerhebungsrechte zu Pfandlehen übertragen ließen.
Rudolph von Bismarck (um 1280 – nach 1340) war schon 1325 beim Zustandekommen eines solchen Vertrags federführend. Damals gingen Stadtbevollmächtigte im Herbst desselben Jahres zum König Ludwig nach Nürnberg, der »den weisen Männern, seinen lieben getreuen Bürgern in Stendal« die Befugnis zur Zollerhebung bestätigte.4 Die Söhne des Rudolph von Bismarck sollten dann Ende der dreißiger Jahre in dem immer noch währenden Streit um feudale Herrschaftsrechte in der Altmark ebenfalls Geschäft und Politik miteinander verquicken und dabei Macht und Reichtum der Familie mehren.
Während dieser Rudolph von Bismarck, der alte Herr, seinen Junioren die macht- und geldträchtigen Geschäfte überließ, bestand er in seinen letzten Lebensjahren einen Kulturkampf, der einige für jene Zeit typische Züge aufwies. Die Patrizier, zwar noch im Feudalismus verhaftet, aber schon den Groß- und Fernhandel in Richtung eines noch fernen Kapitalismus entwickelnd, mussten danach trachten, sich eine höhere geistige Bildung anzueignen und die Ausbildung und Erziehung ihrer Nachkommen unter die eigene Kontrolle zu bringen, sie also den Klerikalen zu entziehen. Von solch ketzerischem Verlangen waren die Ratsfamilien in den Städten Deutschlands, ob im Norden oder Süden, schon seit längerer Zeit getrieben. Gegen das Schul- und Bildungsmonopol des Klerus, der Dom-, Kloster- und Pfarrschulen beherrschte, kämpften nachweisbar und mit Erfolg die Stadträte in Lübeck und Hamburg, in Helmstedt und Wismar, in Dortmund und Esslingen, in Ulm und Freiburg im Breisgau; dort wurden städtische Schulen, die dem Rat unterstellt waren, eingerichtet – allerdings zu Nutz und Frommen ausschließlich der Oberschicht.
Auch in Stendal erwies sich die Domschule von St. Nicolai, die allein darauf ausgerichtet war, kirchliche Bildung zu vermitteln, als unfähig, das junge Patriziergeschlecht auf das kaufmännische Leben vorzubereiten – und das in einer Stadt, die sich durch blühendes Gewerbe und ausgedehnten Fernhandel auszeichnete. Im Jahre 1338, als die antikuriale Bewegung in Deutschland ihren Höhepunkt erreichte und der Widerstand sich in einer Reihe von antipäpstlichen Tagungen der Reichsstände (Kurfürsten, Städte, einige Erzbischöfe) zeigte, war die Zeit reif, eine städtische Schulanstalt ins Leben zu rufen, was der von den Patriziern beherrschte Stadtrat Stendals denn auch beschloss. Um mit dem Bau des Schulhauses sofort beginnen zu können, gewann er durch Aufträge auch einige Meister von Handwerkerinnungen für das Vorhaben, die auf diese Weise in der umstrittenen Frage Verbündete der Patrizier wurden.
Die Geistlichkeit, deren Monopol auf Bildung und Schulung dermaßen entschlossen angegriffen wurde, ging zur Gegenoffensive über. Der Stendaler Dompropst von St. Nicolai bemühte den Diözesanbischof zu Halberstadt, der unter Androhung der Exkommunikation die Ratsherren und Gildemeister Stendals zum Rückzug zu zwingen suchte. Als dies nichts fruchtete, wurden die Geistlichen angewiesen, die Ungehorsamen jeden Sonntag in den Kirchen der Stadt laut und vernehmlich bei brennenden Kerzen und unter Glockengeläut als außerhalb der kirchlichen Gemeinschaft stehend zu verdammen. Den Gildemeistern und der gesamten Bürgerschaft untersagte man, Kirchen und geweihte Orte zu betreten.
Das war ein Interdikt, eine Untersagung, die es in sich hatte. Anders als die Exkommunikation, die sich gegen Personen richtete, war dies eine Art kirchlicher Ausnahmezustand, der in ganzen Regionen, zumindest in den Städten, das sonst so pulsierende kirchliche Leben erheblich störte. Ob das im Namen des Papstes jeweils erklärte Interdikt befolgt werden sollte oder nicht – diese Streitfrage beunruhigte das Gewissen und erhitzte die Gemüter. Der Parteienstreit zog auch Handel und Verkehr in Mitleidenschaft. Wenn das geschah, mussten sich die Patrizier gegenüber den rein weltlichpolitischen Rechtsansprüchen der päpstlichen Kurie und ihrer klerikalen Parteigänger erst recht behaupten. Wir können die Stendaler Patrizier nur nach ihren Taten, ihren Interessen und Konnexionen beurteilen; danach mussten sie eine Suprematie der Kirche über staatliche Organe ablehnen. Auch wenn es nicht ihre Sache war, ein staatspolitisches Werk wie »Defensor Pacis« (Verteidiger des Friedens) des Marsilius von Padua, der am Hofe Ludwigs von Bayern wirkte, zu studieren, so war ihnen dessen Kampf gegen kuriale und klerikale Machtansprüche wohl in groben Umrissen bekannt und durchaus genehm. Gegen diese Machtansprüche begehrten sie auf, diese wünschten sie zu beseitigen, mehr allerdings wollten die großen Ratsherren der hierarchisch strukturierten Kirche nicht antun; ihre Mittlerrolle zwischen dem lieben Gott und den von allerlei Mühsal beladenen Menschen leugneten sie nicht, wie das die Mystiker von der Statur eines Meister Eckhart in jenen Jahrzehnten taten. Sie wollten die Kirche durchaus im Dorfe – und in der Stadt – lassen, der Kirche geben, was der Kirche ist.
Schon 1288, genau ein halbes Jahrhundert vor dem Schulstreit, hatte die Gilde der Gewandschneider der Marienkirche zu Stendal einen Altar gestiftet, dessen Priester, der kein Nebenamt übernehmen durfte und deshalb Altarist hieß, verpflichtet war, jeden Sonntag und außerdem zweimal in der Woche Seelenmesse zu halten. Da es aber nicht allein um das Seelenheil der Verstorbenen, sondern auch um die Huldigung für die Lebenden ging, musste der Altarist des Sonntags auch der Wohltäter der Altarstiftung gedenken. Einmal im Jahr sollte das alles in besonders feierlicher Form vonstattengehen – unter Assistenz eines zweiten Geistlichen und mit vier Chorschülern, bei glänzender Erleuchtung, mit Vesper, Vigilien und Frühmessen.
An der genossenschaftlichen Altarstiftung mit all dem seelentröstenden und -erhebenden Drum und Dran dachten die Gewandschneider nicht im mindesten zu rütteln; sie stifteten sogar einen weiteren Altar, als 1341 die städtische Schule von der Kirche schließlich doch abgesegnet wurde. Die patrizischen Kaufleute wollten mit ihrer Schulgründung nur einen pädagogischen Freiraum schaffen, sonst blieben sie mit der allein selig machenden Kirche durchaus verbunden.
Der Stendaler Schulstreit zog sich drei Jahre hin, weil jede der beiden Seiten, Domstift und Stadtrat, sich innerhalb der gegebenen Machtkonstellation einige Siegeschancen ausrechnen konnte. In der Stadt selbst schürte ein Heer von etwa hundert Geistlichen mit klerikalem Eifer die Missstimmung und Gewissensunruhe der niederen Bürgerschaft. Unschuldig waren sie nicht, diese Herren Patrizier, wenn es den klerikalen Dunkelmännern gelang, beträchtliche Teile des Stendaler Stadtvolks auf ihre Seite zu ziehen. Jahrzehntelang schon rumorte da Unmut über das angemaßte Recht des ausschließlich aus reichen Familien kommenden Rats, sich nach Gutdünken aus den eigenen Reihen zu ergänzen, auch über das offensichtliche Unrecht, dass die Patrizier, die außerhalb der Stadt Lehnsgüter besaßen, bei städtischen Vermögenssteuern nur noch die Hälfte bezahlen mussten. Aus Anlass des Schulstreits brach sich die angestaute Unzufriedenheit der Bürger gegen die selbstherrlichen Geld- und Machtprofiteure im Stadtrat Bahn, die sich zudem der Fehden rittermäßiger Adliger vom flachen Lande zu erwehren hatten.
Trotz aller Wirren innerhalb und außerhalb der Mauern Stendals blieb der patrizische Stadtrat in der Schulfrage unbeugsam, weil er wohl auf den Sieg der antikurialen Bewegung setzte, der sich im Sommer 1338 beim Kurverein zu Rhens manifestierte. Dort beschlossen die versammelten Kurfürsten, dass ein von ihnen oder der Mehrheit von ihnen gewählter König keiner Bestätigung durch den päpstlichen Stuhl bedürfe. Damit war – ein für allemal – der Anspruch des Papstes auf die weltliche Oberherrschaft und das Mitspracherecht bei der Königswahl zurückgewiesen. Das bekräftigte aber auch das Recht der Kurfürsten, den König zu wählen – ein für die weitere deutsche Geschichte folgenschwerer Beschluss.
Rudolph von Bismarck, der in den Streit mit dem Domstift als einer der führenden Köpfe verwickelt war, fiel unter den Kirchenbann und starb um 1340 als Exkommunizierter. Dennoch entschied sich der Stadtrat, der sich aus eigener Machtvollkommenheit ergänzen konnte, für seinen ältesten Sohn Nikolaus oder Klaus von Bismarck (1307 – 1377).
Die Wahl traf auf den Spross einer Familie, die sich durch Reichtum, Macht und Können auszeichnete. In der Tat sollte sich Klaus von Bismarck als ein für seine Zeit überaus wendiger Geldmann und Diplomat erweisen; durch wohldosierte Opfer und Zugeständnisse mehrte er seinen Wohlstand und Einfluss. Er verstand es mehr als jeder andere im Stadtrat Stendals, im Streit um feudale Herrschaftsrechte Geschäft und Politik miteinander zu verquicken.
Klaus von Bismarck war beteiligt, als der Stadtrat 1340 versuchte, mit jenen widerborstigen Landadligen ein Übereinkommen zu finden, das die Patriziergeschlechter mit Fehden überzog. Desgleichen konnte der Stadtrat den Schulstreit auf typisch feudale Weise zu Ende bringen: Durch Überlassen von nicht allzu umfangreichem Dorfland zu Lehen und formalen Zugeständnissen sicherte man die Existenz der Stadtschule, die als Ursprung des Stendaler Gymnasiums gilt.
Klaus von Bismarck weitete seinen politischen Aktionsradius bald über die Grenzen der Stadt aus. Bei allem subjektiven Drang lag darin ein objektiver Zwang. So sehr nämlich die einzelne, auch noch so kleine Feudalgewalt einerseits auf ihre Selbstständigkeit pochte, war sie andererseits an einer zentralisierenden, zumindest fürstlichen, nicht unbedingt königlichen Macht interessiert. Ein oberster Lehnsherr hielt die zentrifugalen Kräfte zusammen, wo er fehlte, herrschte oft das Faustrecht, hörte das Klagen über Fehden und Brandschatzungen nicht auf. Grund zu solchen Klagen gab es in der Altmark genug, da seit dem Aussterben der askanischen Dynastie 1319 Ungewissheit herrschte, wer denn dort, im ältesten Teil der Mark Brandenburg, der Herr sei.
Die Bismarcks mochten in dem Dreierkampf um die Herrschaft in der Altmark zwischen Herzog Otto von Braunschweig, dem Erzbischof von Magdeburg und Markgraf Ludwig, die alle irgendwelche Rechtstitel und verwandtschaftliche Konnexionen ins Feld führen konnten, lange Zeit eine abwartende Haltung eingenommen haben; als jedoch der allgemeine Gang der Politik in Deutschland es offensichtlich machte, dass sich als Grundsatz die Unteilbarkeit der Kurfürstentümer, zu denen die Mark Brandenburg nun einmal gehörte, durchsetzte, entschieden sie sich für deren Einheit und damit für den Markgrafen Ludwig. Nachdem der Erzbischof von Magdeburg 1336 gegen sechstausend Mark Silber auf seine Ansprüche verzichtet hatte, ließen sich die Brüder Klaus und Rule von Bismarck noch vor dem Tod ihres Vaters Rudolph zu Anhängern des Markgrafen Ludwig machen. Dieser honorierte ihre Parteinahme, indem er ihnen landesherrliche Erhebungen für den Fall zubilligte, dass ihm die Altmark zufiel.5
Der in feudalen Vorstellungen verhaftete Wechsel auf die Zukunft drängte die jungen Bismarcks zu einer aktiven Unterstützung des Markgrafen. Dem Brandenburger wurden nicht nach altväterlicher Weise der Ritterheere Ross und Reiter, sondern Geld für die modernen Söldnerheere zur Verfügung gestellt. Vor dem entscheidenden Feldzug von 1343 gegen Herzog Otto von Braunschweig streckte Klaus von Bismarck dem Markgrafen verschiedene Geldsummen vor, wofür man ihm die landesherrlichen Zolleinkünfte aus Havelberg verpfändete – mit sofortiger Wirkung und nicht als Zukunftsaussicht.
Immer waghalsiger und verwickelter gestalteten sich die Geschäfte der Stendaler Patrizier: Im Verein mit sieben anderen reichen Bürgern streckte Klaus von Bismarck im Entscheidungsjahr 1343 weitere Darlehen vor, wofür man die Stendaler und Kyritzer Münze auf zwölf Jahre verschrieb, allerdings mit der etwas unsicheren Maßgabe, dass diese Münzeinnahmen wegen anderweitiger Verschreibung erst nach vierzehn Jahren fließen sollten. Also auch hier wieder ein Wechsel auf die Zukunft, bei dem sich finanzwirtschaftlicher Einfallsreichtum und feudales Rechtsgebaren sonderbar mischten.
Das Geschäft der Stendaler Patrizier mit dem Markgrafen Ludwig ging vom Finanziellen ins rein Politische über. Jedoch lauerten auf dem Weg zur Unterstützung des Markgrafen juristische Fallen. Stendal hatte nämlich zwei Fürsten den Untertaneneid geleistet, dem Markgrafen Ludwig die Erbhuldigung und dem Herzog von Braunschweig die Huldigung auf Lebenszeit. Solange diese lebten, waren die Stendaler Patrizier davon nicht entbunden. Deswegen hielten sie es für geraten, die Vermittlung anzurufen in der Absicht, den Braunschweiger ins vermeintliche oder wirkliche Unrecht zu setzen. Zweifellos war Klaus von Bismarck ein Hauptvertreter der für den Markgrafen wirkenden Partei und an mehreren Verhandlungen beteiligt.
Die hohen Herren vom Stendaler Stadtrat kamen schließlich auf die dummdreiste Idee, als Schiedsrichter ausgerechnet Kaiser Ludwig, den Vater des Markgrafen Ludwig, anzurufen. Von vornherein war klar, dass dieser sich aus politischen und verwandtschaftlichen Gründen – vor allem um der Unversehrtheit des Kurfürstentums Brandenburg willen – für seinen Sohn entscheiden würde. In der Tat bramarbasierte der Römische Kaiser im Juli 1343, dass er »nach Anhörung von Grafen, Freien, Rittern und Knechten seines Rates« das im Grunde erwartete Urteil fällen müsse, »weil man alle Zeit dem Rechte helfen und Beistand leisten solle und dem Unrecht nicht, so sollen die Rathmannen zu Stendal fortan unserem Sohne dem Markgrafen behülflich sein gegen den Herzog von Braunschweig und nicht dem Herzoge«.6
Die Mühe, juristisch spitzfindig zu argumentieren, machte sich der Kaiser gar nicht; seine Berufung auf Recht und Unrecht war rein rhetorisch und schon für die damalige Zeit kaum geeignet, das egoistische Interesse ideologisch zu verhüllen. Doch das kaiserliche Placet, wie dürftig auch begründet, genügte den Stendaler Patriziern, um sich frei zu fühlen, den städtischen Heerbann ins Lager des Markgrafen Ludwig gegen den Herzog Otto von Braunschweig zu führen und den Feldzug nicht allein mit privaten Finanzmanipulationen, sondern auch mit Zuschüssen aus der Stadtkasse zu unterstützen. Herzog Otto verlor im Feldzug von 1343 aber nur eine Schlacht, nicht den Krieg. Um ihn zu bewegen, auf die Altmark endgültig zu verzichten und damit die Einheit der Mark Brandenburg wieder möglich zu machen, musste Markgraf Ludwig in einem Vergleich eine hohe Abstandssumme, zu der die Stendaler Patrizier städtische und private Geldanleihen beigesteuert hatten, zahlen.
Kurz vor Weihnachten 1343 wurde in Stendal dann die Erbhuldigung für den Markgrafen Ludwig inszeniert. Sie war mit einem recht handfesten Vertrag verbunden, wonach alle seit Markgraf Woldemars Tod 1319 in der Altmark gebauten Burgen abgebrochen und neue nicht gebaut werden sollten. Die Städte konnten jedoch ihre Festungswerke verstärken. Diese Bestimmungen richteten sich ausschließlich gegen jene Landadligen, die während der vergangenen zwanzig Jahre das Land unsicher gemacht und den Städten wie dem Markgrafen zugesetzt hatten.
Schon 1340 war Klaus von Bismarck dabei gewesen, als der Stendaler Stadtrat erfolglos versucht hatte, mit den widerborstigen Landadligen ein Übereinkommen zu finden.7 Nach all den Erfahrungen mit dem landadligen Raubgesindel war die Übereinkunft von 1343 zwischen Stadt und Markgrafen durchaus fortschrittlich: Ihre Ziele waren, die Sicherheit der Stadt zu gewährleisten und die nächsthöhere Feudalgewalt, eben die fürstliche Landesherrschaft in den Territorien, zu stärken; unter den damaligen klassen- und territorialstaatlichen Beziehungen konnte diese ohnehin eher den Landfrieden garantieren als die ferne königlich-kaiserliche Gewalt. Aber da die Landesfürsten immer geldbedürftig waren, gerieten sie bald wieder in eine schwache Position.
Die Patrizier wurden in den mit dieser Politik verbundenen Finanzoperationen immer kühner, schanzten dem Markgrafen auch noch Geldbeträge aus der Stadtkasse zu und zogen aus dieser Hilfe große Gewinne. Klaus von Bismarck erfreute sich besonderer Gunst: Der Markgraf belehnte ihn und seine Familie mit dem landesherrlichen Schloss Burgstall. Doch das war den Handwerkern und Krämern zu viel! Sie pflegten die Privilegien als gottgewollte Institution der mittelalterlichen Gesellschaft hinzunehmen, gerieten aber in helle Empörung ob solcher Schiebereien mit Steuergeldern, ob all der Geldsäckelei, der Pfründenwirtschaft und einer Standeserhöhung, die in ihrem Extrem nur als Unrecht erscheinen konnte. Ein Volksaufstand im Sommer 1345 führte zur Vertreibung der vornehmsten alten Familien, darunter der Bismarcks.
Klaus von Bismarck und seine Familie wurden in einer Zeit sozialer Hochspannungen in Stendal wie in der Altmark und ganz Brandenburg schlossgesessen. Diese Erhöhung war ungewöhnlich,8 aber nicht unbegreiflich: Außergewöhnliche Krisenzeiten verlangen stets nach ungewöhnlichen Maßnahmen. Doch die faktische Standeserhöhung fand lange Zeit keinen juristischen Ausdruck; bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts figurierten die Bismarcks in den Urkunden als cives (Bürger).9 Andererseits waren sie gemäß ihrer wahrscheinlich ministerialischen Herkunft, vor allem ihrer feudalen Rechte, Gewinne und Konnexionen, keine selbstbewussten Stadtbürger im Sinne des Spätmittelalters oder gar des 19. Jahrhunderts, vielmehr nahmen sie mit ihrer machtbewussten Schlossgesessenheit in Burgstall während des 14. Jahrhunderts eine ständische Zwischenstellung ein.
Schlossgesessener Bürger-Aristokrat
Noch vor der Belehnung mit Burgstall hatte Klaus von Bismarck erreicht, dass ihm der Markgraf landesherrliche Erhebungen aus der Stadt Tangermünde und dem Dorf Döbbelin, wahrscheinlich gegen einen guten Kaufpreis, überließ. Burgstall war also keine Flüchtlingsburg eines aus der Stadt Vertriebenen, sondern der Zentralsitz eines Mannes, der über weite feudale Besitzungen und Gerechtsame, also Vor- und Nutzungsrechte, in zahlreichen Dörfern der näheren und auch weiteren Umgebung verfügte. Ihm wuchsen die Feldmarken, also die Felder und Wiesen, Weiden und Waldungen der wüst gewordenen Dörfer seines Lehnsgebietes zu,10 über das sich überdies umfangreiche Waldreviere erstreckten, vor allem der Burgstaller und der Letzlinger Forst. Seit der Vertreibung von 1345 verfolgte die Familie Bismarck aber eine Aneignungs- und Enteignungspolitik, die – wie ein Blick auf die Topographie der Besitzungen zeigt – auf einen möglichst geschlossenen Besitz hinzielte.
Bild 17
Seit 1345 besaßen die Bismarcks Anteile am Gut Döbbelin in der Altmark, das von 1375 bis 1945 in ihrem festen Besitz war. Bis zu ihrem Tod 1963 lebte eine 1880 geborene von Bismarck im Herrenhaus. Seit 1991 gehört das Anwesen wieder der Familie.
An der Grenze zum magdeburgischen Territorium gelegen, war Burgstall ein befestigter Stützpunkt mit einer doppelten Funktion: Von dort aus wollte man im Sinne des Markgrafen auf der Hut sein vor dem magdeburgischen Erzbischof, dem man trotz seiner Verzichterklärung von 1336 nicht über den Weg traute; zum andern konnte man im Umkreis von Burgstall gegen fehdeeifrige und heruntergekommene Landadlige vorgehen.
Die sozialen und politischen Wirren in Europa, Deutschland und den märkischen Landen sorgten nach 1345 für manche Überraschung: die Kurfürsten verblüfften die Welt mit der Wahl von König und Gegenkönig; ein falscher Fürst machte das Land unsicher. Er lockte geradezu fürstliche Nachbarn an, um der Mark Brandenburg Herrschaftsrechte zu entreißen. Fehden nahmen zu, mündeten da und dort in kriegerische Auseinandersetzungen; die Pestepidemie, der Schwarze Tod, forderte vor allem in den Städten Opfer; das große Sterben war begleitet vom Fanatismus der Judenpogrome und Geißlerumzüge. Es schien, als hätten sich Gesellschaft und Natur verschworen, die Menschen zu peinigen, ihre Körper und Seelen zu verwüsten.
Im Juli 1346 erhoben die Kurfürsten, ausgenommen die Wittelsbacher aus Brandenburg und der Pfalz, in Rhens am Rhein den Sohn des Böhmenkönigs Johann aus luxemburgischem Geschlecht zum deutschen König. Karl IV., von Papst Clemens VI. gefördert und als Gegenkönig zum exkommunizierten Kaiser Ludwig erkoren, war auch nach dessen Tod im Oktober 1347 noch einige Jahre umstritten und weiterhin in Gefahr, von den Parteigängern der Wittelsbacher mit Gegenkönigen konfrontiert zu werden. Von den einen, wie dem großen Franziskaner William von Ockham, als Pfaffenkönig beargwöhnt, wurde Karl IV. von den anderen als Gottseliger auf dem Throne gepriesen.
Der fromme Mann hatte wahrlich den Teufel im Leib. Schon 1348 bediente er sich des falschen Woldemar, jenes närrischen Betrügers, der sich als der letzte askanische, von langer Pilgerfahrt zurückgekehrte Markgraf ausgab und gegenüber dem wittelsbachischen Markgrafen und Kurfürsten seine angeblichen Rechte geltend machte. König Karl IV. war auf der politischen Bühne der Mark Brandenburg zunächst unsichtbar, hielt aber die Fäden in der Hand; auf und hinter der Bühne agierten mit dem schmierenkomödiantischen Gespenst vom falschen Woldemar land-, pfründen- und privilegiengierige Hochfeudale wie die Herzöge von Sachsen und Mecklenburg, die Grafen von Anhalt und – nicht zu vergessen! – der Erzbischof von Magdeburg. Die dynastische Habgier wütete vor dem Hintergrund von Pestilenz und Massensterben, das die Gemüter niederdrückte, aber auch wieder aufpeitschte. Ursache und Folge dieses verstörten Seelenzustandes waren gehässige Judenjagden, selbstquälerische Geißlerumzüge und trügerische Hoffnungen jener Pilger, die vor Kruzifixen oder Reliquien allerhand Zeichen und Wunder zu sehen glaubten.
Wir können all die krummen Wege, auf denen sich die hohen Herrschaften in Verfolgung ihrer räuberischen Ziele bewegten, nicht weiter nachzeichnen. Es genügt festzustellen: Jeder von ihnen riss Pfandherrschaften an sich, und König Karl IV. ließ, nachdem das tückische Werk, die Mark Brandenburg territorial zu schmälern und politisch zu schwächen, vollendet war, den falschen Woldemar als verächtlichen Kumpan fallen. Unverkennbar war es sein Ziel, die Markgrafschaft den Wittelsbachern zu entreißen und der königlichen Hausmacht irgendwie einzugliedern. Mit langem Atem und listenreich durchstand er zwanzig Jahre lang ein Spiel, bei dem er mit starken wie schwachen Figuren unmittelbar agierte. Zu den vielen, die dem König zumindest mittelbar und zeitweise dienten, gehörte auch Klaus von Bismarck.
Bald nach dem Auftreten des falschen Woldemar, des Geschobenen und Verschrobenen, trat Stendal, unterstützt von sämtlichen Städten der Altmark, mit Klaus von Bismarck wieder in Verbindung. Mitten in der Ungewissheit des Geschehens, als man nicht immer im Bilde war, wer gegen wen und für wen kämpfte, schien es doch ratsam, sich mit dem neuen und doch altbekannten Herrn von Burgstall ins Einvernehmen zu setzen. Im Dezember 1348 kam zwischen diesem und sieben Städten, die darum nachgesucht hatten, eine Einigung zur Wahrung des Landfriedens zustande; allerdings verlangte Stendal in einer Klausel, dass Klaus von Bismarck der Stadt nicht näher treten solle, »als er vorhin derselben gewesen sei«.11 Er blieb im Status der Verbannung, wenn auch einer verklausulierten und damit gemilderten; so schnell versöhnte man sich nicht.
Auf diesem Wege ging es nach fünfzehn Monaten weiter. Der Erzbischof von Magdeburg, der als Vertreter der Herrschaft in der Altmark agierte und damit offenbarte, dass der falsche Woldemar nur als Schreckgespenst diente, hatte seit einiger Zeit den Ausgleich zwischen den Städten und den Vertriebenen angestrebt. In der Tat ermöglichte der Vertrag vom 1. März 1350 ihre Rückkehr nach Stendal, vorausgesetzt, dass sie die neue, gegen die Patrizier gerichtete Stadtverfassung akzeptierten. Ein großer Teil der ausgestoßenen Bürger, unter ihnen die Brüder des Klaus von Bismarck, kehrte wieder zurück. Dieser selbst fand eine politisch interessantere Form der Aussöhnung mit Stendal: Er leistete für die finanziell bedrängte Stadtverwaltung zusammen mit seinem Bruder schon im Frühjahr 1349 Bürgschaft, und er trat – wahrscheinlich 1351 – als Hauptmann der Armbrustschützen in die Dienste der städtischen Kriegsmacht, die in solch turbulenten Zeiten besonders klug geleitet sein musste.12
Klaus von Bismarck verstand seine Machtposition als Schlossherr von Burgstall zu nutzen, um sozusagen von höherer Warte aus Einfluss in Stendal zu gewinnen. Er verkörperte jetzt Neu-Ritter und Alt-Patrizier; was er damit erreichen wollte, war keineswegs Selbstzweck, nicht Ende seiner Laufbahn, sondern Anfang einer neuen Etappe.
Nachdem der falsche Woldemar seine Schuldigkeit getan und ins dunkle Nichts geschickt worden war, durfte Markgraf Ludwig wieder zurückkehren; doch der erkannte klug, dass er nach dem nah- und ferngelenkten Destruktionswerk des falschen Woldemar keine wirkliche Macht in der Mark Brandenburg mehr ausüben konnte. Er wollte keine Schachfigur in der Hand des böhmischdeutschen Königs Karl IV. sein. So ordnete er noch einiges in der Mark Brandenburg, übergab die Scheinmacht seinem jüngeren, gleichnamigen Halbbruder Ludwig dem Römer und ging nach Bayern zurück.
Klaus von Bismarck trat also 1353 als markgräflicher Rat in die Dienste Ludwigs des Römers. Sein Wirken in landesherrlichen Geschäften bezog sich vor allem auf die Altmark. Ihm oblag die politisch bedeutsame Aufgabe, den Erzbischof von Magdeburg aus jenen befestigten Plätzen auszukaufen, die er sich während des Gespensterzugs des Woldemar als Pfandbesitz erschlichen und erpresst hatte. Dazu bedurfte es der Geldmittel, die nur ein Mann wie er beschaffen konnte, einer, der in Finanzfragen über eine durch Erfahrung erworbene und zugleich disziplinierte Kombinationsgabe verfügte und wusste, wie Städte zu locken waren, nämlich durch das Arrangement: Steuergelder gegen städtische Münzberechtigung.
Doch von der Position eines Landrats der Altmark aus konnte Klaus von Bismarck die Verhältnisse in der Mark Brandenburg nicht ändern – wenn sie überhaupt zu verändern waren angesichts der persönlichen Schwäche der neu an die Regierung gekommenen Wittelsbacher, die überdies unter kaiserlichem Druck standen.
Die Macht Karls IV. war stark und unumstritten geworden, was sich bei seiner Krönung zum Kaiser im Jahre 1355 zeigte. Ein Jahr später regelte die Goldene Bulle die künftige Königswahl, die endgültig den sieben Kurfürsten, unter ihnen dem Markgrafen von Brandenburg, übertragen wurde.
Klaus von Bismarck konnte nicht entgehen, dass Kaiser Karl IV. die Wittelsbacher aus der Mark Brandenburg langsam, aber sicher verdrängen wollte. Da er in seiner Position kaum Aussichten hatte, etwas zu bewirken, war es nicht verwunderlich, dass er die wittelsbachisch-brandenburgischen Dienste in einem günstigen Moment quittierte. Der kam, als Kaiser Karl IV. den Papst nach dem Tod des Magdeburger Erzbischofs Otto im Jahre 1361 veranlasste, dem eigenwilligen Domkapitel die Wahl eines Nachfolgers zu untersagen. Aus apostolischer Machtvollkommenheit sollte am 20. Juni 1361 dem königlichen Kanzleibischof Dietrich mit dem Amtsabzeichen Pallium die erzbischöfliche Würde verliehen werden. Die Anweisung des Kaisers an den Papst war nach Namen und Datum bestimmt und unverrückbar. Offenbar konnte die Pfaffen- und Papstgläubigkeit dieses Karl IV. recht eigenartig sein, etwa nach der Maxime: Sei absolut, wenn du meinen Willen tust.
Für Klaus von Bismarck ergab sich daraus ein historischer Glücksfall, denn der neue Erzbischof von Kaisers Gnaden war ein naher Verwandter, wahrscheinlich ein leiblicher Onkel mütterlicherseits. Doch die familiären Bande konnten erst zu politischen geknüpft werden, als sachliche Voraussetzungen dazu kamen. Oberflächlich betrachtet, schien die geistig-soziale Physiognomie der beiden Männer recht unterschiedlich: Der Erzbischof Dietrich, ehemaliger Zögling der Domschule in Stendal, Verwalter mit Mönchsgelübde im Kloster Lehnin, dann Hofmeister des Brandenburger Bischofs und bald eifrig tätig gegen die dem geistlichen Regiment widersetzlichen Wittelsbacher, hatte schließlich als Kanzler in hoher Stellung dem »Pfaffenkönig« Karl IV. in Prag gedient und war selbst schlossgesessener Grundbesitzer in Böhmen. Was hatte dieser hohe Geistliche dem politischen Charakter nach gemein mit dem altmärkischen Schlossbesitzer Klaus von Bismarck, ehemals Förderer der städtischen Schule Stendals und darum vorübergehend exkommuniziert, der sich vor allem als finanzieller und politischer Helfer der wittelsbachischen Markgrafen betätigte?
Bei näherer Betrachtung findet man durchaus Gemeinsames: Beide Männer gehörten der herrschenden Feudalklasse an und waren durch ihr Leben und Wirken Techniker der Macht geworden. Eine umsichtig organisierte und politisch zielbewusst eingesetzte Finanzverwaltung gehörte zum Modernsten, was die herrschenden Klassen im immer noch feudalen 14. Jahrhundert vorzuweisen hatten. Erzbischof Dietrich, selbst ein erfahrener Finanzverwalter, wusste in diesem Sinne durchaus, was er tat, als er Klaus von Bismarck in das Amt des Stiftshauptmanns einsetzte, in die höchste weltliche Stellung des ausgedehnten Landgebiets, das zum Magdeburger Erzbistum gehörte. Bismarck wiederum erschien diese amtliche Stellung besonders geeignet, um seinen 1345 erhandelten Feudalsitz zu sichern; die Sorge darum ist jedenfalls für eine spätere Zeit nachzuweisen. Sein Schloss Burgstall lag an der Grenze zum magdeburgischen Gebiet, er residierte also sehr nahe der erzbischöflichen Residenz. Anders als unter den ohnehin schwachen, von Kaiser Karl IV. in unwürdiger Weise manipulierten Wittelsbachern hatte er dort eine zentrale Position.
Ein geordneter Haushalt mit möglichst hohen Überschüssen war das erste der drei Ziele der weltlichen Regierungstätigkeit des Erzbischofs. Zweitens strebte er die Sicherung des Landfriedens an, und drittens suchte er geheime Absichten des Kaisers auf die Mark Brandenburg zu unterstützen. Dieses Begehren blieb jedem, der sehen und hören wollte, nicht lange verborgen.
Seit 1360 hatte Markgraf Ludwig der Römer seinen jüngeren, damals mündig gewordenen Bruder Otto als Mitregenten; Ende 1362 trat der gegenüber den Brüdern geistig wie materiell weit mächtigere Erzbischof Dietrich von Magdeburg hinzu. War diese Dreierkombination auch verrückt, so hatte sie doch Methode. Alles war dazu angetan, die Mark Brandenburg darauf vorzubereiten, dass ihre Regierung in kräftigere Hände überging. Schon drei Monate später, im März 1363, räumte Kaiser Karl IV. seinem luxemburgischen Hause die Eventualsukzession, also die Machtübernahme, in der Mark Brandenburg ein, falls die jetzt Herrschenden ohne männliche Nachfolger blieben. Er selbst erschien im Lande und nahm die Eventualhuldigung entgegen, die seine Parteigänger teils durch Überredung, teils mit Druck erwirkten.
Nachdem 1365 der Zeitraum von drei Jahren, in denen Erzbischof Dietrich in der Mark mitregieren sollte, abgelaufen war, brauchte er nicht erneut als politischer Platzhalter und Quartiermacher anzutreten, denn der schwächliche Markgraf Otto, jetzt nicht mehr von dem im selben Jahr verstorbenen älteren Bruder Ludwig dem Römer assistiert, war dazu gebracht worden, dem Kaiser selbst die Verwaltung der Mark auf sechs Jahre als »vormunder von unserwegen« zu übertragen.13
Noch in die Regierungszeit des Erzbischofs Dietrich fiel ein Ereignis, das besondere Schauaspekte der Machtausübung zeigte. Am Magdeburger Dom war das zweite Geschoss des Westbaus vollendet und im Herbst 1363 feierlich eingeweiht worden. Das spielte sich im Prager Repräsentationsstil à la Kaiser Karl IV. ab. Dem Erzbischof Dietrich assistierten sieben Bischöfe mit einem zahlreichen Gefolge von Prälaten und weltlichen Herren. Alle Fürsten der das Erzstift umgebenden Länder mit ihren Gattinnen und Kindern sowie ihren Grafen, Rittern und Knappen trugen bei zum feudalen Gepränge im feierlichen Gottesdienst und in der würdevoll einherschreitenden Prozession. Das alles erfreute die Augen und berauschte die Gemüter des staunenden Volkes; wer dabei war, erzählte es weiter.
Wen eigentlich ehrten die feierlich versammelten feudalen Herrschaften? Den unsichtbar-blassen Gott im Himmel? Oder sich selbst in ihrem farben- und formenreichen Erdendasein? Vielleicht waren sie keine Zyniker, aber sie hatten zur katholischen Religion jene ambivalente Haltung, die später im Begriffspaar Privat- und Staatsfrömmigkeit erfasst wird. Pest, Krieg und allerhand Unfrieden mochten viele Mitglieder der herrschenden Klassen im Verlangen nach Heilsversicherung für die Zeit nach dem Tod bestärkt haben; auch konnte die äußere und innere Zerrissenheit die Menschen dazu führen, sich dem Dona nobis pacem, der Sehnsucht nach äußerem und innerem Frieden, anzuschließen. Aber da all die feudalen Herrschaften nicht zur Weltflucht neigten, sondern zum Wirken und Genießen in dieser Welt, stellt sich die Frage, wie, wo und wann die Religion im Machtkampf einzusetzen sei. So entstand eine äußere Religionsbeflissenheit, die etwas schönfärberisch Staatsfrömmigkeit genannt wird; sie äußerte sich in kultischer Repräsentation und öffentlicher Demonstration, in literarisch fixiertem Sendungsbewusstsein der Herrscher, schließlich – sichtbar und erlebbar bis zum heutigen Tag – in Bauten und bildender Kunst. Das war der Sinn der Magdeburger Dombaueinweihung, deren Beurkundung Klaus von Bismarck als höchster Beamter des Erzbischofs am 22. Oktober 1363 gegenzeichnete.
Erzbischof Dietrich lebte nur noch bis 1367. Dann begann, was wahrhaftig bei Groß und Klein, bei Hoch wie Niedrig nicht selten ist: der Erbstreit. Klaus von Bismarck hatte sofort nach Ableben seines hohen Gönners und Anverwandten alles Geld, Silber und Gold, das man bar, in Barren oder Geräten im Nachlass fand, an sich genommen – desgleichen die Edelsteine, Fingerringe und sonstigen Kleinodien. Es will scheinen, dass er während der Streitigkeiten mit dem Erzstift geltend machte, im Wesentlichen den Ersatz seiner dem Verstorbenen gemachten Vorschüsse und all seiner sonstigen Auslagen im erzstiftischen Dienst sicherzustellen. In der Tat beschloss das Schiedsgericht im Jahre 1370, dass Klaus den Nachlass behalten dürfe, doch dem Erzstift dafür tausend vollwichtige Gulden guten Goldes zu vergüten und sieben goldene Siegelringe zurückzugeben habe.14
Harmonisch und friedlich war der Abschied des Klaus von Bismarck aus dem erzstiftischen Amtsbereich also keineswegs. Er trat wieder in die Dienste des Markgrafen von Brandenburg ein, jetzt sogar als Hofmeister mit weitgehenden Vollmachten, aber das Land war heruntergewirtschaftet und lag – wer fühlte es nicht? – als Beute für den Kaiser bereit. Die Pfandbesitzungen aus der Mark, mit denen sich die feudalen Nachbarn gütlich taten, waren noch immer nicht eingelöst.
Dem neuen Hofmeister ging es während der wirren Auseinandersetzungen des Markgrafen mit seinen Nachbarn und dem lauernden Kaiser in erster Linie um die Sicherung seines eigenen Grundbesitzes, des Schlosses Burgstall. Zu diesem Zweck betrieb er eine Annäherung zwischen Braunschweig und Brandenburg und brachte es fertig, dass ein im Wesentlichen gegen Mecklenburg gerichteter Hauptvertrag zwischen den beiden Fürsten und ein – wohlverstanden! – geheimer Neben- oder Privatvertrag zwischen dem Herzog von Braunschweig und ihm, dem Burgstaller Schlossbesitzer, abgeschlossen wurde. Nach diesem merkwürdigen Nebenvertrag vom April 1369 stellten sich Klaus von Bismarck und seine Söhne mit ihren Burgen Burgstall und Alt-Plathow als Hofgesinde dem Herzog und versprachen, ihm zu helfen und zu raten, »wie sie es am besten vermochten in guter Treue«. Umgekehrt verpflichtete sich der Braunschweiger Herzog, die Bismarcks zu schützen, »zu beschirmen und zu verteidigen«.15 Der trotz aller schönen Worte mit Arglist gegenüber dem Brandenburger abgeschlossene Nebenvertrag offenbart die Nervosität und die Unsicherheit der Machtverhältnisse in der und um die Mark.
Entgegen den Absichten des Hauptvertrags schreckte der Herzog von Braunschweig aber vor dem Kampf gegen Mecklenburg zurück, und so griffen der Brandenburger Markgraf und sein Hofmeister nach einem anderen Strohhalm. In tragikomischer Hektik näherten sie sich dem politisch wichtigsten Nachbarn der Altmark, dem Erzbischof Albrecht zu Magdeburg, der aus Mähren stammte und kaum ein Wort Deutsch verstand. Im August 1370 trafen sich die drei hohen Herren in Magdeburg und einen Tag darauf sogar auf Schloss Burgstall. Das war ein diplomatischer Erfolg für Klaus von Bismarck und stärkte, was auch kommen mochte, seine moralisch-politische Position.
Es lohnt sich nicht, hier im Einzelnen zu verfolgen, wie der Markgraf und sein Hofmeister Klaus von Bismarck versucht haben, die nachbarlichen Pfandbesitzer abzufinden und verlorene Rechte und Gebiete wiederzugewinnen, also den alten Umfang der Mark Brandenburg wiederherzustellen. Am Ende gab Kaiser Karl IV. sein diplomatisches Versteckspiel auf, riss die Mark mit Heeresgewalt an sich und belehnte mit dem Land seine Söhne, König Wenzel von Böhmen, Sigmund und Johann.
Noch vor der Eröffnung des Feldzugs von 1373 richtete der Kaiser eine Botschaft an den Papst, worin er bat, den Markgrafen und alle Einwohner vor der Aufrechterhaltung der den Wittelsbachern gegen die luxemburgische Sukzession (Nachfolge) geleisteten Huldigungseide dringend zu warnen. Diese Bitte war Befehl und zeigte, wer in der praktischen Politik über wem stand, nämlich der Kaiser über dem Papst. Ein päpstlicher Nuntius sollte von der Mark aus gegen alle »Edlen, Vasallen, Bürger und sonstige Einwohner«, die nicht von allen den Wittelsbachern gegenüber geleisteten Huldigungseiden und eingegangenen Verpflichtungen zurücktreten würden, »als gegen Verächter apostolischer Verordnungen« mit gebührenden Strafmitteln vorgehen.
Diese Zumutung muss selbst für den wende- und anpassungsfähigen Klaus von Bismarck zu viel gewesen sein, wie sonst könnte man die Exkommunikation verstehen, die der päpstliche Nuntius über »den Laien der Halberstädter Diözese Klaus genannt Bismarck« verhängte.16 Erst im März 1376 wurde die Exkommunikationssentenz aufgehoben – vermutlich gegen klingende Münze, die Klaus von Bismarck etwa anderthalb Jahre vor seinem Tod herausrücken musste.
Im berühmt gewordenen »Landbuch der Mark Brandenburg von 1375« wurde Klaus von Bismarck unter den Schlossgesessenen, »den Edlen« der Altmark – den Herren von Schulenburg, von Bartensleben, von Alvensleben, von Jagow und anderen – nicht aufgeführt. Die Bismarcks erscheinen nur als Stendaler Bürger- und Ratsfamilie; doch sie rangieren auf der Liste der altmärkischen Lehnsbürger als diejenigen, die weitaus die meisten Renteneinkünfte bezogen. Von den Schlossgesessenen hatten im Vergleich zu den Bismarcks nur die Bartenslebens mehr Natural- und Geldrentenansprüche. Die vielen Grundbesitzungen des Klaus von Bismarck machten noch mehr Eindruck als die Renteneinkünfte. Überdies verfügte er über einen so oder so profitablen Geldbesitz von etwa vierbis fünftausend Mark Silber17 – damals ein Riesenbetrag.
Im Ganzen bewegte sich seine materielle Basis in der Größenordnung seiner schlossgesessenen Zeitgenossen. Was seine politische Macht und Wirksamkeit nach 1345 betrifft, so lag sie gleichfalls auf dieser Ebene. Darum ist die Frage, warum er sich 1375 immer noch im offiziellen Stand des cives befand, ebenso berechtigt wie interessant. Dieser offizieller Status, der seinem faktischen keineswegs entsprach, ist umso auffallender, als all die hochedlen Bartenslebens, Alvenslebens und wie sie sonst heißen mögen, wahrscheinlich ebenso wenig Altadlige waren wie die Bismarcks, sondern auch nur aufgestiegene Ministeriale (Dienstmannen).
Allerdings gibt es einen gewichtigen Unterschied: Die Bartenslebens und Alvenslebens waren immer auf dem Land, die Bismarcks dagegen lange Zeit in der Stadt, wenn auch als Patrizier. Das war ihr ständischer Sündenfall. Auch hat Klaus von Bismarck, entsprechend seiner alten Taktik, möglichst mehrere Wege offen zu halten und nicht ohne Not Brücken abzubrechen, im Jahre 1370 insofern in Stendal wieder Fuß gefasst, als er dort vor dem Uenglinger Tor das Gertrauden-Hospital stiftete, das bis ins 20. Jahrhundert hinein im Besitz der Familie Bismarck war und als Gebäude heute noch existiert.
Wenn die neuen Herrscher der Mark Brandenburg, Karl IV. und seine Söhne, keine Veranlassung sahen, den Schlossherrn von Burgstall auch noch ständisch zu bestätigen, dann mag ihre nahezu feindselige Zurückhaltung zunächst nicht recht verständlich sein, schließlich hat Klaus von Bismarck als Stiftshauptmann unter dem Erzbischof Dietrich, dem politischen Quartiermacher Karls IV., jene Ziele der königlich-kaiserlichen Hausmachtpolitik, die sich auf Brandenburg und Magdeburg bezogen, zumindest indirekt unterstützt. Doch es scheint, als sei Klaus vor der sich immer stärker abzeichnenden Machtfülle des böhmischen Königs und deutschen Kaisers allmählich zurückgeschreckt – vor einer Macht, die sich in eigenartiger Weise durch einen Klerikalismus verstärkte, der nur scheinbar dem Papst dienstbar war, tatsächlich aber den Papst dem Kaiser dienstbar machte.
Klaus von Bismarck versuchte allerlei diplomatische Kombinationen und Konnexionen ins Werk zu setzen, um seine Schlossgesessenheit zu schützen. Die Hausmachtbestrebungen der Wittelsbacher unter Ludwig dem Bayern konnte er viel unbeschwerter unterstützen, politisch wie finanziell. Damals befanden sich die beiden Universalgewalten, Papst und Kaiser, in Kollision; unter Karl IV. waren sie unter der Vorherrschaft von Kaiser und König verbündet. Das war wohl der entscheidende Grund, warum Klaus von Bismarck in der politischen Krisenzeit von 1369 bis 1373, als sich der Wechsel des Herrscherhauses in der Mark Brandenburg ankündigte und vollzog, keineswegs eindeutig für den Kaiser und Böhmenkönig aus luxemburgischem Haus gegen die Wittelsbacher Stellung bezog. Deshalb wurde dem Schlossherrn von Burgstall die formelle Standeserhöhung nicht zugestanden.
Im Jahr 1377 starb Klaus von Bismarck siebzigjährig, ein Jahr vor Karl IV. Jeder der beiden Männer hatte in seinem Wirkungskreis Bedeutendes geleistet. Sie waren stark im Festhalten an einmal gesteckten Zielen und einfallsreich auf allen Wegstrecken, in vielen ihrer Handlungen skrupellos, nur banal waren sie nie. Der Egoismus, mit dem ein Klaus von Bismarck seine Schlossgesessenheit und seine Reichtümer verteidigte und profitabel zu nutzen verstand, reichte schon ins zukunftsweisende Allgemeininteresse der Gesellschaft hinein. Nicht nach Raubritterart wollte er seinen Schlossbesitz zu Burgstall verteidigen oder gar Rache nehmen an Stendal; vielmehr bemühte er sich mit seiner Geburtsstadt um den Landfrieden gegenüber der räuberischer Willkür heruntergekommener Landadliger. In der Finanzverwaltung wirtschaftete er nicht nur in seine eigene Tasche, sondern wirkte auch mit am Aufbau jener staatlichen Institutionen, die sich an die Ware-Geld-Beziehungen in der Gesellschaft anpassten. Seine leitende Tätigkeit im Erzbistum Magdeburg, das eine Machtbastion von Kaiser Karl IV. bildete, stand keineswegs im Widerspruch zur antikurialen Haltung in der Zeit seines Stendaler Patriziertums – eben weil Karl IV. im Grunde auch die Machtansprüche des Papstes bekämpfte, nicht mit den Mitteln offener Konfrontation, sondern schleichender Unterwanderung durch Vertraute am päpstlichen Hof in Avignon und das Zur-Schau-Stellen traditionell-katholischer Staatsfrömmigkeit.
Sicherlich stand Klaus von Bismarck an Bildung und Macht weit unter Karl IV., und im Vergleich zur genialen Tücke des Kaisers operierte er auf einem niedrigeren Niveau und in einem eingeengten Bereich. Dennoch lag seine Art, Politik und Geschäft miteinander zu verbinden, über dem zeitgenössischen Durchschnitt. Er war wendungsreich in seinem Handeln, aber nicht charakterlos. Die Konstanten seines Wirkens waren einerseits Abwehr der supranational-überzentralistischen Machtansprüche des Papstes, aber auch des Kaisers, andererseits Bekämpfung des staatszerstörerischen Fehdewesens niedriger Adliger. Klaus von Bismarck mag der Zentralisation in der Dezentralisation beim Auf- und Ausbau des Territorialstaates vorgearbeitet haben; doch sein Anliegen war unter den gegebenen Verhältnissen realistisch.
Die Vorstellungen Kaiser Karls IV., die Kurfürsten könnten als Teilhaber an der Reichsregierung in die Zentralregierung integriert werden, insbesondere durch die Einrichtung eines jährlich mit dem Kaiser zusammentretenden Kurfürstenrates, erwiesen sich als illusionär, vielmehr wurde die in der Goldenen Bulle formulierte Landeshoheit der Kurfürstentümer ein weiteres Sprengmittel. Es machte ein solidarisches Zusammen- und Mitwirken, das das Kaiserreich hätte zentralisieren und stärken sollen, unmöglich. Darüber hinaus wirkte die kurfürstliche Landeshoheit als erstrebenswert für die anderen Fürsten. Sie wurden im Beziehungsgeflecht und Kräftemessen der Klassen und Staaten untereinander so stark, dass sie sich sowohl gegen feudale Gewalten, die unter ihnen standen, gegen kleine Landadlige und die in der Goldenen Bulle fast feindselig behandelten Städte als auch gegen den König und Kaiser in einem hohen Maß politisch durchsetzen konnten. Die Territorialfürstentümer wuchsen an Macht sogar über den Hochadel hinaus – derart, dass kein königliches Geschlecht daran denken konnte, sich empor und gesund zu morden, wie das ein Jahrhundert später in den englischen Rosenkriegen geschah.
Klaus von Bismarck erlebte die Kirchenspaltung nicht mehr, die durch die Doppelwahl von Päpsten im Jahre 1378 eingeleitet wurde; vielleicht hätte er dieses Schisma mit einiger Genugtuung hingenommen, aber berührt hätte es ihn nicht sonderlich. Karl IV. hingegen musste noch erleben, dass gegen den von ihm unterstützten Papst ein Gegenpapst gewählt wurde; zwei Monate danach starb der Kaiser – wohl im kummervollen Bewusstsein, dass er keine Gewalt mehr über die Kurie hatte und die Kirche in ihrem Aus- und Ansehen eine hyperkatholische Staatsfrömmigkeit nicht mehr so recht gestattete.
Die Zukunft stand im Zeichen des weiteren Niedergangs der beiden supranationalen Zentralmächte, des Papsttums wie des Kaisertums; doch gerade deswegen blieben sie weit über das kommende Jahrhundert hinaus zentrale Gegenstände des Streites zwischen den Klassen, Schichten, Parteien, Staaten, ja Völkern. Sollte das Papsttum mit all seinem Dogmen- und Ausplünderungssystem reformiert oder gestürzt werden? Musste man das Kaisertum mit seinen mehr fiktiven als realen Herrschaftsrechten überhaupt anerkennen, und wenn ja, inwieweit? Beim Für und Wider um diese Fragen schieden sich die Geister an den Höfen und in den überall wachsenden Städten mit ihren sozialen Differenzierungen, ihren politischen und ideologischen Auseinandersetzungen. Allein schon unter diesen Blickpunkten war das 14. und 15. Jahrhundert das Zeitalter der Vor-Reformation.
KAPITEL 2
Reformation und Gegenreformation
Im Windschatten der Geschichte
Wenn das 14. und 15. Jahrhundert das Zeitalter der Vor-Reformation ist, dann bildet die aus sozialen und nationalen Gegensätzen gewachsene Hussiten-Bewegung ihren Höhepunkt – sie ist die frühe revolutionäre Gegenposition zu Papst- und Kaisertum, das Wetterleuchten der gewaltigen Gewitterstürme von Reformation und Glaubenskriegen im 16. Jahrhundert.
In einer merkwürdigen Dialektik von Zusammenwirken und Aufeinanderstoßen bildeten sich in diesen drei Jahrhunderten materiell und geistig die europäischen Nationen heraus – als gesellschaftliches Gefüge des Feudalismus, das über ihn hinauswies und sich erst im Kapitalismus voll entfaltete. Politisch waren diese frühen Nationen sehr verschieden geartet: Während sich das französische Königtum im Hundertjährigen Krieg gegen England, dann auch gegen die großen Vasallen behauptete und sich das englische Königtum in den Rosenkriegen durch Ausrotten hochedler Aristokratengeschlechter empor und gesund mordete, erstarkten in Deutschland die Landesfürsten zu Lasten des König- und Kaisertums.
In dieser Welt des allseitigen und weiterführenden Umbruchs, ihrer Größe kaum gewahr werdend, lebten die Nachkommen und weiteren Nachfahren des Klaus von Bismarck als politisch passive Nutznießer dessen, was seine vielseitige Aktivität zusammengebracht hatte. Familienhistoriker glaubten zu loben, wenn sie über solche Nachkömmlinge fast rührselig schrieben: Sie »folgten dem Zug nach ländlicher Zurückgezogenheit und den Freuden der Jagd«;1 oder: Sie waren »fern vom Treiben des Hoflebens und von den großen Ereignissen der Weltgeschichte als friedliche Untertanen wesentlich mit dem Betriebe der Landwirtschaft und Ausübung des edlen Waidwerks auf dem ergiebigen zu Burgstall gehörigen Revier beschäftigt«.2 Ungewollt verrät dieses Rühmen: Im Windschatten der Geschichte lebend, frönten die Bismarcks in all den Jahrzehnten bis ins 16. Jahrhundert hinein einem spießerhaften Egoismus, der kaum über den Horizont ihres Gutes und ihres Waldes hinausging.
Mit diesem Gut als solchem war es nicht einmal weit her: Wie überall in der Mark Brandenburg und in deutschen Landen überhaupt war der Eigenbetrieb der Feudalherren noch sehr klein, es dominierte übermächtig die Rentengrundherrschaft. In der Altmark waren in den einhundertfünfundsiebzig Dörfern siebenundachtzig und ein halbes Prozent des Hufenlandes im bäuerlichen Betrieb, der aber zinspflichtig gegenüber dem Grundherrn war. Abgesehen von ihrem ausgedehnten Waldbesitz war der landwirtschaftliche Eigenbetrieb der Bismarcks klein, aber die Eigentums- und Herrschaftsrechte über die Bauern erwiesen sich als recht umfangreich. Von den Bauern, die ihr Getreide selbst auf den städtischen Markt brachten, erhielten sie trotz sinkender Getreidepreise und steigender Preise für städtische Produkte so viel an Geldrenten, die durch Fronarbeiten ergänzt wurden, dass der Schlossbesitz und der Betrieb der Land-und Waldwirtschaft gesichert waren und die eisernen Geldtruhen gefüllt. Da bis Ende des 15. Jahrhunderts die Verflechtung der adligen Landbesitzer mit der Marktwirtschaft minimal, die Verwaltung des Ganzen leicht und das Einfordern der Arbeits- und vor allem Geldrenten relativ einfach waren, konnten die Herrschaften von Burgstall in der Tat dem »edlen Waidwerk« unedel nachgehen.
Was von den Taten der Enkel des Klaus von Bismarck der Nachwelt überliefert blieb, war ein lausiger Streit mit dem Domkapitel von St. Nicolai zu Stendal über die Frage, wem denn die bäuerlichen Untertanen der Dorfschaft Buchholz die sogenannten Holzpfennige zu entrichten hätten – ein Streit, den Lobschreiber später wegen der vom Domkapitel ausgesprochenen Exkommunikation zum kulturkämpferischen Ereignis aufplusterten, dabei schlugen die Klerikalen gerade damals mit der Waffe der Kirchenstrafe derartig leichtfertig um sich, dass sie schon stumpf geworden war. Es war zu offensichtlich, dass man von der Seele sprach und die Pfennige meinte. Streithähne konnten die Bismarcks allenfalls sein, aber Kämpfer keinesfalls. Zwei andere Bismarcks fanden Unterschlupf in kurfürstlichen Diensten, aber nur in untergeordneten Positionen: Einer war Heidereiter, also – wie es später hieß – Oberförster; der andere Amtmann zu Bötzow, dem heutigen Oranienburg. Ob die Herrschaften ihren Sitz auf dem Schlossgut oder im Amtshaus hatten, das Bismarcksche Geschlecht blieb lange Zeit im Sinne eines aktiven Mitgestaltens geschichtslos.
Allerdings streifte die Herren von Burgstall zu Beginn des 15. Jahrhunderts der kalte Wind der Geschichte. Im Jahr 1412 schickte Kaiser Sigismund, der Sohn Karls IV., den Nürnberger Burggrafen Friedrich I. von Hohenzollern als Landeshauptmann in die Mark Brandenburg, wo er im Innern den Landfrieden gegen die widerborstige Willkür schlossgesessener Adliger sichern sollte, aber auch den Frieden nach außen – gegen den aufsässigen Herzog von Pommern und den gefährlich gewordenen König Polens, der im Verein mit dem Großfürsten von Litauen 1410 den Deutschen Orden bei Tannenberg besiegt hatte. Zeitweilig unterstützt von den fürstlichen Nachbarn Brandenburgs, die alle gleichermaßen unter dem adligen und hochadligen Raub- und Fehdewesen litten, ließ Friedrich von Hohenzollern jene Burgen schleifen, die Zentren eines Land und Leute plagenden und plündernden Treibens waren – Burgen übrigens, die die uradligen Gans zu Putlitz in der Prignitz, die Quitzows in der Mittelmark und einige Alvenslebens in der Altmark unter dem prekären Rechtstitel des Pfandbesitzes erschlichen und erpresst hatten.
Gegen die Hauptschlösser war nur mit den neuesten Belagerungsgeschützen etwas auszurichten. Friedrich von Hohenzollern führte sie ins Feld und siegte nach einem längeren Befriedungsfeldzug, der im Winter 1413/14 begann. In den Jahren 1414 bis 1416 übernahm der Enkel des Klaus von Bismarck (Klaus III., vor 1385 – nach 1431) für den geldarmen Fürsten mehrmals Bürgschaften, bei denen er wahrscheinlich auch mit klingender Münze einspringen musste; aber nichts ist überliefert, dass er etwa wie sein Großvater die Finanzopfer in politischen Einfluss umgemünzt hätte. Dazu war er weder von seiner persönlichen Statur her noch von seiner historischpolitischen Lage aus imstande. Fast alles spricht dafür, dass der dritte Klaus von Bismarck unter einem Zwang stand, dem Namen nach Bürgschaft, der Sache nach Tribut zu leisten. Nachdem der letzte der Luxemburger Markgrafen diesen Klaus mit seinem Bruder erst 1409 als Schlossgesessene zu Burgstall anerkannt und damit den dortigen Bismarcks die ständisch prekäre Zwischenstellung genommen hatte, ist es mehr als wahrscheinlich, dass der erste der Hohenzollernschen Markgrafen – Burggraf Friedrich war 1415 vom König dazu ernannt worden – für die Sicherung des neuen Rechtstitels harte Gegenleistung verlangte, zumal die Bismarckschen Bürgschaftsleistungen nahezu zeitgleich erfolgten mit den Befriedungsaktionen gegen die schlimmsten Rebellen unter den Schlossbesitzern.
Wie die Landespolitik in die Reichs- und Kirchenpolitik hineinreichte – und zwar in direkter und kompakter Weise -, sollte sich bald zeigen. Kurze Zeit nachdem das von König Sigismund lange vorbereitete und unter seinem Vorsitz tagende Konstanzer Konzil zusammengetreten war, floh Papst Johannes XXIII., der schon halb und halb in seine Abdankung eingewilligt hatte, zum Tiroler Erzherzog. Es war dann Friedrich von Hohenzollern, der als Feldhauptmann half, den erzherzoglichen Rebellen und Beschützer des geflohenen und abdankungsreifen Papstes in einem kurzen Feldzug zu besiegen; das erst brachte die Beratungen des Konzils, welches das Schisma beseitigen und die Kirche reformieren sollte, in Gang. Der Papst wurde nicht nur abgesetzt, auch sein Name Johannes XXIII. gleichsam gelöscht. Erst in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts wurde er von einem römischen Pontifex wieder angenommen. Dem Hohenzollern Friedrich konnte König Sigismund die ihm erwiesenen Dienste nicht anders entlohnen, als ihm die Markgrafschaft Brandenburg und die damit verbundene Kurwürde zu übertragen.