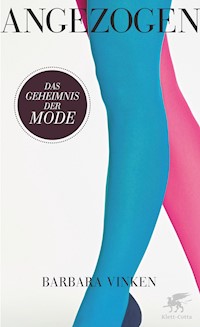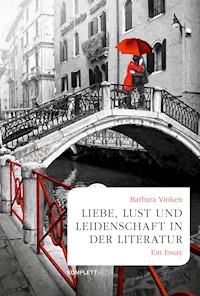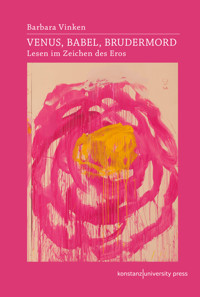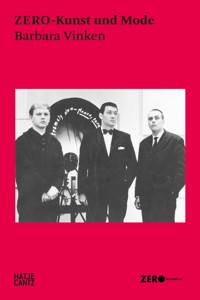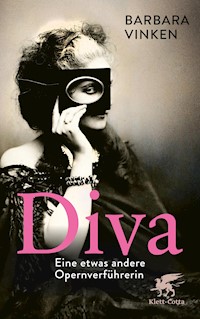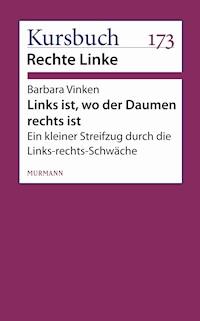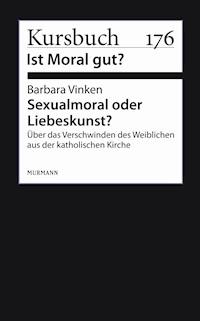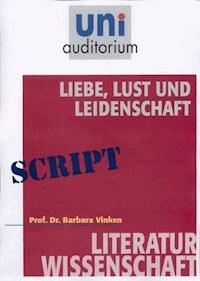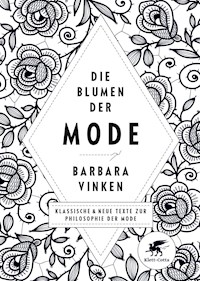
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mode und Kleidung als vielschichtiges Mittel des Selbstausdrucks und der Kommunikation fasziniert Schriftsteller, Philosophen und Soziologen gleichermaßen. Der Band versammelt 45 essentielle Schriften vom 18. bis zum 21. Jahrhundert, jeweils kenntnisreich eingeleitet von Barbara Vinken. Schon immer haben die Menschen mit der Art, sich zu kleiden, mehr intendiert, als ihre Blöße zu bedecken und den Körper zu wärmen. Repräsentation und Rang, Distinktion und Individualität, Männerbilder und Frauenrollen spiegeln sich in Kleidung, Mode, Schmuck. Entsprechend vielfältig und faszinierend tiefgründig präsentiert sich das Nachdenken über Mode quer durch die Jahrhunderte. Der Band versammelt, beginnend mit Mandeville und Jean-Jacques Rousseau, sowohl klassische Texte als auch die führenden zeitgenössischen Gedanken zu einem Thema, dessen kulturelle Bedeutung heute immer klarer erkannt wird. Jedem Text sind einleitende Worte der Herausgeberin vorangestellt, welche die Hintergründe, zeittypischen Ideen und Menschenbilder beleuchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 942
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2016 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Printed in Germany
Sämtliche Bilder: Michaela Melián © Michaela Melián
Cover: ANZINGER | WÜSCHNER | RASP, München
unter Verwendung einer Abbildung von ajuga/iStockphoto
Innengestaltung: Marion Köster und Katrin Kleinschrot, Stuttgart
Gesetzt von Kösel Media GmbH, Krugzell
Printausgabe: ISBN 978-3-608-94910-0
E-Book: ISBN 978-3-608-10031-0
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Inhalt
Blütenlese
BernardMandeville
Aus: Die Bienenfabel
Jean-JacquesRousseau
Aus: Julie oder Die Neue Héloise: Der einundzwanzigste Brief
An Julien
GiacomoLeopardi
Die Mode und der Tod
Georg Wilhelm FriedrichHegel
Aus: Ästhetik: Bekleidung
HeinrichHeine
Aus: Reise von München nach Genua: Kapitel XVII
Honoréde Balzac
Aus: Physiologie des eleganten Lebens: Über die Toilette in allen ihren Teilen
ThomasCarlyle
Aus: Sartor Resartus: Die Körperschaft der Dandys
ThéophileGautier
Mode
CharlesBaudelaire
Aus: Der Maler des modernen Lebens: Lobrede auf das Schminken
CharlesBaudelaire
Aus: Der Maler des modernen Lebens: Der Dandy
StéphaneMallarmé
Aus: Die neueste Mode: Mode
FriedrichNietzsche
Aus: Menschliches, Allzumenschliches: Fragment 215
ÉmileZola
Aus: Paradies der Damen
AdolfLoos
Die Herrenmode (22. Mai 1898)
Damenmode (21. August 1898)
ThorsteinVeblen
Aus: Theorie der feinen Leute: Die Kleidung als Ausdruck des Geldes
GeorgSimmel
Die Mode
EduardFuchs
Aus: Die Frau in der Karikatur: Ich bin der Herr dein Gott!
WernerSombart
Aus: Liebe, Luxus und Kapitalismus: Die Entfaltung des Luxus: Der Sieg des Weibchens
GuillaumeApollinaire
Aus: Der gemordete Dichter: Mode
MarcelProust
Aus: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit: Die Gefangene
EdmondGoblot
Aus: Klasse und Differenz: Die Mode
SigmundFreud
Fetischismus
John CarlFlügel
Die Psychologie der Kleidung
Die Emanzipation der Frauen in der Bekleidung
HelenHessel
Sommerliche Abendkleider
WalterBenjamin
Aus: Das Passagen-Werk: Konvolut B [MODE]
Simonede Beauvoir
Aus: Das andere Geschlecht: Gesellschaft
RenéKönig
Aus: Menschheit auf dem Laufsteg: Mode und Massenkonsum
RolandBarthes
Das Match Chanel-Courrèges
FriedrichKittler
Mode/Ausziehbarkeit
PierreBourdieu und YvetteDelsaut
Die neuen Kleider der Bourgeoisie
ElizabethWilson
Aus: In Träume gehüllt: Geschlecht und Identität
KajaSilverman
Mode und Blick: Fragmente eines modischen Diskurses
BarbaraVinken
Aus: Mode nach der Mode: Martin Margiela. Zeichen der Zeit
AnneHollander
Aus: Anzug und Eros: Sex und moderne Form
ValerieSteele
Aus: Fetisch. Mode, Sex und Macht: Mode, Fetisch, Phantasie
Ein Fetisch ist eine Geschichte in der Maske des Objekts
UlfPoschardt
Mode und Militär
CarolineEvans
Aus: Fashion at the Edge: Vier Phantasmagorien
Blendwerk
AndreasKraß
Metrosexualität oder: wie schwul ist der moderne Mann?
I. Lonesome Metro-Cowboys
KatharinaSykora
Aus: The Queen stripped bare, Luise von Preußen oder Wenn Mode Politik macht
ThomasOláh
Kunst und Krieg, Mode und Armee: Camouflage!
HanneLoreck
La Sape: Eine Fallstudie zu Mode und Sichtbarkeit im postkolonialen Kontext
Das Phänomen
ThomasMeinecke
Aus: Lookalikes
MichaelMüller
Apartheid der Mode
Eine symboltheoretische Revision der formalen Modesoziologie
1. Jenseits der Ästhetik: ›Die Logik‹ der Mode
2. Liminale Ästhetik: Vom dionysischen Kunstwerk zur Hyperbolik der Mode
3. Mediale Steigerung: Der Ausnahmecharakter der Mode
NoraWeinelt
Aus: Minimale Männlichkeit: »Boys don’t cry«. Über Kitsch und Körper bei Hedi Slimane
PhilippEkardt
Eleganz und Material. Über einige modetheoretische Gegensätze bei Helen Grund und Walter Benjamin
Die Expertin
Literaturangaben
Elizabeth Wilson
Kaja Silverman
Valerie Steele
Caroline Evans
Andreas Krass
Thomas Oláh
Hanne Loreck
Michael Müller
Philipp Ekardt
Danksagung
Autorenbiographien
Die Herausgeberin und Verfasserin der Einleitungen zu den Texten
Die Künstlerin
BLÜTENLESE
»... eigentlich ist Mode ja Rechnen.
Und zwar mit allem. Mit allem muss man rechnen.«
Das Licht im Kasten (Straße? Stadt? Nicht mit mir!) (2016)
von Elfriede Jelinek
Die vorliegende Anthologie versammelt das Einflussreichste, Eigenwilligste, Schönste, Schrägste und manchmal auch Ätzendste, was über die Mode in den letzten dreihundert Jahren geschrieben wurde – wilde, gewagte, gestrenge, prächtige und auch manche giftige Blüten. Ein paar übersehene Mauerblümchen und ein paar unverhoffte Funde bei den Klassikern sind darunter. Eigentlich haben alle irgendwann einmal über Mode nachgedacht. Und geschrieben. Es ist deshalb unvermeidlich, dass eine Auswahl etwas Unvollkommenes, Ungerechtes an sich behält. Sicher habe ich das eine oder andere übersehen, sicher nicht allem das verdiente Gewicht gegeben und vielleicht manches überschätzt.
Trotzdem hoffe ich, dass die Lektüre die Mode in ein anderes als das gewohnte Licht rückt und anders über sie zu denken gibt. Die Textauswahl hat nicht nur die Texte aufgenommen, die die Mode als weibisch verurteilten, sie in Bausch und Bogen verdammten, eine endlich moderne Ästhetik auch für die Damenmode forderten – kurz, Modedämmerung für eine endlich aufgeklärte Welt prophezeiten. Diese sehr maskulinistische Stimme, selbst wenn sie von Frauen geschrieben wurde, bildet den basso continuo der Modetheorie.
Diese Anthologie hingegen zeichnet vor allen Dingen den Weg von Denkrichtungen nach, die der Mode gerecht werden wollten: von der Moral und der Ökonomie über die Soziologie und Psychologie bis zu einer psychoanalytisch sensibilisierten Ästhetik. Der Mode als dem Terrain par excellence, auf dem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwischen den Anciens et Modernes vor allen Dingen in Frankreich eine neue Poetik und eine neue Ästhetik entwickelt wird, habe ich dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Eines jedenfalls ist klar: Mode ist bis heute nicht konsensuell. So sehr auf der Hand liegt, dass es sie gibt und dass es kein Entkommen vor ihr gibt, so deutlich gilt ihr Dasein vielen als verdammenswert, manchen als vernachlässigenswert, längst nicht allen als berechtigt und einigen als das Feld schlechthin, auf dem die Ästhetik der Moderne und der Postmoderne erblüht und Gesellschaften sich kritisch ins Bild setzen, aus dem Bild fallen.
Für die einen ist die Mode Indiz der ewig gleichen menschlichen Eitelkeit, Gefallsucht und Statussucht. Vielen ist sie nach wie vor Zeichen einer ebenso tyrannischen wie barbarischen Klassen- und Geschlechterhierarchie. Sie gilt ihnen als Symptom dafür, dass die modernen Gesellschaften von ihrem Ideal der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit weit entfernt sind.
An der Mode, das scheint offenbar, lässt sich die Ungleichheit aller und die Verdinglichung und Selbstentfremdung des weiblichen Geschlechtes im Besonderen immer neu ablesen. So gilt sie vor allem als der Produktionszweig, in dem Menschen und Natur auf einem Markt ausgebeutet werden, der es wie kein anderer versteht, Illusionen zu verkaufen.
Für die anderen ist die Mode ein kostbares Kulturgut, der reflexive Ort, an dem unsere Gesellschaften Rassen-, Klassen- und geschlechtliche Identitäten verhandeln. Ist sie dabei einmal in immanenter Eleganz das sicherste Mittel, den Tod im Leben verhüllend aufzuheben, so ist sie dann auch ein wahrhaftiges Medium der Erkenntnis, das die Zeichen der Vergänglichkeit nackt, fast obszön an den Tag bringt.
Erkennen die einen also eher eine Befestigung der Geschlechter- und Klassenhierarchie, so begrüßen die anderen deren Offenlegung und Verrückbarkeit. Indem diese Hierarchien nicht mehr die natürlichste Sache der Welt sind, sondern als eine mit sehr viel Kunstfertigkeit hervorgebrachte Ordnung erscheinen, wird diese Ordnung lesbar und damit veränderbar.
Am Ende ist die Mode ein Theater der Obsessionen, in dem Bedrohungen, Ängste und deren Abwehr, Verlockungen, aber auch individuelle und kollektive Traumata zur Anschauung kommen. Sie ist sicher nicht immer schön und elegant. Formvollendeter Esprit und leichthändiger Witz sind ihr aber, sieht man nur hin, kaum abzusprechen. Das sollten auch die hier zum Strauß gebundenen Blumen der Mode eine nach der anderen beweisen.
BERNARDMANDEVILLE
1714
Mandevilles Kommentar zu seiner Bienenfabel ist einer der erstaunlichsten Texte zu Luxus und Mode; seine Betrachtungen sind in immer neuen Varianten zum Grundstock einer Soziologie der Mode geworden. Mandeville argumentiert in der Linie der großen französischen Moralisten. Eigeninteresse und Selbstliebe, die zu Stolz und Eitelkeit führen, sind lasterhafte Antriebsfeder eines jeden Menschen. Fast jeder verkennt diese Antriebsfeder und ist sich und seinem Verhalten gegenüber blind; aber – und hier weicht Mandeville von den Moralisten wie La Bruyère oder La Rochefoucauld ab – das ist gut so. Denn Stolz und Eitelkeit verdanken wir das Blühen der Volkswirtschaft. So manchem mag schummerig werden, wenn frivole, gaukelhafte Täuschung, der blendende Schein, ja, das Vergänglichste, Wankelmütigste schlechthin, die vanitas nämlich, zur Grundlage einer soliden Wirtschaft, zum Fundament des Reichtums einer Nation werden soll: Schall und Rauch.
Eigeninteresse und Selbstliebe als Nährboden aller anderen Laster sind Sünden – aber sie sind der Nation nützliche, ja notwendige Laster. Anders als Voltaire, der wenig später den Luxus für eine wunderbare Sache halten sollte, weil er nicht nur die Volkswirtschaft befördert, sondern den Menschen vervollkommnet und ins verlorene Paradies zurückversetzt, hält Mandeville an der blinden, verblendeten Sündhaftigkeit als Grund des Luxus fest. Alle anderen, üblicherweise vorgebrachten Argumente für gutes Anziehen, wie etwa Respekt vor dem Berufsstand oder Höflichkeit dem anderen gegenüber, hält er für bloße Ausreden, die den wahren Beweggrund eskamotieren.
Aber an Eigeninteresse und Selbstliebe soll man um Himmels willen nicht rühren. Denn was für den Einzelnen unter moralischen Gesichtspunkten verheerend, ist für die Wirtschaft unter ökonomischen Gesichtspunkten nötig. Aus Lastern erwächst Wohlstand, Stärke und Wehrhaftigkeit einer Nation. Stolz und Eitelkeit führen zu einer großen Nachfrage, die Arbeitslosigkeit verhindert. Nicht Sparsamkeit, sondern Verschwendung, die später bei dem Ökonomen Keynes deutlich freundlicher »effective demand« heißen sollte, ist für eine Volkswirtschaft nötig. Verschwenderische Verausgabung führt nach Mandeville nicht zu weibischer Dekadenz, wie Montesquieu und später Rousseau argumentieren, sondern zu ökonomischer Vitalität und Wehrhaftigkeit des Staates.
Unter Stolz versteht Mandeville blinde Selbstüberschätzung; die Moden sind das Medium, in dem diese Selbstüberschätzung sich austobt. Hier kann man sich, mit Freud zu sprechen, ganz als Held seiner Tagträume investieren. Mandeville lebte in einem Jahrhundert, in der die Moden die Stände eher als die Geschlechter trennten. Kleider machen Leute. Da die Welt in ihrer Einschätzung des Gegenübers nach dem Äußeren geht, kann man hier mit relativ wenig Mitteln mehr scheinen, als man ist, und so im »Modewahn« Stolz und Eitelkeit befriedigen. Lächerliche Selbstüberschätzung, groteske Wichtigtuerei, stolze Gockelei dienen so dem Wohle des großen Ganzen – ja, sie sind ökonomisch unabdingbar. Würden sich alle Leute eines Besseren besinnen und sich bekehren, würde die Wirtschaft schlicht zusammenbrechen.
Mandevilles Analyse der Mode nimmt viele Momente späterer Modeanalysen vorweg: conspicuous consumption, vicarious display, trickle down – all das ist bereits bei Mandeville angelegt.
1. Die unteren Stände ziehen sich an, als ob sie zu einem höheren Stand gehören würden. Mode hat deshalb etwas mit Verkleidung, mit Travestie zu tun. Das eitle Begehren, mehr zu scheinen, als man ist, ist stärker als alle wirklichen, kreatürlichen Bedürfnisse wie etwa der Hunger: Man spart sich die Kleider vom Munde ab.
2. Neue Moden kommen auf, wenn die unteren Stände die Mode des oberen Standes nachgeahmt haben. Letzten Endes führt das Begehren der Distinktion zu einer unglaublichen Verschwendung; es geht immer noch anders und raffinierter – und der Markt boomt. Aber nicht nur der Markt, auch das Ingenium, das Genie, etwas nie Dagewesenes zu erfinden, die Kreativität wird durch diesen Schrei nach dem Neuen ungeheuer befördert.
3. Die Männer ziehen hier schon ihre Frauen als ihre Statussymbole an.
Aber anders als die meisten seiner Nachfahren will Mandeville an dem von ihm analysierten Stand der Dinge nichts ändern, ja, er warnt sogar eindringlich vor allen Reformversuchen. Über diesem Traktat steht trotz der messerscharf sezierten Missstände nicht: reform. Alles soll so bleiben, wie es ist, und ist aufs Beste eingerichtet. Denn: private Laster sind öffentliche Tugenden.
Aus: Die Bienenfabel
Stolz oder Selbstgefühl ist jene Naturanlage, vermöge deren sich jeder Sterbliche einbildet, besser und mehr wert zu sein, als ein unparteiischer Beurteiler, der mit allen seinen Eigenschaften und Lebensumständen gründlich bekannt wäre, ihm würde zugestehen können. Wir besitzen keine andere für die Gesellschaft so ersprießliche und für ihr Gedeihen und Blühen so notwendige Eigenschaft wie diese, und doch wird gerade sie am allgemeinsten verabscheut. Sehr bemerkenswert an dieser unserer Anlage ist, daß diejenigen, denen sie am meisten zukommt, am wenigsten bereitwillig sind, sie bei anderen zu ertragen, während die Häßlichkeit anderer Fehler gerade von denen am eifrigsten geleugnet wird, die sich selbst ihrer schuldig machen. Der Keusche haßt alles Unzüchtige, und die Trunksucht verdammt keiner so sehr wie der Mäßige; aber niemand ist über seines Nächsten Stolz so empört wie der Allerstolzeste, und wenn irgend jemand ihm verzeihen kann, so ist dies der Bescheidene. Woraus wir, denke ich, folgern dürfen, daß das Schelten aller über den Stolz ein sicheres Zeichen dafür ist, daß alle an ihm laborieren. Dies wird auch von jedem verständigen Menschen gern zugegeben, und keiner bestreitet, daß er Stolz im allgemeinen besitzt. Handelt es sich aber um spezielle Fälle, so wird man nur wenige finden, die eingestehen werden, daß irgendeine ihrer Handlungen, die man etwa nennt, aus diesem Prinzip entsprungen sei. Ebenso gibt es viele, die einräumen, daß in den Ländern, wo die Sünde herrscht, Stolz und Hoffart die großen Beförderer des Gewerbes sind, die aber nicht die Notwendigkeit anerkennen mögen, daß in einem sittenreineren, von Demut erfüllten Zeitalter ein beträchtlicher Niedergang allen Gewerbes eintreten müßte.
Der Allmächtige, sagen sie, hat uns mit der Herrschaft über alle Dinge, so Land und Meer hervorbringen oder enthalten, ausgestattet; in keinem dieser Dinge findet sich etwas, das nicht zum Nutzen des Menschen gemacht wäre, und sein überragender Scharfsinn und Fleiß wurde ihm gegeben, um das übrige Getier, und was sonst im Bereich seiner Sinne ist, sich dienstbar zu machen. Auf diese Überlegung hin halten sie es für gottlos, sich vorzustellen, daß Bescheidenheit, Mäßigkeit und andere sittliche Vorzüge die Menschen vom Genuß jener Lebensfreuden ausschließen sollten, die den verworfensten Völkern nicht vorenthalten sind, und so schließen sie denn, daß auch ohne Stolz und Luxus dasselbe verzehrt, getragen und verbraucht, die gleiche Zahl von Arbeitern und Handwerkern beschäftigt werden und eine Nation in jeder Weise ebenso gedeihen könne wie dort, wo jene Laster am verbreitesten sind.
Was speziell das Tragen von Kleidung anbelangt, so werden sie sich dahin aussprechen, daß der Hochmut, der uns näher ist als unsere Kleider, bloß im Herzen wohne und daß oft Lumpen eine größere Portion davon einhüllen als das prächtigste Gewand. Wie es zweifellos stets tugendhafte Fürsten gegeben habe, die demütigen Sinnes ihre strahlenden Diademe getragen und ihre vielbeneideten Zepter geschwungen haben, so sei es auch höchst wahrscheinlich, daß Gold und Silberbrokat und die reichsten Stickereien ohne eine Spur von Stolz von vielen getragen werden, zu deren Rang und Vermögen sie passen. Kann nicht, sagen sie, ein guter Mensch, wenn er ein sehr hohes Einkommen hat, jedes Jahr einen größeren Aufwand in Kleidern machen, als er abzutragen vermag, und nichts anderes dabei bezwecken als dies, den Armen Arbeit zu geben, das Gewerbe zu unterstützen und durch Beschäftigung vieler das Wohl des Ganzen zu fördern? Da außerdem Nahrung und Kleidung unentbehrlich und diejenigen Artikel sind, woran sich hauptsächlich unsere irdischen Sorgen knüpfen, warum sollen da nicht alle Menschen, ohne auch nur eine Idee von hoffärtigem Wesen, einen beträchtlichen Teil ihrer Einnahmen für den einen wie den anderen beiseitelegen? Ja, ist nicht sogar jedes Mitglied der Gesellschaft gewissermaßen dazu verpflichtet, nach Vermögen zur Erhaltung des Gewerbezweiges beizutragen, der ihr als Ganzem in so hohem Maße von Nutzen ist? Überdies: anständig aufzutreten ist eine Höflichkeit und oft eine Pflicht, die wir ohne Rücksicht auf uns selbst unserer Umgebung schulden.
Dies sind die Einwände, deren sich hochmütige Moralisten in der Regel bedienen, Leute, die es nicht vertragen können, wenn die Würde ihres Geschlechts kritisiert wird. Falls wir aber einmal genauer zusehen, werden wir ihnen bald gebührend antworten können.
Wären die Menschen nicht allgemein mit sittlichen Fehlern behaftet, so verstehe ich nicht, warum irgend jemand mehr Kleider besitzen sollte, als er nötig hat, läge ihm auch noch soviel daran, das Wohl des Volkes zu fördern. Denn hätte er beim Tragen feinen Seidenstoffes an Stelle einfachen Zeuges, bei der Wahl eines schönen, aparten Tuches statt eines groben weiter nichts im Auge als die Beschäftigung von mehr Leuten und damit das Allgemeinwohl, so würde er sich doch zur Kleidung überhaupt nicht anders stellen können als Patrioten zu den Steuern: sie bezahlen sie bereitwillig, aber keiner gibt mehr, als er muß, besonders wenn alle ihrem Vermögen gemäß eingeschätzt sind, wie es ja in einem recht tugendhaften Zeitalter nicht anders zu erwarten wäre. Außerdem würde sich in einer solchen goldnen Zeit niemand über seine Verhältnisse anziehen, niemand würde seiner Familie etwas abzwacken, seinen Nächsten betrügen oder übervorteilen, nur um sich schöne Sachen zu kaufen, und infolgedessen würde also nicht mehr halb soviel konsumiert, noch auch der dritte Teil der Leute wie jetzt beschäftigt werden. Um dies aber deutlicher zu machen und zu beweisen, daß für das Bestehen des Gewerbes nichts dem Stolz und der Eitelkeit an Bedeutung gleichkommt, will ich mal untersuchen, worauf es den Menschen bei ihrer äußeren Erscheinung eigentlich ankommt, und feststellen, was uns die tägliche Erfahrung in betreff der Kleidung lehrt.
Kleider wurden überhaupt ursprünglich in zwiefacher Absicht verfertigt: um unsere Nacktheit zu decken, und um unsern Leib gegen das Wetter und andere äußere Unbilden zu schützen. Hierzu hat nun unsere grenzenlose Eitelkeit eine dritte gefügt, nämlich den Schmuck; denn was sonst als ein Übermaß dummen Stolzes hätte unsere Vernunft so weit bringen können, daß wir das für schmückend halten, was uns – anders wie bei allen übrigen Tieren, die die Natur selbst ausreichend bekleidet – dauernd an unsere Schwäche und Armut erinnern müßte! Es ist in der Tat zu verwundern, daß ein so hochentwickeltes Geschöpf wie der Mensch, der so viele edle Eigenschaften für sich in Anspruch nimmt, sich so weit erniedrigt und auf das etwas zugutetut, was er einem so unschuldigen und wehrlosen Tiere wie dem Schafe geraubt hat oder was er dem allerunansehnlichsten Dinge auf Erden, einem sterbenden Wurme, verdankt. Indem er aber auf sein bißchen Beute noch stolz ist, besitzt er die Torheit, über die Hottentotten am äußersten Vorsprung Afrikas zu lachen, die sich mit den Eingeweiden ihrer toten Feinde schmücken, ohne zu bedenken, daß es die Ehrenzeichen ihrer Tapferkeit sind, womit jene Barbaren sich putzen, die wahren spolia opima,1 und daß ihr Stolz, obgleich roher als der unsrige, gewiß weniger lächerlich ist, weil ihre Beute von einem edleren Tiere stammt.
Welche Betrachtungen man aber auch in dieser Angelegenheit anstellen möge, – die Welt hat längst hierüber entschieden. Ein gefälliges Äußeres ist die Hauptsache, Kleider machen Leute, und wenn man einen Menschen nicht kennt, ehrt man ihn gewöhnlich gemäß seiner Kleidung und sonstiger Dinge, die er bei sich führt: nach deren Eleganz beurteilt man seine Geldverhältnisse, aus der Art, wie er sie trägt, schließt man auf seinen Verstand. Dieser Umstand veranlaßt jeden, der sich seines geringen Wertes bewußt ist, sich wenn irgend möglich besser zu kleiden, als seinem Stande entspricht, besonders in großen, volksreichen Städten, wo ganz obskure Leute in der Stunde mit ein paar Dutzend Fremden auf einen Bekannten zusammentreffen und daher das Vergnügen haben, von einer überwiegenden Majorität nicht für das, was sie sind, sondern als was sie erscheinen möchten, gehalten zu werden, – und das ist eine stärkere Versuchung zur Eitelkeit, als für die meisten notwendig ist.
Jeder, der gern Szenen aus dem Volksleben beobachtet, kann zu Ostern, Pfingsten und an anderen hohen Festtagen Hunderte von Leuten, besonders Frauen, aus fast den niedersten Schichten sehen, die gut und modern gekleidet gehen. Läßt man sich mit ihnen in ein Gespräch ein und behandelt sie dabei mit mehr Höflichkeit und Respekt, als sie nach eigenem Wissen verdienen, so schämen sie sich gewöhnlich einzugestehen, was sie eigentlich sind, und oft kann man, falls man sie etwas ausfragt, finden, daß sie ängstlich besorgt sind, ihre tägliche Beschäftigung sowie die Gegend, wo sie wohnen, zu verheimlichen. Die Ursache hiervon ist klar: indem sie sich jene Artigkeiten anhören, die ihnen für gewöhnlich nicht gesagt werden und die sich ihrer Ansicht nach nur für Höherstehende geziemen, haben sie die Genugtuung, sich vorzustellen, daß sie als das erscheinen, was sie zu sein wünschen. Schwachen Gemütern aber verschafft dies ein ebenso wesentliches Lustgefühl, als wenn ihnen jener Wunsch wirklich in Erfüllung ginge. Aus diesem beglückenden Traume lassen sie sich nicht gern aufwecken, und da sie wissen, daß ihre untergeordnete Stellung, falls man sie erführe, sie in unserer Achtung sehr erniedrigen müßte, so hüllen sie sich noch fester in ihre Verkleidung und verwenden alle erdenkliche Vorsicht, um nicht durch eine unnötige Entdeckung das Ansehen zu verlieren, das sie sich durch ihre feine Kleidung erworben zu haben glauben.
Jeder gibt zwar zu, daß wir in betreff der Kleidung und Lebensweise unserer Stellung gemäß auftreten und dem Beispiel der Verständigsten unter den uns an Rang und Einkommen Gleichstehenden folgen sollten. Wie wenige jedoch, die nicht entweder erbärmlich geizig sind, oder als etwas ganz Besonderes gelten möchten, haben sich eines solchen Verhaltens zu rühmen! Wir alle überschätzen uns und streben, es denen so schnell wie möglich nachzumachen, die in irgendeiner Weise höher stehen als wir.
Die ärmste Arbeiterfrau vom ganzen Viertel, der es nicht paßt, einen warmen wollenen Kittel zu tragen, wie sie doch könnte, wird hungern und ihren Mann hungern lassen, um sich einen abgelegten Rock und Mantel, der ihr nicht halb so viel nützen kann, zu kaufen, denn – bei Gott! – es sieht doch feiner aus. Der Weber, Schuhmacher, Schneider und Barbier, überhaupt jeder niedere Handwerker, der sich knapp etablieren kann, ist dreist genug, um sich mit dem ersten Gelde, das er kriegt, wie ein vermögender Professionist zu kleiden; und der gewöhnliche Kleinhändler wieder nimmt sich für die Garderobe seiner Frau seinen Nachbar zum Muster, der mit derselben Ware im großen handelt, wobei er als Grund angibt, daß jener vor zwölf Jahren auch keinen größeren Laden als er selber hatte. Der Drogist, der Schnitt- und Tuchwarenhändler und andere angesehene Geschäftsinhaber können ihrerseits zwischen sich und den Kaufherren keinen Unterschied mehr entdecken, so daß sie wie diese sich anziehen und auftreten. Die Gattin des Kaufherren, die die Anmaßung derer aus dem Handwerksstande nicht ertragen kann, flüchtet daraufhin in das entgegengesetzte Stadtviertel und verschmäht es, einer anderen Mode als der dort herrschenden zu folgen. Diese hochmütige Art alarmiert nun den Hof. Die Damen vom Stande erschrecken darob, die Kaufmannsfrauen und -töchter ebenso angezogen zu sehen wie sie selbst: die Dreistigkeit der Städter, schreien sie, ist unausstehlich. Damenschneider werden herzugeholt, die sich mit allem Eifer der Erfindung neuer Moden widmen müssen, damit sie jederzeit etwas noch nicht Dagewesenes haben, sobald die frechen Spießbürger wieder anfangen, es jenen nachzutun. Der gleiche Wetteifer verbreitet sich über alle sozialen Schichten in unglaublichem Maße, bis zuletzt den hohen Fürstlichkeiten samt allen Hofschranzen, um die unter ihnen zu übertrumpfen, weiter nichts übrigbleibt, als massenhaftes Geld auf kostbare Gewänder, prächtige Möbel, herrliche Gartenanlagen und fürstlich ausgestattete Paläste auszugeben.
Aus diesem Wettstreit und dauernden Streben, sich gegenseitig auszustechen, folgt auch, daß nach all dem Hin und Her und stetigen Wechsel der Moden, wo neue aufgebracht und alte wieder erneut werden, doch für den Findigen stets ein plus ultra übrigbleibt. Und dies oder wenigstens die Folge davon ist es, was den Armen zu tun gibt, den Gewerbefleiß anspornt und den geschickten Handwerker dazu ermutigt, auf weitere Verbesserungen zu sinnen.
Man könnte einwenden, daß viele der Gebildeten, denen es selbstverständlich ist, sich geschmackvoll anzuziehen, aus reiner Gewohnheit und ohne alle Prätensionen elegant gekleidet gehen, und daß der Vorteil, den das Gewerbe aus ihnen zieht, nicht ihrem Dünkel oder einem Wettstreit unter ihnen zuzuschreiben sei. Darauf antworte ich, daß unmöglicherweise diejenigen, die sich so wenig über ihren Anzug den Kopf zerbrechen, jemals hätten elegante Kleider tragen können, wären nicht Stoffe sowohl wie Schnitte zuerst erfunden worden, um der Eitelkeit anderer zu genügen, die an vornehmer Tracht mehr Gefallen fanden als jene. Abgesehen davon, daß nicht jeder ohne Eitelkeit ist, der es zu sein scheint, sind auch nicht alle Symptome dieses Fehlers leicht herauszufinden; sie sind sehr zahlreich und wechseln mit dem Alter, Naturell, Vermögen und oft auch der körperlichen Konstitution der Menschen.
Der cholerische Stadthauptmann, der es nicht abwarten kann, daß er in Aktion trete, drückt seine Wehrhaftigkeit durch kraftvolle Schritte aus und läßt aus Mangel an Feinden seine Picke vor seines Armes Gewalt erzittern. Sein martialischer Aufputz erfüllt ihn, wie er so daherschreitet, mit unsäglicher geistiger Überlegenheit, in der er nun seinen Laden wie sich selbst ganz vergißt und mit dem Feuer eines sarazenischen Eroberers zu den Balkonen emporblickt. Der phlegmatische Ratsherr dagegen, den sein Alter und Ansehen bereits ehrwürdig machten, begnügt sich damit, für einen einflußreichen Mann gehalten zu werden; da er keinen einfacheren Weg weiß, um seine Eitelkeit zu zeigen, so schaut er, in seinem Wagen sitzend, recht würdig drein, wobei er, an seiner Amtstracht kenntlich, in düsterer Pose die Huldigung entgegennimmt, die ihm die Leute niederen Standes zollen.
Der bartlose Fähnrich markiert eine Gewichtigkeit, als wäre er noch einmal so alt, und strebt mit lächerlichem Selbstgefühl, die finstere Miene seines Obersten nachzuahmen, indem er sich dabei fortwährend schmeichelt, daß man aus seinem kühnen Gebaren auf seine Unerschrockenheit schließe. Das junge Mädchen, in schrecklicher Sorge, daß man sie übersehe, verrät durch die unermüdliche Veränderung ihrer Haltung den lebhaften Wunsch, beobachtet zu werden; sie hascht gewissermaßen nach jedermanns Augen und bewirbt sich mit gewinnenden Blicken um die Bewunderung der Zuschauer. Der eingebildete Geck dahingegen steckt eine möglichst süffisante Miene auf; mit der Betrachtung der ihm eigenen Vortrefflichkeit hat er vollauf zu tun, und an öffentlichen Orten zeigt er eine solche Nichtbeachtung anderer, daß der Uneingeweihte denken muß, er glaube allein zu sein.
Dies und dieser Art sind all die verschiedenen, deutlich sichtbaren Anzeichen von Stolz, die jedermann kennt; ob jedoch ein Mensch eitel ist, läßt sich nicht immer so leicht entdecken. Zeigt jemand ein recht humanes Wesen und scheint nicht weiter auf sich eingebildet, noch auch um andere gänzlich unbekümmert zu sein, so sind wir geneigt, ihn für bescheiden zu halten, während er vielleicht bloß müde ist, seiner Eitelkeit zu frönen, und des Genusses überdrüssig wurde. Jenes Zur-Schau-Tragen innerer Zufriedenheit, jener lässige Ausdruck sorglosen Gleichmuts, womit man große Männer oft in ihrer einfachen Kutsche hingelehnt sieht, sind nicht immer so frei von Kunst, wie es den Anschein hat: »Nichts beglückt den Stolzen mehr, als für glücklich gehalten zu werden.«
Einen feingebildeten Herrn erfüllt es mit dem größten Stolze, wenn er seinen Stolz geschickt verdecken kann, und manche sind im Verbergen dieser Schwäche so bewandert, daß, gerade wenn sie ihr am meisten nachgeben, der große Haufen denkt, sie besäßen sie gar nicht. So nimmt der heuchlerische Höfling, wenn er sich der Öffentlichkeit zeigt, immer ein gewisses Air von Bescheidenheit und Jovialität an, und während er beinahe vor Eitelkeit platzt, scheint er sich tatsächlich seiner Größe gar nicht bewußt zu sein. Dabei weiß er sehr wohl, daß er durch jene trefflichen Eigenschaften in der Achtung der anderen steigen muß und so seiner Größe noch etwas zufügt, die freilich schon ohne seine Beihilfe durch die Krönchen an seinem Wagen und Pferdegeschirr wie durch seine übrige Equipierung klar genug ausgedrückt wird.
Wie nun bei solchen die Eitelkeit übersehen, weil sorgsam verborgen wird, so wird sie bei andern überhaupt in Abrede gestellt, obgleich sie sie in deutlichster Weise zeigen oder wenigstens zu zeigen scheinen. Der wohlhabende Pfarrer, dem, gleich den übrigen seines Berufes, Putz, wie ihn Laien tragen, versagt ist, sieht sich mit Eifer nach dem feinsten und besten schwarzen Tuche um, das für Geld zu haben ist, und zeichnet sich durch die Gediegenheit seiner vornehmen, sauberen Kleidung aus. Seine Perücke ist so modern, wie die ihm zukommende Form es gestattet; da ihm aber nur diese vorgeschrieben ist, so bemüht er sich, daß hinsichtlich Haar und Farbe wenige aus den höchsten Kreisen imstande sein sollen, es mit ihm aufzunehmen. Wie sein Anzug ist auch er selbst immer peinlich sauber, sein Gesicht ist stets glatt rasiert, seine schöngeformten Nägel sind sorgfältig gepflegt, seine weiche, weiße Hand und ein Brillant vom reinsten Wasser daran, die prächtig zusammen passen, gereichen einander zu erhöhter Zierde. Das Leinenzeug, das er trägt, ist von wunderbarer Zartheit, und er verschmäht es, jemals mit einem schlechteren Hute auszugehen, als ein reicher Bankier an seinem Hochzeitstage mit Stolz tragen würde. Mit allen diesen Feinheiten in der Kleidung verbindet er einen majestätischen Gang und zeigt in seinem ganzen Auftreten etwas Befehlend-Hoheitsvolles. Trotz so vieler gleichzeitiger deutlicher Symptome verbietet uns jedoch die allgemeine Höflichkeit, in irgend etwas von seinem Verhalten ein Resultat des Stolzes zu vermuten. In Anbetracht der Würde seines Berufes gilt bei ihm lediglich als schicklich, was bei andern Eitelkeit beweisen würde, und aus Hochachtung vor seinem Stande sollen wir glauben, daß der verdienstvolle Herr sich ohne jede Rücksicht auf seine ehrwürdige Person all diese Mühen und Ausgaben macht, bloß um dem geistlichen Range, dem er angehört, den schuldigen Respekt zu erweisen, und um mit Gottergebenheit seine heiligen Pflichten vor der Verachtung der Spötter zu bewahren. Nun – herzlich gern! Nichts von alledem soll Eitelkeit heißen; man erlaube mir nur zu sagen, daß es ihr für menschliche Begriffe sehr ähnlich sieht.
Sollte ich aber schließlich auch zugeben, daß es Menschen gibt, die sich in bezug auf Einrichtung, Möbel und Kleidung jede Eleganz leisten und doch keine Eitelkeit in sich haben, so ist doch gewiß, daß, falls alle so wären, jener vorerwähnte Wetteifer aufhören und folglich das Gewerbe, das so sehr auf ihn angewiesen ist, in jeder Branche leiden müßte. Denn sagt man: wenn alle Menschen wirklich tugendhaft wären, so könnten sie doch ohne irgendwelches Eigeninteresse und im Streben, ihren Nächsten zu helfen und das Allgemeinwohl zu fördern, ebensoviel konsumieren, wie sie jetzt aus Selbstliebe und Ehrgeiz tun, – so ist das eine erbärmliche Ausrede und ganz widersinnige Annahme. Da es zu allen Zeiten ehrenhafte Leute gegeben hat, so fehlen sie uns auch ohne Zweifel in der gegenwärtigen nicht völlig. Aber forschen wir doch mal bei den Perückenmachern und Schneidern nach, bei welchen Herren, selbst aus dem höchsten Stande und von bedeutendem Vermögen, sie jemals so uneigennützige Ansichten entdecken konnten. Fragt nur die Spitzenhändler, die Seiden- und Leinenwarenverkäufer, ob nicht die reichsten und meinetwegen auch anständigsten Damen, falls sie gleich bar oder in annehmbarer Zeit bezahlen, ob sie da nicht von Laden zu Laden wandern, um die Preise zu erkunden, und nicht ebensoviel Worte machen und ebensolange mit ihnen handeln, um nur drei oder fünf Groschen an der Elle zu ersparen, wie das ärmste Mädel in der ganzen Stadt. Wollte man behaupten, wenn es uneigennützige Leute gerade heute nicht gibt, so könnte es doch morgen welche geben, dann antworte ich: es ist ebenso möglich, daß Katzen, anstatt Ratten und Mäuse zu töten, sie fütterten und im Hause herumgingen, um ihre Jungen zu nähren und zu pflegen, oder daß ein Habicht, gleich dem Hahn, die Hennen zu ihrem Futter riefe oder ihre Kücklein beschützte, anstatt sie zu verschlingen. Machten sie es aber alle so, dann würden sie eben nicht mehr Katzen und Habichte sein; es verträgt sich nicht mit ihrer Natur, und die Tiergattung, die wir meinen, wenn wir von Katzen und Habichten sprechen, würde ausgestorben sein, sobald es einmal hierzu käme.
BERNARD MANDEVILLE (1714): DIE BIENENFABEL ODER PRIVATE LASTER, ÖFFENTLICHE VORTEILE.
Mit einer Einleitung von Walter Euchner. Zuerst erschienen: München: Langen-Müller, später: Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1998, S. 167–177.
JEAN-JACQUESROUSSEAU
1761
Rousseau wächst in der calvinistischen Republik Genf auf, um dann in das aristokratisch-postkatholisch geprägte Frankreich zu kommen. Sein Blick auf das von ihm verdammte Paris ist deshalb so kostbar, weil es der skandalisierte Blick eines Fremden ist. In Paris findet Rousseau das faszinierende Sündenbabel, von dem ihm zu Hause in der keuschen Genfer Republik als Inbegriff aller Korruption gepredigt wurde. Rousseau stilisiert sich und im folgenden Text seinen Helden Saint-Preux, der seiner im Wallis gebliebenen Geliebten Julie aus Paris in Briefen berichtet, als jemanden der – würde man heute sagen – unter Kulturschock steht.
Ohne dass er der Mode jemals eine eigene Abhandlung gewidmet hätte, hat Jean-Jacques Rousseau zentrale Kategorien des modernen Denkens über die Mode entwickelt. Wenige habe das zersetzende Potential der Mode so differenziert und drastisch herausgearbeitet. Rousseau sieht die Mode bereits 1761 nicht mehr als eine Mode der Stände, sondern als eine Mode der Klassen. Mode ist nicht mehr Repräsentation. In der Mode, analysiert Rousseau, geht es nicht um Repräsentation einer in der Ständeordnung garantierten kosmischen Ordnung des Seins. Es hat nichts mit Mode zu tun, wenn König und Königin wie Mond und Sonne in gold- und silberdurchwirkten Seiden diamantenstrahlend als Schmuck des Kosmos glänzen. In der Mode geht es um Distinktion. Unterschiede bewegen die Mode: Klassenunterschiede und Geschlechtsunterschiede. Die oberen Klassen wollen sich von den unteren durch ihre Kleidung absetzen. Dies kann bereits in der Gesellschaft des Ancien Régime nicht mehr durch Prunk, die offensichtliche Ausstellung von Reichtum, geschehen. Denn die Schicht, die den Ton angibt und angeben will, ist nicht mehr die Schicht, die das meiste Geld hat. Ginge es um Prunkentfaltung, so würde die reiche Finanzbourgeoisie den ruinierten Adel sofort überflügeln. Also muss der Hof von den luxuriösen, goldbesetzten, schweren Seidenbrokaten absehen und sich etwas anderes einfallen lassen. Nicht das Geld, sondern der Geschmack – oder die Geschmacklosigkeit – macht Mode. An die Stelle des Luxus treten Transvestismus und Travestie. Sie sieht Rousseau als die von der Pariser Gesellschaft bevorzugten Möglichkeiten, Distinktion zu schaffen.
Mode wird somit für Rousseau zum Gegenteil des Seins; sie zersetzt alles natürlich Seiende und allem voran das Allernatürlichste, nämlich Männlichkeit und Weiblichkeit. Wenn adelige Damen sich wie Huren kleiden, bloß um von den schamhafteren Bürgerinnen nicht nachgeahmt zu werden, ist das eine Form von Klassentravestie. Wenn sich die Pariserinnen wie Männer anziehen und ihre Allure männlich ist, die aristokratischen Männer sich hingegen weibisch geben, ja, sich in Eunuchen verwandeln, dann handelt es sich um Travestie. Aber selbst wenn die Pariserinnen sich wie Frauen anziehen, verkleiden sie sich. Weiblichkeit, meint Rousseau, ist für die Pariserinnen mit fingerdickem Rouge und ausladenden Reifröcken Maskerade: Travestie. Der Virus der Transvestie greift von Paris aus um sich; selbst das gründlich reformierte, reine Genf ist nicht vor dieser Seuche gefeit. Republikanische Männlichkeit kann nicht immer standhalten. Selbst in Genf sehe man nun junge Herren mit flötender Stimme, die Sonnenschirmchen zwischen ihren zarten Fingern drehten, höhnt Rousseau. Sie zeigen sich in den bunten, enganliegenden Seidenjäckchen der Aristokratie, dem juste au corps, statt wie der aufrechte Bürger in locker geschnittenen, in gedeckten Farben gehaltenen Jacken aus Wolle zu erscheinen.
Mode – und das ist für Rousseau synonym mit Pariser Mode – verkehrt somit natürliche Geschlechtlichkeit. Sie ist deshalb der Inbegriff des Dekadenten. Nicht Perfektibilität und Idealität, sondern Entstellung ist ihre Triebfeder. Mode ist pervers; sie verkehrt die Klassen und die Geschlechter. Mode ist künstlich und sie entstellt die natürliche Ordnung. Sie macht Aristokratinnen zu Huren, Männer zu Weibchen und Frauen zu Mannweibern.
Sie verwandelt das Eigenste in Fremdes. In letzter Konsequenz verwandelt die Mode – die Künstlichkeit, das sich Herausputzen, das sich Verkleiden, das sich Schminken, das sich als das andere Geschlecht Anziehen – die Monarchie in Tyrannei und Idolatrie. Unumschränkt absolut regiert das Weibische in einem modernen Eroskult als Idol. Mitten in Paris finden wir uns in einem Harem wieder. Rousseau definiert die Pariser Gesellschaft seiner Zeit als orientalischen Gegenraum zur ländlich-patriarchalischen Schweiz und zur reinen Republik Genf. Paris wird ihm aber auch zum Gegenraum seines politischen Ideals: zum Gegenraum einer tugendhaften römischen Republik, in der es nach Rousseaus Gusto so spartanisch wie möglich zugehen sollte. Erotische Rhetorik regiert als Götzendienst und alle antike virtus, alle patriarchalische Natürlichkeit wird zersetzt.
Aus: Julie oder Die Neue Héloise: Der einundzwanzigste Brief
An Julien
Du hast es so befohlen, Julie. So muß ich Dir denn diese liebenswerten Pariserinnen schildern? Stolze! Noch fehlte diese Huldigung Deinen Reizen. Bei all Deiner erdichteten Eifersucht, all Deiner Bescheidenheit und Liebe sehe ich doch unter dieser Neugier mehr Eitelkeit als Furcht versteckt. Dem sei, wie ihm wolle: Ich will aufrichtig sein; ich darf es sein; und hätte ich mehr Lob auszuteilen, so wäre ich es aus vollerem Herzen. Warum sind sie doch nicht hundertmal bezaubernder! Warum besitzen sie nicht Reize genug, um den Deinigen noch mehr Ehre zu machen!
Du beklagtest Dich über mein Schweigen? Liebster Himmel! Was konnte ich Dir wohl sagen? Wenn Du diesen Brief liest, wirst Du sehen, warum ich so gern von Deinen Nachbarinnen, den Walliserinnen, sprach, und warum ich dagegen von den Frauenzimmern dieses Landes nicht gesprochen habe. Darum nämlich, weil die einen mich stets an Dich erinnerten; die andern aber – lies und urteile selbst über meine Worte. Übrigens denken wenig Leute so wie ich von den französischen Damen; wenn ich nicht etwa gar der einzige bin, der so von ihnen denkt. Das verpflichtet mich die Billigkeit, Dir vorweg zu sagen, damit Du wissest, daß ich sie Dir vielleicht nicht so darstelle, wir sie sind, sondern so, wie ich sie sehe. Dessen ungeachtet wirst Du, wenn ich ungerecht gegen sie sein sollte, nicht versäumen, mich zu schelten und dadurch noch ungerechter als ich werden; denn die Schuld von allem liegt bei Dir.
Laß uns mit dem Äußeren den Anfang machen! Die meisten Beobachter legen darauf den meisten Wert. Wollte ich ihrem Beispiele folgen, so würden die Frauenzimmer dieses Landes sich nur allzusehr beschweren müssen. Sie haben ein Äußeres der Gesichtsbildung genausogut wie des Charakters; und da ihnen das eine nicht günstiger ist als das andre, tut man ihnen unrecht, wenn man sie bloß danach beurteilt. Von Gestalt sind sie höchstens erträglich und im allgemeinen mehr häßlich als schön; ich lasse die Ausnahmen beiseite. Sie sind eher schmächtig als wohlgestaltet, ihr Wuchs ist nicht zierlich; daher haben sie auch eine Vorliebe für Moden, die diesen verbergen. Und deshalb finde ich die Frauenspersonen andrer Länder sehr einfältig, wenn sie darauf aus sind, Moden nachzuahmen, die nur Fehler verbergen sollen, die sie nicht haben.
Ihr Gang ist leicht und gewöhnlich. Ihre Haltung hat nichts Geziertes, weil ihnen jeder Zwang lästig ist. Von Natur besitzen sie eine gewisse disinvoltura, der es nicht an Anmut fehlt und die bis zum Leichtsinn zu treiben sie sich oft schmeicheln. Ihre Gesichtsfarbe ist nicht sonderlich weiß; sie sind gemeinhin etwas mager, was nicht eben dazu dient, ihre Haut zu verschönern. Was ihren Busen anlangt, so sind sie gerade das Gegenteil der Walliserinnen. Durch stark zusammengepreßte Schnürbrüste suchen sie Fülle vorzutäuschen; und es gibt andre Mittel, in der Farbe den Blick zu täuschen. Wiewohl ich diese Dinge nur aus großer Ferne erblickt habe, ist doch ihre Musterung so frei erlaubt, daß wenig zu erraten übrigbleibt. Hierin scheinen diese Damen ihren Vorteil schlecht zu verstehen; denn wenn das Gesicht auch nur einigermaßen angenehm ist, würde ihnen des Beschauers Einbildungskraft weit beßre Dienste tun als seine Augen; und, nach des Gascogner Philosophen Ausspruche, ist der ganz ungestillte Hunger weit gieriger als der schon durch wenigstens einen Sinn gesättigte.
Ihre Gesichtszüge sind wenig regelmäßig; wenn sie aber nun nicht schön sind, so haben sie dafür eine Anmut des Ausdrucks, die der Schönheit Stelle ersetzt, zuweilen sie gar in den Schatten stellt. Ihre lebhaften, glänzenden Augen sind indes weder durchdringend noch sanft; wiewohl sie sie durch starkes Schminken hervorzuheben suchen, ähnelt der Ausdruck, den sie ihnen dadurch verschaffen, mehr dem Feuer des Zorns als dem der Liebe. Von Natur aus sind sie nur lustig; oder wenn sie zuweilen ein Gefühl von Zärtlichkeit zu verlangen scheinen, so versprechen sie es doch niemals.2
Sie kleiden sich so gut, oder stehen wenigstens so sehr im Rufe, sich gut zu kleiden, daß sie hierin, wie in allen Stücken, dem übrigen Europa als Vorbild dienen. In der Tat könnte man eine wunderlichere Kleidung nicht mit mehr Geschmack tragen. Unter allen Frauenzimmern halten sie sich am wenigsten streng an ihre eigenen Moden. Die Mode beherrscht die Weiber in der Provinz; die Pariserinnen aber beherrschen die Mode, und jede weiß sie zu ihrem Vorteile zu formen. Die erstern gleichen unwissenden, sklavischen Kopisten, die selbst die Rechtschreibfehler abschreiben; die letztern gleichen Schriftstellern, die mit Meisterschaft abschreiben und schlechte Lesarten zu verbessern wissen.
Ihr Putz ist mehr gesucht als prächtig; es herrscht darin mehr Eleganz als Kostbarkeit. Der Moden schneller Wechsel, der von einem Jahre zum andern alles veralten läßt, und die Reinlichkeit, um deretwillen willen sie oft ihre Kleidung wechseln, bewahren sie vor lächerlichem Prachtaufwande. Darum geben sie jedoch nicht weniger aus; allein, ihre Ausgaben sind klüger angelegt. Anstatt fadenscheiniger, prächtiger Gewänder, wie in Italien, sieht man hier einfachere, dafür aber stets neue Kleider. Beide Geschlechter besitzen hierin die gleiche Mäßigung, die gleiche Feinheit des Geschmacks; und dieser Geschmack gefällt mir sehr; denn ich schätze es ungemein, wenn ich weder Tressen sehe noch Flecken. Es gibt außer unserm Volk keines, wo vornehmlich die Frauenzimmer weniger goldne Flitter an den Kleidern trügen. Man sieht dieselben Stoffe bei allen Ständen, und schwerlich könnte man eine Herzogin von einer Bürgersfrau unterscheiden, wenn die erstere nicht die Kunst verstünde, Unterscheidungsmöglichkeiten zu erfinden, die die letztre nicht nachzuahmen wagt. Nun scheint diese Kunst ihre große Schwierigkeit zu haben. Denn welche Mode man auch bei Hofe trägt, so macht sie doch alsbald die Stadt nach; die Pariser Bürgerinnen sind darin nicht wie die Provinzlerinnen oder die Ausländerinnen, die sich nur immer nach einer Mode kleiden, die nicht mehr Mode ist. Es ist hier auch nicht wie in andern Ländern, wo die Vornehmen zugleich die Reichsten sind, deren Gemahlinnen sich folglich durch einen Luxus unterscheiden, der andern verwehrt ist. Wollten hier die Hofdamen diesen Weg einschlagen, sie würden sich bald von den Frauen des Geldadels in den Schatten gestellt sehen.
Wie haben sie also getan?
Sie wählten sichrere, schlauere Mittel, die mehr Überlegung verraten. Sie wissen wohl: Vorstellungen der Scham und Sittsamkeit sind dem Geiste des Volks tief eingeprägt. Das eben hat sie auf unnachahmliche Moden gebracht. Sie sahen, daß das Volk Wangenrot verabscheute, dem es in seiner groben Weise hartnäckig den Namen »Schminke« gibt; so legen sie sich nicht »Schminke«, sondern ihr »Rouge« vier Finger dick auf; denn sobald das Wort verändert wird, ist auch die Sache nicht mehr die nämliche. Sie sahen, daß ein entblößter Busen dem Volke ein Ärgernis ist; alsbald schnitten sie ihre Schnürbrüste tief aus. Sie sahen – o sehr viele Dinge, die meine Julie, sosehr sie auch selbst ein Fräulein ist, gewiß niemals sehen wird! Ihr Benehmen richteten sie nach demselben Geiste, der ihren Putz bestimmt. Jene bezaubernde Schamhaftigkeit, die Dein Geschlecht auszeichnet, ehrt und verschönt, schien ihnen ordinär und bürgerlich; ihre Reden und Gebärden belebten sie mit einer edlen Unverschämtheit; und jede ehrbare Mannsperson schlägt vor ihrem kühnen Blicke die Augen nieder. Solchergestalt hören sie auf, Frauenzimmer zu sein, um nicht mit andern verwechselt zu werden, ziehen ihren Rang ihrem Geschlecht vor und ahmen, um unnachahmlich zu sein, die Dirnen nach.
Wie weit sie diese Nachahmung treiben, kann ich nicht bestimmen. Das aber weiß ich, daß es ihnen nicht ganz geglückt ist, dem befürchteten Übel zu entgehen. Was die Schminke und die tief ausgeschnittnen Schnürleibchen anlangt, so haben diese die größtmögliche Verbreitung gefunden. Die Frauenzimmer aus der Stadt entsagen lieber ihrer natürlichen Farbe und den Reizen, die ihnen ihrer Anbeter amoroso pensier verleihen könnte, als daß sie bürgerlich gekleidet bleiben. Wenn ihr Beispiel nicht auch die niedrigen Stände erreicht hat, rührt das daher, weil ein Frauenzimmer zu Fuße in solchem Aufzug vor des Pöbels Beschimpfungen nicht gar zu sicher wäre. Diese Beschimpfungen sind der empörten Schamhaftigkeit Ausdruck; in diesem Falle, wie in vielen andern, ist des Volkes Grobheit ehrbarer als der gebildeten Leute Sitten und erhält hier vielleicht hunderttausend Frauenzimmer innerhalb der Sittsamkeit Schranken. Das aber war eben die Absicht der schlauen Erfinderinnen dieser Moden.
Was die soldatische Haltung anbetrifft, den Dragonerton, die machen schon weniger Eindruck, weil sie allgemein sind und fast nur bei neuen Ankömmlingen auffallen. Vom Faubourg St. Germain bis zu den Hallen gibt es in Paris wenig Frauenzimmer, deren Auftreten und Blick nicht von einer Verwegenheit begleitet wären, die jeden, der in seinem Vaterlande nicht dergleichen gesehen hat, aus der Fassung bringen kann; und eben aus dem Erstaunen, welches dieses ungewohnte Betragen hervorruft, entsteht jenes ungeschickte Gebaren, das man den Fremden vorwirft. Noch ärger ist es, sobald sie den Mund öffnen. Das ist nicht die sanfte, liebkosende Stimme unsrer Walliserinnen. Es ist ein harter, scharfer, fragender, gebieterischer, spottender Ton, und lauter als eine Männerstimme. Wenn noch in ihrem Klang etwas von der Anmut ihres Geschlechts zurückbleibt, so verdrängt sie vollends die neugierige, unerschrockne Art, womit sie andern ins Gesichte sehen. Es ist, als belustigten sie sich über die Verlegenheit, in die sie Leute versetzen, die sie zum ersten Mal erblicken; allein, man darf annehmen, daß diese Verlegenheit ihnen weniger gefallen würde, wenn sie deren Ursache besser erkennten.
Jedoch sei es nun, daß ich zu sehr von der Schönheit eingenommen bin, oder daß diese sich darauf versteht, sich zur Geltung zu bringen, jedenfalls scheinen mir die schönen Frauenzimmer allgemein etwas sittsamer, und in ihrem Auftreten erblicke ich mehr Anstand. Diese Zurückhaltung aber kostet sie auch nichts; sie empfinden wohl ihre Vorzüge und wissen, daß sie keiner Künste bedürfen, uns an sich zu fesseln. Vielleicht ist aber auch die Unverschämtheit, wenn sie mit Häßlichkeit verbunden ist, auffälliger und anstößiger; und soviel ist gewiß, einem häßlichen und dabei unverschämten Gesichte würde man lieber Ohrfeigen als Küsse geben; hingegen kann es mit Hilfe der Sittsamkeit zärtliches Mitleid erregen, das zuweilen den Weg zur Liebe bahnt. Ob man aber gleich im Betragen hübscher Personen etwas Sanfteres bemerkt, sind sie doch so kokett und stets so sichtbar mit sich selbst beschäftigt, daß man in diesem Lande niemals, wie Muralt bei den Engländerinnen, in Versuchung gerät, einem Frauenzimmer zu sagen, sie sei schön, um das Vergnügen zu haben, ihr etwas Neues mitzuteilen.
Die der Nation eigne Fröhlichkeit und der Wunsch, vornehmes Betragen nachzuahmen, sind nicht die einzigen Ursachen der freien Reden und Gebärden, die man hier an den Frauenzimmern bemerkt. Sie scheinen tiefer in ihren Sitten Wurzel geschlagen zu haben, wegen der beständigen und unbesonnenen Vermengung beider Geschlechter, die jedes die Miene, Sprache und Sitten des andern annehmen lehrt. Unsre Schweizerinnen kommen gern unter sich zusammen,3 sie verkehren sehr vertraulich miteinander; und ob sie gleich den Umgang mit Mannspersonen vermutlich nicht hassen, ist es doch ausgemacht, daß der letztern Gegenwart in diese weibliche Republik eine Art von Zwang bringt. In Paris findet man gerade das Gegenteil. Die Frauenzimmer leben nur gern mit Mannspersonen, bloß in ihrer Gesellschaft sind sie zufrieden. In jeder Gesellschaft ist die Frau des Hauses fast immer allein in einem Kreise von Männern. Man kann schwer begreifen, woher all die vielen Mannspersonen kommen, die man überall antrifft. Allein, Paris ist voll von Glücksrittern und ledigen Männern, die ihr Leben damit zubringen, von Haus zu Haus zu laufen. Gleich der Geldmünze scheinen die Mannspersonen durch beständigen Umlauf sich zu vervielfältigen. Alsdann kann leicht ein Frauenzimmer so wie sie, und sie können so wie Frauenzimmer reden, handeln und denken lernen. Alsdann ist sie einziger Gegenstand der kleinen Aufmerksamkeiten der Männer. Sie genießt ruhig ihre schimpflichen Huldigungen, und die Männer geben sich nicht einmal die Mühe, diesen den Anstrich der Wahrheit zu geben. Und was liegt auch dran? Es sei im Scherz oder Ernste; genug, man beschäftigt sich mit ihr, und das ist alles, was sie begehrt. Man lasse eine andre Frau dazukommen, alsbald folgt auf den vertrauten Ton der feierliche; die vornehmen Mienen werden hervorgesucht, der Mannspersonen Aufmerksamkeit wird geteilt, und man erlegt sich gegenseitig einen geheimen Zwang auf, der erst mit dem Besuche sein Ende findet.
Die Pariser Frauenzimmer sehen gern Schauspiele, das heißt, sie lassen sich gern dabei sehen. Jedesmal aber, wenn sie ins Theater gehen wollen, kommen sie in die Verlegenheit, eine Gefährtin finden zum müssen. Denn die Sitte gestattet es keinem Frauenzimmer, allein in eine Loge zu gehen, nicht einmal mit ihrem Manne, nicht einmal mit einem andern Manne. Es läßt sich kaum sagen, wie schwer in diesem sonst so geselligen Lande dergleichen Gruppen sich bilden; von zehn, die man sich vornimmt, werden neun rückgängig gemacht; der Wunsch das Theater zu besuchen, bringt sie zusammen; die Abneigung, es miteinander zu besuchen, löst sie auf. Diesen sinnlosen Brauch nun könnten, dünkt mich, die Frauenzimmer leicht abschaffen. Denn welchen Grund gäbe es wohl, daß sie sich nicht allein öffentlich zeigen dürften? Jedoch hält sich dieser Brauch vielleicht gerade deshalb, weil es keinen Grund gibt. Es ist gut, den Anstand, so sehr man kann, in solchen Dingen einzuhalten, deren Überschreitung zu nichts dienen würde. Was würde ein Frauenzimmer bei dem Rechte, ohne Begleiterin die Oper zu besuchen, gewinnen? Ist es nicht besser, sich dieses Recht dazu vorzubehalten, seine Freunde insgeheim zu sprechen?
Es ist ausgemacht, daß tausend geheime Verbindungen Früchte dieser Gewohnheit sind, sich einsam und zerstreut unter so vielen Mannspersonen zu befinden. Niemand glaubt heutzutage, und die Erfahrung hat den unsinnigen Grundsatz völlig widerlegt, man könne die Versuchungen dadurch überwinden, daß man sie vervielfältigte. Man sagt also nicht mehr, daß dieser Brauch ehrlicher, sondern nur, daß er angenehmer sei. Das halte ich aber für ebensowenig begründet. Denn welche Liebe kann dort herrschen, wo die Schamhaftigkeit verlacht wird; und welchen Reiz kann es wohl geben, wenn zugleich die Liebe und die Ehrbarkeit fehlen? Und weil die große Geißel all dieser vergnügungssüchtigen Leute die Langeweile ist, fragen die Frauen nicht sosehr darnach, daß man sie liebe, als daß man ihnen die Zeit vertreibe; Galanterie und Aufmerksamkeiten gelten bei ihnen mehr als Liebe; bewirbt man sich nur eifrig um ihre Gunst, so liegt ihnen wenig dran, ob man verliebt ist. Selbst die Wörter »Liebe« und »Liebhaber« sind aus beider Geschlechter vertrautem Umgange ausgeschlossen und zugleich mit den »Ketten« und »Flammen« in die Romane verwiesen, die niemand mehr liest.
Es scheint, als wäre hier die ganze Ordnung natürlicher Neigungen umgekehrt. Das Herz bindet sich an nichts. Den Mädchen ist es nicht erlaubt, ein Herz zu haben. Dieses Recht ist allein den verheirateten Frauen vorbehalten und schließt von ihrer Wahl niemanden als ihre Männer aus. Es wäre besser, die Mutter hätte zwanzig Liebhaber, als die Tochter einen. Der Ehebruch ist nichts Abscheuliches; man findet daran nichts, das den guten Sitten widerspräche; die sittsamsten Romane, die jedermann zu seiner Belehrung liest, sind voll davon, und das Laster ist nicht mehr tadelnswert, sobald es mit der Untreue verbunden ist. O Julie! Manche Frau, die sich nicht gescheut hat, hundertmal das Ehebett zu beflecken, würde dennoch sich unterfangen, mit unreinem Munde unsere keusche Liebe zu tadeln und die Vereinigung zweier aufrichtiger Herzen, die niemals einander untreu zu sein vermochten, zu verurteilen. Man möchte meinen, die Ehe sei in Paris nicht von derselben Beschaffenheit als sonst allerorten. Sie ist, wie sie behaupten, ein Sakrament; dies Sakrament aber hat nicht einmal des geringsten bürgerlichen Vertrags Gültigkeit; es scheint bloß ein Übereinkommen zweier freier Personen zu sein, die miteinander vereinbaren, beisammen zu wohnen, denselben Namen zu führen und dieselben Kinder als die ihrigen anzuerkennen, die aber ansonsten kein Recht aufeinander haben. Ein Ehemann, der sich einfallen ließe, über seiner Frau übles Betragen Klage zu führen, würde nicht weniger getadelt werden als derjenige, der bei uns der seinigen gestattete, sich vor aller Augen unsittlich aufzuführen. Die Weiber ihrerseits sind auch nicht streng gegen ihre Männer, und man sieht nicht ein, warum sie sie für die Nachahmung ihrer Untreue strafen sollten. Wie sollte man aber auch auf beiden Seiten mehr Aufrichtigkeit von einer Verbindung erwarten, die getroffen wurde, ohne das Herz zu Rate zu ziehen? Wer nur das Vermögen oder den Stand heiratet, ist der Person nichts schuldig.
Die Liebe selbst, sogar die Liebe hat ihre Rechte verloren und ist nicht weniger unnatürlich als die Ehe. Wenn die Eheleute Jünglinge und Mädchen sind, die beisammen wohnen, um in größerer Freiheit zu leben, so sind dagegen Verliebte gleichgültige Leute, die zum Zeitvertreib, um sich eine gewisse Bedeutung zu geben, aus Gewohnheit oder wegen eines vorübergehenden Bedürfnisses zusammenkommen. Das Herz hat bei solchen Verbindungen nichts zu schaffen; man sucht nur Bequemlichkeit und gewisse äußerliche Vorteile; nämlich sich kennenzulernen, beisammen zu leben, sich miteinander zu verständigen, sich zu sehen, oder noch weniger, wenn es möglich ist. Ein Liebeshandel dauert nur ein wenig länger als ein Besuch; er ist eine Ansammlung artiger Gespräche und artiger Briefe, voll von Witz, Beschreibungen, Lehrsprüchen und Philosophie. Was die Sinnlichkeit anlangt, so verlangt diese nicht so viel Heimlichkeit; man hat sehr verständig eingesehen, die Leichtigkeit, die Begierden zu befriedigen, müsse sich nach dem Augenblicke richten, in dem sie entstehen. Die Erstbeste oder der Erstbeste, es sei der Liebhaber oder ein andrer, ein Mann ist doch immer ein Mann, und alle sind fast gleich gut; man handelt dabei sehr folgerichtig, denn warum sollte man einem Liebhaber treuer sein als einem Ehemanne? Zudem sind in einem gewissen Alter fast alle Mannspersonen ein und dieselbe Mannsperson, fast alle Frauen ein und dieselbe Frau; alle diese Puppen stammen von ein und derselben Galanteriehändlerin; und hier ist kaum eine andre Wahl zu treffen, als sich dem Gegenstand zuzuwenden, der am bequemsten zur Hand ist.
Da ich von dem allem nichts aus eigner Erfahrung weiß, hat man mit mir davon in so außerordentlichem Tone gesprochen, daß mir unmöglich war, das, was man sagte, recht zu fassen. Alles, was ich davon begriff, war, daß bei den meisten Frauen der Liebhaber als ein Mensch betrachtet wird, der zum Hause gehört; tut er seine Schuldigkeit nicht mehr, so schickt man ihn weg und nimmt einen andern; findet er anderswo etwas Besseres oder wird seiner Dienste überdrüssig, so geht er weg, und man nimmt einen andern. Es gibt sogar Weiber, sagt man, die so launenhaft sind, daß sie es mit dem Herrn des Hauses selbst versuchen; denn schließlich ist er doch auch eine Art von Mannsperson. Diese Grille aber währt nicht lange. Sobald sie vorüber ist, schickt man ihn weg und nimmt einen andern; oder wenn er hartnäckig ist, so behält man ihn und nimmt einen andern.
»Allein«, sagte ich zu dem, der mir diese seltsamen Bräuche erklärte, »wie geht hernach eine Frau mit all denen um, die ihren Abschied genommen oder erhalten haben?« – »Oh«, sagte er, »sie geht gar nicht mit ihnen um. Man sieht und kennt sich nicht mehr. Sollte sie je die Laune anwandeln, ihre frühere Beziehung neu zu knüpfen, so hätten sie sich ganz neu kennenzulernen; es wäre schon viel, wenn man sich entsänne, einander jemals gesehen zu haben.« »Ich verstehe Sie«, erwiderte ich; »doch auch wenn ich von diesen Übertreibungen abzusehen suche, so begreife ich immer noch nicht, wie man nach einer so zärtlichen Vereinigung sich mit kaltem Blut wieder sehen kann. Klopft denn nicht das Herz bei der bloßen Nennung dessen, den man einmal geliebt hat? Zittert man nicht, wenn man ihm begegnet?« »Sie bringen mich zum Lachen«, versetzte er. »Sie verlangten also wohl, daß unsre Weiber nichts andres täten, als stets in Ohnmacht fallen?«
Streiche einen Teil dieses Gemäldes, das unstreitig zu stark gezeichnet ist; denke Dir zu dem übrigen Julien hinzu und erinnre Dich meines Herzens; weiter habe ich Dir nichts zu sagen.
Gleichwohl muß ich gestehen, daß viele dieser unangenehmen Eindrücke mit der Gewohnheit verblassen. Wenn das Übel sich vor dem Guten zeigt, hindert es doch dasselbe nicht, seinerseits hervorzutreten. Des Verstandes und Herzens Reize verschaffen den persönlichen Reizen größern Wert. Sobald der erste Widerwille überwunden ist, wird er alsbald zur entgegengesetzten Neigung. Das ist des Gemäldes andre Seite; und die Gerechtigkeit gestattet nicht, es Dir nur von der fehlerhaften vorzustellen.
Der erste Nachteil in großen Städten ist, daß die Menschen dort zu andern Geschöpfen werden, als sie eigentlich sind. Die Gesellschaft gibt ihnen gleichsam ein von dem ihrigem verschiednes Wesen. Das läßt sich auch in Paris, zumal von den Frauenzimmern sagen, für die erst durch die Blicke andrer das Dasein erstrebenswert wird. Wenn man sich bei einer Gesellschaft einer Dame nähert, so sieht man, anstatt der Pariserin, die man zu erblicken glaubt, bloß ein Götzenbild der Mode. Ihre Größe, ihr Umfang, ihr Gang, ihre Taille, ihre Brust, ihre Farben, ihre Miene, ihr Blick, ihre Reden, ihr Betragen, nichts von alledem gehört ihr; und sähe man sie in ihrem natürlichen Zustande, man würde sie nicht erkennen. Dieser Tausch nun ist selten vorteilhaft für die, die ihn vornehmen; und überhaupt gewinnt man niemals, wenn man die Natur gegen etwas anderes eintauscht. Allein, es gelingt auch niemals, sie ganz auszulöschen; stets kommt sie an irgendeiner Stelle zum Vorschein; und eben in der Geschicklichkeit, sie wahrzunehmen, besteht die Kunst zu beobachten. Diese Kunst ist bei den Frauen dieses Landes nicht schwer. Denn da sie mehr Natürliches an sich haben, als sie selbst glauben, so braucht man nur wenig mit ihnen zu verkehren, sie nur ein wenig von jener ewigen Darstellung einer fremden Rolle, die ihnen so sehr gefällt, abbringen, so erblickt man sie alsbald, wie sie sind; und dann verkehrt sich alle Abneigung, die sie anfangs erweckten, in Hochachtung und Freundschaft.
Vergangene Woche hatte ich Gelegenheit, dieses bei einer Landpartie zu bemerken, zu der einige Frauenzimmer mich und andre Neuankömmlinge ziemlich unbedachtsam eingeladen hatten, ohne sich vorher zu vergewissern, ob wir Leute nach ihrem Geschmacke wären, oder auch wohl, um das Vergnügen zu haben, sich über uns lustig zu machen. Das geschah unweigerlich am ersten Tag. Sie überhäuften uns gleich anfangs mit den spitzen Pfeilen ihres Spottes. Da wir aber diese nicht zurückgaben, war ihr Köcher bald leer. Sie besannen sich gutwillig eines Bessern; und da sie uns nicht bewegen konnten, ihren Ton anzunehmen, sahen sie sich genötigt, in den unsrigen einzustimmen.
Ich weiß nicht, ob dieser Tausch ihnen gefiel; ich für mein Teil befand mich dabei vollkommen wohl. Mit Bewunderung sah ich, daß ich im Gespräch mit ihnen mehr Einsichten erlangte, als ich sie bei vielen Mannspersonen gefunden hätte. Ihr Witz bereicherte ihren gesunden Verstand so sehr, daß ich die Mühe sehr bedauerte, die sie auf dessen Verunstaltung wandten. Nunmehr beurteilte ich diese Frauenzimmer günstiger und beklagte gleichzeitig, daß es so vielen liebenswerten Personen nur darum an Vernunft mangelte, weil sie keine zu haben begehrten. Die gezierten städtischen Manieren sah ich nach und nach durch die vertrauten, natürlichen Reize verdrängt; denn unwillkürlich nimmt man ein Betragen an, das dem, was man sagt, angemessen ist, und verständige Reden mit koketten Grimassen zu begleiten ist etwas Unmögliches. Nun schienen sie mir weit hübscher, seitdem sie weniger bemüht waren, es zu sein; und ich sah, daß sie, um zu gefallen nichts weiter zu tun brauchten als sich nicht zu verstellen. Daher wagte ich die Vermutung, daß Paris, dieser vermeintliche Sitz des Geschmacks, vielleicht derjenige Ort in der Welt sein könnte, wo der Geschmack am wenigsten herrscht, weil alle Mühe, die man sich hier gibt, um zu gefallen, nur die wahre Schönheit verunstaltet.
Solchergestalt blieben wir vier bis fünf Tage beisammen, miteinander und mit uns selbst zufrieden. Anstatt Paris samt seinen Torheiten zum Gegenstand des Gesprächs zu machen, vergaßen wir es. Unser ganzes Streben beschränkte sich darauf, uns angenehm und liebenswürdig zu unterhalten. Wir bedurften, um uns zu erheitern, weder der Satire noch spöttischer Neckereien; unser Lachen entstand nicht aus Spottlust, sondern aus Fröhlichkeit, so wie das Lachen Deiner Base.
Und schließlich bewog mich vollends ein andrer Umstand, meine Meinung über die Pariserinnen zu ändern. Mitten unter den lebhaftesten Gesprächen kam man oft und sagte der Frau des Hauses etwas ins Ohr. Sie verließ das Zimmer, schloß sich ein, um Briefe zu schreiben, und kam erst nach langer Zeit wieder. Es war sehr leicht, ein solches Verschwinden einer Korrespondenz des Herzens, oder was man wenigstens so nennt, zuzuschreiben. Ein andres Frauenzimmer ließ einmal eine Andeutung darüber verlauten, die aber sehr übel aufgenommen wurde. Ich schloß daraus, wenn die Abwesende keine Liebhaber hätte, so fehlte es ihr wenigstens nicht an Freunden. Die Neugierde machte mich aufmerksam. Wie groß war mein Erstaunen, da ich erfuhr, daß diese vorgeblichen Boten aus Paris nichts andres als Bauern aus ihrem Kirchspiel waren, die in ihrer Not zu ihrer gnädigen Frau kamen, um sie um ihren Schutz zu bitten! Der eine hatte zuviel Steuern zu zahlen, zugunsten eines Reicheren; den andern hatte man, ohne auf sein Alter und seine Kinder Rücksicht zu nehmen, zur Bürgerwehr eingezogen4; der dritte wurde von einem mächtigen Nachbarn durch einen ungerechten Prozeß belastet; der vierte hatte durch Hagel alles verloren, und doch verlangte man unerbittlich die Pachtsumme von ihm. Kurz, alle hatten um eine Gunst zu bitten, alle wurden geduldig angehört, keiner wurde abgewiesen, und die Zeit, während der ich sie mit Liebesbriefen beschäftigt glaubte, wurde damit zugebracht, Briefe zum Besten dieser Unglücklichen zu schreiben. Ich kann Dir nicht sagen, mit welchem Erstaunen ich erfuhr, daß diese junge, leichtsinnige Person nicht nur an der Erfüllung dieser liebenswürdigen Pflichten Gefallen fand, sondern daß sie auch so wenig damit prahlte. Wie, sagte ich höchst gerührt; wenn sie Julie wäre, könnte sie nicht anders handeln. Von Stund an betrachtete ich sie nur noch mit Ehrerbietung, und in meinen Augen verschwanden alle ihre Fehler.