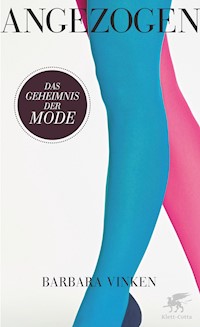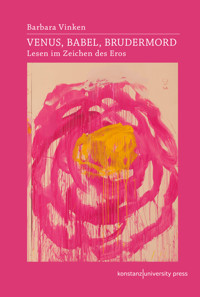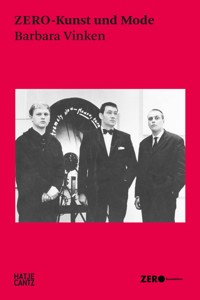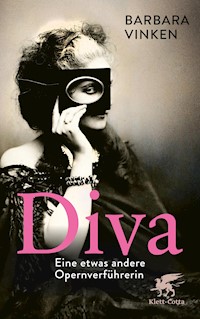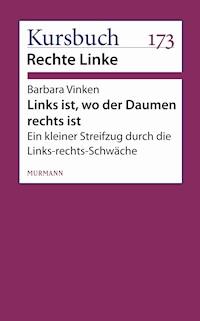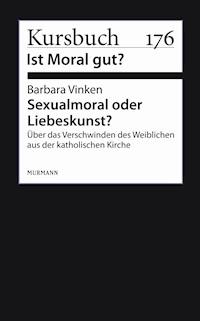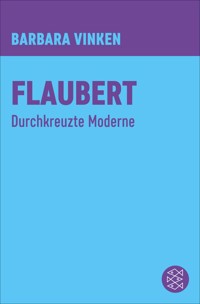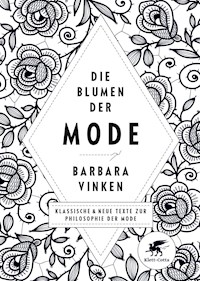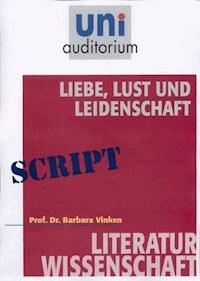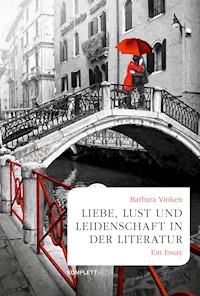
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Komplett-Media Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Leidenschaft der Sappho lässt sie erzittern und raubt ihr das Bewusstsein. Didos rasende Liebe zu Aeneas führt zum Selbstmord. Der Platoniker vervollkommnet sein Ich und steigt durch die Knabenliebe zur Erkenntnis des Wahren, Guten und Schönen auf. Abélard und Héloise ringen mit Fleischeslust, Konvention und höherem Streben. In der Moderne ersetzt der Sex die Liebe. In diesem Essay kommen alle Spielarten der Liebe zu Wort. Sei es die Maßlose, die Selbstbezogene, die Erotische, die Platonische - anhand zahlreicher Beispiele aus der Literatur bekommt der Leser eine Vorstellung davon, wie unterschiedlich geliebt werden kann und was am Ende doch alle Liebesspielarten eint. Ein kleiner aber feiner Geschenkband über die großen philosophischen Fragen der Liebe anhand literarischer Frauenfiguren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 48
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BARBARA VINKEN
Liebe, Lust und Leidenschaft in der Literatur
EIN ESSAY
Originalausgabe
1. Auflage
© Verlag Komplett-Media GmbH
2019, München/Grünwald
www.komplett-media.de
ISBN E-Book: 978-3-8312-7008-8
Bildnachweis:
Alle Illustrationen im Buch: Heike Kmiotek, www.heike-kmiotek.de Titelbild: shutterstock, Cranach
Lektorat: Redaktionsbüro Diana Napolitano, Augsburg
Korrektorat: Redaktionsbüro Julia Feldbaum, Augsburg
Umschlaggestaltung: guter Punkt, München
Grafische Gestaltung, DTP: Lydia Kühn, Aix-en-Provence, Frankreich
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
Dieses Werk sowie alle darin enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrecht zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung.
Inhalt
Inhalt
Einleitung
Die Liebe in der Mythologie
Die sinnliche Liebe – Raserei und Selbstzerstörung
Die platonische Liebe – das Fleisch wird überwunden
Von der körperlichen zur geistigen Liebe – Abaelard und Héloise
Die erhabene Liebe im französischen Klassizismus
Die Unfähigkeit zu lieben in der Moderne
Così fan tutte
Louise Colet und Gustave Flaubert
Zeitgenössische Beispiele
Epilog
Über die Autorin
Einleitung
Die Liebe, wir alle glauben, sie zu kennen. Und doch scheint jeder anders zu lieben. Und zu allen Zeiten wurde anders geliebt. In diesem Essay nehme ich Sie mit auf eine Reise durch die Jahrhunderte und stelle Ihnen die unterschiedlichsten Spielarten der Liebe vor.
Die Leidenschaft der griechischen Dichterin Sappho lässt sie erglühend erzittern und raubt ihr das Bewusstsein. Die rasende Liebe Didos, der Königin von Karthago, zu ihrem Ein und Alles Aeneas führt nach seinem Liebesverrat zu ihrem Selbstmord. Der vom Eros begeisterte Platoniker vervollkommnet sein Ich und steigt durch die Knabenliebe zur Erkenntnis des Wahren, Guten und Schönen auf. Liebe ist hier nicht verheerend, sondern führt zum Allgemeinwohl. Später wird der Platonismus nur mehr Deckname für die Unfähigkeit zu lieben.
Der charismatische Theologieprofessor Abaelard und seine blutjunge Studentin Héloise verwandeln lustvoll tragische antike Sinnlichkeit in glühende geistliche Liebe. Weiter im Liebesreigen mit dabei: der unvergleichliche Liebesverzicht der Prinzessin von Clèves, die Leidenschaft als Trugbild bei Così fan tutte sowie die Unfähigkeit zu lieben, und stattdessen ganz der Kunst zu leben, bei Gustave Flaubert und Louise Colet.
Die moderne Frau meidet die Liebe wie die Pest und hat sich in einen libertinen Homosexuellen verwandelt.
Die Liebein derMythologie
Die sinnliche Liebe - Raserei und Selbstzerstörung
WAS IST LIEBE?
Fangen wir bei Adam und Eva und dem Buch Genesis an. Der Mythos des Falls verbindet zwei für die Liebe entscheidende Momente: Das Begehren nach Gottgleichheit drückt sich in dem Wunsch nach Allwissenheit aus – Eva wird verführt, vom verbotenen Baum der Erkenntnis zu essen. Das Wissen, das sie durch den Übertritt des Verbotes erlangt, ist eines vom Unterschied der Geschlechter: Eva und Adam erkennen, dass sie nackt sind, und schämen sich. Scham und Begehren sind diesem Erkennen des Geschlechtsunterschiedes gleich ursprünglich.
Am Beginn unseres Liebesverständnisses liegen zwei sehr verschiedene Vorstellungen von Liebe. Im fünften Jahrhundert vor unserer Zeit erzählt die griechische Dichterin Sappho, deren Gedichte nur fragmentarisch überliefert sind, von der zerstörerischen Gewalt der Liebe, die das Subjekt zur völligen Selbstverausgabung, zum ekstatischen Selbstverlust und schließlich zum Selbstmord führt. Die Dichterin lebte in Mytilene auf der Insel Lesbos in der Nordägäis, dem kulturellen Zentrum des siebten vorchristlichen Jahrhunderts, und liebte eigentlich Mädchen. Diese Liebe trägt bis heute ihren Namen: Wir sprechen von der »lesbischen« oder der »sapphischen« Liebe. Verzweifelt stürzt sie sich jedoch um eines bezaubernden Jünglings, um Phaons willen – so weiß es die Sage – vom leukadischen Felsen in die tobende See. Phaon war als Fährmann zwischen der Insel Lesbos und Kleinasien unterwegs; ihm voraus eilte der Ruf unwiderstehlicher Schönheit.
Die unerfüllte maßlose Liebe verzehrt. Sie ist eine einsame Erfahrung, die das Individuum aus der Gemeinschaft ausgrenzt. Auch ist sie trotz höchster Steigerung der Selbsterfahrung im Schmerz und in der Angst vor dem lebensbedrohenden Verlust des Geliebten eher wahnhaftes Verkennen als gesteigerte Erkenntnis.
Sapphos Ode an eine Geliebte (Sappho, Fragment 31, um 600 v. Chr.) singt verzweifelt von Raserei und Eifersucht. Sie muss beobachten, wie sich ihre Angebetete einem anderen, einem Mann, zuwendet. Hilflos hingerissen vor Begehren gerät sie außer sich: Ihr verschlägt es beim Anblick des geliebten Objektes die Sprache, der Atem stockt, die Ohren summen, alles verschwimmt ihr vor den Augen, sie wird flammend rot und im nächsten Moment totenbleich. Das Herz schlägt rasend, kalter Schweiß bricht aus, ihr versagen die Sinne. Ein Bild des Todes deutet sich an. Dieses Gedicht, das nur als Fragment überliefert ist, endet mit den Worten:
»Alles aber lässt sich ertragen.«
Das Subjekt erleidet den Selbstverlust, als es die Begehrte im heiteren, scherzenden Gespräch mit einem Dritten sieht, der ihm durch dieses übermenschliche Glück der Zuwendung der Geliebten göttergleich scheint.
Der Selbstverlust in entäußernder Liebe ist als Moment der intensivsten Selbsterfahrung höchst sprachmächtig gefasst. Das von Leidenschaft erfasste Subjekt mag erglühen und gleichzeitig vor Kälte zittern, taub, bleich wie der Tod, blind und stumm werden – der Dichterin verschlägt es darüber die Sprache nicht. Der Verlust des Ausdrucks ist meisterhaft in einer unmittelbar wirkenden, fast nüchternen Sprache beschrieben. Das leidende Selbst, ganz außer sich, macht sich in Selbstbeobachtung kühl zum Objekt der Selbstanalyse und gibt sich den anderen zum Schauspiel. Ein theatralischer Charakter ist selbst dieser extremen Liebeserfahrung, die bis zum Selbstverlust geht, nicht fremd.
Dass diese ekstatische Liebe auf wahnhafter Verkennung – oder, um es mit Freud zu sagen, auf einer Überschätzung des Liebesobjektes – beruht, die nicht von Dauer ist, leuchtet bereits in den Gedichten der Sappho auf, die von der »Verrücktheit ihres Herzens« spricht. In einem Zwiegespräch zwischen Sappho und der Liebesgöttin Aphrodite scherzt diese: