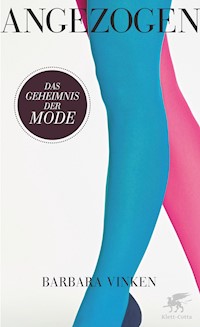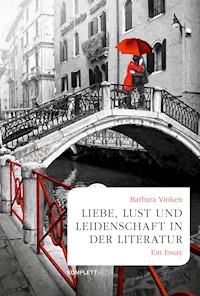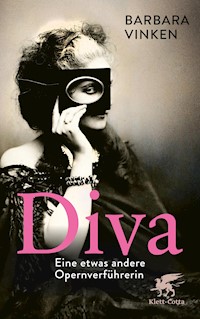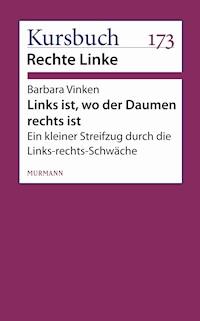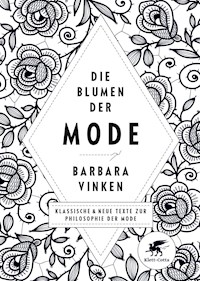12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine neue Deutung von Flaubert als Wegbereiter der Moderne Flaubert gilt als »Vater« und Erneuerer der modernen Literatur. Wie man das allerdings neu verstehen muss, zeigt Barbara Vinken in ihrer brillanten Studie. Als Bezugspunkt dienen ihr zum einen Flauberts Triebschicksal, das ihn zu jemandem werden lässt, der schreibt anstatt zu lieben, zum anderen die Bibel, deren »frohe Botschaft« er im Namen des Kreuzes durchkreuzt. Damit bilden Psychoanalyse und Bibelverständnis den Rahmen, in dem Flauberts Weg in die Moderne eine aufregende und frische Deutung erfährt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1071
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Barbara Vinken
Flaubert
Durchkreuzte Moderne
Sachbuch
Über dieses Buch
Flaubert gilt als »Vater« und Erneuerer der modernen Literatur. Wie man das allerdings neu verstehen muss, zeigt Barbara Vinken in ihrer brillanten Studie. Als Bezugspunkt dienen ihr zum einen Flauberts Triebschicksal, das ihn zu jemandem werden lässt, der schreibt anstatt zu lieben, zum anderen die Bibel, deren »frohe Botschaft« er im Namen des Kreuzes durchkreuzt. Damit bilden Psychoanalyse und Bibelverständnis den Rahmen, in dem Flauberts Weg in die Moderne eine aufregende und frische Deutung erfährt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Barbara Vinken ist Professorin für Allgemeine Literaturwissenschaft und Romanische Philologie an der Universität München. 1989 in Konstanz und 1991 in Yale promoviert, habilitierte sie sich 1996 in Jena und folgte im Wechsel mit Gastprofessuren an der New York University, der EHESS Paris und der Humboldt-Universität in Berlin Rufen auf die romanistischen Lehrstühle in Hamburg und Zürich.
Impressum
Covergestaltung: Hißmann & Heilmann, Hamburg
Coverabbildung: akg-images
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2009
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400264-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Durchkreuzt
Kenosis der Schrift
Das Kreuz der Geschichte
Quidquid volueris: Die Monstrosität der Zivilisation
Briefe an Louise Colet
Der schwarze Kontinent männlichen Begehrens
Liebe, Tod und Mutter
Fetischismus und Kastration
Madame Bovary. Mœurs de province.
Lesen, Lieben, Essen
Die Passion der Mme Bovary
Sündenbock und homo sacer
Zum Fressen: Sex und Schlachten
Das römische Schreckbild der Proskriptionen
Arachne, tödlicher Eros
Phèdre: Fuß um Fuß
Die Gleichheit der Geschlechter vor Gott
Salammbô
Passionsfrucht: Karthago lebt
Erfüllung und Verkehrung Christi: Söldner und Karthager
Perversion der Kenose: Die Karthager und ihre Opfer
Kenose der Kenose: Liebesopfer und Liebesmahl der Söldner
Venus und Mars
Infelix Dido
Rücksicht auf Darstellbarkeit: Das quid pro quo von Stoff und Haut
L'Éducation sentimentale. Histoire d’un jeune homme.
Paris/Rom: Flauberts Pharsalia
Paris/Babel: Liebe und Politik
Égalité, fraternité, lieblos
Negative Typologie: Unheilsgeschichten
Topos Babel
Unlesbarkeit lesen
Bengalische Beleuchtung
Sentimentale Idolatrie
Madonnen und Huren
Ave Maria: Verfleischlichung des Geistigen
Republikanisch: Stabat mater und Bordell
Trois Contes
Sermo humilis: Realismus und Christentum
Notre-Dame de Rouen: Flauberts Kathedrale
Un cœur simple
Eine Legende der Moderne
Der ruinierte Zustand der Welt: Fortuna fatal
Mütterlichkeit, fleischlich und geistlich
Verkehrte Maria: Vögelgeschichten?
Verkehrter Heiliger Geist: Papageiengeschichte
La Légende de St. Julien l'hospitalier
Nimrod, Jäger wider den Herrn
Gezeichnet von Gott
Invertierte Konversion
Hérodias
Iaokanaan oder die Geburt der römischen Kirche aus dem Ungeist Babels
Inzest und Brudermord nach Flavius Josephus
Pervertierte Eucharistie: Das große Fressen des Aulus Vitellius
Auferstehung und Pfingsten verkehrt: Der Tanz der Salome
Danksagung
Bibliographie
Namenregister
Register der Begriffe und Motive
Für Anselm, für Moritz
Durchkreuzt
»die Gottheit der décadence, beschnitten in ihren männlichen Tugenden und Trieben«
(Friedrich Nietzsche) [1]
Flaubert ist vielleicht der einzige Prosaautor des französischen 19. Jahrhunderts, der nicht wie George Sand, wie Victor Hugo, wie Balzac historisch geworden ist. Der nouveau roman hat sich mit Flaubert »Contre Balzac«, dem es in seinem Realismus nicht um das Wie, sondern das Was der Erzählung ging, definiert. Ein »Contre Flaubert« kann man sich schlecht vorstellen. Als einer der Väter der Moderne hat Flaubert ein glanzvolles internationales Nachleben. So unterschiedliche Autoren wie Gertrude Stein, Franz Kafka und James Joyce, William Faulkner, Nathalie Sarraute und Claude Simon beanspruchen ihn als ihren Ahnen. Gertrude Stein schreibt mit ihren Three Lifes und Joyce mit seiner Erzählung »Eveline« aus den Dubliners die Trois contes neu, Kafka spricht von Flaubert als einem Blutsverwandten und träumt davon, die Éducation sentimentale am Stück in einem großen Theatersaal vorlesen zu lassen. Claude Simons Werk kann man über weite Strecken als Meditation zu Flaubert lesen. [2]Nicht nur die Autoren, auch die Kritiker haben Flaubert zwischen Foucault und Derrida nie aus den Augen verloren. Es ist dieses Fortgeschrieben-Werden, das ihn zu einem der kanonischen Autoren der Weltliteratur gemacht hat.
Durch unablässige Arbeit an seinen Texten hat Flaubert eine neue Prosa geschaffen, die die Dichte lyrischer Texte zeigt und dem lapidaren Stil der Klassiker wie Tacitus vielleicht am nächsten kommt. Diese Dichte verdankt sich einer akribischen Arbeit am Text, in dem kein Wort zu viel steht und dessen intra-textuelle Bezüge vollkommen durchgearbeitet sind; sie verdankt sich einer eng gewebten Intertextualität, die die großen Texte der antiken Literatur und ihre zeitgenössische Rezeption in das Frankreich des 19. Jahrhunderts überträgt; sie verdankt sich auch einem philologisch zu nennenden Forscherinteresse; wenige »fiktive« Texte sind so eng mit der aktuellen Forschung wie der Mythen- und Bibelforschung oder der entstehenden Ethnologie verbunden. Ihre Brisanz ziehen diese Texte aber wohl vor allem daraus, Testament gegen die Evangelien und deren patristische Interpretation zu sein.
Die Widersprüchlichkeit der Person und die widersprüchliche Einschätzung ihres Werkes ist für diese Karriere sicher nicht ausschlaggebend, aber vielleicht doch symptomatisch. Flaubert gilt einerseits als realistischer Autor, sein Werk aber auch als Inbegriff einer Kunst um der Kunst willen, des l’art pour l’art. Flaubert hat sich selbst als zurückgezogener Mönch in seiner Kartause stilisiert, wo er der Welt entsagt, um asketisch nur für seine Arbeit zu leben; er hat mit St. Carpe, dem Namen des spätantiken Säulenheiligen, unterschrieben, der sich von der ihn umgebenden Welt angeekelt abwendet. Gleichzeitig war er ganz Dandy und seine Mutter musste für eine schwindelerregende Handschuhrechnung Land verkaufen. Er schrieb, charmant flirtend, verführerische Briefe an die Prinzessin Mathilde, in deren Salon er verkehrte. Das war immerhin das Herz des mondänen und des intellektuellen Paris. Als rentier in der Provinz, mit seiner Mutter und seiner Nichte zusammenlebend, ist Flaubert für seine Familie nie richtig erwachsen geworden: Er hat nicht geheiratet und ist nicht Vater geworden. Weder hat er sein Geld selber verdient – anders als Balzac oder Sand hat er nie von seinem Schreiben leben können –, noch hat er seinen Besitz selbst verwaltet. Seine Vermögensverwaltung hat er in die inkompetenten Hände des Ehemannes seiner Nichte gelegt, dessen Bankrott nur dadurch verhindert werden konnte, dass er fast alle Länder und Bauernhöfe im Besitz der Flauberts verkaufte. Seine Mutter hat ihr Leben lang seit der sogenannten Krise ihres Sohnes ständig um sein Leben gezittert. Seine Nichte hat seine Erziehungsanstrengungen nie zu schätzen gewusst, sondern über seinen Unterricht in antiker Geschichte wie über die Bemühungen eines etwas schrulligen Familienübels berichtet.
Sein Roman Madame Bovary wurde 1857, im selben Jahr, in dem die Fleurs du mal Baudelaires erschienen, angeklagt, gegen die öffentliche Moral zu verstoßen. Es war der erste Prozess, den ein bürgerliches Gericht gegen ein Werk der Fiktion führte. Der Prozess endete mit Freispruch und Madame Bovary durfte weiterhin gedruckt und verkauft werden. Dieselbe Gesellschaft, die ihm den Prozess machen wollte, zeichnete ihn später mit der légion d’honneur aus. Verliehen wurde dieser Orden durch einen Kaiser, dessen Staatsstreich Flaubert in der Éducation sentimentale mit dem römischen Bürgerkrieg verglich, in dem ein schlimmeres Verbrechen als das des Brudermordes passiert: in dem der Brudermord rechtens wurde.
Zu den seine Zeit bestimmenden Strömungen stand Flaubert eigenartig quer. Und es ist dieses Querstehen zur Doxa der Moderne, das seinen Werken die bis heute nicht erschöpfte Potenz verliehen hat. »Geschichte« und »Subjekt« sind die für das 19. Jahrhundert zentralen ideologischen Terrains. Auf diesen beiden zwischen Republik, Wissenschaft und Kirche umkämpften Feldern lässt Flaubert sich auf keine der historisch dominierenden Positionen verrechnen. Beide zersetzt er, und er eröffnet dadurch den Weg in eine andere Moderne, einen Weg, auf dem ihm später so unterschiedliche Leute wie James Joyce und Thérèse de Lisieux, Edith Stein oder Luce Irigaray Weggenossen sein werden.
Nach Hegel sollte der Weltgeist in der Geschichte im glücklichen Fall zu sich selbst kommen. Im Sinne dieses glücklichen Endes, einer Art Offenbarung im Irdischen, werden Rückschläge durch die List der Vernunft auf dieses Ziel hingelenkt. Man hat in diesem Zusammenhang von Säkularisation gesprochen. Jules Michelets Interpretation der Französischen Revolution ist vermutlich eines der besten Beispiele für eine solche hegelsche Version der sich auf Erden erfüllenden Geschichte. Der neue, durch die Offenbarung der Revolution gestiftete Bund ist im Hier und Jetzt durch eine neue Verkündigung und eine Jungfrauengeburt Wahrheit geworden. Endlich ist Sein Reich gekommen. Auch für Flaubert bleibt alle irdische Geschichte auf Ereignisse der Heilsgeschichte bezogen: auf Pfingsten und Babel, auf Kreuzigung und Auferstehung, auf Eucharistie und das erfüllende Liebesversprechen des lebendigen Geistes, das den Text zur heilbringenden Nahrung werden lässt. Der Text, im Verhältnis zu dem Flaubert Literatur bestimmt, im Verhältnis zu dem die Literatur der Moderne entsteht, ist die Bibel. Die einfachste Formel, auf die dieses Verhältnis von Flauberts Werk zu den Evangelien gebracht werden kann, ist vielleicht diese: Im Namen des Kreuzes wird die frohe Botschaft durchkreuzt. Sein Werk ist deshalb ein Dysvangelium; es legt Zeugnis gegen die frohe Botschaft ab. Geschichte straft das Heilsversprechen Lügen; sie wird aber negativ ganz von ihm bestimmt, denn sie stellt nichts als dessen Perversion dar. Nur auf dem Hintergrund dieses durchkreuzten Liebesversprechens, das vollkommen bejaht wird, macht sie ihren furchtbaren Sinn.
Die Frage nach dem Subjekt – ermächtigt oder entmächtigt, selbstbestimmt oder entäußert – wird im 19. Jahrhundert zwischen Kirche und Wissenschaft am Fall der sogenannten Mystik, der Visionen und Entrückungen ausgetragen. Sie ist von vornherein geschlechtsspezifisch gedacht. Sich selbst entrückt sind die Frauen nicht durch Gott, sondern, weiß die Psychiatrie, durch ihre Geschlechtlichkeit. Die Wissenschaft wird diesen Komplex großflächig »Hysterie« nennen und als Grund für die Symptome eine frustrierte Sexualität annehmen. Zu leisten ist im Sinne der bürgerlichen Geschlechterideologie die Überführung des Ideals der keuschen Gottesbraut zur fruchtbaren Ehefrau. Die Selbstermächtigung des Mannes als Subjekt des Wissens geht auf Kosten der Frau, die zum Objekt dieses Wissens wird: Die Frau ist, wie sich bereits im 18. Jahrhundert andeutet, an ihr Geschlecht ausgeliefert und kann damit den Normen moderner Subjektivität nicht entsprechen: Sie kann nicht selbstbeherrschtes und selbstbestimmtes Subjekt werden. Auch hier wählt Flaubert, der sich selbst als verhinderten Hysteriker sah, einen Weg, der weder der der katholischen Kirche noch der der Republik ist. Die Nachwehen dieser Auseinandersetzung reichen über die Psychoanalyse und den Feminismus bis in die heutigen Konflikte zwischen ego-zentrierten Philosophien, die eine Theorie des Subjektes vertreten, das Herr im Haus ist, und Theologen, Analytikern und Philosophen, die das Subjekt als unterworfen sehen.
Kenosis der Schrift
Flaubert, Begründer einer anderen Moderne? Die Zentralität Flauberts für die Moderne war Sartre ein Dorn im Auge. Seine Vorstellung von Moderne hatte mit dem, was er bei Flaubert las, nichts zu tun. Was Flaubert – sein Leben, sein Werk – am schmerzlichsten vermissen ließ, war das, was Sartre als Transzendenz bezeichnet: ein ständiges Selbstüberschreiten auf einen Selbstentwurf hin, den er dem modernen Menschen aufgegeben fand und für ihn als Erfüllung der Moderne entwarf. Flaubert hingegen war passiv, ganz und gar ohne aktiven Antrieb. Als pathetischer Charakter litt er und drückte das Erlittene nicht einmal aus. Sartre verbrachte zehn Jahre damit, Flaubert als typischen Irrweg, als eine neurotische Fehlentwicklung der Moderne aus dem Weg zu räumen, eine verfehlte Erscheinung, die keinesfalls nur individueller Art war, sondern als Kollektivneurose große Teile des Bürgertums betraf – daher Flauberts Erfolg, daher aber auch das notwendige Ende dieser Klasse, die nach Sartres Kriterien nicht fit für den Weg in die Moderne war. [3]Flaubert musste zu Ende analysiert werden, um dem neuen Menschen sartrescher Prägung, dem endlich modernen, auf Selbstüberschreitung bedachten Menschen Platz zu machen.
Von diesem passivischen Zug Flauberts, dem Erleiden, dem Pathos seines Charakters ausgehend, werde ich ein anderes Bild der Moderne zeichnen, für die Flaubert in der Tat eine wichtige Rolle spielt. [4]Flauberts Triebschicksal gewinnt an Brisanz, weil sein Werk dieses Schicksal in eine antichristlich-christliche Bewegung einschreibt, die man die Tradition der reinen Liebe genannt hat und deren Urszene die Entäußerung Christi am Kreuz ist. Darin geht es nicht um die Behauptung oder Überschreitung eines Selbst, sondern um einen Prozess, in dem die Entäußerung des Eigenen erlitten wird. Flaubert artikulierte sein Triebschicksal, das Freud wenig später durchgehend im Bezug auf antike Mythen zur Darstellung brachte, in einer antik vorinformierten, an der antiken Zeitenwende situierten und in ihr reflektierten christlichen Matrix.
Flauberts Werk spielt, so können wir heute, nach Freud, sagen, auch auf einer anderen Szene, der Szene des Unbewussten. Diese Szene wird durch die immer selbe Dynamik von Ödipus- und Kastrationskomplex bestimmt. Der Komplex trägt den Namen des Ödipus der griechischen Tragödie, weil dieser die beiden Tabus, die Kultur begründen, durchbrochen hat: Er hat tatsächlich seinen Vater ermordet und mit der Mutter geschlafen. In ihm tritt das heimliche Begehren ans Licht, das alle Kultur bannen muss.
In dieser tragischen Genealogie sind für Flauberts Werk von den ersten Versuchen an Vatermord, Brudermord und Inzest bestimmend. In dem frühen Werk Quidquid volueris bringt ein Affenmensch seinen »Bruder« um, vergewaltigt die Frau seines Ziehvaters, seine »Mutter« – und am Ende der späten Trois contes begegnet uns dieselbe Konstellation in der Figur des Heiligen Julian, der seine Eltern erdolcht; die Erdolchung der Mutter ist eine offensichtlich travestierte Penetration. Beiden Szenen am Anfang und am Ende der Karriere Flauberts haftet etwas von der Gewalt an, die der kleine Junge bei Freud in der Urszene dem Liebesakt zuschreibt, den er als Akt der Verstümmelung der Mutter, wenn nicht gar als Akt der zerstörerischen Tötung sieht: Die Mutter wird durch den Vater kastriert und durchbohrt.
Den Ausweg aus dem Ödipuskomplex, dem Wunsch, den Vater zu töten, um die Mutter inzestuös genießen zu können, erreicht der Junge durch die Kastrationsdrohung. Der Ödipuskomplex leitet die infantile Theorie der Differenz der Geschlechter als kastriert/phallisch ein und trifft den Jungen als Angst, das Organ seiner Lust zu verlieren. In jedem Fall geht er aus dieser Phase nicht unversehrt hervor, denn die Anerkennung der Differenz der Geschlechter besiegelt den Verlust des Einsseins mit der Mutter. Das Schicksal der Mutter kann ihn auch ereilen, wenn er auf seiner Aggression gegen den Vater beharrt, die Bedingung für den Genuss der Mutter ist. Also muss die Mutter als Objekt des Begehrens aufgegeben werden, um später einmal durch andere Liebesobjekte ersetzt werden zu können. Die Beziehung zum Vater wird entsexualisiert und zum Über-Ich idealisiert. So wird der Weg zu Identifikation und Sublimationen bereitet.
Flaubert mobilisiert sämtliche theologischen und historischen Quellen, um immer wieder den Ödipuskomplex zu erzählen: Inzest und Vatermord. Darin gründet seine außergewöhnliche Faszination vom Nero des Tacitus. In der französischen Geschichte findet dieses notorische Szenario die einprägsamste Variante in Diane de Poitiers, einer der Favoritinnen von François I., die der Thronnachfolger Henri II. dem Vater ausspannt und der er sein Leben lang verfallen bleibt, obwohl, so lesen wir in der Princesse de Clèves der Madame de Lafayette, sie weder schön noch jung war. »Quoiqu’elle n’eût plus de jeunesse ni de beauté, elle le gouvernait avec un empire si absolu que l’on peut dire qu’elle était maîtresse de sa personne et de l'Etat.« [5]Weil sie nicht mehr jung ist, und als Geliebte des Vaters seine Mutter hätte sein können, ist Heinrich II. ihr, die über ihn verfügt und nicht ansteht, ihn auch souverän zu betrügen, verfallen. In Flauberts Werk treffen wir sie im Schloss von Fontainebleau als »Diane infernale«, die das Begehren Frédérics übers Grab hinaus auf sich zieht. Ihre Ahnin ist die Hérodias, der wir in den Trois contes begegnen, auch sie eine Jägerin.
Das Begehren des Ödipus wird erzählt. Und sofort sanktioniert. Flaubert oszilliert zwischen Begehren und Sanktion. Er verharrt in der Dynamik des Limbo zwischen Ödipus- und Kastrationskomplex. Die flaubertsche, um das Register des Inzests erweiterte Vision der civitas terrena des Augustinus liest sich wie eine Variante des Ödipuskomplexes. Auch für Flaubert führt der Kastrationskomplex – Inzesttabu und Etablierung einer Generationenfolge, die nicht mehr von Mord zwischen Brüdern, Vätern und Söhnen bestimmt ist – nicht zum Untergang des Ödipuskomplexes. Inzest und Brudermord regieren die Geschichte, die sich als hiesige Geschichte seit Augustinus’ Darstellung erstreckt.
Die Strafe folgt auf dem Fuße, als Todes- oder Kastrationsbedrohung, aber auch als Entsagung, als Selbstentäußerung und Selbsthingabe. Begehren heißt kastriert werden und/oder sterben. Alle, die glauben, um diesen Preis herumzukommen und phallisch prunken, gibt Flaubert der Lächerlichkeit preis. Die Oszillation von Begehren und Kastration nimmt sadomasochistische Züge an, die in unterschiedlichen Varianten vorkommen: Tod nach dem Inzest in Quidquid volueris, metaphorische Kastration in Hérodias, Selbstauslöschung nach verschobenem Inzest in St. Julien, das bis zum Erbrechen gehende Mitleiden des Autors mit der zu Tode leidenden Emma Bovary, wie auch die Aggression gegen sie, die sich darin zeigt, dass für Flaubert letzten Endes alle Lust, und a fortiori alle weibliche Lust, zum Tode ist. Die Verschränkung von Sadismus und Masochismus tritt unübertroffen in der Passion des Mâtho in Salammbô zutage, die er und die Leser – ganz anders als bei de Sade, wo mit den Leidenden kein Mitleid erweckt wird – bis zu einem fast unerträglichen Grad mit erleiden müssen. Die extremen Seiten des flaubertschen Werkes – sein in extremem Pathos einfühlsames Mitleid und sein unglaublicher Sadismus – wären so ein Gefangensein in der Urszene: Mitleid mit der Mutter als Kastrierter, Identifikation mit dem Vater als Kastrierendem, Schuld ob dieser Identifikation, Selbstbestrafung für die Lust mit der Mutter. Der oft krude Pennälerwitz, den Flauberts Briefwechsel an den Tag legt, wäre Abwehr dieses unerträglichen Hin- und Hergerissenwerdens. Doch das ist nicht alles, was man von der Psychoanalyse für die gleichzeitig mit ihr entwickelte Kunst Flauberts lernen kann.
Die Beharrungskraft des Kastrationskomplexes wird durch die Erkenntnis des Erwachsenen von der sexuellen Differenz nicht gebrochen. Gab es bei Freud noch die Vorstellung, dass die unter dem Primat des Phallus stehenden kindlichen Sexualtheorien der Opposition kastriert/phallisch durch die der Biologie entsprechende Erkenntnis der beiden Geschlechter in Penis und Vagina überwunden werden könne, so bleibt für den Freud-Leser Lacan das Verhältnis der Geschlechter von den kindlichen, unter dem Primat des Phallus entstandenen unbewussten Sexualtheorien weiter bestimmt. Phallus und Kastration bleiben unhintergehbar, wie sie es in Flauberts Schreiben geblieben sind.
Bei Freud ist insbesondere der Fetischismus das Beispiel dafür, dass auch die erwachsene Sexualität von den kindlichen Sexualtheorien unbewusst geprägt bleibt. Für den Fetischisten ist der Ersatz des mütterlichen Phallus – also das, was der Junge gesehen hat, bevor er den horrenden Mangel realisiert, notorischerweise Schuhe, Wäsche oder Pelz für die Schamhaare – zur sexuellen Lust notwendig. Zum Selbstschutz, aus Angst, verleugnet er die Kastration der Mutter, die bedeutet, dass auch er kastriert werden könnte. Er vermeidet die Trennung von der Mutter, indem er an ihrer phallischen Vollkommenheit festhält. Denn so bleibt er in der gespaltenen Position, die Differenz der Geschlechter – die die Möglichkeit seiner Kastration birgt – anzuerkennen und gleichzeitig zu verleugnen. Octave Mannoni hat das auf die unnachahmliche Formel »Je sais bien [dass die Frauen keinen Penis haben], mais quand même [aber trotzdem kann ich es nicht glauben]«. [6]Der Fetischismus »bewahrt«, wie Freud so schön sagt, den Jungen vor der Homosexualität. Denn während der Homosexuelle den »kastrierten« Körper der Frauen nicht begehren kann, der für ihn nichts als Drohung und Angst um sein bestes Stück und seine Integrität ist, aber doch auch die Trennung von der Mutter bedeutet, schafft sich der Fetischist ein Objekt, in dem das Faktum der Kastration in Erinnerung behalten und zugleich verstellt ist. Erst die um das Fehlende ergänzten Frauen können zu Objekten des Begehrens werden. Der Fetisch agiert Verleugnung und Anerkennung der Kastration aus. Er verstellt und markiert zugleich die Differenz der Geschlechter. Er erlaubt vor allem eine Position, in der sich der Junge nicht ganz von seiner Mutter lösen muss. Das ist entscheidend für Flaubert.
Symptome für das Drama des Kastrationskomplexes sind die frühe, homosexuell geprägte Freundschaft zu Alfred Le Poittevin. Das bekannteste Symptom bleibt Flauberts Fuß- oder Schuhfetischismus. Wie die Briefe an Louise Colet zeigen, ging Flauberts Schuhfetischismus mit einer masturbatorischen Fixierung einher, und man braucht nur an Madame Bovarys Stiefelchen, an Madame Arnoux’ offene, mit goldenen Lederriemen gebundene Schuhe, an Salammbôs mit Kolibrifedern besetzte Sandalen zu denken, um die Einschlägigkeit dieser Fixierung nachzulesen. Den Schuhen, den Füßen gilt Flauberts Aufmerksamkeit immer und überall. In den Exzerpten, die er aus dem Hohelied in der Bibelübersetzung von Cahen angelegt hat, schreibt er den Kommentar von Cahen in diesem Interesse liebevoll aus: »Les femmes riches avaient des esclaves qui portaient leurs chaussures dans les étuis. Plaute les appelle sandaligerulae. Benoit Baudoin qui etait cordonnier et qui s’étant mis à l’étude s’est appliqué à ce que regarde la chaussure à compter jusqu’à vingt sept sortes de souliers divers.« In seinen Exzerpten aus Voltaire, einem weiteren unveröffentlichten Manuskript der Pierpont Morgan Library in New York unter dem Titel Voltaire, Mélanges – critique littéraire et historique, findet der durch die Kunst der Frauen hervorgetriebene Fußfetischismus der Spanier ausführliche Beachtung: »Un prince héritier d’une grande monarchie n’aimait que les pieds. On dit qu’en Espagne ce goût avait été assez commun. Les femmes par le soin de les cacher avaient tourné vers eux l’imagination de plusieurs hommes.«
Entscheidender und tiefer liegt die im Briefwechsel mit Colet zutage tretende Abspaltung von zärtlichen und sexuellen Regungen und eine damit einhergehende Unfähigkeit zu dem, was man volkstümlich Liebe nennt. Bei Flaubert wird Liebe durchgängig mit dem Tod assoziiert. Die daraus resultierende Unfähigkeit zu lieben hängt prompt mit der in den Briefen eindringlich artikulierten, sofort mit Verstümmelungsphantasien verbundenen Undenkbarkeit zusammen, neben der Mutter eine Frau zu haben, die mehr wäre als ein beiläufiger Sexualpartner. So kommt seine Beschränktheit, ja Behinderung in sexuellen Hinsichten in Briefen an männliche Freunde über das Niveau von Primanerwitzen selten hinaus. Die zur Schau gestellte Kaltschnäuzigkeit, die aufgeklärte Abgeklärtheit in Liebesdingen – die »trous nus« des Orients, der Besuch bei Huren als psychohygienische Maßnahme – mögen manchen Flaubert-Bewunderer beruhigt haben: Hier war ein Mann, der, ohne sich vom Ewig-Weiblichen abhängig gemacht zu haben, ohne fesselnde Leidenschaften, Besessenheiten ganz Mann blieb, der vorurteilslos und ohne falsche Ziererei die weiblichen und männlichen Prostituierten des Orients genoss, entspannt und ohne Komplexe Huren besuchte und auch sonst für Abwechslung nicht unempfindlich war. Ein Mann, der sich im Wesentlichen aber durch Liebesdinge nicht ablenken ließ oder sich gar in ihnen verausgabt hatte, sondern – génie oblige – ganz für sein Werk lebte.
Andere Leser, je nach Temperament und Triebhang, waren durch so viel Männlichkeit nicht wirklich beruhigt. Mit Freud, der von Leonardo da Vinci sagt, er habe geforscht statt zu lieben, liegt es nahe, von Flaubert zu sagen, er habe geschrieben statt zu lieben. Flaubert stellte sich das Lieben als Tod und Zerfleischung des Herzens vor, und gegen diese Bedrohung hat er nach Marthe Robert sein Werk errichtet. [7]Als der wahre Fetisch Flauberts bieten sich weniger die Schuhe als das Werk selbst an, dessen kunstvolle Künstlichkeit – »fetisch« von »machen«, »herstellen« – Flaubert wie kein anderer betont hat. Flauberts Texte sind jedenfalls, daran lässt er selbst keinen Zweifel, nicht vom Herzen in die Feder geflossen. Sie sind aber auch kein natürlicher Ausfluss eines Genies, sondern das Ergebnis, wie Flaubert nicht müde wird zu wiederholen, härtester, zermürbender Arbeit, kunstvoll, kunstfertig.
Im »gueuloir«, seiner Schreikammer, schrie Flaubert sich bekanntlich heiser, um Rhythmus und Klang seiner Prosa zu überprüfen, während seine Texte, das kristallisiert sich immer klarer heraus, die reinsten Bibliotheksfrüchte sind: Ergebnis umfangreichster Lektüren und wissenschaftlicher Studien, von denen avancierter Philologie nicht zu unterschieden. Indessen ist dies Werk in der Metaphorik, die Flaubert zur Charakterisierung des gelungenen Textkörpers benutzt, ganz männlich. Der Textkörper, kann man ohne Übertreibung sagen, wird als erigiertes Glied konzipiert, aus dem alles Weibliche, alles Weiche, nicht Angespannte, Nachgiebige, Fließende verbannt werden muss. [8]Flaubert behauptet seine ganze Männlichkeit unter Abwehr und Herabsetzung alles Weiblichen, wann immer es zur Beschreibung seiner poetischen Praxis kommt.
Seine poetische Praxis aber scheint mir gleichwohl – malgré lui vielleicht – dem ostentativen Phallologozentrismus in entscheidenden Momenten zuwiderzulaufen. In seinen Texten kann man lesen, was seine Briefe oft zu widerlegen scheinen: Dass man den Phallus um den Preis seiner Preisgabe nur behaupten kann. So schreibt Flaubert zwar, um zu lieben, aber seine Texte selbst behaupten nicht in derselben einfältigen Weise die Männlichkeit, die seine Briefe hervorkehren. Seine Texte behaupten nicht, noch errichten sie Autorität. In der Verlagerung ins Symbolische der Texte Flauberts zeigt sich der gesamte Ödipuskomplex deshalb in einer selten gesehenen Aggressivität gegen die diesen Termini verpflichteten symbolischen Väter, vor allem Hugo und Balzac, deren Autorität zerstört, zerschrieben, lächerlich gemacht wird, und deren Textgewebe, prägend in dem frühen Quidquid volueris, förmlich zerrissen werden. Die intertextuelle Auseinandersetzung, die Angst vor und Abwehr ihres Einflusses wird im Vokabular phallischer Ermächtigung und Kastration verhandelt. [9]
Was an diesen Vorläufern lächerlich gemacht wird, ist ihr »guter Wille zur Autorität«, ihr Wille, sich als Autor zu behaupten und als Autorität zu setzen, kurz, das von ihnen verkörperte Prinzip der Traditionsbildung. [10]Nichts liegt Flaubert mehr am Herzen, als diesen Fehler zu vermeiden. Er tut dies – das ist die stilistische Dimension der Kastrationsdynamik –, indem er einen Stil entwickelt, der ihm genau darin eigen ist, dass alles Eigene aus ihm verbannt ist. Flaubert wird er selbst allein durch andere. Wie bei wenigen anderen Autoren gehen ganze Bibliotheken in die Texte Flauberts ein; sind sie das Ergebnis der aufwendigsten Recherchen. Aber anders als in den klassischen Poetiken und den Poetiken der Renaissance, der Mimesis und der gesteigerten Nachahmung der Emulation, ist Flauberts Praxis kein Pollensammeln, das zu einem Honig eigenen Stils und Tons führt, sondern zu der seit ihm sprichwörtlichen Unpersönlichkeit, der höchsten selbstverleugnenden Askese des Stils.
Man kann von einer Entäußerung an die Texte der andern sprechen, die ihr Eigenes nur im Andern finden kann. Die humilitas des Zitierens, des Gemeinplatzes, des sich Eintragens in Gattungen wie die Heiligenvitae, die autorlos sind, die weitgehende Abwesenheit einer auktorialen Instanz und das, was Roland Barthes den »Nullpunkt der Schrift« genannt hat, aber auch das Entwenden von Textfragmenten und deren Umorientierung in eine neue Anordnung – all das ist Teil einer Arbeit, die nichts Eigenes setzt und behauptet. Die Verweigerung der direkten Äußerung eines eigenen Werturteils und der Verzicht auf Leserlenkung, die Unsicherheit des point of view in der Ironie - auch das ist Teil dieser Arbeit. Das heißt aber auch, mit ihm, Flaubert, wird man nicht so umgehen können, wie er es mit den anderen getan hat, weil er weder so naiv noch so impertinent war, sich selbst zu behaupten. Dies asketische Ausschreiben alles Eigenen, alles Setzenden, hat ihn zum Begründer der modernen Literatur gemacht.
Nun erfolgt die Auseinandersetzung Flauberts mit der Autorität und damit auch die Bestimmung dessen, was Literatur ist, nicht so sehr mit den Autoren und auch nicht mit den wissenschaftlichen Autoritäten seiner Zeit – so wenig diese zu unterschätzen sind –, sondern mit dem Buchstaben der Schrift, die Flaubert sich einverleibt hat, dem der Testamente. Vor diesem Hintergrund wäre noch einmal Flauberts Obsession von der Wahrheit zu untersuchen, die so weit ging, dass er Fahrpläne nachrecherchieren ließ. Dies ist bisher auf das Konto eines Realismus der getreuen Abbildung gesetzt worden. Hier geht es, scheint mir, weniger um Realismus als um die Konkurrenz mit der Bibel. Flaubert insistiert darauf, dass seine Texte nicht nur wie die Allegorie der Dichter einen sensus allegoricus, sondern wie die Testamente einen sensus historicus haben: »Es geschah; so ist es passiert.«
Die hauptsächliche Geistesbeschäftigung des 19. Jahrhunderts zwischen Chateaubriand, Hugo und Nietzsche gilt der Neubestimmung des Verhältnisses von Altem und Neuem Testament, Judentum, Christentum und Antike. Das 19. Jahrhundert steht darin dem 16. Jahrhundert der Reformation näher als dem 17. und 18. Jahrhundert. Charakteristischerweise verlagert sich die Auseinandersetzung auf das Feld der Liebe und das Verhältnis der Geschlechter. Selten vorher ist der Katholizismus so deutlich als eine Religion des Glücks zu lieben und der Wollust der Seele ins Bewusstsein getreten. So war es dann das 19. Jahrhundert, in dem Michelet die Liebe der Braut Christi in die bürgerliche Ehe, Charcot die Matrix der Heiligkeit in die psychologische Kategorie der Hysterie überführt hat. Es ist die Einzigartigkeit des Weges, die Flaubert in der Überführung dieser Matrix gefunden hat, die ihn für die Moderne so wichtig macht. Von Flaubert her gesehen möchte ich es – in aller gebotenen Vorläufigkeit und vorsichtig – die Überbietung der Kastration nennen, die das Christentum inszeniert und die Flaubert entdeckt. Flaubert befindet sich damit im krassen Gegensatz zu seinen Zeitgenossen, die gegen so viel Kastration und hysterische Wollust die Natur und »Männer-Instinkte« Nietzsches – Ähnliches hätten aber auch Zola oder Michelet schreiben können – mobilisieren.
Es ist auffällig, dass Flaubert die Dynamik des Kreuzes, die Paulus im Brief an die Philipper exemplarisch vorgezeichnet hat, als komplexe Dialektik von phallischer Allmacht und Kastration, von Aufstieg und Fall formuliert. Jesus, heißt es im Philipperbrief sinngemäß, hat sich über alle Maßen bis zum Sklaventod am Kreuz entäußert und erniedrigt, um im Sieg über den Tod über alle Maßen erhöht zu werden. Im Gegenzug sieht Flaubert im Auferstehungsversprechen eine phallische Chimäre, deren Zersetzung sein Text leistet. Indem sich Flauberts Werk um die Frage der Fragen, die Frage nach dem Kreuz, dreht, ist seine Antwort nicht mehr, wie gerne angenommen wird, die Voltaires. Zwar vereint beide ein viskeraler Antiklerikalismus, aber Religionssatire ist nicht Flauberts letztes Wort. Flaubert definiert sein Werk gegen und mit dem Buch der Bücher, der Schrift der Schriften antichristlich-christlich. Diese die Literatur der Moderne begründende Auseinandersetzung ist unerhört und ungelesen geblieben. Falls es einen Zeitgenossen gibt, der bestimmte Momente der Perspektive Flauberts teilt, dann ist es der Nietzsche des Antichrist. Auch Nietzsche betreibt seine Auseinandersetzung mit dem Christentum in Termini der Kastration.
Allerdings wäre Flaubert nichts fremder gewesen als die bekannten Nietzschepeinlichkeiten von den »starken Rassen des nördlichen Europas« (19; 183) und das Züchten eines Übermenschen, dessen Zukunft nur allzu bekannt ist. Das zeittypische sozialdarwinistisch vitalistische Gerede vom Willen zur Macht hätte Flaubert, wenn man das so sagen darf, sofort abgeschnitten. Auch das nicht weniger verhängnisvolle Gerede vom größten Laster des Christentums, dem »Mitleiden […] mit allen Missrathenen und Schwachen« (2; 168), dem eine nicht minder flächendeckende, verheerende Zukunft beschieden war, war Flaubert fremd. Da kam der späte Zola der Quatre Evangiles Nietzsche weit näher. Nichts hätte Flaubert ferner gelegen als die Sprache apodiktischer Setzungen. So hat Nietzsche Flaubert wie Pascal wegen deren »unegoistischen« Art verachtet. Flaubert ist entscheidend für die Moderne geworden, weil er als einer von ganz Wenigen ohne Anflug von Größenwahn und Selbstermächtigung dem vitalistisch-darwinistischen Willen zur Macht widerstanden hat, dem Autoritätskonflikt an dessen Wurzel aber nicht ausgewichen ist. In der Kenosis – in einer Entäußerung, einem Einwilligen, wenn man so will, in die Kastration – hat er ihn erduldet, ausgehalten, ihm standgehalten. [11]Hätte man ihn zu lesen verstanden, so meinte der alternde Flaubert, wäre es nicht zum Bürgerkrieg von 70/71 gekommen. Ein berühmtes Diktum von Shaw über den Sozialdarwinismus verlängernd könnte man sagen, wäre es zum Weltkrieg nicht gekommen, hätte man Flaubert lesen gelernt.
Rückwärtig erhellt sich von Nietzsches Interpretation des Lebens und Sterbens Christi her Flauberts Alternative zu Nietzsche. In manchen Punkten holt Nietzsche theoretisch ein, was Flaubert praktiziert, obwohl Nietzsche diese Einsichten kaum in der Lektüre Flauberts gewonnen hat. So zeichnet sich Nietzsche durch ein erstaunliches Verständnis der Kenosis aus, das er indessen schnell abwehrt und verwirft. Nietzsche stellt den Menschen Jesus und die Praxis derer, die in seiner Nachfolge stehen, ganz wie Flaubert – wenn auch mit unterschiedlichen Akzenten – gegen das herrschende Christentum. Für dieses herrschende Christentum, das das Evangelium völlig auf den Kopf stellt, ist Nietzsche zufolge Paulus verantwortlich. Die Kirche, in der Nietzsche nichts anderes als die Fortführung und den Sieg des Judentums und damit nicht nur die größte aller geschichtlichen Katastrophen, sondern auch aller geschichtlichen Ironien sieht, setzt unter der Führung des Paulus das wieder ins Werk, »was mit dem Evangelium abgethan war«. Was aber mit dem Evangelium abgetan gewesen wäre, »war das Judenthum der Begriffe ›Sünde‹, ›Vergebung der Sünde‹, ›Glaube‹, ›Erlösung durch den Glauben‹ – die ganze jüdische Kirchen-lehre war in der ›frohen Botschaft‹ verneint« (33; 204). Gegen diese Interpretation der Kirche von Christi Leben und Tod, die jüdisch ist, ohne es zu wissen, stellt Nietzsche seine Interpretation des Evangeliums: »Was heißt ›frohe Botschaft‹? Das wahre Leben, das ewige Leben ist gefunden – es wird nicht verheissen, es ist da, es ist in Euch: als Leben in der Liebe, in der Liebe ohne Abzug und Ausschluss, ohne Distanz.« (29; 198). Das hat Flaubert ähnlich gesehen. Inbegriff des Unchristlichsten – sofern »der Menschensohn« und seine Nachfolge der Eintritt in den sensus anagogicus, »in das Gesammt-Verklärungs-Gefühl aller Dinge« (34; 205) in jedem einzelnen Individuum im Hier und Jetzt ist – ist der paulinisch-jüdische Gedanke von Opfer und Lohn: Das Kreuzesopfer wird durch die Überwindung des Todes belohnt.
Nietzsches Parcours zeichnet sich durch eine interessante Überführung des psychologischen Portraits Christi als Inbegriff des décadent und damit des Krankhaft-Kindlich-Idiotischen aus, um mit einer bibelhermeneutisch so interessanten wie entschärfenden Interpretation von »Menschensohn« und »Gott Vater« zu schließen, die das für Nietzsche Unerträgliche an der Figur Christi bereinigt, indem er dessen Leben und Sterben zu nichts als einem Symbol für den Zustand von Herzen macht, die im Hier und Jetzt im sensus anagogicus leben. So sehr Nietzsche die gescheiterte Überwindung des Judentums durch die christliche Praxis begrüßt, so unwohl, ja unheimlich, ist ihm bei der Untersuchung des Mittels dieser gescheiterten Überwindung. Anders als Renan, der Christus in seiner psychologischen Studie als »Helden« und »Genie« bestimmt, sieht Nietzsche in ihm eher einen »Idioten« im ursprünglichen Sinne; nur ein Dostojewski hätte den »ergreifenden Reiz einer solchen Mischung von Sublimem, Krankem und Kindlichem zu empfinden« gewusst (31; 200).
Die Substanz der christlichen Praxis eines Evangeliums ohne Schuld, ohne Strafe und Lohn, ist die vollkommene Aufgabe jeder Selbstbehauptung: »der Christ handelt, er unterscheidet sich durch ein andres Handeln. Dass er dem, der böse gegen ihn ist, weder durch Wort, noch im Herzen Widerstand leistet.« (33; 203). Christus erlöst nicht; sein Leben und sein Sterben sind Symbol für einen Zustand der Seligkeit. »bloss die christliche Praktik, ein Leben so wie der, der am Kreuze starb, es lebte, ist christlich. Heute noch ist ein solches Leben möglich, für gewisse Menschen sogar nothwendig […] Nicht ein Glauben, sondern ein Thun, ein Vieles-nicht-thun vor Allem, ein andres Sein« (39; 209). Christus zeigt durch sein Sterben, wie man zu leben hat: »Er widersteht nicht, er vertheidigt nicht sein Recht, er thut keinen Schritt, der das Äusserste von ihm abwehrt, mehr noch, er fordert es heraus […] Und er bittet, er leidet, er liebt mit denen, in denen, die ihm Böses thun« (35; 205). »Nicht sich wehren, nicht zürnen, nicht verantwortlich-machen […] auch nicht dem Bösen widerstehen, – ihn lieben […]« (35; 206).
Nietzsche ist bei dieser Praxis der Kenosis, die er glänzend wiedergibt, unwohl; er möchte nicht in dieser »seltsamen und kranken Welt« (199), bei dieser Mischung aus Verworfenem, Kindlichem, Krankem, Idiotischem verweilen, und je länger dies geht, desto abstrakter wird ihm alles. »Das ›Reich Gottes‹ ist nichts, das man erwartet; es hat kein Gestern und kein Übermorgen, es kommt auch nicht in ›tausend Jahren‹, es ist eine Erfahrung an einem Herzen« (34; 205), schließt Nietzsche, und wir ergänzen mit Blick auf Flaubert, »an einem einfachen Herzen«, am Herzen eines Idioten. Indessen, Flaubert hat mehr Nerven als Nietzsche, bei dem sich an alles Entäußernden zu verweilen, und er flüchtet sich nicht in antike männliche Tugend.
Das Kreuz der Geschichte
Die Zentralität des Kreuzes für das Werk Flauberts springt in einem ganz und gar oberflächlichen, buchstäblichen Sinn immer wieder wie zufällig ins Auge. Das letzte Wort von Madame Bovary ist »croix d’honneur«. Vor dem letzten blanc der Éducation sentimentale, am Ende der Zeitchronik, die die Éducation auch ist, und der dann nur noch eine Coda folgt, stirbt Dussardier »les bras en croix«. Gekreuzigt hängen sich Karthager und Söldner am Ende von Salammbô gegenüber, das mit einem regelrechten Kreuzweg des Helden endet. Die Trois contes stellen die Figur des Kreuzes in der vertikalen Dynamik der Endszenen, die vom Tragen des abgeschlagenen Kopfes des Johannes in der Horizontalen gekreuzt wird; sie zeichnen es. Nun geht es Flaubert – das bestätigt die Manier der anagrammatisch eingezeichneten Kreuze – im Umgang mit der Religion nicht um die zeitübliche Konjunktur der historisierenden Bibelkritik und der in ihr unternommenen Entmythisierung, wie sie der von Flaubert geschätzte Renan betreibt. Die Rettung des Kreuzes vor dem Christentum, die Flaubert umtreibt, ist keine der Vermenschlichung, sondern eine wahrere, unter den herrschenden humanistischen Ansinnen ganz unvorstellbare Nachfolge des Kreuzes. Flaubert schreibt dem Kreuz die Praxis der vorchristlichen Menschenopfer, die Praxis des Sündenbocks ein. Diese, für die Gesellschaftsbildung grundlegende Struktur ist durch das Kreuzesopfer weder überwunden noch erlöst worden; Christus ist ein Sündenbock mehr. Allerdings wächst dem Phänomen des Sündenbocks erst durch das Kreuz Christi sein Pathos zu. Erst von der unerhörten Liebe her, die mit Christi Kreuzestod in die Welt kommt, offenbart es seinen ganzen Schrecken.
Die katholische Kirche und, schlimmer, ihre säkularisierten Formen verstellen diese Logik des Sündenbocks, wie sie, folgt man Flaubert, noch die Gesellschaft des Frankreichs des 19. Jahrhunderts bestimmt, und verschärfen den allgemeinen Verblendungszusammenhang. Nicht heilbringend, sondern schlicht verheerend ist der Glaube, durch Republik oder Sozialismus, Wissenschaft und Fortschritt eine endlich erlöste Gesellschaft zu schaffen. Am schlimmsten ist die Literatur als neue, evangelische Instanz der Heilsverkündigung. Die Kirche und in einem noch verheerenderen Maße ihre säkularen Nachfolgeformationen sind so heilsversessen wie leidensvergessen. Absoluter Antipode der Nachfolge Christi ist das bürgerliche Credo an sich, die Behauptung wohlverstandenen Eigeninteresses. Diesen bürgerlichen Krämergeist findet Flaubert im Christentum angelegt und vorbereitet. Er setzt deshalb an, die herrschenden Diskurse der Zeit zu zersetzen. Das ist vor allen Dingen der dem hegelschen Zu-sich-kommen von Geschichte folgende Historismus, das Einwandern der theologischen Schemata in die weltliche Geschichte, die Flaubert nicht zuletzt bei Hegel kennenlernte. [12]Er nützt die Destruktion des Säkularisierten und damit aller politischen Theologie zur Dekonstruktion des christlichen Liebesopfers, das er neu begründet. Flaubert steht damit im krassesten Gegensatz zu allen politischen, wissenschaftlichen und religiösen Strömungen seines Jahrhunderts; er steht in seiner ätzenden Skepsis, deren Kehrseite ein einzigartiges Pathos des Leidens ist, im 19. Jahrhundert allein.
Denn was dessen Strömungen bei all ihrer Unterschiedlichkeit leugnen, was sie abzuschaffen, zu überwinden oder zu rechtfertigen versprechen, so ergibt sich ex negativo aus der Schrift Flauberts, ist das Leid. Gemeinsam ist ihnen die Verleugnung des Kreuzes, das er seiner Schrift als Signatur des Realen einzeichnet. Die Verleugnung des Kreuzes teilen die Sozialisten mit der katholischen Kirche. Die »socialistes« könnten im folgenden Zitat durch viele andere Heilsversprecher ersetzt werden:
»Voilà ce que tous les socialistes du monde n’ont pas voulu voir, avec leur éternelle prédication matérialiste. Ils ont nié la Douleur, ils ont blasphemé les trois quarts de la poésie moderne, le sang du Christ qui se remue en nous. – Rien ne l’extirpera, rien ne le tarira. Il ne s’agit pas de le dessécher, mais de lui faire des ruisseaux. Si le sentiment de l’insuffisance humaine, le néant de la vie venait à périr (ce qui serait la conséquence de leur hypothèse) nous serions plus bêtes que les oiseaux, qui au moins perchent sur les arbres.«
Was machen die Vögel hier, die klüger als die, die Heilsversprechungen aufsitzen, »perchent sur les arbres«? Sie folgen Christus nach, »perché sur l’arbre de la croix«. [13]Die moderne Dichtung ist Gefäß für das vom Gekreuzigten vergossene Blut und damit der Gegendiskurs zu allen Heilsversprechen. Sie allein – und nicht die Kirche – tut etwas zu Seinem Gedächtnis.
Das Leiden Christi ist Synonym der Unzulänglichkeit alles Menschlichen und der Nichtigkeit des Lebens, das in Erinnerung gehalten werden muss. Die Schöpfung mag nach dem mittelalterlichen Modell der analogia entis gedacht werden; aber der Schöpfer, der in ihr zu lesen ist, ist nur der Gekreuzigte. Geschichte wie Schöpfung heißt die dauernde Inszenierung des Kreuzesgeschehens. Einen anderen sensus anagogicus gibt es für Flaubert nicht. Das Kreuz steht für Unmöglichkeit von Erfüllung, für Tod im Leben, Mangel im Menschlichen.
Das Werk Flauberts wird also zum Chiasmus: zu einer Durchkreuzung des Kreuzes. Durchkreuzt wird das Heilsversprechen in allen religiösen und säkularen Varianten. Wie Nietzsche führt Flaubert eine Antike gegen das Kreuz, die mit virtus, mit sich behauptender Männlichkeit, allerdings nichts zu tun hat. Flauberts gegen das Kreuz geführte Antike ist orientalisch. Sie wurde gerade eben von der Bibel- und Mythenforschung und der jungen Ethnologie seiner Zeit entdeckt. Es ist die Wiederkunft Babels, dessen Tochter Rom ist und die sich im Paris des 19. Jahrhunderts, wahres Rom und damit neues Babylon, erfüllt. Im Lichte des Orients gibt die Moderne ihre Wahrheit zu lesen. Alle Texte Flauberts buchstabieren diesen babylonischen Topos nach Augustinus’ civitas terrena aus. Babylon wird für Flaubert zur Kurzformel der irdisch-menschlichen Geschichte. Aber erst durch das christliche Heilsversprechen und dessen säkularisierte Mutationen, die das Anbrechen eines Reich Gottes auf dieser Welt versprechen, erreichen die antiken Verheerungen ihre volle Erfüllung. Das Kreuz, das so die ewige Wiederkehr des Opfers ein für alle Mal durchbrechen sollte, ist das, was ewig in der Geschichte wiederkehrt. Was das Christentum zu überwinden versprach – die Logik des Sündenbocks –, wird unter dem Mantel des Heilsversprechens umso hemmungsloser fortgeführt. In römisch-katholischer Travestie und ihren säkularen Nachfolgeformationen triumphiert Babylon. Wir haben es mit komplexen Formationen der Übertragung der Antike ins Christentum zu tun, die trotz der Reihe illustrer literarischer Vorläufer in ihrer neuen, radikaleren Pointierung zu analysieren sind. Das Schema der interpretatio christiana, das das Verhältnis von Antike und Christentum nach umbra und figura, heidnischen und alttestamentarischen Prophezeiungen regelt, wird ins Abgründige verkehrt. Der implizite Maßstab, an dem Flaubert die Welt misst – und verurteilt –, ist die sich im Tode entäußernde, selbstlose Liebe, die, umsonst, nichts erlöste. Aus der Unerhörtheit dieser Liebe nährt sich der ebenso unerhörte Pessimismus des flaubertschen Werks. Insofern folgt sein Werk der Hauptunterscheidung, die Augustinus in der Civitas Dei entwickelte, der Unterscheidung zwischen Selbst- und Gottesliebe, selbstbezüglicher und selbstloser Liebe, die die civitas terrena von der civitas Dei trennt.
Rhetorisch gesehen entspricht der Durchkreuzung des Kreuzes wieder ein Chiasmus. Flaubert verkehrt die Kurzformel der paulinischen Hermeneutik vom Buchstaben des Gesetzes, der tötet, und dem Geist der Liebe, der belebt. Flaubert belebt, was zum Tode ist, und er verbuchstäblicht, tödlich, allen lebendigen Geist, der zur Katachrese, zur toten Metapher erstarrt. Das Herz des Verführers Rodolphe wird mit einem von Kindern plattgetrampelten Schulhof verglichen, auf dem, ganz tot, nichts mehr wachsen kann: lebendige Illustration des allen Verstehens und Liebens unfähigen Herzens, des zur Katachrese erstarrten »Herzens aus Stein«. Lebendig dargestellt wird, was zum Tode ist. Zum toten oder abgedroschenen Buchstaben dagegen wird, was sublime Qualität hat, Sublimation oder lebendigen Geist zeigen soll. Die Himmelfahrt des Julian findet sich kurzerhand abgeschnitten, sie wird im Witz der Allpotenz erstickt.
Das Darstellungsvermögen der Dichter, lebendig vor Augen zu stellen, »faire clair et vif« in Flauberts Worten, wird im Topos der ut pictura poesis thematisiert: wie die Malerei, so die Dichtung. In wenigen Werken spielt die Kunst eine so wichtige Rolle wie in den Texten Flauberts; der »illustrierten« Gemälde sind so viele wie der zitierten Texte. Flauberts Texte sind mit Gemälden gegen Gemälde geschrieben. Die Fähigkeit, lebendig vor Augen zu stellen, geschieht nun in einer Durchkreuzung dieses Topos. Flaubert ist Ikonoklast; er setzt auf eine »aride fictionnalité, [qui] tend à dénoncer les images, les figures, les idoles, la rhétorique«. [14]Gegen die idolatrische Faszination des Bildes stellen seine Texte die Esoterik der Schrift. Mit Händen und Füßen hat Flaubert sich gegen die Bebilderung seiner Werke gestemmt: »L'illustration est antilittéraire […]. Voulez vous que le premier imbécile venu dessine ce que je me suis tué à ne par montrer?« [15]Das Bild fällt in Flauberts Vorstellung auf die Seite von Babel. Gegen seine Exoterik stellt er die Esoterik der Schrift. Auch darin sind seine Texte Testament gegen das exoterische Evangelium. Wenn Flaubert auch sonst fast nichts mit Zola teilt, so doch den Ekel vor der ersten Popkunst, die der religiöse Massenkitsch des 19. Jahrhunderts war und der den Gläubigen die Mysterien der Religion lebhaft vor Augen stellen sollte. Die Askese des flaubertschen Stils kulminiert im Verzicht auf die Macht der Dichter, Lebendiges lebendig vor Augen zu stellen. Lebendig vor Augen zu stellen ist im Zustand der babylonischen Gefallenheit der Sprache notwendig Täuschung, Trug; diesen Zustand der babylonischen Sprache gilt es babylonisch – denn andere Möglichkeiten gibt es nicht – zur Sprache zu bringen: die Klischiertheit der Sprache, ihre tödliche Abgegriffenheit, zur Anschauung zu bringen. Gegen den lebendigen Geist stellt Flaubert den Buchstaben, der bleibt; in den Wortwitzen klingen letzte Reste eines himmlischen Echos nach.
Madame Bovary, die Erzählung vom Ruin einer Familie in der normannischen Provinz, ist die Geschichte eines Opfers, das Gemeinschaft begründet. Opfer ist die Ehebrecherin, die in ihren infamen Tod getrieben wird, um ausgeschlachtet zu werden. Flaubert schreibt den Roman als Monument für die fehlgehende, im Fehlgehen gleichwohl erhöhte Passion der Heldin; er tut es zu ihrem Gedächtnis. Die Passion der Bovary ist das Einzige, was in einer Welt, in der jedes nicht eigennützige Verhalten verrückt erscheint, noch in der Perversion, in ihrem Fehlgehen und ihren Verdrehungen von einer Liebe zeugt, die unerhört geblieben ist. Entsprechend zeigt die Éducation sentimentale Geschichte und Welt als ebenso entsetzliche wie ahnungslose und verhängnisvolle Pervertierungen von Eucharistie und Parusie. Als versteckte Matrix sind sie dem Roman eingeschrieben, ex negativo im herrschenden Babel präsent. Der Text selbst hält, um mit Adorno zu sprechen, nicht nur die Hoffnung auf Erlösung als eine vergangene, als eine enttäuschte fest. [16]Er zeigt umgekehrt, dass es das Festhalten an der Hoffnung eines erlösten Reiches auf Erden ist, das in Form von politischer Theologie zur Fortdauer der schlimmsten Verheerungen führt. Ironisch illustriert der Roman, wie die Brutalität der Geschichte im Namen des Heilsversprechens immer und immer wieder nur die Figur des Kreuzes nachzeichnet, in dem Flauberts Text die Logik des Sündenbocks aufscheinen lässt. Die hoffnungslose Figur des Kreuzes in der Geschichte zu lesen und im Text zu stellen, im Gedächtnis zu halten, ist Aufgabe der Literatur. Der Ausfall des Versprechens macht die Passion derer, die sie erleiden, in ihrer ganzen Nutzlosigkeit, Perversität oder Verrücktheit um ein verzweifeltes Maß reiner. Die Askese des Schreibens ist das letzte Mittel, sich dieser Reinheit zu versichern. Literatur »stellt« das Kreuz ohne Heil und ist ein umso unerträglicheres memento crucis, als der einzige Trost im Bezeugen des Leides liegt. In keiner Geschichte aufgehoben, sind die die Geschichte Erleidenden für kein gutes Ende mehr zu haben.
Salammbô ist vor allem eins nicht: bei aller Akribie der historischen Recherche kein historischer Roman. Die Prämissen der hegelschen Geschichtsschreibung, die Prämissen des Geschichtsdenkens des Jahrhunderts einer zu sich selbst kommenden Geschichte und der zu sich selbst kommenden Subjekte darin werden geleugnet und zerstört. Im vollkommenen Gegensatz zu allem, was Säkularisation heißen konnte, bleibt bei Flaubert kein unabhängiger Raum des saeculum. Das Kreuz ist schon vor dem Kreuz die Matrix aller irdischen Geschichte. Geschichte tut nichts anderes und hat nie anderes getan, als immer neue Figuren dieses einen Kreuzes zu stellen. In Salammbô wird die Entäußerung des Liebesopfers in eine schwindelerregende Überbietung, durch brutale Verfleischlichung ins Äußerste getrieben: eine Kenosis, in der die Kenosis sich verkennt.
Die Trois contes sind in ihrer dichten Intertextualität und vollkommenen Komponiertheit mit Prosagedichten verglichen worden. Sie bieten zweifelsfrei die abgründigste Durchkreuzung des Kreuzes und sind in dieser Abgründigkeit Stein des Anstoßes der Flaubertforschung geblieben. Flauberts Werk der Dekonstruktion vollendet sich in den Trois contes: einem Projekt, das man geistes- und religionsgeschichtlich als eine Aufgipfelung und gleichzeitig als ein Abgründigwerden der selbst-entäußernden Kenosis sehen muss, die das Schreiben Flauberts vollzieht. Vieles von dem, was in den vorangegangenen Texten nur implizit oder als Folie präsent ist, wird in diesen drei Kunststücken bizarrer Heiligenviten explizit. Sie spielen auf dem Gebiet der Theologie. Ihr offensichtliches Thema ist eine bis zur Selbstaufgabe gehende selbstlose Hingabe. Welt und Geschichte schrumpfen, verdammt in alle Ewigkeit, lapidarer als in den Romanen noch, zu einem grotesken Negativ von Liebesmahl und pfingstlicher Parusie zusammen.
Das Auffahren in den Himmel, in den die beiden Heiligen Félicité und Julian entrückt werden, wird in den Trois contes sexualisiert. Der mystischen Verzückung der Liebeserfüllung durch den himmlischen Bräutigam im Moment des Todes wird die antike Entrückung durch einen ganz und gar phallisch-antiken Gott mitsamt ihren tödlichen Konnotationen eingeschrieben. Chiastisch ist ihre Himmelfahrt oder ihre Verzückung, ihre ekstatische Erhöhung, ihr tiefster Fall, der die idolatrisch-phallische Natur des Christentums aufdeckt. In diesem im wahrsten Sinne des Wortes aufgeblasenen Versprechen stellt es noch das Heidentum in den Schatten, in dessen Apotheosen immerhin der Tod blieb. Das in Hérodias aus dem Johannesevangelium zitierte Wort »pour qu’il croisse, il faut que je diminue« wird Johannes dem Täufer in den Mund gelegt, um am Ende der Erzählung die Kastrationsformel der heidnischen Cybelekulte zu bewahrheiten. Die selbstlose Liebe des Cœur simple der Félicité rückt in die Nähe der Idiotie. Der Topos der geistigen Nacht, in der der Gläubige blind der Dunkelheit ausgeliefert ist, wird buchstäblich, Félicité verliert ihr Augenlicht. Der Ausgang aus dieser dunklen Nacht, auf die das Licht der visio beatifica folgt, erscheint als blendende Illusion. Auch das Licht der Liebe Julians gerät durch ihr Modelliertsein auf psychiatrischen Analysen in die Nähe des Wahnsinns und erfüllt sich in einer Himmelfahrt, die alle Momente einer homosexuellen Liebesszene zeigt. Mais encore – um die wahre imitatio Christi antreten zu können, entäußern sich diese bizarren Heiligen nicht nur an die Welt in einer Liebe, die umsonst ist und schändliche Züge trägt; ihnen wird, schlimmer, die Durchkreuzung des Kreuzes aufgebürdet, das Kreuz mit dem Kreuz, und es ist dieses zweite Kreuz, das ihre Passion vollendet und ihre imitatio in der Durchkreuzung wahrmacht.
Quidquid volueris: Die Monstrosität der Zivilisation
Die lange Erzählung Quidquid volueris, die Flaubert im Alter von sechzehn Jahren schrieb, inszeniert aufs eindrücklichste das Drama von Geschlechtlichkeit und Grausamkeit, von Zeugung und Schöpfung. [1]Flaubert inszeniert in seiner Menschenaffengeschichte eine Poetik, in deren Fokus der Schlüsselbegriff der – schlechten – Mimesis, der des Nachäffens nämlich, steht. Gerade dies, nachäffen, tut der Menschenaffe Djalioh nicht. Djalioh, die Missgeburt, der Idiot, der nicht lesen und schreiben kann, ist in einer andern Praxis des Schöpfens eine Rückenfigur des Autors Flaubert. Die Szene, die das ganze Werk Flauberts in vielen Variationen bestimmen wird, findet sich hier zum ersten Mal: die Bestimmung der Liebe als inzestuös und das damit einhergehende Ineinssetzen von Liebe und Tod. Die Tödlichkeit der sexuellen Liebe, so zeigt Flaubert in einer Geschichte, die Triebschicksal und Poetik kurzschließt, wird nicht im Kind, sondern im zerreißenden Selbstopfer fruchtbar.
Der – bestialische – Dichter, der nicht nachäfft, sondern Unerhörtes von sich gibt, steht in seiner brutalen Verausgabung dem wohlverstandenen Eigeninteresse der Gesellschaft diametral entgegen. Die bestialischste Figur der Geschichte ist nicht der im Zentrum der Novelle stehende Affenmensch, sondern der einzige Überlebende des Dramas, der zugleich dessen Urheber ist: der Unmensch Paul de Monville. An ihm lässt sich studieren, wie man in der Gesellschaft erfolgreich ist. Diesem Paul, der monströser ist als alles Tierisch-Monströse sein kann, fällt in den Schoß, wonach sich nach Sigmund Freud jedes männliche Ich im Tagtraum notorisch sehnt: »Glück, Glanz, Ruhm und die Liebe der Frauen«. Paul ist der Einzige, dem kein Haar gekrümmt wird. Er profitiert von dem ganzen Drama. Ganz unbeschadet, ja reicher an Ehre, Frauen und Geld, geht er aus ihm hervor.
Quidquid volueris setzt mit dem Verschweigen einer Geschichte ein, die nicht für die Ohren der Frauen und noch weniger für die von Bräuten bestimmt ist: »Contez nous votre voyage au Brésil, mon cher ami. […] Cela amusera Adèle« (244) [»Erzählt von Eurer Reise nach Brasilien, lieber Freund […] das wird Adèle unterhalten« (95)], [2]wird Paul von seiner Tante, Mme de Lansac, am Vorabend seiner Hochzeit aufgefordert. Paul aber scheint der Meinung zu sein, dass die Erzählung seiner brasilianischen Abenteuer für seine Braut Adèle keineswegs amüsant wäre, und zieht sich auf leere Phrasen zurück: »›Mais, ma tante, j’ai fait un excellent voyage, je vous assure.‹ – ›Vous me l’avez déjà dit.‹ – ›Ah!‹ Fit-il. Et il se tut.« (ebd.) [»Aber meine Tante, ich habe eine ausgezeichnete Reise gemacht, das versichere ich Euch.« (ebd.)]. Dieses Schweigen wird er auf dem Hochzeitsball im Kreise männlicher Zuhörer brechen. Doch bevor wir zu der brasilianischen Geschichte kommen, hier Flauberts Portrait dieses erfolgreichen und angesehenen Zeitgenossen: »C'est un homme sensé par excellence, et je comprends dans cette catégorie tous ceux qui n’aiment point la poésie, qui ont un bon estomac et un cœur sec, qualités indispensables pour vivre jusqu’à cent ans et faire sa fortune.« [»Das ist ein vernünftiger Mann par excellence, und zu dieser Kategorie zähle ich alle, die keineswegs Gedichte lieben, die einen guten Magen und ein kaltes Herz haben, unentbehrliche Qualitäten, um hundert Jahre zu leben und sein Glück zu machen.«] Das trockene Herz äußert sich bei diesem Paul darin, dass er »profite de l’amour d’une femme comme d’un habit dont on se couvre pendant quelque temps, et puis qui le jette avec toute la friperie des vieux sentiments qui sont passés de mode.« (245), [»profitiert von der Liebe einer Frau wie von einem Rock, mit dem man sich einige Zeit bedeckt, und wirft sie dann weg mit all dem Trödelkram der alten Gefühle, die aus der Mode gekommen sind.« (97f.)]. Er heiratet nicht aus Liebe, sondern macht aus Kalkül eine gute Partie: Diese Ehe verdoppelt sein Vermögen. Dieser Mann, der eitel und vermutlich nicht zu Unrecht alle Frauen in sich verliebt glaubt, weiß, seelenlos von Eigeninteresse beherrscht, nicht, was Liebe ist.
Ist Paul der Inbegriff des realistischen Bourgeois, so ist der Affenmensch Djalioh, den Paul an Sohnes statt aufzieht, dessen Gegenstück: ein leidenschaftlicher Romantiker. Sein Einswerden mit der Natur könnte aus Chateaubriands Atala stammen. Djalioh illustriert den Schlüsselbegriff der romantischen Poetik aus Hugos »Préface de Cromwell«, das Groteske. Während Paul kühl kalkulierend ganz dem Niedrig-Egoistischen verhaftet bleibt, ist die Liebe Djaliohs grenzenlos: Sein Herz ist, der Topik des Erhabenen verpflichtet, »vaste et immense, mais vaste comme la mer, immense et vide comme sa solitude.« (249), [»weit und unermeßlich, aber weit wie das Meer, unermeßlich und leer wie seine Einsamkeit.« (105)]. Durch die Hässlichkeit seines Körpers leuchtet die Schönheit seiner Seele. Djalioh hat kein trockenes Herz, ihm ist die Gabe der Tränen im Übermaß verliehen. Er ist ganz Poesie, Leidenschaft, Seele und Einsamkeit: »La poésie avait remplacé la logique, et les passions avaient pris la place de la science.« [»Die Poesie hatte die Logik ersetzt, und die Leidenschaften hatten die Stelle des Wissens eingenommen.«] Und Flaubert fasst zusammen: »Voilà le monstre de la nature qui était en contact avec M. Paul, cet autre monstre, ou plutôt cette merveille de la civilisation et qui en portait les symboles, grandeur de l’esprit et sécheresse du cœur.« (250), [»Das war die Mißgeburt der Natur, die mit Monsieur Paul in Berührung war, jener anderen Mißgeburt, oder vielmehr jenem Wunder der Zivilisation, das alle ihre Symbole aufwies, Größe des Geistes, Kälte des Herzens.« (106 f.)].
Aber wer ist Djalioh, der, wie der Text sagt, etwas vom Affen und vom Neger hat? Dass er nicht wie Paul in die Gesellschaft derer gehört, die als rentiers von ihrem Vermögen leben, ist schnell geklärt: Er hat keine Frau, geht nicht auf die Jagd und raucht keine Zigarren. Er ist jedoch – das ist die Alternative zum rentier – auch kein Intellektueller, da er, wie M. Paul seinen Freunden erläutert, weder lesen noch schreiben kann. [3]Das Rätsel von Djaliohs Identität zu lüften, schickt Paul sich am Vorabend seiner Hochzeit im Kreise seiner Männerfreunde an, denen er seine brasilianischen Abenteuer zum Besten gibt. Die Geschichte erzählt von im Namen der Wissenschaft verübter bestialischer Grausamkeit. Paul hat sich in Brasilien, wie er selber sagt, auf eigenartige Weise amüsiert. Eine von ihm gekaufte Sklavin war ihm nicht so gefügig wie erhofft, und in seiner Eitelkeit gekränkt, beschließt er, sich an ihr aufs grausamste zu rächen. Er missbraucht sie als Versuchskaninchen zu Zuchtzwecken; sein Experiment soll die die Akademie beschäftigende Frage beantworten, ob es Kreuzungen zwischen Menschen und Affen geben kann. Die wissenschaftliche Neugier – die pseudo-objektiv das Grauenhaft-Obszöne ihrer eigenen Fragestellung bereits verdeckt – dient Paul als Deckmantel für seine Rachsucht. Da er glaubt, dass seine Sklavin sich ihm verweigert, weil sie ihn, den unwiderstehlichen Paul, für so hässlich wie einen Wilden hält, kauft er an einem Tag, an dem er sich langweilt, den schönsten Orang-Utan, den er je gesehen hat, und nennt ihn passend Bell. Sein Ziel ist eine – um es mit Shakespeare zu sagen, dem ja bereits der Titel der Geschichte »Wie es Euch gefällt« entliehen zu sein scheint – besonders grauenhafte Version der Widerspenstigen Zähmung. Als er auf die Jagd geht, schließt Paul den erstandenen Menschenaffen und die Sklavin in seinem Schlafzimmer ein. Blutig von den Krallen des Tieres und weinend findet er sie bei seiner Rückkehr; der Orang-Utan ist entflohen.
Paul, der keine Spur von Mitleid mit der vergewaltigten Sklavin zeigt, bringt durch seinen Zynismus den der Akademie ans Licht. Planmäßig wird die Sklavin schwanger. Paul hat in dieser Frage gleich noch um Mirsa, die Sklavin eines Kollegen, gewettet. Pauls Sklavin gebiert nach sieben qualvollen Monaten ihr Kind auf dem Mist und stirbt kurz darauf. Paul fasst das Ergebnis seines elenden Experiments mit dem den balzacschen Helden eigenen bravado zusammen: »Bref, j’ai gagné Mirsa, j’ai eu la croix à vingt ans, et de plus j’ai fait un enfant avec des moyens inusités.« (257) [»kurz, ich habe Mirsa gewonnen, ich habe mit zwanzig Jahren das Ehrenkreuz erhalten, und dann habe ich auf ungewöhnliche Weise ein Kind gemacht.« (120 f.)]. Die umstehenden Männer reagieren begeistert. Diese Kreuzung zwischen Affe und Mensch, Ergebnis einer tatsächlich bestialischen Vergewaltigung und eines noch bestialischeren Experiments, ist Djalioh.
Im Alter von sechzehn Jahren kehrt Djalioh mit Paul nach Europa zurück. Er verliebt sich unsterblich in die blonde Adèle, Braut und dann Frau Pauls. In diese Liebe legt Djalioh sein ganzes Sein. Adèle hingegen – wie alle Frauen bei Flaubert dem schönen Schein sinnlich verblendet verfallen – liebt Paul; sie interessiert die Schönheit der Seele hinter der grotesk-hässlichen Erscheinung Djaliohs nicht. Die einzige Möglichkeit, seine Leidenschaft auszudrücken, besteht für Djalioh im verzerrten Geigenspiel auf dem Hochzeitsball und im aus dem Takt gekommenen Rudern, als er die nach der Hochzeitsnacht sinnlich Glücklichen auf dem See spazieren fährt. Der Affenmensch bleibt vollkommen sprachlos.
Die Ehe zwischen Paul und Adèle verläuft in der Erfüllung aller Klischees aufs glücklichste – jedenfalls bis zu dem Moment, in dem die Bestialität der Zivilisation, deren Ergebnis Djalioh darstellt, bestialisch in die Zivilisation einbricht. Der Grund für diese Bestialität ist allerdings nichts Tierisches, sondern Summa abendländischer Kultur, etwas, zu dem der Paul des trockenen Herzens und des rechnenden Verstandes nicht fähig ist, eine ganz und gar romantische Leidenschaft, »le vague des passions«, zu deren Schilderung Flaubert alle Register dieses leidenschaftlichen Diskurses zieht:
»C'était un supplice infernal, une douleur de damné. Quoi! Sentir dans sa poitrine toutes les forces qu’il faut pour aimer, et avoir l’âme navrée d’un feu brûlant, et puis ne pouvoir éteindre le volcan, qui vous consume, ni briser ce lien qui vous attache! être là, attaché à un roc aride, la soif à la gorge comme Prométhée […] (260)«.
[»Das war eine Höllenqual, der Schmerz eines Verdammten. Was! In seiner Brust alle Kräfte spüren, die man braucht, um zu lieben, und die Seele von einem lodernden Feuer verbrennen lassen, und dann den Vulkan, der einen verzehrt, nicht auslöschen, noch jenes Band, das einen fesselt, zerreißen können! Da sein, gefesselt an einen kalten Felsen, mit durstiger Kehle, wie Prometheus […]« (125 f)].
Die sinnliche Eifersucht wird durch den Vergleich mit Prometheus heroisch aufgeladen.