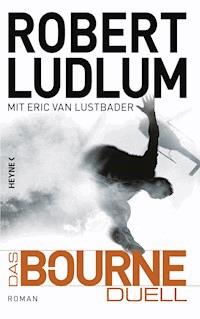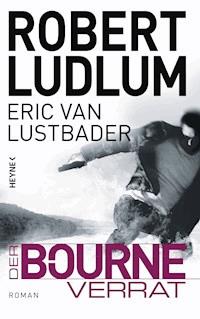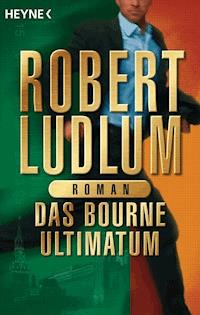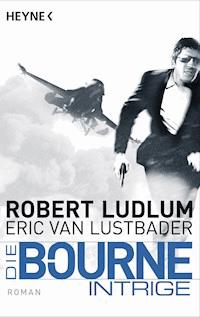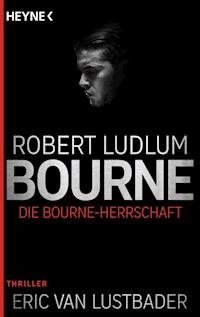10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: JASON BOURNE
- Sprache: Deutsch
Jason Bourne ist zurück - und wird als Mörder gejagt.
Sie war die große Hoffnung der amerikanischen Demokraten. Schlagfertig, klug und progressiv. Doch dann wird die junge Kongressabgeordnete Sofia Ortiz bei einem Überfall auf eine Veranstaltung in New York mit mehreren Schüssen getötet. Dringend tatverdächtigt ist ausgerechnet jener Mann, der bis vor Kurzem als Killer im Auftrag der Regierung stand. Sein Name ist Jason Bourne und er ist auf der Flucht. Einzig die Journalistin Abbey Laurent glaubt an seine Unschuld und beschließt, ihm zu helfen. Doch Bournes Feinde kennen keine Skrupel. Eine gnadenlose Verfolgungsjagd beginnt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
Er hatte keine Zeit, um seine Wunde zu versorgen. Bald würden noch mehr Männer hier sein. Er nahm die Pistole in die linke Hand und drückte die rechte an die Brust. Im Moment spürte er keine Schmerzen, doch das würde sich schnell ändern. Mit gesenktem Kopf stapfte er durch den Park, vorbei am Château Frontenac, und eilte die Stufen zur Promenade hinunter. Lichter schimmerten am anderen Ufer des Flusses. Der Wind peitschte ihm den Regen ins Gesicht. Er humpelte auf die andere Seite der Promenade und stützte sich auf das Metallgeländer. Dahinter ging es fünfzig Meter in die Tiefe. Unten in der Altstadt ragten kahle Bäume empor. Er schloss die Augen, geschwächt und benommen vom Blutverlust.
»Jason Bourne.«
Jemand zischte es ihm zu, nur wenige Meter entfernt.
Dann noch ein Wort. »Verräter.«
Die Autoren
Robert Ludlum erreichte mit seinen Romanen, die in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurden, weltweit eine Auflage von über 300 Millionen Exemplaren. Er verstarb im März 2001. Am Ende des Buches finden Sie ein ausführliches Werkverzeichnis des Autors.
Brian Freeman hat über zwanzig Romane geschrieben. Seine Bücher wurden mit dem Thriller Writers Award und dem Macavity Award ausgezeichnet sowie für zahlreiche weitere Preise nominiert.
Weitere Informationen unter heyne.de/ludlum
ROBERT LUDLUM
BRIAN FREEMAN
DIE BOURNE EVOLUTION
THRILLER
Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Norbert Jakober
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe THEBOURNEEVOLUTION erschien 2021 bei G. P. Putnam’s Sons.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstausgabe März 2023
Copyright © 2021 by Myn Pyn LLC
Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Dr. Rainer Schöttle
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock.com (Dino Osmic, Sandra_M)
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-27926-4V001
www.heyne.de
LAS-VEGAS-MASSAKER GIBT WEITER RÄTSEL AUF
9. Oktober 2019
WASHINGTON (AP)
Fast ein Jahr nach einem der schlimmsten Massenmorde der Geschichte, bei dem sechsundsechzig Menschen erschossen wurden, verkündete das FBI vergangene Woche, dass die Ermittlungen abgeschlossen seien. Doch der Bericht der Behörde, der keinerlei Angaben über das Motiv des Täters macht, lässt mehr Fragen offen, als er beantwortet.
Am 3. November 2018 eröffnete Charles Hackman das Feuer aus einem Zimmer im 14. Stock des Hotels Lucky Nickel in der Innenstadt von Las Vegas. Der Täter schoss in eine Menschenmenge von fünftausend Männern, Frauen und Kindern, die eine Oldtimer-Ausstellung besuchten. Erst nach achtzehn Minuten konnte Hackman von der Polizei gestellt und getötet werden.
Der Täter, ein vierundfünfzigjähriger Versicherungsmathematiker aus Summerlin, Nevada, hatte keine Vorstrafen und war weder durch psychische Probleme noch durch Drogenmissbrauch aufgefallen. Auch nach eingehender Überprüfung von Hackmans persönlichem Hintergrund konnten keinerlei Hinweise auf politische, ethnische oder religiöse Motive für die Tat festgestellt werden. Laut FBI deutet nichts darauf hin, dass Hackman einer extremistischen Organisation angehört hätte, was die Schlussfolgerung nahelegt, dass es sich um einen Einzeltäter handelt.
Da der FBI-Bericht keinerlei Erklärung dafür liefert, was einen völlig unscheinbaren, unbescholtenen Mann dazu bringen konnte, einen so unfassbaren Massenmord zu begehen, kursieren mittlerweile im Internet jede Menge Verschwörungstheorien. Viele werfen dem FBI vor, die wahren Hintergründe der Tat zu vertuschen. Obwohl die sozialen Medien sich inzwischen bemühen, die Verbreitung von Fake News einzudämmen, haben bereits Millionen Menschen derartige Beiträge gelesen, denen zufolge Hackman ein Dschihadist sei oder als Sündenbock für geheime Machenschaften der Regierung herhalten müsse.
Selbst die Zahl der Opfer ist mittlerweile umstritten. Während es offiziellen Angaben zufolge sechsundsechzig Tote gewesen sind, gibt es laut Hashtag #66or67 ernst zu nehmende Hinweise auf ein weiteres Opfer, dem der erste Schuss des Täters gegolten habe …
@abbeylaurent_ 9/4/20 16:12
Live-Tweet: Alles wartet auf die Kongressabgeordnete Sofia Ortiz, die im Washington Square Park in New York über die Verletzung der Privatsphäre im Internet sprechen wird. Riesenpublikum, Sprechchöre, Plakate. Straßen verstopft, Verkehr zum Stillstand gekommen.
@abbeylaurent_ 9/4/20 16:28
Wir warten immer noch auf die Abgeordnete.
@abbeylaurent_ 9/4/20 16:29
Wollt ihr mehr über Ortiz wissen? Dann lest meinen Artikel über die New Yorker Kongressabgeordnete im Online-Magazin The Fort. tinyurl.com/yxl8mpdo
@abbeylaurent_ 9/4/20 16:39
Da ist sie. Ohrenbetäubender Jubel. Ortiz kommt sofort zur Sache. »Wir sind hier, um den Big-Tech-Konzernen klarzumachen, dass unsere Daten uns gehören, nicht ihnen, und dass wir entschlossen sind, sie uns zurückzuholen!«
@abbeylaurent_ 9/4/20 16:43
Ortiz bestätigt, was mir meine Quelle schon letzte Woche anvertraut hat. Sie beschuldigt die IT-Riesen, einen groß angelegten Datenraub zu vertuschen. Woher der Angriff kam, ist unklar. Die Täter sitzen möglicherweise im Ausland. »Es betrifft fast jede Amerikanerin und jeden Amerikaner.«
@abbeylaurent_ 9/4/20 16:46
Ortiz fordert umfassende staatliche Regulierungen. »Wir brauchen eine massive Ausweitung des Datenschutzes.« Es habe sich gezeigt, dass man den Technologieriesen nicht trauen könne.
@abbeylaurent_ 9/4/20 16:47
Die Menge kommt so richtig in Fahrt. Die Leute strömen auf die Straßen, es gibt vereinzelte Zusammenstöße mit der Polizei. Ortiz ruft zu friedlichem Protest auf – MOMENT – O MEINGOTT!!!!!
@abbeylaurent_ 9/4/20 16:48
ORTIZNIEDERGESCHOSSEN!!!!! ABGEORDNETEORTIZVONSCHÜSSENGETROFFEN!!!!!
@abbeylaurent_ 9/4/20 16:50
Wenige Meter von mir entfernt liegt Ortiz auf dem Boden. Überall Blut. Panik. Die Leute stürmen auf die Bühne. WIEDERSCHÜSSE! SCHÜSSEINDERMENSCHENMENGE!
@abbeylaurent_ 9/4/20 16:52
Muss weg. Es ist die Hölle.
@abbeylaurent_ 9/4/20 17:21
Tumulte! Leute mit Schusswaffen, Messern und Flaschen bewaffnet. Ich sehe zwei Menschen auf dem Boden liegen. Acht brennende Autos. Es gibt Plünderungen, Schaufenster werden eingeschlagen.
@abbeylaurent_ 9/4/20 17:32
GEHTNICHT zum Washington Square!
@abbeylaurent_ 9/4/20 17:41
Maskierte Chaoten hinterlassen eine Spur der Gewalt. Unklar, woher die plötzlich kommen. Polizei nicht imstande, die Unruhen unter Kontrolle zu bekommen. Muss weiter.
@abbeylaurent_ 9/4/20 17:56
Polizei nimmt wahllos Leute fest, auch mich. Kann jemand für mich Kaution stellen?
@abbeylaurent_ 10/4/20 7:05
Okay, bin wieder draußen. Hab mein Handy wieder. Update: Fünf Tote nach gestrigen Unruhen, die Gegend immer noch abgesperrt. Abgeordnete Ortiz durch Schuss in den Hals getötet. FBI spricht von gezieltem Attentat.
@abbeylaurent_ 10/4/20 8:35
Laut meiner Quelle gibt es einen Tatverdächtigen. NICHT in Gewahrsam, Aufenthaltsort unbekannt, bewaffnet und gefährlich.
@abbeylaurent_ 10/4/20 8:37
Verdächtiger ist Ex-Agent einer Regierungsbehörde, der sich vermutlich einer Extremistengruppe angeschlossen hat. Noch keine Identität bekannt, nur Deckname »Cain«.
@abbeylaurent_ 10/4/20 8:38
Wer ist Cain?
ERSTER TEIL
1
Der Mann in Schwarz hob das Fernglas und beobachtete die verregnete Promenade. Die Bänke entlang der hoch gelegenen Dufferin-Terrasse, die die Unterstadt und den Sankt-Lorenz-Strom überragte, waren leer. Seine Kontaktperson war noch nicht da, doch das hatte er auch nicht erwartet. Es war erst Viertel nach neun, und er hatte das Treffen für Punkt zehn Uhr vereinbart. Die Zeit bis dahin benötigte er, um den Treffpunkt zu checken und nach einer eventuellen Falle Ausschau zu halten.
Er hatte den Wagen beim Hafen geparkt und war dann mit der Standseilbahn zur Oberstadt hochgefahren. Nun stand er wie ein Unsichtbarer in der Dunkelheit, hinter einer Steinmauer auf dem Hügel der Zitadelle. Im strömenden Regen verschwammen die nächtlichen Lichter von Québec. Der kalte Wind schüttelte die winterlich kahlen Bäume und übertönte mit seinem Heulen die Geräusche der Stadt. Vor ihm erhob sich das Hotel Château Frontenac wie ein mittelalterliches Schloss. Unter ihm glitzerte die Lichterkette der Unterstadt am dunklen Band des Flusses. An der Aussichtspromenade waren historische Kanonen aufgereiht, die auf das Wasser hinaus gerichtet waren, als wäre mit einem erneuten Angriff amerikanischer Invasoren zu rechnen.
Die Kanonen logen nicht.
Die Amerikaner waren hier irgendwo und suchten nach ihm.
Wo versteckt ihr euch?
Er wartete geduldig, ohne sich zu rühren, obwohl ihm Kälte, Regen und Wind zusetzten. Er hatte gelernt, solche äußeren Faktoren zu ignorieren. Wieder hob er das Fernglas und suchte jedes Fenster und jeden Türeingang ab, jeden dunklen Winkel, in dem sich jemand verborgen halten konnte. Selbst die erfahrensten Profis machten Fehler. Das Aufflammen eines Streichholzes beim Anzünden einer Zigarette. Die kaum merkliche Bewegung eines Vorhangs. Ein Fußabdruck im Schlamm. Als er alles gecheckt hatte, fing er wieder von vorn an. Dann noch einmal.
Allmählich begann er sich sicher zu fühlen.
Dann schrie jemand.
Er spannte sich an, doch es war ein vergnügter Schrei, voll jugendlicher Unbeschwertheit. Zwei junge Leute rannten Hand in Hand die regennasse Promenade entlang. Sie fanden Unterschlupf unter einem Vordach und küssten sich leidenschaftlich. Er zoomte ihre Gesichter heran – sie waren Mitte zwanzig und attraktiv. Die nassen Haare der Frau – pink und blond – klebten ihr im Gesicht. Sie hatte die schlanke, athletische Statur einer Läuferin und trug hautenge Leggings. Der junge Mann war etwas größer, hatte schwarze Haare und eine lange Narbe auf der Wange.
Er versuchte sie einzuschätzen.
Nur zwei harmlose Touristen?
Oder zwei Killer?
Die Wahrheit lag meistens in den Augen. Er achtete darauf, ob einer der beiden sich dadurch verriet, dass er oder sie einen heimlichen Blick auf die Umgebung riskierte, doch es war nicht das kleinste verräterische Zeichen zu erkennen. Falls die beiden ihm etwas vorspielten, machten sie ihre Sache unglaublich gut. Nach einigen Küssen gingen sie wieder in den Regen hinaus. Sie schauten einander mit einem begehrenden Lächeln an, wie Liebende es zu tun pflegten. Sie gingen nach Norden, in die Richtung des Hotels.
In diesem Augenblick sah er seine Kontaktperson auf der Promenade. Sie war früh dran. Der strömende Regen schien ihr nichts auszumachen, als sie mit einer großen Ledertasche an der Schulter die Stufen vom Governor’s Park hinunterstieg. Sie erreichte den Fußweg genau in dem Moment, als die beiden jungen Leute vorbeigingen. Zufall? Sein Misstrauen war aufs Neue geweckt. Er konnte es sich nur zu gut vorstellen: eine Pistole in der Hand des jungen Mannes mit der Narbe. Ein Schuss – keine Chance, zu entkommen –, und seine Kontaktperson sackte mit einer Kugel in der Kehle zu Boden. Er riss seine Waffe aus der Jackentasche und machte sich bereit, von der Zitadelle hinunterzusprinten, obwohl er viel zu weit weg war, um das Schlimmste zu verhindern.
Doch er irrte sich.
Die jungen Leute winkten der Frau zu. Sie lächelte zurück. Drei Leute, die einander zufällig begegneten und sich vom Regen nichts anhaben ließen. Kein Hinterhalt, keine tödlichen Schüsse. Er beobachtete, wie die jungen Leute ihren Weg zum Château Frontenac fortsetzten und seine Kontaktperson den Weg zu dem Pavillon überquerte, wo sie sich treffen wollten. Sie holte ihr Mobiltelefon aus der Handtasche, um nach der Uhrzeit zu sehen. Dann schaute sie zur Zitadelle in seine Richtung, die Hände in die Hüften gestemmt. Er wusste, dass sie ihn nicht sehen konnte, doch sie schien zu spüren, dass sie beobachtet wurde.
Er musterte sie eingehend durch sein Fernglas.
Die Journalistin Abbey Laurent war zweiunddreißig, mittelgroß und sehr schlank. Über einem weißen T-Shirt trug sie eine Jeansjacke, die bis zur Taille reichte, dazu eine waldgrüne Cargohose und schwarze, wadenhohe Stiefel. Ihre dunkelrot gefärbten Haare fielen ihr in nassen Strähnen auf die Schultern und in die Stirn. Ihr Mund war zu einem neugierigen Lächeln gekrümmt, als genieße sie die Aufregung des nächtlichen Treffens. Ihren klugen dunklen Augen schien nichts zu entgehen.
Sie drückte ein paar Tasten auf ihrem Mobiltelefon. Im nächsten Augenblick summte sein eigenes Handy. Sie hatte ihm eine Nachricht geschickt.
Ich bin hier, Mystery Man.
Er erlaubte sich ein angespanntes Lächeln. Er mochte diese Frau. Aber mögen und vertrauen waren zwei Paar Schuhe.
Er ließ sie warten, ohne auf ihre Nachricht zu antworten. Stattdessen suchte er die Umgebung ein weiteres Mal mit dem Feldstecher ab. Sie waren allein. Das junge Paar war längst verschwunden. Er konnte nicht das kleinste Anzeichen erkennen, dass die Frau beobachtet wurde – dennoch wartete er ab und ließ den vereinbarten Zeitpunkt verstreichen. Zehn Uhr. Zehn Uhr fünfzehn. Halb elf. Sie schickte weitere Nachrichten, die ihre wachsende Ungeduld ausdrückten.
Hey, wo bleiben Sie?
Wir hatten zehn Uhr gesagt.
Ich bin klatschnass, und jetzt kommen Sie nicht?
Ich warte sicher nicht ewig.
Und wirklich. Um zehn Uhr vierzig sah er, wie ihre Lippen ein lautes Schimpfwort formten. Sie stapfte aus dem Pavillon in den Regen hinaus, vorbei an den Kanonen und durch das nasse Gras des Parks beim Château Frontenac. Als sie aus seinem Blickfeld verschwand, wurde er aktiv. Er schob die Pistole in die Jackentasche und stieg zum Fuß des Zitadellenhügels hinab, wo die alten Steinhäuser von Québec einander an schmalen, hügeligen Straßen gegenüberstanden. Er lief die Rue des Grisons hinunter, blieb einen Block weiter stehen und wartete im Eingang eines kleinen Gästehauses, wo ihn niemand sehen konnte.
Am Ende der Straße sah er die rothaarige Journalistin die Kreuzung überqueren. Sie ging zielstrebig, ohne sich umzudrehen, ohne jede Sorge, dass ihr jemand folgen könnte. Er lief zur nächsten Ecke weiter und sah sie auf den gepflasterten Weg des Parc du Cavalier-du-Moulin einbiegen. In schnellem Lauf folgte er ihr. Sie war noch einen halben Block vor ihm und schien nicht zu merken, dass er allmählich zu ihr aufschloss.
So hatte er es in seiner Ausbildung gelernt: Lass den Zeitpunkt des Treffens verstreichen, damit ein eventueller Beobachter denkt, das Treffen wäre geplatzt. Dann fang die Kontaktperson in einiger Entfernung vom vereinbarten Ort ab, sodass das Treffen unter sicheren Voraussetzungen zustande kommen kann.
Das Problem war, dass die Leute, die ihn einst ausgebildet hatten, nun hinter ihm her waren.
Sie wussten genau, wie er vorging.
Als er zu dem Park rannte, in dem Abbey Laurent verschwunden war, fiel ihm auf, dass die Straßenlaterne vor ihm ausgefallen war. Sein Instinkt schlug Alarm, doch es war zu spät, um jetzt noch umzukehren. Zehn Meter vor ihm tauchte ein Mann aus dem Dunkel auf. Es war der junge Mann mit der Narbe, eine Beretta mit Schalldämpfer in der Hand.
Er hatte keine Zeit mehr, um selbst zur Waffe zu greifen. Instinktiv warf er sich zur Seite, rollte sich auf dem nassen Boden ab und stieß gegen die Ziegelwand des nächsten Gebäudes. Das gedämpfte Pop der Beretta und das peitschende Geräusch der Kugeln auf dem Asphalt verfolgten ihn, als er aufsprang, tief geduckt weiterlief und sich hinter einen blauen Kastenwagen warf, der am Weg parkte.
Das Fahrzeug bot ausreichend Deckung, während er seine Pistole zog. Regenwasser rann ihm übers Gesicht, plätscherte den Rinnstein entlang, flutete die Straße. Es war stockdunkel. Er sah und hörte nichts. Langsam kroch er hinter dem Wagen hervor. Als er die Straße erreichte, drückte er dreimal kurz nacheinander ab. Der Mann mit der Narbe war da. Eine Kugel traf seinen Waffenarm, er feuerte wild zurück. Blutend duckte sich der junge Killer hinter die andere Seite des Kastenwagens.
Ihm blieben nur wenige Sekunden. Er wusste genau, was er zu tun hatte.
Schnell weg! Zum Auto!
Québec war ein Fehler gewesen. Sein Treffen mit Abbey Laurent war eine Falle.
Er wich zurück, die Pistole auf den Kastenwagen gerichtet. Gleich hinter ihm ging es in eine Gasse, durch die er fliehen konnte. Er blinzelte sich den Regen aus den Augen. Der Wind pfiff zwischen den Häusern hindurch und hallte in seinem Kopf wider. Seine Sinne waren ganz auf den Wagen fokussiert, während er darauf wartete, dass der Narbige eine weitere Salve abfeuerte. Erst in der allerletzten Sekunde spürte er die neue Gefahr hinter sich.
Die junge Frau mit den pink-blonden Haaren sprang aus der Gasse hervor und griff mit einem langen Messer an. Er wich gerade noch rechtzeitig aus, um zu vermeiden, dass sie ihm die Kehle durchschnitt, und versetzte ihr einen Tritt in die Magengrube. Sie steckte den Treffer weg, biss die Zähne zusammen und griff aufs Neue an, das Messer auf seine Kehle gerichtet. Er hatte nur einen Sekundenbruchteil, um ihr Handgelenk zu packen und mit einem jähen Ruck herumzudrehen. Der Knochen brach, das Messer fiel zu Boden. Bevor er die Pistole heben und abdrücken konnte, schnellte die Frau hoch wie eine Feder und rammte ihm den Schädel gegen das Kinn. Sein Kopf zuckte zurück, er spürte Blut im Mund. Benommen ließ er sie los.
Dann ein mehrfaches gedämpftes Pop wie von Knallfröschen. Der Mann mit der Narbe sprang aus der Deckung und feuerte mit seinem verletzten Arm. Eine Kugel zertrümmerte ein Fenster im Haus gegenüber, eine andere prallte vom Gehsteig ab. Der Mann in Schwarz packte die junge Frau an ihrem gebrochenen Handgelenk und zog sie vor sich. Sie schrie auf vor Schmerz, verstummte aber schnell, als die nächste Kugel, die auf seine Brust gezielt war, in den Hinterkopf der Frau einschlug.
Der Mann, der sie noch vor wenigen Minuten geküsst hatte, hatte sie erschossen.
Er hielt die Frau als totes Gewicht vor sich, riss seine Waffe hoch und gab einen präzisen Schuss ab, der den Narbigen unter dem Kinn traf. Ein tödlicher Schuss mitten durch die Kehle.
Wie bei Sofia Ortiz.
Einen Moment lang stand er wie erstarrt da, scharfer Rauch stieg ihm in die Nase. Die tote Frau baumelte an seinem Arm wie eine Puppe, und er legte sie auf die nasse Straße. Ihre aufgerissenen Augen starrten ihn an. Eine kleine Blutlache bildete sich um ihren Kopf, doch der Regen spülte sie in die Bäche, die am Bordstein entlangliefen.
Schnell weg! Zum Auto!
Die Falle schnappte zu.
Am östlichen Ende der Straße sah er die Lichter entlang der Promenade schimmern. Er lief darauf zu, dicht an den Häuserwänden entlang. An der nächsten Ecke checkte er die Querstraße und die Bäume, die wie Soldaten im Governor’s Park standen. Er war nicht allein, das spürte er. Doch er konnte nicht sehen, wo die Bedrohung lauerte. Er atmete ein paarmal tief durch, dann sprang er aus der Deckung, sprintete über die Straße und warf sich ins schlammige Gras des Parks.
Aus zwei Richtungen pfiffen Kugeln über ihn hinweg. Der erste Schütze war auf den Stufen eines Gästehauses postiert, der zweite im dunklen Tunnel der Parkgarage unter dem Château Frontenac. Er sprang auf und rannte im Zickzack weiter, als die nächste Salve auf ihn einprasselte. Einen kurzen Moment blieb er stehen, fuhr herum und gab vier Schüsse in den dunklen Tunnel ab. Der Schütze in der Parkgarage sackte zu Boden, doch der Mann auf der Hoteltreppe feuerte weiter. Dann passierte es. Er spürte einen scharfen Stich in der Brust. Mit zusammengebissenen Zähnen schleppte er sich hinter eine Esche, riss sein Hemd auf und sah den blutigen Ring der Einschusswunde.
Der Attentäter auf der Treppe feuerte weiter. Der Mann in Schwarz wartete, bis der Schütze sein Magazin verfeuert hatte, dann sprang er aus der Deckung und drückte ab. Sechsmal.
Der Schütze rollte von der Treppe auf die Straße hinunter.
Er hatte keine Zeit, um seine Wunde zu versorgen. Bald würden noch mehr Männer hier sein. Er nahm die Pistole in die linke Hand und drückte die rechte an die Brust. Im Moment spürte er keine Schmerzen, doch das würde sich schnell ändern. Mit gesenktem Kopf stapfte er durch den Park, vorbei am Château Frontenac, und eilte die Stufen zur Promenade hinunter. Lichter schimmerten am anderen Ufer des Flusses. Der Wind peitschte ihm den Regen ins Gesicht. Er humpelte auf die andere Seite der Promenade und stützte sich auf das Metallgeländer. Dahinter ging es fünfzig Meter in die Tiefe. Unten in der Altstadt ragten kahle Bäume empor. Er schloss die Augen, geschwächt und benommen vom Blutverlust.
»Jason Bourne.«
Jemand zischte es ihm zu, nur wenige Meter entfernt.
Dann noch ein Wort. »Verräter.«
Er riss die Augen auf. Ein jäher Schmerz durchfuhr ihn, als er die Pistole hob. Er war nicht allein. Er hatte jemanden übersehen, der im Dunkeln lauerte. Beim Pavillon stand ein Mann mit grauem Trenchcoat und Fedora-Hut und richtete im strömenden Regen seine Pistole auf ihn. Er war fünfzehn Jahre älter als Bourne, kleiner, aber wettergegerbt und zäh. Bourne kannte Nash Rollins gut. In einem anderen Leben hätte er ihn als Freund bezeichnet – jetzt nicht mehr.
Nicht nach dem, was in Las Vegas passiert war.
Und nun war dieser Mann hier, um ihn zu töten. Oder getötet zu werden. Eine andere Option gab es nicht.
Bourne hatte mitgezählt. Er hatte nur noch eine Kugel im Magazin, doch das genügte, um einen alten Freund zu töten. Um den Abzug zu drücken und ihn sterben zu sehen. Sein Gehirn wog die Optionen ab, um zu einer Strategie zu gelangen. Sein Herz rang mit der Frage, ob er diesen Mann wirklich töten konnte.
Rollins war persönlich gekommen, um dabei zu sein, wenn Bourne eliminiert wurde. Das war ein Fehler. Er war seit Jahren nicht mehr im Feldeinsatz gewesen. Bei einem Showdown ging es um Konzentration. Man durfte sich durch absolut nichts ablenken lassen, doch das war schwierig, wenn die alten Fähigkeiten eingerostet waren. Während einer den anderen anstarrte, um ihn zu verunsichern, wartete Bourne darauf, dass der ältere Mann ihm eine winzige Chance bot. Er wusste, dass er sie bekommen würde. Ein Windstoß traf den Mann mit voller Wucht, und er zuckte zusammen. Das Nachlassen der Aufmerksamkeit währte nur einen Sekundenbruchteil, doch das war genug.
Bourne drückte ab. Die Kugel bohrte sich in Rollins’ Oberschenkel. Sein alter Freund sackte zu Boden, schrie auf vor Schmerz, doch in spätestens zwei Sekunden würde dem Mann bewusst werden, dass er noch lebte. Er würde sich nicht lange fragen, warum er verschont worden war, sondern einfach zurückfeuern.
Bourne sah keine Fluchtmöglichkeit, warf die leere Pistole weg, packte das Geländer mit beiden Händen und sprang in den Abgrund. Der Schmerz der Schussverletzung durchzuckte seinen Oberkörper. Die Schwerkraft griff nach ihm, doch eine Mikrosekunde lang verharrte er in der Luft wie eine Tontaube. Sein alter Freund drehte sich auf dem Boden zu ihm, riss unter Schmerzen die Waffe hoch und drückte ab. Einmal.
Die Kugel zog eine blutige Spur über seinen Schädel.
Jason Bourne fiel in die Dunkelheit. Ein Meteor im kalten Universum, ein winziges Stück Materie in der Weite des Raumes. Der Boden tief unter ihm war wie ein fremder, unerforschter Planet, der mit Lichtgeschwindigkeit auf ihn zuzurasen schien. Im Moment des Aufpralls wurde es dunkel um ihn herum.
Die kanadischen Sanitäter wollten Nash Rollins ins Krankenhaus bringen, doch er weigerte sich entschieden. Er würde nirgendwohin gehen, sagte er, solange man den Mann nicht gefunden habe, der vor seinen Augen in die Tiefe gesprungen war. Er stützte sich auf den Stock, den ein Sanitäter ihm gegeben hatte, und biss sich auf die Zunge, um sich von den Schmerzen abzulenken, die sein Bein durchpulsten.
In der Ferne tanzten die Lichter des Suchtrupps in den Straßen der Unterstadt. Sie suchten den verwundeten amerikanischen Killer. Rollins wusste, dass er ihn noch getroffen hatte, bevor er abgestürzt war. Er hatte Blut spritzen sehen. Es erschien ihm unvorstellbar, dass der Mann die Schussverletzung und den Sturz überlebt haben könnte, doch bislang war noch keine Leiche gefunden worden, nur eine Blutspur, die an der Rue du Petit-Champlain abrupt endete. Der Mann war ganz einfach verschwunden.
Bourne war ein Phantom. Ein Meister des Überlebens.
Doch Rollins war nicht überrascht. Er wusste genau, was Bourne in seiner Ausbildung gelernt hatte.
Rollins verspürte keine Reue. Er war mit seinem Team angerückt, um eine Mission zu erfüllen. Doch sie war noch nicht beendet. Seine frühere Beziehung zu dem Mann war nicht von Bedeutung. Dass Bourne sein Leben verschont und auf sein Bein gezielt hatte, spielte ebenfalls keine Rolle. Was zählte, war allein, ihn zu stoppen!
Er zog sein Mobiltelefon hervor und wählte die Nummer. Am anderen Ende meldete sich eine Frau mit einem einzigen Wort.
»Treadstone.«
»Gehen Sie auf eine sichere Verbindung«, forderte Rollins sie auf.
»Verbindung ist sicher«, meldete sie nach einem kurzen Moment. »Wie ist die Lage in Québec? Hat sich Ihr Verdacht bestätigt? Ist es Cain?«
»Ja, er ist es. Wie ich Ihnen gesagt habe.«
»Haben Sie ihn neutralisiert?«
»Nein, er ist auf der Flucht.«
»Das ist schlecht«, sagte die Frau eiskalt. »Sie haben felsenfest versprochen, mit dem Problem fertigzuwerden. Direktor Shaw ist sehr besorgt. Falls Bourne hinter dem Attentat in New York steckt, ist der Neustart von Treadstone gefährdet.«
Rollins verzog das Gesicht, als der Schmerz im verletzten Bein wieder aufflammte. Er würde nicht mehr lange durchhalten, doch das war ihm egal. »Keine Sorge. Sagen Sie Shaw, ich werde Bourne finden. Er ist verwundet und kann nicht weit kommen. Ich werde ihn finden und höchstpersönlich eliminieren.«
2
Um ein Uhr nachts war der Pub in der Rue Saint-Angèle immer noch gerammelt voll. Abbey Laurent saß im Halbdunkel an der Bar unter den grob gezimmerten Balken der niedrigen Decke. Ihre Kleidung und die mahagonifarbenen Haare waren immer noch nass, sie zitterte vor Kälte. Ihre Finger flogen über die Tasten ihres Laptops, von den Rhythmen des Jazzquartetts beflügelt, das wenige Meter entfernt spielte. Sie hatte Jacques, ihrem Chefredakteur, dreitausend Wörter für die nächste Online-Ausgabe von The Fort versprochen. Der Artikel sollte morgen früh erscheinen, doch sie hatte bis zuletzt damit gewartet in der Hoffnung, der geheimnisvolle Unbekannte würde ihr eine Geschichte liefern.
Doch er hatte sie im Regen stehen lassen. Wortwörtlich, dachte sie, während sie sich eine feuchte Strähne aus dem Gesicht strich.
Alle paar Sätze trank sie einen Schluck Bier aus der Flasche, die sie vor sich auf dem Tresen stehen hatte. Es fiel ihr schwer, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Das Problem war nicht der Lärm oder die vielen Leute – das hatte sie immer als anregend empfunden. Sie konnte selbst beim Finale der Fußballweltmeisterschaft im Publikum sitzen und eine Geschichte in die Tasten klopfen. Nein, ihr ging der Mann nicht aus dem Kopf, der sie versetzt hatte.
Wer war er? Wo war er?
Warum hatte er sich die Mühe gemacht, über mehrere geheime Kontakte ein Treffen mit ihr zu vereinbaren, wenn er dann nicht kam?
Abbey holte ihr Mobiltelefon heraus und tat, was sie schon ein halbes Dutzend Mal getan hatte, seit sie hier im Pub war. Sie scrollte zu seiner ersten Kontaktaufnahme vor einer Woche zurück. Drei Tage nachdem Sofia Ortiz in New York ermordet worden war. Eine SMS von einer unterdrückten Nummer.
Wir müssen uns treffen. Ich kann Ihnen helfen, die Antworten zu finden, die Sie suchen.
Als Journalistin bekam sie oft solche Anrufe und Nachrichten. Meistens handelte es sich um unbrauchbaren Quatsch von durchgeknallten Verschwörungsfanatikern oder um Männer, die die Frau auf dem Foto kennenlernen wollten, das ihre Artikel begleitete. In diesem Fall war es anders. Der Mann wusste etwas. Er hatte ihr Details geliefert, die nie an die Öffentlichkeit gelangt waren. Sie hatte alles überprüft und festgestellt, dass es zutraf.
Ihr journalistisches Radar hatte angeschlagen.
Jacques hatte ihr von dem Treffen abgeraten, hatte es für zu gefährlich gehalten. Er neigte von Natur aus zur Vorsicht – und das umso mehr nach der Ermordung der Abgeordneten Ortiz und den Unruhen auf dem Washington Square. Doch Abbey hatte sich noch nie davon abhalten lassen, einer heißen Spur nachzugehen, auch wenn sie dafür ein Risiko eingehen musste.
Okay, hatte sie dem Unbekannten geantwortet. Soll ich kommen, oder kommen Sie zu mir?
Sie hatten sich auf ihre Stadt geeinigt. In drei Tagen in Québec.
Sie kannte weder seinen Namen, noch wusste sie, wie er aussah. Er war absolut darauf bedacht, seine Anonymität zu wahren; seine Vorsicht grenzte an Paranoia. Er hatte ihr ausführliche Instruktionen gegeben, um sicherzustellen, dass ihr niemand folgte. Außerdem hatte er ihr zwei Codesätze genannt, an denen sie einander erkennen würden, als wären sie zwei Spione aus der Zeit des Kalten Krieges.
Sie sollte sagen: Wasmögen Sie am meisten in Québec?
Er würde antworten: Diese wunderbaren kleinen Ahornbonbons.
Trotz der aufwendigen Vorbereitung war er dann nicht erschienen. Das ergab keinen Sinn. Erneut checkte sie ihre Nachrichten in der Hoffnung, dass er sein Fernbleiben begründete, doch da waren nur diejenigen, die sie ihm vom Treffpunkt aus gesandt hatte.
Abbey seufzte frustriert, als sie einsah, dass sie heute Nacht nichts Brauchbares mehr zustande bringen würde. Jacques würde etwas länger auf ihren Beitrag warten müssen. Sie fuhr den Laptop herunter und setzte sich mit dem Rücken zur Theke, um ihr Bier auszutrinken und noch eine Weile der Band zuzuhören. Die Jungs auf der Bühne winkten ihr zu. Es war ihre Stammkneipe, hier war sie zu Hause. Ihr Büro in The Fort war vier Blocks entfernt, ihr Apartment sechs Blocks. Sie war ständig auf Achse, aber wenn sie zu Hause war, schrieb sie ihre Artikel meistens in dieser Kneipe. Als Journalistin verdiente sie nicht viel, doch der Barkeeper »vergaß« immer mal wieder, einen Drink auf ihre Rechnung zu setzen. Sie revanchierte sich, indem sie das Lokal in der Online-Zeitschrift lobend erwähnte, sooft sich eine Gelegenheit bot.
Die Tür wurde geöffnet, kalte Luft strömte herein. Ein paar Leute gingen, neue Gäste kamen. Abbey musterte die Gesichter der Neuankömmlinge. Normalerweise fühlte sie sich in ihrem Pub immer wohl, aber heute hatte sie ein seltsames Gefühl. Als würde jemand sie beobachten. Genauso wie zuvor bei dem geplatzten Treffen auf der Promenade. Es fühlte sich anders an als das übliche Interesse irgendwelcher Typen, die ein Auge auf sie warfen. Niemand in der Kneipe kam ihr verdächtig vor, doch ihr Instinkt sagte etwas anderes.
Wahrscheinlich wurde sie langsam paranoid. Wie der geheimnisvolle Unbekannte.
Wo bist du?
Auch die sanften Jazz-Rhythmen vermochten ihre Nerven nicht zu beruhigen. Die Bassistin war eine attraktive Spanierin namens Emilia, die über magische Finger verfügte. An den meisten Abenden genoss Abbey es immens, ihr zuzuhören. Doch als sie nun ihr Gesicht betrachtete, sah sie nicht Emilia, sondern Sofia Ortiz auf dem Washington Square. Immer wieder kam die Erinnerung an den schrecklichen Moment in ihr hoch, als der Hals der Frau in einem Blutschwall explodierte und sie auf der Bühne zusammensackte. Dann die Schreie und die Panik in der Menschenmenge. Ein Attentäter hatte vor ihren Augen eine Kongressabgeordnete ermordet.
Ihre Quelle hatte ihr verraten, dass der Killer ein ehemaliger US-Geheimagent mit dem Decknamen Cain war.
Wer war dieser Cain?
Sie hatte Jacques nicht die ganze Wahrheit über jenen furchtbaren Abend erzählt. Nach dem Attentat hatte sie Blutspritzer auf dem Hemd gehabt – so nahe war sie der ermordeten Politikerin gewesen. Danach waren weitere Schüsse gefallen, die Situation war völlig eskaliert. Ein vermummter Chaot hatte seine Pistole auf sie gerichtet – und sie hatte nur überlebt, weil in dem Moment jemand gegen sie gestoßen war und sie zu Boden gerissen hatte. Als sie aufstand, war der Bewaffnete verschwunden, doch sie erinnerte sich noch gut an seine schwarze Kapuze und die Pistole, mit der er auf ihren Kopf gezielt hatte.
Mit zitternder Hand trank Abbey ihr Bier aus. Dann stand sie von ihrem Hocker auf, doch in diesem Moment schnappte sie aus dem Stimmengewirr zwei Worte auf, die sie elektrisierten.
»Château Frontenac.«
Dann noch zwei Worte: »Tot. Erschossen.«
Abbey versuchte den Sprecher in der Menge auszumachen. Wer war das? Sie nahm ihren Computer und schob ihn in die Laptop-Tasche. Als sie sich durch die Menge schlängelte, spitzte sie die Ohren, um den Gesprächen zu lauschen. Einige unterhielten sich über Sport, andere über Drogen, Drinks und Sex, aber niemand über das Luxushotel, in dessen Nähe sie auf den Unbekannten gewartet hatte. Nichts von einem Mord. Und doch wusste sie, dass sie sich nicht verhört hatte, dass irgendetwas passiert sein musste.
Und dass es mit ihr zu tun hatte.
»Polizei überall.«
Da! Zwei stämmige junge Männer, einer schwarz, einer weiß, beide in Nordiques-Eishockeytrikots, saßen an einem Ecktisch hinter der Band. Ihre Stimmen waren trotz des Geräuschpegels in der Kneipe deutlich zu hören. Abbey kämpfte sich zu ihnen durch und beugte sich über ihren Tisch. Eine Wandleuchte warf Schatten auf ihre Gesichter.
»Entschuldigen Sie.«
Die zwei Männer verstummten und musterten sie einen Moment lang. Was sie sahen, schien ihnen zu gefallen. »Was gibt’s, Schätzchen?«, fragte einer.
»Ich habe zufällig Ihr Gespräch aufgeschnappt. Haben Sie vom Château Frontenac gesprochen?«
»Ja«, antwortete der weiße Nordiques-Eishockeyfan. »Ich war vorhin dort. Die haben das ganze Viertel abgeriegelt.«
»Was ist passiert?«
»Keine Ahnung. Angeblich gab es Tote auf der Straße. Eine Schießerei, glaube ich. Hey, setz dich doch zu uns, dann können wir …«
Doch Abbey war bereits auf halbem Weg zur Tür.
Sie musste sofort zurück zum Château Frontenac und herausfinden, was dort vor sich ging.
Als sie in die Kälte hinaustrat, fing sie in ihren nassen Sachen erneut zu zittern an. Es hatte aufgehört zu regnen, doch der Gehsteig war noch nass. In der Dunkelheit stapfte sie die steil ansteigende Rue Sainte-Angèle hinauf. Von der anderen Straßenseite kam ein Mann auf sie zu, als hätte er auf sie gewartet.
»Mademoiselle Laurent?«
Sie schaute sich nervös um. Ihr war bewusst, dass sie beide allein auf der leeren Straße waren. Ihre Hand ging zu ihrer Tasche, für den Fall, dass sie den Taser herausholen musste, den sie immer bei sich trug. Ihre Reportagen führten sie manchmal in unangenehme Gegenden, und sie hatte gelernt, auf alles gefasst zu sein.
Mit einem angedeuteten Lächeln wiederholte der Mann seine Frage. »Sie sind doch Abbey Laurent, nicht? Die Reporterin?«
»Worum geht es? Wer sind Sie?«
»Wir wollten uns treffen. Ich muss mich entschuldigen, dass ich mich verspätet habe.«
»Sie?« Damit hatte sie nicht gerechnet. »Sie sind der geheimnisvolle Unbekannte?«
»Richtig.«
»Wo zum Teufel haben Sie gesteckt?«
»Es tut mir leid. Ich wurde aufgehalten. Es ließ sich nicht vermeiden.«
Abbey entspannte sich ein wenig, musterte ihn einen Moment lang und war fast ein wenig enttäuscht. Er entsprach nicht unbedingt dem, was sie erwartet hatte. Er war groß und kräftig gebaut, hatte schütteres blondes Haar und eine goldgeränderte Brille. Über einem teuren beigefarbenen Anzug trug er einen braunen Mantel. Er sah aus wie ein Buchhalter in mittleren Jahren, nicht wie ein Spion, als den sie sich ihren Unbekannten vorgestellt hatte.
»Ich bin froh, dass ich Sie noch gefunden habe«, fügte er mit übertriebener Höflichkeit hinzu. »Nach all der Mühe, die ich mir gemacht habe, um Sie zu treffen.«
»Wie haben Sie mich gefunden?«
»Jeder hinterlässt einen Online-Fußabdruck, Ms. Laurent. Wir wissen eine Menge über Sie. Wir verfolgen Ihre Berichte schon länger.«
»Wir?«
»Ich gehöre einer einflussreichen Gruppe an. Sie sagten, Sie wollen eine Geschichte, richtig? Aufgrund meiner Position habe ich Zugang zu brisanten Informationen.« Wieder lächelte er unverbindlich und deutete zum Ende der Straße. »Wollen wir ein Stück gehen und plaudern?«
»Okay.«
Nebeneinander näherten sie sich der Kreuzung, wo die Rue Sainte-Angèle mit der Rue Saint-Jean zusammentraf. Sie gingen mitten auf der gepflasterten Straße, vorbei an schicken Geschäften und Restaurants, die alle längst geschlossen hatten. Es gab keinen Verkehr und keine Fußgänger mehr. Der Unbekannte hatte die Hände in den Manteltaschen vergraben. Abbey stellte fest, dass er sie nie direkt ansah. Seine Augen waren ständig in Bewegung, als würden sie jeden dunklen Winkel prüfen.
»Suchen Sie jemanden?«, fragte sie.
»Ich bin einfach nur vorsichtig.«
»Befürchten Sie Ärger?«
»Damit muss man immer rechnen.«
»Ich habe gehört, dass es beim Château Frontenac zu einer Schießerei gekommen ist«, sagte sie. »Angeblich wurden Leute getötet.«
»Ja.«
»Sind Sie deswegen nicht gekommen?«
»Ja.«
»Wäre es gefährlich gewesen, wenn wir uns dort getroffen hätten?«
»Da waren tatsächlich gefährliche Leute beim Hotel«, sagte der Mann, »aber die hatten es auf mich abgesehen, nicht auf Sie. Sie hatten bloß gehofft, dass Sie sie zu mir führen würden.«
»Haben Sie die Leute umgebracht?«
Diesmal antwortete er nicht, sondern schaute sie an. Sie sah seine eisblauen Augen hinter der Goldrandbrille. »Halten Sie mich etwa für einen Killer?«
»Ich weiß nicht, wer oder was Sie sind. Ich weiß ja nicht einmal, wie Sie heißen.«
»Namen sind nicht wichtig.«
»Aber Sie kennen meinen Namen«, hielt Abbey dagegen.
»Das stimmt, Ms. Laurent.«
Sie kamen zu der alten Steinmauer beim Artilleriepark, die zu der vor dreihundert Jahren errichteten Festung gehörte, als Briten und Franzosen um die Vorherrschaft in der Region gekämpft hatten. Ohne zu fragen, stieg der Mann die Treppe zum Park hinunter und blieb bei dem grasbewachsenen Hügel unterhalb der Mauer stehen. Sie folgte ihm. Er zündete sich eine Zigarette an und blies den Rauch in die Luft. Dann schaute er sie mit einem Lächeln an, das ihr irgendwie nicht ganz geheuer war. Die Stelle, an der sie jetzt standen, war von den umliegenden Gebäuden aus nicht einsehbar. In ihrem Kopf schrillte eine Alarmglocke.
»Was hat das mit der Ermordung der Abgeordneten Ortiz zu tun?«, fragte sie ungeduldig. »Sie haben mir ein paar Antworten versprochen. Okay, ich will wissen, warum sie umgebracht wurde. Und wer sie umgebracht hat.«
Er hielt seine Zigarette zwischen zwei Fingern. »Das war ein furchtbarer Tag.«
»Das kann man wohl sagen.«
»Sie waren in der Nähe der Abgeordneten, als sie erschossen wurde, nicht wahr?«
»Das ist richtig. Wissen Sie, wer es getan hat?«
»Die amerikanischen Behörden glauben, dass es Cain war«, sagte er.
»Wer ist Cain?«, hakte Abbey nach. Dann kam ihr ein beängstigender Gedanke. »Sind Sie Cain? Haben Sie Sofia Ortiz ermordet?«
Die Frage schien ihn zu amüsieren. »Ich? Nein. In dieser Liga spiele ich nicht mit. Cain ist ein Phantom. Eine Legende. Ich bin bloß aus Fleisch und Blut.«
Sie spürte, dass er mit ihr spielte. Wie die Katze mit der Maus, bevor sie ihre Krallen ausfuhr. Das Treffen fühlte sich irgendwie nicht richtig an. Wie er sie ansah und mit ihr redete, wie er sich benahm – es entsprach gar nicht dem Mann, der mit ihr Kontakt aufgenommen hatte.
Dann fiel ihr etwas ein.
Sie hatte bei der überraschenden Begegnung gar nicht mehr an die Codesätze gedacht, die der Unbekannte vorgeschlagen hatte. Dieser Mann hatte sich weder vergewissert, dass sie Abbey Laurent war, noch hatte er ihr bestätigt, dass er der war, als der er sich ausgab.
Abbey zwang sich zu einem Lächeln. »Was mögen Sie am meisten in Québec?«
Er runzelte die Stirn und schaute sie verständnislos an. »Wie bitte?«
»Wir fragen das die Touristen gern. Wir Kanadier sind höfliche Leute, wissen Sie. Was mögen Sie am meisten in Québec? Ich weiß, es gibt so viel hier … trotzdem.«
Sie wollte die vereinbarten Worte von ihm hören. Diese wunderbaren kleinen Ahornbonbons. Sie hielt den Atem an und wartete.
Sag es!
Der Mann warf die Zigarette auf den Boden und trat sie mit dem Schuh aus. Er nahm seine Goldrandbrille ab und wischte sie sorgfältig mit einem Taschentuch ab, das er aus der Anzugtasche genommen hatte. Dann setzte er die Brille auf, und seine Hände verschwanden wieder in den Manteltaschen. »Ich glaube, die Unterstadt«, sagte er. »Die ist wirklich malerisch.«
Sie versuchte, ruhig zu bleiben und sich nicht zu verraten. Lächle, sagte sie sich und bemühte sich, die Angst nicht zu zeigen, die in ihr hochkam. Er ist es nicht. Das ist nicht mein Unbekannter. Das ist irgendein Fremder – nein, nicht bloß ein Fremder. Ein Killer.
Er war hier, um sie umzubringen.
»Jetzt brauch ich auch eine Zigarette«, sagte Abbey und griff in ihre Tasche.
Doch er ließ sich nicht täuschen.
Ihre Hand suchte nach dem Kunststoffgriff des Tasers. Als sie ihn herauszog, nahm der Mann mit der Goldrandbrille ebenfalls die Hand aus der Manteltasche. Er hielt eine schwarze Pistole mit langem Lauf in der Hand und fixierte sie mit dem scharfen Blick eines Falken. Abbey kniff die Augen zu und drückte den Abzug. Die Drähte mit den nadelförmigen Projektilen schossen aus dem Taser und jagten dem Mann fünfzigtausend Volt durch den Körper. Sein Arm zuckte, er drückte ab, schoss in die Luft. Abbey schrie auf und verpasste ihm noch einen Elektroschock. Der Mann sackte zu Boden, zuckte und wand sich, die Pistole glitt ihm aus der Hand.
Abbey warf den Taser weg.
Ohne sich noch einmal umzudrehen, rannte sie aus dem Park, vorbei an dunklen Winkeln, und tauchte in den verlassenen alten Straßen der Stadt unter.
3
Jason wusste nicht, ob er sich erinnerte oder träumte.
Bruchstückhafte Szenen eines Lebens wurden in seinem Kopf abgespult wie ein Film in einem alten Projektor. Er sah Kinder in einer Reihe stehen, ein Dutzend Jungen in grauen Uniformen, die von einem strengen alten Mann gescholten wurden. Er sah einen Grabstein aus blauem Marmor mit zwei nebelhaft verschwommenen Namen darauf. Er konnte nur die Todesjahre lesen: 2001. Er hörte das Donnern von Explosionen und hielt sich die Ohren zu. Schüsse. Wörter kamen aus seinem Mund in Sprachen, die er nicht verstand. Er sah Orte, die ihm unbekannt waren, obwohl er wusste, dass er überall schon gewesen war. Städte in allen Erdteilen. Straßen und Denkmäler in der Nacht. Kirchen, nicht, um darin zu beten, sondern weil er dort ein geheimes Treffen hatte. Boote auf dem Wasser, Grenzen, Checkpoints. Mauern, über die er klettern, Gebäude, in die er eindringen musste.
Die verschwommenen Bilder wirbelten in seinem Kopf umher. Mittendrin sah er ein Gesicht. Eine Frau. Immer wieder erschien sie ihm, unterbrach den Film und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Bleib bei mir, Liebling, halt durch. Sie hatte lange schwarze Haare, eine leicht gekrümmte Nase, dunkle, leidenschaftliche Augen, ein neckisches Lachen, olivbraune Haut. Er spürte ihren Körper an seinem, ihre vollen Lippen, ihre weiche Haut.
Sie lag in seinen Armen, und sie waren glücklich.
Dann war sie in den Armen eines anderen – er trug sie fort. Ihre Augen waren geschlossen, ihr Gesicht leblos, ihr Blut auf dem Boden. Er hörte sich selbst schreien.
Nein!
Er schlug die Augen auf, tauchte aus der Bewusstlosigkeit auf. Er war wach, aber völlig benommen. Die Bilder in seinem Kopf flüchteten wie lichtscheue Küchenschaben und ließen nur Leere zurück.
Bourne lag in einem Doppelbett. Das Laken unter ihm war feucht von seinem Schweiß. Die Decke musste er irgendwann in der Nacht abgeschüttelt haben. Er lag nackt und unbedeckt auf dem Rücken. Das Zimmer war klein und dunkel, doch die Lichtstreifen an den Rändern der Jalousien ließen ihn seine Umgebung erkunden. Es gab eine Tür nach draußen, ein kleines Bad, nicht viel größer als eine Telefonzelle, einen leeren Wandschrank. Zwei mit Wasserfarben gemalte Bilder hingen an der rissigen Tapete. Sie zeigten Segelboote auf dem Wasser. Eine Lampe stand auf einem Schreibtisch beim Fenster.
Er fühlte sich desorientiert, wie in einem bizarren Traum gefangen.
Er versuchte aufzustehen, doch der Schmerz, der ihn wie ein brennender Pfeil durchzuckte, ließ ihn schwer atmend zurücksinken. Sein Kopf hämmerte, vor seinen Augen drehte sich alles, und er wartete, bis er wieder klarer sah. Als er auf seinen Oberkörper hinunterschaute, sah er den weißen Verband unterhalb der linken Schulter, mit einem großen roten Fleck, wo die Gaze von Blut durchtränkt war.
Er musste nachdenken, sich erinnern, drückte beide Fäuste an den Kopf, ignorierte die Schmerzen. Sein Atem donnerte in der Brust, Schweiß brach aus allen Poren.
Doch diesmal war es Angstschweiß.
Jason versuchte erneut, aufzustehen, biss die Zähne gegen den Schmerz zusammen. Als er die Beine aus dem Bett schwang, gelang es ihm, sich in die Sitzposition aufzurichten, mit beiden Füßen auf dem Hartholzboden. Er wartete, bis der nächste Schwindelanfall verging. Die Schmerzen gingen nicht nur von der Brust aus, sondern auch vom Kopf. Er hob die Hand zum Schädel, doch schon bei der flüchtigsten Berührung durchfuhr es ihn wie ein Blitzschlag. Er fühlte auch hier einen Verband.
Seine Sinne lieferten ihm Informationen, die sein Gehirn zu verarbeiten versuchte. Draußen hörte er Vögel zwitschern. Durch den Türrahmen pfiff kalte Luft herein. Er nahm den feuchten Geruch seines Körpers wahr, doch da war auch ein salziger Duft, wie am Meer. Er stand auf, stützte sich mit einer Hand an der Wand ab, dann ging er zum Fenster und drückte die Lamellen der Jalousien auseinander. Er befand sich in einem Urlaubscottage und schaute auf eine hölzerne Veranda hinaus. Nur wenige Schritte entfernt traf das blassblaue Wasser einer kleinen Bucht auf den steinigen Strand. Am anderen Ende der Bucht ragte eine dicht bewaldete Landzunge ins Wasser. Es herrschte Ebbe, die Möwen pickten im schlammigen Boden. Die Bucht öffnete sich in eine weite, offene Wasserfläche, wo keine Küste mehr zu sehen war.
Er kannte diesen Ort. Das Delta des Sankt-Lorenz-Stroms.
Jetzt erinnerte er sich wieder. Er war in einem Strandgasthaus in Saint-Jean-sur-Mer, zwei Stunden nordöstlich der Stadt Québec. Les chalets sur la rivière. Hier hatte er sich an Bord von Schiffen geschlichen, um Schmugglerringe zu zerschlagen. Der Kampf gegen Drogen- und Menschenhandel. Doch es gab noch mehr Erinnerungen an dieses Zimmer, so viel mehr. Hier war er mit Nova gewesen. Auf diesem Bett hatten sie sich geliebt, hatten die Zeit und alles um sich herum vergessen.
Ja, er wusste, wo er war.
Langsam kehrten auch die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit zurück, träge zunächst, als müssten sie sich aus dem Treibsand befreien. Der Hinterhalt, in den er geraten war. Der Schusswechsel. Die Konfrontation mit Nash Rollins.
Und davor New York. Das Attentat. Die Unruhen auf den Straßen.
Sie waren für Bourne nichts Ungewöhnliches, diese lähmenden Momente des Vergessens. Er hatte gelernt, damit zu leben. Er war ein Mensch mit bruchstückhafter Vergangenheit, ein Mann ohne Identität. Vor Jahren schon hatte er sein Gedächtnis verloren, nachdem er von einer Kugel in den Kopf getroffen worden war. Die Verletzung hatte ihm seine Vergangenheit geraubt. Geblieben waren ihm nur Bruchstücke dessen, was er einmal gewesen war, und ein Name aus einem anderen Leben, mit dem ihn nichts verband. Dieses Leben gehörte zu einem Fremden. Mit Anfang dreißig hatte er ganz neu anfangen müssen. Hatte neue Erinnerungen erwerben müssen. Auch heute noch passierte es ihm immer wieder, dass er wie in dichtem Nebel aufwachte und nicht wusste, wer er war. Dann packte ihn die Angst, dass er erneut alles verloren hatte.
Langsam taumelte er zum Badezimmer und zog an der Strippe, um die Glühbirne an der Decke einzuschalten. In dem matten gelben Licht stützte er sich mit beiden Händen auf das Waschbecken und musterte das Gesicht, das ihm aus dem Spiegel entgegenschaute.
Es war ein kantiges, aber nicht unschönes Gesicht, nur sehr blass und abgezehrt. Die kurz geschnittenen Haare waren von einem dunklen Braun, das fast schon in Schwarz überging. Die blaugrauen Augen unter der hohen Stirn hatten einen intensiven Ausdruck, die Tränensäcke spiegelten einen chronischen Schlafmangel. Er hatte sich seit Tagen nicht mehr rasiert, sodass die Stoppeln sich zu einem Bart verdichteten. Er war etwa eins fünfundachtzig groß und von athletischer Statur, doch sein Oberkörper war von frischen Wunden und blauen Flecken übersät, die ihm der Sturz von der Promenade eingetragen hatte. Es war nicht das erste Mal. Er trug am ganzen Körper die Narben früherer Verletzungen, auch über dem rechten Auge und unterhalb des Ohrs.
Als er den Brustverband entfernte, sah er, dass die Schusswunde genäht worden war. Daran konnte er sich erinnern. Er wäre fast verblutet während der halbstündigen Autofahrt aus der Stadt zu einem Mann, auf dessen Verschwiegenheit und sichere Hand er sich verlassen konnte. Anschließend hatte er der Tochter des Arztes eine stattliche Summe bezahlt, damit sie ihn hierherbrachte, während er auf dem Rücksitz schlief. Er brauchte Ruhe und Erholung, doch er konnte nicht lange hierbleiben. Es gab nicht so viele Ärzte in und um Québec. Es würde nicht lange dauern, bis sie auf einen Chirurgen im Ruhestand namens Valoix und seine Tochter stießen. Sie würden Bournes Spur hierher folgen. Ihn jagen. Ihn töten.
Warum, um Himmels willen?
Doch im Grunde wusste er, warum. Sie dachten, er wäre wieder zu Cain geworden. Einem Namen aus der Vergangenheit, aus seiner Vergangenheit. Einem Killer.
Aus dem Zimmer hörte er lautes Klingeln, das ihn hochschrecken ließ. Seine Hand zuckte, er öffnete und schloss die Faust. In solchen Momenten der Unsicherheit war sein erster Impuls, zur Waffe zu greifen, doch die hatte er bei der Auseinandersetzung auf der Promenade verloren. Er schaute zum Nachttisch und sah das Hoteltelefon. Humpelnd durchquerte er das Zimmer und nahm den Hörer ab, ohne etwas zu sagen. Er wollte erst wissen, wer dran war.
»Bonjour, Monsieur«, meldete sich die Stimme eines alten Mannes. »Comment ça va ce matin?«
Er verstand die Sprache, wartete jedoch einen Moment lang, bis er mit heiserer Stimme fragte: »Wer spricht?«
»C’est moi, Monsieur Bernard, bien sûr. Avez-vous faim? Voulez-vous le petit déjeuner?«
»Ich esse später.«
»D’accord. Avez-vous besoin de quelque chose?«
Er dachte: Es gibt wirklich etwas Dringendes. Ich muss wissen, was in New York passiert ist. Muss wissen, wer mir diesen Mord in die Schuhe schieben will.
»Nein, alles bestens«, antwortete Jason. »Wie spät ist es?«
»Kurz vor elf«, sagte der Hotelbesitzer in akzentbehaftetem Englisch. »Sie haben mir gesagt, ich soll Sie früher wecken, aber die junge Frau, die Sie hergebracht hat, meinte, le médecin hätte darauf bestanden, Sie schlafen zu lassen. Ich hoffe, das ist in Ordnung.«
»Ja. Danke.«
»Ihre Kleidung ist sauber – soll ich sie Ihnen bringen?«
»Bitte.«
»Wenn Sie mir die Frage gestatten – wird Ihre reizende Frau Sie auf dieser Reise begleiten?«, fragte der Mann.
»Meine Frau …«, murmelte Bourne.
Der Hotelbesitzer hörte sein Zögern. »Oh, ich habe doch hoffentlich nichts Falsches gesagt. Dieses entzückende Geschöpf mit den schwarzen Haaren und diesen lebhaften Augen. Sie können sich glücklich schätzen. Selbst einem alten Mann wie mir schlägt das Herz höher, wenn er eine solche Frau sieht.«
Dieses entzückende Geschöpf.
Nova.
Nein, sie waren nicht verheiratet. Es hatte nur zu ihrer Tarnung gehört, sich als Ehepaar auszugeben, als sie das erste Mal hier gewesen waren. Doch irgendwann hatten sie festgestellt, dass sie sich wirklich zueinander hingezogen fühlten. Sie waren ein seltsames Paar – die britische Geheimagentin mit griechischen Wurzeln und der Treadstone-Agent ohne Vergangenheit. Zwei Jahre hatte diese Beziehung gehalten, in der sie sich überall auf der Welt getroffen hatten, um das andere Leben wenigstens für ein paar Stunden hinter sich zu lassen. Sie hatten sogar schon von einer möglichen Zukunft zu zweit geträumt, obwohl es für Leute wie sie im Grunde dumm war, solche Pläne zu schmieden.
»Nein, diesmal bin ich allein unterwegs«, sagte Bourne.
»Ah. Quel dommage.«
»Hat jemand nach mir gefragt?«, wollte Jason wissen. »Weiß irgendjemand, dass ich hier bin?«
»Natürlich nicht. Ihre Anwesenheit ist wie immer streng vertraulich. Auf meine Diskretion können Sie sich hundertprozentig verlassen.«
»Das weiß ich zu schätzen.«
»Sie sind immer sehr großzügig gewesen, Monsieur. Wir sehen uns bald.«
Bourne legte den Hörer auf.
Einen Moment lang stand er wie gelähmt in der Dunkelheit des Hotelzimmers. Seine Gedanken waren immer noch bei Nova – ein Luxus, den er sich eigentlich nicht leisten konnte. Nova war fort. Sie war tot.
Treadstone hatte sie in Las Vegas eliminiert.
Jason arbeitete zurzeit für jemand anderen. Dort fragte man sich bestimmt schon, wo er steckte und was schiefgelaufen war. Er musste möglichst bald Kontakt aufnehmen. Er ging zu dem kleinen Tisch beim Fenster, von dem man auf die Bucht hinausblickte. Sein Mobiltelefon war da, ein nicht registriertes Handy, das er in Albany gekauft und bar bezahlt hatte, als er New York in Richtung Norden verlassen hatte. Er legte den Akku ein, den er herausgenommen hatte, um sicherzustellen, dass das Telefon nicht aufgespürt werden konnte. Er schaltete es ein und wartete, bis das Handy ein Netz fand.
Über die Kontaktnummer sollte er mit einer Frau namens Nelly Lessard verbunden werden. Sie würde sich mit folgenden Worten melden: »Carillon Technology. Mit wem darf ich Sie verbinden?« Bourne würde nach einer Nebenstelle verlangen, die eine der folgenden Nachrichten weitergab: Rufen Sie mich zurück. Ich werde verfolgt. Ein Treffen ist notwendig. Alles in Ordnung.
Eine Nummer war wie ein Notruf. Die des Personalbüros im sechsten Stock.
Es bedeutete: Notfall, muss die Operation abbrechen.
Er wählte die Nummer und wartete auf Nelly Lessards Stimme. Es kam jedoch nur ein seltsames Pfeifen, dann eine Automatenstimme: »Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist nicht erreichbar.«
Jason spürte ein Dröhnen im Kopf. Die Wunde in der Schulter fing an zu pulsieren.
Hatte er sich verwählt? Nein.
Er versuchte es erneut – mit demselben Ergebnis. Und wieder. Und wieder. Nelly sollte rund um die Uhr erreichbar sein. Doch anscheinend war die Nummer nicht mehr gültig. Sie hatten sie ihm entzogen. Er wusste, was das bedeutete.
Die Operation war abgebrochen worden. Er wurde nicht mehr gebraucht.
Einen Weg gab es noch, mit Carillon in Kontakt zu treten. Eine Person, die er erreichen konnte. Scott DeRay hatte ihm eine private Handynummer gegeben, über die er Tag und Nacht erreichbar war. Jason hatte sie noch nie in Anspruch genommen, doch nun wählte er sie.
Eine männliche Stimme meldete sich beim ersten Klingeln, aber nicht die, die er erwartet hatte. Es war nicht die Stimme eines Freundes, sondern eines Fremden.
»Wer spricht da?«, fragte der Mann.
Damit hatte Jason nicht gerechnet. Warum hatte plötzlich ein anderer diese Nummer?
»Ich muss Scott sprechen«, sagte Jason.
»Sie haben sich verwählt.«
»Unmöglich! Ich weiß, dass die Nummer richtig ist«, beharrte Bourne. »Ich weiß, dass Sie ihn erreichen können. Das ist sein Telefon. Ich muss ihn dringend sprechen.«
»Ich kann Ihnen nicht helfen. Sie müssen die falsche Nummer gewählt haben.«
Lügner!, wollte Jason ins Telefon schreien. Er schloss die Augen und überlegte, wie viel er sagen sollte. »Hören Sie, ich muss Scott sofort sprechen. Oder Miles Priest. Sagen Sie ihnen, es … es geht um Medusa.«
Eine Weile herrschte Schweigen.
Dann sagte die Stimme: »Rufen Sie nicht mehr an.«
Als es wieder still wurde, wusste Jason, dass der Mann die Verbindung getrennt hatte.
Die Falle, die man ihm in New York gestellt hatte, war endgültig zugeschnappt. Sie hatten nichts übersehen. Jason war ein Gejagter und nun auch noch von jeder Hilfe abgeschnitten. Sogar der Freund, den er seit seiner Kindheit kannte, hatte sich von ihm abgewandt.
Bourne war allein.
4
Die Schreie der Möwen begleiteten Jason auf seiner Wanderung über den steinigen Strand zu den Straßen von Saint-Jean-sur-Mer. Es war ein kühler Apriltag. Er hatte die blaue Wollmütze tief in die Stirn gezogen und trug eine Sonnenbrille, die Monsieur Bernard ihm gegeben hatte. Seine Kleidung war sauber, von den Blutflecken war nichts mehr zu sehen. Er hatte geduscht, sich rasiert und einen frischen Verband angelegt. Er sah aus wie jemand, der ein paar Urlaubstage in dem kleinen Touristenort genoss.
Die Leute besuchten Saint-Jean-sur-Mer vor allem wegen des Sankt-Lorenz-Stroms. Sie kamen zum Segeln oder zum Angeln und aßen Hummerbrötchen in den Strandcafés. Am Highway, der am Wasser entlang verlief, gab es Kunstgalerien und Bäckereien. Die Häuser hatten alle die gleichen spitz zulaufenden Dächer und weißen Fassaden. Ohne die französischsprachigen Schilder wäre er sich vorgekommen wie in Cape Cod. Das Dorf hatte nur ein paar Hundert Einwohner, deren Familien größtenteils seit vielen Generationen hier lebten.
Jason kramte in seiner Tasche, um nachzusehen, wie viel Geld er noch hatte. Nachdem er den Arzt, seine Tochter und Monsieur Bernard für ihre Hilfe bezahlt hatte, blieben ihm nur noch zweihundert kanadische Dollar. Irgendwie musste er für Nachschub sorgen. Er war sich sicher, dass das Konto, das Scott DeRay und Miles Priest für ihn eröffnet hatten, gesperrt war – wahrscheinlich mit der Instruktion, den Mann, der kam, um Geld abzuheben, möglichst lange hinzuhalten.
Sobald er sich zu erkennen gab, würden Killer losgeschickt werden.
Jason spürte noch etwas in der Jackentasche. Als er es herauszog, sah er, dass es die Schlüsselkarte für sein New Yorker Hotelzimmer am Washington Square Park war. Dort hatte der Täter sich mit einem Scharfschützengewehr postiert, während Jason sich unten in der Menge aufgehalten hatte. Aus diesem Zimmer hatte der Killer den tödlichen Schuss auf Sofia Ortiz abgegeben.
Eine Kugel in die Kehle. Eindeutig Cains Handschrift.
Er zerbrach die Schlüsselkarte und warf die Teile in zwei verschiedene Mülleimer vor den Geschäften.
Jetzt erst wurde ihm bewusst, dass er hungrig war. Er hatte seit vierundzwanzig Stunden nichts mehr gegessen. Er entschied sich für eine Brasserie, in der es Fish and Chips und Fischsuppe gab und die eine Aussicht auf die Bucht bot. Das Restaurant bestand aus einem einzigen Raum, die Tische waren mit Plastiktüchern bedeckt, auf denen Gemüse und Blumen dargestellt waren. Die Wände waren mit Stricken, Fischernetzen und Rettungsringen dekoriert. Er setzte sich an einen leeren Tisch in der Ecke, nahe der Tür, durch die man zum Strand gelangte. Er nahm die Sonnenbrille ab, ließ die Mütze aber auf.
»Oui, Monsieur?«, sprach eine mürrische Kellnerin ihn an, als wäre sein Besuch in dem halb leeren Café eine Zumutung für sie.
Er bestellte gebratene Shrimps und Kaffee.
Über dem Tresen war ein kleiner Fernseher angebracht, auf dem die internationale Ausgabe von CNN lief. Nach einer Woche war die Ermordung der Abgeordneten Sofia Ortiz immer noch das beherrschende Thema. Auf dem Bildschirm waren die chaotischen Szenen zu sehen, zu denen es nach dem Attentat gekommen war. Er hätte es sich nicht ansehen müssen – er war selbst dort gewesen und wusste nur zu gut, was sich zugetragen hatte. In den Medien war von allgemeiner Panik die Rede, von Krawallen und Ausschreitungen. Doch diese Bezeichnungen trafen es nicht wirklich. Krawalle waren unvorhersehbare, unkontrollierte Ausbrüche. Die Gewalt in New York hatte sich jedoch nach einem bestimmten Muster ausgebreitet, wie ein kontrolliertes Feuer – so als hätte jemand im Hintergrund die Ereignisse nach einem Drehbuch ablaufen und von Schauspielern in Szene setzen lassen, deren Rollen von vornherein festgelegt waren. Hinter diesen Unruhen hatte ein Plan gestanden, der unter anderem vorsah, dass Abbey Laurent zu den Opfern gehören sollte.
Jason war ihr durch die panische Menge gefolgt. Doch er war nicht der Einzige. Ein Vermummter hatte die Frau beschattet, aber nicht einer, dem es bloß um sinnlose Gewalt ging. Dieser Mann hatte Abbey Laurent nicht aus den Augen gelassen. Als Jason sah, wie er eine Pistole auf sie richtete, hatte er einen scheinbar zufälligen Zusammenstoß inszeniert, um sie zu retten. Danach hatte er den Bewaffneten überwältigt.
Der Mann hatte keinen Ausweis bei sich gehabt – nichts, was seine Anwesenheit hätte erklären können. Er war nur eine Schachfigur in dem Spiel.
Ein Söldner von Medusa.
Die Kellnerin brachte ihm das Essen. Bourne verschlang die Shrimps wie ein Verhungernder. Er konnte nicht wissen, wann er wieder Gelegenheit haben würde, etwas zu essen. Auch der Kaffee tat ihm gut. Durch das Fenster beobachtete er ein paar Kinder unten am Fluss, die Steine ins Wasser warfen. In der Ferne sah er ein Schiff Richtung Osten fahren, auf die Mündung zum Atlantik hinaus. Wenn er die Verschwörung nicht stoppen konnte, würde ihm nur noch diese Möglichkeit bleiben: im Frachtraum eines solchen Schiffes zu entkommen.
Auf der anderen Seite des Cafés wurde die Tür geöffnet und wieder geschlossen.
Bourne schaute zum Eingang und presste einen stillen Fluch hervor. Ein Polizist. Olivgrüne Polizeijacke, schwarz geränderte Mütze und eine Pistole im Holster. Er war ein großer, dünner Kerl, noch keine fünfundzwanzig Jahre alt, und kannte offenbar jeden im Café. Selbst die mürrische Kellnerin blühte auf und flirtete heftig mit ihm. Der Koch kam heraus und machte Scherze.
Es mochte Zufall sein, dass der Cop gerade jetzt gekommen war, doch Bourne wollte es nicht recht glauben. Bestimmt wussten alle Behörden Bescheid. Die Polizei suchte ihn. Bourne beobachtete den Mann aus dem Augenwinkel. Der Cop schaute sich im Restaurant um, während er mit der Kellnerin schwatzte. Er sah Bourne an dem Ecktisch und fixierte ihn einen Herzschlag länger als die anderen Gäste. Das war’s. Der Cop schaute schnell zur Seite. Zu schnell.
Jason wusste, dass er aufgeflogen war.
Er zog zwei Scheine aus der Tasche und legte sie auf den Tisch. Ohne Hast trank er seinen Kaffee aus und schob sich den letzten gebratenen Shrimp in den Mund. Dann setzte er die Sonnenbrille auf, stand auf und verließ das Café durch die Hintertür. Ein paar Holzstufen führten zum Strand hinunter, wo die Kinder spielten. Er trat zu ihnen ans Wasser, warf selbst ein paar Steine und schaute zwischendurch kurz über die Schulter zurück.
Der Polizist beobachtete ihn von der Terrasse aus. Er hatte ein Funkgerät in der Hand, um Verstärkung zu rufen.
Jason schlenderte in Richtung Osten. Nicht weit entfernt begann ein Uferabschnitt mit dicht stehenden Bäumen, aus denen vereinzelte Hausdächer herausragten. Als er sich bückte, um seinen Schuh zu binden, schaute er erneut zurück und sah, dass der Polizist ihm folgte. Der junge Cop hielt etwa fünfzig Meter Abstand und hatte die rechte Hand am Holster. Er versuchte gar nicht, seine Absicht zu verbergen, doch Jason sah ihm an seinen ruckartigen Bewegungen an, dass er nervös war.
Wenn ein Verfolger nervös ist, mach ihn noch nervöser. Tue etwas Unerwartetes. Etwas, mit dem er absolut nicht rechnet.
Treadstone.