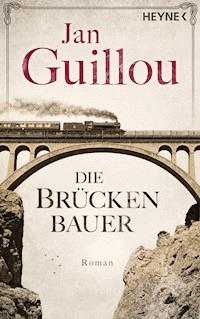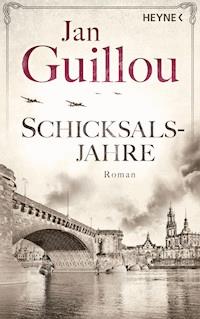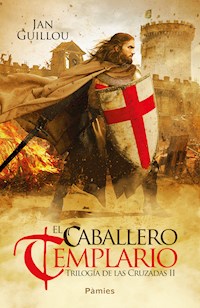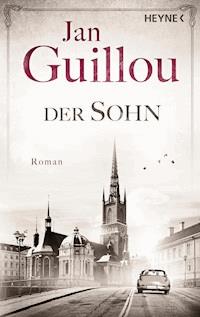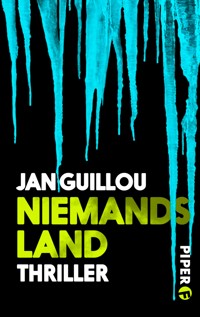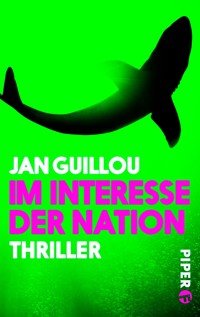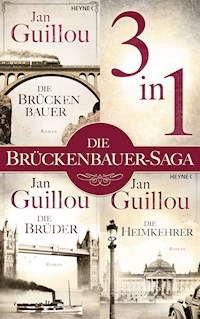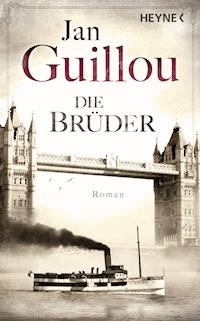
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Brückenbauer-Serie
- Sprache: Deutsch
Das große JAHRHUNDERTABENTEUER geht weiter
Der Verrat an seinen Brüdern wiegt schwer, doch Sverre, der jüngste der drei Brückenbauer, wird ihnen nicht nach Norwegen folgen. So sehr er sich auch wünscht, am ehrgeizigsten Ingenieursprojekt des Landes mitzuwirken, die Liebe ist stärker. Sverre folgt seinem Studienkollegen Albert nach England. Hier führen die beiden das wilde Leben der Boheme. Doch ihr Glück ist nur von kurzer Dauer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Jan Guillou
DIE
BRÜDER
Roman
Aus dem Schwedischen von Lotta Rüegger
und Holger Wolandt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
Dandy bei Piratförlaget, Stockholm
Copyright © 2012 by Jan Guillou
Copyright © 2013 der deutschen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Maike Dörries
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel/punchdesign, München
Umschlagabbildung: Johannes Wiebel unter Verwendung von Motiven
von shutterstock.com/Claudio Divizia; Pierre-Jean Durien
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN 978-3-641-10960-8V002
www.heyne.de
I – Eine andere Welt
Wiltshire, Juni 1901
Sverres Gelassenheit beruhte hauptsächlich darauf, dass Albie immer nur sehr vage von seinem Zuhause in Wiltshire erzählt hatte. Ab und zu hatte er eher beiläufig das »Haus« erwähnt und gelegentlich die »Felder« und die »Schafzucht«, was nach einem etwas größeren norwegischen Bauernhof geklungen hatte, insbesondere wegen der Schafe.
Im Zug nach Salisbury hätte Albie vielleicht die letzte Möglichkeit nutzen können, das eine oder andere zu klären. Stattdessen waren sie in eine ausgelassene Diskussion darüber geraten, welchen Beitrag ihre Wissenschaft zur Verbesserung des wichtigsten Verkehrsmittel Englands, der Eisenbahn, leisten konnte. Sie waren frischgebackene Diplomingenieure der Universität Dresden und besaßen damit die beste technische Ausbildung der Welt. Für die Menschheit war soeben das Jahrhundert unfassbarer Fortschritte angebrochen, die vielleicht sogar das Ende jener Barbarei, die Krieg hieß, mit sich bringen würden. Immer noch klangen ihnen diese Worte des Rektors am Examenstag in den Ohren. Die Verantwortung dafür trugen vor allem die Ingenieure. Die neue Technik würde das menschliche Dasein von Grund auf verändern. Nichts war unmöglich, warum also nicht sofort damit beginnen, sich ein paar rasche Verbesserungen für den Bahnverkehr auszudenken?
Sverre war auf Eisenbahnen spezialisiert und Albie auf Maschinenbau, das Thema lag also fast auf der Hand.
Albie breitete die Arme aus, reckte sich glücklich unbekümmert – sie hatten ein ganzes Erste-Klasse-Abteil für sich –, hob dann in einer für ihn typischen Geste den Zeigefinger und formulierte die Frage:
»Was stört uns am meisten, während wir hier sitzen? Lass uns damit beginnen. Was sollte man umgehend verbessern? Was fällt einem als Erstes auf?«
»Der Ruß«, stellte Sverre fest und deutete verdrossen auf seine Manschetten. »Ich habe ein frisch gestärktes weißes Hemd angezogen, als wir heute Morgen im Hotel Coburg aufgestanden sind. Jetzt kann ich es nicht einmal mehr zum Abendessen tragen, fürchte ich. Und dann wären da noch der Lärm und das Gerüttel, möglicherweise auch die geringe Geschwindigkeit.«
Albie dachte einen Augenblick nach und nickte dann. Das waren die unmittelbaren Probleme, die gelöst werden mussten, daran bestand kein Zweifel.
Sie begannen mit dem Ruß, der größten Unannehmlichkeit, insbesondere an einem warmen Sommertag wie diesem, an dem man gerne mit geöffnetem Fenster reiste. Die Lokomotiven wurden von mit Kohle befeuerten Dampfmaschinen angetrieben, und der Rauch war überaus unangenehm. Zwei Lösungen boten sich an: entweder die Kohleabgase mithilfe eines Filtersystems zu reinigen, oder – eine drastische Methode – das Antriebssystem auszutauschen. Die neuen Automobile wurden mit Petroleumprodukten angetrieben. Auch diese Art von Verbrennungsprozess brachte Ausstöße mit sich, verglichen mit dem Kohlerauch eines Zuges waren sie jedoch nur unbedeutend. Theoretisch ließen sich die mit Kohle befeuerten Dampfmaschinen durch etwas größere Verbrennungsmotoren vom Automobiltyp ersetzen. Was das kostentechnisch bedeuten würde, war eine andere Frage, denn Kohle war in England praktisch gratis.
Andererseits hatte bereits Rudolf Diesel in seiner Abhandlung »Theorie und Konstruktion eines rationellen Wärmemotors zum Ersatz der Dampfmaschine und der heute bekannten Verbrennungsmotoren« festgestellt, dass bei einer Dampfmaschine neunzig Prozent der Energie verloren gingen. Das war eine kolossale Vergeudung und damit auch verschwendetes Geld. Rudolf Diesels neuer Motor, zumindest die Experimentalversion, wurde von Erdnussöl angetrieben. Dieses ließ sich zwar nicht ohne Weiteres in ausreichenden Mengen beschaffen, war aber im Unterschied zur Kohle kein endlicher Rohstoff und außerdem sauberer und weniger schädlich. Also ein Dieselmotor?
Oder Elektrizität?, überlegte Sverre. Sauber und leise. Die Verunreinigung durch Kohle beschränkte sich auf die Kraftwerke, in denen man die elektrische Energie herstellte. Dort ließe sich auch der Kohlerauch auf vernünftige Art filtern.
Unverzüglich wandten sie sich dem Thema Elektromotoren zu. Bislang existierten keine, die genügend Kraft entwickelten, um einen ganzen Zug anzutreiben, aber das lag nicht unbedingt an praktischen Problemen. Vielleicht hatte bisher einfach niemand den Bedarf gesehen. Die Technik existierte schließlich, sie musste einfach nur weiterentwickelt werden. Ein größeres Problem stellte da schon der Transport der Elektrizität vom Kraftwerk zur Lok dar. Elektrische Leitungen mit Transformatorstationen gab es bereits, so weit also keine Schwierigkeiten. Wie wäre es mit einer dritten, stromführenden Eisenbahnschiene, von der die Lok ihre Kraft mithilfe eines Senkschuhs oder eines Skis an der Unterseite bezog?
Keine gute Idee. Eine bodenläufige Stromschiene, die kreuz und quer durch England verlief, würde – einmal ganz abgesehen von dem rein metallurgischen Problem raschen Verschleißes und der Lärmbelästigung – den Tod Hunderttausender Kühe und Zehntausender Kinder zur Folge haben.
Auf diesen vernichtenden Einwand kam Albie.
Sverre stellte mit einem Seufzer fest, dass man wohl eine Übertragung der elektrischen Kraft durch die Luft ersinnen müsse.
Sie ließen das Problem des Antriebs vorerst auf sich beruhen und wandten sich dem Aspekt des Lärms zu. Die Schienenstöße verursachten das unerträgliche Rattern und Dröhnen. Was könnte dagegen unternommen werden?
Auf diesem Gebiet nun kannte sich Sverre aus. In Ländern mit großen Temperaturschwankungen, erklärte er, seien großzügige Schienenlücken vonnöten, da sich Metall, insbesondere Eisen, bei Wärme ausdehne und bei Kälte zusammenziehe. Hier habe man es mit einem unumgänglichen physikalischen Gesetz zu tun, es sei denn, Eisenbahnräder ließen sich flexibler gestalten. Gold eigne sich in der Theorie, verschleiße dafür aber rasch und weise andere offensichtliche Nachteile auf. Gummiräder wie bei Automobilen würden sich noch schneller abnutzen. Aber wenn es eine Möglichkeit gäbe, dieses neue Material im Innern der Räder zu verwenden, also nicht in direktem Kontakt mit den Schienen, ließe sich das durch die Schienenstöße verursachte Rumpeln beträchtlich dämpfen. Also Gummiräder mit einem Reifen aus Stahl?
Mit dieser Überlegung gaben sie lachend auf, der Zug näherte sich Salisbury. Jetzt hatten sie ihr neues Leben fast erreicht.
*
In Antwerpen vor Betreten des Postdampfers hatte Sverre ein letztes Mal gezögert. Dort, wirklich erst dort, mit Sicht auf England jenseits der Meerenge, war es ihm vorgekommen, als würde er den Rubikon überschreiten.
Er hatte sich alle Mühe gegeben, seine Unsicherheit vor Albie zu verbergen. In Albies Nähe und wenn sie sich in die Augen sahen, fiel es ihm nicht schwer. Albies schöne, ironische, intelligente, flehende und herrische braune Augen vertrieben jegliche Zweifel. Außerdem wurde er getragen von dem berauschenden Gefühl, sich in der neuen Epoche des Friedens und der Technik zu befinden, die sie jetzt gemeinsam erobern würden und in der alles möglich war. Gemeinsam würden sie Berge versetzen, nicht nur im übertragenen Sinne, sondern notfalls sogar buchstäblich, beispielsweise beim Kanalbau.
Dies war die eine und eindeutig ausgeprägteste Seite seiner Empfindungen.
Was die andere Seite dafür nicht weniger quälend machte. Weil sich unmöglich schönreden ließ, dass er ein Verräter war. Er hatte Norwegen verraten, genauer gesagt die Wohltätigkeitsloge Die gute Absicht in Bergen, die sowohl ihm als auch seinen Brüdern Lauritz und Oscar eine Ausbildung finanziert hatte, die den drei vaterlosen Fischerjungen von der Osterøya sonst verschlossen geblieben wäre. Ohne die Unterstützung der Loge hätten sie ihre Lehre in Cambell Andersens Seilerei absolviert und wären mit der Zeit Seiler geworden, weder mehr noch weniger.
Der Zufall hatte jedoch die Mitglieder des Wohltätigkeitsvereins dazu veranlasst, sie, einer Märchenfee gleich den Zauberstab schwingend, mit einer höheren Ausbildung zu segnen, was einer Erste-Klasse-Fahrkarte in die Oberschicht gleichkam. Innerhalb weniger Jahre wären sie vermögend gewesen. Die Stellen und die Gehälter, die man den drei Brüdern nach dem Examen in Dresden geboten hatte, ließen daran keinen Zweifel.
Die Ausbildung, die ihnen geschenkt worden war, brachte aber auch Verpflichtungen mit sich, denen er sich wie ein Zechpreller entzogen hatte. Seinen Teil der Verantwortung hatte er ungefragt seinen Brüdern aufgebürdet, ein unentschuldbares Verhalten.
Ein Gespräch mit den Brüdern wäre sicherlich nicht sehr fruchtbar verlaufen. Lauritz war ein großer Bruder, den man bewundern musste, seine eiserne Disziplin, sein besessenes Training, um Europas bester Velodrom-Rennfahrer zu werden, seine feste Entschlossenheit, der beste Diplomingenieur seines Jahrgangs zu werden, sein unermüdlicher Fleiß, obwohl er oft vom Training erschöpft gewesen war. Nichts vermochte Lauritz aufzuhalten.
Diese Eigenschaften konnten selbst einen Bruder ein wenig einschüchtern. Lauritz würde sich nie von so etwas Weltlichem und Trivialem wie der Liebe davon abhalten lassen, zu erledigen, was seine Ehre ihm abverlangte. Daher war nie infrage gestellt worden, dass sie alle drei nach Bergen zurückkehren und anschließend für einen Lohn, der kaum höher war als der eines Bahnarbeiters, in Schnee und Eis auf der Hochebene arbeiten würden, fünf Jahre lang, genauso lang wie die Studienzeit.
Anschließend, wenn sie alle über dreißig waren, eröffneten sich ganz sicher neue Möglichkeiten. Wie oft hatten sie nicht über die neue Ingenieursfirma Lauritzen & Lauritzen & Lauritzen in Bergen gescherzt! Mit vierzig würden sie dann mit Frau und Kindern in einer schönen Villa in Bergen ein respektables, bürgerliches Glück leben. Das war der Plan, den nichts durchkreuzen durfte. Am allerwenigsten Gefühlsduseleien. Für Lauritz waren starke Emotionen ein Ausdruck von Unmännlichkeit.
Diesem unerbittlich harten und prinzipientreuen Lauritz erklären zu wollen, dass es Gefühle gab, die alle Prinzipien über den Haufen warfen, noch dazu Gefühle, die in den Augen Gottes einen Frevel darstellten, wäre vollkommen unmöglich gewesen. Lauritz glaubte zu allem Überfluss nämlich auch noch an Gott. Er hätte sich nur angeekelt abgewandt. Es hätte einen fürchterlichen Abschied gegeben. Daher war es sinnvoll gewesen, feige und prinzipienlos die Flucht zu ergreifen.
Seltsam, wie sehr die Brüder sich ähnelten und zugleich unterschieden. Für niemanden in Dresden hatte je irgendein Zweifel bestanden. Da kommen die drei norwegischen Wikingerbrüder, hatte man gesagt. Sie waren ungefähr gleich groß, hatten dieselben breiten Schultern und dasselbe rotblonde Haar. In den ersten Jahren hatten sie sogar denselben Schnurrbart getragen, bis Sverre aus politischen Gründen dazu übergegangen war, glatt rasiert aufzutreten.
Äußerlich so gleich und innerlich doch so verschieden. Die beiden älteren Brüder interessierten sich keinen Deut für Kunst und Musik, für Sverre waren sie lebensnotwendig. Er sah die Schönheit in einer guten Skizze, einem kühnen Brückenschlag über einem Abgrund auf der Hardangervidda oder einer eleganten Gleichung. Lauritz und Oscar hingegen konnten einen Gustave Doré, obwohl ihnen das Motiv hätte vertraut sein müssen, nicht von einem Claude Monet unterscheiden, und die einzige Musik, die sie möglicherweise interessierte, war Blasmusik an einem Sonntagnachmittag im Park.
Es gab keinen Grund, die Brüder ihres Geschmackes wegen, den sie trotz allem mit den meisten anderen Menschen teilten, zu kritisieren. Sverre hatte eine besondere Gabe, seine Brüder hingegen nicht. So musste man es betrachten. Aber seltsam war es schon, dass sie sich trotz der garantiert gleichen Eltern, der gleichen Kindheit und Jugend und der symbiotischen Studienjahre so unterschiedlich entwickelt hatten. Lauritz nutzte jede freie Minute, um wie besessen Rennrad zu fahren. Oscars einziges Steckenpferd war sein Gewehr, und jeden Sonntag nahm er an Übungen der Dresdner Scharfschützenkompanie teil. Man hätte meinen können, diese Beschäftigung wäre ihm mit der Zeit vielleicht etwas eintönig geworden, aber mitnichten. Leichter nachzuvollziehen war sein diskretes Faible für das Nachtleben.
Sie hatten sich jedoch bislang immer geliebt, wie sich Brüder eben lieben. Bis vor Kurzem, bis zum Verrat des jüngsten Bruders.
Nun rackerten sich Lauritz und Oscar auf der Hardangervidda ab. Man konnte sich unschwer vorstellen, wie es ihnen dort erging, vielleicht war es ja jetzt im Juni nicht ganz so schrecklich. Einmal hatten sie während der Sommerferien nach der Heuernte zu dritt die Osterøya verlassen und waren eine Woche lang auf der Hardangervidda gewandert, um sich ein Bild davon zu machen, was sie erwartete, wenn sie den Bau des am höchsten gelegenen und schwierigsten Eisenbahnabschnitts nach Beendigung ihrer Ausbildung in Dresden in Angriff nehmen würden. Zur Sommerzeit präsentierte sich die Hardangervidda magisch schön in ungeahnter Farbenpracht. Sverre hatte vor Ort eine Reihe Bilder gemacht, sogar einige Aquarelle. Es gehörte nicht viel Fantasie dazu, eine weiße, wirbelnde Schneedecke über die ganze Landschaft zu ziehen und sich eine Temperatur von minus 35 Grad vorzustellen. Die Schönheit verwandelte sich dabei in eine Hölle.
Die Bergenbahn war zweifelsohne Norwegens größtes technisches Projekt, ein heroisches Projekt und eine gelungene Metapher des 20. Jahrhunderts als eines Jahrhunderts der Technik. Nun denn. Die Arbeit an sich war jedoch technisch nicht sonderlich anspruchsvoll und zeichnete sich vor allem durch große körperliche Anforderungen aus. Es handelte sich mehr um eine Kraftprobe als um eine technische Herausforderung. Vielleicht war das ungerecht oder auch nur die leichtfertige Ausrede eines Menschen mit einem schlechten Gewissen.
Dort oben rackerten sich jetzt Lauritz und Oscar im Kampf gegen die Elemente ab, während sich der Verräter, ihr jüngster Bruder, an den schönen Künsten in Paris erfreute – Albie und er hatten dort auf der Reise nach Antwerpen eine zweitägige Pause eingelegt – und an der üppig grünen südenglischen Landschaft mit den sanften Hügeln und der pastoralen Idylle.
Vielleicht war es ja sein Verhältnis zur Kunst, das die Voraussetzungen für die inzwischen wahrscheinlich unüberwindbare Kluft zwischen den Brüdern geschaffen hatte. Im Haus von Frau Schultze hatten sie gut, jedoch sehr bescheiden und diszipliniert gelebt. Die Universität schickte jedes Quartal einen Bericht an Die gute Absicht in Bergen, in dem die Studienresultate der Brüder bis auf eine Stelle hinter dem Komma aufgelistet wurden. Anschließend wurde pünktlich Geld an die Filiale der Deutschen Bank in der Altstadt überwiesen. Sie hatten wahrlich keine Not gelitten. Aber das Geld aus Bergen erlaubte ihnen keine Ausschweifungen. Ordentliche, saubere Kleidung, drei Mahlzeiten bei ihrer Vermieterin, das war alles.
Mit der Zeit brachte Lauritz Geldprämien von seinen Radrennen nach Hause, die er penibel teilte: eine Hälfte für seine Brüder und sich, die andere für Die gute Absicht in Bergen. Es war Geld, das ihren Wohltätern nicht fehlte und das sie nie eingefordert hatten.
Es begann damit, dass Frau Schultze ihn bat, den Türrahmen des großen Speisezimmers zu dekorieren, in dem sonntags gegessen wurde, wenn mehr als vier Gäste teilnahmen. Natürlich wünschte sie sich »Wikingerkunst«, und dagegen war nichts einzuwenden. Dieser Auftrag kostete Sverre vier Arbeitstage und ein schlechtes Ergebnis bei einer unwichtigen Prüfung, das sich schnell wieder aufholen ließ.
Die Gäste, die Frau Schultze an Sonntagen empfing, begeisterten sich wie scheinbar ganz Deutschland für die Wikinger und altnordische Ornamentik. Damit nahm alles seinen Anfang. Die ersten Gäste, die etwas in Auftrag gaben, bezahlten nicht viel. Als Sverre das zu bunt wurde, nahm er, auf seine Studien verweisend, nur noch widerstrebend Aufträge an. Prompt stieg die Nachfrage, aber auch für einfachste Arbeiten stieg der Preis dramatisch an, wobei schwarze Reliefs auf Goldgrund am teuersten waren.
Er ließ seine Brüder an dem Gewinn teilhaben, nicht aber die Wohltätigkeitsloge, ein Umstand, den Lauritz seltsamerweise nie kommentierte.
Dank dieser zusätzlichen kunsthandwerklichen Arbeit war er ab seinem dritten Jahr in Dresden niemals knapp bei Kasse, obwohl er immer mehr Geld für modische Kleidung für sich und seine Brüder ausgab, in denen sie alle Kommilitonen überglänzten.
Diese leidenschaftliche Begeisterung für Kleider führte ihn vermutlich mehr als alles andere mit Albie zusammen. Es gab eine große Gruppe englischer Studenten in Dresden, es hieß sogar, die englische Landsmannschaft sei größer als die der deutschen Provinzen, möglicherweise mit Ausnahme von Sachsen. Deutschland und die deutsche Kultur waren während der letzten Jahre in England in Mode gekommen, was den englischen Studenten deutlich anzumerken war, deren Bewunderung alles Deutschen gelegentlich geradezu übertrieben wirkte. Trotzdem kleideten sie sich eher englisch als deutsch, wobei die Unterschiede gering waren.
Besuchte man ein Konzert oder die Semperoper, warf man sich natürlich in Schale, das verstand sich von selbst und war Teil des Vergnügens. Aber ein Frack war ein Frack und ließ sich nicht groß variieren. Ein Besuch der Soireen des Kunst- und Opernvereins stellte eine größere Herausforderung dar, denn hier galt es, in einfacher Eleganz aufzutreten, was viel schwerer war. Die Engländer wählten zu diesen Anlässen normalerweise einen Smoking, ein Kleidungsstück, das Sverre eher fantasielos fand. Es handelte sich dabei um einen einfachen Frack mit schwarzer statt weißer Fliege, in dem alle gleich aussahen. Mit Ausnahme jener Engländer natürlich, die darauf bestanden, graue Hosen zu dem schwarzen oder mitternachtsblauen Jackett zu tragen, ein Stil, den sie »Oxford Grey« nannten.
In so einem Zusammenhang waren Albie und er sich erstmals begegnet. Sie trugen beide keinen Smoking, sondern hatten sich deutlich mehr ins Zeug gelegt und tauschten sich recht ausgiebig über die Schneidereien in der Stadt aus.
Eins führte zum anderen. Albie war in der Kolonie englischer Ingenieursstudenten beliebt und lud öfter als die anderen nach Veranstaltungen zu sich nach Hause ein. Das konnte er sich auch erlauben. Er wohnte in einer großen Wohnung mitten in der Stadt und hatte sowohl einen Butler als auch eine Haushälterin. Das war bei den Engländern nichts Ungewöhnliches, die ausnahmslos aus wohlhabenden Familien zu kommen schienen und erklärten, dass man seine Studien in Oxford und Cambridge ebenfalls auf diese Weise organisiere. Die Feste der englischen Studenten waren entweder rauschend und glamourös oder, wie oft bei Albie, ruhiger und philosophisch. Es wurde zwar auch gerne getrunken, aber mäßiger. Ab und zu hörte man bis spät in die Nacht Grammofonmusik oder las Gedichte vor, deutsche und englische.
Es war ein angenehmes Beisammensein, und Albie war ein ausgesprochen großzügiger Gastgeber. Außerdem bot sich für Sverre dort die Gelegenheit, seine Englischkenntnisse, die er sonst nur durch die wenigen amerikanischen Lehrbücher trainierte, kostenlos zu verbessern. Aber Englisch lesen war wesentlich einfacher als Englisch sprechen oder verstehen.
Erstaunlicherweise sprach Albie im Unterschied zu seinen Landsleuten kein Sächsisch, sondern ein schönes, perfektes Hochdeutsch. Er bestätigte, dass man ihn überall in Deutschland für einen Deutschen hielt, erläuterte aber nie, wie er diese Fähigkeit erworben hatte, und leugnete, deutsches Blut in den Adern zu haben.
Albies hervorragendes Deutsch kam noch mehr zu seinem Recht, wenn die anderen Gäste nach Hause geschwankt und sie allein waren, was immer öfter geschah. Manchmal brachen die anderen Gäste erstaunlich früh auf, als hätten sie einen kleinen Wink erhalten.
Sie blieben im Hinblick auf die Vorlesungen des folgenden Tages viel zu lange auf und unterhielten sich buchstäblich über alles zwischen Himmel und Erde, über Norwegen und England, über Bach und Mozart, über den Durchbruch des Impressionismus, Wagners Wikingerromantik im Verhältnis zur bedeutend raueren Wirklichkeit jener Zeit, über Sozialismus und Frauenwahlrecht, über Deutschlands zögerliche Teilnahme am Wettstreit um die Kolonien, die vielleicht allzu übertriebenen Bestrebungen Englands in dieser Hinsicht und die holländische Helldunkelmalerei im Vergleich zu den helleren Farben der modernen französischen Malerei. Wer hätte nicht gerne einen Vermeer besitzen wollen, wenn man bedachte, wie viele moderne französische Kunstwerke plus einer Kopie des alten Meisters man dafür eintauschen konnte.
In diesen einsamen Stunden war die Welt schmerzlich schön, so schön wie gewisse Abschnitte in Tschaikowskys Sinfonie »Pathétique«. Während endloser Gespräche verglichen sie Bachs mathematische und Tschaikowskys emotionale Methode, schöne Kunst zu schaffen.
Zusammen mit Albie wurde das Leben größer und reicher. Dieses Gefühl überwältigte Sverre ganz besonders, wenn er daran dachte, wie sein Leben verlaufen wäre, wenn er als Seiler in Bergen geblieben wäre und ihm somit der Blick auf die Welt großenteils verschlossen geblieben wäre. Manchmal hatte er das Gefühl von einem starken Überdruck in seinem Inneren, wie in einem allzu fest aufgepumpten Autoreifen, der zu platzen drohte. Anfangs war es eine Art fiebriger Erregung, die er nicht in Worte fassen konnte, weder sublime noch alltägliche. Er erkannte nicht die heimliche und in den Augen vieler schändliche Bedeutung dieser überwältigenden Gefühle.
Nachdem ihn Albie zum ersten Mal zum Abschied geküsst hatte, behutsam und zärtlich, aber auf den Mund, ging er wie berauscht im roten Licht des Sonnenaufgangs am Elbufer nach Hause, ein absichtlicher Umweg. Er sang, was ihm gerade einfiel, hauptsächlich Schubert. Seine Gefühle waren stärker als jede Vernunft. Er ahnte nicht und dachte nicht, dass er an einem entscheidenden Wendepunkt im Leben angekommen war.
*
Albie wurde wie immer von einem schlechten Gewissen gequält. Zu viele Dinge hatte er Sverre verschwiegen. Nicht einmal andeutungsweise hatte er die Katastrophe, die ihn gezwungen hatte, England zu verlassen und ein neues Leben oder zumindest den Anfang eines neuen Lebens in Deutschland zu suchen, erwähnt. Er hatte Sverre gegenüber kein Wort über seine früheren Ausschweifungen – eine der vielen verschönernden Umschreibungen – verloren, über seine fröhlichen Tage mit den Bohemiens und Dandys Londons, um bei den verschönernden Umschreibungen zu bleiben.
Anfangs war es, als wolle er Sverre beziehungsweise ihr enges Verhältnis durch seine Diskretion schützen. Sverre war rein, unbefleckt wie ein Heiliger und der Inbegriff einer Unschuld vom Lande. Nicht im Geringsten tuntenhaft. Sverre war ein Wikinger, muskulös wie eine griechische Statue im British Museum. Sein blauer Blick verströmte ein Flair von salzigem Meer und Fischernetzen, gleichzeitig war er Ingenieur der besten technischen Universität der Welt und eine verträumte Künstlerseele und überdies der am elegantesten gekleidete Mann Dresdens – eine märchenhafte und natürlich unwiderstehliche Kombination von Eigenschaften.
Anfangs hatte er befürchtet, Sverre durch die leiseste Andeutung, dass es vor ihm schon andere Männer gegeben hatte, abzuschrecken. Je mehr Zeit er hatte verstreichen lassen, desto größer war die Lüge geworden und immer schwerer aus der Welt zu schaffen.
Dennoch wäre es durchaus möglich gewesen, als ein Anfang von den positiven Seiten zu erzählen. Denn einer der Dandys im Kreise Oscar Wildes zu sein hatte Augenblicke voller Freiheit und Glück bedeutet. Wie damals, als sie alle gemeinsam mit grünen Nelken im Knopfloch verspätet zur Premiere von Lady Windermeres Fächer erschienen waren. Zu jener Zeit liebten alle, die in London etwas auf sich hielten, Oscar. Insbesondere, als er in seiner Dankesrede von der Bühne aus dem Publikum zu seinem guten Geschmack und seinem hervorragenden literarischen Urteilsvermögen gratulierte, da alle im Salon das Stück fast so sehr zu schätzen gewusst hätten wie er selbst. George Bernard Shaw hätte mit einer solchen Rede an sein Publikum einen Skandal hervorgerufen. Aber Oscar befand sich während seiner Rede in einer himmlischen Dimension, schützend eingehüllt in Liebe wie Watte und Seide, der allen um sich herum das Gefühl vermittelte, er sei der Prince of London und damit unverwundbar geworden.
Nur wenige Jahre später geriet Oscar Wilde in die Tretmühle hinter der Readinger Zuchthausmauer, verurteilt zu zwei Jahren Zwangsarbeit für die »Liebe, die ihren Namen nicht zu nennen wagt«, die aber in der Sprache der Strafgesetzgebung als besonders unanständige Tat bezeichnet wurde. Diese Katastrophe war an jenem Abend im St. James’s Theatre undenkbar.
Nachdem das volle Ausmaß des Skandals deutlich geworden war, nach der Verurteilung Wildes, und der Hass auf alles, was er angeblich verkörperte, immer wieder durch die Presse wogte, fand die glückliche Zeit ein so jähes und brutales Ende, dass einem selbst die Erinnerung daran unwirklich vorkam. Plötzlich war es riskant, im Samtjackett mit einer grünen Nelke im Knopfloch ein Restaurant in der Stadt aufzusuchen. Allein glatt rasiert aufzutreten konnte das – oft berechtigte – Misstrauen der Umgebung wecken. Sich positiv über französische Kunst oder Literatur zu äußern, war mittlerweile äußerst unklug, grenzte geradezu an Landesverrat.
Der Daily Telegraph lieferte voller Ernst die politische Erklärung. Man schrieb, alles wurzele in einer satanischen Konspiration der Franzosen, heimlich unaussprechliche französische Sitten einzuführen, um kurzfristig die Moral der englischen Jugend zu untergraben und somit längerfristig die englische Rasse auszulöschen. Es handele sich also um eine besonders heimtückische und feige Art der Kriegsführung vonseiten des französischen Erzfeindes. Folglich machten sich Oscar Wilde und sein Gefolge sowohl des Verrats an England als auch am britischen Weltreich schuldig. Die Nachwelt würde vermutlich über diese Unüberlegtheiten lachen. Aber wer dem ausgesetzt war, den konnte schon die Panik packen. Albie suchte sie noch jahrelang in seinen Albträumen heim.
Als die Aufregung in London ihren Höhepunkt erreichte, floh er nach Wiltshire in sein Elternhaus und sah seinen Vater nach acht Monaten zum ersten Mal wieder.
Dieser saß vertieft in seine Buchhaltung oder ähnlich triviale Dinge in dem kleinen Arbeitszimmer neben der Bibliothek. Er hatte mit einer Szene gerechnet und damit, dass sein Vater ihn zurechtweisen und mit Sanktionen drohen würde. Mit der Streichung seines Unterhalts zum Beispiel. Nichts davon geschah.
Sein Vater blickte gelassen auf und nickte, als hätten sie sich erst vor Kurzem gesehen, bedachte die Kleidung seines Sohnes kommentarlos mit einem raschen Blick und ließ nur ein feines Lächeln ahnen.
»Gut, dass du kommst«, sagte er. »Ich schlage einen Nachmittagsspaziergang vor, da besprechen wir alles. Ich erledige dies hier nur noch rasch, du kannst dich inzwischen umziehen.«
Daraufhin vertiefte sich der Vater erneut in seine Papiere. Albie blieb also nichts anderes übrig, als auf sein Zimmer zu gehen, braune Halbschuhe, Knickerbocker und Tweedjacke anzuziehen und eine Mütze aufzusetzen. Binnen zehn Minuten verwandelte er sich von einem Dandy in einen Country Gentleman. Sein lila Samtjackett, den langen weißen Mantel und seinen Hut hängte er zuhinterst in den Schrank.
Wenig später gingen sie im Park spazieren. Sein Vater wirkte vollkommen ruhig, zögerte jedoch, etwas zu sagen. Es war ein grauer Tag, und es nieselte.
Nach einer Weile begann sein Vater schließlich zu sprechen. Die Lage spitze sich zu und erinnere immer mehr an die französische Verfolgung der Hugenotten im 17. Jahrhundert. Die moralische Entrüstung in London nehme bestialische Ausmaße an. Zwar sei Lord Alfred Douglas, der geliebte Bosie Oscar Wildes, dem Gefängnis und der Schande entgangen, ebenso wie die werten Cousins Henry James Fitzroy und Lord Arthur Somerset einige Jahre zuvor. Wirklich eine unerfreuliche Geschichte, dieser sogenannte Cleveland-Street-Skandal. Damals hätten sich die Mühlen der Gerechtigkeit begnügt, einige Bordellbesitzer und einfachere Kunden zu zermahlen. Dass es dem Sohn des Prince ofWales gelungen sei, aus dem Netz zu schlüpfen, wundere niemanden. Und wie gesagt, auch die werten Cousins seien mit dem bloßen Schrecken davongekommen. Jetzt gebe es jedoch allen Grund zu der Annahme, dass die – wenn man so wolle – glücklichen Zeiten unwiderruflich vorüber seien. Jetzt sei allen Ernstes eine Epoche hemmungsloser Verfolgungen zu befürchten. Daher sei ein mehrjähriges Studium im Ausland angezeigt.
Albie hatte dem nichts hinzuzufügen und keinerlei Einwände. Sein Vater hatte die Lage nüchtern und präzise dargelegt.
Schweigend schritten sie eine Weile nebeneinander einher, zwei spazierende Herren, die sich über die für Gentlemen üblichen Themen wie Wetter, Kricket und Fasane unterhielten. Das Wichtigste schien gesagt. Die Lage war erörtert worden, und Albie begann bereits, sich sein Leben in Paris auszumalen. Daher überraschte ihn die nächste Äußerung seines Vaters sehr.
»Ich schlage vor, dass du dich in deinen weiteren Studien auf Maschinenbau konzentrierst«, sagte er in einem Ton, als plauderten sie über das Wetter.
Als Albie nach einigen Sekunden, während derer er noch glaubte, es handele sich um einen typisch englischen, ironischen Scherz, einsah, dass es seinem Vater ernst war, war es, als habe ihn der Schlag getroffen.
Maschinenbau? Etwas so Simples und Banales, etwas für Kutscher, Schmiede und die niederen Beamten in ihren Büros in London? So geisttötend, so erbärmlich!
Er konnte sich anschließend nicht mehr erinnern, wie er seine Einwände formuliert hatte, wahrscheinlich hatten ihm die Worte im Hals festgesteckt. Sein Vater lächelte nur. Er hatte sicher lange darüber nachgedacht, wie er seinem Sohn diesen höchst prosaischen Vorschlag unterbreiten sollte, und war auf Einwände gut vorbereitet.
Das 20. Jahrhundert, begann er, würde das große Jahrhundert der Maschinen und der Technik werden. Maschinen würden nicht nur die Landwirtschaft grundlegend verändern, sondern auch das Verkehrswesen und die Industrie. Wer das frühzeitig erkenne, könne nicht nur sich selbst über alle Maßen bereichern, sondern auch der Menschheit zum Guten dienen.
Und was bedeutete dies nun für Albie? Wie künstlerisch er sich auch kleiden und wie unkonventionell und provozierend er sich ausdrücken möge, wie beharrlich er auch verkünde, die Literatur sei die einzig sinnvolle Beschäftigung, so bestehe doch kein Zweifel daran, dass er allem voran mathematisch begabt sei. Dessen brauche er sich keinesfalls zu schämen. Alle Zeugnisse aus Eton seien in diesem Punkt eindeutig gewesen.
Er dürfe nicht vergessen, dass ihm diese Begabung in Eton einiges eingebracht habe. Hatte er etwa nicht in seinen letzten beiden Jahren dort unzählige mathematische Hausaufgaben nicht nur für seine Klassenkameraden, sondern auch für bedeutend ältere Kommilitonen und sogar für die Aufsicht führenden Prefects erledigt? Was diese eine Stunde gekostet hätte, habe er in fünf Minuten bewältigt. Nicht wahr? Habe ihm diese ungewollte Gabe etwa nicht die besten Finanzen aller Studenten in Eton, wo es strenge Regeln für die finanzielle Unterstützung von zu Hause gab, beschert? Könne man daraus nicht auch Schlüsse für die Zukunft ziehen?
Es gebe also folgende Möglichkeiten: entweder sich mit etwas, was man liebe, aber nicht beherrsche, in Albies Fall Poesie und Literatur, abmühen, oder sich auf etwas einlassen, wofür man sich bestens eigne, und es mit der Zeit lieben zu lernen.
Wieder folgte ein langes Schweigen. Sie erreichten den großen Bach. Das Frühjahrshochwasser hatte die Brücke mitgerissen, es war Zeit umzukehren.
Albie fühlte sich in der Logik gefangen. Sein Vater brauchte nicht einmal auszusprechen, dass ihm als einzigem Sohn eine besondere Verantwortung zufiel. Aber auch ungeachtet dieses Schattens, der ihm überallhin folgte, war er sachte und methodisch in eine Ecke gedrängt worden, aus der es kein Entkommen gab. Was er sich für sein Leben wünschte, war eine Sache. Die Logik gebot leider etwas ganz anderes.
»Nun gut«, sagte er. »Dann eben Maschinenbau.«
»Excellent«, antwortete sein Vater. »Ich glaube, das ist ein sehr kluger Entschluss, sowohl für die Familie als auch für dich selbst, vielleicht sogar für England. Nun also zur Frage, wo man Maschinenbau studieren kann. Cambridge hat, wie bekannt, einen sehr guten Ruf, was die Naturwissenschaften betrifft. Eine Rückkehr ans Trinity College würde jedoch kaum die von uns gewünschten Veränderungen herbeiführen.«
Das war eine gelinde, möglicherweise ironische Untertreibung. Albie hatte am Trinity College das Leben eines Bohemiens geführt, außerdem war er seiner ständigen Absenzen wegen gerade bis zum Semesterende relegiert worden. So gesehen fehlten ihm also jegliche Gegenargumente.
»Ich verstehe, Vater«, antwortete er resigniert. »Ich soll ein neues Leben außerhalb der Boheme beginnen. Also im Ausland?«
»Genau. Womit wir bei der interessanten Frage angelangt wären, wo im Ausland?«
»In Frankreich!«
»Ich habe schon befürchtet, dass du mir mit Frankreich kommen würdest …«
Der Hass seines Vaters auf Frankreich durfte keinesfalls mit der ausgeprägten Abscheu eines Daily Telegraph und anderer notorisch frankophober Londoner Zeitungen verwechselt werden, er sah die Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel. Frankreich leistete in Bezug auf Literatur, bildende Künste und in gewissem Maße auch auf moderne Musik Großartiges. Aber das Land war zuallererst Europas Bestie, war seit Ludwig XIV. und Napoleon blutrünstig und kriegerisch bis zur Besessenheit. Erst als sich Österreich, Preußen, England, sogar Schweden und in gewissem Maße der russische Winter mit vereinten Kräften der Bestie widersetzten, wurde sie gezähmt. Englands nächster Krieg würde zweifellos und unvermeidlich wie immer gegen Frankreich geführt werden. Aus gutem Grund waren Albie und seine Schwestern von deutschen statt von den französischen Gouvernanten, die manche Cousins leider immer noch vorzogen, erzogen worden, setzte der Vater seine lange Predigt fort.
Im Gegensatz zu Frankreich repräsentierte Deutschland Europas friedliche Morgenröte. Er wusste, wovon er sprach. Der Historiker Frederic William Maitland war in Eton sein Mitschüler gewesen, sie waren gleichaltrig und hatten beide das Trinity College besucht, er allerdings wie auch Albie aus Familientradition. Maitland hatten Stipendien und seine einzigartige Begabung zu einem Platz verholfen.
Sein Vater und Maitland hatten während der ersten Jahre im Trinity College nebeneinander gewohnt, zusammen gefeiert und … ja. Aber darüber hinaus hatten sie unendliche Diskussionen über die Zukunft Europas geführt.
Maitland hatte Deutschland immer als das Vorbild Europas dargestellt, allerdings auch als ein Land unpraktischer Träumer in Wolken blauen Tabakrauchs und schöner Musik. Wahrscheinlich waren die Deutschen das friedlichste Volk Europas, man musste sich nur die Geschichte der letzten fünfhundert Jahre ansehen. Dass Frankreich sie 1870/71 zu einer Auseinandersetzung gezwungen hatte, lag ganz einfach daran, dass die Franzosen sich wie immer weitere Territorien unter den Nagel reißen wollten und glaubten, Europas jüngster Staat sei eine leichte Beute. Kein Wunder, dass die ganze Welt während des den Deutschen aufgezwungenen Krieges mit Deutschland sympathisierte. Ein Segen, dass Deutschland gesiegt hatte! Seither hatte Deutschland in vollkommenem Frieden mit seinen Nachbarn gelebt.
Und obwohl man natürlich nur schwer in die Zukunft schauen konnte, stand zumindest eins fest: Bald würde sich England erneut mit Frankreich im Krieg befinden, wahrscheinlich aufgrund eines Konflikts über den Sudan oder ein anderes Gebiet in Afrika. Gegen Deutschland würde England natürlich nie einen Krieg führen.
»Wenn du dich also fragst, warum du manierliches Deutsch, aber miserables Französisch sprichst, dann hast du jetzt die Antwort!«, beendete sein Vater seine leidenschaftliche Lobrede auf das Land des Friedens und der schönen Künste, das sich während der letzten Jahre nun auch noch auf dem Gebiet der Technik als führend erwiesen hatte.
Von Neuem hatte ihn sein Vater in eine Sackgasse bugsiert, die nur einen Beschluss erlaubte. In einem Land zu studieren, das in der nahen Zukunft erneut Feindesland werden würde, war natürlich unklug. Das machte Deutschland zum Land der Wahl, und Albie war überredet. Er weinte auch nicht den frohen Pariser Zeiten nach, die ihm nun entgehen würden, denn eigentlich war ihm bewusst, dass seine ohnehin mäßige Studiendisziplin an der Sorbonne rasch in einem Vergnügungsstrudel untergegangen wäre. Nicht umsonst war Paris Oscar Wildes europäische Lieblingsstadt.
Blieb also nur noch die formale Kapitulation.
»Und wo in Deutschland soll ich diese Maschinen studieren? Was schwebt dir vor, Vater?«, fragte er gemessen.
»In Dresden. Dort erhält man gegenwärtig nicht nur die meiner Meinung nach – sollen sie in Cambridge sagen, was sie wollen – beste technische Ausbildung der Welt. Gute Reise, mein lieber Sohn!«
Mit augenscheinlicher, geradezu selbstverständlicher Leichtfertigkeit hatte ihn sein Vater in die Arme Sverres getrieben, obwohl sie sich beide in diesem Augenblick keine solche Laune des Schicksals hätten vorstellen können.
Nach wenigen Wochen in Dresden war es ihm gelungen, ein Abonnement für die Semperoper zu ergattern, in der er natürlich Gleichgesinnten begegnete und auch Sverre. Nach der Vorstellung trafen sich die Opernbegeisterten beim Opernverein, um zu kritisieren und zu diskutieren und auch um, wenn nötig – und das war es fast immer – ein paar Gläser zu trinken.
Als Erstes fielen ihm an Sverre auf die Entfernung und im Gedränge seine Kleidung und die handgenähten Schuhe auf. Aber es verstrich noch eine Weile, bis sie, ohne sich auffällig darum zu bemühen, in einer kleinen Gesellschaft gemeinsam in die Stadt zogen.
Seit jenem Mal, besser gesagt seit jenem Augenblick, denn es gab einen bestimmten Augenblick, als sie sich zum ersten Mal richtig sahen, war Sverre ständig bei ihm, wenn auch zu Anfang vor allem in seiner Fantasie. Seither wuchs ein immerhin von schönsten Rosenranken umschlungener Lügenturm höher und höher.
Nun, direkte Lügen waren es nicht, eher Ausflüchte und Unausgesprochenes, was aber auf dasselbe hinauslief. Er selbst wusste alles über Sverres Leben, über die Kleinstadt Bergen, die malerische, felsige Insel, die Fischerboote, die wütenden Stürme, die tragischen Todesfälle des Vaters und Onkels, die aus sechs Kindern Halbwaisen machten, und die Lehrlingszeit in der Seilerei.
Aber was wusste Sverre über ihn? Dass er eine Art Schafzüchter aus der englischen Provinz war.
Sie konnten einander in den Sommerferien nicht nach Hause einladen, was sich bequem damit erklären ließ, dass Sverres Mutter tiefreligiös war und feste Vorstellungen davon hatte, was eine normale Sünde und was ein Frevel war. Und sein radrennsportbesessener ältester Bruder war offenbar ebenso reaktionär borniert wie intolerant.
In diesem Umfeld hätte jede noch so kleine, unvorsichtige Zärtlichkeit sie verraten, und davor fürchtete sich Sverre ganz offensichtlich. Das funktionierte zumindest als Ausrede, was Norwegen betraf.
Albie formulierte seine Ausrede vager. Vermutlich hätte sein Vater besorgt die Stirn gerunzelt, mehr aber nicht, wenn er einen norwegischen Kommilitonen, der eindeutig mehr war als ein Kommilitone, mitgebracht hätte.
Albies Vater unterschied sich sehr von Sverres Mutter. Schon immer hatte er großes Verständnis für junge Männer aufgebracht, die sich, bevor sie sich auf ihre Pflicht besannen und eine Familie gründeten, erst einmal Ausschweifungen hingaben. Über diese Dinge hatten sie sich vor seiner Abreise nach Dresden sehr offen unterhalten. Sein Vater hatte wie alle anderen männlichen Familienmitglieder Eton besucht und wie diese die Nähe männlichen Beisammenseins erlebt. So war es auch am Trinity College gewesen. Fast mit Bedauern in der Stimme erzählte er, wie seine Sturm-und-Drang-Zeit, wie er sie nannte, abrupt endete, weil sein Vater viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde und für ihn die Zeit der Pflichterfüllung anbrach.
Es war ein Naturgesetz, das man akzeptieren musste. Heirat, gerne eine gute Partie, mindestens einen Sohn zeugen, besser noch ein paar in Reserve, Ende des schönen Lebens.
Sein Vater hatte in zweierlei Hinsicht Erfolg gehabt. Er hatte reich geheiratet und einen Sohn bekommen. Aus den Reservesöhnen war jedoch nichts geworden. Albie hatte drei Schwestern: Alberta, Margrete und Penelope.
Es empfahl sich nicht, einen Freund mit nach Hause zu bringen, wenn alle auf eine Verlobung hofften. Es war keine Katastrophe, aber wenig empfehlenswert. Möglicherweise hatte er aus reiner Feigheit Sverres Bedenken zu seinen eigenen gemacht und nicht unbedingt ausgesprochen, aber doch angedeutet, dass sie sich beide in derselben Klemme befänden.
Natürlich reiste er ohne Begleitung zu der Beerdigung seines Vaters. Wenn sein Großvater nicht im Burenkrieg gefallen und aus diesem Grund viel zu jung gestorben wäre, hätte man erbliche Turbulenzen befürchten können. Albies Vater war an Magenkrebs gestorben, am Ende war es sehr schnell gegangen.
Die tiefe Trauer schwand nach einem Jahr, aber er spürte, dass ihn die Narben bis an sein Lebensende begleiten würden.Am meisten betrübte ihn, dass er seinem Vater erst nach der Verurteilung Oscar Wildes richtig nahegekommen war. Vor seiner Flucht nach Deutschland hatte er nicht einmal geahnt, wie künstlerisch gebildet und an Literatur interessiert sein Vater war, und noch viel weniger, dass er dieselben Neigungen hegte wie er selbst.
Viel zu spät hatte er entdeckt, dass sein Vater nicht nur ein Country Gentleman war, mit dem man wie mit allen Männern dieses Schlages nur eintönige und dürftige Unterhaltungen führen konnte, sondern dass er, wenn er nachmittags über seinen Schreibtisch gebeugt saß, möglicherweise den Faust las und sich nicht unbedingt mit Rechnungen oder dem Erntebericht beschäftigte. Trauerte sein Vater um die allzu kurze Freiheit im Kreise hochbegabter junger Männer, die seine Träume geteilt hatten? Wahrscheinlich. Aber das würde Albie nie erfahren.
Und nun sah er sich selbst in dieselbe Lage versetzt. Er musste heiraten und irgendwie einen Sohn zeugen und möglichst noch einen zweiten, weil sonst seine Mutter und seine Schwestern, falls er wegen eines Unfalls oder aus einem anderen Grund frühzeitig starb, ausziehen und irgendeinem Cousin alles überlassen mussten. Die Erbfolge war so etwas wie ein Gesetz der Natur, das sich nicht verändern ließ.
Und da war noch eine Sache, die er Sverre gegenüber im Ungefähren belassen oder, ehrlicher ausgedrückt, die er ihm vorenthalten hatte.
Jetzt näherte sich die Stunde der Wahrheit mit der gnadenlosen Geschwindigkeit von vierzig Meilen in der Stunde. Bald würden sie in Salisbury eintreffen. Er konnte nur auf zwei Dinge hoffen.
Ehe er England an jenem gewittrigen Morgen vor fünf Jahren verlassen hatte, hatte er den ehrlichsten Text seines Lebens verfasst. Es war kurz nach dem Prozess gegen Oscar Wilde gewesen. Damals betrachtete er sich selbst als einen Künstler, verführt zu der romantischen Sichtweise auf die Welt wie alle anderen jungen Männer im Dunstkreis Oscars, ermuntert dazu wie alle anderen jungen Männer von Oscar persönlich. Albie hatte mit seinem Herzblut geschrieben, so schonungslos ehrlich, wie die Kunst es laut Oscar erforderte.
Er hatte auf fünfzig Bögen nicht nur über den Prozess und das Leben der Boheme, die glückliche Zeit unmittelbar vor der Katastrophe, sondern auch über sein eigenes Leben in dieser Zeit und all das, was er Sverre vier Jahre lang verheimlicht hatte, geschrieben. Für all dies gab es also ein schriftliches Zeugnis.
In ein paar Tagen würde er die Erzählung aus seinem Safe nehmen und sie Sverre übergeben, koste es, was es wolle. Aber wenn sie von nun an ein neues gemeinsames Leben einleiten wollten, war Ehrlichkeit eine Conditio sine qua non, eine notwendige Voraussetzung.
Das neue Haus stand bereits und sollte Sverre davon überzeugen, dass er sehr ernsthaft ihr gemeinsames Leben vorbereitete. Ob gut oder schlecht, die Entscheidung rückte näher. Diese Erkenntnis war erschreckend, aber auch erleichternd.
*
Im Nachhinein musste Sverre zugeben, dass er es mit einem Minimum an Aufmerksamkeit und simpelster Kombinationsgabe hätte vermeiden können, so vollkommen überrumpelt zu werden. Beispielsweise hätte ihm auffallen müssen, dass sie auf dem trubeligen Bahnhof der London & South Western Railway in Salisbury nicht von einer gewöhnlichen Droschke, sondern von einer Pferdekutsche abgeholt wurden, deren Türen kein gewöhnliches Stadtwappen zierte.
Dass Albie und er wie selbstverständlich ihre neunzehn Gepäckstücke unbewacht zurückließen, deutete er als eine charmante Eigenheit der englischen Provinz, wo offenbar keine Gefahr bestand, dass jemand eine der auffällig teuren Reisetaschen oder einen der wertvollen Koffer stahl. Dies und anderes hätte er bereits bei seiner Ankunft in Salisbury zumindest ansatzweise verstehen müssen.
Möglicherweise hatten ihn seine ausgeprägten Fantasiebilder blind für die Realität gemacht. Er hatte sich bis ins kleinste Detail ausgemalt, wie es bei Albie zu Hause aussah. Ein hübscher Bauernhof auf einer Anhöhe, umgeben von grünen Wiesen, ein lang gestrecktes Gebäude mit hellen Kalksteinmauern, ein paar Scheunen und Schuppen, etwa hundert Schafe, die in der Umgebung weideten, ein vornehmer Hof etwas feinerer Leute.
Ihr Wagen hatte bald das offene Land erreicht. Es war ein Sommertag mit einem fast wolkenlosen Himmel und in Anbetracht der ständigen Klagen der Engländer über ihr Wetter erstaunlich warm.
Albie unterhielt sich anfangs fröhlich mit dem Kutscher in einem Sverre kaum verständlichen Dialekt. Aber recht bald verstummte er und schien sich in Gedanken zu verlieren.
Sie fuhren an mindestens drei Höfen vorbei, die Sverres Vorstellungen entsprachen, dann ging es durch einige idyllische Dörfer mit Bruchsteinhäusern, Rosen und Strohdächern. Sehr englisch.
»Ist es noch weit?«, fragte Sverre, nachdem sie für ihre Verhältnisse ungewöhnlich lange geschwiegen hatten.
»Nein. Keine zwanzig Minuten mehr«, antwortete Albie. »Ich habe übrigens eine Überraschung für dich vorbereitet, die mit unserer Arbeit zu tun hat. Ich hoffe, sie wird dich freuen.«
Sverre fiel keine passende Antwort ein. Und da es ja eine Überraschung sein sollte, konnte er keine Fragen stellen. Außerdem klang Albie seltsam fremd, fast abwesend.
Soeben hatten sie ein Dorf durch das schmiedeeiserne Tor in einer drei Meter hohen Ziegelmauer verlassen. Die Wärter hatten das Tor geöffnet, salutiert und keinerlei Anstalten gemacht, Passiergelder oder irgendwelche Reisedokumente einzufordern.
Und schon fuhren sie wieder durch die Landschaft.
Weiter ging es an ein paar Teichen vorbei, auf denen Enten und Schwäne schwammen, dann durch einen lichten Eichenwald mit majestätischen, viele hundert Jahre alten Bäumen, unter denen große Hirschrudel ästen.
»Was sind das für Hirsche?«, fragte Sverre. »Solche habe ich noch nie gesehen.«
»Das ist Damwild, es ist hier in der Gegend recht zahlreich«, antwortete Albie.
Damit war die Unterhaltung schon wieder zu Ende. Albie wirkte immer noch seltsam angespannt. Da ging Sverre plötzlich auf, dass es sich bei dem hohen Eisentor um eine Ein- und nicht um eine Ausfahrt gehandelt hatte.
Von dem schmalen Sandweg, der sich zwischen den Eichen hindurchschlängelte, sahen sie ein sehr großes Gebäude, ein Krankenhaus, eine Kaserne oder irgendeine andere öffentliche Einrichtung, die auf dem Land völlig deplatziert wirkte. Von dem weißen Bauernhof auf der Anhöhe war immer noch nichts zu sehen.
Als sie sich wenig später dem imposanten Bauwerk näherten, erkannte Sverre, dass der Weg auf einem großen Vorplatz vor einer breiten Freitreppe und einem hohen Portal endete. Auf den unteren Treppenstufen hatten sich mehrere Personen aufgestellt.
Albie holte tief Luft und schloss die Augen, als stünde ihm eine große Anstrengung bevor. Dann erteilte er grimmig seine Anweisungen.
»Wir gehen von rechts nach links. Zuerst begrüße ich alle, dann stelle ich dich vor. Meiner Mutter, meinen Schwestern und meiner Großmutter küsst du die Hand, bei den anderen genügt ein Händedruck!«
Sverre saß wie versteinert da. Die Szenerie war nicht misszuverstehen, so wenig wie die knappe Anweisung Albies. Mit diesem Schloss und einer Adelsfamilie hatte er nun wirklich nicht gerechnet.
Als der Kutscher vor dem Empfangskomitee vorfuhr, eilten zwei junge Männer in hellblauen Uniformen herbei und öffneten auf beiden Seiten des Wagens den Schlag und klappten gleichzeitig die Stufen herunter, bevor sie Haltung annahmen.
Die erwartete ländliche Idylle platzte wie eine Seifenblase. Sverres Mund war trocken, und er fürchtete, weder auf Englisch noch auf Deutsch ein Wort über die Lippen zu bringen, dann gelang es ihm aber doch noch, eine rasche Frage zu zischen.
»Wie spreche ich die Damen an?«
Albie, der bereits im Begriff war auszusteigen, drehte sich rasch um. Seine Nervosität war wie weggeblasen, und er schenkte ihm sein reizendstes Lächeln, als sei genau dies seine besondere Überraschung.
»Mylady reicht fürs Erste. Folge einfach meinem Beispiel, Liebling, das schaffen wir mühelos!«
Behände sprang er auf den Kies und ging mit ausgebreiteten Armen auf die hübsch gekleideten Damen zu, die in der ersten Reihe der Wartenden standen. Sverre folgte schräg hinter ihm. Albie umarmte seine Mutter, küsste sie und beantwortete rasch ein paar Fragen nach dem Verlauf der Reise. Dann begann die eigentliche Prozedur.
»Liebste Mama, darf ich dir Diplomingenieur Sverre Lauritzen vorstellen, meinen künftigen Kompagnon, von dem ich schon so viel erzählt habe? Sverre, meine Mutter, Lady Elizabeth.«
Plissierte Seide, am Hals elegant ausgeschnitten, sehr geschmackvoll, von einer Brosche geziert, vermutlich ein Aquamarin. Die Dame mittleren Alters, die keine vollendete, aber eindrucksvolle Schönheit war, streckte ihm die rechte Hand entgegen. Er nahm sie vorsichtig mit seiner Linken und berührte sie flüchtig mit den Lippen.
Sie hieß ihn herzlich willkommen, und er murmelte eine Antwort. Dann stellte Albie ihm seine Schwestern vor, Lady Margrete, genannt Margie, und Lady Penelope, genannt Pennie. Er küsste ihnen ebenfalls die Hand. Die beiden sprachen Deutsch und scherzten mit ihm. Als er sie mit gnädige Frau ansprach, löste dies große Heiterkeit aus, was ihn unsicher machte. Als Nächstes wurde eine ältere Dame begrüßt, offenbar die Großmutter, Lady Sophy. Albie raunte ihm zu, dass sie mit Lady Sophy anzusprechen sei, obwohl man sie im Familienkreise nur Auntie nenne. Erneuter Handkuss. Und wieder war Sverre unfähig, das Geschehen um sich herum zu begreifen. Es war wie ein Albtraum, in dem er taub war und sich die Münder der anderen bewegten, ohne dass er etwas hörte.
Ein groß gewachsener Mann im Jackett, der neben der Großmutter stand, wurde einfach nur mit seinem Vornamen, James, vorgestellt, aber es gelang Sverre nicht, ihn in der Rangordnung zu platzieren. Das war verwirrend. Er versuchte es mit Sir, wurde jedoch reserviert zurechtgewiesen, dass der Name James und ein Händedruck völlig genüge.
Anschließend kam eine Dame mittleren Alters an die Reihe, die nicht ganz so elegant gekleidet war wie die Damen der Familie, aber auch nicht so einfach wie die Dienstboten, die weiter hinten standen. Sie hieß Mrs. Stevens, und Sverre vermutete, dass er ihr wie James einfach nur die Hand geben musste.
Die nächste Dame wurde trotz ihres englischen Namens, Mrs. Jones, auf Deutsch vorgestellt. Albie erklärte, Mrs. Jones sei das ehemalige Fräulein Gertrude, die Nachfolgerin Fräulein Hildes, die unseligerweise mit einem der Buchhalter durchgebrannt sei. Das ehemalige Fräulein Gertrude war inzwischen Mrs. Jones geworden, Ehefrau des Oberbutlers Henry Jones, somit im Haushalt fest verankert und, soweit bekannt, ohne Absichten, das Weite zu suchen. Sverre konzentrierte sich darauf, wiederum einfach nur die Hand zu schütteln.
Die Begrüßung der schwarz-weiß gekleideten Dienstboten vollzog sich bedeutend schneller. Anschließend begaben sich alle ins Haus, angeführt von den Damen, gefolgt von Sverre, den Albie diskret vor sich herschob und ihm dabei ins Ohr flüsterte, er solle sich nur an ihm orientieren, dann würde schon alles glattlaufen.
Die Dienstboten verschwanden wie Geister in verschiedene Richtungen, und die Familie versammelte sich in einem kleineren Salon im Erdgeschoss, den man durch eine Bibliothek und ein Herrenzimmer erreichte und der in einem Stil möbliert war, den Sverre kunsthistorisch nicht einzuordnen wusste. Er tippte auf 18. Jahrhundert, sehr englisch, definitiv nicht französisch. James servierte Tee, Sandwiches und Scones.
Sverre wusste nicht, ob er sich wie in einem Traum oder im Schockzustand fühlte. Er bemühte sich, die freundlichen, allgemein gehaltenen Fragen zu beantworten, was ihm am leichtesten fiel, wenn sie von den Schwestern gestellt wurden, die darauf bestanden, Deutsch mit ihm zu sprechen, ein Deutsch, das fast so perfekt war wie Albies. Die Teezeremonie dauerte etwa eine halbe Stunde, als Lady Elizabeth sich plötzlich erhob. Auch Albie erhob sich unverzüglich, und Sverre war geistesgegenwärtig genug, es ihm gleichzutun. Lady Elizabeth sagte etwas über die lange Reise und das Willkommensdinner um acht Uhr.
Daraufhin hakte sich Albie bei Sverre unter und geleitete ihn aus dem Salon, als könne er nicht allein gehen. Draußen in der frischen Luft kehrte sein bis dahin lahmgelegtes Denkvermögen wie eine Erlösung wieder.
»Mein allerliebster Albie, warum hast du mich nicht vorgewarnt?«, fragte er, als sie die rauen Kalksteinstufen der Haupttreppe hinuntergingen.
»Weil ich befürchtet habe, dich abzuschrecken. Dann, nachdem sich diese Angst verflüchtigt hatte, fand ich es bedeutungslos, weil unsere Beziehung über solch banalen finanziellen und sozialen Fragen steht. Und zuletzt habe ich mich geschämt, weil ich nichts gesagt habe. Wie auch immer, jetzt sind wir hier.«
»Über diese Antwort hast du offenbar lange nachgedacht.«
»Darauf kannst du dich verlassen. Seit wir in Antwerpen an Bord gegangen sind ungefähr.«
»Sie war jedenfalls wohlformuliert.«
»Danke, mein Lieber.«
Sie gingen schweigend durch den unüberschaubar großen Park auf ein langes, zweistöckiges Gebäude mit riesigen Fenstern zu, die vom Boden bis ins Obergeschoss reichten, vermutlich eine Art Orangerie.
Die erste Hürde war überwunden, das Allerwichtigste war gesagt. Trotzdem gab es noch einige Unklarheiten. Doch Sverre zögerte zu fragen. Albie sah so rührend schuldbewusst aus, und die Unterhaltung sollte schließlich nicht in eine Art Verhör ausarten. Gleichzeitig konnte Sverre seine Neugier kaum zügeln.
»Du weißt, dass ich aus, wie man zu sagen pflegt, sehr einfachen Verhältnissen komme?«, begann er vorsichtig.
»Aber ja. Eine typisch englische Ausdrucksweise. Gewiss doch. Schließlich hast du im Gegensatz zu mir alles über dich und deinen Hintergrund erzählt. Viele Menschen schämen sich einer derartigen Herkunft und tun alles Erdenkliche, um sie zu verbergen, um nicht von Leuten wie mir durchschaut zu werden. Aber du hast das nie getan. Bei uns war es umgekehrt.«
Die Antwort verwirrte Sverre, aber er kam nicht dazu, weitere Fragen zu stellen, da sie an der Tür des länglichen weißen Gebäudes angelangt waren. Albie hielt vielsagend zwei Schlüssel in die Höhe, überreichte einen davon Sverre und schloss auf.
»Das ist die Überraschung, von der ich sprach«, sagte er, als sie in die Diele traten.
Der Anblick war überwältigend. Die Wände waren weiß gekalkt wie in einer protestantischen Kirche, die gerahmten Lithografien erinnerten an die Ingenieurskünste, dazwischen hingen aber auch einige dramatische Ölgemälde von dampfenden Lokomotiven und gewaltigen Ozeandampfern, die ähnliche Assoziationen hervorriefen. Es duftete frisch geputzt, nach Farbe und nach Neubau. Eine doppelläufige, hufeisenförmige Treppe aus hellem Eichenholz führte ins Obergeschoss. Die Modernität und das Licht bildeten einen starken Kontrast zu dem dunklen, alten Schloss ein paar hundert Meter entfernt.
Albie öffnete eine kleine Tür, und sie betraten eine große Bibliothek, in der vier Zeichentische standen, wie sie sie auch in Dresden verwendet hatten.
»Die Bibliothek ist gut ausgestattet, sie umfasst nahezu die gesamte technische Literatur auf unserem Gebiet. Zweitausendsechshundert Bände«, erklärte Albie, ging mit ein paar raschen Schritten durch den Raum und öffnete die nächste Tür.
Dort, am äußeren Ende des Erdgeschosses, lag eine komplett ausgerüstete mechanische Werkstatt. Was immer am Zeichentisch im angrenzenden Arbeitszimmer ersonnen wurde, konnte sofort versuchsweise umgesetzt werden.
Eine Wendeltreppe im hinteren Ende der Werkstatt führte in einen großen Salon, ein klassisches Herrenzimmer mit einer Bibliothek, die Literatur und Geisteswissenschaften umfasste. Die Einrichtung war im Unterschied zur technischen Bibliothek im Erdgeschoss konservativer, die Wände waren mit dunklem Holz getäfelt, den Boden bedeckten Perserteppiche, ein paar Palmen standen in Kübeln in den Ecken, Seestücke hingen an den Wänden, und es gab ein Grammofon mit einer beachtlichen Schallplattensammlung. Neben dem Herrenzimmer lagen vier Gästezimmer, spartanisch eingerichtet, fast ohne Wandschmuck und statt des Stucks mit einem griechischen Fries, einem symmetrischen Muster, an der Decke versehen.
Sverre folgte Albie schweigend durch das gesamte Obergeschoss bis in ein Badezimmer von der Größe eines besseren Salons. Statt einer Badewanne gab es ein kleines Bassin, in das man mithilfe eines Treppchens aus Messing und Mahagoni hinabstieg. Die Ausstattung mit den kobaltblauen und weißen Fliesen mutete griechisch an.
Direkt an das große Badezimmer anschließend hatte jeder von ihnen ein eigenes Schlafzimmer mit geräumigen Schränken an der inneren Schmalseite. Der Stil war hier eher dunkel-orientalisch. Vor den großen, ehemaligen Orangeriefenstern hingen gefältelte Tüllgardinen und schwere rubinrote Samtvorhänge. Vor dem großen schwarzen Eisenbett standen kreuz und quer Sverres sämtliche Koffer und Reisetaschen, die sich ohne sein Zutun vom Bahnhof in Salisbury hierherbewegt hatten.
Ihm fehlten die Worte. Während der gesamten Führung hatte er geschwiegen. Jetzt ließ er sich inmitten seines Gepäcks auf einen Ledersessel sinken, seufzte demonstrativ und wischte sich mit seinen Manschetten – er hatte ohnehin vor, das Hemd zu wechseln – den Schweiß von der Stirn.
»Nicht schlecht, was?«, fragte Albie.
»Allerdings«, erwiderte Sverre leise. »Dies ist also die Überraschung?«
»Ja, dies ist die Überraschung. Hier haben wir die Freiheit, die wir brauchen, um Neues zu schaffen. Die Dienstboten wohnen nicht hier, sie erscheinen nur zu den Mahlzeiten und ziehen sich dann zurück. Die Küche liegt direkt unter uns. Dort gibt es wie auch hier oben im Bad fließendes Wasser. Du wirkst eher gefasst als glücklich.«
»Ich bin gefasst und glücklich.«
»Jetzt packen wir erst einmal aus, danach sehen wir uns im Bad, einverstanden?«
Sverre nickte stumm und lächelte vorsichtig. Dann sah er Albie paralysiert hinterher, der sich übertrieben pfeifend durch das Badezimmer in sein eigenes Schlafzimmer zurückzog. Nicht über einen Korridor, sondern durch das Badezimmer waren ihre beiden Schlafzimmer verbunden. Für gewöhnlich schliefen sie in einem Bett, wenn sie die Nacht zusammen verbringen konnten. Wie würde es von nun an sein? Eine Nacht bei Albie, eine Nacht bei ihm?
Reglos saß er in seinem Sessel. Das ihn umgebende Durcheinander war von vorübergehender Art, sobald er die Taschen und Koffer auspackte und die Sachen wegräumte, wäre alles perfekt. Vor den Fenstern standen zwei prachtvolle Sträuße rote Rosen, offenbar eine früh blühende Sorte. Südengland war wegen des milden Klimas und des vielen Regens für seine Rosen berühmt.
Er sah ein, dass er diesem Gemütszustand nicht nachgeben durfte, der dem genussvollen Gefühl glich, morgens etwas länger liegen zu bleiben, auch wenn er dann zur ersten Vorlesung des Tages rennen musste.
Schließlich schlug er mit beiden Händen auf die lederglänzenden Armlehnen des Sessels, erhob sich etwas steif und ging energisch auf seine zwei Bücherkisten zu, in denen er seine Bücher alphabetisch verpackt hatte. Er würde sie neu sortieren müssen, da gut die Hälfte der Bücher in die humanistische Bibliothek im Obergeschoss gehörte, die andere Hälfte in die technische Bibliothek im Erdgeschoss. Er begann also damit, seine Bücher umzupacken, eine Kiste Technik, die andere Humanistisches. Das Einsortieren hob er sich für später auf.
Nachdem er die beiden Kisten auf den Korridor geschleppt hatte, machte er sich daran, die Kleider auszupacken und in den geräumigen Schränken eine praktische Ordnung herzustellen. Freizeitkleidung neben der Tür, dann Kleidung für das Dinner an Wochentagen, dahinter die Fräcke und schließlich Diverses für Spaziergänge und Ausflüge in die Stadt. Darunter, in etwa passend, seine Schuhe.
Es gab ausreichend Schubladen und Fächer für seine Hemden und Unterwäsche. Sverre arbeitete eifrig und methodisch und hörte, wie Albie das Badewasser einlaufen ließ.
Nachdem er die Kleider eingeräumt hatte und gerade die Reisetaschen und Koffer auf den oberen breiten Regalfächern in den Schränken verstaute, trat Albie ins Zimmer, warf sich Sverres Frack über den Arm und suchte ein passendes Frackhemd heraus.
»Ich hänge die Sachen vor die Schlafzimmertür, dann kann sich Jones bis zum Dinner darum kümmern, die Reiseknitter zu beseitigen. Wir sehen uns in zehn Minuten im Bad«, sagte er und verschwand, ohne eine Antwort abzuwarten.
Sverre ließ sich erneut auf den modernen Ledersessel sinken. Das Zimmer war außerordentlich geschmackvoll gestaltet. Die Fenster reichten bis zur Decke, und das grün glänzende Leder der Polster harmonierte perfekt mit den schweren rubinroten Verhängen und dem afghanischen Teppich im selben Rot mit einem schwarzen Muster. Vor den riesigen Fenstern stand eine Palme, an den Wänden hingen Bilder griechischer Sportler aus der Antike, die bekannte Abbildung des Diskuswerfers in der Mitte. Albie hatte einen guten Geschmack und Sinn für einfache, klare Linien. Keine Exzesse oder gewagte Farbkombinationen. Einzig die roten Laken, die unter dem Überwurf hervorschauten, hätten sich möglicherweise im Scherz als dekadent bezeichnen lassen können, waren sie doch farblich ganz auf den Teppich abgestimmt, dessen schwarzes Muster hinwiederum mit dem schwarzen, eisernen Bettgestell harmonierte.
Sverre hörte, dass das Wasser abgedreht wurde und Albie vor Wohlbehagen stöhnte, als er sich ins Badewasser gleiten ließ. Plötzlich kam Sverre ein Bad noch verlockender vor. Er riss sich die Kleider vom Leib, ließ sie einfach auf den Boden fallen und trat nackt ins Badezimmer. Albie lag lang ausgestreckt im Bassin, eine Darbietung männlicher Schönheit, die sicherlich beabsichtigt war. Sverre stieg in das funkelnde Blau und umarmte ihn, und schlagartig verflüchtigte sich das Gefühl der Starre und Unsicherheit, und ihre Leidenschaft entbrannte schnell und selbstverständlich, als hielte man ein Streichholz an einen ordentlich im Kamin aufgeschichteten Brennholzstapel. Nichts war mehr schwierig oder fremd.
Anschließend lagen sie lange in stiller, inniger Umarmung da und schaukelten leicht im Wasser, bis es kühler wurde und Albie zu frösteln begann. Sie stiegen aus dem Wasser und holten sich jeder ein Badetuch.
»Was das Dinner betrifft«, sagte Albie mit neuer Energie, während er sich kräftig frottierte, damit ihm wieder warm wurde, »so erwarten wir einige Gäste, überwiegend Nachbarn und Cousins. Der wichtigste ist Lord Somerset, der Mann meiner ältesten Schwester Alberta, die du bei dieser Gelegenheit auch gleich kennenlernst. Wir sind vermutlich um die zwanzig Personen. Es ist das Willkommensmahl für mich, anschließend wird es dann ruhiger.«
»Und wie passt der norwegische Bauer in diesen illustren Kreis der Adligen?«, fragte Sverre mit wiederkehrender Besorgnis.
»Ganz einfach. Lord Somerset wird neben meiner Mutter platziert, einer der Nachbarn, vermutlich der älteste, führt meine Großmutter zu Tisch, das bleibt dir also erspart. Als mein Gast wirst du zwischen meinen beiden unverheirateten Schwestern platziert, die beide nur zu gerne Deutsch sprechen. Du hast also keinen Grund zur Beunruhigung.«
Albie warf das Badetuch beiseite, lächelte unwiderstehlich, vielleicht aber auch nur selbstironisch, und drückte Sverre an sich.
Behutsam schob Sverre ihn von sich, nahm Albies Kopf in beide Hände, sah ihm in die Augen, als suche er nach etwas Verborgenem, und sprach dann aus, was ihn verunsicherte.
»Und worüber soll ich mit deinen Schwestern sprechen? Oder besser, worüber darf ich nicht sprechen?«
»Dein gesellschaftliches Gespür kann sich mit dem meiner Großmutter messen. All right! Wir rasieren uns jetzt, dann rauchen wir eine Zigarette oder zwei, bevor wir uns ankleiden, und währenddessen erläutere ich dir die für dich wissenswerten Dinge.«
Sie hatten jeder eine Toilette mit separatem Eingang vom Schlafzimmer aus am Ende des großen Bads, mit Wasserklosett, Waschbecken, elektrischer Beleuchtung und einem Wandspiegel. Sie rasierten sich sorgfältig, jeder am eigenen Waschbecken, ehe sie sich am Rauchtisch in Albies Schlafzimmer wieder vereinten, das genauso eingerichtet war wie Sverres, nur mit umgekehrter Farbgebung. Was bei Sverre grün war, war bei Albie rot und umgekehrt.
Beide trugen Bademäntel, und Albie fror immer noch etwas. Die Zigaretten waren türkischen Ursprungs und besaßen goldene Mundstücke.
»Es ist ganz einfach«, erklärte Albie nach dem ersten genüsslichen Zug. Sverre kannte niemanden, bei dem das Rauchen so verlockend aussah. »Meine beiden jüngeren Schwestern würden dich lieben, wenn du eine Frau wärst.«
Er legte eine Kunstpause ein, sicherlich mit Absicht, um Sverre zu verwirren, dem es ganz richtig schwerfiel, den Inhalt des Satzes zu verstehen.
»Du kannst nicht folgen?«, spottete Albie.
»Nein, kann ich nicht. Sind sie auch …?«
»Bewahre! Lesbische Frauen gibt es nur in größeren Städten und in intellektuellen Kreisen, aber nicht in der eher fossilen Oberschicht auf dem Land. Hier liest man, wenn ich so sagen darf, kaum Sappho. Du musst noch einiges über England lernen, aber das hier ist erst dein zweiter Tag, zerbrich dir also nicht so sehr den Kopf. Folgendermaßen verhält es sich: Wärst du meine Geliebte, meine Verlobte oder zukünftige Frau und einigermaßen üppig, fähig, einen oder vorzugsweise zwei oder drei Söhne zu gebären, dann würden sie dich lieben. Jetzt bist du aber erfreulicherweise ein Mann.«
»Erfreulicherweise? Nicht für Pennie und Margie, wie mir scheint?«