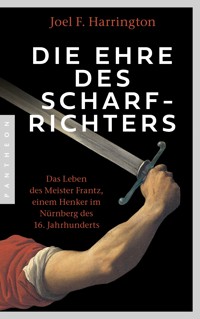
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Unter Mördern, Dieben, Dirnen: Schuld und Sühne in der frühen Neuzeit
Frantz Schmidt tötete fast 400 Menschen, unzählige weitere hat er gefoltert oder verstümmelt. Und doch war er am Ende seines Lebens ein angesehener Mann. Ungewöhnlich ist nicht nur der Lebensweg des Meister Frantz, der im 16 Jahrhundert in Nürnberg als Henker arbeitete, sondern auch, dass er Tagebuch schrieb. Der Historiker Joel Harrington hat dieses einmalige Zeugnis erstmals umfassend ausgewertet und gibt in seinem packenden Buch seltene Einblicke in das Leben, Denken und Fühlen der Menschen zu Beginn der Neuzeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Joel F. Harrington
DIE EHRE DESSCHARFRICHTERS
MEISTER FRANTZ
ODER
EIN HENKERSLEBEN IM 16. JAHRHUNDERT
Aus dem Englischen von Norbert Juraschitz
Siedler
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die englischsprachige Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »The Faithful Executioner. Life, Death, Honor and Shame in the Turbulent Sixteenth Century« bei Farrar, Straus and Giroux, New York.
Copyright © 2013 by Joel F. Harrington
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014 by Siedler Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München, nach einer Vorlage von Rothfos und Gabler, Hamburg
Covermotiv: © akg-images / Electa
Lektorat: Teresa Löwe-Bahners, New York
Karten: Peter Palm, Berlin, nach einer Vorlage von Gene Thorp
Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
Reproduktion: Aigner, Berlin
ISBN 978-3-641-10500-6V003www.siedler-verlag.de
Meinem Vater John E. Harrington jr.
VORWORT
Jede nützliche Person ist ehrbar.
JULIUS KRAUTZ, Scharfrichter von Berlin (1889)1
Es ist Donnerstag, der 13. November 1617, ein kühler Morgen. Die Sonne blickt kaum über den Horizont, da versammelt sich bereits eine Menschenmenge. Für heute ist nämlich eine öffentliche Hinrichtung in der Freien Reichsstadt Nürnberg angekündigt. In ganz Europa ist diese Stadt als Bastion von Recht und Ordnung bekannt. Schaulustige aus allen Gesellschaftsschichten möchten sich einen guten Platz sichern, ehe das große Ereignis beginnt. Verkäufer haben Stände errichtet, um Nürnberger Würstchen, Sauerkraut und gesalzene Heringe zu verkaufen. Entlang der gesamten Strecke der Prozession, vom Rathaus bis zum Galgen vor der Stadtmauer, reiht sich eine Bude an die andere. Erwachsene und Kinder drängeln sich durch die Menge und bieten Bier und Wein zum Verkauf an. Inzwischen haben sich mehrere Tausend Zuschauer versammelt, und dem guten Dutzend Büttel der Stadt, den sogenannten Schützen, sieht man an, dass ihnen nicht wohl ist bei dem Gedanken, hier für die Aufrechterhaltung der Ordnung verantwortlich zu sein. Betrunkene junge Männer schubsen sich und werden unruhig, ihre obszönen Liedchen sind nicht zu überhören. Der Gestank von Erbrochenem und Urin mischt sich mit dem angenehmen Duft gegrillter Würstchen und gerösteter Kastanien.
Gerüchte über den verurteilten Häftling, der wie üblich nur der »arme Sünder« genannt wird, machen die Runde. Die wesentlichen Daten sprechen sich rasch herum: Sein Name ist Georg Karl Lambrecht, 30 Jahre alt, ursprünglich aus dem fränkischen Mainbernheim. Obwohl er eine Müllerlehre gemacht und jahrelang als Müller gearbeitet hatte, rackerte er sich zuletzt in der niederen Stellung eines Weinträgers ab. Jeder weiß, dass er zum Tod verurteilt wurde, weil er gemeinsam mit seinem Bruder und anderen verruchten Gesellen, die aber allesamt entkommen konnten, Gold- und Silbermünzen in großen Mengen gefälscht hat. Mehr als die Fälschertätigkeit fasziniert die wartenden Zuschauer allerdings, dass diesem Mann, der von seiner ersten Frau wegen Ehebruchs geschieden worden ist und eine Zeit lang mit einer berüchtigten Hexe, der Eisenbeißerin, »im Lande herumgeschlampen«hat, magische Kräfte nachgesagt werden. Erst neulich hat Lambrecht, so mehrere Zeugen, eine schwarze Henne in die Luft geworfen, gerufen: »Sehe, teuffel, da hast du deine speise, schaffe mir jetzunder auch die meine!« und darauf einen seiner zahlreichen Feinde mit einem Todesfluch belegt. Von seiner verstorbenen Mutter ging ebenfalls das Gerücht, sie sei eine Hexe gewesen, und sein Vater wurde schon vor vielen Jahren als Dieb gehängt, was die Einschätzung des Gefängniskaplans bestätigt, dass »der apfel nicht weit vom baum gefallen ist«.
Kurz vor Mittag fangen die Glocken der nahe gelegenen Kirche des heiligen Sebald an zu läuten, gefolgt von der Frauenkirche am Marktplatz und der Lorenzkirche auf der anderen Seite der Pegnitz. Wenige Minuten später wird der arme Sünder mit Ketten an den Füßen und einem straff gebundenen Seil um die Hände durch eine Seitentür aus dem Rathaus geführt. Johannes Hagendorn, einer der beiden Kapläne des Strafgerichts, schreibt später in sein Tagebuch, Lambrecht habe sich in diesem Moment an ihn gewandt und inständig um Vergebung seiner vielen Sünden gefleht. Außerdem bittet er ein letztes Mal darum, mit einem Schwertstreich gegen den Hals hingerichtet zu werden, denn das ist ein schnellerer und ehrenhafterer Tod als das Verbrennen bei lebendigem Leib – die vorgeschriebene Strafe für Falschmünzerei. Die Bitte wird abgelehnt, dann führt Frantz Schmidt, seit vielen Jahren Scharfrichter der Stadt, Lambrecht zum benachbarten Marktplatz. Von dort setzt sich nun die Hinrichtungsprozession gemessenen Schrittes zum etwa eine Meile entfernten Richtplatz in Bewegung. Der Richter des Blutgerichts, der in eine rot-schwarze Robe gekleidet ist, führt den feierlichen Zug zu Pferde an. Ihm folgen zu Fuß der Verurteilte, zwei Kapläne und der Henker – den Stadtbewohnern besser bekannt unter dem Ehrentitel Meister Frantz. Hinter ihm gehen dunkel gekleidete Vertreter des Nürnberger Rates, Angehörige der führenden Familien der Stadt, gefolgt von den Vorsitzenden mehrerer Handwerkerzünfte. Sie alle bezeugen den wahrhaft bürgerlichen Charakter der Veranstaltung. Weinend geht Lambrecht an den Zuschauern vorüber, wünscht allen Menschen, die er kennt, seinen Segen und bittet sie um Vergebung. Durch das Frauentor lässt der Zug die mächtigen Stadtmauern hinter sich und nähert sich seinem Ziel: einer erhöhten Plattform, die im Volksmund Rabenstein genannt wird, nach den Vögeln, die nach der Hinrichtung einen Festschmaus an den menschlichen Überresten halten. Der arme Sünder steigt mit dem Henker die Steinstufen zur Plattform hoch und wendet sich der Menge zu, um zu ihr zu sprechen. Unweigerlich fällt sein Auge auf den nahen Galgen. Einmal mehr legt er ein öffentliches Geständnis ab und fleht um göttliche Vergebung, dann fällt er auf die Knie und spricht das Vaterunser, während der Kaplan ihm Worte des Trostes zuflüstert.
Nach dem Gebet setzt Meister Frantz Lambrecht in den Richtstuhl und schlingt ihm eine feine Seidenschnur um den Hals, damit der Verurteilte, von der Menge unbemerkt, erdrosselt werden kann, bevor sein Leib zu brennen anfängt – ein letzter Akt der Gnade seitens des Henkers. Außerdem fixiert er den Verurteilten mit einer Kette um die Brust, hängt ein Säckchen Schießpulver an dessen Hals und legt mit Pech bestrichene Kränze zwischen Lambrechts Arme und Beine, um das Verbrennen zu beschleunigen. Der Kaplan betet weiter mit dem armen Sünder, während Meister Frantz mehrere Büschel Stroh um den Stuhl aufschichtet und mit kleinen Klammern fixiert. Kurz bevor der Henker eine Fackel zu Lambrechts Füßen wirft, zieht sein Gehilfe, von der Menge unbemerkt, die Schlinge um den Hals des Verurteilten enger, um ihn zu erdrosseln. Dass dies misslungen ist, zeigt sich, als die Flammen am Richtstuhl lecken, denn der Verurteilte schreit pathetisch: »Herr, in deine hände befehle ich meinen geist.« Während das Feuer weitertobt, ertönt immer wieder der Schrei: »Herr Jesu nimm meinen geist auf!«, dann ist nur noch das Knistern der Flammen zu hören, und der Gestank von verbranntem Fleisch liegt in der Luft. Später am selben Tag vertraut Kaplan Hagendorn seinem Tagebuch voller Mitgefühl an: Aufgrund des eindeutigen Beweises frommer Reue am Ende »zweifle ich auch gar nicht, er seie zwar durch den erschröcklichen und erbärmlichen tod zum ewigen leben hindurch gedrungen und ein kind und erbe des ewigen lebens worden«.2
Ein Ausgestoßener scheidet aus dieser Welt; ein anderer bleibt zurück und fegt die verkohlten Knochen und Glutreste seines Opfers zusammen. Berufsmäßige Mörder wie Frantz Schmidt sind lange gefürchtet, verachtet und sogar bemitleidet worden, doch in den seltensten Fällen sah man nicht nur die Funktionsträger, sondern auch die Menschen und hielt sie der Erinnerung der Nachwelt für würdig. Aber was geht diesem 63-jährigen erfahrenen Scharfrichter durch den Kopf, während er den Stein sauber fegt, von dem noch vor wenigen Minuten die letzten Schreie einer verzweifelten Frömmigkeit durch den dichten Rauch drangen? Ganz gewiss keine Zweifel an der Schuld Lambrechts. Schließlich hatte Frantz Schmidt höchstpersönlich in zwei langen Verhören die Schuld des Angeklagten nachgewiesen, dazu kommen die Aussagen mehrerer Zeugen – ganz zu schweigen von den Fälscherwerkzeugen und anderen unwiderlegbaren Beweisen, die im Haus des Verurteilten gefunden worden sind. Denkt Meister Frantz womöglich über die verpfuschte Strangulierung nach, die ein so peinliches Schauspiel überhaupt erst ermöglicht hat? Ist deshalb seine Berufsehre verletzt, sein Ansehen befleckt? Oder ist er durch fast fünf Jahrzehnte in einem, wie alle meinen, extrem abstoßenden Beruf zur Gefühllosigkeit versteinert?3
Normalerweise wäre die Beantwortung dieser Fragen reine Spekulation, ein Ratespiel ohne jede Aussicht auf eine befriedigende Lösung. Doch in diesem Fall verfügen wir über einen seltenen und entscheidenden Vorteil: Ähnlich wie der bei der Hinrichtung anwesende Kaplan führte auch Meister Frantz ein Tagebuch, in dem er sämtliche Hinrichtungen und anderen Strafen, die er während seiner außerordentlich langen Berufstätigkeit vollstreckte, verzeichnete. Dieses bemerkenswerte Dokument deckt einen Zeitraum von 45 Jahren ab, von Schmidts erster Hinrichtung im Alter von 19 Jahren im Jahr 1573 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 1618. Die grauenvolle Tötung des reuigen Falschmünzers war seine letzte Hinrichtung, der Endpunkt einer Karriere, in der er nach eigener Zählung 394 Menschen tötete und Hunderte auspeitschte und verstümmelte.
Was ging also in Meister Frantzens Kopf vor? Obwohl dieses Tagebuch den deutschen Frühneuzeithistorikern wohl bekannt ist, hat bisher kaum jemand versucht, diese Frage zu beantworten. Seit dem Tod des Verfassers kursierten zwei Jahrhunderte lang mindestens fünf Abschriften des inzwischen verlorenen Originals, 1801 und 1913 erschienen gedruckte Ausgaben und 1928 eine gekürzte englische Übersetzung der Fassung von 1913. Es folgten mehrere Neuauflagen der beiden deutschen Ausgaben.4
In der Ecke für Stadtgeschichte einer Nürnberger Buchhandlung begegnete ich vor einigen Jahren zum ersten Mal dem Tagebuch des Meister Frantz. Dieser Moment war zwar nicht so spektakulär wie, sagen wir, die Entdeckung eines verschollenen Manuskripts in einem versiegelten Gewölbe, das sich erst öffnet, wenn man eine Reihe uralter Rätsel löst, aber für mich war es doch ein Heureka-Erlebnis. Schon die Vorstellung, dass ein Scharfrichter vor vier Jahrhunderten des Lesens und Schreibens mächtig war, noch dazu den Drang verspürte, seine Gedanken und sein Tun in dieser Form zu dokumentieren, faszinierte mich. Wie war es möglich, dass bislang niemand diese bemerkenswerte Quelle dazu genutzt hatte, das Leben dieses Mannes und die Welt, in der er lebte, zu rekonstruieren? Hier, in der hintersten Ecke als antiquarische Kuriosität versteckt, fand sich eine Geschichte, die nur darauf wartete, erzählt zu werden.
Ich kaufte das schmale Bändchen, nahm es mit nach Hause und machte beim Lesen einige Entdeckungen: So hatte Frantz Schmidt keineswegs als einziger Scharfrichter eine Chronik geführt – auch wenn er, sowohl was den Zeitraum als auch was die geschilderten Details betrifft, ein für seine Ära unübertroffenes Werk vorgelegt hat. Im damaligen Deutschland waren die meisten Männer Analphabeten, aber einige Scharfrichter konnten immerhin so gut schreiben, dass sie einfache, formelhafte Hinrichtungslisten führten, von denen einige erhalten sind.5 Zu Beginn der Neuzeit waren Memoiren von Henkern sogar zu einem beliebten Genre geworden; das berühmteste Beispiel sind wohl die Chroniken der Familie Sanson, einer Henker-Dynastie, die von der Mitte des 17. bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts in Paris ansässig war. Gerade in der Zeit, als die Anwendung der Todesstrafe in ganz Europa stark zurückging, wurde eine wahre Flut von Erinnerungen jener »letzten Henker« veröffentlicht, einige dieser Werke wurden sogar zu Bestsellern.6
Deshalb war es mir ein Rätsel, warum die faszinierende Gestalt des Nürnberger Scharfrichters bislang weitgehend unbekannt geblieben war, doch dann entdeckte ich einen zweiten, geradezu beklemmenden Aspekt dieser Chronik. Meister Frantz zieht den Leser zwar mit den Porträts all der Verbrecher, denen er begegnete, in den Bann, aber er hält sich selbst im Hintergrund: ein schattenhafter und schweigsamer Beobachter, ungeachtet seiner zentralen Rolle bei den von ihm beschriebenen Ereignissen. Diese Aufzeichnungen sind nämlich nicht ein privates Tagebuch im heutigen Sinn, sondern die Chronik eines Berufslebens. Die 621 Einträge mit einer Länge von wenigen Zeilen bis hin zu mehreren Seiten sind in chronologischer Reihenfolge geschrieben, unterteilt in zwei Listen: Die erste umfasst alle von Meister Frantz ab dem Jahr 1573 vollstreckten Todesstrafen, die zweite sämtliche körperliche Züchtigungen von 1578 an: Auspeitschen, Brandmarken, Abhacken von Fingern und Abschneiden der Ohren und Zunge. Jeder Eintrag umfasst Name, Beruf und Heimatort des Verurteilten sowie die zur Last gelegten Verbrechen, die Form der Bestrafung und den Ort der Vollstreckung. Je länger er diese Chronik führt, desto mehr gibt Meister Frantz Hintergrundinformationen über die Täter und ihre Opfer preis, nennt Einzelheiten zu den verhandelten Verbrechen sowie frühere Missetaten und beschreibt hier und da die letzten Stunden oder Momente vor einer Hinrichtung etwas ausführlicher. In ein paar Dutzend längeren Einträgen liefert er Zusatzinformationen, die im Zusammenhang mit den fraglichen Verfehlungen stehen, erzählt bestimmte Schlüsselereignisse nach und schmückt sie mit malerischen Beschreibungen, vereinzelt sogar mit kurzen Dialogen aus.
Viele Historiker würden Schmidts Arbeitschronik nicht als ein »Ego-Dokument« bezeichnen, also als eine Quelle wie ein Tagebuch oder persönliche Korrespondenz, die Wissenschaftler nach Hinweisen auf die Gedanken, Gefühle und inneren Kämpfe einer Person untersuchen. Denn diese Chronik enthält weder Schilderungen von Sinnkrisen, die durch lange Foltersitzungen ausgelöst wurden, noch längere philosophische Diskurse über Gerechtigkeit, nicht einmal knappe Spekulationen über den Sinn des Lebens. Genau genommen spricht der Verfasser erstaunlich wenig von sich selbst. In den Einträgen aus mehr als 45 Jahren verwendet Schmidt die Worte »ich« und »mein« lediglich je 15 Mal und nur einmal »mich«. In den meisten Fällen verweisen diese Pronomina auf berufliche Wegmarken (Ist mein erst Gerichten mit dem Schwert gewest), ohne eine Meinung oder Gefühlsregung wiederzugeben; die übrigen tauchen als willkürliche Einschübe auf (den ich vor zwey Jarn mit Ruthen außgestrichen hab).7 Die Wendungen mein Vater und mein Schwager, beideHenkerkollegen, tauchen jeweils drei Mal in einem beruflichen Kontext auf. Weder Schmidts Frau noch seine sieben Kinder geschweige denn Freunde oder Bekannte werden erwähnt – im Grunde keine Überraschung, wenn man bedenkt, worauf das Augenmerk der Chronik liegt. Aber auch Verwandtschaftsbeziehungen zu einem Opfer oder Täter werden verschwiegen, und ebenso wenig wird Zuneigung zu einem Opfer oder Täter bekundet. Dabei kannte der Autor viele Betroffene nachweislich persönlich, nicht zuletzt seinen anderen Schwager, einen berüchtigten Banditen.8 Frantz Schmidt gibt auch keine religiösen Bekenntnisse ab und verwendet nur selten moralisierende Formulierungen. Wie kann ein so bewusst unpersönliches Dokument bedeutsame Einblicke in das Leben und die Denkweise des Verfassers vermitteln? Ich kam zu dem Schluss: Wahrscheinlich hat bislang eben deshalb niemand das Tagebuch des Meister Frantz als biographische Quelle genutzt, weil es ganz einfach zu wenig über Meister Frantz selbst enthält.9
Ich hätte dieses Projekt also gar nicht erst begonnen, wären mir nicht zwei wichtige Durchbrüche gelungen. Einige Jahre nach meiner ersten Begegnung mit Meister Frantz entdeckte ich während anderer Forschungen in der Nürnberger Stadtbibliothek durch Zufall eine ältere und genauere Abschrift dieses Tagebuchs als alle bislang bekannten Versionen. Während die Herausgeber der beiden veröffentlichten Ausgaben Kopien vom Ende des 17. Jahrhunderts heranzogen, die beide zur Erleichterung der Lesbarkeit von barocken Schreibern bearbeitet worden waren, stützt sich dieses biographische Porträt auf eine Abschrift aus dem Jahr 1634, dem Todesjahr von Frantz Schmidt.10 Zum Teil wurde der Text in späteren Fassungen nur geringfügig geändert: Die Schreibweise bestimmter Wörter, die Zählung der Einträge (was die Suche erleichtern sollte), an wenigen Stellen auch Datumsangaben, zudem gibt es kleinere syntaktische Korrekturen und sind in späteren Versionen Satzzeichen eingefügt. (Die Fassung von 1634 enthält keine Satzzeichen, und es ist anzunehmen, dass Schmidt wie die meisten Schreiber mit seinem Bildungshintergrund im Original ebenfalls keine verwendete.) Viele Abweichungen sind jedoch gravierend. In manchen Versionen wurden ganze Sätze ausgelassen und neue Zeilen mit moralisierenden Passagen eingefügt, darüber hinaus etliche Details, welche die Schreiber den Nürnberger Stadtchroniken und Gerichtsprotokollen entnommen hatten. Diese späteren, zusammengestückelten Fassungen steigerten die Attraktivität des Textes für die Nürnberger Bürger des 18. Jahrhunderts, unter denen diese Manuskripte kursierten. Aber gleichzeitig raubten sie dem Tagebuch die Stimme des Meister Frantz und damit auch seine Sicht auf die Dinge. Insbesondere die letzten fünf Jahre weichen in späteren Ausgaben sehr stark von der Fassung von 1634 ab. Manche Einträge werden hier ganz übersprungen und die Namen der meisten Verbrecher sowie nähere Angaben zu ihren Untaten einfach weggelassen. Insgesamt weichen die späteren Fassungen zu mindestens einem Viertel mehr oder weniger stark vom älteren Text ab.
Die bemerkenswerteste – und zugleich aufschlussreichste – Abweichung steht jedoch gleich zu Beginn des Textes. In den 1801 und 1913 veröffentlichten Ausgaben überschreibt Frantz sein Werk mit den Worten: Angefangen zu Bamberg, für meinem Vattern. Anno 1573. In der von mir gefundenen Fassung schreibt der junge Scharfrichter hingegen: Anno Christi 1573. Jahr: Volgt waß Ich für Persohnen für meinen Vatter Heinrich Schmidt zu Bamberg justificiert habe. Dieser Unterschied, der auf den ersten Blick gering scheint, wirft ein Licht auf die zentrale und schwer zu beantwortende Frage: Warum hat Frantz Schmidt dieses Tagebuch überhaupt geführt? Der Wortlaut in den späteren Kopien klingt eher nach einem väterlichen Befehl als nach einer Widmung, als habe Schmidt senior angeordnet, dass sein Sohn nun, da er Geselle war, seinen beruflichen Werdegang im Blick auf künftige Arbeitgeber dokumentieren sollte. In der älteren Version heißt es dagegen nicht, dass der Sohn die Aufzeichnungen für seinen Vater oder auf dessen Wunsch hin begann, sondern dass Frantz im Folgenden die Hinrichtungen verzeichne, die er für seinen Henker-Vater ausgeführt habe, der zudem namentlich genannt wird. Tatsächlich geht aus einem späteren Hinweis in dieser Version hervor, dass das Tagebuch nicht im Jahr 1573, sondern 1578 begonnen wurde, dem Jahr von Schmidts Ernennung zum Scharfrichter in Nürnberg. Im Rückblick kann sich der 24-jährige Frantz jedoch nur noch an die Hinrichtungen aus den vergangenen fünf Jahren erinnern und lässt so gut wie alle Leibesstrafen aus, denn: von 1573 [bis 1578] Jahr an was ich zu Bamberg vericht, Weiss ich nicht mehr.
Diese Entdeckung wirft neue Fragen auf, allen voran: Wenn Frantz Schmidt nicht im Jahr 1573 für seinen Vater zu schreiben anfing, für wen schrieb er dann und aus welchem Grund? Es ist eher unwahrscheinlich, dass er vorhatte, die Arbeitschronik später zu veröffentlichen, insbesondere wegen der Skizzenhaftigkeit der meisten Einträge aus den ersten 20 Jahren. Möglicherweise malte er sich aus, dass sie in Abschriften weitergegeben werde (wie es ja auch kam), aber auch das ändert nichts daran, dass die frühen Jahre längst nicht so detailliert dargestellt werden wie in anderen Chroniken der Stadt und alles in allem eher einer Inventarliste als einem echten literarischen Versuch gleichen. Womöglich war das Tagebuch nie für andere Leser, sondern nur für den Autor gedacht, aber dann stellt sich die Frage, warum er es ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt anfing, nämlich nach seiner Ernennung zum Scharfrichter in Nürnberg im Jahr 1578, und warum er konsequent jede Erwähnung privater Angelegenheiten vermied.
1 Heinrich Sochaczewsky, Der Scharfrichter von Berlin, Berlin 1889, S. 297.
2 JHT, 13. November 1617; siehe auch Theodor Hampe, »Die letzte Amtsverrichtung des Nürnberger Scharfrichters Franz Schmidt«, in: MVGN 26 (1926), S. 321ff.
3 Unter den Historikern des 20. Jahrhunderts reichen die Bezeichnungen für frühneuzeitliche Scharfrichter von »Soziopath« bis hin zu »gefühllos gegenüber den Opfern der Gesellschaft«. Siehe Nowosadtko, S. 352.
4Meister Frantzen Nachrichter alhier in Nürnberg, all sein Richten am Leben, so wohl seine Leibs Straffen, so Er verRicht, alleß hierin Ordentlich beschrieben, aus seinem selbst eigenen Buch abschrieben worden, hg. v. J. M. F. v. Endtner, Nürnberg: J. L. S. Lechner, 1801, Nachdruck: Dortmund: Harenberg, 1980, mit einem Kommentar von Jürgen C. Jacobs und Heinz Rölleke. Maister Franntzn Schmidts Nachrichters inn Nürmberg all sein Richten, hg. v. Albrecht Keller, Leipzig: Heims, 1913, Nachdruck: Neustadt an der Aisch, P. C. W. Schmidt, 1979, mit einer Einführung von Wolfgang Leiser; dessen englische Übersetzung hatte den Titel A Hangman’s Diary, Being the Journal of Master Franz Schmidt, Public Executioner of Nuremberg, 1573–1617, übersetzt von C. V. Calvert und A. W. Gruner, New York: D. Appleton, 1928, Nachdruck: Montclair, NJ: Patterson Smith, 1973.
5 Z. B. die »Tagebücher« des Ansbacher Scharfrichters von 1575–1603 (StaatsAN Rep 132, Nr. 57); in Reutlingen von 1563–1568 (Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte, I [1878], S. 85f.); Andreas Tinel von Ohlau, ca. 1600 (zitiert in: Keller, S. 257); Jacob Steinmayer in Haigerloch, 1764–1781 (Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte, IV [1881], S. 159ff.); Franz Joseph Wohlmuth in Salzburg (Das Salzburger Scharfrichtertagebuch, hg. v. Peter Putzer, Wien 1985); Johann Christian Zippel in Stade (Gisela Wilbertz, »Das Notizbuch des Scharfrichters Johann Christian Zippel in Stade [1766–1782]«, in: Stader Jahrbuch n. s. 65 [1975], S. 59–78). Ein Überblick über die frühneuzeitlichen Scharfrichterverzeichnisse in: Keller, S. 248–260. Allenfalls jeder dritte deutsche Mann konnte bis zu einem gewissen Grad lesen und schreiben. Siehe Hans Jörg Künast, »Getruckt zu Augspurg«:Buchdruck und Buchhandel in Augsburg zwischen 1468 und 1555, Tübingen 1997, S. 11ff.; R. A. Houston, Literacy in Early Modern Europe: Culture and Education, 1500–1800, Harlow 2002, S. 125ff.
6Sept Générations d’Exécuteurs, 1688–1847, mis en ordre, rédigés et publiés par Henri Sanson,6 Bde., Paris 1862f.; in einer gekürzten zweibändigen Ausgabe auf Deutsch erschienen unter dem Titel: Eberhard Wesemann, (Hg.), Tagebücher der Henker von Paris, Henry Sanson, Leipzig 1989. Zwei britische Beispiele für dieses Genre: John Evelyn, Diary of John Evelyn, Bickers and Bush 1879; Stewart P. Evans, Executioner: The Chronicles of James Berry, Victorian Hangman, Stroud 2004.
7 Abgesehen vom Beginn und Ende des Tagebuchs sowie vom Beginn der Amtszeit Schmidts in Nürnberg in folgenden Einträgen: 1573 (2-mal); 1576 (3-mal); 1577 (2-mal); 6. März 1578; 10. April 1578; 21. Juli 1578; 19. März 1579; 26. Januar 1580; 20. Februar 1583; 16. Oktober 1584; 4. August 1586; 4. Juli 1588; 19. April 1591; 11. März 1598; 14. September 1602; 7. Juni 1603; 4. März 1606; 23. Dezember 1606.
8 Friedrich Werner, hingerichtet am 11. Februar 1585. Die einzige Ausnahme ist eine beiläufige Erwähnung von Hans Spiss: so mein gefatter, der wegen Unterstützung eines flüchtigen Mörders alhie mit Ruten außgestrichen durch den Lewen; FST, 7. Juni 1603.
9 Keller behauptet sogar: »und bis zum Ordnen seiner Gedanken ist er [Schmidt] überhaupt nicht gekommen« (S. 252).
10 Die von Endtner herausgegebene Version von 1801 sowie die von Albrecht Keller 1913 herausgegebene Version basieren hauptsächlich auf der Kopie vom Ende des 17. Jahrhunderts im GNM: Bibliothek 2° HS Merkel 32. Eine ältere Abschrift von Endtners veröffentlichter Ausgabe befindet sich im StaatsAN: Rep 25: S II. L25, Nr. 12. Meine Übersetzung sowie der in der deutschen Ausgabe zitierte Wortlaut des FST (das in Kürze erscheinen wird) stützen sich auf die Kopie in der Stadtchronik des Hans Rigel aus dem Jahr 1634 in der StadtBN: 652 2°. Offenbar wurden im späten 17. und 18. Jahrhundert noch weitere Kopien und Fragmente angefertigt, von denen mindestens zwei in der Staatsbibliothek Bamberg (SH MSC Hist. 70 und MSC Hist. 83) und zwei im Germanischen Nationalmuseum GNM (Bibliothek 4° HS 187 514; Archiv, Rst Nürnberg, Gerichtswesen Nr. V1/3) erhalten sind.
Eine Seite aus der Abschrift von 1634, der ältesten überlieferten Fassung des Tagebuchs von Frantz Schmidt, die im Besitz der Nürnberger Stadtbibliothek ist. Die Zählung der Hinrichtungen am linken Rand wurde vermutlich vom Schreiber hinzugefügt.
© Stadtbibliothek Nürnberg (Seite aus Tagebuch)
Der Schlüssel, mit dem ich das Rätsel um Frantz Schmidts Tagebuch schließlich löste, ist ein bewegendes Dokument aus seinen späteren Jahren, das heute im österreichischen Staatsarchiv in Wien aufbewahrt wird. Nachdem er sein Leben lang einen Beruf ausgeübt hatte, der allgemein verachtet und sogar offiziell als »unehrlich« bezeichnet wurde, wandte sich der siebzigjährige pensionierte Scharfrichter mit der Bitte an Kaiser Ferdinand II., den guten Namen seiner Familie wiederherzustellen. Das Gesuch wurde von einem gelernten Notar aufgesetzt und verfasst, aber die darin geäußerten Gefühle sind sehr persönlich, hier und da sogar erstaunlich intim. Der betagte Frantz schildert, wie seine Familie durch ein Unrecht zu diesem anrüchigen Beruf gelangt ist, und berichtet von seinem langjährigen Streben, den eigenen Söhnen dieses Schicksal zu ersparen. Das dreizehnseitige Dokument ist überaus aufschlussreich. Es enthält die Namen mehrerer bekannter Bürger, die Schmidt kurierte, er war nämlich auch als Heiler tätig und erteilte medizinischen Rat – eine unter Henkern häufige Nebentätigkeit, was zunächst überraschen mag. Zudem erfährt das Gesuch enthusiastische Unterstützung seitens des Nürnberger Rates, der vier Jahrzehnte lang Frantzens Arbeitgeber gewesen war. Sein langer Dienst für die Stadt und seine persönliche Lebensführung seien, so erklärten die Ratsmitglieder, »vorbildlich« gewesen, aus diesem Grund baten sie den Kaiser eindringlich, Frantz Schmidts Ehre wiederherzustellen.
War womöglich gar der Nürnberger Rat von Anfang an das gedachte Lesepublikum gewesen, und Schmidts Trachten, seinen guten Namen wiederherzustellen, das Leitmotiv? Möglicherweise war er der erste, aber wohl kaum der letzte deutsche Scharfrichter, der diese Strategie wählte.11 Als ich mir Meister Frantzens Tagebucheinträge mit diesem Motiv im Hinterkopf noch einmal durchlas, entstand vor meinem geistigen Auge allmählich ein denkender und fühlender Verfasser, der nach und nach aus dem Schatten des auf den ersten Blick unpersönlichen Berichts heraustrat. Thematische und sprachliche Muster zeichneten sich ab; Abweichungen und Veränderungen im Stil gewannen an Bedeutung; ein allmählich entstehendes Identitätsgefühl zeigte sich immer stärker. Hier war ein Autor, der nicht das geringste Interesse hatte, sich selbst zu offenbaren, der aber unwillkürlich sein Denken und seine Empfindungen in so gut wie jedem Eintrag enthüllte. Eben jene Subjektivität, die spätere Schreiber durch ihre Bearbeitungen unbeabsichtigt auslöschten, enthüllte die Antipathien, Ängste, Vorurteile und Ideale des Autors. Klar umrissene Auffassungen von Grausamkeit, Gerechtigkeit, Pflicht, Ehre und persönlicher Verantwortung traten hervor und ergaben nach und nach eine kohärente Sicht auf die Welt. Das Tagebuch selbst bekam eine moralische Bedeutung, und allein die Tatsache, dass Frantz dieses Tagebuch führte, zeugt von dem lebenslangen Kampf des Autors um Ehrbarkeit.
Die vielschichtige Persönlichkeit, die nach dieser Lektüre, ergänzt um zahlreiche Archivquellen, greifbar wird, ist alles andere als das Klischee des gefühllosen Brutalos der Trivialliteratur. Vielmehr begegnen wir einem frommen, enthaltsamen Familienmenschen, der nichtsdestotrotz aus der angesehenen Gesellschaft, der er diente, ausgeschlossen war. Er musste einen Großteil seiner Zeit mit verurteilten Verbrechern und den ihm zur Hand gehenden ungehobelten Wachen verbringen.12 Obwohl er im Grunde isoliert war, bewies dieser Scharfrichter ein hohes Maß an sozialer Kompetenz, eine Fähigkeit, die sowohl seinen beruflichen Erfolg ermöglichte als auch die schrittweise Aufhebung des Stigmas, das ihn belastete. Dank des großen zeitlichen Rahmens, den das Tagebuch abdeckt, erleben wir die literarische und philosophische Entwicklung eines minimal gebildeten Autodidakten mit, dessen Einträge von lakonischen Aufzählungen seiner Begegnungen mit Verbrechern bis zu kleinen Geschichten reichen und beredtes Zeugnis von der angeborenen Neugier des Autors – insbesondere in medizinischen Fragen – sowie von seinem moralischen Kosmos geben. Obwohl er selbst unentwegt mit der ganzen Skala menschlicher Grausamkeit konfrontiert war und regelmäßig eigenhändig schreckliche Gewalt ausübte, schwankte dieser offenbar tief religiöse Mann niemals in seinem Glauben an die Vergebung und Erlösung für alle, die danach streben. Zwei treibende Kräfte bestimmten dieses Leben im Beruflichen wie im Privaten: die Verbitterung über vergangenes und gegenwärtiges Unrecht sowie die unerschütterliche Hoffnung auf die Zukunft.
Das aus all diesen Archivfunden hervorgegangene Buch vereint zwei miteinander verflochtene Geschichten. Zum einen erzählt es die Lebensgeschichte des Menschen Frantz Schmidt, angefangen mit der Geburt in eine Henkerfamilie im Jahr 1554, gefolgt von den Lehrjahren an der Seite des Vaters bis zu der nun unabhängig vom Vater unternommenen Wanderschaft als Henkergeselle. Anhand seiner eigenen Äußerungen und einer Schilderung seiner Zeit lernen wir die erforderlichen Fertigkeiten eines professionellen Scharfrichters kennen, seinen unrühmlichen gesellschaftlichen Status und die frühen Bemühungen Frantzens, persönlich voranzukommen. Anschließend lernen wir das Rechtssystem und Sozialstrukturen des frühneuzeitlichen Nürnberg kennen, erfahren Näheres über die unablässigen Versuche des Scharfrichters, sich gesellschaftlich und beruflich zu verbessern, und über seine Vorstellungen von Gerechtigkeit, Ordnung und Ehrbarkeit. Ferner begegnen wir seiner Frau und der wachsenden Familie sowie einem bunten Haufen von Verbrechern und Dienern der Strafverfolgung. Schließlich erleben wir Meister Frantz im späteren Leben zunehmend in zwei immer dominanter werdenden Rollen – der des Moralisten und der des Heilers – und erhalten einen Einblick in das Gefühlsleben dieses berufsmäßigen Folterknechts und Mörders. Seine letzten Jahre werden durch Enttäuschung und eine persönliche Tragödie bittersüß, doch angesichts der Beharrlichkeit seines Strebens nach Ehre reibt man sich immer wieder verwundert und zugleich voller Bewunderung die Augen.
Den Kern dieses Buches bildet jedoch ein zweites Narrativ: nämlich eine Reflexion über die menschliche Natur und den gesellschaftlichen Fortschritt, wenn es so etwas überhaupt gibt. Aufgrund welcher Annahmen und Empfindlichkeiten erschienen die sanktionierten Formen gerichtlicher Gewalt (Folter und Hinrichtungen), die Meister Frantz regelmäßig anwandte, ihm und seinen Zeitgenossen akzeptabel, und warum empfinden wir sie in unserer heutigen Zeit als abstoßend? Wie und warum fassen solche Mentalitäten und sozialen Strukturen Fuß, und wie verändern sie sich? Die Europäer der Frühen Neuzeit hatten mit Sicherheit nicht das Monopol auf menschliche Gewalt oder Grausamkeit, geschweige denn auf individuelle oder kollektive Vergeltung. An der Zahl der Morde gemessen, war die Welt des Frantz Schmidt nicht so gewalttätig wie die seiner mittelalterlichen Ahnen, aber gewalttätiger etwa als die der heutigen Vereinigten Staaten (eine beachtliche Leistung).13 Mit Blick auf die staatliche Gewalt werden andererseits die höheren Hinrichtungszahlen und häufigen militärischen Plünderungen in allen frühneuzeitlichen Gesellschaften von den »totalen Kriegen«, politischen Säuberungen und Völkermorden des 20. Jahrhunderts in den Schatten gestellt. Schon der Umstand, dass in zahlreichen Ländern noch heute gerichtliche Folter ausgeübt wird und öffentliche Hinrichtungen stattfinden, unterstreicht unsere Nähe zu »primitiveren« früheren Gesellschaften und lässt erkennen, wie dünn die Schicht der gesellschaftlichen Zivilisation ist, die uns angeblich von ihnen trennt. Ist die Todesstrafe wirklich auf dem Weg, weltweit verboten zu werden, oder ist der menschliche Drang nach Vergeltung zu tief in jeder Faser unseres Körpers verwurzelt?
Das einzige absolut zuverlässige Porträt von Frantz Schmidt, das uns überliefert ist, wurde von einem Nürnberger Gerichtsnotar mit künstlerischen Ambitionen auf den Rand eines Bandes über Todesurteile gezeichnet. Zum Zeitpunkt dieses Ereignisses, der Enthauptung des Hans Fröschel am 18. Mai 1591, war Meister Frantz etwa 37 Jahre alt.
© Staatsarchiv Nürnberg (Skizze von Frantz Schmidt)
Was ging in Meister Frantzens Kopf vor? Was immer wir herausfinden, der brave Scharfrichter von Nürnberg wird immer eine zugleich fremde und vertraute Figur bleiben. Es ist schon schwer genug, uns selbst und die uns nahestehenden Menschen zu verstehen, geschweige denn einen Berufskiller aus einer fernen Zeit und einem fremden Ort. Wie in allen Lebensgeschichten lassen sein Tagebuch und die anderen historischen Quellen unweigerlich viele Fragen unbeantwortet – einige sind vermutlich generell nicht zu beantworten. Und auf der einzigen zeitgenössischen Zeichnung von Schmidt, die als zuverlässig gelten kann, steht der treue Henker vom Betrachter – wie könnte es anders sein – abgewandt. Der Versuch, Frantz Schmidt und seine Welt zu begreifen, führt jedoch zu einem höheren Maß an Selbsterkenntnis und Empathie, als man bei der Beschäftigung mit einem berufsmäßigen Folterknecht und Henker erwarten sollte. Die Geschichte von Meister Frantz aus Nürnberg ist in vieler Hinsicht eine fesselnde Geschichte aus einer fernen Zeit, aber sie ist auch eine Geschichte für unsere Zeit und unsere Welt.
11 Dieses Motiv wird von Leiser in seiner Einführung zu Keller (Maister Franntzn Schmidts Nachrichters, Einführung, S. Xff.) und von Nowosadtko (»Und nun alter Franz«, S. 236) angedeutet, aber keiner der beiden untersucht, welche Folgen dies für das Leben des Autors hatte.
12 Anhand der Heirats-, Geburts- und Sterberegister im LKAN ist es mir gelungen, die Rahmendaten der Herkunft Schmidts und seines Familienlebens zu rekonstruieren. Verhörprotokolle und andere Gerichtsunterlagen, die in erster Linie im Staatsarchiv Nürnberg aufbewahrt werden, haben die Angaben zu seiner beruflichen Tätigkeit maßgeblich ergänzt. Beschlüsse des Nürnberger Rates, die sogenannten Ratsverlässe, erwiesen sich als äußerst reiche Quelle in mehrfacher Hinsicht und lieferten eine Fülle aufschlussreicher Informationen über beide Aspekte seines Lebens. Die Beschlüsse erhellten auch seine Tätigkeit als Heiler, insbesondere in den Jahren nach seiner Pensionierung (die im Tagebuch nur nebenbei erwähnt wird). Schließlich verdanke ich viele Erkenntnisse den wertvollen biographischen Informationen, die andere Historiker zusammengetragen haben, insbesondere Albrecht Keller, Wolfgang Leiser, Jürgen C. Jacobs und Ilse Schumann.
13 Einen hilfreichen Überblick über Gewalt in der damaligen Zeit bietet Julius R. Ruff, Violence in Early Modern Europe, 1500–1800, Cambridge 2001.
KAPITEL 1DER LEHRLING
Wer demnach seinen Sohn nicht alsbald in den besten Lehrgegenständen unterweisen lässt, der ist selbst kein Mensch, und kein Sohn eines Menschen.
ERASMUS VON ROTTERDAM,Über die Notwendigkeit einer frühzeitigen wissenschaftlichen Unterweisung der Knaben (1529)14
Wert und Würde eines Menschen werden von seinem Mut und seiner Willenskraft bestimmt; hierauf allein beruht seine wahre Ehre.
MICHEL DE MONTAIGNE,Über die Menschenfresser (1580)15
Die Nachbarn in Bamberg hatten sich mittlerweile an das wöchentliche Ritual gewöhnt, das sich im Hinterhof des Hauses von Meister Heinrich Schmidt abspielte, und gingen ohne sonderliches Interesse weiter ihren Geschäften nach. Die meisten verstanden sich recht gut mit Schmidt, dem neuen Scharfrichter des Fürstbischofs, hüteten sich aber, ihn oder seine Familienangehörigen in ihr Haus einzuladen. Sein Sohn Frantz, dem er sich an jenem Maitag im Jahre 1573 ganz widmete, war allem Anschein nach ein höflicher und – wenn man das von dem Sprössling eines Henkers sagen konnte – wohlerzogener junger Mann von 19 Jahren. Wie damals üblich erlernte er das gleiche Handwerk wie sein Vater und hatte diesen Berufsweg bereits im Alter von elf oder zwölf Jahren angetreten. Geboren und aufgewachsen war Frantz in der fränkischen Provinzstadt Hof. Seit die Familie vor acht Monaten nach Bamberg umgezogen war, hatte er den Vater zu mehreren Hinrichtungen in der Stadt und benachbarten Dörfern begleitet, dessen Technik studiert und ihm gelegentlich assistiert. Mit zunehmendem Alter hatte er immer verantwortungsvollere Pflichten übernommen und schulte seine Fertigkeiten. Sein Ziel war es, genau wie der Vater ein Meister in der Praxis der sonderen Befragung, also der Folter zu werden sowie in der Kunst, eine verurteilte Seele auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise ins Jenseits zu befördern – angefangen mit der gewöhnlichen Hinrichtung durch den Strick über die seltener angewandten Formen des Verbrennens oder Ertränkens bis hin zum berüchtigten und außerordentlich seltenen Vierteilen.
An diesem Tag prüfte Meister Heinrich seinen Sohn in der schwierigsten – und zugleich ehrenhaftesten – Form der Hinrichtung: dem Tod durch das Schwert. Erst im vergangenen Jahr hatte der Vater Frantz für fähig und würdig befunden, das vielgepriesene Richtschwert zu schwingen, eine hervorragend gearbeitete, sieben Pfund schwere gravierte Waffe, die meist an einem Ehrenplatz über dem Kamin hing. Sie hatten ihre Übungen vor Monaten mit Kürbissen begonnen, ehe sie zu kräftigen Rhabarberstängeln übergingen, die der Konsistenz eines menschlichen Nackens näherkommen. Frantzens erste Versuche waren unbeholfen und brachten gelegentlich sogar ihn und den Vater, der den »armen Sünder« festhielt, in Gefahr. Im Lauf der Zeit wurden seine Bewegungen jedoch geschmeidiger, und seine Treffsicherheit nahm deutlich zu. Meister Heinrich hielt deshalb die Zeit für gekommen, zur nächsten Schwierigkeitsstufe überzugehen: zu Ziegen, Schweinen und anderem »gefühllosen« Vieh.
Der Hofer Hundschlager, der Schmidt unterstellt war, hatte auf seine Bitte hin einige streunende Hunde gefangen und sie in klapprigen Holzkäfigen zum Haus des Henkers im Stadtzentrum gebracht. Schmidt zahlte ihm einen kleinen Lohn für den Gefallen und brachte die Tiere in den geschlossenen Hof hinter dem Haus, wo sein Sohn bereits wartete. Obwohl ihm nur sein Vater zuschaute, war Frantz sichtlich nervös. Denn anders als Hunde bewegen sich Kürbisse nicht, und selbst Schweine leisten kaum Widerstand. Ihm zu unterstellen, er habe Unwillen empfunden, »unschuldige« Haustiere zu töten, wäre sicherlich eine anachronistische Projektion.16 Frantz dachte wohl vor allem daran, dass er mit einer erfolgreichen Enthauptung dieser Hunde – jeweils mit einem einzigen kräftigen Schlag – den letzten Schritt seiner Ausbildung absolvierte. Diese Übung war also ein deutliches väterliches Zeichen der Anerkennung seiner Fertigkeiten und bedeutete ihm, dass es Zeit war, als wandernder Scharfrichtergeselle in die weite Welt zu ziehen. Meister Heinrich übernahm auch an diesem Tag die Rolle des Gehilfen; mit festem Griff hielt er den ersten Hund, der heftig zappelte, während Frantz das Schwert fester packte.17
EINE GEFÄHRLICHE WELT
Furcht und Angst gehören untrennbar zur menschlichen Existenz. Wenn man so will, sind wir Menschen durch diese Grundkonstante über die Jahrhunderte hinweg miteinander verbunden. Die Welt Heinrich Schmidts und seines Sohnes Frantz zeichnete sich jedoch durch eine weit höhere individuelle Verwundbarkeit aus, als Angehörige moderner westlicher Gesellschaften für erträglich halten. Feindliche Kräfte natürlicher und übernatürlicher Art, rätselhafte, oft tödliche Seuchen, gewalttätige und böse Mitmenschen, fahrlässig verursachte oder vorsätzlich gelegte Brände – all diese Gefahren prägten die Vorstellungswelt und den Alltag der Menschen in der Frühen Neuzeit. Das daraus erwachsene Klima der Unsicherheit genügt zwar nicht, um die gängige Grausamkeit der frühneuzeitlichen Gerichtsbarkeit zu erklären, aber mit dem Wissen um diese Fragilität der Verhältnisse im Hinterkopf können wir besser nachvollziehen, warum die Zeitgenossen Vollstrecker der Gerichtsbarkeit wie die Schmidts zugleich voller Dankbarkeit und mit Abscheu betrachteten.18
Von Anfang an war das Leben bedroht. Da war zunächst die hohe Zahl an Fehl- und Totgeburten, es traf mindestens jeden dritten Fötus. Und als Frantz Schmidt das Licht der Welt erblickte, standen seine Chancen, das zwölfte Lebensjahr zu erreichen, lediglich 50 : 50. (Die Geburt eines Kindes brachte auch die Mutter in Lebensgefahr: Jede zwanzigste Frau starb in den ersten sieben Wochen nach der Entbindung – eine deutlich höhere Quote als in den ärmsten Ländern unserer Tage.) Die ersten beiden Jahre waren die gefährlichsten für ein Kind, weil häufig auftretende Seuchen wie Pocken, Typhus und Ruhr für kleine Kinder besonders oft tödlich waren. Die meisten Eltern erlebten den Verlust mindestens eines Kindes und die meisten Kinder den Tod eines Bruders, einer Schwester oder mindestens eines Elternteils.19
Zu den häufigen Ursachen eines frühen Todes zählte die Ansteckung mit einer der unzähligen Seuchen, die in den Städten und Dörfern Europas grassierten. Die meisten Menschen, die das 50. Lebensjahr erreichten, hatten vermutlich ein gutes halbes Dutzend solcher verheerenden Seuchen überlebt. Große Städte wie Nürnberg oder Augsburg verloren innerhalb der ein bis zwei Jahre, die eine besonders schwere Epidemie wütete, oft ein Drittel bis die Hälfte der gesamten Bevölkerung. Die am meisten gefürchtete, wenn auch nicht immer tödliche Seuche war die Pest. Zu Lebzeiten Frantz Schmidts brach sie besonders häufig in Mitteleuropa aus – häufiger als zu jeder anderen Zeit und an jedem anderen Ort in der europäischen Geschichte seit dem ersten Auftauchen des Schwarzen Todes Mitte des 14. Jahrhunderts. Und niemand konnte sagen, wann die nächste Epidemie ausbrechen und wie viele Opfer sie fordern würde.20 All die einzelnen traumatischen Erinnerungen und Erlebnisse ließen eine allgemeine Angst vor jeglicher Form der Ansteckung entstehen, die wiederum die Anfälligkeit des menschlichen Lebens und das Ausmaß der individuellen Verwundbarkeit unterstrich.
Ebenfalls häufig und in kaum vorhersagbaren Abständen traten Überschwemmungen, Missernten und Hungersnöte auf. Die Schmidts hatten das Pech, ausgerechnet in den kältesten Jahren der Ära zu leben, die die Kleine Eiszeit (um 1400–1700) genannt wird. Ein weltweites Absinken der Temperaturen hatte längere, strengere Winter und kühlere, nassere Sommer zur Folge, vor allem in Nord- und Mitteleuropa. Zu Lebzeiten Frantz Schmidts sah seine Heimat Franken deutlich mehr Schnee und Regen als in den vorangegangenen Jahren, überflutete Felder und verrottete Ernten waren die Folge. In manchen Jahren reichte die Zahl der Sonnentage nicht einmal für die Traubenreife, sodass man nur sauren Wein gewinnen konnte. Die Ernteerträge waren erbärmlich gering, was Hungersnöte nach sich zog. Nicht nur Menschen und Vieh starben an Seuchen und Hunger. Selbst die Zahl der Wildtiere ging dramatisch zurück, weshalb hungrige Wolfsrudel sich zunehmend auch menschliche Opfer suchten. Der Mangel an Lebensmitteln ließ die Preise in die Höhe schnellen, sodass sich auch gesetzestreue Bürger zu Wilderei und anderem Diebstahl verleiten ließen, um sich und ihre Familie zu ernähren.21
Doch nicht nur Naturkräfte, über die sie keine Macht hatten, plagten die Menschen. Sie mussten zudem die Gewalt anderer Menschen erdulden, insbesondere der scheinbar allgegenwärtigen Räuber, Söldner und Gesetzlosen, die ungehindert durch die Lande streiften. Territorien wie das Fürstbistum Bamberg und die Reichsstadt Nürnberg bestanden zum überwiegenden Teil aus unberührten Wäldern und offenen Wiesen, hier und da ein Dorf, ein paar kleine Städte mit ein- oder zweitausend Einwohnern und eine vergleichsweise große Metropole. Ohne den Schutz der Stadtmauern oder besorgter Nachbarn war ein isoliertes Bauernhaus oder eine Mühle ein paar kräftigen, bewaffneten Männern auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Selbst stark bereiste Wege und Landstraßen lagen häufig weitab von jeder Hilfe. Die Straßen und Wälder unmittelbar um eine Stadt sowie sämtliche Grenzregionen waren besonders gefährlich. Ein Reisender konnte hier ohne Weiteres Räuberbanden zum Opfer fallen, die von üblen Vogelfreien wie Cunz Schott angeführt wurden. Jener Schott verprügelte und beraubte seine zahllosen Opfer nicht nur, sondern betrieb zudem den makabren Sport, die Hände von Bürgern der Stadt zu sammeln, die er sich zum Feind erklärt hatte: Nürnberg.22
Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war in Wirklichkeit, wie Voltaire später spottete, weder heilig noch römisch noch ein Reich. Die Zuständigkeit für Recht und Ordnung war vielmehr verteilt auf die mehr als 300 Mitglieder, deren Größe von der Burg eines Freiherrn und den umliegenden Dörfern bis hin zu großen Fürstentümern wie Kursachsen oder dem Herzogtum Bayern reichte. Die gut 70 Reichsstädte, darunter Nürnberg und Augsburg, fungierten als quasi autonome Einheiten, manche Äbte und Bischöfe, auch der Fürstbischof von Bamberg, übten schon seit Langem neben der kirchlichen auch die weltliche Gerichtsbarkeit aus. Der Kaiser und seine alljährlich in einer der Reichsstädte abgehaltene Ständeversammlung, der Reichstag, verkörperten gewissermaßen das Reich und genossen in allen deutschen Landen eine symbolische Autorität, waren jedoch weitgehend machtlos, wenn es um die Verhinderung oder Beilegung von Fehden und kriegerischen Konflikten ging, die regelmäßig unter den Mitgliedstaaten ausbrachen.
Nur zwei Generationen vor Frantz Schmidts Geburt hatte der Reformkaiser Maximilian I. (reg. 1486–1519) selbst indirekt das gewaltsame Chaos eingeräumt, das im gesamten Reich herrschte, als er in seinem »Ewigen Landfrieden« von 1495 kundtat:
Also das von Zeit diser Verkündung niemand, von was Wirden, Stats oder Wesens der sey, den andern bevechden, bekriegen, berauben, vahen, überziehen, belegern, auch dartzu durch sich selbs oder yemand anders von seinen wegen nicht dienen, noch auch ainich Schloß, Stet, Märckt, Bevestigung, Dörffer, Höff oder Weyler absteigen oder on des andern Willen mit gewaltiger Tat frevenlich einnemen oder gevarlich mit Brand oder in ander Weg dermassen beschedigen sol …23
Damals hatten insbesondere fehdeführende Adlige und ihr Gefolge für instabile Verhältnisse gesorgt, denn sie überfielen häufig ihre Widersacher – und brannten auf diesen Raubzügen auch Haus und Hof unbeteiligter Landbewohner nieder. Damit nicht genug: Manche Adlige betrieben als Raubritter auf eigene Faust ein auf Raub, Entführung und Erpressung gestütztes Geschäft, das wir heute als organisierte Kriminalität bezeichnen würden. Damals nannte man das Plackerei – eine weitere Gefahr für Dorfbewohner und Reisende.
Eine Zeichnung von Nürnberg aus dem frühen 16. Jahrhundert unterschlägt die armen Siedlungen außerhalb der Stadtmauern, gibt aber trefflich den Festungscharakter der Stadt wieder, die Schutz vor den unzähligen Gefahren der umliegenden Wälder versprach (1516).
© Museen der Stadt Nürnberg (Nürnberg mit Umgebung)
Zu Frantz Schmidts Lebzeiten hatten diese Dauerfehden zwischen Adelsfamilien weitgehend aufgehört, was ebenso auf die stärkere wirtschaftliche Einbindung des Adels wie auf den Machtzuwachs der Territorialfürsten zurückzuführen war.24 Nachdem diese ihre Kontrolle über entstehende Flächenstaaten wie das Herzogtum Württemberg oder das Kurfürstentum Brandenburg gefestigt hatten, schickten sie sich allerdings an, noch mehr Land zu erobern, und verwendeten einen großen Teil ihres Vermögens darauf, große Söldnerheere aufzustellen. Dieser Kriegsdurst fiel in eine Zeit des wirtschaftlichen Niedergangs mit einer außerordentlich langen Phase der Inflation und hoher Arbeitslosigkeit, die einfachen Leuten vom Kriegsdienst abgesehen oft keine Aussicht auf Beschäftigung bot. Die Historiker sprechen deshalb auch vom langen 16. Jahrhundert (um 1480–1620). In der Frühen Neuzeit wuchs die Zahl der Söldner um das Zwölffache. Land und Leute waren nun allerorten einer furchterregenden neuen Gefahr für die persönliche Sicherheit und den Besitz ausgesetzt: den ebenso berüchtigten wie verachteten Landsknechten.
Ein deutscher Landsknecht (um 1550).
Ein Zeitgenosse charakterisierte diesen Menschenschlag als raubendes, mordendes, saufendes und die Frauen schändendes seelenloses Gesindel ohne Gnade:
ein newer orden der seelossen leuth, genant die Landsknecht welche on alles auffsehen auf ehre oder billigkeit, luffent on die ort, do sie hoffen gut zu uberkommen, geben sich mutwilliglich in geferligkeit yrer selen, und unzucht in schetten, schweren, schandworten, fluchen et., ya in hurerey, ehebruch, jungfrawschendung, fullerey, zusauffen, ya zu gantz vihischen sachen, stelen, rauben, moerden ist bey ynen wie teglich brot, … Kurtz, sie stehen ganz gebunden in gewalt des teuffels, der zeucht sie wohin er will.
Sogar Kaiser Karl V. (reg. 1519–1556), dessen Macht sich nicht unwesentlich auf solche Männer stützte, räumte die »unmenschlich tiranney« der umherziehenden Banden von Landsknechten ein, die er gar für »lesterlicher und grawsamer als die Turcken« hielt.25 Sobald die Söldner angeheuert hatten, verbrachten sie ihre Zeit damit, in Lagern herumzulungern und gelegentlich das Hinterland ihres vertragsmäßigen Gegners zu plündern. Nüchtern berichtet Grimmelshausen in seinem berühmten, 1668 erschienenen Roman Simplicissimus von solchen Gewalttaten:
denn obzwar etliche anfingen zu metzgen, zu sieden und zu braten, daß es sah, als sollte ein lustig Bankett gehalten werden, so waren hingegen andere, die durchstürmten das Haus unten und oben, ja das heimlich Gemach war nicht sicher, gleichsam ob wäre das gülden Fell von Kolchis darinnen verborgen; Andere machten von Tuch, Kleidungen und allerlei Hausrat große Päck zusammen, als ob sie irgends ein Krempelmarkt anrichten wollten, was sie aber nicht mit zu nehmen gedachten, wurde zerschlagen, etliche durchstachen Heu und Stroh mit ihren Degen, als ob sie nicht Schaf und Schwein genug zu stechen gehabt hätten, etliche schütteten die Federn aus den Betten und fülleten hingegen Speck, andere dürr Fleisch und sonst Gerät hinein, als ob alsdann besser darauff zu schlafen gewesen wäre; Andere schlugen Ofen und Fenster ein, gleichsam als hätten sie ein ewigen Sommer zu verkündigen, Kupfer und Zinnengeschirr schlugen sie zusammen, und packten die gebogenen und verderbten Stück ein, Bettladen, Tisch, Stühl und Bänk verbrannten sie, da doch viel Klafter dürr Holz im Hof lag, Hafen und Schüsseln musste endlich alles entzwei, entweder weil sie lieber Gebraten aßen, oder weil sie bedacht waren, nur ein einzige Mahlzeit allda zu halten; unser Magd ward im Stall dermaßen traktiert, daß sie nicht mehr daraus gehen konnte, welches zwar ein Schand ist zu melden! Den Knecht legten sie gebunden auff die Erd, stecketen ihm ein Sperrholz ins Maul und schütteten ihm einen Melkkübel voll garstig Mistlachenwasser in Leib, das nenneten sie ein Schwedischen Trunk … Da fing man erst an, die Stein von den Pistolen und hingegen an deren statt der Bauren Daumen aufzuschrauben, und die arme Schelmen so zu foltern, als wenn man hätt Hexen brennen wollen.26
In Friedenszeiten war die Lage nicht viel besser. Wenn sie keine Arbeit hatten oder schlicht keinen Sold bekamen (was häufig der Fall war), zogen Gruppen dieser meist jungen Männer auf der Suche nach Essen, Trinken und Frauen (nicht unbedingt in dieser Reihenfolge) durchs Land. Diesen marodierenden Landsknechten schlossen sich häufig flüchtige Diener und Lehrlinge, Schuldner, die ihre Frauen im Stich gelassen hatten, verbannte Verbrecher und andere Herumtreiber an. Diese »starken Bettler« lebten in erster Linie von Bettelei und kleineren Diebstählen. Manche wurden jedoch auch handgreiflich und terrorisierten Bauern, Dorfbewohner und Reisende mit der gleichen Plackerei wie Raubritter und berufsmäßige Räuber. Für die Opfer spielte die Unterscheidung zwischen Vollzeit- und Nebenerwerbsbanditen keine Rolle. So berichtet Frantz Schmidt im Februar 1596 von zwei berufsmäßigen Dieben, die von ihm aus der Stadt gepeitscht wurden. Die beiden hatten zusammen mit ihren Kumpanen, einigen bettelnden Söldnern, uff dreyen Müllen garttet [gebettelt] die leuth genötigt ihnen zu geben … hacken und büchsen genomen.27
Ein einsamer Hausierer gerät in einen Hinterhalt von Straßenräubern; Detail aus einem Landschaftsgemälde von Lucas I. van Valckenborch (um 1585).
© Kunsthistorisches Museum Wien (Hinterhalt für einen Hausierer)
Von all den Verbrechen, die mit Räuberbanden und anderem umherstreifendem Gesindel in Verbindung gebracht wurden, fürchtete die Landbevölkerung eines am meisten: Brandstiftung. In einer Zeit lange vor der Gründung von Feuerwehren und Gebäudeversicherungen brachte allein das Wort die Gemüter in Wallung. Schon eine Fackel konnte, geschickt platziert, einen Bauernhof oder gar ein ganzes Dorf in Schutt und Asche legen und die wohlhabenden Bewohner binnen weniger als einer Stunde zu obdachlosen Bettlern machen. Tatsächlich wurde schon die Androhung, jemandem das Haus oder die Scheune anzuzünden, als gleichbedeutend mit der Tat selbst angesehen. Deshalb stand auch die gleiche Strafe darauf: Tod durch Verbrennen bei lebendigem Leib auf dem Scheiterhaufen. Mordbrenner genannte Banden erpressten von Bauern und Dorfbewohnern durch die Androhung von Bränden beträchtliche Lösegelder und machten dieses heimtückische Verbrechen zu ihrem einträglichen Geschäft.28 Die Angst vor solchen Mordbrennern war auf dem Land weit verbreitet, doch die meisten Brandstiftungen gingen zurück auf die grassierenden Privatfehden oder waren Racheakte, denen gelegentlich das Warnzeichen eines auf die Wand gemalten roten Hahns oder des an die Tür genagelten Brandbriefs vorausgegangen war. Die Brandbekämpfung hatte in den meisten Städten seit dem Mittelalter kaum Fortschritte gemacht, Wohngebäude und Scheunen auf dem Land waren ohnehin noch völlig ungeschützt. Nur die reichsten Kaufleute konnten sich eine Versicherung leisten, und selbst diese deckte für gewöhnlich nur die Handelswaren ab. Ganz gleich ob ein Gebäudebrand natürliche Ursachen hatte oder von Menschenhand entfacht worden war, er trieb so gut wie jeden Haushalt in den Ruin.
Neben den genannten Gefahren fürchteten die Menschen jener Zeit ein weiteres, unsichtbares, potenziell überall lauerndes Unheil: das Gewimmel von Geistern, Feen, Werwölfen, Dämonen und anderen übernatürlichen Angreifern, die den alten Überlieferungen zufolge auf Feldern, in Wäldern, an Wegen und in Feuerstätten hausen. Kirchliche Reformer aller Konfessionen versuchten vergebens, solche uralten Vorstellungen auszurotten; zur gleichen Zeit schürten sie jedoch eine Angst viel größeren Ausmaßes vor der in ihren Augen wahren Gefahr durch übersinnliche Kräfte, indem sie lautstark und in den düstersten Farben vor einer satanischen Verschwörung warnten. Das Schreckgespenst der Hexerei schwebte zu Frantz Schmidts Lebzeiten drohend über allem und führte zu den tragischen Konsequenzen im wirklichen Leben vieler Menschen, die man heutzutage als den europäischen Hexenwahn bezeichnet. In den Jahren von 1550 bis 1650 wurden mindestens 60000 Menschen wegen Hexerei hingerichtet.
Wohin sollte man sich in diesem irdischen Jammertal wenden, um Schutz und Trost zu finden? Familie und Freunde, die übliche Zuflucht vor den Grausamkeiten der Welt, mochten einem Einzelnen helfen, mit einem Unglück fertigzuwerden, konnten aber bei der Vorbeugung kaum helfen. Wundheiler, Bader, Apotheker und Hebammen vermochten hier und da Schmerzen zu lindern und Wunden zu heilen, aber sie waren gegen schwere Krankheiten und die meisten Gefahren der Geburt machtlos. Ärzte, die heutzutage wichtigsten medizinischen Ratgeber, waren selten, teuer und in ihren Fertigkeiten durch die begrenzten medizinischen Kenntnisse jener Zeit stark eingeschränkt. Sterndeuter und andere Wahrsager mochten beunruhigten Seelen ein gewisses Gefühl der Kontrolle und sogar des Schutzes der Vorsehung vermitteln, aber auch sie konnten nichts gegen die konkret drohenden Gefahren ausrichten.
Religion, eine der wichtigsten geistigen Ressourcen jener Zeit, bot Erklärungen für ein Unglück an, ja gelegentlich sogar vermeintliche vorbeugende Maßnahmen. Martin Luther und andere protestantische Geistliche lehnten von den 1520er-Jahren an jegliche Verwendung »abergläubischer« Schutzrituale ab, verstärkten aber den allgemeinen Glauben an ein moralisches Universum, in dem nichts zufällig geschieht. Naturkatastrophen und Seuchen wurden als Zeichen göttlichen Missfallens oder Zorns gedeutet, auch wenn die Ursache dieses Zorns nicht immer ersichtlich war. Manche Theologen und Chronisten erkannten in einer bestimmten ungesühnten Freveltat, Inzest etwa oder Kindsmord, den Katalysator des Unheils. Allgemein wurde kollektives Leid als ein göttlicher Aufruf zur Reue interpretiert. Martin Luther, Johannes Calvin und viele andere Protestanten lebten weiter in der apokalyptischen Erwartung, die letzten Tage der Menschheit seien angebrochen; sie rechneten folglich damit, dass die Mühsal dieser Welt schon bald ein Ende haben werde. Der Teufel und seine Diener waren weiterhin ein ebenso selbstverständlicher wie wesentlicher Bestandteil aller Versuche, Katastrophen zu erklären. Die Palette reichte von Behauptungen, Hexen hätten Hagelstürme heraufbeschworen, bis hin zu Geschichten über Dämonen, die Verbrechern übernatürliche Kräfte verliehen hätten.
Die am häufigsten angewandte Präventivmaßnahme gegen die verschiedenen »Todesengel« war ganz einfach das Gebet. Seit Jahrhunderten stimmten Christen es gemeinsam an: »Vor Pest, Hunger und Krieg bewahre uns, oh Herr!«29 Bittgebete an Jesus Christus, die Jungfrau Maria oder einen gegen eine bestimmte Gefahr helfenden Schutzheiligen blieben im späten 16. Jahrhundert auch unter Protestanten weit verbreitet, die offiziell jede übernatürliche Fürsprache außer der von Christus ablehnten. Viele Gläubige schützten sich zusätzlich mit Talismanen wie Schmuckstücken, Kristallen oder Holzarbeiten vor natürlichen und übernatürlichen Gefahren. Das Gleiche galt für religiöse Dinge, die den Katholiken als Sakramentalien galten: Weihwasser, geweihte Hostien, Heiligenmedaillons, gesegnete Kerzen oder Glocken und die angeblich heiligen Reliquien, etwa ein Knochensplitter oder Körperteil eines Heiligen. Andere eindeutig für magisch erklärte Sprüche, Pulver oder Tränke (teils förmlich verordnet) versprachen Genesung von Krankheiten oder Schutz vor Feinden. Wenn Trost und Beruhigung die obersten Ziele waren, dürfen wir die Wirksamkeit derartiger Maßnahmen nicht so ohne Weiteres leugnen. Auch der Glaube an ein Leben nach dem Tod, in dem die Leidenden und Tugendhaften belohnt, die Bösen hingegen bestraft werden, mag viele getröstet haben, doch selbst der stärkste persönliche Glaube konnte keine Katastrophe verhindern oder abwenden.
Angesichts all dieser Gefahren sehnten sich Frantz Schmidt und seine Zeitgenossen verzweifelt nach einem Gefühl der Sicherheit und Ordnung. Weltliche Obrigkeiten, vom Kaiser über die Territorialfürsten bis hin zu den Stadtherren, teilten allesamt diese Sehnsucht und waren auch zu handeln bereit. Dieser Paternalismus war alles andere als altruistisch – da jedes Mehr an Sicherheit immer auch eine Ausweitung ihrer eigenen Autorität mit sich brachte –, doch die Sorge um die öffentliche Sicherheit und das allgemeine Wohl war in den meisten Fällen echt. Anstrengungen der Obrigkeit, die Folgen von Erdbeben, Überschwemmungen, Hungersnöten und Seuchen zu lindern, haben die Lage der Opfer womöglich erleichtert. Doch selbst die ehrgeizigsten Verbesserungen der öffentlichen Hygiene zeigten vor der Neuzeit nur eine geringe Wirkung. Die Quarantäne, die manche Regierungen nach dem Ausbruch von Seuchen verhängten, hemmte zwar die Ausbreitung der Krankheit ein wenig, genau wie eine besser geregelte Müllentsorgung, aber die Flucht aus städtischen Regionen während des Ausbruchs einer Epidemie war für alle, die es sich leisten konnten, immer noch die wirksamste Methode, sich zu schützen.
Dagegen bot die Strafverfolgung eine im wörtlichen Sinne schlagende Gelegenheit, die Fähigkeit der Regierung unter Beweis zu stellen, die Gewalt in Schach zu halten und den Untertanen ein gewisses Maß an Sicherheit zu bieten. Überdies fand hartes Durchgreifen gegen Gewalttäter im Volk große Zustimmung und sicherte damit die Macht der Obrigkeit. Frantz Schmidt und seine Zeitgenossen nahmen gegenüber der Gewalt in ihrem Umfeld eine paradoxe Haltung ein. Einerseits neigen Menschen, die regelmäßig von Naturkatastrophen und Krankheiten heimgesucht werden, dazu, die Gewalt ihrer Mitmenschen mit einem ähnlichen Fatalismus zu betrachten. Andererseits steigerten die höheren Ansprüche der Obrigkeit, die Gewalt einzudämmen – oder zumindest drakonisch zu bestrafen –, die Erwartungen und Hoffnungen des Volkes. Als Gerichtsherren die Bevölkerung dazu aufforderten, auf private Vergeltung zu verzichten und sich an die zuständigen Gerichte und Amtsträger zu wenden, waren diese kaum auf die Flut von Petitionen und Klagen vorbereitet, die über die Amtsstuben hereinbrach. Die Gesuche reichten von Beschwerden über den Straßenzustand und die Mülleinsammlung über Bitten, dem öffentlichen Ärgernis der aggressiven Bettler und wilden Straßenkinder ein Ende zu bereiten, bis hin zu Anzeigen unziemlicher oder krimineller Tätigkeiten von Nachbarn. Für ihr Streben nach Herrschaftssicherung mussten die ehrgeizigen Landesherren den hohen Preis zahlen, ihre Untertanen anzuhören, und den Beweis erbringen, dass ihren Worten auch Taten folgten.
Der ausgebildete Scharfrichter war also ein absolut unentbehrliches Mittel der herrschenden Obrigkeit, die Angst ihrer Untertanen vor gesetzlosen Überfällen zu lindern. Mit seiner Hilfe konnten die Herrschenden in einer von Gewalt und Rechtsunsicherheit geprägten Gesellschaft, in der die große Mehrheit der schweren Straftäter niemals zur Verantwortung gezogen wurde, zumindest bis zu einem gewissen Grad Gerechtigkeit schaffen. Die ritualisierte Gewalt, die der Scharfrichter im Namen der Gemeinschaft ausübte, rächte erstens die Opfer, setzte zweitens der Gefahr ein Ende, die von dem betreffenden Verbrecher ausging, statuierte drittens ein abschreckendes Exempel und verhinderte viertens weitere Gewalt vonseiten wütender Verwandter oder Lynchmobs. Ohne die vom Henker gewissenhaft und öffentlich inszenierte, häufig grausame Durchsetzung der zivilen Autorität wäre das »Schwert der Gerechtigkeit« eine leere Metapher geblieben, und der selbst erklärte Anspruch der weltlichen Obrigkeit, Garant der öffentlichen Sicherheit zu sein, wäre als leeres Gerede angesehen worden. Als ihr Repräsentant übernahm der Henker die heikle Aufgabe, zumindest den Anschein herrschender Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten, indem er einem anderen menschlichen Wesen körperlichen Schaden zufügte oder es tötete. Ein aufstrebender junger Henker wie Frantz Schmidt musste potenzielle Arbeitgeber nicht nur von seinen technischen Fertigkeiten überzeugen, sondern auch von seiner Fähigkeit, selbst in emotional überaus aufgeladenen Situationen ruhig und leidenschaftslos zu handeln. Für einen so jungen Mann war das eine schwere Aufgabe, der sich Meister Heinrich und sein Lehrling jedoch mit unerschrockener Entschlossenheit unterzogen.
DIE SCHANDE EINES VATERS
Die relative Toleranz, die Heinrich Schmidt und seine Familie im Frühjahr 1573 erfuhren, war eine neuere gesellschaftliche Entwicklung. Und es war keineswegs gesagt, dass sie von Dauer war. Seit dem Mittelalter wurden Scharfrichter allgemein als käufliche, kaltblütige Killer verachtet und folglich vom Leben der angesehenen Gesellschaft vollkommen ausgeschlossen. Meistens waren sie gezwungen, außerhalb der Stadtmauern oder in der Nähe eines unreinen Ortes innerhalb der Stadt zu leben, in der Regel des Schlachthauses oder eines Siechenhauses (für Leprakranke). Auch von Rechts wegen waren sie ausgegrenzt: Kein Scharfrichter oder Familienmitglied eines solchen konnte das Bürgerrecht erlangen, Mitglied einer Zunft werden, ein öffentliches Amt übernehmen, als Vormund oder Zeuge vor Gericht auftreten und noch nicht einmal ein gültiges Testament aufsetzen. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts genossen diese Ausgestoßenen keinen gesetzlichen Schutz vor dem Zorn des Pöbels, wenn eine Hinrichtung einmal misslang; es kam also durchaus vor, dass Scharfrichter von den aufgebrachten Zuschauern gesteinigt wurden. In den meisten Städten war es Henkern – wie sie üblicherweise genannt wurden – verboten, eine Kirche zu betreten. Und wenn ein Scharfrichter sein Kind taufen lassen wollte oder die Letzte Ölung für einen sterbenden Angehörigen wünschte, so war er auf die Bereitschaft des gelegentlich wenig mitfühlenden örtlichen Priesters angewiesen, seinen Fuß in ein »unreines« Haus zu setzen. Ferner war ihnen der Zutritt zu Badehäusern, Schenken und anderen öffentlichen Gebäuden untersagt, und es kam so gut wie nie vor, dass ein Scharfrichter das Haus eines angesehenen Bürgers betrat. Die Menschen jener Zeit hegten eine panische Angst vor sozialer Ansteckung allein durch die Berührung der Hand eines Scharfrichters, sodass angesehene Personen schon durch einen zufälligen Kontakt mit ihm ihre Existenz aufs Spiel setzten. Unzählige Legenden beschworen das Unheil, das über jene kam, die dieses Tabu brachen, und berichteten von zum Tod verurteilten schönen Jungfrauen, die diesen Tod einer Ehe mit dem willigen Henker vorzogen.30





























