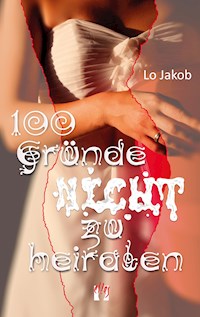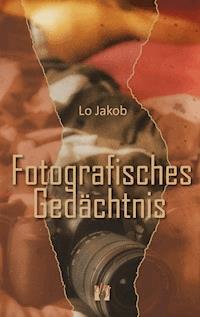Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: édition el!es
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Feuerwehrfrau-Serie
- Sprache: Deutsch
In ihrer letzten Nacht in der Notfallambulanz behandelt die übermüdete Ärztin Willa Schneck eine verletzte Feuerwehrfrau, in die sie sich sofort verliebt. Sie fragt sich hinterher verzweifelt, wie sie sie je wiedersehen kann. Denn eigentlich beginnt für Willa genau jetzt ein neues Leben mit einer Praxis als Hausärztin auf dem Land. In genau dem bescheuerten Dorf, in dem sie groß geworden und aus dem sie geflohen ist. Maxi Gnädig, echtes City-Girl mit Ambitionen zum Wurzelweib, ist erst seit Neustem in ihrer Freizeit bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und sie lebt in einem Hexenhäuschen am Rande genau des Dorfes, in dem Willa ihre Praxis eröffnet. Da sollte es doch ein Leichtes sein, der gegenseitigen Faszination nachzugehen . . .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lo Jakob
DIE FEUERWEHRFRAU, IHRE ÄRZTIN, DEREN MUTTER UND DAS GANZE DORF
1. Teil der Serie»Die Feuerwehrfrau«
© 2020édition el!es
www.elles.de [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-95609-320-3
Coverillustration:
1. Akt
1
Willas letzte Schicht in der Notfallambulanz forderte noch einmal alles von ihr und zeigte ihr ganz deutlich, warum sie hier so dringend weg wollte. Weil sie vollkommen ausgelutscht wurde von dem ständigen Wahnsinn, der hier mit schöner Regelmäßigkeit ausbrach.
Vor ihrer Nachtschicht, ihrem letzten Einsatz auf ihrer alten Station, war sie tatsächlich etwas wehmütig geworden. Sie würde die Kolleginnen und Kollegen vermissen. Nicht alle, aber die, mit denen sie gern zusammenarbeitete. In Zukunft würde sie mit ihrer medizinischen Fachangestellten allein in der Praxis sein. Wenn sie dann eine eingestellt hatte.
Sie hatte ein wenig Bammel davor, so gänzlich auf fachlich-kollegiale Hilfe verzichten zu müssen, ganz auf sich allein gestellt zu sein. Deshalb hatte sie vor Schichtbeginn, noch zu Hause, eine kleine Krise hingelegt und sich kurz eingebildet, dass sie eigentlich die ideale Ärztin für die Notfallambulanz wäre. Und überhaupt die Notfallambulanz der perfekte Arbeitsplatz. All das und noch mehr an realitätsverdrehendem Zeugs war ihr durch den Kopf gegangen.
Es hatten sie ja immer wieder Zweifel gepackt, ob sie nicht den größten Fehler ihres Lebens beging, ihre Stelle im Universitätsklinikum aufzugeben und Hausärztin auf dem Land zu werden.
Nicht irgendwo auf dem Land, sondern genau in dem vermaledeiten Kaff, in dem sie großgeworden war und in dem immer noch der Großteil ihrer Verwandtschaft wohnte. Herrgott, die Hälfte des Dorfes hieß Schneck wie sie. Vermutlich waren in Zukunft all ihre Patientinnen und Patienten mehr oder weniger mit ihr verwandt. Da würde sie sich vermutlich wieder in dieses geordnete Chaos hier im Klinikum zurückwünschen. Auch wenn sie jetzt gerade am liebsten vor Müdigkeit nichts mehr hören und sehen wollte und sich ein Husten eines Cousins vierten Grades nach einem ärztlichen Traum anhörte.
Aber nein. Noch fünf Stunden Wahnsinn aller Arten. Und sie meinte nicht den der psychischen Sorte, sondern den, der hier Alltag war und der Verletzungen aller Arten mit sich brachte.
Ihr nächster Fall würde da keine Ausnahme bilden, wenn sie das lautstarke Gezeter der afrikanischen Großfamilie im Wartebereich richtig einschätzte. Normalerweise wäre sie erst in ihrem Behandlungszimmer auf ihre nächste Patientin gestoßen, weil normalerweise eine der Krankenschwestern oder -pfleger die Einteilung der Patienten und die Sondierung machte. Aber heute war wieder so viel los, dass sie von Georg einfach nur die Unterlagen in die Hand gedrückt bekommen hatte, als er an ihr vorbeigestürmt war. Er wusste, dass sie eine der Ärztinnen war, die sich auch mal einen Patienten selbst aus dem Wartebereich holten.
Schon in der nächsten Sekunde wurde sie bestürmt, als sie durch die Doppeltür trat, die den Behandlungsbereich abtrennte. In einem zuerst völlig unverständlichen Englisch texteten mehrere Menschen gleichzeitig auf sie ein. Es war ihr unmöglich, irgendetwas aufzuschnappen, und sie wedelte einhaltgebietend mit den Händen, was absolut nichts bewirkte. Wer war hier eigentlich der Notfall? Alle, die um sie herumstanden, mit ziemlicher Sicherheit nicht. Da sah sie keine Verletzungen, und die Männer und Frauen der Großfamilie wirkten auch alle quicklebendig.
»Please, please, I don’t understand a word you say.«
Noch während sie versuchte, durch beschwichtigende Gesten Ruhe in die Angelegenheit zu bringen, sah sie durch eine Lücke eine schwangere Frau, die mit gesenktem Kopf noch immer saß und an die sich zwei kleine Kinder klammerten. Einer Intuition folgend drängte sie sich durch die Gruppe und näherte sich der Frau. Sie hatte eine Art Turban auf dem Kopf und war in ein buntes afrikanisches Gewand gekleidet, wie die anderen Frauen, die dabei waren. Die Männer hingegen trugen alle Jeans und T-Shirts.
Einer davon drängte sich neben sie. »My wife. Headache. All the time. You understand?« Er zeigte auf seinen Kopf und dann auf den seiner Frau.
»I understand«, antwortete Willa. »Does she speak English?« Die Frau hob den Kopf noch nicht einmal an, als Willa sich neben sie setzte.
»A little. I can speak for her«, sagte der Ehemann sehr selbstsicher, aber sein Englisch hörte sich nicht so gut an, dass er verstehen würde, was sie von ihm wissen musste.
Willa atmete einmal tief durch. Das würde nicht leicht werden. Mit Kommunikationshindernissen eine Diagnose zu stellen, war eine echte Herausforderung. Sie würde sich mehr auf die Untersuchungsergebnisse stützen müssen, als sich auf irgendwelche Aussagen zu verlassen. Was wusste sie schon, wie in der Kultur, aus der ihre neue Patientin stammte, mit Krankheit umgegangen wurde. Wie über Symptome gesprochen wurde. Vielleicht sprach man manche Dinge nicht aus wegen gesellschaftlicher Tabus, vielleicht überzeichnete man andere.
Seufzend erhob sie sich. »Please follow me.«
Als Willa merkte, dass offenbar alle Anwesenden vorhatten, die Patientin zu begleiten, war ihr klar, dass die Schwierigkeiten bereits in diesem Moment anfingen.
Zwanzig Minuten später hatte sie die Patientin endlich in ihrem kleinen Behandlungsraum, eine weitere Stunde später war die schwangere Frau mit einem ersten Verdacht auf Station aufgenommen und ihre Verwandtschaft nach Hause geschickt.
Willa war mit sich zufrieden, weil sie sich sicher war, das Richtige für die Frau getan zu haben, aber Erschöpfung war ein zu schwaches Wort für ihren Zustand nach diesem Fall.
Sie machte sich auf die Suche nach einer dringend benötigten Tasse Kaffee. Der schmeckte hier zwar so, als ob er nach drei Tagen noch einmal aufgewärmt worden wäre und schon vorher eine richtige Kaffeebohne nur von Weitem gesehen hätte, aber heute Nacht war sie nicht zimperlich. Sie brauchte das Koffein, um durchzuhalten.
Im Stationspausenraum goss sie sich in einen großen Humpen, den irgendjemand mit dem Namen Manuela zurückgelassen haben musste, denn das stand in großen, bunten Buchstaben darauf, eine ausreichende Menge der rabenschwarzen Flüssigkeit ein.
Sie beging den Fehler, auf dem Weg zu einer Sitzgelegenheit in den angeschlagenen Spiegel zu schauen, der an der Wand hing. Sie sah genauso müde aus, wie sie sich fühlte. Die Ringe unter ihren Augen zeigten die Anzahl ihrer Nachtschichten an – fünf am Stück. Selbst ihre Haare sahen müde aus.
Normalerweise waren ihre Augen und ihre Haare das, was Willa an sich am meisten mochte. Ihr rotbrauner Kurzhaarschnitt betonte ihre grün-braunen Augen. Ihre gerade Nase war nichts Besonderes, aber sie wusste, dass ihr Mund ausdrucksstark war. Zumindest hatten das Menschen, die ihr Komplimente machen wollten, schon des Öfteren gesagt.
Heute würde sie jedenfalls keine Komplimente erhalten, so viel stand nach einem weiteren kritischen Blick fest. Das Weiß ihres Kittels betonte das Lebende-Leiche-Aussehen noch. Da half auch das grüne T-Shirt, das sie darunter trug, nichts.
Willa wandte sich von dem Elend im Spiegel ab. Sie ließ sich auf einen der stapelbaren Industriestühle sinken und ignorierte mit einer Selbstverständlichkeit, die nur durch lange Übung kam, die Scheußlichkeit ihrer Umgebung. Ihr Blick schweifte über die kargen weißen Wände, die verkratzten Tische und das Sammelsurium an Kaffeetassen, ohne sie weiter wahrzunehmen.
Erschöpft ließ sie ihre Gedanken kreisen und trank den Kaffee in großen Schlucken wie ein Verjüngungselixier.
Für ihre neue Praxis hatte sie als Erstes eine kleine Maschine angeschafft, die auch Milch schäumen konnte und die Bohnen für jede Portion frisch mahlte. Ihr Vorgänger, der bereits vor zwei Jahren altersbedingt aufgehört hatte, hatte eine alte Standardmaschine zurückgelassen. Niemand hatte seither das verkalkte alte Ding weggeworfen. Sie würde ganz schön ausmisten müssen in der Praxis. Dafür gab sie sich mindestens zwei Wochen, dann erst würde sie die ersten Patienten aufnehmen.
Wieder wurde sie nervös, wenn sie an all die Details dachte, die sie zu erledigen hatte.
Der Bürgermeister hofierte sie wie Hochadel, so glücklich war er darüber, endlich wieder eine Ärztin in der Gemeinde zu haben. Er hatte ihr jedwede Unterstützung zugesagt. Zusätzlich zu den fünftausend Euro Werbeprämie.
Auch ihre Mutter hatte sich gleich als Hilfe angeboten. Aber Willa würde den Teufel tun, das anzunehmen. Bei aller Liebe. Nun ja, Liebe. Empfand sie wirklich Liebe für ihre Mutter? Sie würde wahnsinnig werden von den guten Ratschlägen, die immer so ziemlich das genaue Gegenteil von dem waren, was Willa wollte. Sie würde auf andere Art wahnsinnig werden als hier, aber wahnsinnig nichtsdestoweniger.
So schlecht war es hier im Krankenhaus doch gar nicht. Bei genauerer Überlegung. Wieder packte sie die Wehmut. Sie trank einen weiteren Schluck Kaffee. Da war diese Anwandlung gleich wieder wie weggeblasen. Allein wegen des Kaffees. Es war die richtige Entscheidung, eine eigene Praxis zu eröffnen. Hoffte sie.
2
Maxi zupfte an der nagelneuen Hose ihrer Feuerwehruniform herum, die leider noch furchtbar steif war. Mehr von der Uniform hatte sie auf die Schnelle nicht geschafft anzuziehen. Das dunkelblaue Standard-T-Shirt mit dem Logo zählte nicht. Die volle Montur war das, was Eindruck machte. Auch wenn das T-Shirt auf unauffällige Art ihren Oberkörper betonte, für dessen Optik sie jeden Abend ihre Klimmzüge und andere nicht gerade leichte Übungen machte. Sie war eitel, was das anging. Das gestand sie sich ein.
Allerdings war es hier draußen am Ortsrand von Weiler so furchtbar Sacknacht, dass es egal gewesen wäre, wenn sie nackt herumgelaufen wäre. Und weil sie schließlich die ausgebüxte Pferdeherde nicht noch mehr aufscheuchen durften, hatte Dieter, ihr Feuerwehrkommandant, die Devise ausgegeben, die Taschenlampen nur im Notfall einzusetzen.
Maxi stolperte also halbblind durch die Pampa und wartete immer noch darauf, dass sich ihre Augen langsam mal anpassten. In der Nähe waren überall ihre Kollegen unterwegs und filzten die Wiesen, Hecken und Wälder nach den verstreuten Tieren ab. Zwanzig Stück waren entkommen, und Maxi befürchtete, dass sie die ganze Nacht unterwegs sein würden, um sie zu finden und zurückzubringen. Von der Hofbesitzerin hatten sie dafür alle ein Halfter bekommen.
Dass sie noch nie einem Pferd so ein Ding übergestülpt hatte, hatte Maxi nicht verraten. Aber das konnte ja wohl kein Hexenwerk sein. Das machte der Mensch schließlich seit Jahrtausenden. Viel schwieriger war es, die Gäule aufzustöbern. Aber auch das machte der Mensch seit Jahrtausenden, wie sie erst neulich in einer Arte-Dokumentation über die Beziehung zwischen Mensch und Pferd gesehen hatte.
Maxi stolperte ein Stück weiter über die unebene Wiese.
Dieter wohnte ganz in der Nähe des Hofes. Er hatte sie alle zusammengetrommelt, als er die ersten Exemplare der Herde in seinem Garten stehen sah, seine Karotten auffressend. Es war Maxi reichlich egal, wer Dieters Wurzelgemüse verspeiste. Aber sie hatte auf ihren ersten Einsatz hingefiebert. Mit ein bisschen Feuer hätte der zwar schon sein dürfen, aber im Grunde taten es auch die Pferde.
Sie brannte darauf, sich zu beweisen. Die skeptischen – und ja, auch höhnischen – Bemerkungen ihrer besten Freundin und ihrer Verwandtschaft hingen ihr noch nach. Dass ausgerechnet sie aufs Land zog und dann auch noch in die Freiwillige Feuerwehr ging. Warum nicht gleich zu den Landfrauen. Die Wetten liefen schon, wann sie ihr Experiment aufgeben und mit eingezogenem Schwanz wieder in die Großstadt zurückkehren würde.
Darauf konnten die alten Unken lange warten. Maxi fühlte sich in Weiler sauwohl. Und wenn die erste Runde Besuche durch war, würden alle, und zwar restlos alle, auch anders darüber denken. Oder wenn sie ihre ersten Heldentaten zu berichten hatte.
Maxi tapste wildentschlossen weiter durch das feuchte Gras. Nur knapp vor sich machte sie eine Hecke aus. Immerhin war sie nicht komplett dämlich hineingestürzt. Als sie sie umrundete und dabei in einer Bodenwelle zum Straucheln kam, sah sie es. Intuitiv wusste sie, trotz stockfinsterer Nacht, dass sie es hatte.
Beinahe.
So gut wie.
Fast.
Eigentlich hörte sie es mehr, als dass sie es sah, aber trotzdem. Das leichte Schnauben, das Mahlen der Zähne beim Grasen, die Hufe im Gras beim langsamen Vorwärtslaufen.
Maxi würde jetzt gleich das Leitpferd einfangen, und dann würden die anderen zwanzig folgen. Oder so ähnlich. In der Theorie. So hatte es die Hofbesitzerin empfohlen.
Sie näherte sich mit ausgestrecktem Arm ganz langsam dem Tier. Es stand direkt hinter der Hecke, und es war purer Zufall, dass sie darauf gestoßen war. Bisher hatte es völlig unbeeindruckt gegrast, als sie sich über die Wiese schlich. Aber jetzt hob es alarmiert den Kopf. Im Gegensatz zu seinen Kumpels trug das Exemplar hier sogar schon ein Halfter um den Kopf. Kein Führstrick, aber man konnte nicht alles haben.
Maxi konnte ihr Glück kaum fassen. Sie müsste das Pferd nur am Halfter zu fassen kriegen. Ihre fünfzehn Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr Weiler hechteten währenddessen hinter den falschen Pferden her. Die Hofbesitzerin hatte es ihr zwar nur ganz kurz erklärt, aber diese Tatsache war hängengeblieben: Chef der Truppe war ein braunes Pferd mit einer auffälligen weißen Blässe, die sich bis über die Nüstern zog. Das konnte sie sogar in der stockdunklen Nacht erkennen. Das Pferd, das da jetzt vor ihr aufgeregt tänzelte, hatte genau solch eine Zeichnung.
Warum die Herde ausgebüxt war, wusste sie nicht, nur dass sie jetzt gleich wieder heimkehren würde. Und das neueste Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr würde damit in die Vereinsannalen eingehen. Ergo sie, Maxi Gnädig, ihres Zeichens seit genau zwei Monaten Feuerwehrfrau. Also ehrenamtliche Feuerwehrfrau.
Die Pferde würden heimkehren in ihren Stall oder was auch immer, ohne auf irgendeine Straße zu rennen, ohne Dieters Vorgarten zu zertrampeln, und vor allem, ohne dass sie weiter ihre Nacht verbringen musste, indem sie endlos hinter Vierbeinern herrannte. Sie war als Kind nie ein Pferdemädchen gewesen – City-Girl, das sie die meiste Zeit ihres Lebens war –, aber wie schwer konnte es schon sein, ein Pferd einzufangen? Nicht sehr schwer, wenn sie die zehn Zentimeter betrachtete, die ihre Hand nur noch vom Halfter trennten.
Eigentlich war es ganz romantisch, wie sie fand, in die Sommernacht hinauszurennen, während die Sterne am klaren Himmel blinkten. Es roch gut nach frischem Gras und feuchter Erde, und die Luft war so rein, wie Maxi sie wohl in ihrem ganzen Leben noch nicht geatmet hatte.
Ein leichter, angenehmer Geruch nach Pferd erinnerte sie daran, dass sie sich auf ihre Aufgabe konzentrieren musste, denn sonst ergriff das große Tier womöglich noch die Flucht. Es rollte komisch mit den Augen, sodass man in der Dunkelheit das Weiße drumherum erkennen konnte. Das war kein gutes Zeichen, oder?
Maxi beschloss, nicht länger zu zögern, sondern zuzugreifen. Beherzt.
Und das tat sie dann auch.
Nur dass das Pferd anderer Meinung war. Es versuchte, sofort wieder loszukommen. Aber wenn Maxi eines bei der Feuerwehr in der kurzen Zeit gelernt hatte, der Job war nichts für Weicheier. Wer vor jedem Regenwurm Panik bekam, hatte nichts in der Freiwilligen Feuerwehr verloren.
Sie hängte sich also mit aller Kraft, die sie hatte, an dieses Halfter und versuchte, das Tier in Richtung Weg und damit zum Hof zu ziehen. Die ersten Meter war sie die klare Gewinnerin dieses Zweikampfes, und innerlich triumphierte sie bereits. Aber dann steigerte das Pferd plötzlich seinen Widerstand. Bilder von wilden Mustangs und deren Zähmung schossen mit einem Schlag durch Maxis Kopf. Sie würde nicht loslassen. Auch wenn das Pferd den Spieß umgedreht hatte und jetzt sie durch die Gegend schleifte.
Maxi stieß einen heiseren Schrei aus vor lauter Wut und Entschlossenheit. Sie hörte daraufhin tatsächlich die Stimmen ihrer Kollegen rufen, die sich aus der Dunkelheit näherten. Aber für das Pferd war das wohl der letzte Schritt zur Vollpanik, und es befreite sich mit einem gewaltigen Bocksprung aus Maxis Klammergriff. Noch im Loslassen war Maxi fast erleichtert, aber noch während sie weggeschleudert wurde, trat das Pferd noch einmal aus. Beim ersten Mal war sie so nah gewesen, dass die ausschlagenden hinteren Hufe ihr nicht gefährlich wurden. Aber aus dem Augenwinkel sah sie es fast wie in Zeitlupe kommen. Trotz Dunkelheit, trotz der Schnelligkeit, mit der alles vonstattenging.
Das Pferd sprang aus lauter Angst hoch und schleuderte mehr so nebenbei seine Hinterläufe in ihre Richtung. Wie es schien, noch nicht einmal zielgerichtet auf sie, nur leider war sie nicht so reaktionsschnell wie ein Pferd. Und hatte dem auch nicht so viel Muskelmasse entgegenzusetzen. Sie versuchte noch, sich wegzudrehen und spannte jeden Muskel an. Aber der Tritt streifte ihre Rippen, und Maxi klappte schlagartig zusammen. Der sofortige Schmerz raubte ihr die Atemluft.
Sie lag auf dem Boden und wusste nicht so recht, warum, spürte aber das Hufgetrappel eines flüchtenden Pferdes. Dann menschliche Füße, die in ihre Richtung liefen. Mehrere. Sie starrte einen Moment von Schmerz geflutet die blinkenden Sterne an.
Als ihre Kollegen angerannt kamen, raffte sie sich gerade auf ins Stehen. Vornübergebeugt, auf die Knie gestützt, atemlos. Aufrichten ging nicht. Aber alles halb so schlimm. Das versuchte sie auch Harry und Dieter zu sagen, aber es kam nur ein heiseres Ächzen heraus. Sie hatte keine Luft zum Sprechen. Und der Schmerz schoss bei jeder kleinsten Bewegung durch ihren Brustkorb und schnürte ihr fast den letzten Rest Atemluft ab.
»Wir brauchen einen Krankenwagen«, sagte Dieter, und aus dem Augenwinkel sah sie ihn an seinem Handy herumfummeln.
Maxi winkte ab, aber auch das verursachte Schmerzen. »Geht schon«, brachte sie heraus.
»Ich glaube, du spinnst. Stell dich doch mal aufrecht hin, wenn es dir so prächtig geht.«
Maxi versuchte es. Sie versuchte es wirklich.
Schließlich winkte sie Dieter ihr Einverständnis. Wie sollte sie schließlich hier wegkommen, wenn sie nicht weiter hochkam als so? Sie stand einfach nur, stützte sich schwer auf ihre Knie und atmete. Um sie herum aufgeregtes Gerede, Kollegen kamen und gingen, die Minuten verstrichen. Immer wieder machte sie einen Ansatz, vollends aufrecht zu stehen, aber der Schmerz und die Atemlosigkeit verhinderten es jedes Mal.
Dieter blieb neben ihr stehen, gab Anweisungen und scheuchte die Kollegen. Inzwischen flackerten überall auch Taschenlampen um sie herum. In der Ferne hörte sie immer wieder Rufe und Hufgetrappel, aber was die Pferdeherde machte, war ihr im Moment völlig egal.
»Er tritt sonst nie aus«, sagte irgendwann die Hofbesitzerin neben ihr, und Maxi hätte fast losgeprustet vor Lachen. Das war wohl die Variante von Der tut nichts, der ist ganz lieb, die Hundebesitzer sagten, bevor Fiffi zubiss – abgewandelt für Pferdebesitzer.
Das Lachen blieb ihr aber im Hals stecken. Und sie würdigte diese Aussage auch keines Kommentares. Schließlich war sie der lebende Beweis, dass er – wie auch immer er hieß – sehr wohl austrat. Ihre Rippen taten entsprechend höllisch weh. So langsam kam auch eine einsetzende Angst dazu, dass eine oder zwei gebrochen sein könnten. Sehr viel länger wollte sie daher hier nicht mehr stehen, denn so langsam machte sich diese Angst breit und war auch nicht gerade ihrer Atmung zuträglich.
Schließlich hörte sie in der Ferne ein näherkommendes Martinshorn, und die Nacht irrlichterte in blauem Licht.
»Scheiße, wieso kommen die mit Blaulicht mitten in der Nacht?«, fragte Dieter rhetorisch, und Maxi konnte sich innerlich nur anschließen. Wie peinlich war das denn? Das ginge schneller im Dorf rum als ein Lauffeuer.
Aber als dann schließlich der Trupp des Notarztteams aus den zwei Fahrzeugen stieg und um sie herumschwärmte, war sie noch nie in ihrem Leben erleichterter gewesen. Die Schmerzspritze, die sie sofort verabreicht bekam und die sie geradezu abschoss, war ein Wunderding. Maxi schnitt im Drogenrausch nur am Rande mit, wie sie auf eine Liege verfrachtet und im Krankenwagen Richtung Universitätsklinikum gefahren wurde. Aber eigentlich dachte sie, sie wäre in einem Raumschiff unterwegs. Was für ein geiler Trip. Sie wollte nie wieder runterkommen.
3
Willa wollte gerade den Pausenraum verlassen und sich immer noch müde dem nächsten Fall annehmen, als Georg sie abfing.
»Wir kriegen eine Feuerwehrfrau rein, die vom Pferd getreten wurde. Verdacht auf Perforation der Lunge. Nimmst du die?« Er hatte Unterlagen in der Hand, die er ihr überreichen wollte.
Aber Willa zögerte. »Berufsfeuerwehr oder Freiwillige?«
Durften Frauen eigentlich in Deutschland inzwischen zur Berufsfeuerwehr? Sie wusste das gar nicht. Bei der Freiwilligen war es inzwischen angekommen, auch Frauen aufzunehmen. Das wusste sie von ihrer Mutter aus Weiler. Die fand das nämlich einen Skandal. Was hatten Frauen denn bei der Feuerwehr verloren? Fand ihre Mutter. Was typisch war.
»Ist doch egal«, sagte Georg, der schließlich nur die Patientin loswerden wollte, um sich dann wieder um das überfüllte Wartezimmer kümmern zu können.
»Oh nein«, wehrte Willa ab. »Wenn du die Freiwillige Feuerwehr so gut kennen würdest wie ich, würdest du das nicht sagen.«
Und das entsprach vollkommen der Wahrheit. Wie viele Feuerwehrfeste hatte sie in ihrer Kindheit und Jugend mit ihrer Familie besuchen müssen, wie viele Trinkgelage der Jungs von der Freiwilligen mitgekriegt – sie hatte alles, aber wirklich alles gesehen in dieser Hinsicht.
Georg runzelte unwirsch die Stirn. Er konnte ihren Gedankengängen offensichtlich nicht folgen. »Nimmst du sie jetzt oder nicht? Wirst du jetzt in deiner letzten Nacht komisch, Willa? Bloß weil die Frau von der Freiwilligen Feuerwehr ist?«
Er hatte natürlich recht. Sie war schließlich professionell. Sie würde die Feuerwehrfrau wie jeden anderen Patienten behandeln. Egal durch wie viel Unfähigkeit oder Alkohol oder beides sie sich selbst in diese Situation gebracht hatte. »Her mit der Feuerwehrfrau. Schlimmer als die afrikanische Großfamilie kann es nicht sein. Dann mach ich eben auch noch Freiwillige Feuerwehr. Die kommen bestimmt von der Gurkentruppe aus Weiler.«
Das letzte sagte sie nur so daher. Nur um ein bisschen mehr zu maulen über diese letzte Schicht. Weil es das Schlimmste war, was ihr gerade einfiel. Eine Steigerung der Freiwilligen Feuerwehr als solcher.
»Woher wusstest du das?«, fragte Georg erstaunt.
Willa musste spontan losprusten. »Oh mein Gott. Echt jetzt?« Was war heute nur los? Ihre letzte Schicht servierte es ihr so richtig fett, dass es schon fast ulkig wurde. So langsam. Und mit viel Galgenhumor betrachtet.
Georg sah sie seltsam an. Er dachte wohl, dass sie in ihrer letzten Schicht geistig nicht ganz zurechnungsfähig geworden war. »Ob die Feuerwehrfrau aus Weiler ist, weiß ich nicht, aber der Krankenwagen war nach Weiler beordert worden. Lass dich also überraschen.« Und damit verschwand er einfach und ließ sie zurück.
Willa stieß einen Stoßseufzer aus und bereitete sich mental auf die Ankunft der Freiwilligen Feuerwehr Weiler vor. Das Wort Gurkentruppe war dabei nie weit von ihren Gedanken entfernt. Es wunderte sie überhaupt nicht, dass es jemand von denen geschafft hatte, sich von einem Pferd treten zu lassen. Wie auch immer das vonstattengegangen war, Willa war sich sicher, dass es selbstverschuldet sein musste. Absolut sicher. Sie hoffte wirklich inständig, dass kein Alkohol beteiligt war. Lungenperforation und Alkohol. Eine äußerst unschöne Kombination.
Aber noch während sie sich diesen Gedanken hingab, hörte sie schon, wie das Notfallteam mit der Liege den Gang von der Krankenwageneinfahrt her angerollt kam.
Sie warf nur einen oberflächlichen Blick auf die Patientin, als sie an ihr vorbeigerollt wurde. Sie konzentrierte sich darauf, was der Kollege Notarzt über ihren Status zu berichten hatte. Währenddessen übernahm im Hintergrund ihr medizinisches Personal die Ankunft der Liege. Aus dem Augenwinkel nahm sie wahr, dass alles seinen üblichen Gang ging. Sie würde auch das hier schaffen. Noch dreieinhalb Stunden bis zur Freiheit.
Der Kollege verabschiedete sich sehr schnell, da ein neuer Einsatz reinkam.
Willa ordnete zuallererst Röntgenaufnahmen und Ultraschall an. Bevor sie nicht wusste, was Sache war, konnte sie gar nichts tun. Die Patientin war stabil, hatte ausreichend Schmerzmittel bekommen, so weit so gut. Und kein Alkohol weit und breit. Das war doch schon mal ein positives Zeichen.
Während die Untersuchungen liefen, übernahm sie zwei weitere Fälle von Georg und kam dann erst ins Behandlungszimmer, als die Patientin schon auf sie wartete. Zwischendrin hatte sie im Vorbeiflug die Kurzinfo erhalten, dass sowohl beim Röntgen als auch im Ultraschall völlige Entwarnung gegeben worden war. Nicht weiter tragisch also, dass sie nicht sofort zur Stelle war. Und sie wusste ja vom Kollegen, was er der Feuerwehrfrau für die Fahrt an Schmerzmitteln gegeben hatte. Absolut ausreichend für einige Stunden.
Jetzt also Freiwillige Feuerwehr Weiler. Willa wappnete sich für das Schlimmste. Zu ihrem Erstaunen fand sie einen leeren Behandlungsraum vor und nicht die versammelte Mannschaft wie erwartet. Lediglich zwei Frauen – die eine auf der Behandlungsliege, die andere daneben sitzend auf einem Stuhl. Schon wieder ein Punkt, der positiv zu bewerten war.
Ihre Nacht hellte sich gerade drastisch auf. Sie hatte nämlich fest damit gerechnet, wie bei der afrikanischen Großfamilie erst einmal für Ordnung sorgen zu müssen und ein gefühltes Volksfest auflösen. Nicht, dass die Horden aus aufgebrachten Feuerwehrleuten nicht womöglich noch Einzug halten konnten, aber es war wesentlich unwahrscheinlicher geworden. So schnell kämen die an Georg draußen nicht vorbei, und so schnell könnten sie auch ihr Behandlungszimmer nicht ausfindig machen. Bis dahin wäre sie hier wahrscheinlich schon durch.
»Hallo. Ich bin Doktor Schneck, die behandelnde Ärztin.«
Das war ihr Standardspruch zur Begrüßung für Patienten, die ansprechbar waren. Aber Willa gab grundsätzlich niemandem mehr die Hand. Das hatte sie sich schon vor langer Zeit abgewöhnt. Ungefähr im zweiten Semester Medizinstudium, und nicht erst mit der Corona-Pandemie. Die furchtbarsten Erreger wurden durchs Händeschütteln übertragen. Sie wusste zwar, dass viele Patienten das als wichtig erachteten und sich wohler fühlten, wenn der Arzt oder die Ärztin ihnen die Hand gab. Sie hatte erst vor Kurzem darüber wieder einen Artikel in einer Fachzeitung gelesen. Aber das neue Corona-Virus fühlte sich dabei eben auch pudelwohl. Um nur eine der Plagen, die das Krankenhaus heimsuchten, zu nennen.
Sie behielt also ihre Hand für sich. Unterlagen, die man mit sich herumschleppte, waren da immer zur Tarnung hilfreich. Die hielt sie auch jetzt wieder wie ein Schild vor sich.
»Maxi Gnädig. Die Feuerwehrfrau, die vom Pferd getreten wurde. Ich weiß – peinlich«, sagte die Patientin auf der Liege mit einem schiefen, selbstironischen Lächeln.
Erst jetzt sah Willa sie sich genauer an. Und fühlte sich, als ob sie der Schlag treffen würde.
Oder wie paralysiert.
Oder wie von Amors Pfeil durchbohrt.
Sie konnte ihren Blick gar nicht von der attraktiven Frau lösen, die irgendwas in ihr auslöste, das nichts mit rationaler Logik zu tun hatte.
Natürlich sah die Frau wirklich gut aus. Dunkle, lockige Haare bis knapp über die Ohren, die jetzt ziemlich wild aussahen. Ein schöner, geschwungener Mund, der sich vermutlich wunderbar weich zum Küssen eignete. Blaue Augen, die vor Intelligenz nur so sprühten, aber gerade auch eine Portion Schmerz in den kleinen Fältchen drumherum zum Ausdruck brachten. Eine edle Nase, wie sie einer griechischen Statue gut zu Gesicht stünde. Perfekt geformt für das insgesamt sehr edle Gesicht. Einfach extrem gutaussehend. Fast schon schön zu nennen. Selbst in dem kalten Licht des Behandlungsraums und nach einem nicht gerade zuträglichen Erlebnis mit einem Pferd.
Aber das war es gar nicht. Diese Attraktivität, diese Schönheit. Nicht nur. Es war viel mehr ein Gefühl, diese Maxi Gnädig zu kennen. Sie schon aus hundert früheren Leben zu kennen. Und ihr jedes Mal wieder mit Haut und Haar zu verfallen.
Willa glaubte als Medizinerin natürlich nicht an solch einen wissenschaftlich nicht nachgewiesenen Quatsch wie Wiedergeburt, aber genau das war das übermächtige Gefühl, das sie überkam. Vollkommen irrational. Dass sie sich am liebsten sofort dazu bekennen wollte, dass sie diese Frau für sich wollte, dass sie sich sicher war, die Eine gefunden zu haben. Es haute sie einfach um, und sie war machtlos dagegen.
Diese ganze Erkenntnis fand im Schlag einer Wimper statt. Mehr Zeit brauchte es gar nicht.
Die zweite Person im Raum rettete sie davor, einfach nur dazustehen und zu glotzen. »Elli Gnädig-Schmitz. Die Schwester«, sagte die Frau und sah dabei sehr ernst und besorgt aus.
Richtig, sie war ja hier, um eine medizinische Diagnose zu stellen. Willa schaffte es irgendwie, in den Raum zu nicken, ohne wie eine Bekloppte ihre neue Patientin weiter anzustarren. Ihr Herz hatte ungefragt einfach angefangen zu wummern, und sie merkte, dass sich ihre Wangen heiß anfühlten. Eine unleidige Angewohnheit, wenn Frauen ihr gut gefielen. Und diese Feuerwehrfrau namens Maxi Gnädig hier war die unangefochtene Nummer eins in ihrer Hitparade des Gefallens.
Es fiel ihr schwer, sich auf ihr medizinisches Fachwissen zu konzentrieren. Willa blätterte in den Ergebnissen der Untersuchungen, um sich zu sortieren und sich die Sachlage ins Gedächtnis zurückzurufen. Röntgenbilder – nichts gebrochen. Lunge intakt. Ultraschall – keine inneren Blutungen im Bauchraum. Die Feuerwehrfrau hatte mehr Glück als Verstand gehabt. Pferdetritte in die Rippen gingen selten so glimpflich ab. Was nicht heißen sollte, dass sie nicht Schmerzen kriegen würde, die einen Heiligen in die Knie zwingen würden.
Eine weitere wichtige Information bohrte sich in ihr Hirn. Die Patientin hatte eine Adresse in Weiler. Willas Herz wummerte bei dieser Tatsache fast noch mehr. Gerade sah sie sich einem Phänomen ausgesetzt, dessen Existenz sie für einen Mythos gehalten hatte: Liebe auf den ersten Blick.
Noch konfuser als vor dem Blick in die Unterlagen räusperte Willa sich und wappnete sich für erneuten Augenkontakt. Die beiden Frauen im Raum warteten auf ihr ärztliches Urteil. Neben der Schwester stand sogar eine gepackte Reisetasche. Wahrscheinlich rechneten sie mit der Aufnahme auf Station.
Das war doch mal ein Faktum, mit dem sie anfangen könnte, ohne sich lächerlich zu machen. »Die gute Nachricht ist, Sie werden nicht hierbleiben müssen, weil Ihre Rippen vollkommen intakt sind und auch sonst keine Organe betroffen sind.« Willa hielt das Röntgenbild hin und zeigte auf die Rippenbögen.
Zwei Paar Augen, die sich ähnelten, schauten gebannt darauf, auch wenn Willa vermutete, dass sie nicht so besonders viel erkennen konnten. Außer ein paar schattige Bögen, die man auch als medizinischer Laie als Rippen ausmachen konnte.
»Ich möchte Sie trotzdem noch kurz untersuchen und mir Ihre Atmung anschauen.«
Willa näherte sich der Liege, legte ihre Unterlagen beiseite und wappnete sich für den Körperkontakt mit dieser umwerfenden Frau. Sie zog sich einen Rollhocker heran und setzte sich unnötig langsam, um die Situation noch ein paar Sekunden länger hinauszuzögern.
Vielleicht verrannte sie sich völlig, vielleicht war diese Maxi Gnädig in Wirklichkeit total bescheuert – schließlich gehörte sie zur Gurkentruppe –, vielleicht würde Willa morgen schon ganz anders über diese Begegnung denken. Vielleicht, vielleicht.
Aber jetzt in diesem Moment war sie ein Nervenbündel, weil sie diese schöne Frau untersuchen musste.
4
Maxi konnte sich nicht aufsetzen, auch wenn ihr innerer Macho alles daransetzte, es unbedingt zu schaffen. In Anwesenheit einer jungen, gutaussehenden Ärztin kam er ungefragt heraus und scherte sich auch erst einmal nicht um ihre teuflische Verletzung.
Schließlich gab er sich geschlagen, und sie schaffte es mit Ellis Hilfe, das Feuerwehr-T-Shirt auszuziehen. Nur noch in ihrem Sport-Bustier lag sie völlig außer Atem, weil sie nur flache Atemzüge wagte, auf der Liege, und die Ärztin kam auf ihrem Hocker nähergerollt. Sie studierte Maxis Torso mit ihren intensiven Blicken – sodass Maxi nach der Erleichterung über die Entwarnung schon wieder besorgt wurde. War doch etwas nicht in Ordnung? Maxi sah an sich hinunter. Sie entdeckte noch nicht einmal einen blauen Fleck in der Form eines Hufeisens oder in irgendeiner anderen Form. Aber die Schmerzen pochten gedämpft durch die Schmerzmittel immer noch im Hintergrund. Sie fühlte sich wie von einer Straßenwalze in den Asphalt planiert. Oder eben wie von einem Pferd getreten.
Trotzdem nahm sie sehr wohl wahr, dass diese Doktor Schneck zum einem ihr Gaydar bis in den roten Bereich ausschlagen ließ, und zum anderen, dass sie eine wirklich sehr hübsche Rotbraune war, deren grünlich-braune Augen Maxi mit ihrer Intensität in ihren Bann zogen. Selbst der unansehnliche weiße Arztkittel tat dem Ganzen keinen Abbruch. Maxi konnte darunter ein säuberlich gebügeltes grünes T-Shirt mit V-Ausschnitt erkennen. Eine weiße Hose natürlich und weiße Turnschuhe. Alles nicht weiter unerwartet, außer den kurzen rotbraunen Haaren und diesen Augen. Ungefähr fünf Sommersprossen auf dem Nasenrücken.
Maxi starrte die Ärztin mit dem etwas lustigen Nachnamen an. Für einen kurzen Moment vergaß sie, dass sie Schmerzen hatte und warum sie hier lag. Eine kurze unbedachte Bewegung mit der Schulter, eigentlich nur ein intuitives Anheben, erinnerte sie dann aber unschön daran, dass sie wirklich Besseres zu tun hatte, als Frauen anzuschmachten.
Und besagte Angeschmachtete auch. Die hatte auch Besseres zu tun. Die würde sie gleich untersuchen. Mit ihren Händen. Direkt auf ihrer nackten Haut. Maxi hielt in Erwartung der Berührung die Luft an.
»Ist Ihre Atmung eingeschränkt?«, fragte Doktor Schneck auch gleich und schaute ihr jetzt direkt in die Augen. Ihre geschwungenen, dunkelroten Augenbrauen waren fragend angehoben. Sie hatte den Kopf leicht schiefgelegt.
Maxi stieß sofort die Luft wieder aus. »Eigentlich nicht. Wobei ich mich noch nicht getraut habe, ganz tief durchzuatmen.«
»Das sollten Sie aber. Deshalb bekommen Sie auch die entsprechend starken Schmerzmittel mit nach Hause. Und die nehmen Sie auch bitte. Bei Rippenverletzungen ist eine der Gefahren, dass die Lunge nicht richtig eingesetzt wird, und dadurch kann eine Lungenentzündung entstehen.« Die Ärztin musste Maxis entsetzte Augen gesehen haben, denn sie fügte hinzu: »Ich sagte, kann.«
Dann fackelte sie nicht weiter, legte Maxi eine Hand auf den Bauch und fing an, sie erst einmal großräumig abzutasten.
Die widerstreitenden Gefühle in Maxi waren kaum auszuhalten. Einerseits befürchtete sie, jederzeit Schmerz zu spüren, andererseits bereitete es ihr ein perverses Vergnügen, von den zarten, weißhäutigen Händen der Ärztin vorsichtig ertastet zu werden. Und das waren seeeehr angenehme Hände, die sehr vorsichtig vorgingen.
Maxi schaute auf ihren Bauch und diese geschmeidigen Hände. Sie sahen dort sehr gut aus, sehr passend. Wie stolz sie immer auf ihre flachtrainierten Bauchmuskeln war, in diesem Moment umso mehr. Sie hatte zwar kein Sixpack und würde das in diesem Leben auch nicht mehr erreichen, aber auch kein Gramm Speck überschüssig. Nicht wie Elli, die mit einem Rettungsring aus überflüssigen Pfunden zu kämpfen hatte, und das, obwohl sie ein paar Jahre jünger war als sie.
Doktor Schnecks Hände wanderten fachkundig weiter, und Maxi schwankte erneut zwischen Befürchtungen und abstrusen Gedanken an sämtliche Arztromane, die sie jemals gelesen hatte. Bilder aus Krankenhausserien geisterten durch ihren Kopf. Da waren die Ärztinnen auch immer wahnsinnig gutaussehend, und sie fragte sich, ob das so sinnvoll war. Dass das Krankenhauspersonal mit seiner Optik die Patienten ganz wuschig machte. Sie fühlte sich jedenfalls ganz wuschig. Wie Doktor Schneck wohl mit Vornamen hieß?
Maxi war klar, dass die Schmerzspritze sie immer noch geistig etwas beeinträchtigte. Solche unkontrollierbaren Fantasien waren nicht unbedingt normal für sie. Und sie hatte den Krankenwagen schließlich zeitweise für ein Raumschiff gehalten. Dass der Notarzt über die Schlaglöcher und den Oberbürgermeister, der nichts dagegen unternahm, gelästert hatte, hatte sie allerdings noch in Erinnerung.
Sie kam sich immer noch vor wie auf Droge. Sie hatte keine nennenswerten Drogenerfahrungen außer gelegentlichem Alkoholkonsum und einem Haschplätzchen in ihrer Jugend, aber genauso stellte sie sich das vor mit chemischen Drogen. Dass man nicht mehr ganz kontrollieren konnte, wohin das Gehirn einen führte. Dass sie bei der Untersuchung jetzt entweder die Hände der Ärztin anstarren musste, oder wie jetzt, als sie sich an ihrer Schulter entlangtasteten und Maxi sie aus dem Blick verlor, ihr Gesicht fasziniert fixierte, das gehörte genau in diese Kategorie.
Maxi war natürlich in ihrem Leben schon einigen schönen Frauen begegnet, mit der einen oder anderen hatte sie auch was am Laufen gehabt, aber sie tendierte wirklich nicht zum lüsternen Starren. Nicht so, wie sie es jetzt tat.
Was für hübsche Augen! Umrahmt von rötlich schimmernden dunklen Wimpern. Das hatte sie so noch nie gesehen. Obwohl die Ärztin gänzlich ungeschminkt war. Wer sah denn in seiner Nachtschicht so verboten gut aus? Ein bisschen blass vielleicht. Doktor Schneck kam wohl nicht so viel an die frische Luft und die Sonne, so deutlich, wie sich ihre paar eingestreuten Sommersprossen auf der Nase abzeichneten. Aber das machte sie fast noch anziehender. Maxi konnte sich gar nicht sattsehen. Der Mund war auch hübsch. Nicht zu dünne Lippen, nicht zu dicke Lippen. Genau perfekt proportioniert. Und diese Lippen bewegten sich jetzt. Sehr schön, wie das aussah. Mit einem kleinen, amüsierten Kräuseln im Mundwinkel. Und der Kopf wieder leicht schräggestellt wie schon einige Male. Sehr charmant.
Maxi lächelte zurück.
Und erst dann wurde ihr klar, dass sie vermutlich angesprochen worden war. In dem Moment, als diese betörenden Hände sich von ihrer nackten Haut verabschiedet hatten.
»Maxi!«, rief ihr Elli förmlich zu. Dann sprach sie die Ärztin an, bevor Maxi sich äußern konnte. »Ist das normal, dass sie so weggetreten ist?«
»Mein Kollege hat ihr vor dem Transport ein sehr starkes Schmerzmittel verabreicht. Das hält noch ein paar Stunden an. Sorgen Sie dafür, dass sie die Schmerztabletten in genau den Abständen nimmt, die ich Ihnen aufschreibe.« Die Ärztin saß immer noch direkt neben ihrer Liege, aber jetzt rollte sie in Ellis Richtung.
»Ich wollte eigentlich wieder heimfahren«, sagte ihre Schwester zu der Ärztin.
Das Gespräch fand gänzlich ohne Maxi statt. Aber sie war auch immer noch mit dem Anblick von Doktor Schneck beschäftigt. Sie hatte eine wirklich schöne Kurzhaarfrisur, die ihre glatten, kräftigen Haare richtig gut zur Geltung brachte. Wie sie im kalten Neonlicht glänzten, war ein Faszinosum für Maxi.
»Sie sollte nicht allein sein. Lebt sie denn allein?« Das war eine komische Frage der Ärztin, und Maxi wurde klar, dass sie mal so langsam etwas sagen musste, sonst würde das mit dem Nachhausegehen nichts werden.
»Ich komme schon zurecht«, klinkte Maxi sich mehr oder weniger unelegant ins Gespräch ein.
Doktor Schneck sah fragend zu Elli.
Glücklicherweise ließ ihre Schwester sie nicht hängen. »Ich bleibe bei dir. Ich ruf Gerald an. Er muss die Mädchen eben mal allein in die Kita bringen.« Sie hörte sich nicht begeistert an, aber wenn Not an der Frau war, konnte Maxi sich immer auf sie verlassen. Und umgekehrt galt das schließlich auch.
Doktor Schneck erhob sich zögernd von ihrem Hocker. »Wenn das geklärt ist, schreibe ich Ihnen noch ein Rezept aus. Die Apotheken, die Nachtdienst haben, stehen am Schwarzen Brett.« Sie schien ihre Untersuchung damit beendet zu haben, blieb aber immer noch neben der Liege stehen, den Kopf wieder leicht zur Seite geneigt.
Eine Eigenart, die Maxi sehr reizend fand.
Die Ärztin schaute zuerst sie an, kurz Elli und dann irgendwie unsicher in den Raum. Was jetzt? Vertraute sie ihrer Diagnose nicht ganz? Wollte sie sie doch einweisen? War es das? Dachte sie, Elli würde sich vom Acker machen? Sie sah wirklich so aus, als ob ihr etwas Ernstes auf der Zunge läge. Und Maxi wollte auf keinen Fall im Krankenhaus bleiben müssen. Bevor sie nicht am Abnippeln war, wollte sie heim in ihr eigenes Bett.
Deshalb kam sie Doktor Schneck ganz schnell zuvor, bevor sie sprechen konnte. »Dann noch eine angenehme Nachtschicht. Vielen Dank für Ihre freundliche Hilfe. Bestimmt gibt es noch interessantere Fälle als eine langweilige Feuerwehrfrau mit Pferdetritt.« Sie plapperte einfach einen Satz nach dem anderen. Auch das schrieb sie innerlich den Medikamenten zu, aber sie konnte nicht aufhören, bis sie sah, dass die Ärztin sich der Tür zuwandte.
»Hm, ja, gut also«, sagte Doktor Schneck noch immer etwas zögerlich.
»Ja, also, gute Nacht. Danke noch mal«, schloss Maxi die Situation endgültig ab. Nur nicht hierbleiben müssen. Auch wenn der Anblick der Ärztin eine enorme Aufmunterung war und sie ihre Verletzung für die paar Minuten ihrer Anwesenheit fast vergessen ließ.
Wie sie ohne diese Ablenkung wieder in ihr T-Shirt kommen sollte, wusste sie noch nicht. Zur Not musste Elli ihr ein Handtuch aus ihrer gepackten Reisetasche umschlingen. Wie voreilig von ihrer Schwester, gleich eine Tasche für den Krankenhausaufenthalt zu packen. Maxi grinste bei dem Gedanken. Sie durfte heim!
Doktor Schneck schob in diesem Moment die Schiebetür des Behandlungsraumes auf und verschwand mit einem letzten geheimnisvollen Blick, den Maxi nicht deuten konnte, aus ihrem Blickfeld.
Ein Seufzer entfuhr ihr, und sie spürte mit einem Mal wieder ganz deutlich, wo das blöde Ross sie getroffen hatte. Bis auf den Millimeter genau konnte sie es verorten. Hatte Doktor Schneck heilende Hände? Oder irgendeine esoterische Kraft, die Verletzungen unterdrückte? Es war mysteriös. Die Ärztin hatte sie so in ihren Bann gezogen, dass sie fast alles vergessen hatte. Wie schade, dass sie sie nie wiedersehen würde. Wirklich schade.
»Ich verfrachte dich jetzt nach Hause. Auch wenn ich es lieber gesehen hätte, wenn sie dich im Krankenhaus behalten hätten. Zur Beobachtung und so.«
»Nur über meine Leiche bleibe ich hier länger als nötig.«
Auch wenn hier eine gewisse Ärztin durch die Gänge lief. Maxi seufzte wieder und bereute es sofort.
5
Willa betrat am nächsten Nachmittag den gepflasterten Weg, der zum Haus ihrer Eltern in der Ortsmitte von Weiler führte. Ihr Elternhaus lag wunderbar idyllisch neben der alten Kirche unter altem Baumbestand.
Als Kind hatte sie hier in der Straße mit dem Ball gespielt und war mit ihrem Roller rauf- und runtergefahren. Ihr älterer Bruder war immer eher unterwegs bei seinen Freunden gewesen oder in den diversen örtlichen Vereinen. Aber für sie war das schon damals nichts gewesen. Und sie konnte sich auch jetzt, da sie die neue Weilerer Hausärztin wurde, nicht vorstellen, wieder hier zu wohnen. Bei dem Gedanken allein bekam sie schon Beklemmungen. Wie gut, dass sie ihre Wohnung in der Stadt behielt, auch wenn das hieß, dass sie pendeln musste. Fünfundzwanzig Minuten Fahrt waren verkraftbar. Die hatte sie auch jetzt nach der furchtbaren Nachtschicht trotz Übermüdung geschafft.
Eigentlich hatte sie heute nur entspannen wollen, aber die Begegnung gestern mit der Feuerwehrfrau brachte sie hierher nach Weiler.
Sie hatte immer noch den Schlüssel zum Haus und öffnete die Tür mit einem lauten »Hallo« in den Flur.
Ihre Mutter schaute sofort aus der Küche, die ihr Reich war. »Wilhelmine, was machst du denn hier? Ich dachte, du kommst erst übermorgen. Jetzt hab ich überhaupt nichts hier, was ich dir anbieten kann. Dein Vater geht doch jeden Freitag in den Schützenverein, da koche ich nichts.« Über den Rand ihrer Lesebrille schaute sie sie mit einem leichten Vorwurf an. Einen Ausdruck, den sie relativ häufig im Zusammenhang mit ihrer Tochter zur Schau trug. Auch wenn es besser geworden war, seit Willa verkündet hatte, dass sie die Praxis im Ort übernahm. Aber das war vermutlich nur eine kurze Pause, die vielleicht in diesem Augenblick schon wieder vorüber war.
»Hallo, Mama. Das macht doch nichts. Ich hab mich ja auch nicht angemeldet.« Willa bemühte sich um einen freundlichen Tonfall. Bemühen war genau das, was sie mit ihrer Mutter immer machte. Wenn sie sich nicht bemühen würde, könnte sie vermutlich überhaupt keinen Kontakt zu ihr halten.
Ihre Mutter setzte die Brille rasch ab. »Ich geh noch schnell rüber zum Bäcker und hole ein paar süße Stückchen. Vielleicht will ja dein Bruder mit uns Kaffee trinken.«
Willa erstaunte es, dass ihre Mutter ihren Bruder erst im zweiten Satz erwähnte und nicht bereits im ersten, wie es normalerweise der Fall war. Es stellten sich ihr automatisch schon wieder die Nackenhaare auf.
Ihr Bruder war das goldene Kind. In den Augen ihrer Mutter konnte er nie etwas falsch machen. Seit jeher wurde er ihr als hehres Vorbild hingehalten. Schon ihr ganzes Leben lang. Ihr Verhältnis zu ihrem Bruder Wilhelm – ja, wie bitter, sogar ihr Name war ein Abklatsch von seinem – hatte das nicht gerade positiv beeinflusst. Natürlich war Wilhelm im Dorf geblieben, hatte hier heterosexuell geheiratet und Kinder gezeugt. Er war zwar inzwischen schon wieder geschieden, aber selbst das wurde ihm nicht angekreidet. Das lag, laut ihrer Mutter, nur an der schrecklichen Ex-Schwiegertochter, die alles in der Ehe falsch gemacht hatte, wenn sie solch einen Mann wie Wilhelm nicht hatte halten können.
Willas Sympathien lagen hingegen bei ihrer Ex-Schwägerin Larissa, mit der sie immer noch Kontakt hatte, was aber niemand aus ihrer Familie wissen durfte, weil sonst der dritte Weltkrieg ausgebrochen wäre.
»Ich wollte eigentlich nur kurz bleiben und dann in die Praxis rübergehen.«
Aber so schnell ließ sich Gertrud Schneck nicht von einem eingeschlagenen Kurs abbringen. »Einen Kaffee wirst du ja wohl mit uns trinken können. Wilhelm soll seinen Freund Bernd mitbringen. Den kennst du noch nicht. Ein sehr netter junger Mann.«
Und Bingo. Da waren sie bereits im Hausflur wieder bei einem Thema, das noch in jedem Gespräch irgendwie vorgekommen war: der Wunsch ihrer Mutter nach einem Schwiegersohn. Das war vollkommen abwegig, und trotzdem gab ihre Mutter nicht auf. Willa hatte noch nie etwas mit einem Mann gehabt, noch nicht einmal ansatzweise, sodass das die Hoffnungen ihrer Mutter irgendwie nähren könnte. Sie war so maximal homosexuell, wie es nur ging, aber das interessierte Gertrud Schneck nicht.
Als Willa mal gesagt hatte, dann solle eben ihr Bruder Wilhelm in zweiter Ehe einen Mann heiraten, kam das gar nicht gut an. Sie hatte schon alle Strategien gefahren: geduldiges Erklären bis zum Abwinken, wütende Retouren bis hin zur Aggression, schnippische Antworten, Gleichmütigkeit, Witz. Aktuell war sie beim Ignorieren angekommen. Das machte sie auch jetzt wieder so. »Ich habe einen Kaffee in meinem Thermosbecher dabei. Ich werde also gleich rüber in die Praxis gehen. Ich wollte nur kurz Hallo sagen.«
Und ein paar Infos aus ihrer Mutter herausquetschen, die grundsätzlich alles aus dem Dorf wusste. Da würde sie ja wohl auch wissen, was es mit der Feuerwehrfrau Maxi Gnädig auf sich hatte und wo sie zu finden war. Willa wusste zwar noch nicht, wie sie auf elegante Art mit ihr in Kontakt kommen konnte, aber das würde sich vielleicht noch zeigen.
Ihre Mutter zog erwartungsgemäß einen Flunsch, aber Willa ließ sich davon nicht beeinflussen. Hatte sie nicht mehr, seit sie fünfzehn war.
»Wenn du meinst«, sagte Gertrud Schneck reichlich pikiert, was Willa nur am Rande wahrnahm, da ihre Gedanken sich schon wieder nur um die Feuerwehrfrau drehten.
Eigentlich hatte sie noch gestern Nacht irgendwie das Gespräch auf Privates lenken wollen. Ihr war nur absolut nichts eingefallen. Im Gehen hatte sie nach Worten gesucht, hatte fallenlassen wollen, dass sie bald in Weiler praktizieren würde, dass man sich doch mal sehen könnte. Irgendwas.