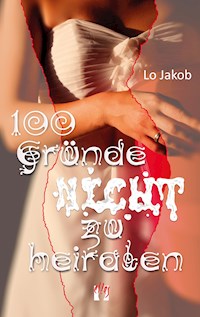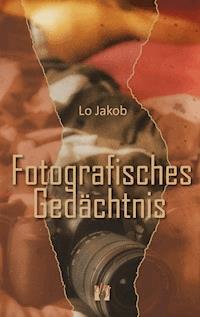Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: édition el!es
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Weil die erfolgreiche Managerin Maria ihre Nerven und sich nicht mehr im Griff hat, nimmt sie eine Auszeit auf dem Land, um ihren dementen Großonkel zu pflegen. Und damit platzt sie in das gemütliche Einsiedler-Leben der Imkerin Theresa, die sich als Nachbarin bislang um Großonkel Willi gekümmert hat. Zoff ist programmiert und gipfelt im Einsatz des Sprengmittelbeseitigungsdienstes. Doch mit Willis Ableben ändert sich alles, denn ein unerwartetes Testament, dunkle Geheimnisse in der Familiengeschichte und eine raffgierige Verwandtschaft schweißen Maria und Theresa mehr zusammen, als ihnen zunächst lieb ist ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lo Jakob
DIE HONIGFALLE
Roman
© 2017édition el!es
www.elles.de [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-95609-219-0
Coverillustration: © Leysan, sldesign1 – Fotolia.com
Prolog
Theresa betrat das Haus ihres Nachbarn mit einem unguten Gefühl. Willi war einundachtzig und ein echter Eigenbrötler. Er kam mit niemandem aus. In der ganzen Umgebung war er verhasst, und niemand kümmerte sich um ihn. Nicht, dass er das überhaupt gewollt hätte. Dass er heute nicht schon misstrauisch aus der Tür geschaut hatte, als sie auf den Hof fuhr, war ungewöhnlich. Niemand betrat sein Grundstück, ohne dass Willi das kontrollierte und absegnete.
Theresa war die Einzige, die unangekündigt kommen durfte. Aus ihr nicht ganz einleuchtenden Gründen war sie in Willis Augen in Ordnung. Vielleicht lag es daran, dass sie beide so weit außerhalb des Dorfes wohnten und dadurch eine Art Zweckgemeinschaft bildeten. Vielleicht auch daran, dass sie beide ähnlich weltabgewandt lebten und er in ihr eine verwandte Seele sah. Oder daran, dass Willi auf sie zugekommen war und nicht umgekehrt – nachdem sie bereits ein Jahr lang fünfhundert Meter von ihm entfernt gewohnt hatte. Sie hatte ihn nicht bedrängt.
Was auch immer es war, in den letzten sechs Jahren hatte sich so etwas wie eine zurückhaltende Freundschaft entwickelt. Und jetzt, da Willi immer mehr abbaute, fühlte sie sich verpflichtet, ab und an nach dem Rechten zu sehen. Aber inzwischen war sie schon ein paar Wochen nicht mehr bei ihm gewesen und hatte ihn auch nicht zufällig in Feld und Flur getroffen, wenn sie nach ihren Bienenvölkern schaute.
Die alte Haustür hatte offen gestanden. Sie hatte angeklopft, aber keine Antwort erhalten. Zögerlich trat sie nun weiter in den Hausflur. Sie hatte immer das Gefühl, sich bücken zu müssen, wenn sie Willis Haus betrat, so niedrig war das alte Bauernhäuschen. Obwohl sie sich noch im Eingangsbereich befand, schlug ihr eine Welle von Mief entgegen. Das ganze Haus schien nach altem Mann zu stinken. Nach dreckigem altem Mann. Eine Mischung aus Urin, Schweiß, Alter, verkommenen Lebensmitteln und schlicht und ergreifend Dreck. Theresa versuchte nicht durch die Nase zu atmen. Sie ging die quietschende alte Holztreppe hoch – immer dem Geruch hinterher.
»Willi? Bist du da? Ich bin’s. Die Resi.«
Keine Antwort. Sie sah in die Küche und erschrak über den Zustand des Raumes. Überall vergammeltes Essen und Fliegen. Ein grün verschimmelter Rest Brot lag auf dem Küchentisch, und wie es aussah, war erst vor kurzem ein Stück davon abgeschnitten worden. Theresa wurde es fast übel bei dem Anblick. Die Rillen des alten Metallgriffs an der Tür schnitten ihr in die Hand, so fest hielt sie ihn. Dann schloss sie die Küchentür mit ihren Butzenfenstern wieder und wandte sich in dem verwinkelten, dunklen Flur zum Wohnzimmer.
»Willi?«, rief sie noch einmal.
Dieses Mal kam eine Antwort, ein heiseres »Ja«. Es hörte sich schwach an. Sie öffnete die Wohnzimmertür und hätte fast gewürgt.
Der Gestank war hier um ein Vielfaches potenziert. Und der Verursacher, der in einem alten Ohrensessel am Ofen saß, sah auch entsprechend aus. Willi war total verwahrlost. Seine Kleider wirkten, als habe er sie schon seit Wochen nicht gewechselt – vollkommen verdreckt. Die Hose hatte im Schritt verdächtige dunkle Flecke. Essensreste klebten an seinem karierten Hemd, das schon bessere Zeiten gesehen hatte. Er war unrasiert, seine Haare eine graue, ungekämmte und fettige Matte. Seine Augen schimmerten glasig, und seine Wangen wirkten eingefallen. Theresa war geschockt. Dass die Lage hier so bedenklich war, hätte sie nicht erwartet.
Willi sah sie mit unstetem Blick an und schien etwas zu suchen. »Hast du heute Wolfi gar nicht dabei?«, fragte er schließlich mit undeutlicher Aussprache.
Wolfi, Theresas Hund, war schon seit drei Jahren tot. Und Willi hatte sein Gebiss nicht drin. Es lag vor ihm auf dem Tisch. Fliegen scharten sich darum und veranstalteten ein Volksfest.
Theresa überwand sich und trat in das stickige, stinkende Zimmer. »Wolfi? Der ist doch an Altersschwäche gestorben. Erinnerst du dich nicht?«, fragte sie Willi vorsichtig, während sie auf ihn zutrat. Der Ofen war kalt, und es war kühl im Raum, trotz der frühsommerlichen Wärme draußen. Da Willi anscheinend mit allem einschließlich persönlicher Pflege überfordert war, hatte er wohl auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gelüftet. Vorsichtig sog Theresa die Luft zwischen den Zähnen ein, hatte aber trotzdem das Gefühl, hier drin ersticken zu müssen.
»Quatsch«, fuhr Willi plötzlich unerwartet kraftvoll auf. »Du warst doch noch gestern mit ihm zusammen hier. Da ist er doch noch draußen rumgesprungen wie ein junger Hund.« Merkwürdig, für dieses verärgerte Blaffen schien er noch Energie zu haben.
»Wolfi ist schon lange tot«, insistierte sie und flehte innerlich, dass bei ihm wieder so weit Klarheit einziehen möge, dass sie vernünftig mit ihm reden könnte. Dann wäre schon viel gewonnen. Aber ihre Hoffnung war vergebens.
»Wenn du mich weiter verarschen willst, kannst du dich auf was gefasst machen. So wie der Rest von der Saubande.« Willi drohte ihr jetzt sogar mit der geballten Faust. Er hatte ein fast unheimliches Funkeln in den Augen.
Vorsicht war angebracht, das wusste Theresa. Willi war schon öfter mal verwirrt gewesen, und das war bei ihm häufig gepaart mit Aggressivität. Heute schien es besonders schlimm zu sein. Und sie hatte keine Lust, mit einem stinkenden, gebrechlichen Greis ringen zu müssen, den sie eigentlich als Freund betrachtete.
»Scherz«, verkündete sie deshalb mit einem Grinsen und log um Willis Seelenfrieden willen: »Wolfi ist zu Hause und hütet die Schafe.« Es hatte keinen Zweck, auf der Realität zu beharren. Die war Willi offensichtlich abhanden gekommen. Zusammen mit dem Rest seines Verstandes und seiner Würde.
Statt einer Antwort brummelte Willi – jetzt wieder friedlich – nur vor sich hin.
Es führte kein Weg dran vorbei: Sie müsste die Nummer seiner Nichte heraussuchen und sie anrufen. Seit einiger Zeit schob sie das nun schon vor sich her. Willi hatte keine eigenen Kinder, war auch nie verheiratet gewesen. So viel wusste Theresa. Er hasste seine ganze restliche Verwandtschaft. Deshalb wollte sie ihm das eigentlich nicht antun. Aber wenn es so weiterging, läge er eines schönen, ziemlich nahen Tages hier tot in seinem Häuschen, und sie würde sich bittere Vorwürfe machen.
Maria Ossola, von allen außerhalb der Geschäftswelt Maia genannt, saß in der gefühlt fünftausendsten Sitzung ihres dreiunddreißig Jahre zählenden Lebens und fragte sich, ob sie etwas anderes hätte studieren sollen. Augen auf bei der Berufswahl, hatte Großonkel Willi immer gesagt. Jetzt war sie Managerin in einem international tätigen Unternehmen, das Heizkörper produzierte, und konnte sich in diesem Moment nichts Unsinnigeres auf der Welt vorstellen.
»Frau Ossola, die Zahlen stimmen hinten und vorn nicht.« Einer der Aufsichtsräte plusterte sich auf. »So können Sie wirklich nicht hier in der Sitzung auftauchen. Bei allem Verständnis für die kurze Zeit, die Sie zur Verfügung hatten.«
Sie hatte den Typen noch nie leiden können. Außerdem hatte er wohl auch noch recht. Das Schlimme war, dass ihr das fast gänzlich egal war. Diese Erkenntnis riss sie kurz aus ihrer Gleichgültigkeit – denn normalerweise war ihr nichts wichtiger als ihre Karriere, ihr Erfolg, ihr berufliches Standing. Sie war die geborene Managerin. Hatte sie zumindest immer gedacht.
Aber ihr Kopf fühlte sich mal wieder an, als sei er in Watte verpackt, und ihr Herz hämmerte schon seit dem frühen Morgen wie bei einem Marathon. Herzrasen, analysierte sie mit erstaunlicher Klarheit, während um sie herum Stimmen auf sie zubrandeten und wieder abebbten.
So ging das jetzt schon seit Wochen. Mal mehr, mal weniger. Sonst ignorierte sie diese Revolte ihres aufmüpfigen Körpers einfach. So wie sie in den letzten Jahren Schlafmangel, übermäßigen Stress und Verspannungskopfschmerzen übergangen hatte. Sich stets gezwungen hatte weiterzumachen, egal wie beschissen es ihr ging. Mit purem Willen. Und davon hatte sie Unmengen.
Aber dass der sich irgendwann verabschieden würde, war nicht eingeplant gewesen. Schon gar nicht jetzt gerade, in diesem chromblitzenden, pompösen Besprechungsraum im achtzehnten Stock auf einer Sitzung mit den Aufsichtsräten, bei der es um die anstehende Messe in Hongkong ging und den sich rasant entwickelnden chinesischen Markt. Für dessen Einschätzung sie zuständig war. Sie sollte China von hinten aufrollen, am besten flächendeckend mit den von ihrem Unternehmen hergestellten Heizkörpern überziehen und damit eine Gewinnmarge produzieren, die den Herren Aufsichtsräten die Dollarnoten aus den Ohren quellen lassen sollte.
Wenn es allerdings so weiterging wie die letzten Wochen, würde der Gewinn kleiner ausfallen. Sie war nicht in bester Verfassung, das musste sie sich zähneknirschend eingestehen. Das Gefühl der absoluten Überforderung überkam sie wieder, während die Zahlen, die der Beamer an die Wand warf, vor ihren Augen flirrten. Wenn sie jetzt nicht alles zusammennahm, was sie an Selbstbeherrschung und Konzentration noch übrig hatte, ergaben die verdammten Zeichen und Tabellen noch nicht einmal Sinn. Obwohl sie normalerweise für Zahlen lebte. Sie liebte es, mit ihnen zu jonglieren. Doch heute waren sie überhaupt nicht ihre Freunde. So mies hatte sich Maia noch nie gefühlt: vollständig energielos und gleichzeitig kurz vor der Explosion.
Ihr Chef schien zu spüren, dass etwas nicht stimmte, und versuchte ihr beizustehen auf seine unfähige Art: »Von jemandem mit Ihren italienischen Wurzeln hätte ich mehr Leidenschaft für die Sache erwartet, Frau Ossola.« Er grinste in die Runde und fand seinen Witz über ihren italienischen Nachnamen wahrscheinlich gelungen.
Den Versuch musste sie ihm wohl anrechnen. Aber Herrgott noch mal, sie stammte aus einer Familie von Waldensern und war so deutsch, wie es nur ging. Ihre Vorfahren waren seit dem 17. Jahrhundert im Land. Sie sprach noch nicht einmal italienisch. Und das wusste er auch – oder sollte er zumindest wissen.
Sie fing an, im Kopf zu zählen. Das half ihr normalerweise immer, sich zu beruhigen. Heute war es vergebens. Sie kam bis zwölf. Dann fing sie an zu kichern.
Sie wusste noch nicht einmal, weshalb. Die Runde dachte zuerst, sie lache über den Scherz, und stimmte mit aufgesetztem Lachen ein. Als sie aber immer weiter kicherte und sich das Ganze noch steigerte, während die anderen alle angemessen schnell aufhörten mit ihrem künstlichen Amüsement, erntete sie ungläubige und zunehmend irritierte Blicke. Aber sie konnte beim besten Willen nicht aufhören. Ihre Gesichtsmuskeln schmerzten bereits, ihre Zähne schlugen immer wieder hart aufeinander, sie spürte unfeine Spuckefäden an ihren Mundwinkeln. Und obwohl sie all das in ihrem abgedrehten Zustand bemerkte, musste sie hysterisch weiterlachen. Tief aus dem Bauch, mit verzerrt klingenden Lauten.
Sie sah die entsetzten Mienen ihrer Vorgesetzten und Kollegen, und ihr Lachen wurde noch lauter. Ihr Würmer, schoss es ihr durch den Kopf, und gleichzeitig sah sie die Köderdose von Großonkel Willi vor sich, wenn sie mit ihm zum Angeln gegangen war in ihrer Kindheit. Wieso musste sie gerade so viel an Willi denken? Sie hatte ihn bestimmt schon zehn Jahre nicht gesehen. Dann kehrte wieder der Gedanke an die Würmer zurück. Wie sie sich gewunden hatten, bevor er sie auf den Haken gespießt hatte. Das war immer eklig gewesen. Die Erinnerung ließ sie abrupt verstummen.
Sie erhob sich, ließ ihre Unterlagen und ihren Laptop liegen und ging ohne ein Wort zu sagen aus dem Raum. Im Rücken spürte sie die Blicke der anderen, aber jetzt musste sie nur noch hier raus. Ihr Herz hämmerte in einem Tempo, dass sie das Gefühl hatte, es würde ihr gleich aus der Brust springen. Sie bekam keine Luft, und ihr Kopf wollte wie ein heliumgefüllter Ballon davonfliegen.
Noch im Hinauslaufen riss sie sich ihr Jackett vom Leib. Sie hielt es nicht mehr aus, darin eingezwängt zu sein. Über mit tiefem, weißem Teppich ausgelegte Flure mit teurer Kunst an den Wänden wankte sie planlos davon, bis die Rettung in Form der nächstgelegenen Toilette auftauchte. In dem stilvollen Raum zwängte sie ihren Kopf unter den Designer-Wasserhahn, der dafür nicht vorgesehen war und entsprechend wenig Platz bot. Eiskaltes Wasser lief auf ihre kunstvoll modellierte, blondgefärbte Hochsteckfrisur.
Während sie bis zweihundert zählte und sich ihr Puls dabei langsam beruhigte, wurde ihr klar, dass sie gerade so eine Art Nervenzusammenbruch gehabt hatte. Sie starrte in den Abfluss, wo das Wasser in stetem Strom verschwand. Das Wort Burnout schien über ihrem Kopf zu hängen wie ein Damoklesschwert.
Dann fing sie wieder an zu lachen. Sie riss den Kopf hoch, dass das Wasser nur so in dem eleganten Toilettenraum herumspritzte und ihr in Bächen auf die teure Seidenbluse hinunterfloss. Alles scheißegal.
1 In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit . . .
Die Frau am Fahrbahnrand hämmerte auf ein Smartphone ein. Hier draußen so tief im Odenwald hatte es keinen Empfang, das hätte Theresa ihr vorher sagen können. Und im Dunkeln auf der abgelegenen Landstraße konnte sie lange warten, bis jemand vorbeikommen würde. Theresa seufzte schicksalsergeben: außer ihr. Sie kam gerade vorbei. Ihr Gewissen ließ es nicht zu, dass sie einfach weiterfuhr.
Sie hielt ihren verbeulten Jeep rechts am Straßenrand und stieg aus.
»Was ist das Problem?«, fragte sie ziemlich barsch. Diese Aktion hier musste jetzt wirklich nicht sein. Hoffentlich ließ sich das Ganze in fünf Minuten über die Bühne bringen. Sie war erledigt und auch ein bisschen in Missstimmung, nachdem sie hatte feststellen müssen, dass eines ihrer besten Völker geschwärmt war. Eine hervorragende Königin war ihr damit abhanden gekommen, und sie hatte den Schwarm trotz intensiver Suche nirgends gefunden. Sie hatte sich über sich selbst geärgert. Denn hätte sie das Volk in letzter Zeit besser kontrolliert, hätte sie die Schwarmstimmung bemerken müssen. Aber die letzten Wochen waren anstrengend gewesen. Jeden Tag zweimal zu Willi rüber, ihm Essen bringen, ihn je nach Stimmungslage zum Anziehen frischer Kleider animieren, die gröbste Schweinerei in seinem Häuschen wegräumen . . . Und es war gerade Hochsaison in der Imkerei. Ihre hundert Völker hielten sie auf Trab. Aber geschwärmt war ihr schon seit langem kein Volk mehr, Zeitsorgen hin oder her.
Die Frau neben dem schicken, dunkel glänzenden Wagen sah ihr mit großen Augen entgegen. »Oh mein Gott«, stieß sie atemlos hervor, »bin ich froh, dass Sie angehalten haben. Ich habe einen Platten, und mein Handy schafft es nicht, zum Pannendienst durchzukommen. Haben Sie ein Handy dabei? Oder können Sie mich zur nächsten Werkstatt bringen?«
Theresa hätte fast losgelacht, so viel Unsinn war in diese paar Sätze gepackt. Aber was sollte man auch von so einer erwarten. Businessanzug, hochhackige Schuhe, kein Haar in Unordnung. Die Frau sah aus, als hätte sie in ihrem ganzen Leben noch nie an irgendwas Hand anlegen müssen, weil immer irgendjemand da war, der das machte. Wahrscheinlich hätte sie es lieber gehabt, dass ein Mann angehalten hätte. Der wäre auf das Hilflose-Frauchen-Schema mit Sicherheit ganz anders eingestiegen als Theresa. Sie war gegen so was hochgradig allergisch.
»Haben Sie ein Ersatzrad?«, fragte sie ungeduldig. Je schneller sie dieser Frau den Reifen gewechselt hätte, desto schneller wäre sie daheim und könnte endlich etwas essen. Ihr Magen knurrte, seit sie das ganze Gelände rund um ihren Bienenstand abgestiefelt war und alle Äste und Baumhöhlen nach ihrem Bienenschwarm abgesucht hatte. Und das war schon wieder Stunden her.
Mit einem irritierten Stirnrunzeln erklärte die Frau: »Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich hab noch nie eines bemerkt.« Ihr war offensichtlich nicht klar, dass man einen Platten durchaus auch selbst beheben konnte. Solche hilflosen Pflänzchen lösten bei Theresa immer Unverständnis aus. Da kämpften Frauen nun schon so lange um ihre Gleichstellung, wollten emanzipiert sein und nicht als unterlegenes Geschlecht gelten, aber sobald es bei solchen Weibchen wie dieser hier um einen Glühbirnenwechsel ging, wurde nach einem Mann gerufen. Lächerlich und kontraproduktiv. So würden Frauen nie ernst genommen werden. Aber der anderen das jetzt zu erklären, würde sie nur Nerven kosten, und die Frau in den Pumps würde es vermutlich noch nicht einmal verstehen.
Theresa besah sich den Reifen vorn rechts. Tatsächlich, einfach nur platt. Dann trat sie zum Kofferraum. »Aufmachen okay?« Sie deutete auf den Kofferraumdeckel.
»Ja, aber da ist alles voll mit meinem Gepäck«, kam die zögerliche Antwort.
Theresa ignorierte das, öffnete den Kofferraum und fing an, die Taschen der Frau auf die Straße zu räumen.
Die protestierte: »Hey! Was machen Sie denn da?«
»Ersatzrad rausholen. Liegt unter der Kofferraumabdeckung«, gab Theresa knapp Auskunft. Nerviger ging es wirklich nicht. Wenn diese feine Madame mithelfen würde, ginge alles doppelt so schnell, aber die stand nur rum und schaute ungläubig auf ihre Taschen und Koffer.
Nachdem sie endlich den Boden des Kofferraums freigelegt hatte, hob Theresa die Abdeckung an, unter der wie vermutet das typische dünne Ersatzrad zusammen mit dem Radkreuz und dem Wagenheber lag. Sie selbst hatte ja für ihren Jeep immer ein normales Rad zum Auswechseln dabei. Doch dass Madame mit dem Ersatzrad nur langsam weiterfahren konnte und bald eine Werkstatt aufsuchen musste, war nicht ihr Problem. Immerhin: Alles war in einem gepflegten Zustand. Offensichtlich hatte die Dame eine gute Werkstatt. Oder der Wagen war so neu, dass alles noch frisch aus der Montagehalle war.
Wie auch immer, der Reifen würde sich nicht von selbst montieren. Theresa wuchtete das Rad heraus und rollte es nach vorn. Reifenwechsel war eine absolut einfache Angelegenheit, man wurde nur saumäßig dreckig dabei. Sie seufzte. Was soll’s. Ein paar Flecke mehr oder weniger auf ihrer Arbeitsjeans waren jetzt auch vollends egal.
Maia beobachtete, wie ihre gute Samariterin sich mit aller Kraft in das kreuzförmige Werkzeug stemmte – wie auch immer dieses Teil hieß, mit dem man Schrauben am Auto öffnete – und sich zum wiederholten Male nichts tat. Die Frau hatte Kraft, das war deutlich zu sehen. Und sie schien das auch nicht zum ersten Mal zu machen. Trotzdem rührten sich die Schrauben kein Stück. Ihre Helferin fluchte vor sich hin. Irgendwas von wegen Idioten,Pressluft und sollte unter Strafe stehen. Maia hatte keine Ahnung, was sie damit meinte.
»Ihre Scheißwerkstatt hat die Muttern mit Pressluft angezogen. Die sitzen bombenfest«, stieß die Fremde schließlich ärgerlich hervor und stapfte zu ihrem eigenen Auto.
Ein paar Herzschläge lang befiel Maia Panik. Wollte diese Frau sie jetzt etwa hier zurücklassen? Sie kam sich so hilflos und dämlich vor. Die Frau war nicht gerade freundlich und zeigte offen, dass sie Maia für beschränkt hielt. Überhaupt war sie ein ganz und gar gefühllos wirkendes Exemplar ihrer Gattung. Ihr Gesicht sah im Licht der Autoscheinwerfer hart und vollkommen humorlos aus. Eine Meisterin der Kommunikation war sie auch nicht gerade. Bisher hatte sie keine fünf Sätze mit ihr gewechselt, obwohl sich Maia doch durchaus bemüht hatte, nachdem der erste Schock überwunden war. Waren die Frauen hier auf dem Land alle so wie ihre ungewollte abendliche Retterin? So abgearbeitet, so vorzeitig gealtert, so herb? Die Jeans und das T-Shirt machten den Eindruck, als würde sie jeden Tag darin arbeiten. Landwirtschaft vermutlich. Kurze, dunkle Haare – war wohl praktisch so. Zumindest sah die Frisur nicht nach mehr aus.
Maia beobachtete, wie die grobe Landwirtin in ihrem dreckigen alten Geländewagen herumwühlte und Sachen beiseiteräumte, deren Verwendungszweck ihr ein Rätsel war. Holzkisten, merkwürdige Werkzeuge, dann zog sie ein metallenes Rohr hervor. Für einen Moment bekam Maia es erneut mit der Angst zu tun. Würde die Grobe damit jetzt auf sie losgehen? Aus Rache für die Pressluft?
Aber die Frau ging mit einem abfälligen Grunzen an ihr vorbei und stülpte das Rohr über eines der Enden am kreuzförmigen Werkzeug. Sie fing an, am Rohrende zu drücken, dass ihr die Muskeln an den Oberarmen anschwollen. So viel war Maia klar, dass sie jetzt einen längeren Hebel hatte und damit mehr Kraft auf die festsitzenden Schrauben ausüben konnte. Kurz war sie von der Cleverness der anderen beeindruckt. Bis die Frau wieder anfing zu fluchen.
»Verdammte Bullenscheiße.«
Ihr Vokabular sprach nicht gerade für gute Manieren und gepflegten Umgang. Was für ein derber, roher Klotz diese Frau doch war. Aber Maia musste dankbar sein, dass sie gehalten hatte und ihr half. Auch wenn es nicht so aussah, als ob das mit dem Reifenwechsel etwas werden würde.
Die Frau steckte das Rohr noch einmal in ein anderes Ende des Radkreuzes ein, so dass es tiefer und parallel über dem Boden lag. Maia beobachtete verwundert, wie sie mit ihren derben Arbeitsstiefeln schwungvoll auf das Rohrende sprang. Mit einem ohrenbetäubenden, quietschenden Geräusch gab die Schraube unter ihrem Gewicht nach.
»Na also«, brummte ihre Helferin zufrieden und machte sich daran, den anderen vier Schrauben genauso zu Leibe zu rücken. Mit einer gewissen Faszination sah Maia ihr dabei zu. Ungläubigkeit paarte sich mit Bewunderung. Die andere war inzwischen an Händen und Kleidung ziemlich mit schwarzer Schmiere versaut. Sogar im Gesicht hatte sie einen Streifen.
Sie müsste der Frau Geld für ihre Mühen geben, beschloss Maia. Die Kleider würde die Landwirtin wahrscheinlich wegwerfen müssen. Maia verstand zwar nicht ganz, warum sie sie nicht zum nächsten Telefon oder der nächsten Werkstatt gebracht hatte oder auch einfach nur zum nächsten Taxi, aber vielleicht war das so eine Art Ehrenkodex auf dem Land. Oder – die Erkenntnis kam unvermittelt und löste ein beklemmendes Gefühl aus – vielleicht war das hier draußen, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagten, am späten Abend auch gar nicht so einfach.
Eigentlich hatte sie viel früher in Frankfurt wegkommen wollen. Sie hatte sich verschätzt, wie lange die Fahrt hierher in den abgelegensten Winkel des Odenwalds dauerte. Schließlich war sie schon Jahre nicht mehr hier gewesen. Genauer gesagt waren es exakt elf Jahre, seit sie Willi zuletzt besucht hatte. Zu seinem Siebzigsten. Deshalb plagte sie schon die ganze Zeit das schlechte Gewissen – seit sie krankgeschrieben war und Zeit hatte, über so einiges nachzudenken. Und umso mehr, seit sie von ihrer Mutter erfahren hatte, dass es ihm nicht gutging.
Willi war nicht wirklich ihr Großonkel. Sie waren weitläufiger verwandt. Ihre Mutter war seine Cousine zweiten Grades – oder irgend so was. Trotzdem war sie als Kind häufig bei ihm gewesen. Er hatte sich nicht daran gestört, dass sie ihre Nase die ganze Zeit in Büchern gehabt hatte. Es war ihm sogar recht gewesen, dass sie wenig redeten. Plappernde Kinder hatte er nicht leiden können, und Maia war das genaue Gegenteil gewesen. Der Rest der Welt fand die kleine Maia zu introvertiert. »Verstockt«, hatte ihre verhasste Tante Edeltraut immer gesagt. Aber Großonkel Willi war damals ihr Verbündeter gewesen.
Jetzt war sie die Abgesandte der Familie. Niemand anderes durfte ins Haus, der Rest der spärlichen Verwandtschaft hatte noch immer Besuchsverbot. Bisher hatte ihn eine Nachbarin mehr schlecht als recht versorgt. Wahrscheinlich irgendeine ältliche Witwe, die sich Hoffnungen auf eine Heirat mit Onkel Willi gemacht hatte. Die arme Frau konnte ihre Träume begraben: So wie Maia es verstanden hatte, war Willi nicht mehr der Alte. Sie würde sein Haus so weit auf Vordermann bringen, dass der Pflegedienst es betreten konnte. Und dann müsste man mal sehen. Vielleicht müsste sie auch ein Heim suchen. Das würde natürlich das Erbe schmälern, und wenn sie ihre Tante Edeltraut richtig verstanden hatte, sollte sie das um jeden Preis vermeiden. Aber ihre Tante konnte sie mal. Maia würde das machen, was für Willi am besten war. Wie praktisch, dass ich gerade jetzt Burnout gekriegt habe, dachte sie sarkastisch.
Ihre miesepetrige Retterin hatte inzwischen alle Schrauben gelöst und brachte das Ersatzrad in Position. Tatsächlich ging es jetzt ganz fix. Zügig drehte die Frau die Schrauben wieder hinein und zog sie an. Dann rollte sie den Reifen mit dem Platten um Maia herum und wuchtete ihn in den Kofferraum. Gott, musste die Muskeln haben, so leicht, wie das bei ihr aussah. Wahrscheinlich sah sie unter ihrer Kleidung aus wie eine russische Diskurswerferin der siebziger Jahre. Maia mochte Frauen lieber feminin. Obwohl sie wusste, dass viele Lesben auf durchtrainierte Körper standen und auch viele ihrer Bekannten bei den Nacktfotos von Abby Wambach glasige Augen bekamen. Die amerikanische Fußballerin hatte sich in Kämpferinnenpose ablichten lassen, jeder wohldefinierte Muskel zeichnete sich ab, und Maia war bei dem Anblick das Wort Kriegsgöttin in den Sinn gekommen. Ästhetisch, zweifellos, aber nicht ihr Beuteschema.
Die Frau, die sich gerade die Schmiere von den Händen wischte, war jedoch sowieso mit Sicherheit eine Hetera. Hier auf dem Land gab es bestimmt gar keine Lesben. Außerdem brauchte die Lesbenwelt keinen so ungehobelten Klotz in ihren Reihen. Es gab schon genügend Vorurteile. Da musste so eine sie nicht auch noch bestätigen.
Maia zog schnell einen Fünfziger aus ihrer Geldbörse. Die Frau hatte sich schon ohne ein weiteres Wort zu ihrem Auto gewandt und wollte sie offensichtlich nach getaner Arbeit einfach stehenlassen.
»Warten Sie«, rief es hinter ihr.
Theresa wischte sich die Hände mehr schlecht als recht an einem alten Lappen ab und rollte die Augen. Was war denn nun noch? Sollte sie der anderen auch noch das Gepäck wieder einräumen, war Madame sich auch dazu zu schade? Nicht genug, dass sie die ganze Zeit glotzend danebengestanden hatte, während Theresa sich an den blöden Radmuttern fast einen Bruch geholt hätte. Sie hatte auch nicht ein einziges Mal gefragt, ob sie mit irgendwas zur Hand gehen konnte, und sei es nur irgendetwas halten oder reichen. Wie eine Bedienstete hatte sie Theresa behandelt. Als ob sie in der Werkstatt einen Service durchführen ließe.
Die Schmiere wollte einfach nicht abgehen, und Theresa gab den Versuch auf, ihre Hände einigermaßen sauber zu kriegen. Sie würde daheim mit einer Spezialpaste ans Werk gehen müssen. Wortlos drehte sie sich um, warf den Lappen in den Kofferraum und wartete, was kommen würde. Sie würde es ihrem Gegenüber nicht leicht machen. Wenn sie mit dem Gepäck anfinge, würde sie ihr die Meinung geigen.
Aber die Frau streckte ihr einen Geldschein hin. Fünfzig Euro, wenn sie das richtig gesehen hatte in der Dunkelheit.
»Ich möchte mich erkenntlich zeigen. Für die Reinigung Ihrer Kleider, für Ihre Mühen, für ein Essen – was auch immer.«
Damit hatte Theresa nicht gerechnet. Sie sah die Frau kritisch an und versuchte einzuschätzen, welche Reaktion jetzt angemessen war. Der Kontrast zwischen ihnen hätte nicht größer sein können: Sie selbst in ihrer jetzt ganz und gar versauten Jeans und vermutlich insgesamt dreckig von Kopf bis Fuß nach einem langen Arbeitstag – die andere wie aus dem Ei gepellt in ihrem schicken Anzug, einer weißen Bluse und fünfzig Meter gegen den Wind nach einem ganzen Arsenal Kosmetika riechend. Sollte sie das Geld als Beleidigung auffassen? Was dachte die denn, wer sie war? Die Königin von Saba? Und Theresa eine Lumpensammlerin von der Müllkippe?
»Bitte«, insistierte die Businessfrau. »Ich bestehe darauf. Ohne Sie wäre ich hier draußen aufgeschmissen gewesen.«
Wenn die das weiterhin als Dienstleistung sehen wollte, dann ließ Theresa sich eben für den geleisteten Service bezahlen. »Stimmt«, grummelte sie, nahm den Geldschein an sich und stieg in ihr Auto.
Eigentlich sollte sie ja noch warten, bis die andere ebenfalls in ihrem Auto saß und losfuhr. Eine Frau im Dunkeln mitten in der Pampa allein stehenzulassen, war überhaupt nicht ihre Art und ging gegen alle ihre ethischen Grundsätze. Aber heute musste sie eine Ausnahme machen. Ihre Geduld mit der Person war einfach am Ende. Sie hatte ihr den Reifen gewechselt, das musste reichen. Die fünfzig Euro brannten ein Loch in ihre Tasche, so unangenehm war es ihr schon beim Losfahren, dass sie das Geld tatsächlich akzeptiert hatte. Unter Einsatz aller Logik strickte sie an einer Rechtfertigung, während sie ihren Jeep auf die kurvige kleine Straße zurücklenkte: Sie konnte das Geld gut gebrauchen, schließlich war sie so gut wie immer knapp bei Kasse. Fünfzig Euro, das war der Verkaufswert eines jungen Bienenvolk-Ablegers, und so viel hatte sie jetzt einfach durch den Reifenwechsel verdient. Und die Frau hatte eh viel Geld auf dem Konto, das konnte selbst jemand so Weltabgewandtes wie Theresa sehen – für die waren fünfzig Euro gar nichts. Trotzdem wünschte sie sich jetzt fast, den Schein nicht genommen zu haben. Sie kam sich dadurch billig vor. Gekauft eben. Ihre selbstverständliche Hilfeleistung wurde dadurch zu einem Geldgeschäft, in dem sie die inferiore Handlangerin war. Was für ein Abschluss eines großartigen Tages!
Sie würde jetzt als Erstes zu Hause ein oder zwei Bier bei den Schafen auf der Weide trinken und dabei in den Sternenhimmel schauen. Das wäre die nötige Versöhnung mit ihrer Umwelt, die sie jetzt brauchte.
Im Rückspiegel sah sie noch, wie das Weibchen im Businessanzug vollauf damit beschäftigt war, ihr Gepäck wieder zu verstauen, und dabei reichlich gestresst wirkte. Dann verlor sie sich in der Dunkelheit. Auf Nimmerwiedersehen.
Viel zu spät am Abend stand Maia endlich vor dem Bauernhäuschen, das sie aus ihrer Kindheit so gut kannte. Fast war es wie ein zweites Zuhause gewesen. Jetzt sah es düster und heruntergekommen aus, wie es da in vollkommener Dunkelheit lag. Hoffentlich würde sie Willi nicht zu Tode erschrecken, wenn sie abends um elf das Haus betrat. Aber es war nicht zu ändern. Die Reifenpanne hatte sie mindestens eine Stunde gekostet.
Mit ihrer Reisetasche beladen machte sie sich auf den Weg von dem mit Unkraut zugewucherten Stellplatz zur Haustür. Den Rest ihres Gepäcks würde sie morgen früh reintragen. Für die erste Nacht reichte das Notwendigste.
Die Haustür war wie immer nicht abgeschlossen. Darauf hatte sie gesetzt. Sonst hätte sie Willi jetzt aus dem Bett klingeln müssen. Hatte er überhaupt so etwas wie eine Klingel? Sie konnte sich nicht erinnern.
Maia trat in den bäuerlichen Flur, von dem aus der Keller, die Werkstatt und der vordere Teil des Stalls abgingen und auch die Treppe zur Wohnung im Obergeschoss. Hier hatte es schon immer nach einer bunten, erdigen Mischung gerochen – nach Most, den Willi selbst machte und der im Keller lagerte, nach Schmierfett aus der Werkstatt, nach Tierfutter. Aber das heute war nicht der Duft ihrer Kindheit. Es war ein widerlicher Gestank, der ihr da im Hausflur entgegenschlug. Grauslich. Was gammelte da im Keller nur vor sich hin?
Sie knipste mit dem alten Bakelitschalter das Licht an und beeilte sich, die Treppe hochzukommen. Aber der Gestank ließ nicht nach. Maia flüchtete sich in die dunkle Küche. Hier war es etwas besser, das Fenster war sperrangelweit offen, das half. Sie schaltete auch hier das Licht an. Alles war hier drin wie immer – so wie sie es von unzähligen Besuchen kannte. Direkt gegenüber der Tür war das zweiflüglige Fenster, links davon die Spüle, die Tür zum Badezimmer und der alte Herd, den man anfeuern musste. Unter dem Fenster stand noch immer der alte Holztisch mit den passenden vier Stühlen. Der hässliche Küchenschrank aus weißem Resopal war natürlich auch noch da und sah noch abgeschabter aus als früher.
Die Erschöpfung überkam Maia schlagartig. Sie war einfach zu nichts mehr imstande seit ihrem Zusammenbruch. Allein die Fahrt hierher und die Panne reichten schon aus, ihr Energiedepot vollkommen zu leeren. Aber was sie erstaunte, war die Tatsache, dass sie seit der Reifenpanne einen vollkommen klaren Kopf hatte. Und die Panne hatte sie auch ohne Herzrasen überstanden.
Vielleicht war es gar keine so schlechte Idee gewesen, ihre Auszeit zu nutzen, um sich um Großonkel Willi zu kümmern. Ablenkung schien gut zu funktionieren. Jetzt musste sie nur noch ihr altes Zimmerchen beziehen, und morgen konnte sie dann hoffentlich alles Notwendige in Angriff nehmen.
Mit zugehaltener Nase ging sie das kurze Stück über den Flur zu der groben Brettertür, die mehr danach aussah, als ob sie zu einer Rumpelkammer gehörte, und betrat das kleine Zimmer, das sie jede Ferien bewohnt hatte. Der Kippschalter klappte mit einem lauten Klick herum – und Maia hätte fast losgeheult.
Alles war überzogen mit Spinnweben und Staub, in den Ecken lag noch anderer verdächtiger Dreck. Mäuseköttel? Oder gar Nester? Das Zimmer machte den Eindruck, als sei es seit damals nicht mehr betreten worden. Die in ihrer Kindheit schon ziemlich wackeligen und zusammengewürfelten Pressspanmöbel sahen endgültig nach Sperrmüll aus. Das Bettzeug konnte man vermutlich nur noch mit Gummihandschuhen anfassen – wer wusste, was da drin wohnte.
Maia wäre am liebsten schreiend davongelaufen. Sie merkte, wie sich wieder ein hysterisches Lachen seinen Weg nach draußen bahnen wollte, und begann zu zählen.
Bei 37 angekommen schaffte sie es, ganz ruhig kehrtzumachen, ohne auszurasten. Hier konnte sie nicht schlafen. Auf gar keinen Fall. Bevor sie dem Zimmer nicht mit den giftigsten Putzmitteln, die sie finden konnte, zu Leibe gerückt war, würde sie dort nie im Leben ihr Lager aufschlagen.
Sie eilte durch den stinkenden Hausflur zurück zu ihrem Auto. Dann würde sie eben auf der Rückbank schlafen. Eine andere Möglichkeit blieb ihr wohl nicht, wenn sie Willi nicht wecken wollte. Es war Sommer, und sie hatte eine Decke im Kofferraum – das würde schon gehen. Sie hatte das zwar noch nie gemacht, aber so schlimm konnte es ja nicht sein. Einen Augenblick überlegte sie, sich umzuziehen; sie trug ihren legersten Anzug, aber zum Schlafen war das trotzdem nicht gerade ideal. Dann erschien es ihr zu viel Aufwand.
Mit der Autodecke rollte sie sich auf der Rückbank zusammen und versuchte, sich nicht schrecklich einsam zu fühlen. Und wie die größte Loserin auf der ganzen Welt. Oder wie eine Frau, die mächtig eine Schraube locker hatte. Sie begann wieder zu zählen. Bei 1356 gab sie es auf.
Nach vielem Hin- und Hergewälze musste sie schließlich doch eingeschlafen sein, denn das Geräusch einer zuschlagenden Autotür weckte sie unsanft.
Der Wagen auf dem Hof kam Theresa bekannt vor. Er sah so aus wie der Pannenwagen von gestern Abend. Und richtig, der rechte Vorderreifen war eindeutig ein Ersatzrad.
Was zum Teufel . . .?
Ein Kopf erschien im Fenster der hinteren Tür. Ein blonder, reichlich verwuschelter Kopf. Der definitiv ihrer gestrigen Nemesis gehörte. Was soll das? Was will die hier?
Die Autotür öffnete sich, während Theresa noch mit einem verärgerten Blick dastand und sich auf alles gefasst machte, und die Frau quälte sich aus dem Auto. Allem Anschein nach hatte sie dort genächtigt. Von der Perfektion ihres Stylings war nichts mehr übrig. Ihr Anzug, der sich gestern noch so vollendet an ihren Körper geschmiegt hatte, war unrettbar zerknittert und sah verzogen aus. Ihre teure Frisur war komplett aufgelöst und hatte sich in eine Art verknoteten Wischmopp umgestaltet, der an einer Seite unschön eingedellt war. Ihr Frau-von-Welt-Make-up war zu einer Waschbärenmaske geworden. Theresa nahm all das mit Häme wahr. Eigentlich hätte es ihr egal sein sollen, aber der Anblick verschaffte ihr eine gewisse Genugtuung. Vielleicht auch nur, weil sie noch immer ein schlechtes, beschmutztes Gefühl wegen der fünfzig Euro hatte.
Als die Frau sich endlich berappelt hatte, schaute sie Theresa so ungläubig an, dass es schon fast komisch war. Theresa holte Luft. »Was machen Sie hier?«, fragten sie beide gleichzeitig.
Die andere lachte darüber. Theresa verzog keine Miene. Sie war misstrauisch. Wie sie fand, zu Recht. Willi war momentan nicht in der Lage, sich gegen irgendwelche dubiosen Geschäftemacher zur Wehr zu setzen, und Theresa wusste, dass manche Banden sich gezielt alte Leute für ihre Abzocke aussuchten. Vielleicht hatte die Frau im Businessanzug es ja auf Willis Grund und Boden abgesehen. Sonst war bei ihm nichts zu holen, Willi war arm wie eine Kirchenmaus.
In bestimmtem Ton sagte Theresa: »Sie zuerst.«
»Na schön«, seufzte die derangierte Blonde. »Obwohl ich eigentlich viel mehr das Recht hätte, Sie das zu fragen. Ich bin Willi Häfners Großnichte. Maria Ossola. Ich bin gekommen, weil eine Nachbarin sich bei unserer Familie gemeldet hat. Es geht ihm wohl nicht so gut.«
Theresa musterte sie und ließ das Gesagte auf sich wirken. Sie wusste nichts von einer Großnichte. Aber das musste nichts heißen. Willi redete so gut wie nie über seine ungeliebte Verwandtschaft. Sie wusste nur von der Nichte, die er als akzeptabel einstufte. Dann wäre das hier vermutlich die Tochter der akzeptablen Nichte.
»Nicht so gut ist eine Untertreibung«, ging sie nach einigen Sekunden unangenehmen Schweigens auf das ein, was Maria Ossola gesagt hatte. »Eigentlich hätte ich ihn ins Krankenhaus bringen lassen sollen. Nur weil ich weiß, wie sehr er das hassen würde, und weil es ihm schon wieder etwas besserging, habe ich das nicht gemacht.« Sie ärgerte sich, weil ihre Erklärung so defensiv war und für ihre Verhältnisse ungewöhnlich ausführlich. Aber Tatsache war, dass sie ihr Vorgehen immer noch vor sich selbst rechtfertigen musste.
»Sie sind die Nachbarin?«, fragte die Großnichte ungläubig. Offensichtlich hatte sie das nicht erwartet.
»Ja«, gab Theresa knapp zur Antwort. Sollte die sich doch denken, was sie wollte. Aber dann gewannen ihre Manieren: »Theresa Späth. Willi nennt mich Resi.«
Jetzt wurde sie ihrerseits prüfend angeschaut. Was diese Prüfung ergab, konnte sie sich schon denken. Mit ihrem einfachen T-Shirt und einem ausgewaschenen Paar Jeans war sie nicht gerade einem Modemagazin entsprungen. Und diese Maria Ossola wirkte, als ob das für sie das wichtigste Kriterium für Menschen überhaupt war: wie sie angezogen waren. Kleider machen Leute – das hatte Theresa schon immer gehasst. Ein Grund, warum sie sich in ihrer Einsiedelei so wohl fühlte. Ihren Schafen und Bienen war es egal, wie sie rumlief, da musste sie nicht repräsentieren. Maria Ossola hatte sie offenbar innerhalb von Sekunden als rückständiges Landei abgestempelt. Wenn die wüsste, wie wenig das stimmte. Zumindest früher einmal . . . jetzt war so ein bisschen was dran.
Der nächste Satz von Frau Ossola zeigte, dass sie mit ihrer Einschätzung genau richtig lag. Die Herablassung troff aus jedem Wort: »Schön, Resi. Dann gehen wir doch zusammen zu ihm rein.« Ihr Lächeln war für Theresas Empfinden durch und durch aufgesetzt.
Was die sich einbildete! Theresas Kiefer verkrampfte sich, als sie mit den Backenzähnen einen Schraubstock imitierte. »Ich habe nicht gesagt, dass Sie mich Resi nennen dürfen«, quetschte sie dazwischen hervor. »Und warum haben Sie im Auto übernachtet, wenn Sie zur Verwandtschaft gehören?« Die Geschichte dieser Maria Ossola überzeugte sie bisher noch nicht. Außerdem nannte niemand außer Willi sie Resi. Im Dorf hatten es ein paar Leute versucht, aber das hatte sie ihnen schnell wieder ausgetrieben. Wäre noch schöner, wenn sie das dieser angeblichen Großnichte durchgehen ließe, einer Frau, die sie schon gestern Abend wie eine Untergebene behandelt hatte.
Maria Ossola versuchte ihre Haare zu ordnen, während sie antwortete: »Haben Sie mal einen Blick ins Gästezimmer geworfen? Das ist widerlich. Überhaupt, warum stinkt es im Haus so?«
»Das nennen Sie stinken? Sie hätten mal vor zwei Wochen reingehen sollen.« Theresa musste fast feixen. Das würde lustig werden, wenn diese Frau versuchen würde, mit Willi zurechtzukommen. Einem Willi, der immer mal wieder vergaß, aufs Klo zu gehen. Es war besser geworden, seit sie ihn jeden Tag dazu brachte, etwas zu essen und ausreichend zu trinken, seither war er wieder klarer im Kopf; aber er hatte seine Aussetzer. Und Theresa war keine Altenpflegerin. Mehr als das Nötigste hatte sie nicht geschafft. Sie hatte ihn aufgefordert, sich zu waschen, bezweifelte aber, dass er mehr als das Gesicht gemacht hatte. Deshalb hatte sie ja die Nichte angerufen. Da mussten Profis ran. Maria Ossola sah hingegen nicht so aus, als ob sie jemals in ihrem Leben auch nur ein Katzenklo geputzt hätte – geschweige denn dazu in der Lage war, einen alten Mann zu pflegen. Armer Willi. Das würde was werden.
Maria Ossola betrachtete sich im Außenspiegel ihres Autos und zupfte an ihren Haaren herum. Die schlimmsten Schminkereste hatte sie mit einem Tempo entfernt. Das musste Theresa wirklich nicht mit ansehen. Sie hatte heute noch einiges zu tun. Ohne ein weiteres Wort ließ sie die andere stehen und ging ins Haus. Sie würde Willi wecken und ihm Frühstück machen. Dann würde sie ihn wohl oder übel seiner Großnichte überlassen. Es sei denn, Willi duldete diese Maria Ossola nicht im Haus. In diesem Fall würde sie sie hochkant rauswerfen – und es wäre ihr ein ausgesprochenes Vergnügen, das zu tun. Wie es mit Willi weitergehen sollte, würde sie danach angehen.
Diese Frau war die Grobheit in Person. So etwas Ungehobeltes war Maia noch nie begegnet. Sie versuchte es wirklich, war nett, freundlich, offen. Doch an der steinernen Fassade prallte alles ab. Vielleicht würde sie andere Saiten aufziehen müssen, aber eigentlich war ihr das zu anstrengend, und sie fand es auch unangemessen. Sie stand wirklich in der Schuld von dieser Theresa Späth, dachte Maia zerknirscht, während sie sich beeilte, ihr ins Haus zu folgen. Nicht nur hatte die Frau ihr bei der Reifenpanne aus der Patsche geholfen, jetzt stellte sich auch noch heraus, dass sie schon seit Wochen Willi versorgte. Aber sie machte es einem wahrlich nicht leicht, Dankbarkeit zu zeigen. Wahrscheinlich war sie recht einfach gestrickt und hatte den gepflegten Umgang mit Menschen nie richtig gelernt. Hier draußen am Arsch der Welt kein Wunder. Gab es hier überhaupt schon anständige Internetverbindungen? Wenn man so abgeschieden lebte, konnte man ja nur verrohen. Ihr eigener Großonkel war schließlich auch so ein komischer Kauz. Ein liebenswerter Kauz. Aber mit dem Großteil der Menschheit eben nicht kompatibel.
Wieder brachte der Geruch im Hausflur Maia zum Naserümpfen. Theresa, die man nicht Resi nennen durfte, schien das gar nichts auszumachen. Sie war bereits die Treppe hinaufgegangen und klopfte unbeeindruckt an Willis Schlafzimmertür. Maia hetzte hinterher und kam gerade rechtzeitig, als Willis Nachbarin ihn in seinem Bett begrüßte. Er schien putzmunter zu sein und hatte sie wohl schon erwartet, denn er hatte sein Gebiss bereits eingesetzt.
»Morgen, Resi.«
»Morgen, Willi.«
Das war alles, was die beiden an Worten miteinander wechselten. Mehr schien nicht nötig zu sein. Maia kam sich wie ein Eindringling vor. Willi hatte sie noch gar nicht bemerkt. Sie war auch ganz froh, ihn einen Moment lang von der Tür aus betrachten zu können, denn sein Anblick war doch ein ziemlicher Schock. Er war abgemagert und so stark gealtert, dass er aussah wie hundertfünf. Seine ungehobelte Nachbarin half ihm, sich aufzusetzen. Er trug einen viel zu großen Jogginganzug, der ihm bestimmt einmal gepasst hatte.
Es tat weh, ihren Großonkel so zu sehen. Sie hatte sich zwar mental auf das Schlimmste eingestellt, aber es dann wirklich vor Augen zu haben, war etwas ganz anderes.
Doch Lamentieren half nicht, sie musste sich der Sache stellen. Maia zwang sich, ebenfalls das Schlafzimmer zu betreten, und wünschte sofort, sie hätte es nicht getan. Sie würgte unfein – sie konnte es nicht unterdrücken. Hastig lief sie zum offenen Fenster und nahm ein paar kräftige Atemzüge frischer Luft. Dann erst war sie in der Lage, Willi zu begrüßen. Sie musste dafür aber im Luftzug stehen bleiben.
»Du stinkst«, sagte sie zu ihrem Großonkel. Theresa Späth drehte sich wie der Blitz zu ihr um und warf ihr einen drohenden Blick zu.
»Und du hast auch schon mal besser ausgesehen«, kam die lachende Antwort. Willi hörte sich schwächlich an, aber ansonsten schien er ganz der Alte zu sein. Das war schon mal beruhigend.
»Tja, da sind wir beide gerade nicht in bester Verfassung.« Maia wusste, dass ihre Mutter ihm am Telefon von dem Burnout erzählt hatte, als sie ihren Besuch ankündigte. »Das passt mal wieder perfekt, findest du nicht?« Willi würde wissen, was sie damit meinte. Nämlich die Zeit in ihrer Jugend, als Willi im größten Clinch mit der restlichen Verwandtschaft gelegen hatte, allen voran Tante Edeltraut, und Maia eine schwere Teenager-Krise durchgemacht hatte, weil sie ihre Gefühle für andere Mädchen nicht einsortieren konnte. Da hatte sie im Sommer die ganzen sechs Wochen der Sommerferien bei ihm verbracht und war erst vier Wochen später in die Schule gegangen. Ihre Mutter hatte ihr ein Attest besorgt. Das war ihre schönste und wichtigste Zeit mit Willi gewesen. Obwohl sie mit keinem Wort über ihre jeweiligen Sorgen gesprochen hatten. Es hatte gereicht, dass sie sich gegenseitig mit ihren Macken und Schrullen akzeptierten. Eine ungewöhnliche Kombination, sie beide. Der alte Zausel und das verkopfte Mädchen.
»Maia«, sagte Willi mit Tränen in den Augen und blinzelte sie an. Er hatte noch nie geweint, wenn sie dabei war. Maia merkte, dass es ihm unangenehm war, sich so bedürftig zu zeigen. Sie tat das einzig Richtige.
»Fang jetzt bloß nicht an zu heulen«, blaffte sie ihn an und grinste.
Und tatsächlich: Wieder lachte ihr Großonkel krächzend auf. »Das sind Freudentränen. Brauchst dir nichts einzubilden. Sie sind für Resi. Ich heule jeden Tag vor Glück, wenn ich sie sehe.« Er wischte sich die Tränen aus den Augenwinkeln.
Die Nachbarin stand daneben und betrachtete die Szene mit einem merkwürdigen Ausdruck. Das erste Mal hatte Maia das Gefühl, wirklich angesehen und nicht nur mit einem vorbeischweifenden Blick negativ bewertet und ad acta gelegt zu werden.
Das Häufchen Elend, das ihr Onkel war, grinste sie noch immer an, und die Tränen kullerten ihm nach wie vor in die grauen Bartstoppeln. Auch Maia schossen jetzt die Tränen in die Augen. Sie hatte sich bemüht, das alles hier gelassen zu nehmen, um Willi nicht aufzuregen. Aber sie selbst war eben immer noch nicht wieder die starke Frau, die alles wegstecken konnte. Das hier war eine schwächere, anfälligere Version ihrer selbst. Wenn er nicht so stark gestunken hätte, dass sie sich fast übergeben musste, hätte sie sich Willi in die Arme geworfen wie früher als kleines Kind.
»Jetzt wird alles gut«, sagte sie, sowohl für ihn als auch für sich selbst zur Beruhigung. »Wir beide kriegen das zusammen hin. So wie früher. Erinnerst du dich?« Die erste Träne bahnte sich ihren Weg über ihre Wange. Weitere wollten folgen.
»Natürlich erinnere ich mich«, versuchte Willi den alten flapsigen Ton wiederzufinden. »Ich bin doch nicht senil.«
»Da habe ich aber Gegenteiliges gehört. Und du riechst entsprechend«, gab sie im selben Stil zurück, obwohl sie beide immer noch mit den Tränen kämpften. Und ständig verloren.
»Wirst du mir helfen?« Willis Stimme kippte.
Dass er zugab, nicht allein zurechtzukommen, Hilfe zu brauchen, war ein Alarmsignal für Maia. Willi war immer stark gewesen. Hatte alle Welt vor den Kopf gestoßen, wenn es nötig war. War sich stets selbst genug gewesen. Um Hilfe zu bitten, musste ihn viel kosten.
»Deshalb bin ich da«, versicherte sie, mühsam beherrscht. »Ich bleibe, Onkelchen. So schnell wirst du mich nicht wieder los.«
Willi heulte unkontrolliert schluchzend los. Und auch bei ihr brachen alle Dämme. Scheiß drauf. Maia stürzte zum Bett und umarmte Willi ungestüm. In dem Moment nahm sie die Gerüche nicht einmal mehr wahr.
Zeichen und Wunder, dachte Theresa, als sie das Tableau vor sich betrachtete. Die Großnichte Maia kniete vor dem Bett, Willi umklammerte sie wie ein Ertrinkender, und beide heulten wie Schlosshunde. Noch vor zwei Sekunden hätte sie das keinem von beiden zugetraut. Dass die Anzugfrau einen alten, schmuddeligen Mann auch nur mit der Kneifzange anfassen würde, war ein abwegiger Gedanke gewesen. Dass sie auf die genau richtige, vertraute Art mit ihm reden konnte, ebenso. Die beiden verband etwas ganz Tiefes, das war in dem kurzen Gespräch klargeworden. Erstaunlich.
Aber umso besser. Das hieß, dass jetzt jemand da war, der in Zukunft für alles Weitere sorgen würde. Sie hatte ihre Zeit wieder zur freien Verfügung. Keine schwärmenden Völker mehr. Sie konnte sich endlich um ihren Honig kümmern. Die zweite Schleuderung stand bevor. Sie war noch nicht einmal dazu gekommen, den Honig der ersten Schleuderung in Gläser abzufüllen, obwohl ihre Kunden schon darauf warteten.
Theresa ließ die beiden zurück und beschloss, noch ein letztes Mal das Frühstück für Willi vorzubereiten. Danach wären die beiden hier auf sich allein gestellt. Bevor sie die Küche betrat, fiel ihr die Tür zum Gästezimmer ins Auge. Einen Augenblick sah sie unschlüssig darauf, dann entschied sie, sich einen kurzen Blick hinein zu gönnen. Aus purer Neugier. Diese Maia hatte bestimmt maßlos übertrieben. Mehr als ein bisschen Gerümpel zu viel war dort sicherlich nicht zu finden.
»Heilige Scheiße«, entfuhr es ihr, als sie die Tür aufgestoßen hatte und das ganze Ausmaß der Verwahrlosung wahrnahm. Da wäre mit einem Besen nicht viel erreicht. Vielleicht müsste Frau Ossola einen Container kommen lassen für die Entrümpelung. Insgesamt war das vielleicht keine schlechte Idee. Willis Häuschen war bis unters Dach voll mit altem Zeug. Aber das war ja Gott sei Dank nicht ihr Problem.
In der Küche holte Theresa das Brot aus dem Kasten und schmierte zwei Butterbrote. Auf einem verteilte sie einen Klecks ihres Honigs – sie brachte Willi immer mal wieder ein Glas vorbei, weil er zu geizig gewesen wäre, ihn ihr abzukaufen –, auf dem anderen deponierte sie eine Scheibe Käse. Fertig. Genau so wollte Willi es jeden Morgen. Nebenher brühte sie eine Kanne Kaffee.
Mit einem Schlurfen über den Gang kündigten sich Willi und seine Großnichte an. Willi ließ sich schwer atmend am Küchentisch nieder, und Maria Ossola verschwand durch die Küche im Bad. Theresa stellte Willi den Teller mit den Broten hin und schenkte ihm eine Tasse Kaffee ein. Laut schlürfend begann er zu trinken.