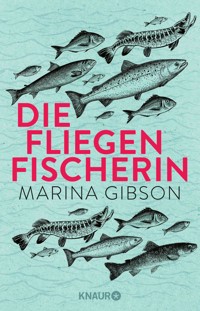
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine inspirierende und wahre Geschichte über die heilende Kraft des Wassers – erzählt von einer der besten Fliegenfischerinnen der Welt. In ihren frühen Zwanzigern fühlt Marina Gibson sich ziel- und orientierungslos und flieht aus der Stadt aufs Land. Dort nimmt sie zum ersten Mal seit Jahren wieder eine Angel in die Hand. Sie entdeckt damit ein altes Hobby ihrer Kindheit wieder und setzt so die Familientradition ihrer Mutter fort. »Marina schreibt so exquisit wie sie angelt.« Paul Whitehouse Bald wird das Fliegenfischen zur Passion, denn sie spürt, wie gut ihr die Ruhe beim Angeln tut - die Mischung aus Konzentration und Geduld hat etwas Meditatives. Das ritualhafte Auswerfen der Angel, begleitet von der Melodie des Wassers, spendet ihr Trost und hilft ihr dabei, ihre gescheiterte Ehe zu verarbeiten und Verbindung aufzunehmen zur Tradition weiblicher Fischerei, die Generationen zurückreicht. Marina Gibson erzählt nicht nur eine zutiefst berührende Geschichte: In ihrem Buch über ihren Neuanfang trifft Female Empowerment auf Nature Writing. Denn Gibson zeichnet auch die epischen, den Kontinent durchquerenden Reisen von Wanderfischen und die lebenslange Suche von Anglern nach. »Die Fliegenfischerin« ist eine Liebeserklärung ans Wasser und an die Suche nach innerem Frieden und tieferem Sinn in den Weiten der Natur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Marina Gibson
Die Fliegenfischerin
Aus dem Englischen von Ursula Held
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Nach einer gescheiterten Ehe zieht es Marina Gibson von der Stadt aufs Land. Dort nimmt sie zum ersten Mal seit Jahren wieder eine Angel in die Hand – nicht ahnend, dass das ihr Leben verändert. Marina ist schnell von der Magie des Fischens hingerissen und erlebt, wie die Melodie des Flusses den Lärm des Lebens in den Hintergrund treten lässt. Hüfttief im Wasser stehend macht sie die beglückende Erfahrung, endlich Frieden und Sinn zu finden. Berührend und leidenschaftlich erzählt sie von ihrer Passion und der heilenden Kraft des Wassers.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
Werfen
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Fangen
Viertes Kapitel
((Kapitel ohne ÜS))
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Freilassen
Achtes Kapitel
((Kapitel ohne ÜS))
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Dank
Glossar
In liebevoller Erinnerung an Sedge, meinen Onkel Timothy und Mick May
Prolog
Der Secure, Nebenfluss des Amazonas
Die Bäume umringten mich wie in stummer Anklage. Sie thronten auf den Klippen über mir und schienen zu beobachten, wie ich den Ellbogen zurücknahm und zum Wurf ausholte. Mein Blick war nach unten gerichtet, auf einen schwachen Schimmer im Wasser, der mir sagte, dass eben jetzt der richtige Moment gekommen war.
Ich war nach Bolivien gereist, um nach einem seltenen, ja wundersamen Fisch zu suchen. Den Traum jeder Anglerin, jedes Anglers. Der Dourado, auch Südamerikanischer Lachssalmler oder treffender »Tigre de Río« genannt, ist der Spitzenprädator der Amazonas-Gewässer, er gehört zu den kräftigsten Wildfischen der Welt. Mit einem betörenden Glitzern hebt sich sein goldglänzender Kopf aus dem Wasser, dann reißt der Räuber sein Maul auf und enthüllt scharfe Zähne und starke Kiefer, die ihn zu einem bösen Gegner für seine Jäger wie für seine Beute machen. Hängt ein sich wehrender Dourado am Haken, kräuselt sich das Wasser nicht: Es kocht. In einem schäumenden Wirbel kämpft er um sein Leben. Von allen Fischen, nach denen ich überall auf der Welt Ausschau gehalten habe, war es der Dourado, nach dem ich mich schon immer gesehnt hatte und für den ich einen weiten Weg hinter mich gebracht hatte, im doppelten Sinne. Zu Beginn meines Aufenthalts hatten schon ein paar kleinere Exemplare an meiner Angel gehangen, doch nun nahte das Ende des einwöchigen Trips und immer noch war mir der kapitale Fang, der »monster catch«, entgangen. Ich wusste, dass ich den Regenwald nicht verlassen könnte, ohne diese Erfahrung gemacht zu haben.
»Entweder der Dschungel nimmt dich auf oder er spuckt dich aus«, hatte uns unser Guide am ersten Tag gesagt. In dieser Woche kam es mir vor, als hätte der Regenwald mich mit Haut und Haaren verschluckt. Die Farben und Geräusche waren so intensiv, die Natur so dicht, so endlos und geheimnisvoll, dass man sich kaum vorstellen konnte, dass auch jenseits ihrer ungeheuren Ausmaße etwas existierte. Über uns kreischten Aras, durch die feuchte Luft schwirrten unzählige winzige Sandmücken (die mich durch meine Leggings blutig gestochen hatten). Beim Angeln umflatterten uns leuchtende Schmetterlinge in einem bunten Konfettiregen und streckten ihre Saugrüssel nach ein paar Salztropfen aus.
Wir befanden uns am Fluss Secure, einem Neben-Neben-Nebenfluss des mächtigen Amazonas. Seit Tagen waren wir mit einem Holzkanu unterwegs, waren durch schmale Flussabschnitte gepaddelt, in denen sich die Ufer annäherten und uns das Blätterdach einschloss, waren dann wieder in ausgedehntere Passagen gelangt, in denen die Bäume zurücktraten, das Wasser breit dahinfloss und runde Felsbrocken seine Oberfläche durchbrachen: das perfekte Versteck für Dourados. Die Ufer waren meist felsig, zum Teil aber auch sandig: Unsere Guides rieten uns, mit den Stiefeln durch den Sand zu schlurfen, um die Stachelrochen zu vertreiben, die sich darunter versteckt halten könnten.
Die anderen standen ein Stück oberhalb, und so fühlte ich mich vollkommen allein in dieser Wildnis. Die Stiefel gegen die glatten Ufersteine gedrückt, starrte ich in den Fluss. Vor Kurzem hatte es eine Überschwemmung gegeben, und das Wasser war trüber als sonst. Seit meiner unangenehmen Begegnung mit den Sandmücken trug ich lange, dünne Hosen, die in der schwülen Hitze an meinen Beinen klebten.
Sosehr ich auch auf den Moment konzentriert war, konnte ich doch die Gedanken nicht vertreiben, vor denen ich so weit geflohen war. Ich war auf der Suche nach dem Dourado nach Bolivien gekommen, zugleich aber war ich auch verzweifelt auf der Flucht vor etwas. Meine gerade einmal zwei Jahre andauernde Ehe schien bereits zum Scheitern verurteilt.
Ich hatte mich in den Dschungel, in die denkbar extremste Angelumgebung begeben, um Abstand zu gewinnen. Aber ich konnte nicht abschalten. Die Gelassenheit, die das Angeln normalerweise bewirkt, trat nur sporadisch ein, wie ein unterbrochenes Radiosignal, immer wieder störte ein Rauschen aus Selbstvorwürfen die Ruhe. Sogar in dieser ewig weit von meinem englischen Zuhause entfernten Wildnis bedrängten mich die Fragen: Wie war es nur dazu gekommen? Sollte es wirklich so schnell zu Ende sein? Was würden die Leute sagen?
Als ich dann endlich unter einem ins Wasser ragenden abgebrochenen Baumstamm diesen leichten Goldschimmer erblickte, ermahnte ich mich, noch zu warten. Daheim nutzte ich meist einfachere Knoten, hier aber müsste es der tropfenförmige »Perfection Loop« sein, eine Anglerschlaufe, mit der ich die Fliege so sicher befestigen könnte, dass sie hoffentlich auch dem brutalen Biss eines Dourados standhielt. Ich konnte Lucas, unseren Führer, gerade noch sehen, mein Rufen aber würde er nicht hören. Ich wusste, das hier war mein »Tiger« – der Fisch, für den ich hergekommen war. Auf keinen Fall wollte ich diese Chance verstreichen lassen. Der Instinkt nahm überhand und meine Finger knüpften wie automatisch einen verbesserten Clinchknoten: Ich legte das Schnurende zusammen, fädelte die Fliege ein, wickelte die Schnur fünfmal um sich selbst und führte das Ende zunächst durch die kleine und dann durch die größere Schlaufe. Ich befeuchtete den Knoten im Mund und zog ihn an beiden Enden fest zu. Der Clinch- oder Klammerknoten eignet sich eigentlich für Forellen oder Lachse, jetzt sollte er mir den Tiger an Land holen.
Ich brachte die Fliege mit einem schnellen Wurf aus, sodass sie knapp unterhalb des Fisches landete, »strippte« die Leine, indem ich sie mit der rechten Hand zurückzog, und spürte auch schon diesen beruhigenden kleinen Ruck, der mir anzeigte, dass der Fisch auf den Köder anbiss. Noch war es kein heftiges Ziehen – dazu käme es, wenn ich den »Anhieb setzte« und sich der Haken im Maul des Fisches verfing. Erst dann könnte ich mit dem Einholen beginnen.
Wäre es eine Forelle gewesen, hätte ich nur die Rutenspitze geschickt anheben müssen, einfach senkrecht nach oben. Aber das harte, unnachgiebige Maul des Dourados erforderte etwas mehr, nämlich einen »Strip Strike«: Ich musste die Leine mit der Hand fest zur Seite reißen, um maximalen Druck auszuüben und den Haken fest zu verankern. Also machte ich mich bereit, stützte mich in Erwartung des vollen Fischgewichts mit den Füßen ab und lauerte auf den genugtuenden Ruck des Anbeißens.
Doch dann war die Leine mit einem Mal schlaff. Die Bäume ragten noch immer hinter mir auf, die Schmetterlinge flatterten und die Aras kreischten, der Fisch aber war fort.
Ebenso schlagartig trat die schmachvolle Erkenntnis ein. Es war kein Wurffehler gewesen und auch am Anhieb hatte es nicht gelegen. Sondern vielmehr an dem Knoten, den ich so hastig geknüpft hatte, weil ich die Gelegenheit beim Schopfe packen wollte, anstatt auf Hilfe zu warten. Er war unter der Belastung einfach gerissen. Es war ein peinlicher Fehler zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Als ob ein Läufer beim Verlassen des Startblocks über seine losen Schnürsenkel stolpert. Minuten später stand Lucas neben mir und zeigte mir ein betrübtes, wissendes Lächeln. »Warum hast du nicht auf mich gewartet?«
Die gerissene Fliege war mehr als ein entgangener Fang, mehr als ein lang ersehnter Fisch, der mir entglitten war. Es war ein Weckruf: Ich traf schlechte Entscheidungen, mein Verstand war genauso außer Kontrolle geraten wie mein Leben. So oft war das Angeln meine einzige Gegenmaßnahme gewesen – die Möglichkeit, meinen Verstand auszuklinken und mich von den Gedanken zu lösen, die mich ständig umschwirrten, während ich durch den Tag stolperte und so tat, als wäre alles normal und als könnte ich perfekt funktionieren.
Doch jetzt, da meine Ehe noch vor der Baumwollenen Hochzeit ins Wanken geriet, wollte diese Tür, hinter der ich mich immer hatte verbarrikadieren können, auf einmal nicht mehr zubleiben. Das monatelange Leugnen holte mich ein. Die Belastung war zu groß geworden.
Jetzt glitt mir scheinbar auch das Angeln aus den Händen, und doch wies es mir weiter den Weg. Bis jetzt war ich in Angst und Zweifel verharrt, nicht in der Lage, einen Schritt vor oder zurück zu machen. Jetzt hatte ich Klarheit. Ich spürte, wie sich eine tiefe Enttäuschung in mir ausbreitete. Der Fisch, den ich so sehnsüchtig erwartet hatte, war mir entglitten. Die Ehe, an die ich so sehr geglaubt hatte, war gescheitert. Und doch wusste ich endlich, was ich tun musste. Es duldete keinen Aufschub.
Am Tag nach meiner Rückkehr aus Bolivien war die Entscheidung gefallen, der Knoten gelöst.
Es war nicht das erste Mal, dass mich das Angeln aus einer verzweifelten Lage herausholte, indem es mir eine Leine hinhielt, an der ich mich festhalten kann und die mir hilft, Antworten zu finden, die ich nirgendwo anders finden kann. Es sollte zudem nicht das letzte Mal sein.
Werfen
Erstes Kapitel
Der Spey, Schottland
Bist du durch deinen Vater zum Angeln gekommen?«
Ich kann nicht sagen, wie oft mir diese Frage gestellt wurde, wenn ich an Flussufern oder Angelteichen stand. Dabei war es gar nicht mein Vater, der mich zum Angeln mitnahm. Wie man eine Fliege befestigt und die Schnur auswirft, hat mir jemand anderes beigebracht. Angeln war für mich stets mit meiner Mutter verbunden: Sie war meine erste Lehrerin, mein größter Ansporn, und sie ist noch immer meine ideale Angelpartnerin.
In meinen frühesten Erinnerungen ist sie es, die an unserem Dorfteich in Gloucestershire stand, während ich einen Krabbenkescher schwang, mit dem ich alles aufsammelte, was ich an zappelnden, fliegenden und schwimmenden Dingern finden konnte. Mein älterer Bruder Marcus und ich wurden ermahnt, die Fische nicht durch Geschrei oder Wasserspritzer zu verscheuchen. Damals begriff ich noch nichts von Angeltechnik, ich hatte keine Ahnung vom Zusammenspiel von Rute und Leine. Für mich gab es nur das Wasser: eine ruhige Oberfläche, die ein Universum voller Geheimnisse barg. Ich liebte das Wasser, bevor ich überhaupt wusste, was Angeln ist – bevor ich eine Angelrute in der Hand hielt, die nasse Haut eines Fisches spürte oder seinen schimmernden Körper aus der Nähe betrachtete.
Irgendwann dann zeigte mir meine Mutter, wie man angelt und was Angeln bedeutet, sie brachte mir die Liebe zum Wasser und die Freude an diesem Sport nahe – eine Begeisterung, die sie als Kind gepackt hatte, als sie in dem Bach neben ihrem Elternhaus in Warwickshire mit bloßen Händen nach Groppen und Stichlingen fischte. Tatsächlich waren meine Mutter und ich schon ganz früh zusammen fischen gegangen: Es war auf der Isle of Lewis, sie war im achten Monat mit mir schwanger und konnte nicht mehr in tiefes Wasser waten, also stellte sie sich oben auf die Uferkante und schwang ihre Angel durch die mückenschwere Luft.
»Ich war noch nie auf den Äußeren Hebriden«, sagte ich einmal zu ihr.
»O doch, das warst du«, entgegnete sie.
Das Wasser samt allem, was sich unter seiner Oberfläche befinden mochte, bildete das Zentrum meiner Kindheit, die wir, mein Bruder und ich, wann immer möglich im Freien verbrachten.
Die ländliche Umgebung von Stow-on-the-Wold in Gloucestershire bot uns dazu reichlich Gelegenheit. Wir kümmerten uns um die Tiere, die wir hielten, gingen mit den Hunden im nahe gelegenen Wald spazieren und bettelten unsere Mutter an, sie möge uns zum Forellenteich mitnehmen. Und immer war unser Spiel mit einem Wettkampf verbunden. An den Wochenenden und in den Schulferien ging es darum, wer als Erster aus dem Haus war, wir stürmten nur so über den Hof und durch das Holztor, das meinem sechsjährigen Ich riesig erschien. Mit Futtereimern in der Hand betraten Marcus und ich den Hühnerstall, sorgsam auf der Hut vor dem Hahn, der manchmal in Angriffslaune war und uns mit seinen Sporen angriff – diesen fiesen Krallen, die sich wie kleine Nashornhörner hinten über den Füßen nach oben krümmen. Die Hühner waren nur ein Teil einer Tiersammlung, die unser Haus manchmal wie einen Miniaturbauernhof aussehen ließ. Wir hatten außerdem Hunde, Katzen, Hamster, Kaulquappen und Stabheuschrecken. An den Kletterpflanzen nahe der Eingangstür entdeckte ich Schnecken, die ich einzeln nach drinnen brachte. Ich baute ihnen Häuser und freute mich an den glitzernden Spuren, die die Tiere auf dem Boden und an den Wänden hinterließen.
Aus den verschwommenen Erinnerungen an die frühe Kindheit treten einzelne, beeindruckende Entdeckungen mit scharfen Konturen hervor: die schwachen, abgewinkelten Beine der Eintagsfliege am Forellenteich, an dem ich das Angeln lernte, die schwarz glänzenden Wasserkäfer, der Molch mit seinen gespreizten Gliedmaßen und der gesprenkelten Haut. Ich entsinne mich, dass ich ihn für einen Dinosaurier in Miniaturformat hielt, ein Wesen, das einem meiner Bilderbücher entsprungen zu sein schien.
An spätere Zeiten habe ich konkretere Erinnerungen: Ich habe Farben mit ans Wasser genommen und sammle Kieselsteine, die ich bemalen will. Es müssen glatte Steine sein, die in meine Handfläche passen, dabei aber groß genug sind, um sie mit meinen Pinseln zu bearbeiten. Weiter flussabwärts fischen meine Eltern, meine Mutter in schickem Tweed, mein Vater, trotz der lauen schottischen Sommerluft, in seinem blauen Lieblingspullover. Ich schaue so gerne zu, wie sie die Angelschnur auswerfen: Mein Vater baut sich auf und zwingt die Fliege unter Einsatz seines gesamten Körpers über die ganze Breite des Flusses; meine Mutter bleibt ruhig und gelassen, jede Bewegung sitzt, sie arbeitet mit dem Wasser und verschwendet keine Kraft. Sie fischen, ich male, und der Fluss zieht seufzend vorbei.
Am Ufer liegen schon einige bunte Steine zum Trocknen im fahlen Sonnenlicht, als mir auffällt, dass da irgendetwas glitzert, das nicht dort hingehört. Es ist der durchsichtige Flügel einer Libelle, die sich auf dem Sand niedergelassen hat. Ich gehe etwas näher heran – wage kaum zu atmen, damit ich sie nicht aufschrecke – und betrachte ihre dunklen, spinnenförmigen Beine, den stacheligen, schwarz-blau gemusterten Hinterleib. Die Libelle rührt sich nicht. Nach einer Weile wird mir klar, dass sie sich nicht etwa ausruht, sondern tot ist: Ihr letzter Flug hat direkt neben mir geendet, ohne dass ich es bemerkt habe. Sie war in dem vor mir liegenden Wasser auf die Welt gekommen, sie war dort aus einem Ei geschlüpft und nun zum Sterben an den Fluss zurückgekehrt.
Ich hebe die Libelle sanft am Schwanz auf und lege sie in meine Handfläche. Ihr kleiner Körper ist zart und robust zugleich; ihre vier Flügel, die sie eben noch mit beeindruckender Geschwindigkeit durch die Lüfte trieben, sind hauchdünn und von winzigen dunklen Adern durchzogen wie ein Krakelee. Ich beschließe, sie mit nach Hause zu nehmen, denn ich möchte sie zusammen mit den Steinen, die ich fast den ganzen Tag über bemalt habe, meiner Schatzsammlung hinzufügen. Zu Hause überziehen wir die Steine mit Klarlack; manche werden als Türstopper verwendet, den Rest bewahre ich auf der Fensterbank meines Schlafzimmers auf, als eine Erinnerung an den vergangenen Sommer und als ein Versprechen auf einen weiteren, kommenden Sommer.
»Was ist das denn?«
Ich bin so vertieft, dass ich nicht bemerke, dass Jamie neben mir steht. Meine und seine Familie verbringen den Urlaub zusammen und später einmal werden wir uns anfreunden. Aber jetzt ist er nur ein Junge, der tut, was Jungen tun, der Fragen stellt und Forderungen stellt und darauf besteht, dass er mitmachen darf. Ich halte meine Libelle an mich, lege schützend die andere Handfläche über sie.
»Was machst du mit diesen blöden Steinen?«
»Die sind nicht blöd.«
»Doch. Sind sie.« Er nimmt einen meiner bunten Steine und wirft ihn ins Wasser. Ich sehe, wie er lautlos untergeht, vom steten Rauschen des Stroms verschluckt.
»Hör auf damit.«
»So richtig blöd.« Er wirft noch einen Stein.
Er wendet sich mit höhnischem Blick nach mir um. In meiner Wut vergesse ich die schützende Hand, sie öffnet sich und wir schauen zu, wie die tote Libelle zu Boden taumelt.
Es ist, als ob wir beide wissen, was nun passieren wird.
Als er den Fuß hebt und ihn auf den leblosen Körper niederstampfen lässt, ballt sich meine Hand zur Faust und ich versetze ihm einen Schlag mitten ins Gesicht. Jamie brüllt, dann sind es die Erwachsenen, die mit einem Mal laut werden. Es gibt strenge Ermahnungen, zögerliche Entschuldigungen, die feierliche Beteuerung, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt. Meine zertretene Libelle bleibt unbeachtet liegen, ein paar Steine lassen sich noch retten, aber zu Hause auf der Fensterbank sollten sie nun immerfort eine andere Geschichte erzählen als die, die ich ihnen aufgemalt hatte.
Wenn der Atlantische Lachs laicht, ist dies sowohl ein Ende als auch ein Anfang. Für die geschlechtsreifen Lachsmännchen und Lachsweibchen ist es der Höhepunkt einer Reise, die sie von ihren Heimatflüssen hinaus in die Gefahren des Ozeans geführt hat, wo sie Nahrung finden und wachsen, um am Ende zurückzukehren – einer der großen Erzählungen der Natur folgend. Oft ist es Jahre her, dass die Lachse in den Süßwassergewässern unterwegs waren, denen sie einst auch entsprungen sind. Und nun gilt es, den Zweck zu erfüllen, zu dem sie ihre Tausende Kilometer weite, mehrere Kontinente umspannende Reise unternommen haben.
Die Lachsweibchen warten auf die kühlen Gewässer des Herbstes oder Winterbeginns, um ihre Eier abzulegen. Sie suchen sich einen seichten Flussabschnitt, in dem das Wasser schneller fließt und das Sediment gröber ist, also eher aus Kies als aus Schlick besteht und eine stabile Grundlage für den Nestbau bietet. Hier verbessert die schnelle Strömung den Sauerstoffgehalt und verhindert zudem, dass zu viele Nester nah beieinander gebaut werden. Eine zu hohe Konzentration an Schlüpflingen würde Räuber anlocken und zudem den Nahrungswettbewerb verschärfen.
Das Lachsweibchen hebt eine Laichgrube aus, indem es mit dem Schwanz auf das Flussbett schlägt und Steine und Kies herausstreicht. In unmittelbarer Nähe befindet sich ihr Partner, der von den vom Weibchen freigesetzten Pheromonen angelockt wurde und konkurrierende Lachsmännchen fernhält. Sobald die Eier abgelegt sind, kommt er herbei, um sie mit seiner Milch zu befruchten. Das Weibchen bedeckt die befruchteten Eier mit Kies, verschließt damit eine Laichgrube und legt gleichzeitig eine weitere an. Das Paar wiederholt das Ritual mehrmals kurz hintereinander, bis das Weibchen alle Eier abgelegt hat und Tausende dieser orangeroten Kugeln auf nebeneinanderliegende Laichgruben verteilt hat. Durch ihre klebrige Oberfläche haften die Eier aneinander und am kiesigen Flussgrund.
Durch die Bewegungen der Fische und die Strömung des Flusses werden jedoch einige Eier herausgelöst und aus dem sicheren Nest gerissen. Sie sind nur die ersten Opfer der schwierigen Bedingungen, denen der Atlantische Lachs in allen Phasen seines Lebens ausgesetzt ist. Der Winter wird weitere Opfer fordern, noch bevor die Larven überhaupt schlüpfen konnten. Von den vielen Tausend Eiern, die ein Lachsweibchen ablaicht, entwickelt sich nur eine Handvoll zu ausgewachsenen, fortpflanzungsfähigen Fischen.
Aus den überlebenden Eiern schlüpfen im Frühjahr, ausgelöst durch die steigenden Wassertemperaturen, die ersten Larven. Im Innern der Eier, die jetzt wie milchige Perlen aussehen, sind die leuchtenden Augen des Lachsnachwuchses nun sichtbar zum Leben erwacht. Sein Körper ist zu groß geworden, um noch länger eingepfercht zu sein. Die Larve windet sich im Ei hin und her und kämpft gegen die Enge an. Das Ei erzittert, bringt damit auch das Nebenei in Bewegung und so beginnen die Jungfische in einer Kettenreaktion zu schlüpfen.
Aus den Eiern treten wurmartige, durchsichtige Schlüpflinge, die zwar stark genug waren, der Enge des Eies zu entkommen, aber dennoch sind sie nicht fähig, die Laichgrube zu verlassen. Noch ein oder zwei Monate werden sie in diesem Grenzbereich zwischen Geburt und Leben im schützenden Nest verbringen, während der ein an ihrer Unterseite klebender Dottersack die zu keiner Nahrungssuche fähigen Larven mit Nährstoffen versorgt. Erst wenn dessen Inhalt vollständig aufgenommen wurde, ist der Jungfisch in der Lage, die Laichgrube zu verlassen und sich in den Fluss zu wagen.
»Kommt doch mal!«
Es ist Sommer und ein leichter Wind streicht über den schnell dahinströmenden Fluss. Der sich diagonal durch den Nordosten des Landes mäandernde Spey ist eng mit der Geschichte Schottlands und seinen großen Industriezweigen verknüpft. Er entspringt in den Monadhliath Mountains, den »grauen Hügeln«, wo seine leicht bräunlichen Wasser durch Rinnen laufen, die von den zurückweichenden Gletschern der Eiszeit in das Land geschnitten wurden: Die Schmelzwasserströme haben sich einen Weg gegraben, sich zu Flüssen vereinigt und an den Stellen, an denen hartes Gestein in weiches übergeht, Wasserfälle gebildet. Im Anschluss wendet sich der Spey durch die Cairngorms gen Norden und fließt durch Tannen- und Birkenwälder – vorbei an Brennereien, die aus seinem Wasser Whisky herstellen, und an ehemaligen Schiffsbaustädten, die ihn einst zum Transport von Holz nutzten. Dann geht es weiter durch die ländliche Gegend von Morayshire, bis er zwischen Portknockie und Lossiemouth in die Nordsee mündet.
Auf seinem langen Weg trifft der Spey auf eine bemerkenswerte Vielfalt an Wildtieren: Fischotter, die mit demselben Eifer in seinen Wassern fischen wie menschliche Angler; Fischadler, die kreisend über ihm lauern und sich im Sturzflug einen Fisch herauspflücken; und hier und da Rothirsche, die mit gebeugtem Geweih aus ihm trinken.
Vor allem aber ist der Spey mit dem Atlantischen Lachs verbunden. Jedes Jahr endet die Wanderung vieler Tausend Fische mit der Rückkehr in seine Gewässer – es sind die letzten hundert Kilometer nach der weiten, weiten Reise bis zu seiner Mündung. Und mit den Lachsen kommen die Angelnden und bevölkern die Unterläufe des Flusses, an denen einige der berühmtesten Fanggebiete der Welt liegen. Für einen Lachsangelnden ist der Spey das heiligste aller Gewässer, seine Ufer sind geweihter Boden. Doch für mich als Kind ist er einfach nur ein Ort, an dem ich fischen kann, inzwischen mit Rute und Schnur, da ich die Grundlagen des Handwerks lerne. Ich bin acht Jahre alt, eine blutige Anfängerin, noch dazu eine ungeduldige. Ich bin überzeugt, dass die Zeit, die ich auf einem Angelausflug nicht am Flussufer verbringe, vergeudete Zeit ist.
Die Erwachsenen in unserer Gruppe, darunter meine Eltern und mein Patenonkel, sind da anderer Meinung. Sie sitzen etwas weiter weg und lassen sich das Picknick schmecken, das ich dagegen möglichst schnell vertilgt habe, um schnell wieder am Wasser zu sein.
Ich kann hören, wie sie sich unterhalten, auch über das sanfte Rauschen des Flusses und das gellende Rufen eines Sperbers oder Austernfischers hinweg. Ich laufe auf und ab, drücke das Gras mit meinen Gummistiefeln platt und warte darauf, dass die Mittagspause vorbei ist, damit ich wieder loslegen kann. Offenbar haben sie nicht einmal bemerkt, dass ich weggelaufen bin.
»Kommt doch endlich.«
Ich merke, wie der Frust in mir hochkocht. »Wie eine geschüttelte Sektflasche«, wird ein Lehrer später sagen und diesen übersprudelnden Enthusiasmus meinen, den ich teils schätze, teils aber auch verfluche, denn es handelt sich um eine Eigenschaft, die für impulsive Entscheidungen – und eben auch die typischen Ergebnisse von impulsiven Entscheidungen – sorgen kann.
Ich kann nicht mehr warten. Ich schnappe mir eine Angelrute: Die Schnur ist aufgerollt, die Fliege noch angebunden. Die Rute ist für den beidhändigen Griff konzipiert und für mich eigentlich zu groß. Sie schwingt auf und ab, als ich sie hochnehme, aber das Gefühl des Korkgriffs in meinen Handflächen, das mir irgendwann so vertraut sein wird, ist jetzt schon angenehm. Ich stapfe hinunter zum Ufer und werfe die Leine aus.
Am Morgen hatte ich die für diesen Fluss typische Technik gelernt – den Spey-Wurf. Ein »Ghillie«, einer der traditionellen schottischen Naturführer, die den Fluss schützen und Besucher ins Angeln einweisen, hatte Marcus und mich in einem kleinen Boot mitgenommen. Wir kreisten in einem Pool – ein tiefer, langsam fließender Abschnitt des Flusses – und er zeigte uns, wie man die Leine in einem D-förmigen Bogen auswirft, bevor sie auf dem Wasser zu liegen kommt. Meine Mutter meinte, wir hätten ausgesehen wie der Eulerich und die Miezekatz aus dem Nonsens-Gedicht von Edward Lear: zwei kleine Kinder, die mit einem silberhaarigen Mann mit Tweedmütze in einem kleinen Boot Kreise drehen und immer wieder in hohem Bogen ihre Angelruten auswerfen.
Jetzt bin ich begierig, wenn auch unfähig, diese Lektion in die Praxis umzusetzen. Ich beherrsche die Technik nicht. Obwohl ich weiß, wie ein guter Wurf aussieht, kann ich ihn noch lange nicht fertigbringen. Ich bewege Arme und Schultern unrund statt geschmeidig, lasse rohe Kraft statt Rhythmus walten. Ich reiße die Schnur zurück und zerre sie im Kreis über meine Schulter, bevor ich sie nach vorn ins Wasser schleudere. Und das immer wieder, in einer schlechten Nachahmung des Echten, die sich trotzdem gut anfühlt, weil ich etwas tue, und das ist immerhin besser als nichts.
Ich weiß nicht, wie lange ich das schon mache, als es passiert. Ein Ruck durchfährt mich, als sich die Leine strafft; meine Synapsen beginnen zu feuern. Mein Gehirn registriert, dass sich am Ende der Schnur ein Gewicht befindet: Ein Fisch hat die Fliege genommen. Nicht einer der Spey-Lachse, sondern ein anderer Wanderfisch, der ins Süßwasser zurückkehrt: eine Meerforelle. Das, worauf ich so dringlich gehofft habe, ist eingetreten. Endlich und noch bevor ich weiß, wie ich zu reagieren habe, hat ein Fisch angebissen. Auch heute noch spüre ich jedes Mal diese kleine Explosion, wenn mir ein Fisch an den Haken geht, wenngleich ich die Schnur inzwischen mit Bedacht auswerfe, ein konkretes Ziel im Auge habe und nur selten eine wirkliche Schrecksekunde eintritt. Aber an diesem Tag, am ersten Tag, überwältigt es mich. Der Fisch zappelt an der Leine, die Angel zittert in meinen Händen, ich schreie auf – vor Begeisterung und vor Schreck. Ich habe keine Ahnung, was ich als Nächstes tun soll. Gleichzeitig mit einem Triumphgefühl erfasst mich die Angst, ihn im nächsten Augenblick zu verlieren.
Mit der Zeit werde ich lernen, dass man in dem Moment, in dem der Fisch die Fliege nimmt und auf den Köder beißt, alle Anspannung aus sich herauslassen muss. Dass man Fische nicht in hektischer Aufregung, sondern mit geduldiger Präzision an Land bringt. Wenn ein kräftiger Fisch beschlossen hat zu fliehen und sich vom Haken losreißen will, muss man ihm genug Leine geben – Raum zur Gegenwehr, bis er bereit zum Einholen ist. Der Drill, wie der Kampf mit dem Fisch bei Angelnden heißt, gleicht eher dem Tanz eines Matadors als einem ruckartigen Tauziehen. Erleichtert wird dies durch das mechanische Bremssystem der Angelrolle. Sie gibt Schnur aus, hält dabei aber das richtige Maß an Spannung: Bei zu viel Zug reißt die Schnur, bei zu wenig kann sich der Haken lösen.
Als Achtjährige aber, an meinem ersten Angeltag am Spey, mit der ersten Meerforelle, die ich ganz allein an den Haken bekommen habe, weiß ich noch nichts von diesem Balanceakt, ich habe keine Ahnung von diesem Spiel aus Geben und Nehmen. Mein Bruder Marcus und mein Patenonkel Adrian sind auf mein Rufen hin das Ufer hinuntergeklettert und versuchen, mir zu helfen, während sich die Angel in meinen Händen immer weiter biegt und mir die Haare ins Gesicht fallen.
»Gib ihm Leine«, sagt Adrian. Er hat sich das Netz geschnappt und will helfen, den Fisch einzuholen. Aber ich höre nicht zu. Ich spüre, wie sich die Schnur spannt, und reagiere mit dem klassischen Anfängerfehler, indem ich Kraft mit Kraft begegne. Anstatt mithilfe der Rolle Leine zu geben, umklammere ich die Schnur und drücke sie gegen den Korkgriff der Rute. Die Spannung, die an meinen Armen zerrt, wird immer unerträglicher. Ich ziehe, so stark ich kann, aber der Fisch am Haken tut es auch, und es gibt nur eine Möglichkeit, wie das Ganze enden kann. Plötzlich reißt das Vorfach – das Verbindungsstück zwischen Fliege und Schnur. Mit einem Mal ist alle Anspannung dahin. Die Meerforelle schwimmt davon, das Wasser nimmt seinen ruhigen Fluss wieder auf. Ich habe den ersten Wanderfisch verloren, den ich je mit der Fliege gefangen habe.
Es ist eine herbe, niederschmetternde Enttäuschung und für den Rest des Tages fühle ich mich wie eine Versagerin. Dabei ist es ebendieser Tag, an dem ich zur Fliegenfischerin werde.
Wenn der junge Lachs die Laichgrube verlässt, gehört er zu den am ärgsten gefährdeten Lebewesen des Flusses. Der Brütling oder »Fry« ist nur wenige Zentimeter lang, hat aber bereits die Anatomie eines Fisches mit Flossen und Schwanz entwickelt. Aber er ist kein guter Schwimmer und kämpft mit Mühe gegen die Strömung des Flusses an. Um das zu ändern, muss er das nächste Wagnis eingehen. Mit einem zaghaften Schwanzflattern treibt der Fry sich vorwärts und strampelt an die Wasseroberfläche, wo er den ersten Atemzug nimmt und so seine Schwimmblase aufpumpt, mit der er den Auftrieb aufrechterhalten und regulieren kann.
Diese erste Erkundung außerhalb des Wassers ist ein Abenteuer, das für die Jungfische fast so bedeutsam ist wie ihr Schlupf. Danach kehren sie auf den sicheren Flussboden zurück, sind fortan aber zumindest dafür ausgestattet, ihren Platz im aquatischen Ökosystem zu verteidigen und den Launen der Strömung und allem, was in ihr lebt, zu widerstehen.
Die Jungfische bewegen sich nun selbstständig durch den Dschungel des Wassers, doch die neu gewonnene Unabhängigkeit hat ihren Preis. Mit dem Verlassen des Nests gelangen sie in das Reich der Raubtiere – den ersten von vielen, denen sie auf ihrer langen Reise begegnen werden. Sie sind größeren Fischen, Flussottern, aber auch Vögeln wie dem Eisvogel ausgeliefert, die am Fluss leben und sich an seinen Bewohnern gütlich tun. Als vollständige Mitglieder des Ökosystems Fluss sind sie ab jetzt den schonungslosen Realitäten der dort geltenden Nahrungskette ausgesetzt.
Dabei gehen die Gefahren nicht nur von anderen Arten aus. Die Jungfische sind einander eine Bedrohung, denn sie konkurrieren um Nahrung, da sie für ihr Wachstum Unmengen von Plankton aus dem Wasser aufnehmen. Die Gefahr, Raubtieren zum Opfer zu fallen, ist ebenso hoch wie die Wahrscheinlichkeit zu verhungern. Für den Lachs ist das Fry-Stadium die Zeit mit der höchsten Todesgefahr: Nur einer von fünf Fischen überlebt.
Die wenigen, die das tückische erste Lebensjahr überstehen, wachsen zu »Parr« heran: jungen Lachsen, die in das vorletzte Süßwasserstadium eingetreten sind, das ein oder mehrere Jahre dauern und mit dem Verlassen des Flusses enden wird. In dieser prägenden Phase reifen die Parr in mehrfacher Hinsicht. Ihr Wachstum beschleunigt sich, da ihre Nahrung nun auch aus Wasserinsekten besteht. Sie zeigen Territorialverhalten und suchen flache Gewässer auf, wo größere Felsen nicht nur Schutz vor Räubern, sondern auch vor ihren Artgenossen bieten. Und sie verändern ihr Aussehen, indem sie dunkle Querstreifen – das typische Parr-Muster – entwickeln, mit denen sie sich an ihre Umgebung anpassen und so Schutz finden.
Obwohl ein Parr schon so einiges durchgemacht hat, hat er doch nur einen Bruchteil der Gefahren kennengelernt, mit denen er bald konfrontiert sein wird. Wenn er zur nächsten Stufe seines Lebenszyklus heranreift, wird er seine schützenden Markierungen ablegen, doch der Überlebensinstinkt, für den sie stehen, bleibt ihm dauerhaft eingeprägt.
Wenn man zu angeln beginnt, begreift man sehr schnell: Der Lachs ist anders als die anderen Fische. Den König der Fische an den Haken zu bekommen, das spukt vielen Fliegenfischern das ganze Jahr im Kopf herum und sie erwarten sehnsüchtig die neue Saison, damit sie die Jagd wieder aufnehmen können. Dabei wird ihr Vorhaben durch die rätselhaften Eigenschaften des Lachses reglementiert: So braucht der Fisch keine Nahrung mehr, sobald er in den Fluss zurückgekehrt ist, und kann daher im Gegensatz zur Forelle nur schwer mit einem als Mahlzeit verbrämten Köder angelockt werden. Der Lachs ist nicht nur misstrauisch, die Selbsterhaltung ist tief in ihm verankert. Er hat eine Tausende Kilometer weite Meereswanderung hinter sich und dabei das Schlimmste erlebt, was Natur und Mensch ihm antun können. Sein Körperbau und sein Instinkt machen den ins Süßwasser zurückgekehrten Lachs zu einem besonders intelligenten und schwer zu fangenden Fisch. Er hat zu viel überstanden, um sich jetzt leichtfertig zu ergeben. So wird der Fang eines Lachses zu einem unwahrscheinlichen Ereignis und jeder Kampf mit ihm zu einer unerhörten Begebenheit.
Bevor ich das alles wusste oder verstand, merkte ich, dass meine Eltern anders sprachen, wenn es um den Lachs ging, und dass sie besonders konzentriert und angespannt waren, wenn wir in den Sommerferien nicht Forellen, sondern Lachse angelten. Ich beobachtete meine Eltern und ich beschloss, ihnen nachzueifern: Ich wollte selbst einen Lachs fangen, denn ich wollte verstehen, warum sie sich so sehr für einen Fisch interessierten, der sich in meinen – unerfahrenen – Augen nicht besonders von anderen unterschied.
Drei Jahre waren vergangen und wir waren wieder in Schottland, diesmal am Oykel, einem Zufluss des Kyle of Sutherland, der schmaler und weniger beängstigend ist als der Spey. In einigen Abschnitten des Oykel konnte ich schon mit zwölf Jahren bis auf die andere Seite auswerfen. Noch harmloser ist der Borgie, ein winziger Fluss, an dem ich einige Jahre später nur mit meiner Mutter unterwegs war und erfahren musste, dass man einen Fisch, den man quasi vor der Nase hat, nicht automatisch fängt.
Einen äußerst frustrierenden Nachmittag lang beobachtete ich, wie ein Lachs nach dem anderen aus dem seichten Wasser sprang und uns seine Bauchflosse zeigte – lustige Akrobaten, die keinerlei Anstalten machten, die Fliege zu nehmen. Ich konnte den Köder zielgenau über ihnen auswerfen, aber das bewirkte rein gar nichts: Hat ein Lachs kein Interesse, lässt sich nichts machen. Ich wurde immer ungeduldiger, bis meine Mutter mir schließlich zuraunte, sie würde es weiter flussaufwärts probieren. »Ich bleibe hier«, erwiderte ich, den Blick stur auf das Wasser gerichtet.
Die Ferien zogen sich wie ein weiterer Fluss durch meine Kindheit: ein steter und doch abwechslungsreicher Strom, mit immer anderen Orten und Begebenheiten. Die gemeinsamen Urlaube blieben auch nach der Trennung meiner Eltern bestehen. Ich war elf, als die beiden auseinandergingen und die Familie sich voneinander entfernte: Mein Vater blieb in unserem Haus in Stow-on-the-Wold, meine Mutter kehrte nach Schottland zurück. Ich folgte ihr, ging in den Highlands zur Schule und teilte meine Sommerferien zwischen den englischen Cotswolds und den Lachsfanggebieten im Herzen Schottlands auf. Als ich so um die Mitte zwanzig war, gingen meine Mutter und ich auch alleine auf Reisen, aber den großen Sommerurlaub unternahmen wir weiter als Familie. Sie taten alles, um uns trotz der Entfernung eine gewisse Kontinuität zu bieten, und ich habe von beiden Eltern Liebe und Unterstützung erfahren – ihr stetes Vorbild und ihre sanfte Ermutigung gaben mir das Gefühl, dass ich mit jedem Problem zu ihnen kommen konnte, und das tat ich auch.
Und so waren auch beide mit mir an der Oykel, als ich im Alter von elf Jahren eine erste Verbindung zu den Lachsen aufnahm. Ich konnte inzwischen allein angeln, mit der Bedachtsamkeit eines Anfängers. Ich lernte, wie man die Schnur im richtigen Bogen führt und die Fliege dort absetzt, wo man sie haben möchte. Ich kannte die richtigen Töne, ich wusste, welche Abfolge sie haben mussten, aber ich fand noch nicht diesen abgeklärten Rhythmus, diesen intuitiven Flow, mit dem die wahren Kenner auswerfen. Das würde später kommen – viel später. Die Feinheiten des Drills, also des Gebens und Nehmens von Leine, und die selbst bei kleinen Stippvisiten am Ufer erforderliche große Geduld wurden mir allmählich zur Gewohnheit. Einen Lachs aber hatte ich immer noch nicht an der Angel gehabt. Meine Ungeduld war mir Freund und Feind zugleich, sie ließ mich nicht los. Meine Eltern fingen ständig Lachse und auch mein Bruder hatte seinen ersten gelandet. Ich konnte nicht akzeptieren, dass ich als Einzige leer ausging.
Ich angelte flussabwärts, mit Wathose im Wasser stehend, mein geliebter Border Terrier sah mir vom Ufer aus zu. Die Hündin war meine Kumpanin, die auch in meinem Bett schlief, wo sie ihr raues, rehbraunes Fell an meine Füße drückte. Ein Leben ohne sie war für mich nicht vorstellbar, denn sie folgte mir überallhin, mit kurzen Beinen, die nur mit Mühe mithalten konnten, aber nie müde wurden.





























