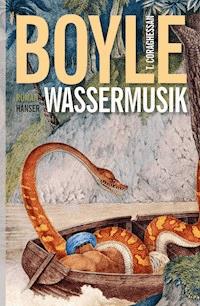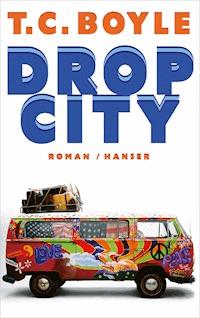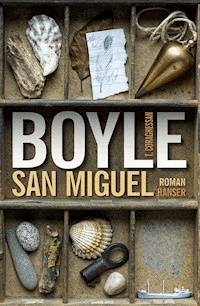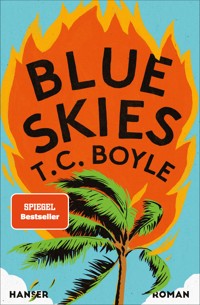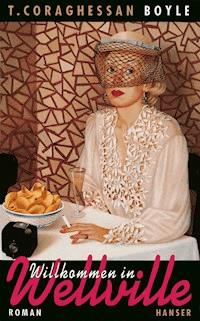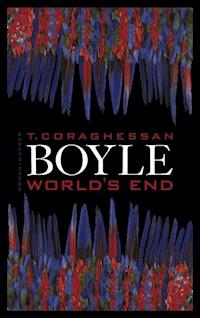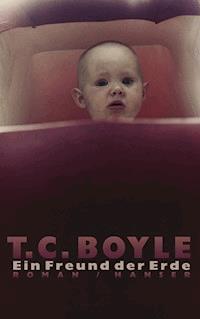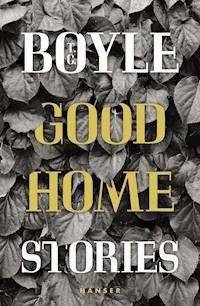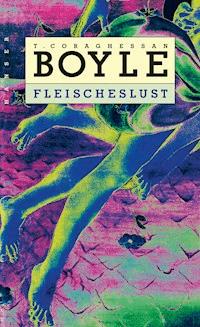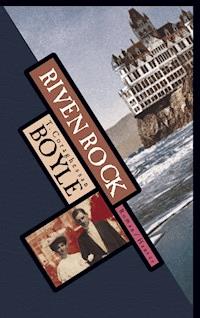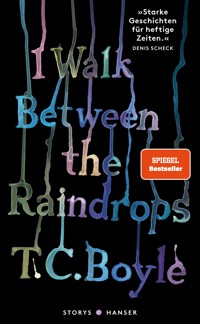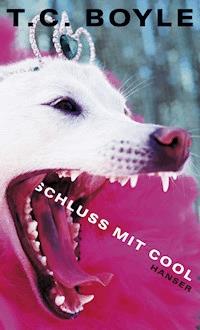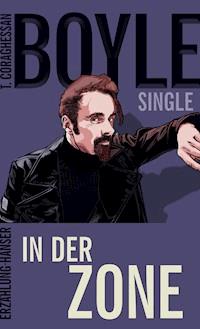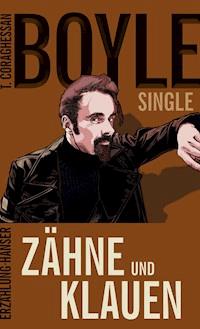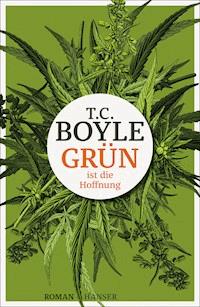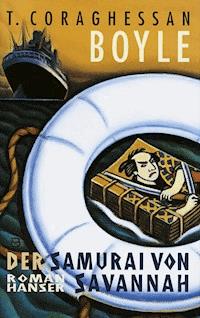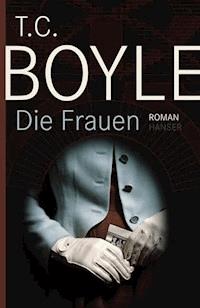
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er ist genial, er ist exzentrisch und er ist der berühmteste Architekt der USA - wenn nicht gar der Welt: Mit der überlebensgroßen Figur Frank Lloyd Wright erweitert T. C. Boyle seine Darstellung mythischer Amerikaner. Mitten in der Prärie hat Wright einen Traum verwirklicht: das Anwesen Taliesin. Hier lebt und arbeitet er mit seinen treuen Schülern und seinen geliebten Frauen: der aparten Tänzerin aus Montenegro, der exaltierten Morphinistin und - natürlich - Mrs. Wright. Sie alle führen erbitterte Kämpfe gegen ihre Nebenbuhlerinnen und gegen die bigotte amerikanische Gesellschaft. Boyles Geschichte des großartigen Egomanen ist zugleich eine Kritik an der Prüderie der Amerikaner in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 950
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
T. Coraghessan Boyle
DIE FRAUEN
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Kathrin Razum
und Dirk van Gunsteren
Carl Hanser Verlag
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2009
unter dem Titel The Women bei Viking in New York.
Kathrin Razum übersetzte bis Seite 262 und Seite 383 bis 410,
Dirk van Gunsteren den Rest.
eBook ISBN 978-3-446-23337-9
© T. Coraghessan Boyle 2009
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Carl Hanser Verlag München 2009
2. E-Book-Auflage 2017
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt Electronic Publishing GmbH, Hamburg
www.hanser.de
www.tc-boyle.de
Für Karen Kvashay
VORBEMERKUNG DES AUTORS
Dieses Buch ist eine fiktionale Darstellung bestimmter Ereignisse im Leben Frank Lloyd Wrights, seiner drei Ehefrauen – Catherine Tobin, Maude Miriam Noel und Olgivanna Lazovich Milanoff – und seiner Geliebten Mamah Borthwick Cheney. Obwohl es um tatsächliche Ereignisse und historische Gestalten geht, sind die einzelnen Situationen und Dialoge erfunden, mit Ausnahme der Zitate aus zeitgenössischen Presseberichten. Ich bin den zahlreichen Biographen Frank Lloyd Wrights und Verfassern persönlicher Erinnerungen an ihn zu tiefem Dank verpflichtet, insbesondere Meryle Secrest, Brendan Gill, Robert C. Twombly, Finis Farr, Edgar Tafel, Julia Meech, Anthony Alofsin, John Lloyd Wright und Ada Louise Huxtable. Außerdem danke ich Keiran Murphy und Craig Jacobsen von Taliesin Preservation Inc. für ihre Unterstützung sowie Charles und Minerva Montooth und Sarah Logue für ihre Herzlichkeit und Gastfreundschaft.
Schon früh in meinem Leben
musste ich mich zwischen ehrlicher Arroganz
und scheinheiliger Demut entscheiden;
ich entschied mich für die Arroganz.
Frank Lloyd Wright
Erster Teil
OLGIVANNA
EINFÜHRUNG ZUM ERSTEN TEIL
Ich kannte mich damals mit Automobilen kaum aus – was übrigens bis heute nicht anders ist –, doch es war ein Automobil, mit dem ich im Herbst 1932 nach Taliesin gelangte, durch eine Landschaft, die mal mit Bäumen befestigt, mal wie ein Teppich bis zur Rückseite der Scheunen, Heuschober und Farmhäuser ausgerollt war, durch Ortschaften mit Namen wie Black Earth, Mazomanie oder Coon Rock, wo kein Mensch je einen Japaner zu Gesicht bekommen hatte. Oder einen Chinesen. Wenn ich anhielt, um zu tanken, ein Sandwich zu essen oder auf die Toilette zu gehen, hätte man meinen können, ein Marsmensch wäre erschienen und hätte sich auf dem Fahrersitz eines ganz normalen kanariengelben und pechschwarzen Stutz Bearcat Roadsters niedergelassen. (Was ist das überhaupt, eine »Bärenkatze«? Eine Art Hybridmonster aus dem Fundus eines Werbefachmanns wahrscheinlich, das brüllend die Straße mit seinen Tatzen bearbeitet, und genau das tat auch meines, wie angepriesen.) Die meisten Leute auf meiner Fahrt an jenem Tag, der zu heiß war für Oktober, zu still, zu klar, als wollte die Jahreszeit gar nicht mehr wechseln, gafften, bis sie es selbst bemerkten, und schauten dann weg, als wäre das, was sie gesehen hatten, nicht wirklich bei ihnen angekommen, nicht einmal als flüchtiges Bild auf der Netzhaut. Nur ein Mann – und ich mache ihm das nicht zum Vorwurf, denn er wusste es nicht besser, und ich hatte mich inzwischen daran gewöhnt – reagierte auf meine Hamburger-Bestellung, indem er die Kinnlade einen halben Meter herunterklappen ließ und ausrief: »Heiliger Strohsack – Sie sind Chinese, stimmt’s?«
Das Ganze wurde dadurch noch komplizierter, dass ich es nicht schaffte, das Verdeck zu schließen, weshalb mein Gesicht nicht nur der sengenden Sonne und einer gnadenlosen Kanonade von Staub, Hühnerfedern und pulverisiertem Dung ausgesetzt war, sondern auch dem Glotzen jedes einzelnen phlegmatischen Einheimischen, den ich auf dem Weg durch Wisconsin passierte. Die Radfurchen waren eine Plage, die Schlaglöcher Pfuhle voll verfärbtem Wasser, das alle zwanzig Meter geysirartig in die Höhe spritzte. Und dann die Insekten: Noch nie im Leben hatte ich so viele Insekten gesehen – als wäre die Urzeugung eine Tatsache und die Erde würfe sie einfach aus, wie Pollenkörner, zahllos wie Sand oder Staub. Sie zerplatzten auf der Windschutzscheibe zu leuchtenden Klecksen aus Flüssigkeit und festen Stoffen, bis ich die Straße kaum mehr erkennen konnte. Und überall die ziellos herumlaufenden Farmhunde, die umherirrenden Gänse, desorientierten Schweine und selbstmörderischen Kühe – ein Hindernis nach dem anderen tauchte unvermittelt in meinem Blickfeld auf, bis ich schließlich vor jeder Kurve, jeder Kreuzung innerlich erstarrte. Ich muss an hundert Farmwagen vorbeigefahren sein. An tausend Feldern. Unzähligen Bäumen. Ich klammerte mich am Lenkrad fest und biss die Zähne zusammen.
Drei Tage zuvor hatte ich meinen fünfundzwanzigsten Geburtstag gefeiert – allein, im Nachtzug vom Grand Central Terminal zur Union Station in Chicago, in meinem Koffer ein Gratulationstelegramm meines Vaters sowie meine abgegriffenen Wendingen-Hefte, den Band Ausgeführte Bauten und Entwürfe von Frank Lloyd Wright und einige neue Kleidungsstücke, die mir, wie ich glaubte, im Hinterland würden nützlich sein können, Blue Jeans, Freizeithemden und ähnliches mehr. Ich hatte mir noch nicht einmal die Mühe gemacht, sie auszupacken. Für mich hatte diese Expedition rituellen Charakter und verlangte nach Gesellschaftskleidung und förmlichem Verhalten, trotz der Unbilden der Fahrt und der nur als ungeordnet zu bezeichnenden Zustände auf dem Land. Mein gekämmtes – und wegen des daran reißenden Windes immer wieder aufs neue gekämmtes – Haar war ein seidig glänzendes, pomadisiertes Muster an Form und Gestaltung, und ich trug meinen besten Anzug, einen neuen Kragen und eine Krawatte, die ich eigens für diesen Anlass ausgesucht hatte. Schutzbrille und Mütze waren mir nicht nötig erschienen, doch hatte ich mir bei Marshall Field’s ein Paar Autohandschuhe besorgt (taubengraue, aus Ziegenleder) und dazu einen weißen Seidenschal, den ich im Geiste hatte fröhlich im Wind flattern sehen, der sich tatsächlich dann aber in schweißtreibendem Würgegriff um meinen Hals gewickelt hatte, ehe ich auch nur fünfzehn Kilometer weit gefahren war.
Ich drückte das Rückgrat durch, hielt mit der einen Hand das Lenkrad, mit der anderen den geheimnisvollen Schaltknüppel, wie es mir der hilfsbereite und höfliche Mann von der Automobilhandlung am vorigen Abend in Chicago beim Kauf des Wagens gezeigt hatte. Es war ein 1925er Modell, gebraucht, aber »sehr sportlich«, wie er mir versichert hatte – »in erstklassigem Zustand, eins a, wirklich eins a« –, und ich hatte es mit einem Scheck bezahlt, ausgestellt auf das Konto, das mein Vater mir eingerichtet hatte, als ich vier Jahre zuvor in San Francisco an Land gegangen war (und auf das er weiterhin, so großzügig wie fürsorglich, an jedem Monatsersten etwas überwies).
Ich muss gestehen, dass mir das Auto gefiel, wie es dort am Straßenrand stand – ausgesetzte Bewegung, verhaltene Kraft und so weiter – wobei ich mich durchaus fragte, was mein Vater wohl dazu gesagt hätte. Man dachte unweigerlich an lose Mädchen und Studienanfängerinnen im Waschbärmantel – oder, schlimmer noch, an Gangster –, aber die anderen Wagen sahen daneben einfach gewöhnlich aus. Geradezu trist. Es gab einen schwarzen Durant Six, dessen Fenster eigentlich das Emblem eines Bestattungsunternehmens hätten tragen müssen, und mindestens ein Dutzend, wenn nicht mehr langweilige Fords in jener – mittlerweile verblassten – Farbe, die Henry Ford Japanschwarz genannt hatte (ich habe keine Ahnung, warum, es sei denn, er dachte dabei an Tuschestäbe und kanji, aber woher hätten er oder seine Konstrukteure in den abgelegenen, fremdenfeindlichen Randbezirken Detroits von kanji wissen sollen?).
Die Kotflügel wiesen, soweit ich sehen konnte, keine Einschusslöcher auf, und der Motor knatterte und röhrte, dass es eine Freude war. Ich setzte mich ans Steuer, fuhr ein, zwei Runden um den Block, während der Verkäufer neben mir Anweisungen und Mahnungen ausstieß und meine Fortschritte lobte, und dann war ich allein und kroch im Schneckentempo aus der Stadt, während die ratternden, hoch aufragenden Fords und Chevrolets auf mich zugebraust kamen oder von hinten heranschossen, um mich zu überholen. Ich beachtete sie nicht weiter, auch wenn die anderen Fahrer höhnisch frohlockten und durchs Fenster unanständige Gesten machten. Nein, ich war zu beschäftigt – Schaltknüppel, Kupplung, Bremse und Gaspedal forderten meine ungeteilte Aufmerksamkeit. (Theoretisch war es ein Klacks, ein Auto zu steuern, eine reine Reflexsache – das konnte jeder, sogar Frauen –, doch in der Praxis war es, als stiege man immer wieder in das überhitzte Wasser einer Badewanne.)
Was ländliche Gegenden angeht, so war ich ihnen an der Harvard University noch am nächsten gekommen, wo mein Zimmer im Studentenwohnheim auf gepflegte Rasenflächen, Gesträuch und die endlosen Schatten hinausging, die Eichen und Ulmen dort schon seit Generationen über die Studenten breiteten. Auf einer Farm war ich noch nie gewesen, nicht einmal zu Besuch, und Fleisch und Eier kaufte ich wie jeder andere im Laden. Nein, ich war ein Stadtmensch durch und durch, aufgewachsen in einer Reihe verschiedener Wohnungen im Tokioter Stadtteil Akasaka und in Washington, D.C., wo mein Vater sechs Jahre als Kulturattaché der japanischen Botschaft gearbeitet hatte. Ich mochte Bürgersteige. Asphaltierte Boulevards. Straßenlampen, Läden und Restaurants, in denen man einen französischen Oberkellner und womöglich sogar einen Küchenchef antreffen konnte, der Béchamelkartoffeln und Sauce béarnaise zuzubereiten wusste, nicht nur den allgegenwärtigen Kartoffelbrei mit brauner Soße. Wie jeder andere bewegte ich mich mit Zug, Straßenbahn und Droschke von einem Punkt zum anderen, und die einzigen Tiere, die ich häufiger zu Gesicht bekam, waren Tauben. Und Hunde. An der Leine.
Trotzdem mühte ich mich nun mit der Gangschaltung und einer Kupplung ab, die so schwergängig war, dass mir beim Treten des Pedals jedesmal fast die Kniescheibe heraussprang, und folgte den Windungen einer gottverlassenen unasphaltierten Landstraße im Hinterland von Wisconsin, von einer immer dicker werdenden Schicht aus Staub und Insektenteilen überzogen, frustriert, verärgert und ohne Orientierung. Nein, nicht nur ohne Orientierung: Ich hatte mich hoffnungslos verfahren. Schon zum dritten- und vermutlich nicht letztenmal war ich an demselben Farmhaus vorbeigekommen, an demselben kaputten Karren mit rostigen Rädern, durch dessen Speichen sich das Unkraut rankte, demselben Feld mit denselben keilgesichtigen Kühen, die mich aus ihren aufreizend ausdrucksleeren Glotzaugen anstierten. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Irgendwie hatte mich die Straße in Trance versetzt, meine Gliedmaßen bewegten sich automatisch, mein Gehirn war ausgeschaltet, und ich konnte nicht anders als links, dann rechts und wieder links abbiegen, bis die altbekannte Scheune vor mir auftauchte und ich in meinem brummenden Straßenflitzer, der zu meinem Gefängnis und Purgatorium geworden war, ein weiteres Mal an ihr vorüberkroch.
Dabei war ich sogar im Besitz einer handgezeichneten Landkarte, die mir ein gewisser Karl Jensen zugeschickt hatte, Sekretär der Taliesin Fellowship, deren neues Mitglied – und Gründungsmitglied – ich war, doch auf dieser Karte führte eine angebliche Straße an einem angeblichen Fluss entlang, den es nicht zu geben schien. Das unablässige Heulen des Motors als Resonanzschwingung in meinem Kopf, fragte ich mich gerade, wo ich wohl falsch gefahren war, als sich der Anblick zum viertenmal vor mir auftat, doch diesmal hatte sich etwas verändert: Da war die Scheune, da der Karren, da standen die Kühe, doch es war etwas Neues hinzugekommen. Eine stämmige Frau im grauen Hängekleid mit Schürze hatte sich an den Straßenrand gestellt, neben sich einen gestromten Hund und zwei kleine Jungen. Sobald sie mich sah, begann sie heftig mit den Armen zu rudern, als befänden wir uns auf hoher See und sie wäre über die Reling in die grüne Umklammerung des Kielwassers gestürzt, und im nächsten Moment riss ich auch schon am Schaltknüppel und trat auf die Bremse, bis das Auto etwa sieben Meter vor ihr mit einem Ruck zum Stehen kam. Sie wartete einen Augenblick, bis der Staub sich gelegt hatte, dann trat sie mit stoischer Miene näher, während die Jungen (sie müssen etwa sieben oder acht gewesen sein) vor ihr her sprangen, den kläffenden Hund auf den Fersen.
»Hallo!« rief sie mit dünner, atemloser Stimme. »Hallo!«
Sie stand jetzt neben dem Auto, die Jungen hingegen waren im letzten Moment zurückgewichen und äugten, bis zur Taille in dem Bewuchs am Straßenrand stehend, unsicher zu mir herauf. Ich war mir der Distanz zwischen uns bewusst, der hohen Warte, die ich meinem Stutz-Automobil einnahm, der gewaltigen, langgestreckten Schräge der Kotflügel. Das Unkraut, das hier und da vom Braun der Jahreszeit überzogen war, wucherte in die Straße hinein, die ohnehin kaum breiter als ein Karrenweg war. Einer der Jungen pflückte einen Grashalm und steckte ihn sich zwischen die Schneidezähne. Mir fiel nichts ein, was ich hätte sagen können.
Ich studierte ihre Miene, während sie mich musterte: zwei helle irische Augen, die mein Gesicht, meine Kleider, mein formidables Automobil taxierten. »Suchen Sie was?« fragte sie, redete dann aber sofort weiter, ohne eine Antwort abzuwarten. »Weil, Sie fahren diese Straße jetzt schon zum viertenmal lang. Haben Sie« – und nun erfasste sie schließlich, was ihre Augen ihr schon die ganze Zeit sagten, nämlich dass ich ein Ausländer, ja, schlimmer noch, ein Exot war – »sich verirrt oder so?«
»Ja«, sagte ich, um ein Lächeln bemüht. »Offenbar habe ich mich ziemlich ... verfranzt. Ich will nach Taliesin?« Ich machte eine Frage daraus, allerdings war mir damals nicht klar, dass ich den Namen falsch aussprach, denn ich hatte ihn noch nie laut ausgesprochen gehört. Vermutlich hatte ich ihm eine japanische Betonung gegeben – Tál-je-sien statt des süßlicheren Tal-i-éssin –, jedenfalls starrte sie mich nur verständnislos an. Ich wiederholte es noch zweimal, bis einer der Jungen sich meldete. »Ich glaube, er meint Taliesin, Ma.«
»Taliesin?« wiederholte sie, und ihr Gesicht verzog sich, als stoße ihr der Name sauer auf. »Was wollen Sie denn da?« Ihre Stimme hob sich auf der letzten Silbe zu einer Art unterdrücktem Jaulen, doch noch während sie fragte, verfestigte sich in ihren Augen schon die Antwort. Was immer sie mit dem Namen verbinden mochte, es war nichts Erfreuliches.
»Ich habe eine, äh« – unter mir bebte und spotzte das Auto – »eine Verabredung.«
»Mit wem?«
Die Worte entschlüpften mir, ehe ich’s mich versah: »Mit Wrieto-San.«
Die zusammengekniffenen Augen, der Mund wieder gallig verzogen, der hechelnde Hund, die gaffenden Jungen, überall Insekten. »Mit wem?«
»Mr. Lloyd Wright«, sagte ich. »Dem Architekten. Erbauer des« – ich hatte Ausgeführte Bauten und Entwürfe von Frank Lloyd Wright studiert, bis es ganz zerfleddert war, und kannte jedes seiner Häuser in- und auswendig, doch in dieser Extremsituation fiel mir nur Tokios ganzer Stolz ein – »Hotels Imperial.«
Kein Aufhorchen, nichts. Langsam begann ich mich zu ärgern. Mein Englisch war vollkommen verständlich, ja ich beherrschte die Sprache gut genug, um einigermaßen mühelos jenen hohltönenden Konsonanten zu erzeugen, der meinen Landsleuten solche Schwierigkeiten bereitete. »Mr. Lloyd Wright«, wiederholte ich unter sorgfältiger Betonung des Doppel-L.
Jetzt war es an mir, etwas ausgiebigere Betrachtungen anzustellen: Wer war diese Frau? Diese Farmerin mit den schmuddeligen Jungen, den überdimensionalen Brüsten und mehreren Kinnen, die einander umschlossen wie die Jahresringe eines Baums? Was für ein Recht hatte sie, mich auszufragen? Ich wusste es nicht, damals noch nicht, doch ich vermutete, dass sie noch nie vom Hotel Imperial gehört hatte, von seiner überirdischen Schönheit und der revolutionären Bauweise, dank der es die schlimmste Erdbebenkatastrophe in unserer Geschichte mit wenigen, lediglich oberflächlichen Schäden überstanden hatte – ja ich vermutete, dass sie nie auch nur von meiner Heimat gehört hatte oder von den riesigen brodelnden Weiten des Pazifiks, die zwischen ihrem und meinem Land lagen. Doch den Namen Lloyd Wright kannte sie. Er explodierte wie eine Granate in der Tiefe ihrer Augen und drückte ihre Mundwinkel nach unten, bis ihre ganze Mundpartie wie versteinert wirkte.
»Ich kann Ihnen nicht helfen«, sagte sie, hob die Hand und ließ sie wieder fallen, dann wandte sie sich ab und ging die Straße entlang zurück. Die Jungen blieben noch einen Augenblick stehen, tief beeindruckt von der wundersamen Erscheinung dieses glänzenden, sportlichen gelbschwarzen Automobils, das am Rand ihres Landsträßchens angehalten hatte, und des Exoten an seinem Steuer, doch dann ließen sie die Schultern hängen und trödelten ihr hinterher. Ich blieb mit den Insekten, der Vegetation und dem Hund zurück, der sich kurz in den Staub hockte, um sich hinter dem Ohr zu kratzen, und dann davontrottete, den anderen nach.
Wie sich zeigte, fand ich den Weg nach Taliesin schließlich doch, was immer das auf der symbolischen Ebene besagen oder worauf es hindeuten mochte – hätte ich ihn nicht gefunden, wäre es wenig sinnvoll, dies alles zu Papier zu bringen. Jedenfalls saß ich noch einen Moment lang da, verblüfft über die Gleichgültigkeit, die man mir demonstriert hatte und die hier vielleicht normal sein mochte, in meiner Heimat aber undenkbar gewesen wäre. Amerikaner, brummte ich, und musste unweigerlich an meinen Vater denken, der sich gern und oft über dieses Volk beklagte und der wachsenden Frustration während seiner Jahre in Washington fast erlegen wäre, dann packte ich den Schaltknüppel und wendete. Diesmal zog das Farmhaus links an mir vorbei, und nachdem ich mehrmals hintereinander willkürlich abgebogen war, entdeckte ich tatsächlich neue Scheunen, neue Landsträßchen, neue Radfurchen, bis schließlich – mirabile dictu – der angebliche Fluss in Sicht kam und mit ihm die Straße. Meine Stimmung verbesserte sich schlagartig. Es ging aufwärts.
Gleich kommt es, sagte ich mir immer wieder, gleich kommt es, doch inmitten meiner wachsenden Vorfreude meldete sich plötzlich meine Unsicherheit. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartete. Zwar war ich von meiner bisherigen Ausbildung durchaus überzeugt – nach einem abgeschlossenen Studium an der Kaiserlichen Universität Tokio war ich zu weiterführenden Studien erst nach Harvard, dann ans M.I.T. gegangen, um mir ein modernes, ein westliches Architekturverständnis anzueignen, und ich war bereit, dafür von morgens bis abends zu arbeiten und auch die Nacht noch zum Tage zu machen –, doch nach Taliesin fuhr ich infolge eines spontanen Entschlusses. Es war ganz simpel gewesen: Im vergangenen Frühling hatte ich mich eines Nachmittags mit einem Zikkurat aus Büchern unter dem einen Arm und dem Kasten mit meinen Zeichenutensilien unter dem anderen durch den Flur des Architekturgebäudes geschleppt, verstimmt und deprimiert (ich hatte das, was die modernen Musiker – nach der Farbe der Anomie und Hoffnungslosigkeit – den »Blues« nennen, denn meine Geliebte hatte mich wegen eines weißen Amerikaners verlassen, der Posaune spielte, dieses phallischste aller Instrumente, und mein Studium war so eintönig, geistlos und gestrig wie die ionischen Säulen und Plinthen, auf denen es basierte), und in meinem Trübsinn und Lebensüberdruss war ich einen Moment lang vor dem Schwarzen Brett neben dem Zimmer des Deans stehengeblieben.
Ein Anschlag fiel mir ins Auge. Auf cremefarbenem, langfaserigem Papier wurde, exquisit gedruckt, die Gründung der Taliesin Fellowship unter der Schirmherrschaft von Frank Lloyd Wright bekanntgegeben, mit Sitz auf dessen Anwesen samt Studio in Wisconsin, Schulgeld 675 Dollar inklusive Kost und Logis und persönlichem Kontakt mit dem Meister. Ich ging sofort auf mein Zimmer und setzte ein Bewerbungsschreiben auf. Fünf Tage später telegrafierte mir Wrieto-San persönlich und teilte mir mit, dass ich angenommen sei und er meinen Scheck erwarte.
Und nun war ich also hier, stand kurz vor dem Augenblick der Wahrheit. Am Scheideweg, sozusagen, und wer konnte es mir da verdenken, dass mir einigermaßen bange war? Ich fühlte mich wie ein Studienanfänger, der zum erstenmal das Universitätsgelände betritt und sich fragt, wo er schlafen und was er essen wird, wie seine Altersgenossen ihn beurteilen werden und ob er die Gnade von Erfolg und Anerkennung erfahren oder in Schande und Versagen enden wird. Ich fuhr unwillkürlich schneller, der Wind zerrte an meinem Haar, die Enden meines Schals klatschten mir auf die Schultern wie ein in der Mitte zerrissenes nasses Handtuch, und es war wohl der Vorsehung zu danken, dass auf dem letzten Stück nach Taliesin die herumtollenden Hunde, einhertrottenden Kühe und was da sonst noch alles war die Straße mieden und mir nicht in die Quere kamen.
Der Fluss zog sich dahin, die Straße ebenso. Fünf Minuten verstrichen, zehn. Ich war ungeduldig, ärgerte mich über mich selbst, mir war bang und unwohl, alles auf einmal – wo war es denn nun, wo war es, dieses Wunder der Architektur, das ich nur aus einem Buch kannte, dieses Muster an rarer Kunstfertigkeit, der materialisierte Himmel, in dem ich das ganze kommende Jahr und womöglich noch länger leben würde? Wo? Ich fluchte laut, während der Motor auf Hochtouren lief und und die Vegetation am Straßenrand zurückwich, als schlüge ein unsichtbarer Dreschflegel auf sie ein, doch ich sah immer nur das gleiche: Felder und noch mehr Felder, Maisstauden, das Auf und Ab der Hügel, egal, durch welches Tal ich fuhr, Scheunen, die ewigen Scheunen – und dann war es auf einmal da. Ich schaute hoch, und es tauchte plötzlich vor mir auf wie einer der verborgenen Tempel in der Geschichte vom Prinzen Genji, wie ein Trompe l’œil, wie etwas, das man erst sieht, wenn man direkt davor steht. Oder nein, es erschien nicht einfach, sondern entfaltete sich gleichsam aus dem Hügel vor mir, schloss sich wieder, entfaltete sich und schloss sich erneut.
Fuhr ich zu schnell? Ja. Eindeutig. Doch beim Bremsen vernachlässigte ich irgendwie die Kupplung – und das Lenkrad, das plötzlich ein Eigenleben entwickelte –, und mein Bearcat stieß ein letztes Jaulen aus, schlitterte in einem gewaltigen Wirbel aus Staub und fliegendem Dreck über die Straße und blieb mit abgewürgtem Motor entgegen der Fahrtrichtung stehen.
Egal. Dort stand das Haus, ein riesiges, niedriges Gebäude, das sich weitläufig vor mir über den Hügel erstreckte, von der Nachmittagssonne vergoldet, ein Phönix von einem Haus, 1911 erbaut, drei Jahre später abgebrannt, wiederaufgebaut und erneut abgebrannt, nur um sich ein weiteres Mal in seiner ganzen goldenen Pracht aus der Asche zu erheben. Ich musste an Schellings Ausspruch denken, dem zufolge große Architektur erstarrte Musik sei, Musik im Raum, denn das traf es genau, und dies hier war keine Kammermusik, es war eine Symphonie mit hundertstimmigem Chor, das Haus von Wrieto-San, sein Heim und Refugium. In das ich geladen worden war, um bei dem Meister in die Lehre zu gehen. Na gut. Ich klopfte mir den Staub vom Jackett, fuhr mir mit dem Kamm durchs Haar, versuchte vor allem, mich zu fassen. Dann ließ ich den Motor wieder an und machte mich auf die Suche nach der Zufahrt.
Es war gar nicht so einfach. Zunächst einmal konnte ich in diesem Wirrwarr aus Straßen und Feldwegen nicht erkennen, welches die Zufahrt zu dem Anwesen war, und als ich sie schließlich gefunden zu haben meinte, ein Sträßchen, das sich durch die matschige Senke einer Schweinefarm zog, blieb ich angesichts der Unmenge von Verbotsschildern erst einmal stehen. Die können sich ja wohl kaum auf mich beziehen, sagte ich mir, doch eine angeborene Unsicherheit – Schüchternheit, wenn man so will, oder vielleicht könnte man auch von einer natürlichen Ehrfurcht vor den gesellschaftlichen Regeln und Normen sprechen – hielt mich zurück. Das Automobil bebte im Matsch. Ich schaltete in den Leerlauf und starrte eine ganze Weile auf das mir nächste Schild. Seine Aussage war klar, ja völlig unmissverständlich. BETRETEN VERBOTEN, stand darauf.
In diesem Moment bemerkte ich hinter dem hölzernen Lattenzaun zu meiner Linken eine Gestalt, die mich beobachtete. Ein Farmer, nahm ich an. In schmutziger Latzhose und verschmierten Stiefeln. Er stand bis zu den Knöcheln im Mist des Schweinepferchs – genau mittendrin –, und um ihn herum wühlten die Tiere und verströmten einen der unangenehmsten, beißendsten Gerüche, die mir je untergekommen waren. Ich beobachtete ihn einen Augenblick, während er mich beobachtete – er grinste jetzt, und etwas Sarkastisches, Abschätziges trat in seinen Blick –, dann hob ich die Stimme, um den Motor und das Grunzen der Tiere zu übertönen. »Ich wollte fragen, ob –« setzte ich an, doch er schnitt mir mit einem kurzen, scharfen Lachen das Wort ab. »Oh, fahren Sie ruhig«, sagte er, »das ist ihm völlig schnuppe. Die sind nur für die Touristen da.« Er bedachte mich mit einem langen, nachdenklichen Blick. »Sie sind doch kein Tourist, oder?«
Ich schüttelte verneinend den Kopf, dankte ihm mit einer leichten Verbeugung und schaltete in den niedrigsten Gang, um den Hügel hinaufzufahren, der leider immer steiler wurde, je näher die Kalksteinmauern, Terrassen und flachen Walmdächer des Hauses rückten. Doch jetzt hatte ich Schotter unter den Rädern, und in den fraß sich der großartige Bearcat mit kreischendem Motor und malmenden Rädern hinein wie ein mythisches Tier, das mit den Flügeln schlägt und Feuer speit. Hinauf ging es, hinauf, hinauf – bis der Schotter plötzlich tiefer, zu einer Art steinernem Schlamm wurde und die Räder zauderten, ehe sie unter heftigem Auswurf von Splitt wieder griffen, und als ich daran dachte, auf die Bremse zu treten, hatte der Wagen auch schon den Kamm des Hügels erklommen und wäre fast mit der Schnauze an die hintere Stoßstange des dort oben geparkten Wagens gestoßen. Ich glühte vor Erregung, zitterte nach dieser Strapaze vor Anspannung und Freude. Was spielte es schon für eine Rolle, dass ich versehentlich die hintere Zufahrt genommen hatte, über die sonst nur der Traktor und die Zugpferde kamen? Was spielte es für eine Rolle, dass ich um ein Haar in die Stoßstange von Wrieto-Sans Cord Phaeton geknallt wäre, des schnellsten und majestätischsten Automobils, das je gebaut worden war? Ich war da. Ich war angekommen.
Meine ersten Eindrücke? Frieden, Schönheit allenthalben, eine altmodische Anmut und Eleganz der Linienführung. Doch da war noch mehr: eine tiefsitzende Spiritualität, die aus der Erde selbst zu kommen schien, als sei dies ein heiliger Ort, ein Schrein, an dem sich einst die Ureinwohner zum religiösen Kult versammelt hatten, in einer Zeit lange bevor Wrieto-Sans Vorfahren, die Lloyd-Joneses, aus Wales gekommen waren, einer Zeit vor Kolumbus, einer Zeit, als Edo noch von der Welt abgeschnitten gewesen war. Ich fühlte mich, als hätte ich einen der Tempel von Kioto betreten – Nanzenji oder eher noch Kinkakuji, dessen Blattgold das Licht in sich bewahrt. All meine Ängste lösten sich in Luft auf. Ich wurde mit einem Schlag ruhig, ganz ruhig.
Es war vier Uhr nachmittags. Die Sonne hing über den Baumwipfeln wie ein Glücksbringer an einer unsichtbaren Schnur. Ich stellte den Motor ab, und alle Vögel dieser Welt begannen zu singen. Die Abgase verflüchtigten sich fast unmittelbar, und ich spürte die Milde und Reinheit der Luft. Sie war von dem Duft nach Klee und Kiefern, nach dem Chlorophyll frisch gemähten Grases und einem Hauch von Holzfeuer erfüllt – und von dem Geruch nach Essen, nach Gekochtem, der mich daran erinnerte, dass ich seit jenem unglücksseligen Hamburger nichts mehr gegessen hatte. Ich nahm mir einen Augenblick Zeit, um tief durchzuatmen, erwog, mir eine Zigarette anzuzünden, entschied mich dann jedoch dagegen. Taliesin erwartete mich.
Ich stieg gerade aus und streifte mir die (schweißgetränkten) Handschuhe ab, um danach meinen verknoteten Schal zu lösen, da tauchte aus einer der Garagen im Hof gleich hinter der funkelnden Motorhaube des Cord eine Gestalt auf. Es dauerte einen Moment – ich sah im Nahbereich, also im Bereich des Zeichentischs, weit besser als in die Ferne –, ehe ich mit nun wieder hämmerndem Puls begriff, dass ich mich in der Gegenwart des Meisters höchstpersönlich befand.
Ich verbeugte mich. Tief. So tief, wie ich mich nur je vor einem Menschen verbeugt habe, meinen Vater und den Rektor der Kaiserlichen Universität Tokio eingeschlossen.
Er verbeugte sich ebenfalls, jedoch nur leicht – ein Neigen von Kopf und Schultern, wie es seiner Position mir gegenüber entsprach. Zu meiner Überraschung begrüßte er mich dabei auf japanisch. »Konnichi wa«, sagte er und richtete die Augen auf mich.
»Hajimemashite«, antwortete ich und verbeugte mich ein zweites Mal.
Wrieto-San war damals fünfundsechzig, nach eigenen Angaben allerdings erst dreiundsechzig, und nach seinem Aussehen und Verhalten zu urteilen, hätte er gar zehn oder fünfzehn Jahre jünger sein können. In seiner Autobiographie, die in jenem Jahr erschienen und hoch gelobt worden war, behauptete er, einen Meter siebzig zu messen, doch tatsächlich war er deutlich kleiner (ich selbst bin einen Meter achtundsechzig groß, und ich sollte im Laufe der folgenden Wochen verschiedentlich die Gelegenheit haben, unauffällig unsere Körpergröße zu vergleichen – ich war bestimmt drei, wenn nicht fünf Zentimeter größer als er). Er war gekleidet wie ein Ästhet auf dem Weg zu einer Kunstausstellung: Baskenmütze, Cape, ein Hemd mit hohem Kragen, wollene Wickelgamaschen, dazu der Malakkastock, den er gern benutzte, um seine Eleganz und Autorität zu unterstreichen. Sein Haar, ein Gewirk aus Schäfchen- und Gewitterwolke, quoll ihm über den Kragen.
»Ogenki desu-ka?« fragte er. (Wie geht es Ihnen?)
»Genki-desu«, antwortete ich. »Anata wa?« (Gut. Und Ihnen?) »Watashi-mo genki-desu.« (Mir geht es auch gut.)
Damit war sein Japanisch offenbar erschöpft, denn er beugte sich über die Motorhaube des Cord ins Licht, wie um mich noch besser betrachten zu können, und wechselte ins Englische. »Und Sie sind?« Ich verbeugte mich erneut, so tief ich konnte. »Sato Tadashi.« »Tadashi? Ich kannte mal einen Tadashi in Tokio – Tadashi Ito, einer aus Baron Ōkuras Gruppe.« Er musterte mich, registrierte den Glanz meiner Schuhe, die Bügelfalten meiner Hose, meinen Kragen und die Krawatte. »Ihr Name bedeutet ›korrekt‹, nicht wahr?«
Ich verbeugte mich bestätigend.
»Und entsprechen Sie Ihrem Namen? Sind Sie korrekt, Tadashi?«
Ich bejahte das – »zumindest am Zeichentisch« –, und er lachte. Wrieto-San lachte sehr gern, er war ein Ausbund an Fröhlichkeit und Ausgelassenheit und besaß einen natürlichen, wohltuenden Charme, durch den sein Genie noch an Strahlkraft gewann. Aber natürlich war er auch für seine Schärfe bekannt, für seine Launen und Wutanfälle, besonders wenn er das Gefühl hatte, dass man ihm nicht die Achtung – die Bewunderung, ja Verehrung – entgegenbrachte, die ihm seiner Ansicht nach gebührte.
»Und anständig auch?«
Eine weitere Verbeugung.
Jetzt grinste er – sein ganzes Gesicht verwandelte sich. »Tja, Tadashi, also, ich muss ja sagen – das ist eine der Eigenheiten Ihres Volkes, die ich am meisten liebe.« Er richtete sich auf und tänzelte auf den Pflastersteinen in einem kleinen Kreis um mich herum – er konnte nie lange stillhalten, sein Enthusiasmus war unerschöpflich, seine Energie vulkanisch. »Die strikte Beachtung von Normen und Beschränkungen. Ich kann das durchaus auch«, sagte er und zwinkerte, ehe er fortfuhr, »aber ich hoffe, Sie werden nicht schockiert sein, Sato-San, wenn ich häufiger unanständig als anständig bin. Sie würden einen Mann ja wohl nicht festnageln wollen, oder? Ihn in die Ketten der Konvention legen?«
Ich begriff nicht ganz, wohin unsere Unterhaltung sich bewegt hatte, doch ich erkannte, dass es eine Art scherzhaftes Geplänkel war und dass ein gemurmeltes »Nein« als Antwort völlig ausreichte.
»Sie sind doch der aus Harvard, stimmt’s, mit Zwischenstopp im Institute of Technology?«
»Ja.«
»Meiner Erfahrung nach« – wie ich feststellen sollte, gab er ständig irgendwelche grundsätzlichen Erklärungen ab, und diese äußerte er nicht zum erstenmal – »nimmt Harvard schlaue Füchse als Studenten auf und macht Esel aus ihnen.«
Seinem Ton war zu entnehmen, dass er Gelächter erwartete, also lachte ich und stimmte ihm zu. Da ich wusste, wie stark ihn die Architektur meines Landes, die schlichte und klare Linienführung unserer Wohnhäuser und Tempel, beeinflusst hatte, verbeugte ich mich abermals und sagte: »Ich konnte einfach nicht allein mit der klassisch und ornamental ausgerichteten Ausbildung, die man hier an der Universität bekommt, nach Japan zurückgehen ...«
»Und deshalb sind Sie zu mir gekommen.«
»Ich wollte eine praktische Herangehensweise – organische Architektur, die Verwendung einheimischer Materialien und die Gestaltung von Häusern, die die Natur ergänzen, statt sie zu dominieren, all das eben, was Sie als erster umgesetzt haben, beim Robie-Haus, beim Darwin Martin, beim, beim Willits und –«
Sein Gesichtsausdruck erinnerte – und dieser Vergleich ist keineswegs respektlos gemeint – an den eines Schoßhundes, den man auf den Rücken gerollt hat und am Bauch krault. Er sah hochzufrieden aus – ich hatte das Richtige, genau das Richtige gesagt – und beglückwünschte sich innerlich dazu, Sato-San zum Schüler gewählt zu haben. »Gut«, sagte er und hob eine Hand, um mir zuvorzukommen. »Ausgezeichnet. Aber ich warne Sie, ich bin kein Lehrer, und Sie werden hier keinen Unterricht erhalten. Die Fellowship, so wie ich sie mir vorstelle, wird Ihnen die Möglichkeit geben, meinem Bedarf entsprechend für meine Zwecke zu arbeiten, und zwar auf sämtlichen Ebenen, auf denen Sie meine Tätigkeit als praktizierender Architekt unterstützen können. Das ist Ihnen bewusst, oder?«
Ich bejahte.
»Gut, in Ordnung. Sie fangen in der Küche an. Mrs. Wright hat mir gesagt, dass dort noch jemand gebraucht wird.« Eine Glocke hatte zu läuten begonnen – es handelte sich, wie ich bald erfahren sollte, um ein chinesisches Artefakt, das er von einer seiner Exkursionen in den Fernen Osten mitgebracht hatte, und sie ertönte jeden Nachmittag um vier, damit sich die Mitglieder der Fellowship im Teezirkel zu einer kleinen Stärkung zusammenfanden. Er hatte sich schon abgewandt, um in Richtung des Läutens zu gehen, da drehte er sich noch einmal zu mir um: »Dieses Auto, Tadashi – gehört das Ihnen?«
»Ja, Wrieto-San.« Wir schauten beide zum Bearcat hinüber, der geduckt hinter dem Cord stand und dessen Kotflügel und kanariengelbe Motorhaube trotz der Staubschicht, die ihn überzog, noch schimmerten und glänzten. Wrieto-Sans Gesicht hatte einen nüchternen, wertenden Ausdruck angenommen. Es war die Miene, die er immer aufsetzte, wenn es ums Finanzielle ging, das leider im Mittelpunkt seines Lebens stand. Dass ein Mann seines Formats – ganz zu schweigen von Alter, Weisheit und Genie – sich permanent abmühen musste, um über die Runden zu kommen, fand ich damals ungeheuerlich, und das finde ich auch heute noch, all die Jahre später. Ja, ich hatte die Gerüchte gehört – dass er pleite sei, weil er infolge seiner diversen Missgeschicke und der Skandale, die ihn über die letzten zwanzig Jahre verfolgt hatten, erbärmlich wenige Aufträge erhalte, und weil die Wirtschaftskrise seinen potentiellen Kundenkreis schrumpfen lasse und weil zudem seine Arbeit aufgrund der sich wandelnden Mode mittlerweile als arrière garde gelte, und dass die Fellowship einfach nur ein Mittel sei, jene zu schröpfen, die naiv genug seien, um zu glauben, sie könnten aus seiner Aura einen verwertbaren Gewinn ziehen –, aber trotzdem war es ein Schock, zu sehen, in welchem Ausmaß dieser Mann damit beschäftigt war, die Dinge einfach nur am Laufen zu halten. Er war knauserig, anders kann man es nicht sagen. Vielleicht sogar ein Filou. Und wie nannten sie ihn in Spring Green, dem nächstgelegenen Ort? Frank Säumig.
»Ist der nicht ein bisschen extravagant?« überlegte er laut. »Will sagen, wäre es nicht in jeder Hinsicht klüger gewesen, wenn Sie Ihr Geld in die Fellowship gesteckt hätten? Ich meine, das Schulgeld deckt kaum Kost und Logis ab – ganz zu schweigen von all den anderen Vorteilen, in deren Genuss Sie hier kommen werden –, und ich halte es angesichts dieser schwierigen Zeiten sogar noch künstlich niedrig, um die Sache erst mal ins Rollen zu bringen. Aber das, Tadashi, das ist nun wirklich ... übertrieben.«
Es stand mir nicht zu, ihn auf den Widerspruch hinzuweisen. Im Vertrauen möchte ich allerdings doch anmerken, dass der Cord ein Vielfaches dessen gekostet haben muss, was ich – oder vielmehr mein Vater – für den Bearcat bezahlt hatte, auch wenn dieser zugegebenermaßen einen gewissen Luxus darstellte. Aber auch ich mochte schöne Dinge, und ich hatte noch nie zuvor ein Automobil besessen. Was ich tatsächlich sagte – mit einer Verbeugung –, war, dass der Wagen nicht war, was er schien.
»Es ist doch ein Stutz, oder?« fragte er nach und kniff die Augen zusammen.
»Hai, Wrieto-San. Aber ein alter. Er ist acht Jahre alt. Gebraucht. Ich habe ihn gebraucht gekauft. Gestern, in Chicago.« Ich versuchte ein Lächeln, obwohl es mit meiner Stimmung, ehrlich gesagt, bergab ging. »Um möglichst schnell hierherzugelangen und als Mitglied der Fellowship unter Ihrer Anleitung und Beratung zu arbeiten.«
Er schien das einen Moment lang zu bedenken. »Na schön«, sagte er schließlich. »Gut. Aber erwarten Sie keine Unterweisung von mir. Ich bin kein Pädagoge, beileibe nicht. Merken Sie sich das.« Die Glocke läutete erneut. Mehrere kleine Vögel – Schwalben? Mauersegler? – schossen unter dem Dachvorsprung hervor und flitzten durch den Hof. Wrieto-San wandte sich zum Gehen, doch dann fiel ihm noch etwas ein. Er bedachte mich mit einem langen Blick. »Sie können doch kochen«, fragte er, »oder?«
Nein, ich konnte nicht kochen. Das heißt, ich konnte so kochen, wie alle Junggesellen in allen Gesellschaften es können: minimal. Ein gekochtes Ei. Ein zweimal in der Pfanne gewendetes Beefsteak. Bratwurst mit Brötchen. Doch das spielte alles keine Rolle, denn mein Einsatz in der Küche sollte nichts anderes beinhalten als Kohl zu schneiden, Mais zu entblättern und die Kartoffeln zu schälen, die die anderen Schüler aus der mit Mist angereicherten Erde gegraben hatten. Das Kochen übernahmen zwei Frauen aus dem Ort, die Schwestern eines der Arbeiter, die Wrieto-San zur Renovierung der Hillside Home School angestellt hatte (vormals ein von Wrieto-Sans unverheirateten Tanten geleitetes fortschrittliches Internat), die am südwestlichen Rand des Anwesens lag und einen Teil der Fellowship beherbergen sollte, und diese beiden Köchinnen hatten ihre ganz eigene Meinung über den Meister, eine weit weniger ehrfürchtige Meinung als ich. Wie dem auch sei, als ich an jenem ersten Abend dastand und zusah, wie Wrieto-San sich mit gestrafften Schultern entfernte, sein Stock, während er flotten Schrittes davonging, in ständiger Bewegung – nach rechts und links hüpfend, durch die Luft wirbelnd wie ein Zauberstab –, hatte ich keine Zeit, mir Gedanken über meinen Status zu machen. Im nächsten Moment nämlich erschien wie aus dem Nichts ein junger Mann von geradezu absurder Größe und mächtiger Gestalt, schwang sich akrobatisch über das Mäuerchen und kam mit ausgestreckter Rechter auf mich zu. Er trug eine Latzhose, Arbeitsstiefel und ein sehr legeres Flanellhemd mit hochgekrempelten Ärmeln. »Hallo«, sagte er. »Sie müssen der Neue sein.«
Ich versuchte mich zu verbeugen, doch die Hand schoss auf meine zu, um den unvermeidlichen Handschlag zu vollziehen, dieses halb freundliche, halb aggressive und absolut unhygienische Begrüßungsritual, mittels dessen die Männer dieses Landes einander prüfen und beurteilen. Seine Hand umschloss meine – eine rauhe Hand, schwielig und von der Arbeit gehärtet –, und ich versuchte, ebenso fest zuzudrücken wie er, meine Botschaft über das Fleisch zu senden, so wie er die seine sandte. Seine Botschaft war, dass er keine Vorurteile hatte, obwohl er über zwanzig Zentimeter größer war als ich, gut fünfunddreißig Kilo schwerer und an einem Ort aufgewachsen, wo man einen Japaner ungefähr so häufig zu sehen bekam wie einen Eskimo oder einen Bantu, und meine Botschaft war, dass ich mich mit jedermann messen konnte und zu allem bereit war, was der Meister von mir verlangen mochte – inklusive Küchendienst.
»Wes Peters«, sagte er und drückte noch ein letztes Mal mit aller Macht zu (was ich mit auch nicht unerheblichem Druck erwiderte), ehe er meine Hand zur Beendigung der Zeremonie losließ. »Und Sie sind Sato, stimmt’s?«
Ich verbeugte mich zustimmend, doch diesmal nur leicht, eine Verbeugung für Gleichgestellte. »Nennen Sie mich Tadashi«, sagte ich.
»Gut«, sagte er. »Tadashi. Sehr erfreut. Und herzlich willkommen.«
»Sie sind einer der Schüler, nehme ich an?«
»Ja.« Jetzt grinste er. »Wir werden täglich mehr. Mr. Wright zufolge werden wir insgesamt dreißig sein. Eine ganze Truppe. Inklusive Frauen. Fünf. Aus Vassar.«
Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte – waren dreißig viel? Oder wenig? Wieviel Arbeit mochte es geben? Ich hatte mich Seite an Seite mit Wrieto-San an bedeutenden Entwürfen arbeiten sehen, an Grundrissen großartiger Gebäude wie des Unity Temple, des Fukuhara House oder des Larkin Administration Building, mein Zeichenstift unter der Regie des seinen. Und dann Frauen. Mit Frauen hatte ich nicht gerechnet, nicht in einem Architekturunternehmen. Verwirrt antwortete ich: »Gut. Das klingt gut.« Oder vielleicht sagte ich auch »Famos«.
Ich zeichnete schon seit meiner Kindheit, und während meine Mitschüler an der Yasinori Academy Doppeldecker oder Automobile skizzierten, schuf ich mir eine eigene Welt, fertigte perspektivische Ansichten erfundener Städte und bevölkerte diese mit voll ausgestalteten Figuren, die weitläufige Boulevards entlangschritten, unterwegs zu ihren Landhäusern, die ich in zahlreichen Skizzen, Grund- und Aufrissen für sie entwarf. (Grundrisse faszinierten mich besonders, weil ich sie so leicht zum höheren Wohl und unübertrefflichen Glück dieser unbekümmert dahinschreitenden Menschen, für die ich mir Namen, Berufe und Biographien ausdachte, manipulieren konnte – ich verschob hier eine Wand für das Billardzimmer, schuf dort ein Süßigkeitenzimmer oder ein Jungenzimmer mit dreistöckigem Etagenbett, Cowboyhüten und Bisonköpfen an der Wand und einer eigenen Rutsche auf die Straße.) Irgendwie hatte ich immer einen Stift in der Hand und kritzelte, skizzierte, schattierte oder malte etwas aus. Manchmal saß ich stundenlang träumend vor einem Blatt Papier, bis ich dort Dinge sah, die niemand anders sehen konnte, ließ mich von Zirkel, Winkelmesser und Lineal leiten, während mir unter dem Tisch vor lauter Aufregung die Knie zitterten und ich mit allen Fasern um Stimmigkeit rang. Es war zauberisch, eine Art Magie, ein elektrischer Strom, der vom Gehirn in die Hand in den Bleistift floss, bis das Blatt zum Leben erwachte.
»Aber wissen Sie was«, sagte Wes gerade, und sein Blick sprang von mir zum Bearcat und wieder zurück, »ich glaube, wir müssen heute auf den Teezirkel verzichten, denn wir brauchen Lebensmittel, ich meine, wir brauchen sie dringend, und ich dachte, wenn es Ihnen nichts ausmacht ... « Er sprach nicht zu Ende und sah mit vielsagendem Blick zum Bearcat hinüber.
Es dauerte einen Moment – ich bin manchmal ziemlich schwer von Begriff, besonders wenn ich abgespannt bin, immerhin war ich erst vor zehn Minuten aus dem Auto gestiegen, meine Koffer lagen noch auf der Rückbank, und ich wurde von neuen Eindrücken überrollt wie von einem Tsunami –, ehe ich ihn verstand. »Ach so«, sagte ich. »Ja. Natürlich.«
»Wenn es Ihnen nichts ausmacht«, wiederholte er in besänftigendem Ton, dem Ton eines Menschen, der bekommen hat, was er will, und schlenderte bereits mit seinen raumgreifenden Schritten auf den Wagen zu, während ich zu ihm aufschloss. »Es sind nur sechs Kilometer.«
»Nein, natürlich nicht«, sagte ich, öffnete die Fahrertür und spähte zugleich den teuflischen Hang hinab zu der gewundenen Straße und der Schweinefarm in der Ferne, während er sich auf den Beifahrersitz zwängte. »Es macht mir gar nichts aus. Überhaupt nichts.«
Die Frau im Lebensmittelladen schaute mich – schaute uns – mit dem gleichen Blick an, mit dem mich schon die Farmerin bedacht hatte: zusammengepresste Lippen, glühende Augen, nicht ein Hauch von Sympathie oder auch nur ganz normaler Freundlichkeit. Wes verlangte Ketchup, Kaffee, Tee, Zucker, riesige Säcke getrocknete Bohnen und Reis und all die anderen Grundnahrungsmittel, die der Gemüsegarten und die Farm von Taliesin nicht bieten konnten. (An diesen Blick sollte ich mich in den kommenden Monaten übrigens gewöhnen. Er hatte natürlich mit meiner Rassenzugehörigkeit zu tun, doch Wes und Herbert Mohl, ja eigentlich alle, die in irgendeiner Weise mit Taliesin verbunden waren, zogen ihn ebenfalls auf sich, und er erklärte sich vor allem aus Wrieto-Sans Gewohnheit, anschreiben zu lassen, und dem tiefsitzenden Unmut über seine früheren Techtelmechtel und Affären, über das in den Augen der zutiefst konservativen einheimischen Bevölkerung ganz und gar unmoralische Verhalten, das er damals an den Tag gelegt hatte. In aller Öffentlichkeit. Hier im Herzland Amerikas. Obwohl er doch Sohn und Neffe von Predigern war.) Nachdem Wes unterschrieben hatte – die Frau war wütend, erhitzt, die Sehnen an ihrem Hals waren hervorgetreten, und ihr Blick hätte uns die Haut von den Knochen sengen können –, stiegen wir schwerbeladen in den Bearcat und fuhren zurück nach Taliesin.
Und dann stand ich in der Küche und schälte Zwiebeln.
Die Küchenchefin (Miss Emma Larson, fünfundvierzig Jahre alt, mollig und energisch, mit einem angegrauten, schwungvoll nach vorn gekämmten Bubikopf, der vielleicht zehn Jahre zuvor an der Schaufensterpuppe eines Kaufhauses modisch gewirkt haben mochte) beugte sich über einen geschwärzten Kessel, der heftig klappernd auf dem Holzofen stand, während ihre Schwester Mabel mit dem Schneebesen Eier schlug und Pökelfleisch – es müssen mehrere Pfund gewesen sein – von der Bratpfanne auf eine Platte hob. Nach den Zwiebeln schälte ich Kartoffeln, und nach den Kartoffeln schälte ich Karotten. Danach wusch ich Geschirr ab, stapelweise, bergeweise, und das wochenlang. Was ich aus dieser Erfahrung lernte? Dass Wrieto-San (beziehungsweise Mr. Wright, wie ihn alle, selbst die mit ihm verfeindeten Farmersfrauen und Lebensmittelhändler, ausnahmslos nannten) gern Hausmannskost aß. Er mochte Weißfisch, Kalbsleber aux oignons, Gemüseeintopf, die guten alten Bratkartoffeln und frisch gepflückte Beeren – in der Sahne schwimmend, die ihm als Junge versagt geblieben war. Und ich lernte, dass Taliesin ein echtes demokratisches Gemeinschaftsprojekt war, abgesehen von diesem Gott in seiner Maschine, der dem Ganzen auf seine spontane und unverhohlen despotische Art vorstand. Zudem sah ich, dass ein praktizierender Architekt dem General einer Armee gleicht, dem General der Generale, und dass auf dem Weg vom unausgereiften Entwurf zu dessen konkreter Umsetzung eine Reihe von Annehmlichkeiten, Umgangsformen und Sitten aufgegeben werden mussten.
Kurzum, er bestimmte unser Leben. Daddy Frank. Wie oft hatte ich den einen oder anderen Schüler ihn hinter seinem Rücken so nennen hören? Daddy Frank, der Paterfamilias von Taliesin. Er hielt alles in Bewegung, mischte sich in unsere Privatangelegenheiten ein, in unsere Liebschaften, Streits und freundschaftlichen Beziehungen, und er unterdrückte jegliche Initiative und Individualität unsererseits ebenso vehement, wie er die seine behauptet hatte, als er Jahrzehnte zuvor Louis Sullivans Schüler gewesen war. Wirklich, dass er sich zwischen Daisy Hartnett und mich gestellt hat – und auch, dass er meinem Vater ein Darlehen abschwatzte (das er natürlich nie zurückzahlte) –, das werde ich ihm, glaube ich, nie verzeihen.
Aber ich will mich nicht beklagen – das ist nicht der Zweck dieser Übung. Ganz gewiss nicht. Und ich gehörte auch nicht jener Gruppe von Kaspern und Klugschwätzern an, die sich aufführten, als wäre die Fellowship eine Art ausgedehntes Ferienlager und Wrieto-San eine archaische Gestalt aus der fernen Vergangenheit, »der größte noch lebende Architekt des neunzehnten Jahrhunderts«, wie einer dieser Witzbolde einmal sagte. Ich blieb neun Jahre in Taliesin, länger als jeder andere Schüler, abgesehen von Herbert Mohl und von Wes, der schließlich Wrieto-Sans Stieftochter Svetlana heiratete, und diese Jahre entpuppten sich als die prägende Phase eines langen, vom Glück begünstigten und erfolgreichen Lebens. Neun Jahre. Neun Jahre lang war ich in enger Verbindung mit wahrer Größe, mit dem Mann, der sich hinsetzen und den Entwurf für das womöglich bedeutendste Wohnhaus des Jahrhunderts in einem Zug zu Papier bringen konnte, als hätte er ihn von Geburt an im Kopf gehabt – ich denke hier an Fallingwater –, während der erzürnte Auftraggeber aus Milkwaukee zu ihm unterwegs und jeden Moment damit zu rechnen war, dass er in die Einfahrt einbiegen würde. Ich habe das persönlich miterlebt. Ich reichte ihm Papier, spitzte seine Bleistifte, hing mit einem halben Dutzend anderer über seiner Schulter, in einer Ehrfurcht, die an Vergötterung grenzte.
Ich will meine eigene Bedeutung nicht hochspielen – ich war eine Zeitlang ein Rädchen in seinem Getriebe, ein Rädchen von vielen und nicht mehr. Doch ich kannte ihn, und ich kannte jene, die ihn schon gekannt hatten, als ich noch ein kleiner Junge in kurzen Hosen gewesen war, einen Kontinent und einen Ozean entfernt, während Taliesin sich aus dem Nebel erhob – Männer wie Old Dad Signola, den Steinmetz, der in den Pfeilern aus gelbem Dolomitkalkstein verewigt sein wird, solange das Haus steht, und Billy Weston, den Zimmermeister, der seine halbe Welt im Dienste der Vision von dieser Welt verlor. Ich kannte Mrs. Wright – Olgivanna, Wrieto-Sans dritte und letzte Frau – und seine Töchter, Svetlana und Iovanna, ich kannte die Schüler und Kunden und Wrieto-Sans Söhne und Töchter aus erster Ehe. Aber kannte ich ihn?
Natürlich wird es Beanstandungen geben – das ist nicht anders zu erwarten. Dieses Verfahren ist alles andere als vollkommen, bedenkt man die Jahre, die seitdem verstrichen sind, die Kapricen der Erinnerung, die Tatsache, dass hier Szenen geschildert werden, deren Korrektheit heute niemand mehr bestätigen oder anfechten kann. Zudem muss ich mich auf meinen Koautor und Übersetzer verlassen (den jungen Seamus O’Flaherty, einen irischstämmigen Amerikaner, der mit meiner Enkelin Noriko verheiratet ist und dessen bisher unveröffentlichte Übersetzungen von Fukazawa und Shimizu, wie ich höre, ziemlich neuartig sind), und seine Ausdrucksweise, das muss ich zugeben, erscheint mir doch oft recht eigenartig. Dennoch bleibt die Frage bestehen: Kannte ich den Mann, den wir Japaner als Wrieto-San verehren? Wer war er tatsächlich? Der Held, der, wie er in seiner Autobiographie behauptet, nach fünfjähriger Arbeit am Hotel Imperial (und einer Budgetüberschreitung, die Baron Ōkuras Geldgeber fast in den Ruin getrieben hätte) unter Hochrufen – »Banzai, Wrieto-San! Banzai!« – im Triumph durch Tokios Straßen geführt wurde? Oder der verschwenderische Filou, der in Ungnade, wenn nicht Schande, von der Baustelle, von der Arbeit, aus dem Land vertrieben werden musste? War er das gekränkte Genie oder der Schürzenjäger und Soziopath, der das Vertrauen von praktisch jedem, den er kannte, missbrauchte, besonders das der Frauen, ja, besonders das ihre?
Tadashi Sato
Nagoya, 9. April 1979
Kapitel 1 FÜR DIE TOTEN TANZEN
An dem Tag im Herbst 1924, als er bei einer Ballettvorstellung in Chicago Olga Lazovich Milanoff Hinzenberg kennenlernte, war Frank Lloyd Wright* optimistisch gestimmt, geradezu vergnügt. Mag sein, dass es an jenem Tag regnete – doch, es regnete, das graue Gestrichel verwandelte die nähere Umgebung in ein pointillistisches Gemälde, gebeugte Gestalten stapften unter dem Schutz ihrer Regenschirme die Straße entlang, Graupelschauer waren angekündigt, gefolgt von Schnee –, doch seine Stimmung war durch nichts zu trüben. Er hatte sich immer als ein heiteres Gemüt betrachtet, sonnig und übersprudelnd, als einen jener seltenen Menschen, die die Stimmung eines ganzen Raums verändern können, indem sie einfach nur zur Tür hereintreten, doch die Gefühlswirren der letzten zwei Jahre – jedenfalls seit seiner Rückkehr aus Japan – hatten ihn zermürbt. Das Problem, oder vielmehr dessen Gipfel und Krönung, war natürlich Miriam. Hinzu kamen Geldnöte. Zu wenige Aufträge, hasenherzige Kunden und die tief verwurzelte Ignoranz (und Feigheit, auch Feigheit) seiner Landsleute angesichts der Fauvisten, Futuristen, Dadaisten, Kubisten und all der anderen -isten und -ismen, Duchamp, Braque und Picasso sowie, noch schlimmer, des soi-disant Internationalen Stils von Le Corbusier, Gropius, Meyer, Mies – all dieser neuen Bewegungen, durch die er sich veraltet und bedrängt fühlte. Das alles machte die Sache nicht besser. Während er im Fernen Osten gewesen war, waren die Europäer in Amerika eingefallen.
* Im Original Wrieto-San.
Doch es ging bergauf. Miriam war fort, seit Mai, mochte er auch, jedesmal wenn er über einer Zeichnung oder einem Buch die Augen schloss, ihr Gesicht sehen, das tragische, das sie wie eine Maske trug:
Es erschien vor seinem inneren Auge, um sich schließlich in einem Wirbel dunkelvioletter Flecken aufzulösen. Trotzdem, sie war fort, und in Taliesin herrschte wieder Frieden. Zur Zeit wohnten drei junge Paare dort – die Neutras, die Tsuchiuras und die Mosers –, und es gab Musikabende, Kameradschaft, die Beschaulichkeit vorm Kamin. Und nun war er geschäftlich wieder hier in Chicago, stampfte sich im Theaterfoyer den Regen von Hut und Mantel, reif für ein bisschen Unterhaltung.
Ein Freund* hatte ihn gefragt, ob er Lust habe, am Nachmittag die Vorstellung der Karsavina zu besuchen, die Auszüge aus »Dornröschen«, »Die schlecht behütete Tochter« und »Les Sylphides« darbot, und er hatte die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, mochte die Primaballerina ihre besten Zeiten auch längst hinter sich haben und ihre überirdische Schönheit nur noch ein Schatten dessen sein, was sie einst gewesen war. Er wollte gesehen werden, und sei es nur, um ein paar Fusseln von der mottenzerfressenen Decke der Gerüchte und blanken Lügen abzuschütteln, die die Klatschmäuler über ihm ausgebreitet hatten – er würde am Ersten des Jahres hier wieder ein Büro eröffnen und musste Präsenz zeigen. Na schön. Draußen regnete es, die Tür öffnete und schloss sich, ließ einen Hauch des sich ankündigenden Winters herein, im Foyer herrschte Gedränge: Männer in modischer Aufmachung oder in dem Anzug, den sie in der Kirche getragen hatten, in Perlen und Pelze gehüllte Frauen, deren Stimmen zwitschernd und tirilierend aufstiegen wie der Gesang der Vögel im Aviarium des Lincoln Park Zoo. Ging man ihm aus dem Weg? War das nicht –?
* Nicht identifiziert; vielleicht einer seiner Bekannten aus früheren, glücklicheren Tagen in der Chicagoer Gesellschaft.
Doch. Olivia Westphal, die er einst in seinem ersten Wagen um den Oak Park herum spazierengefahren hatte (das spezialgefertigte Stoddard-Dayton Sportkabrio, das auf der Geraden 90 Stundenkilometer schaffte, ein Auto, von dem er noch heute in den Momenten kurz vor dem Aufwachen träumte, der »Gelbe Teufel«, vor dem sich die Leute auf den Gehweg retteten und der ihm den ersten Strafzettel wegen Geschwindigkeitsüberschreitung eingebracht hatte, der jemals auf diesen verschlafenen, von Pferdefuhrwerken befahrenen Straßen ausgestellt worden war, weil er auf einen Bauauftrag von ihr und ihrem neuen Ehemann hoffte (und schon damals war sie ihm in den Rücken gefallen, denn sie entschied sich, Patton und Fisher einen völlig überladenen Kasten für sie bauen zu lassen, so fade wie eine Portion Kellogg’s Cornflakes, die man über Nacht hat stehenlassen. Auf der Küchentheke. In einer Lache sauer gewordener Milch). Und was hatten die Jahre aus ihr gemacht – sie war jetzt eine richtige Matrone, hatte an Gesicht und Oberarmen Fett angesetzt, und ihre massige, gedrungene Figur ließ ihre einst so reizvollen Kurven kaum mehr ahnen. Sie schaute ihm direkt in die Augen – erkannte ihn, das sah er – und schaute wieder weg.
Wie er sich daraufhin fühlte? Kämpferisch. Wütend. Angewidert. Sollten sie ihn doch ignorieren, diese Tugendwächterinnen und die schüchternen kleinen Nager, mit denen sie verheiratet waren, zu ängstlich, um je aus dem Glied zu treten, zu leben, die große Geste zu wagen, irgendeine Geste ... doch jetzt hatte ihn sein Begleiter* am Arm gefasst und führte ihn zu einer Gruppe Männer mitten im Geschehen – war das Robert? Oscar? –, und er spürte, wie ihm die Brust schwoll, bis er kurz davor war, seinen Stock Pirouetten drehen zu lassen. Was er nicht bemerkte – und sein Begleiter ebensowenig –, war die große, dunkelhaarige junge Frau mit dem ernsten Gesicht, die zur Tür hereinschlüpfte, in der einen behandschuhten Hand die Eintrittskarte, in der anderen ihre Abendtasche. Sie hingegen bemerkte ihn, als sie von einer Ecke des Foyers aus den Blick über die Menge schweifen ließ – durchaus gewillt, gesehen zu werden, doch zugleich auf Anonymität bedacht, ohne Begleitung auf einer Matinee, von ihrem Mann getrennt und ungebunden, eine Anhängerin des Tanzes und dessen, was die Karsavina einst verkörpert hatte, eine alleinstehende Frau, die an einem regnerischen Nachmittag ausging. Olgivanna sah dieselben Hüte, Schultern, Pelze und geschwätzigen Münder, die auch er gesehen hatte, ein Kotillon, eine Hackordnung, die Gesellschaft in all ihren Facetten, und dann war plötzlich er da, und ihre Augen hefteten sich auf ihn.
* Nennen wir ihn der Einfachheit halber Albert Bleutick – ein Mann von mittlerer Größe, mittlerer Haarfarbe, mittlerem Bauchumfang und einer weder dominanten noch introvertierten Persönlichkeit, ein Begleiter aus dem zweiten Glied, der verlässlich die Rechnung für das Mittagessen übernahm und Karten für Ballett, Sinfonieorchester und Museum besorgte. Sein Schicksal war das aller Nebenfiguren im Leben eines bedeutenden Menschen: eine Funktion zu erfüllen und dann abzutreten, so farblos wie der Regen, der auf die tristen grauen Straßen fiel, an einem Tag, der sich ebensogut hätte selbst wegspülen können.
Das erste, was sie spürte, war die prickelnde Erregung, die sich einstellt, wenn man in der Öffentlichkeit ein berühmtes Gesicht entdeckt, ein Erbeben des ganzes Nervensystems, begleitet von einer gewissen Genugtuung, als hätte sie infolge eines Geistesblitzes die Lösung eines Rätsels gefunden. Sodann überkam sie das Gefühl, unbedingt mit ihm reden zu müssen – ein so unwiderstehlicher Drang, dass sie fast durch die Menge zu ihm gestürmt wäre, obwohl sie hier doch eine Fremde war, ohne Begleitung und niemandem vorgestellt, doch sie unterdrückte den Impuls aus Scheu und einem Schwindelgefühl, das an Panik grenzte: Was sollte sie zu ihm sagen? Wie sollte sie das Eis brechen? Ihn auch nur dazu bringen, sie anzusehen? Und schließlich meldete sich, stärker als die beiden anderen Wahrnehmungen, der in hormonelle Aufwallung gewandete Gedanke, dass er sie auf einer sehr tiefgehenden, unergründlichen Ebene erkennen würde, als wäre es ihnen vorbestimmt, als wären sie wiedergeborene Liebende aus dem Mahabharata oder einem Roman von Rice Burroughs – ja mehr noch: dass er sie in Besitz nehmen, sie bändigen würde in einer wilden Mischung aus Macht und Unterwerfung.*
*Ich lernte sie in Taliesin als eine missmutige, dünne, humorlose Frau kennen, die in jenem ersten Jahr schwindsüchtig war und immer beschäftigt, beschäftigt mit all den anfallenden Hausarbeiten, sie scheuerte, hängte Wäsche auf, hackte die Beete, spaltete Holz für den Herd, den Ofen und die siebzehn Kaminfeuer, die wir in diesem höhlenartigen Gebäude ständig unterhielten und die doch nur eine kümmerliche Wärme ausstrahlten. Doch auch sie war einmal ein junges Mädchen und verliebt. Das sei ihr zugestanden.
Frank** bemerkte nichts. Er stand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, renommierte und paradierte vor der kleinen Gruppe, die sich um ihn versammelt hatte, vor alten Freunden und frisch gewonnenen Bekannten, scherzte, lachte, gab eine Geschichte nach der anderen zum besten und machte seine trockenen Bemerkungen über dieses oder jenes Paar – sollten sie doch gaffen, nur zu, nur zu –, doch da ertönte das Läuten, Albert nahm ihn beim Arm, und sie begaben sich zu einer der vorderen Reihen. Zufällig schob sich Albert als erster hinein und setzte sich auf den mittleren von drei leeren Plätzen, Frank ließ sich zu seiner Rechten nieder. Die Lichter verlöschten. Im Orchestergraben stand der Dirigent auf, die Arme über das Notenpult erhoben. Und dann glitt im letzten Moment Olgivanna anmutig durch den Mittelgang, ein beweglicher Schatten vor dem Hintergrund der Bühne. Der Platzanweiser trat zur Seite, der Vorhang hob sich, das Publikum regte sich, da war ihr Platz, ihr blieb kaum Zeit, die unauffällige Gestalt neben sich wahrzunehmen, als auch schon die Musik begann und die Tänzerinnen erschienen, und mit einemmal bemerkte sie, dass er hier war, hier, nur zwei Sitze weiter.
** Im Original, auch ff., Wrieto-San.
Frank für sein Teil hatte aufgeschaut, als sie sich auf ihren Platz gesetzt hatte – ein Reflex des menschlichen Organismus: wenn sich irgendwo etwas bewegt, wandern die Augen unwillkürlich hin –, so wie er zu jedem aufgeschaut hätte, zu einer dieser Kühe aus dem Foyer oder dem Wichtigtuer, der sie begleitete, ja selbst zu einem seiner eingeschworenen Feinde. Ein kurzer Blick, mehr nicht, doch was er sah, gefiel ihm. Kein Hut, kaum Make-up, das in der Mitte gescheitelte Haar zum Chignon geschlungen, die Schultern von einem Spitzenschal umfangen. Das fiel ihm auf – die Schlichtheit des Kleids und des Stils, eine Art Reinheit, ein Vertrauen in die eigene Schönheit, das all die aufgeblasenen, gepuderten und huttragenden Matronen beschämte, und schließlich ihre Art, sich zu bewegen, eine große junge Frau in ihren Zwanzigern, die ihren Sitzplatz im Ballett mit einer ganz eigenen tänzerischen Anmut einnahm. Er warf noch einen verstohlenen Blick auf sie. Und noch einen.
Auf der Bühne entstand Bewegung, Beifall brauste auf, als die Karsavina erschien – ihre Beine waren immer noch in Ordnung, ihr Gesicht nicht mehr ganz so –, und erstarb dann wieder. Frank nahm stummes Bemühen wahr, Männer und Frauen, die herumwirbelten und -wankten wie Kegel, die nicht umfallen wollten, und er erkannte sofort, dass dies eine mittelmäßige Vorstellung einer im Niedergang begriffenen Künstlerin werden würde. Langweilig. Ein vergeudeter Nachmittag. Er beugte sich vor, um an Albert vorbeizuschauen. Die junge Frau – eigentlich noch ein Mädchen – saß still da, die Hände im Schoß gefaltet, den Blick auf die Bühne geheftet. Sie gab ein tadelloses Bild ab, von der Haltung ihrer Schultern über die Rundung ihrer Brüste bis zu den klaren Konturen von Kiefer und Wangenknochen im Profil, dem schönen muschelförmigen Ohr und dem hellen Diamanten, der an ihrem Ohrläppchen glitzerte – minimalistisch, ihr ganzes Äußeres war eine einzige minimalistische Komposition. Aber sie war keine Amerikanerin, da hätte er gewettet.
Zehn Minuten nach Vorstellungsbeginn – vielleicht auch später, vielleicht waren es zwanzig – wurde er unruhig. Er wäre am liebsten aufgestanden und gegangen – was dort auf der Bühne stattfand, war reine Routine, müde, leblos, und niemand im Publikum merkte es –, doch noch stärker war sein Impuls, zu bleiben und irgendwie die Aufmerksamkeit dieses Mädchens zu gewinnen, denn er kannte sie, er kannte sie allein durchs Betrachten, und er wollte mehr, viel mehr, er wollte Kontakt, Anerkennung, einen Blick, ein Lächeln. »Die sind vollkommen leblos«, murmelte er, zu Albert gebeugt, und das verblüffte Gesicht seines Freundes schien im Lichtschein der Bühne zu schweben wie eine Kürbislaterne an einem Draht. »Wie tot«, sagte er, gerade so laut, dass sie es hören konnte – und sie hörte es auch, das merkte er an ihrer Reaktion, wenngleich sie den Blick nicht von der Bühne wandte –, »Tote, die für Tote tanzen.«
In der Pause – sobald der Applaus erstorben war und noch ehe sie aufstehen und allein davonspazieren konnte – beugte er sich an Albert vorbei zu ihr hinüber und sagte: »Ich habe Ihre Reaktion gesehen – Sie stimmen mir zu, oder? Dass die Karsavina bei der Inspiration, die sie heute an den Tag legt, ebensogut in London hätte bleiben können? Vermutlich sogar lieber in London wäre. Um zu stricken. Oder was immer sie dort tut.«
Sie wandte sich ihm zu und sah ihm in die Augen. Er konnte nicht wissen, was er da sagte, konnte nicht wissen, dass in seinem Kommentar während der Aufführung eines der Dikta Gurdjieffs* angeklungen war, ihres Meisters, der stets danach getrachtet hatte, die Menschheit aus der Leblosigkeit der physischen Welt wachzurütteln und zum Bewusstsein der jenseits davon liegenden mystischen Wahrheiten zu führen, oder dass sie eine von Gurdjieffs führenden Danseuses