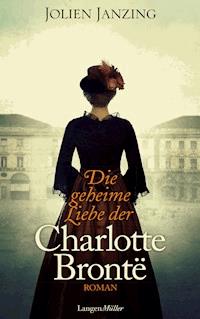
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Charlotte sehnt sich nach Abenteuern und leidenschaftlicher Liebe. Weil es beides in Yorkshire nicht gibt, geht sie mit ihrer Schwester Emily nach Brüssel, um endlich mehr von Europa zu sehen. Dort erleben sie eine Achterbahn der Gefühle und tauchen ein in eine neue Welt: Die Stadt bietet französisches Flair, monumentale Bauten und zahlreiche neue Eindrücke. Im "Pensionnat Heger" verbessern die beiden Schwestern ihre Französischkenntnisse, doch Charlottes Aufmerksamkeit gilt vor allem dem charismatischen Monsieur Heger, in den sie sich hoffnungslos verliebt. Zeitgleich umwirbt sie auch der gut aussehende flämische Arbeiter Emile. Plötzlich hat sie die Wahl: eine Affäre mit einem verheirateten Mann oder eine ehrenhafte Ehe? Am Ende ist ihr Herz gebrochen und sie verarbeitet ihren Schmerz in einem Roman, den sie Jane Eyre nennt und der noch 200 Jahre später auf der ganzen Welt gelesen und geliebt wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Die Originalausgabe »De Meester« erschien 2013 bei De Arbeiderspers.
Diese Übersetzung wurde von Flemish Literature Fund gefördert.
Wir bedanken uns herzlich.
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.langen-mueller-verlag.de
© für die Originalausgabe und das eBook: 2016 LangenMüller in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel
Umschlagmotiv: Trevillion Images
Karte von Brüssel: David Rumsey Map Collection, www.davidrumsey.com
Satz und eBook-Produktion: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
ISBN 978-3-7844-8241-5
Für Paul
Für Serge und Alessandra
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen ihren Irrtümern geben.
Oscar Wilde
PERSONEN
CHARLOTTE BRONTË: Tochter eines englischen Predigers, Schülerin, Gouvernante und begabte angehende Schriftstellerin
EMILY BRONTË: Charlottes Schwester, Schülerin, Genie, Dichterin und angehende Schriftstellerin
Haworth, England
PATRICK BRONTË: englischer Prediger, Witwer von Maria Branwell und Vater von Charlotte, Branwell, Emily und Anne
BRANWELL BRONTË: Charlottes Bruder, Sorgenkind und einziger Sohn Patrick Brontës
ANNE BRONTË: Charlottes Schwester und jüngste Tochter von Patrick Brontë
TANTE ELIZABETH: Schwester der verstorbenen Maria Branwell, Schwägerin von Patrick Brontë
TABBY: das betagte Dienstmädchen des Pfarrhauses
MARTHA: das junge Dienstmädchen
Brüssel, Belgien
MONSIEUR CONSTANTIN HEGER: Lehrer für französische Literatur am Athénée Royal und dem Pensionnat Heger
MADAME CLAIRE HEGER: Direktorin des Pensionnats Heger und Ehefrau Constantin Hegers
MARIE, LOUISE, CLAIRE, PROSPÈRE UND JULIE MARIE HEGER: ihre Kinder
LOUISE DE BASSOMPIERRE: Schülerin, eng befreundet mit Emily Brontë
ARCADIE CLARET: äußerst attraktive Tochter des Majors Charles Claret
CHARLES CLARET: Major der Belgischen Armee und Schatzmeister des Kriegsministeriums von der Witwen- und Waisen-Kasse der Belgischen Armee
HENRIETTE CLARET: Mutter von Arcadie, Ehefrau von Major Charles Claret
JOS: Kutscher der Familie Claret
Schloss Koekelberg
MARY TAYLOR: englische Schülerin und teure Freundin von Charlotte Brontë
MARTHA TAYLOR: Marys jüngere Schwester
Vieux Marché
EMILE: Arbeiter, der den Französischunterricht bei Constantin Heger besucht
Königspalast
LEOPOLD I.: ab 1831 erster König Belgiens, Witwer der Prinzessin Charlotta Augusta von Wales und Ehemann von Louise-Marie von Belgien
LOUISE-MARIE: Tochter des französischen Königs Louis Philippe und der Königin Marie Amélie von Bourbon und Neapel-Sizilien, erste Königin Belgiens und Ehefrau Leopolds I.
JULES VAN PRAET: persönlicher Sekretär Leopolds I., des ersten Königs der Belgier
I
Die Glocken von Saint-Michael und Sainte-Gudula schlagen zwölf Uhr, man schreibt das zweiundvierzigste Jahr des neunzehnten Jahrhunderts. Eine Zeit, in der die Taftröcke der Damen rauschen, wenn sie die Treppe im Theater hinunterschreiten, in der die Straßen mit Gaslaternen beleuchtet werden, der Samen verheirateter Männer nicht auf den Boden fallen darf und arme Mädchen ihre langen Zöpfe verkaufen. Sie werden Zeuge einer Liebesgeschichte werden, einer verbotenen Romanze. Zu Bündeln geschnürte Briefe mit gelblichen Schleifen zeugen von dieser geheimen Liebe, dieser Leidenschaft, die nicht sein durfte, aber nicht einfach auszulöschen war. Die Geschichte spielt sich in einem derart kleinen und absurden Königreich ab, dass man es für ein reines Produkt der Fantasie halten könnte: Belgien. Der Name scheint wie aus einem Märchen entnommen, aber schon Caesar sprach über die »Belgae« und schrieb, dass sie die tapfersten aller Gallier seien. Dieses kleine Land, eine Laus im Pelz Europas, ist jedoch besonders fruchtbar, mit fetten Weiden und fetten Kühen und Gänsen so dick und wohlgenährt, dass man sie kaum heben kann. Während die meisten Bauern und Arbeiter kaum genug zu essen haben, um wirklich Fleisch auf ihre Knochen zu bringen, sind die Herren dick und stramm, und die Damen haben üppige Hüften und Brüste und rosige, runde Gesichter. Diese guten Menschen von Belgien verstehen sich untereinander nicht immer unbedingt, denn der König spricht gerne mal Deutsch, die Aristokratie und das Bürgertum spricht Französisch, das Volk im Süden des Landes plappert ein Patois des Französischen, und im Norden spricht man Flämisch – was wiederum eine saftige Variante des Niederländischen ist. So viel babylonisches Geschnatter bringt freilich Verwirrung und Uneinigkeit mit sich. Wenn Sie ein Exemplar der unterdrückten Klasse der flämischen Arbeiter treffen, achten Sie auf die starken, aber trotzig hochgezogenen Schultern. Der Kopf ist leicht nach vorne gereckt, in einer Haltung beständig argwöhnischen Lauschens, die Augenbrauen zu einem Blick voll stillen Aufruhrs gerunzelt. Belgien, das Land, in dem die Zwietracht regiert. Und obwohl es ein lächerlich kleines Land ist, hat es eine Hauptstadt, die schrecklich schnell wächst: Brüssel! Eine Stadt mit einem Herz aus weiten Plätzen und breiten Straßen, die sich lotrecht schneiden, von Palästen und vornehmen Häusern und einem herrlichen Park mit schattigen Alleen – ein würdiger Wohnort für die Reichen und das Bürgertum. Von den Rändern dieses Herzens schlängeln sich die Straßen des gemeinen Volkes nach außen, und hie und da stößt man auf die immer zahlreicher werdenden feuchten Mietskasernen der Plebs, wie Druckstellen an einer überreifen Frucht. Und durch die Wasserstraßen der Stadt, zwischen den Häusern sowohl der Adeligen als auch der Armen, fließt ein schmales Flüsschen, das modrig grün ist und abscheulich stinkt.
Aber bevor Sie mit der Heldin dieser Geschichte ins wuchernde Brüssel reisen – mit dem Dampfschiff über die Nordsee und mit der Postkutsche durchs flache Flandern –, gestatte ich Ihnen einen Blick auf ihre Zukunft an genanntem Ort.
Schauen Sie, wie die junge Lehrerin durch die Straßen von Brüssel streift. Der Tag war anstrengend heiß, und die Dunkelheit lässt noch auf sich warten. Sie will noch nicht ins Pensionat zurückgehen. Dröhnendes Glockengeläut reißt sie aus ihren Gedanken. Es ist die hypnotische Stimme der Kirche Saint-Micheal und Sainte-Gudula, die die Gläubigen zur Vesper ruft. Sie weiß nicht, was sie überkommt, aber sie läuft rasch in Richtung Kirche, durch die Rue de la Chancellerie und die lange Kalksteintreppe hinauf. Neben dem Portal steht ein Bettler und streckt die Hand aus, und sie gibt ihm eine Münze, nicht für sein Seelenheil, sondern für ihres.
Wie kühl es in der Kirche ist! Frauen mit Rosenkränzen zwischen den Fingerspitzen sitzen vereinzelt auf den Bänken. Sie würde sich am liebsten auf die Fliesen legen, aber sie setzt sich ans äußerste Ende einer Bank und wartet, bis das Abendgebet zu Ende ist. In einer verlassenen Ecke der Kirche wird die Beichte abgenommen. Die Beichte! Sie ist eine Sünderin und muss ihre Geschichte erzählen. Jemand muss sie anhören. Eine einfache Frau aus dem Volk nähert sich dem Beichtstuhl, sie ordnet sich das fettige Haar, indem sie es sich glatt an den Schädel streicht, und zupft ihre Schürze zurecht. Kann der Priester sie denn sehen? Ist die Beichte nicht anonym?
Sie kann es sich noch überlegen: Sie kann wieder auf die Straßen zurückgehen, auf denen sie niemand kennt. Doch sie bleibt lieber sitzen und wartet. Die Frau kommt mit der Andeutung eines Lächelns auf den Lippen wieder aus dem Beichtstuhl.
Sie steht auf, weiß kaum, was sie da tut. Diese Tradition ist ihr fremd – wie muss sie den Priester überhaupt ansprechen? Sie schlüpft in den Beichtstuhl, lässt den rotsamtenen Vorhang hinter sich herabfallen und wird beinahe überwältigt vom Geruch nach Weihrauch, Pfeifentabak und altem Schweiß. Es dringt gerade genug Licht ins Innere des Beichtstuhls, um vage das Gesicht hinter dem geflochtenen Gitter wahrnehmen zu können.
»Mon père«, sagt sie, und das Blut steigt ihr ins Gesicht. »Ich habe gesündigt.«
»Sind Sie Ausländerin?«, fragt der Priester streng, offenbar überrascht von ihrem Akzent.
Sie bejaht, und sie fügt hinzu, dass sie protestantisch erzogen ist. Er will wissen, ob sie immer noch Protestantin ist, und sie nickt, was er anscheinend nicht sieht, deswegen räuspert sie sich und flüstert: »Oui, mon père.« Als er erklärt, dass sie dann auch nicht beichten kann, steigen ihr die Tränen in die Augen. Wenn er sie jetzt fortschickt, ohne sie ihre Geschichte erzählen zu lassen, wird sie wahnsinnig. Das sagt sie ihm und fleht ihn an, sie anzuhören.
»Ma fille«, sagt der Priester sanft, und sie erstickt fast an ihren Tränen. »Beichten Sie und lassen Sie dies Ihren ersten Schritt in die wahre Kirche sein.«
Sie erzählt ihm alles, sie überschlägt sich fast dabei. Vom sicheren, aber doch einengenden Leben im Haus ihres Vaters, und wie sie ihm entkommen ist. Wie sie in Brüssel ihre Freiheit genießen wollte, sich jedoch in ein Pensionat einschließen ließ. Das Gesicht des Priesters kommt näher an das Gitter, sie fühlt seinen Atem auf ihrer Wange.
»Erzählen Sie mir, was Ihre Sünde ist.«
Und sie erzählt es ihm. Sie erzählt ihm alles.
DIE REISE
II
Lassen Sie Ihren Blick über England gleiten, bis Sie bei den windigen, baumlosen Hügeln von West Yorkshire sind. Dort, in der überbevölkerten Industriestadt Haworth, oben an der steilen, zugigen Hauptstraße und hinter der Kirche mit ihrem Schachbrett aus moosbewachsenen Grabsteinen, steht das Pfarrhaus, in dem eine junge Frau – fünfundzwanzig Lenze zählt sie – im Garten ihre weißen Unterröcke von der Wäscheleine abnimmt. Sie heißt Charlotte Brontë und ahnt noch nichts von dem Ruhm, der ihr einst zuteilwerden wird – oder von der Leidenschaft, die sie im fernen, zügellosen Brüssel erwartet.
Charlotte ist beschäftigt mit ihrer Wäsche, was uns Gelegenheit gibt, sie in aller Ruhe zu betrachten. Sie ist nicht schön, das wollen wir gleich vorwegnehmen: Sie ist nicht bildschön, reich und verwöhnt wie Blanche Ingram oder verführerisch wie Ginevra Fanshawe – Figuren aus ihren späteren Romanen. Kein wallendes goldenes Haar fällt ihr auf die Schultern, kein Rosenmund wartet darauf, geküsst zu werden. Aber wird die Bedeutung körperlicher Schönheit nicht schrecklich übertrieben? Setzen Sie sich zu mir ans Fenster des White Lion oder des Black Bull, zwei beliebten Pubs in Haworth, oder von mir aus in irgendein beliebiges Café in einer Metropole wie Paris, und schauen Sie sich mit mir die vorüberlaufenden Menschen an. Wie viele Schönheiten sind darunter? Wie viele Frauen mit ganz symmetrischen Zügen und einer Nase ohne die geringste Krümmung, wie viele klassische Athleten mit gesundem Haar und makelloser Haut? Stundenlang könnten wir dort sitzen, ohne einen einzigen zu sehen – und dann, ganz plötzlich, eine Perle. Die Schönheiten sind selten, und es wäre lächerlich, sich mit der Frage des schönen Aussehens zu quälen, wenn sie den meisten Menschen ja doch nicht gegeben ist.
Es mag also sein, dass sie nicht besonders schön ist, das Fräulein Brontë, aber sie ist ganz bestimmt auch nicht unattraktiv. Ihr dickes, weiches Haar (kaninchenbraun, mit einem Hauch Fuchsrot darin) mit dem strengen Mittelscheitel, zwei Flechten über jedem Ohr, zu tiefsitzenden Schnecken aufgerollt, die mit dem Rest ihrer Locken am Hinterkopf aufgesteckt sind. Ihr Gesicht ist eine fast jungfräuliche Leinwand, der nur die lebhaften, dunklen Augen und der gefühlvolle Mund Farbe verleihen. Es liegt ein gewisser Charme in diesen Gesichtszügen, und sie hat eine sehr weibliche Art, sich zu bewegen. Sie nimmt die hölzernen Wäscheklammern von der Leine und beugt sich geschmeidig, um den Unterrock in den Korb zu legen. Sie streckt sich nach dem zweiten Rock und entblößt dabei ihre Fußknöchel – in der Eile hat sie ganz vergessen, Strümpfe anzuziehen, sie trägt nur hölzerne Gartenpantoffeln –, und ihre Knöchel sind zierlich und hübsch. Was für eine zarte Frau – auch die Gelenke ihrer weißen Hände sind kaum breiter als die eines Kindes. Obwohl es gerade Februar ist, liegt schon ein Hauch von Frühling in der Luft, und Charlotte wendet ihr Gesicht einen Moment der Sonne zu.
»Emily!«, ruft sie in Richtung der offen stehenden Küchentür. »Komm mal raus.«
Ihre Schwester kommt jedoch nicht, und Charlotte verabschiedet sich allein von den Gänsen, und als Keeper, Emilys Hund, seinen Kopf an ihren Bauch schmiegt und leise brummt, krault sie ihm den Nacken und zieht dort sanft an einer Hautfalte. Hat sie wohl noch Zeit, ein wenig auf der Heide spazieren zu gehen? Die Melancholie, die sie erfüllt, weil sie morgen ihr Zuhause verlassen wird, wird durch ihre nach dem Aufbruch drängende Ungeduld gemildert. Sie wird keine Zeit mehr haben, das weiß sie, und sie setzt den Korb ab und läuft zum Hof vor dem Haus: eine Wiese mit ein paar wilden Brombeersträuchern an der Mauer, ein Fliederbusch und vereinzelte Tannen.
Eine Lücke zwischen den Tannen gibt den Blick frei auf die Kirche von St. Michael and All Angels, das hat sie nie anders gekannt: Das ist die Kirche, in der ihr Vater predigt, und in ihrer Kindheit dachte sie, dass der Turm der höchste in ganz England wäre. Nachdem sie den Dom von York gesehen hat, ist der Kirchturm in ihrer Achtung gesunken, und seine braune Farbe erinnert sie überdies an einen faulen Zahn. Zwischen der Kirche und der Gartenmauer liegt ein Ausläufer des Friedhofs, hie und da steht ein Grabstein aufrecht, doch die meisten liegen flach auf dem Boden, als ob die Lebenden verhindern wollten, dass die Toten aus dem Grab kriechen. Charlottes Mutter und ihre älteren Schwestern Maria und Elizabeth liegen in einem Grabgewölbe nahe dem Altar der Kirche. Ihre Mutter war achtunddreißig, als sie starb – gar nicht mal so jung, wenn man sich vor Augen hält, dass die meisten Bewohner von Haworth noch viel früher abtreten müssen. Maria und Elizabeth waren gerade mal elf und zehn Jahre alt, als der Typhus sie dahinraffte.
Charlotte öffnet das Gartentor, und in dem Blick, den sie über die Landschaft schweifen lässt, liegt eine gewisse Zuneigung, obwohl sie es nicht erwarten kann, möglichst viel Abstand zwischen sich und das Städtchen zu legen. Sie wird nicht zurückkommen – wenn es nach ihr geht, wird sie niemals zurückkommen.
»Ich hoffe ja, dass das milde Wetter anhält.«
Sie dreht sich um. Da kommt ihr Vater, ein Prediger der Church of England, in der Hand Bibel und Gebetbuch für den Abendgottesdienst. Trotz seiner vierundsechzig Jahre ist er noch immer ein beeindruckender Mann: hochgewachsen und gut aussehend, das widerspenstige rote Haar mittlerweile aber fast ganz silberweiß. Er macht noch immer dieselben Riesenschritte, aber in letzter Zeit hat sich die Andeutung eines Zögerns in seine Bewegungen eingeschlichen. Das nordische Blau seiner Augen wird zunehmend vom Star getrübt.
»Na, nimmst du Abschied, meine Tochter?«
Als sie die ruhige, tiefe Stimme hört, wallt die Rührung in ihr auf, und sie kann nicht antworten. Er legt ihr die Hand auf die Schulter und scheint sich kurz auf sie zu stützen, obwohl sie so klein und zerbrechlich ist.
»Das ist ein schlechter Moment für mich, meine Gemeinde zu verlassen«, sagt er. Es gibt Murren über die Kirchensteuer, die für viele Menschen zu hoch ist. Sie fühlt, dass sie etwas über die Armen in Haworth sagen sollte – wie schrecklich sie es findet, dass die Menschen so viel erdulden müssen. Aber ihr fehlt der Mut. Sie hat in den letzten Wochen viel Zeit und Energie in die Spendensammlung gesteckt, und anschließend in die Verteilung von Kleidung, Decken und fünfzig Paar Schuhen, hundert Säcken Haferflocken und zweihundert Ladungen Kohle. Sie hat so viele graue Gesichter gesehen, so viele magere, zitternde Hände, und dann das Husten, Räuspern und Niesen in all diesen dunklen Höhlen! Sie schämt sich für das Unbehagen, das sie im Umgang mit den Armen verspürt, und für den Groll, den sie gegen die Mütter hegt, die trotz ihrer Bedürftigkeit jedes Jahr wieder ein Kind bekommen. Ein Kind, das wiederum aufwachsen wird, um später schlecht bezahlte Arbeitskraft in einer der Textilfabriken am Fluss zu werden, lange Tage an einem Webstuhl zu sitzen oder in einer muffigen Dachkammer Wolle zu kämmen. Sie wünschte, sie könnte mehr Mitgefühl aufbringen, aber sie kann sich nicht verleugnen. Bei einem Besuch am Sterbebett eines Familienvaters – sie brachte der Familie Steinkohle, Brot und Gänseeier aus dem Pfarrhaus – fühlte sie, wie auf einmal die schmutzig klamme Hand eines Kindes in ihre glitt. Die Kleine trug ein schmuddeliges Nachthemd, und aus der Nase lief ihr der grüne Rotz, und Charlotte zog aus schierem Ekel ihre Hand jäh zurück.
Krankheit ist allgegenwärtig in Haworth. Die Behausungen der Arbeiter sind überbelegt, oft wohnen mehrere Familien in einer Hütte. An der Straße stehen die hölzernen Toiletten, die sich mehrere Haushalte teilen, und der Inhalt läuft in einem offenen Abwasserkanal den Hügel hinunter. Ihre Freundin Ellen hat einmal bemerkt, dass die Luft in Haworth doch sehr gesund sein muss, denn die Stadt liegt hoch auf den Hügeln des Penninengebirges, aber es ist ein nasskalter, windiger Ort, an dem es oft regnet und schneit.
Obwohl Charlotte Nordengland noch nie verlassen hat und abgesehen von ein paar Jahren im Internat ihr ganzes Leben in Haworth verbrachte, ist sie in ihrer Fantasie fast täglich geflohen. Wenn sie am Tisch vorm Kamin sitzt und zum Stift greift, stellen Entfernung und Geldmangel kein Hindernis mehr dar, und sie kann reisen, wohin sie möchte. Dann kommen die Bilder von mediterranen Küsten mit Olivenhainen, Palmen und vanilleduftenden Blumen. Oder sie irrt durch die Alleen und Gassen, zwischen den hohen Kirchen und Herrenhäusern von Städten wie London und Paris.
»Morgen Abend sind wir schon in London, Papa«, sagt sie, lauter als beabsichtigt, und sie wendet ihren Blick resolut von der braunen Kirche und den Gräbern ab, läuft an ihrem Vater vorbei und geht durch die Küchentür hinein.
Es kann noch lange nicht Morgen sein, aber Charlotte bekommt kein Auge mehr zu. Ihr Bett ist zu warm, sie richtet sich vorsichtig auf und schlägt die Decke zurück. Emilys Atemzüge machen leicht pfeifende Geräusche, wie der Wind, der durch das zerbrochene kleine Fenster des Kirchturms zieht. Es war eine schlechte Idee, wieder das Bett mit ihr zu teilen. Es hat etwas Altjüngferliches, wenn sie wieder so mit ihrer Schwester im Bett liegt. Ein Mann sollte neben ihr liegen, ein Ehemann.
Ihr steckt Unruhe in den Beinen, sie will aufstehen, aber der Dielenboden knarrt oft so schrecklich laut, und dann weckt sie Emily. Sie legt sich auf den Rücken und denkt, dass sie schon einen Mann will, aber ohne Kinder. Ohne den säuerlichen Milchgeruch, die Masern und Krupp und das ständige nervende Geschrei in der Nacht. Sie hat genug taufrische Mädchen gesehen, die sich im ersten Jahr ihrer Ehe in nervöse Hausmütterchen verwandelten, das baumwollene Kopftuch nachlässig um den Kopf geschlungen und ein quengelndes Baby auf dem Arm. Aber es gibt keinen Weg, Mutterschaft und Haushalt zu entkommen, wenn man sich mit einem Mann zusammentut.
Charlotte fährt mit den Fingerspitzen über die Verzierung der Decke und zieht zwei Bommeln so fest auseinander, dass ein Riss in der Wolle entsteht. Sie muss schlafen, denn morgen erwartet sie die erste Etappe ihrer Reise. Ihr Vater wird Emily und sie begleiten, erst nach London und drei Tage später dann mit dem Passagierschiff nach Ostende. Er will sichergehen, dass sie gut zurechtkommen, obwohl es eigentlich keinen Grund zur Besorgnis gibt, denn ihre Freundin Mary und deren Bruder John begleiten sie, und die haben diese Reise schon mehrmals gemacht.
Im ersten Morgengrauen sieht sie ihre Reisekleider am Kleiderschrank hängen. Ist die einfache Kleidung aus Yorkshire wohl für eine mondäne Stadt wie Brüssel geeignet? Emily weigert sich, ihre altmodischen Kleider mit den riesigen Puffärmeln zu Hause zu lassen, sie gibt kein Jota auf ihr Äußeres, weil sie nicht erkennt, dass sie beide im ersten Moment eben sehr wohl danach beurteilt werden. Und überhaupt, es gibt noch mehr Gründe, warum sie in Brüssel wohl ab und zu Schwierigkeiten haben werden. Das Bürgertum spricht dort Französisch, eine Sprache, die sie ganz anständig schreiben kann, aber sie hat bis jetzt nur mit Lehrerinnen gesprochen, die noch nie einen Fuß aufs europäische Festland gesetzt haben. Emily kann ein wenig Französisch lesen, aber keine Unterhaltung führen. Dazu kommt, dass Belgien ein katholisches Land ist, in dem andere Sitten und Gebräuche herrschen.
Auf einmal beginnt Emily zu husten. Sie richtet sich auf, hebt einen Arm vor den Mund und hustet in den Ärmel.
»Geht es?« Charlotte legt alle Kopfkissen aufeinander, sodass ihre Schwester etwas aufrechter liegen kann.
»Em – meinst du, es ist eine gute Idee, dass wir nach Brüssel ziehen? Ich bin mir plötzlich gar nicht mehr so sicher.«
Es bleibt eine ganze Weile still, dann sagt Emily: »Willst du vielleicht wieder Gouvernante werden?«
Sie versteht sich darauf, den Finger in offene Wunden zu legen.
»Willst du wieder Sklavenarbeit verrichten und von einer Mrs White herumkommandiert werden?«
Charlotte sieht die Umrisse des Körpers ihrer Schwester: ihre angezogenen, langen, mageren Beine und ihr Profil wie ein Schiff auf Kurs – die Nase das geblähte Segel, das Kinn der trotzige Bug.
»Nein, nein, das weißt du doch. Und was wird mit Papa?«
»Der wird mich vermissen.« Emily räuspert sich. »Er ist es gewohnt, dass ich für ihn sorge, aber er hat ja auch noch Tante Elizabeth und Martha. Und in sechs Monaten sind wir doch wieder zurück, oder? Das hast du versprochen. Länger dürfen wir nicht wegbleiben.«
»Du kommst auf jeden Fall nach Hause«, sagte Charlotte. »Vielleicht bleibe ich noch etwas länger in Brüssel, aber das weiß ich noch nicht sicher.« Sie stößt einen Seufzer aus. »Bin ich verrückt?«
»Nein, verrückt bist du nicht.« Gereizt wirft Emily eins von den Kopfkissen über das Fußende des Bettes. »Dein Plan wird schon aufgehen. Wir lernen Französisch und Deutsch, und ich werde mein Klavierspiel aufpolieren. Mit diesen Kenntnissen können wir dann gleich selbst eine Schule aufmachen. Anne kann den Mädchen das Sticken beibringen. Dann müssen wir nie wieder weggehen.«
Charlotte hört ihre eigenen Argumente. Seltsam, wie ihre Schwester sie in fast denselben Formulierungen widergibt, als wollte sie versuchen, sich selbst zu überzeugen.
»Vielleicht kann Branwell ja auch etwas tun«, schlägt sie vor.
»Branwell ist ein Faulpelz«, sagt Emily barsch. »Ich wüsste nicht, wozu der gut sein sollte.«
»Ich vermisse ihn.«
»Was vermisst du? Seinen Alkoholdunst?«
Emily legt sich auf den Bauch und dreht den Kopf auf die andere Seite.
III
Charlotte trinkt ihren Kaffee und genießt die wachsende Aufregung. Es ist so weit: Sie reist ab.
Es klopft an der Esszimmertür, und der Hilfsprediger ihres Vaters tritt ein. Er zittert und reibt sich die Hände, denn draußen ist es noch nächtlich kalt.
»Na, Mr Weightman«, sagt Charlotte. »Haben Sie es so früh aus dem Bett geschafft?«
Es gefällt ihr, den jungen Prediger zu quälen. Er hat etwas von einem jungen Hund, der um einen herumspringt, weil er so gerne spielen will. Mit einem Gesicht, das der Schöpfer schön modelliert hat, mit seinem munteren Augenaufschlag und den langen, flinken Beinen ist er ein hübscher Mann. Da sind sich die Frauen in Haworth einig. William Weightman ist sich seiner Schönheit durchaus bewusst, wie ein Kind, das davon ausgeht, dass es süß und perfekt ist – doch er hat dabei überhaupt nichts Anmaßendes. Charlotte selbst ist immun gegen seinen Charme, er ist für ihren Geschmack zu weiblich. Aber sie weiß, dass Anne eine Schwäche für ihn hat.
»Davy vom Black Bull ist da.« Martha wischt sich die Hände an der Schürze ab und beginnt, geräuschvoll die Teller aufeinanderzustapeln. In ihren blassblauen Augen stehen die Tränen.
Tante Elizabeth hilft Emily in den Mantel und bindet die Bänder von Charlottes Haube. Rasch legt sie sich einen Schal um die Schultern und folgt ihnen dann nach draußen.
»Zeit zum Aufbruch!«, sagte Patrick Brontë mit bestimmtem Ton. Er fasst seine Schwägerin beim Ellenbogen und küsst sie auf die Wange.
»In ein, zwei Wochen bin ich wieder zu Hause.«
Elizabeth streichelt ihm die Hand und streckt dann die Arme nach ihren Nichten aus. Charlotte gibt ihr einen liebevollen Kuss, doch die Umarmung von Emily ist hölzern und geistesabwesend. Seit über zwanzig Jahren kümmert sich Elizabeth um den Nachwuchs ihrer Schwester Maria, und sie kennt die Kinder durch und durch. Anne, die Jüngste, ist ihr Liebling, ein Engel von einem Mädchen, und Branwell, der einzige Sohn, sucht auch immer noch ihre Gesellschaft, wenn er mal zu Hause ist. Die zwei Ältesten scheinen sie eher als konventionelle, einfältige Frau zu betrachten. Bei Charlotte wird die Geringschätzung durch ihre warme Gemütsart abgemildert, doch Emily treibt manches Mal ganz offen ihren Spott mit Elizabeth. Die Kinder schätzen sie aufrichtig, daran zweifelt sie gar nicht, aber sie werden sie nie so lieben wie eine Mutter, und das ist eine der größten Enttäuschungen ihres Lebens.
Damals hat sie alles verlassen, um ihrem Schwager zu helfen: ihre Geburtsstadt Penzance in Cornwall (»Dort schien die Sonne immer so herrlich, Patrick!«) und auch ihre Chance, selbst noch eine Familie zu gründen. Es gab keine andere Lösung, denn als Witwer mit sechs kleinen Kindern fand Patrick Brontë keine solide Frau, die ihn geheiratet hätte. In den ersten Jahren im Pfarrhaus verliebte sich Elizabeth heftig in ihren Schwager, und sie sah ihn gegen sein wachsendes Verlangen ankämpfen. Wie an dem Tag in der Küche, als sie an der Anrichte stand und er ihr die Hand aufs Haar legte – und sie dort minutenlang liegen ließ. Bis er mit frustrierter Miene aus der Küche rannte und mit seiner Pistole auf den Zaun schoss, bis sie leer war. Es gab keine Zukunft für sie als Eheleute, denn das Gesetz verbot es einem Witwer, die Schwester seiner verstorbenen Gattin zu ehelichen. Im Laufe der Zeit wich ihre Verliebtheit der Zärtlichkeit. Nun reicht sie ihm eben mit freundlicher Wärme den Korb mit den belegten Broten und sagt ihm, dass er seine Jacke gut zuknöpfen soll.
Tante Elizabeth sieht, wie Charlotte sich noch einmal umdreht, als die Pferde sich in Bewegung setzen, als wollte sie Abschied nehmen vom Pfarrhaus, der Kirche und den Gräbern. Sie ruft ihr noch etwas zu, aber ihre Nichte ist in Gedanken schon weit weg, in einer Welt, in die sie ihr nicht folgen kann. Sie bleibt stehen und blickt dem Wagen nach, bis er hinter dem Hügel verschwunden ist.
Davy und der Hilfsprediger sitzen auf dem Kutschbock, und die Pferde gehen vorsichtig die Hauptstraße hinab. Die kleine Stadt erwacht in der Morgendämmerung. Mabel, die Tochter des Metzgers, fegt gerade den Gehweg vor dem elterlichen Laden. Als sie die Kutsche sieht, lehnt sie den Besenstiel an ihre Schulter und winkt den Reisenden zu. Der Krämer schiebt einen Korb mit Rotkohl nach draußen und ruft: »Hochwürden, Sie kommen doch zurück, nicht wahr?«
Joseph – Vater von elf Kindern, der immer Probleme hat – läuft dem Wagen atemlos hinterher und ruft: »Hochwürden, bleiben Sie lange fort?«
Davy lässt die Pferde halten, denn Patrick Brontë zieht ihn am Hosenbein. Die Fragen seiner Kirchgänger dürfen doch nicht unbeantwortet bleiben! Er steht auf und erklärt, dass er seine Töchter auf ihrer Reise nach Übersee begleitet, nach Brüssel, der Hauptstadt von Belgien, wo sie zur Schule gehen sollen. Mabel reißt die sanften Kuhaugen auf. Belgien, was ist das denn für ein Land? Und sind die Fräuleins Brontë dort nicht in Gefahr? An der Hauptstraße gibt es fast einen Menschenauflauf, weil alle dem Prediger und seinen Töchtern eine gute Reise wünschen wollen. Charlotte muss lächeln. Emily scheint taub zu sein für die Grüße, die man ihr zuruft. Sie drückt keine Hände und lächelt nicht, so kennt man sie in Haworth. Charlotte hat durchaus Verständnis für ihre Schwester. Sie will sich mit den Einwohnern von Haworth nicht weiter einlassen, denn die Leute sind hier in allem so grob und ungeschliffen. Sogar die Großgrundbesitzer der Gegend sind kaum mehr als Großbauern und beschäftigen sich in ihrer Freizeit mit der Jagd oder ordinären Festen. Die wahren Reichen von Haworth, die Besitzer der Textilfabriken unten am Fluss, mögen sich vielleicht in dem Glauben wiegen, dass sie Herren sind, aber sie trinken zu viel und veranstalten Hahnenkämpfe. Mitten in dieser Wüstenei haben ihre Eltern das Pfarrhaus von Haworth in eine Oase für den Geist verwandelt: Hier konnte sie sich mit ihren Schwester und Branwell an Schönheit und Weisheit laben. Ihre Mutter las ihnen Märchen und Legenden vor, und nach ihrem Tod sorgte der Vater dafür, dass es immer etwas zu lesen und zu lernen gab. Draußen war das Leben hart und der Wind scharf, und so kuschelten sie sich aneinander wie junge Füchse. An der Tafel am Kamin erschufen sie sich in begeisterten Versen ihre eigene ideale Welt. Ihr Vater musste sich in die Außenwelt hinauswagen, aber er fand Freude an seinem Amt.
Er ist ein guter Redner, und jeden Sonntag ist seine Kirche voll bis auf den letzten Platz. Es ist ganz besonders, wie einprägsam er zu den Leuten spricht! Sie findet, dass er an seiner langen, schmalen Nase entlang auf seine Gemeinde blickt wie ein Universitätsprofessor auf eine Gruppe noch unwissender Studenten. Ihr Bruder ist der Einzige in der Familie, der ein Talent hat, sich unters Volk zu mischen, wenngleich es bedauerlich ist, dass er das vor allem in der Kneipe tut. Sie hat Branwell schon seit sechs Monaten nicht mehr gesehen, denn er arbeitet als Beamter bei der Eisenbahn. Was er dort wohl macht – am Schalter Karten verkaufen? Und das, wo doch alle so große Pläne für ihn hatten! Er hat die größten Chancen bekommen. In seiner frühen Kindheit wurde er zu Hause von ihrem Vater unterrichtet, auch in Latein, während ihre Schwester und sie ins Internat geschickt wurden. Er hätte in Cambridge oder Oxford studieren können, aber das wollte er nicht. Er hätte sich in London um eine Zulassung der Royal Academy of Art bewerben können, aber dort tauchte er nie auf. Er bekam ein Atelier in Bradford und alles nötige Material, um sich als Portraitmaler einzurichten, kam aber mürrisch und niedergeschlagen wieder nach Hause. Und dann sein Schreibtalent – denn das hat er zweifellos, ihr Vater hält ihn für den begabtesten Schriftsteller von ihnen allen, aber er schafft es, wirklich alles zu vergeuden. Er ist ihr Bruder, ihr genialer und doch so unvernünftiger Bruder. »Charlotte, ich hab’s geschafft!«, rief er, als er den Brief gelesen hatte, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass man ihn als Schalter-Assistenten am Bahnhof Sowerby Bridge angenommen hatte. Genau das, wovon junge Männer träumen – zur Eisenbahn gehen. Und die Linie von Leeds nach Manchester ist ja auch eine Pionierleistung. Dennoch konnte Charlotte seine Begeisterung nicht verstehen. In seinem Enthusiasmus hob er sie hoch, schwang sie einmal rundherum und brachte ihre Frisur ganz durcheinander. Sein ganzer magerer Körper bebte vor Freude. Er wirkte etwas angetrunken, aber sein langes, schmales Gesicht und seine von sich selbst eingenommene Art verliehen ihm die Ausstrahlung eines jungen Aristokraten. Er ist ihr Bruder, und sie vermisst ihn, aber auch ihn muss sie jetzt in England zurücklassen.
Unten, am Rande von Haworth, springt William Weightman vom Bock, und als er gerade sein Gleichgewicht wiedergefunden hat, nimmt er mit einer übertrieben tiefen Verbeugung seinen Hut ab.
»Adieu!«
Tatsächlich muss Emily lächeln.
Yorkshire, Yorkshire, du gnadenloses Land.
Charlotte schiebt ihre Hände in den Lammfellmuff auf ihrem Schoß. Ihr Weg nach Bradford führt sie weiter durch die Heidehügel. Trostlose Hügel mit niedrigen Mauern aus Steinen, die die Schäfer und Bauern aus dem Feld geklaubt haben. Saurer Moorboden, auf dem nur Flachs und Heidekraut gedeihen wollen. Die Heidehügel werden im September ein einziges schäumendes Violett, aber im Oktober beginnen die Sträucher schon zu verholzen. Der Boden ist jetzt braun, blassbraun wie Brot, fleckig braun wie ein Raubvogel, lohbraun wie Baumrinde, gelblich braun wie die Ausscheidungen eines Hundes, oder grün wie Moos und manchmal auch schwarz. Sie geht fort, bevor sich auch noch ihr Herz braun verfärben kann.
Mary Taylor steht auf dem Bahnsteig und beugt sich gerade herab, um den großen, zottigen Hund eines anderen Reisenden zu streicheln, doch als sie Charlotte kommen sieht, richtet sie sich entzückt wieder auf. Selten sind zwei Freundinnen so verschieden gewesen. Die zarte Charlotte, die immer so aussieht, als wäre sie noch nicht ganz ausgewachsen, mit einer Taille, die jeder gestandene Mann mit zwei Händen umfassen könnte, in einem etwas zu weiten graublauen Kleid und schwach nach Veilchen duftend. Und Mary, die stolze, üppige Erscheinung, einen Kopf größer als Charlotte, mit roten Wangen, elegant in einem leicht ausgeblichenen, aber immer noch schönen Reisekleid und einem rosa gestreiften Hütchen. Charlotte und Mary haben sich als Vierzehnjährige kennengelernt, als sie in Roe Head waren, dem Pensionat von Miss Wooler in der kleinen Stadt Mirfield. Charlotte hegt große Bewunderung für ihre Freundin, denn sie hat ein unabhängiges Naturell und geht ihren eigenen Weg. Mit ihrer Schwester Martha studiert sie in Brüssel am Schloss Koekelberg, und sie schmiedet Pläne, später nach Neuseeland auszuwandern. Ihr Bruder John, ein Jüngling mit offenem Blick und vollem schwarzem Haar, das er in Kinnhöhe stumpf abgeschnitten trägt, schüttelt Patrick Brontë die Hand. Es ist ihre erste Begegnung, und der Prediger betrachtet ihn argwöhnisch, wie er es bei jedem Mann tut, der in die Nähe seiner Töchter kommt.
Nichts wird je wieder so sein wie zuvor, und Charlotte ergreift ihre Chance. Ihr Leben setzt sich in Bewegung wie die Lokomotive des Zuges. Heute, ab jetzt, am Bahnhof von Leeds. Sie ist keine Gouvernante geblieben, sie hat sich eine andere Laufbahn ausgedacht.
»Oh, Mary«, sagt sie. »Mary, wir fahren nach London.«
»Und nach Brüssel.« Mary zwickt Charlotte in die Hand.
»Erzähl mir von London«, bittet Charlotte.
»Heute Abend sind wir doch schon dort«, sagt Mary, »dann kannst du alles selbst sehen.«
»Es wird aber dunkel sein«, schmollt Charlotte.
»In London ist es niemals dunkel«, sagt Mary. »Es gibt immer mehr Gaslaternen, und in den dunkleren Straßen kannst du dir einen Jungen mit einer Laterne mieten, der dir den Weg leuchtet.«
»Erzähl uns von dem Passagierschiff«, sagt ihr Vater zu John, und der Jüngling beginnt enthusiastisch, eine detaillierte technische Erklärung zum Schiff abzugeben – derart langweilig, dass Charlotte aufsteht, und im Waggon auf und ab läuft.
Sie muss sich an den Bänken festhalten, weil der Zug so wackelt, aber sie ist zu rastlos, um sitzen zu bleiben. Der Gestank von Steinkohle und Öl setzt sich in ihrem Gedächtnis für immer als der Geruch von Abenteuer fest. Sie betrachtet die Landschaft und schaukelt im Rhythmus des Zuges mit. Der Zug donnert durch Yorkshire, bald werden sie die Midlands erreichen, bis nach London und immer weiter fort von ihrer Vergangenheit. Weg von den traurigen Erinnerungen! Ihre tote Mutter und der säuerliche Geruch, der in ihrem Zimmer hing, während ihre Hände einen Strauß Feldblumen umklammerten, den Elizabeth und sie ihr gepflückt hatten. Der kranke, magere Körper ihrer ältesten Schwester Maria und wie sie, Charlotte, in deren lieben Armen geschlafen hat. Wie weise und gut Maria war – ein Engel. Die Hügel, die ewigen Hügel, und wie hart das Gesicht ihres Vaters manchmal werden kann. Der Zug bahnt sich seinen Weg, und rechts und links von den Schienen tun sich Abgründe auf, die sie von dem ängstlichen Mädchen trennen, das sie einmal gewesen ist. Sie sieht es dort stehen, das Kind Charlotte, auf der Böschung hinter dem Graben: ein zartgliedriges Mädchen mit blauen Schatten unter den Augen, in einem flatternden weißen Nachthemd. Sie blinzelt kurz, und verschwunden ist das Kind.
IV
Es heißt, dass London niemals schläft, und obwohl sich gegen Mitternacht kein gesitteter Mensch mehr nach draußen wagt und die Stadt zum Terrain von Einbrechern, Straßendirnen und Kanalisationsarbeitern wird, die für eine Flasche Gin die Sickergrube leeren, ist die Stadt um zehn Uhr abends noch voller Leben. Ganz normale anständige Bürger flanieren auf den Gehwegen, Kutschen fahren vorbei. Die Opernaufführung in Her Majesty’s Theatre am Haymarket ist noch in vollem Gange, in den music halls schaukeln Akrobaten am Trapez und schöne Dämchen singen schlüpfrige Liedchen, und in den Gaststätten werden die Tische fürs Abendessen gedeckt.
An diesem regnerischen Februarabend ist es nicht anders. Am Bahnhof am Euston Square wird die Ruhe gestört durch die Ankunft des Zuges aus dem Norden, eines Zuges mit zwanzig oder dreißig Waggons. Die Lokomotive aus Kupfer und Eisen, mit ihren mahlenden Treibstangen und dem stampfenden Geräusch der Zylinderkolben, zischt und schnauft und stößt eine dunkelgraue Rauchwolke aus. Die Türen werden aufgestoßen, und auf dem Bahnsteig gibt es ein großes Gerufe und Geschiebe. Männer rufen nach Gepäckträgern, eine Mutter sucht ihr Kind, das in diesem Spektakel verstört ihre Hand losgelassen hat, Reisende stampfen mit den Füßen, um sich nach der kalten Fahrt wieder zu wärmen, und Droschkenkutscher preisen lautstark ihre Dienste an. Das alles unter dem hohen schmiedeeisernen Dach mit den Glasfenstern.
In diesem Chaos kommen Patrick Brontë und seine Reisegesellschaft an, und als John Taylor sieht, wie sich der Prediger verwirrt umschaut, übernimmt er sofort die Führung. Er verhandelt mit den Gepäckträgern, die kaum zuhören und eine bizarre Sprache sprechen – es hört sich an, als würden sie ihr Englisch kauen. Ein Kofferträger mit einer Nase, die aussieht wie eine übergroße Erdbeere, und Augen, die vom Gin ganz glasig sind, beginnt an Emilys Koffer zu ziehen, aber sie ermahnt ihn zur Vorsicht, indem sie ihn mit ihren langen, starken Fingern in den Arm kneift.
»Ho, ho, Missy!«, ruft der Gepäckträger und spuckt einen Klecks Rotz auf den Boden neben seine Füße.
Am Ausgang des Bahnhofs bekommen die Träger Ärger mit dem Kutscher, mit dem sich John Taylor geeinigt hat. Erst als Patrick Brontë den Männern jeweils einen Schilling gegeben hat, werden die Koffer auf die Droschke gestellt und sie können abfahren. Emily stellt zu ihrem Entsetzen fest, dass ihre Handflächen ganz schwarz sind. Sie hat die Pferde gestreichelt, aber die Tiere sind offenbar mit einem klebrigen schwarzen Pulver überzogen.
»Das kommt von der Kohle, Missy«, sagt der Kutscher über die Schulter nach hinten. »Ein paar Tage pro Woche arbeiten sie in der Kohlenmine.«
Als sich die Kutsche aus dem Gedränge vor dem Bahnhof befreit hat und sie über eine prächtige, breite Straße fahren, kommen unsere Reisenden wieder etwas zur Ruhe. Emily klagt über kalte Hände, aber Charlotte nimmt begierig alle Eindrücke in sich auf. Beim Anblick jeder Statue und jedes besonderen Gebäudes will sie in ihrem Enthusiasmus etwas ausrufen, aber ihr Vater sitzt mit geschlossenen Augen in der Kutsche, und Mary hat eine Haarspange zwischen den Lippen und versucht, ihren Haarknoten, der sich gelöst hat, wieder zu befestigen. An der Ecke einer Gasse ruft der Kutscher: »Ho!« Ab hier darf man nur zu Fuß weiter, daher werden die Koffer abgeladen. John geht in die Herberge, um einen Laufburschen zu holen. Das ist also die Paternoster Row, geht es Charlotte durch den Kopf, als sie Arm in Arm mit Mary zum Chapter Coffee House geht. Das muss das Haus von Longman sein, der die Gedichtbände der Lake Poets herausgegeben hat! Sie ist aufgeregt, aber der Rest der Gesellschaft ist müde, denn es ist schon spät, lang nach Schlafenszeit.
In der Pension (neben der riesigen Kathedrale, die sie im Dunkeln überhaupt nicht vermutet) liegt die junge Frau aus Yorkshire hellwach im Bett. Letzte Nacht war sie noch zu Hause im Pfarrhaus ihres Vaters, und nun ist sie hier in London, der Metropole. Ihre Freundin liegt neben ihr und schläft tief und fest, strahlt mollige Wärme aus. Auf dem Bett direkt an der Mauer liegt ihre Schwester, die höchstwahrscheinlich ebenfalls hellwach ist. Das Zimmer ist klein und schäbig, mit – wenn sie sich recht erinnert – vergilbter Tapete und muffigen Quiltdecken. Vor einer halben Stunde haben sie die Kerze ausgeblasen, und sie kann jetzt noch den schwelenden Docht riechen. Ein vertrauter Geruch, aber ansonsten ist alles fremd. Als sie ankam, war sie so furchtlos, und es ist seltsam, wie ihre Ängste jetzt im Dunkel der Nacht zurückkommen. Wie still es hier ist. Natürlich nicht so still wie auf dem Hügel, auf dem das Pfarrhaus steht und wo man nachts ab und zu eine Eule hört, aber doch überraschend still für eine Stadt mit fast zwei Millionen Einwohnern. Sie hört das Rattern einer Kutsche und den Hufschlag eines Pferdes auf dem Kopfsteinpflaster, aber es entfernt sich wieder. Die anderen Geräusche der Stadt bilden ein fernes, dumpfes Rauschen, wie von einer Wassermühle. Vielleicht ist es wahr, was ihr Vater gesagt hat, sie aber nicht glauben wollte: dass es in der Großstadt einsamer ist als auf dem Dorf.
Diese zarte junge Frau hat sich auf ein Abenteuer eingelassen, dessen Folgen sie noch nicht absehen kann. Heute Nacht London, und in ein paar Tagen Brüssel, die Hauptstadt eines fernen, bizarren Landes. Wie soll sie es dort schaffen, wenn das Englisch in London schon ganz anders klingt als in ihrer Gegend? Und in Brüssel spricht man gar kein Englisch, sondern Französisch und Flämisch, was wohl ein niederländischer Dialekt sein muss. Was für einen wilden Plan hat sie da nur gefasst – wie schlecht durchdacht! Eine Frau ist nichts ohne Vater oder Mann, ohne einen Beschützer an ihrer Seite. Und schlimmer noch: Sie stürzt sich ja nicht alleine in dieses Abenteuer, sondern schleift auch noch ihre Schwester mit. Was sie nicht für möglich gehalten hätte, geschieht nun doch: Sie vermisst das Pfarrhaus. Das Haus mit der kalten Steintreppe – aber in der Küche steht ja der Fußwärmer. Sie vermisst sogar die Felder, auf denen kein Baum wachsen will, weil dort immer Schafe waren, und Keeper, der stets vorauslief. Da kommen ihr die Tränen, und das hilft, sie rollen ihr über die Wangen, ihr Hals wird nass. Sie tut ihr Bestes, um kein Geräusch zu machen, und wischt sie mit dem Ärmel ihres Nachthemds ab. Wie ist sie nur auf die Idee gekommen, dass sie etwas Besonderes ist, dass sie dafür geschaffen ist, auf dieser Welt etwas wirklich Bedeutendes hervorzubringen? Ihr Gesicht ist nicht oval und ihr Verstand ist begrenzt, sie ist nicht mehr als ein Kiesel im Bach oder ein Knochen für den Hund: armselig und nichtig! All die Briefwechsel mit ihrem Bruder Branwell, ihre Gedichte und Erzählungen über die erfundene Welt von Glasstown und Angria. Wie konnte sie sich nur jemals einreden, dass in ihr eine große Schriftstellerin schlummert? Eine Frau ist für die Ehe bestimmt, dafür, Mann und Kinder zu umsorgen. Sie muss an Henry Nussey denken, den Bruder ihrer Freundin Ellen. Er steht so klar vor ihrem geistigen Auge, als würde er gerade das Zimmer betreten. Ein junger Prediger, nur vier Jahre älter als sie: gesund und kräftig, mit weißem Haar, weißen Wimpern und bläulicher Haut, die an Buttermilch erinnert. Vor drei Jahren hat er ihr in einem Brief einen Heiratsantrag gemacht, so kalt und aufdringlich wie die Vorladung eines Gerichtsvollziehers. Sie konnte unmöglich glauben, dass er sie liebte, und er tat auch gar nicht erst so. Er sprach von Respekt und Freundschaft. Sie lehnte seinen Antrag ab, ohne groß zu überlegen, einfach nur, weil er keine Leidenschaft für sie empfand. Wie dumm sie gewesen war! Wer war sie schon, eine solche Gelegenheit auszuschlagen? Henry war ein aufrechter, achtbarer Mann. Er bot ihr ein Heim und bat sie, die Dorfschule zu leiten. Eine eigene Schule! Wie töricht sie doch gewesen ist, mehr vom Leben zu erwarten, als das, was er ihr bieten konnte – mehr als einen sicheren Hafen, einen Gatten, Kinder und eine Schule. Obendrein bot Henry ihr an, dass ihre Schwester, ihre liebe Freundin, auch bei ihnen wohnen könnte. Aber nein, sie musste natürlich von der Leidenschaft träumen!
Sie wischt sich mit dem Ärmel die nasse Nase ab, aber als sie sich gerade auf die Seite drehen will, fangen die Turmglocken an zu schlagen. Dieses Geläut überwältigt sie, tief und schwer und himmlisch schön. Wieder und wieder, ihr ganzer Körper bebt vom Widerhall der Glockenschläge. Das ist natürlich das Glockenspiel von St. Paul – ja, natürlich, ihre Herberge liegt ja gleich neben der Kathedrale! Sie lauscht mit ihrem ganzen Wesen, und als der letzte Schlag verklingt, hat sie mit sich selbst und ihrer Anwesenheit hier ihren Frieden gemacht.
V
Es ist Samstag, der 12. Februar 1842, früher Abend, und Emily steht mit Charlotte, ihrem Vater und den Taylors mitten in einer Menschenmenge am Quai der London Bridge Wharf. Gleich sollen sie an Bord des Dampfers gehen. Bei ihrer Ankunft am Quai ließ eine diesige Dunkelheit – nur hie und da unterbrochen durch den milchigen Fleck einer Gaslaterne – das ganze Abenteuer wie einen Traum wirken. Als ob sie jeden Moment in ihrem vertrauten Bett im Pfarrhaus erwachen könnte. Tageslicht, so unangenehm wie ein Schluck kalter Tee, löst die Nacht jetzt ab, und langsam kann sie Einzelheiten erkennen. Das enervierende Geschniefe von jemandem, dem die Nase läuft, der aber sein Taschentuch vergessen hat, scheint von einer grobschlächtigen Frau mit rotem, geschwollenen Riechorgan zu kommen. Sie schnieft nicht nur, sondern spuckt auch noch ab und zu auf den Boden. Und da sind die Kinder, die Emily hat heulen hören. Sieh nur dort, die arme Londoner Familie: Vater, Mutter und ihre fünf Sprösslinge, alle gleich blass, ausgemergelt und blauäugig. Hoffentlich bleiben sie auf Abstand. Sie will bei der Überfahrt nämlich ihre Ruhe haben, denn mittlerweile ist sie seit vier Tagen ununterbrochen von Menschen umgeben. Das ist das erste Mal, dass sie auf einem Schiff mitfährt, aber das kann sie nicht wirklich faszinieren.
»Wie kann man übers Reisen schreiben, wenn man es noch nie getan hat?«, fragte Charlotte gestern Abend, als sie im Chapter Coffee House beim Essen saßen. Ihre Wangen waren ganz rot vor Aufregung. Aber was interessiert es Emily, wie die Kojen im Schiffsbauch aussehen, oder wie es sich anfühlt, wenn sie auf See in einen Sturm geraten? Im Gegensatz zu Charlotte liebt sie die Penninen mit unerklärlicher Begeisterung. In Gedanken kann sie reisen, wohin sie will, und sie wird selbst entscheiden, was für Erfahrungen sie dabei macht. Es macht ihr Angst, dass sie in Brüssel keine Zeit haben wird, die Erzählung über Gondal weiterzudichten, diese magische Insel und ihre Bewohner, die Anne und sie in ihrer Jugend aus dem Nichts geschaffen hatten. Sie wird an wenig mehr denken als an Gondal und an Keeper auf der Heide.
Als sie an Bord gehen, nimmt Patrick Brontë den Arm seiner Tochter Emily, denn er ahnt, was in ihr vorgeht. Er kennt sie besser, als Charlotte sie kennt, und sie ist sein Sorgenkind, aber jetzt geht sie an einen Ort, an dem er sie nicht mehr beschützen kann. Emily schließt nur schwer Freundschaft mit Fremden. Dennoch muss er sie loslassen, es muss ja einmal geschehen, und sie ist schließlich auch schon dreiundzwanzig. Wenn sie nicht krank wird und stirbt (denn das ist eine traurige Möglichkeit, mit der er seit dem Tod seiner Frau und seiner ältesten Töchter immer rechnet), wird sie zu ihm zurückkommen. Sie ist wie ein Hund, der, nachdem man ihn fern von zu Hause ausgesetzt hat, tagelang laufen wird, um wieder nach Hause zu finden. Mit Charlotte ist es anders, bei ihr sieht er ein anderes Risiko. Es könnte gut sein, dass sie in Brüssel einen Mann findet und dort bleibt.
Die Ondine





























