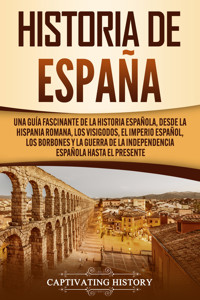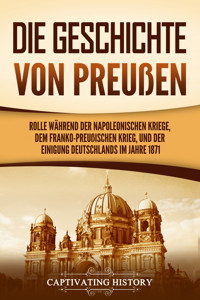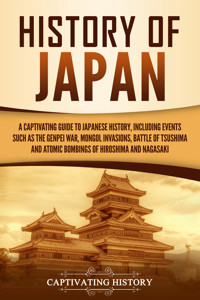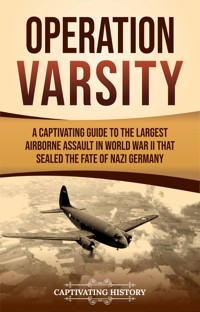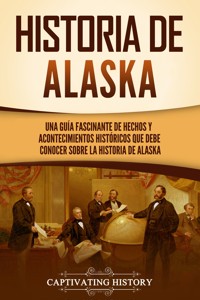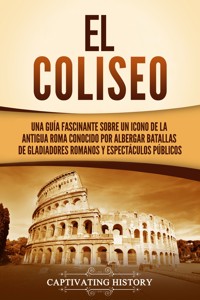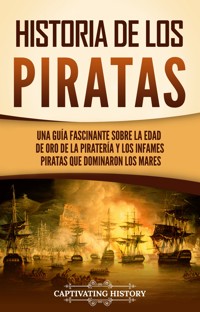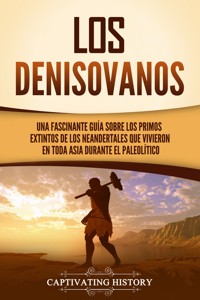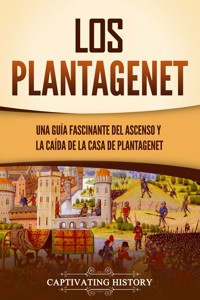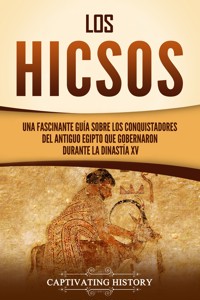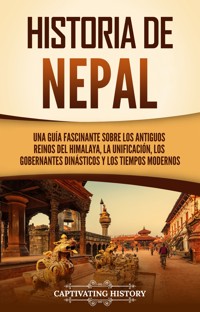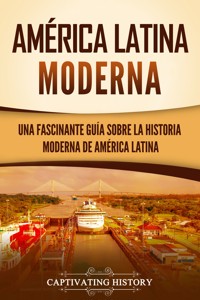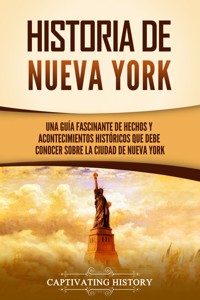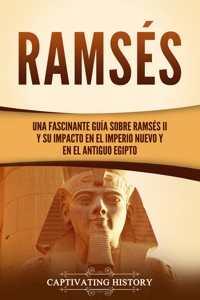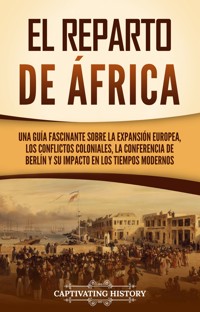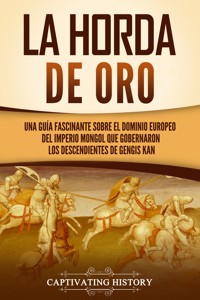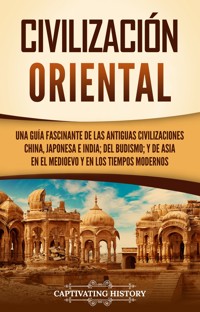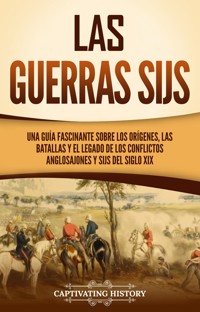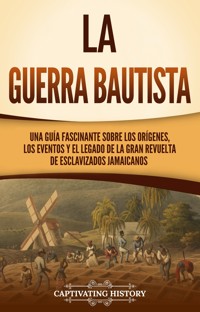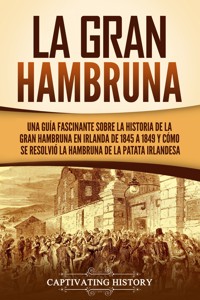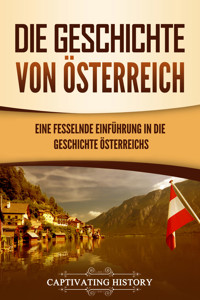
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Captivating History
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wenn Sie mehr über die fesselnde Geschichte Österreichs erfahren möchten, lesen Sie weiter... Als der österreichische Bundespräsident Franz Jonas im Jahre 1971 den Vatikan besuchte, beschrieb Papst Paul VI. Österreich als "die Insel der Seligen". Er tat dies, um den steilen wirtschaftlichen Aufstieg Österreichs zu unterstreichen. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren nur fünfundzwanzig Jahre vergangen, und Österreich war bereits zu einem der wohlhabendsten europäischen Länder geworden. In der modernen Gesellschaft ist es kaum vorstellbar, dass ein Land ganz ohne das Gefühl, dass die Bürger Teil einer vereinten Nation sind, existieren kann. Wenn Sie sich also fragen, wie so etwas möglich ist, lesen Sie einfach weiter. Dieses Buch wird Ihnen dabei helfen, die Reihe von komplexen Ereignissen zu verstehen, die zur Gründung des heutigen Österreich und der modernen österreichischen Identität geführt haben. Lesen Sie das Buch über die Geschichte Österreichs vom Herausgeber "Captivating History" und erfahren Sie mehr über den bemerkenswert großen Einfluss, den dieses kleine Land auf den Rest Europas hatte. Lernen Sie außerdem mehr über: - Die Herkunft des Namens Österreich und ab wann das Land unter diesem Namen bekannt wurde - Dem Römischen Limes und was er mit Österreich zu tun hatte - Die Babenberger, die ersten Herrscher von Österreich - Wie die Habsburger an die Macht kamen - Was die Buchstaben A.E.I.O.U. bedeuten und wie sie sich auf das göttliche Herrschaftsrecht berufen - Lernen Sie mehr über die Habsburger und ihre Rolle als Heilige Römische Herrscher - Wir Österreich mit der Reformation und deren Gegenbewegungen umging - Die aufgeklärten Herrscher des Habsburgischen Reiches - Wie die Doppelmonarchie von Österreich-Ungarn zustande kam - Erfahren Sie mehr über die Revolution in Zentraleuropa und den Aufstieg der Slaven - Wer erschoss Franz Ferdinand und wieso führte dessen Ermordung zum Beginn des Ersten Weltkrieges - Wie sich Österreich Deutschland anschloss und so zu einem Nazistaat wurde - Erfahren Sie mehr über den steilen Aufstieg Österreichs zu einem der reichsten und etabliertesten Europäischen Staaten Scrollen Sie hoch und klicken Sie auf "In den Einkaufswagen", um mehr über die Geschichte Österreichs zu erfahren!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Geschichte von Österreich
Eine fesselnde Einführung in die Geschichte Österreichs
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Die Geschichte von Österreich: Eine fesselnde Einführung in die Geschichte Österreichs
Einleitung
Kapitel 1: Der Marsch in den Osten
Kapitel 2: Die Habsburger kommen ins Spiel
Kapitel 3: A.E.I.O.U.
Kapitel 4: Bastion des Christentums
Kapitel 5: Die Habsburger Monarchie
Kapitel 6: Die Aufklärung in Österreich
Kapitel 7: Das revolutionäre Österreich und die Doppelmonarchie
Kapitel 8: Der Erste Weltkrieg
Kapitel 9: Der Zweite Weltkrieg
Kapitel 10: Modernes Österreich
Fazit
Quellenverzeichnis
© Copyright 2022
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert werden. Rezensenten dürfen in Besprechungen kurze Textpassagen zitieren.
Haftungsausschluss: Kein Teil dieser Publikation darf ohne die schriftliche Erlaubnis des Verlags reproduziert oder in irgendeiner Form übertragen werden, sei es auf mechanischem oder elektronischem Wege, einschließlich Fotokopie oder Tonaufnahme oder in einem Informationsspeicher oder Datenspeicher oder durch E-Mail.
Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, die in diesem Werk enthaltenen Informationen zu verifizieren, übernehmen weder der Autor noch der Verlag Verantwortung für etwaige Fehler, Auslassungen oder gegenteilige Auslegungen des Themas.
Dieses Buch dient der Unterhaltung. Die geäußerte Meinung ist ausschließlich die des Autors und sollte nicht als Ausdruck von fachlicher Anweisung oder Anordnung verstanden werden. Der Leser / die Leserin ist selbst für seine / ihre Handlungen verantwortlich.
Die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze und Regelungen, einschließlich internationaler, Bundes-, Staats- und lokaler Rechtsprechung, die Geschäftspraktiken, Werbung und alle übrigen Aspekte des Geschäftsbetriebs in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich regeln oder jeglicher anderer Jurisdiktion obliegt ausschließlich dem Käufer oder Leser.
Weder der Autor noch der Verlag übernimmt Verantwortung oder Haftung oder sonst etwas im Namen des Käufers oder Lesers dieser Materialien. Jegliche Kränkung einer Einzelperson oder Organisation ist unbeabsichtigt.
Einleitung
Teile seiner Geschichte lasten schwer auf dem heutigen Österreich. Es ist ein Land, in dem jeder Kratzer an der Oberfläche der Erde ein Stück Vergangenheit freilegen kann. Von römischen Ruinen über die Habsburger-Dynastie bis hin zu den jüngsten Opfern des Naziregimes - Österreich ist eine wahre Goldgrube für wissbegierige Gelehrte. Die Vergangenheit Österreichs geht viel weiter als das kleine Territorium, das es heute einnimmt, und sie reicht über die heutigen Grenzen hinaus bis weit in die Gebiete aller seiner Nachbarländer. Für viele Österreicherinnen und Österreicher ist es oft schwer, sich mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen, denn diese ist geprägt von Unterdrückung, Krieg, Misshandlung verschiedener ethnischer Gruppen und Kriegsgräueln. Doch so sehr Österreich auch die Schuld an seiner eigenen Vergangenheit trägt, so sehr hat das Land auch einige Opfer erbracht. Seit seinen frühen Anfängen war das Land Schauplatz vieler Konflikte und Auseinandersetzungen. Die zentrale geografische Lage des Landes in Mitteleuropa trug erheblich dazu bei, dass viele Auseinandersetzungen auf österreichischem Gebiet eskalierten, im militärischen wie auch im ideologischen Sinne.
Während der Völkerwanderungszeit zogen viele Stämme durch Mitteleuropa, und viele von ihnen bekämpften sich gegenseitig, um das Recht zu gewinnen, sich im fruchtbaren Donautal niederlassen zu dürfen. Während der Römerzeit waren die österreichischen Gebiete Teil einer wichtigen Grenzregion, besser bekannt als der europäische Limes. Um das Römische Reich vor den germanischen Stämmen im Norden zu schützen, wurde ein Verteidigungssystem aus Festungen errichtet. Als jedoch der fränkische Stamm im Osten zu Ruhm gelangte und die Karolinger-Dynastie gründete, wurde das Gebiet des heutigen Österreich zur Ostmark umbenannt. Durch die Ankunft der Magyaren kam es zu einem weiteren Konflikt, und unter dem Druck dieser Auseinandersetzung brach die Ostmark zusammen.
Mit dem Aufstieg des Heiligen Römischen Reiches konnte sich Österreich endlich eine Pause vom Krieg gönnen. Doch ein erneuter Konflikt sollte kurz darauf ausbrechen, diesmal war die Unstimmigkeit ideologischer Art. Die katholische Kirche, das Rückgrat des Heiligen Römischen Reiches, wurde zu einer geldgierigen, korrupten Institution, die von permanenter Vetternwirtschaft kontrolliert wurde. Viele erhoben sich gegen diese Ideale und begannen damit, die Kernpunkte des alten, bescheideneren und konservativen Christentums zu predigen. Der daraus resultierende ideologische Krieg, bekannt als Reformation und Gegenreformation, fand zwischen den Protestanten und den Katholiken statt. Die Geschichte hat jedoch gezeigt, dass auf viele ideologische Konflikte Gewalt, Unterdrückung und Ausrottung folgen. Die Reformation bildete da keine Ausnahme. Die habsburgischen Herrscher führten in ihren Territorien Krieg gegen die Lutheraner und Calvinisten. Die Reformation löste schließlich einen noch größeren Konflikt aus, den so genannten Dreißigjährigen Krieg, einen der blutigsten militärischen Konflikte in Europa mit über sieben Millionen Todesopfern. Der Krieg war jedoch nicht nur religiös motiviert, sondern bildete auch die Grundlage für einen ewigen Kampf um die Vorherrschaft in Europa zwischen den Habsburgern in Österreich und den Bourbonen in Frankreich.
Das Zeitalter der Aufklärung war eine Periode der europäischen Geschichte, die auch eine neue Art der Herrschaft versprach, nämlich die einer konstitutionellen Monarchie. Für Österreich bedeutete dies nur mehr Ärger, denn keiner der Herrscher der Aufklärung war dazu in der Lage, die Bedeutung einer neuen Verfassung zu begreifen. Festgefahren in ihren alten Gewohnheiten und getrieben von ihrem Motto „A.E.I.O.U.“ („Alles Erdreich ist Österreich untertan“ oder „Austriae est imperare orbi universo“) sowie ihrem vermeintlichen göttlichen
Herrschaftsanspruch, waren die Habsburger nicht in der Lage zu erkennen, dass die Welt ihnen Veränderungen abverlangte. Aber selbst wenn einer von ihnen dazu bereit war, Veränderungen herbeizuführen, war es für ihn alleine eine unmögliche Aufgabe. Unter dem Dach der Habsburger lebten so viele Bevölkerungsgruppen, die alle ihre eigenen Rechte und Selbstbestimmung einforderten, das politische Einigung und Veränderungen sehr komplex waren und oft nicht umgesetzt werden konnten. Die Habsburger sahen sich mit der Möglichkeit der potentiellen Auflösung ihres Reiches konfrontiert. In ihrer Verzweiflung, die Integrität Österreichs und später Österreich-Ungarns zu bewahren, ließen sich die Monarchen der Habsburger-Dynastie auf noch mehr Konflikte ein.
Schließlich wurde das multiethnische Österreich durch die Ermordung von Erzherzog Franz Ferdinand in den Ersten Weltkrieg hineingezogen. Doch das Attentat selbst war nur ein Vorwand, um einen Krieg zu beginnen, der, wie der Habsburger Kaiser hoffte, der Dynastie ihren alten Ruhm zurückbringen und Österreich wieder seinen alten Platz als europäische Großmacht sichern sollte. Doch dazu sollte es nicht kommen. Stattdessen wurden Österreich und seine Verbündeten besiegt und in wirtschaftliche Armut, Demütigung und Verzweiflung gestürzt. Die Habsburger gab es nicht mehr, und die verbliebenen Österreicher kämpften darum, ihre eigene Identität inmitten der vielen Nationen Mitteleuropas zu erhalten. Sie waren sehr lange Teil von etwas Großem gewesen, und es fiel ihnen schwer, sich mit dem kleinen Territorium zufriedenzugeben, das sie vom einst riesigen Habsburgerreich geerbt hatten. Stattdessen beschloss Österreich, sich seiner deutschen Identität gänzlich hinzugeben. Leider bedeutete dies auch, den aufkommenden Nationalsozialismus mit seinem Antisemitismus und der Ideologie der großen arischen Rasse zu akzeptieren.
Der Zweite Weltkrieg fand Österreich als willigen Teilnehmer auf der Seite Deutschlands vor. Die österreichische Geschichte war nicht länger in erster Linie österreichisch geprägt. Erst mit der völligen Niederlage des Naziregimes erhielt Österreich eine neue Chance, sich abzugrenzen und ein unabhängiger Nationalstaat zu werden. Die Österreicher bekamen endlich die Chance, ihre eigene nationale Identität aufzubauen. Sie erkannten endlich, dass diese Identität nicht nur aus einer Ethnie bestehen musste, sondern aus dem habsburgischen Erbe hervorgehen musste. Mit dieser Erkenntnis und einer klugen Finanzpolitik stieg Österreich schnell zu einem der reichsten und wohlhabendsten Länder Europas auf.
In der modernen Zeit zeigt sich Österreich konfliktscheu und bemüht sich darum, sein Militär neutral zu halten. In diesem Sinne fungiert es als der Friedenswächter Europas, ein Land, das zahlreiche Einwanderer aufnimmt, die vor Kriegen fliehen oder auf der Suche nach einem besseren Leben sind. Österreich gilt nach wie vor ein multiethnischer Mischmasch, der sich über kleinliche Konflikte hinweggesetzt und zu einer wahrhaft modernen und international respektierten Gesellschaft entwickelt hat.
Kapitel 1: Der Marsch in den Osten
Margraviat von Österrreich um circa 1000 der christlichen Zeitrechnung
https://en.wikipedia.org/wiki/Margraviate_of_Austria#/media/File:Austria_locator_map_(1000).svg
Frühe Geschichte
Die erste schriftliche Erwähnung Österreichs stammt aus dem Jahr 996 n. Chr., als es als „das östliche Land“ oder, im lokalen Deutsch, als „Ostarrichi“ bezeichnet wurde. Dieses Gebiet war damals die Ostmark des Herzogtums Bayern und damit ein Teil des deutschen Königreichs. Österreich begann seine Geschichte als Militärbezirk an der südöstlichen Grenze Deutschlands. Menschliche Siedlungen auf diesem Gebiet fanden sich jedoch schon Tausende von Jahren vor der ersten Erwähnung in schriftlichen Texten.
Das Gebiet ist gebirgig, was bedeutet, dass es zunächst nur sehr wenige Siedlungen gab. Aufgrund der geografischen Lage und seiner Unzugänglichkeit erlebte das österreichische Gebiet die eisenzeitliche Kultur, die als Hallstatt bekannt ist, erst sehr spät, um etwa 800 v. Chr. Die ersten Siedler in dieser Region waren die Illyrer, die bis 400 v. Chr. dort lebten. Die Keltenwanderung verdrängte die Illyrer, und die Stämme der Noriker und Taurisker besetzten die Region. Um 500 v. Chr. bildete sich eine Konföderation der alpinen Stämme, die Räter, die auch 200 v. Chr., als die Kelten im Osten das Königreich Noricum gründeten, in den Bergen Vorarlbergs und Tirols dominierten. Um die Jahrhundertwende wurde Noricum von Norden her von den Germanen bedrängt. Um 15 v. Chr. wurde es Teil des Römischen Reiches.
Die römische Herrschaft auf dem Gebiet des heutigen Österreichs dauerte mehr als fünfhundert Jahre. Die Römer nutzten Noricum als Stützpunkt, von dem aus sie die Besetzung Pannoniens im Osten in Angriff nahmen. Sie versuchten, die germanischen Stämme nördlich von Noricum zu erobern, hatten dabei aber nicht sehr viel Glück. Als die Römer im Jahr 9 v. Chr. im Teutoburger Wald eine katastrophale Niederlage gegen die Cherusker, ein germanisches Volk, erlitten, zogen sie sich südlich der Donau zurück und machten Noricum zum kaiserlichen Grenzgebiet. Die keltischen Siedlungen, die sich bereits in Noricum befanden, wurden zu römischen Städten: Lentia (das heutige Linz), Brigantium (Bregenz), Juvavum (Salzburg) und Vindobona (Wien). Die Hauptstadt von Pannonia Superior war Carnuntum, die in ihrer Blütezeit etwa fünfzigtausend Einwohner hatte. Heute befinden sich die Überreste dieser Stadt in Niederösterreich, aber um 50 v. Chr. war Carnuntum die Hauptfestung des europäischen Limes, der Grenzverteidigung des Römischen Reiches. Die Römer bauten ein ausgedehntes Straßennetz, um die Region mit dem Rest des Reiches zu verbinden, und sie führten den Weinbau im heutigen Österreich ein. Die Zivilisation blühte während der römischen Herrschaft auf.
Die römische Herrschaft über die Region war relativ friedlich bis zur Herrschaft von Marcus Aurelius (reg. 161-180). Er kam im Jahr 172 in die Region, um sie vor einer germanischen Invasion zu schützen. Stämme wie die Markomannen, Quadi und Naristi nördlich des Limes bedrohten das Römische Reich. Dies war das erste Mal, dass Wien Berühmtheit erlangte, denn der römische Geschichtsschreiber Aurelius Victor behauptete, dass Marcus Aurelius dort starb. Das antike Vindobona war jedoch nur ein Teil der römischen Provinz Pannonien, in der der Kaiser starb, doch sein tatsächlicher Tod ereignete sich in Wirklichkeit in einer anderen Stadt, namens Sirmium. Der Konflikt mit den germanischen Stämmen ging auch nach dem Tod des Aurelius weiter.
Als die Hunnen um 370 in Europa eintrafen, erlaubten die Römer einigen germanischen Stämmen, sich in Pannonien, auf der anderen Seite des Limes, niederzulassen. Die fliehenden Stämme erklärten sich sogar dazu bereit, in die römische Armee einzutreten und die Region zu verteidigen. Im Jahr 433 hatten die Römer Pannonien geräumt, da sie sich nicht mehr gegen Attila den Hunnen und seine Heere wehren konnten. Doch als Attila 453 starb, wurde die gesamte Region von den Goten besiedelt. Noricum wurde von dem germanischen Stamm der Rugii besetzt, die der christianisierten und romanisierten Bevölkerung befahlen, die Region zu verlassen. Die Region Rätien, die westlich von Noricum lag, wurde von der Alemannen-Konföderation germanischer Stämme übernommen. Im Jahr 493 war die römische Herrschaft über das heutige Österreich beendet. Die Ostalpen waren Teil des Ostgotenreichs von Theoderich dem Großen geworden.
Doch die Wanderung der Stämme aus dem Norden und Westen war noch nicht zu Ende. Ihr Ziel war das Donautal, und die Langobarden tauchten um 500 in der Region auf. Sie kamen aus dem Norden und Osten, wurden aber bis 567 von den Awaren und Slawen vertrieben. Die Langobarden ließen sich später in Norditalien nieder. Ein anderer germanischer Stamm, die Bayern (Bajuwaren), kam aus dem Norden und Westen. Sie waren die Vasallen der Franken, die ebenfalls in die Region eingedrungen waren. Der Kampf zwischen den Awaren und Slawen auf der einen und den Bajuwaren auf der anderen Seite begann. Sie kämpften um die Kontrolle über die Region, die eines Tages zum modernen Österreich werden sollte.
Die Awaren waren der vorherrschende Stamm, und zu Beginn des 7. Jahrhunderts kontrollierten sie ein riesiges Gebiet von der Ostseeküste bis tief in die Balkanhalbinsel hinein. Zu diesem Zeitpunkt waren die Slawen die Vasallen der Awaren, und sie wurden dazu eingesetzt, um mit den Bajuwaren um die Ostalpen zu kämpfen. Die Slawen wandten sich jedoch gegen die Awaren, als diese 626 nach Chr. versuchten, Konstantinopel zu erobern, und daran scheiterten. Die Nordslawen ernannten einen fränkischen König, Samo, zu ihrem Herrscher, während die Slawen, die in der als Karantanien bekannten Alpenregion lebten, einen bayerischen König, Odilo, als ihren Herrscher anerkannten. Den Awaren gelang es schließlich, das Reich von Samo zu erobern, doch die Karantanien blieben unter bayerischer Herrschaft. Die Bayern nahmen den Slawen und Awaren die gesamte Region des Donautals ab. In der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts zogen sich die Slawen unter dem Druck der Bajuwaren zurück und landeten schließlich auf dem Gebiet hinter der Enns.
Die Bajuwaren wurden zur dominierenden Macht in der Region, und im 7. Jahrhundert nach Chr. waren sie weitgehend sich selbst überlassen, obwohl sie offiziell als fränkische Vasallen galten. Sie drangen weiter nach Osten und Süden vor und übernahmen schließlich die Kontrolle über Karantanien. Doch im 8. Jahrhundert erinnerten sich die fränkischen Könige an die Bajuwaren und bekräftigten ihre Herrschaft über die abtrünnigen Vasallen. Karl der Große führte sein fränkisches Heer, dem sich auch die Bayern anschlossen, 791 gegen die Awaren. Es gelang dieser Koalition, die Awaren bis zu den Flüssen Fischa und Leitha, den Nebenflüssen der Donau, zurückzudrängen. Dadurch wurde ein Großteil der Region für die Besiedlung geöffnet. Von der Donau bis zur Adria legten die Franken ein Marschsystem an und schufen so eine Pufferzone. Das Gebiet war weiterhin verschiedenen Angriffen ausgesetzt, sei es durch interne Rivalitäten oder durch Invasionsversuche der Bulgaren und des Großmährischen Reiches. Am schlimmsten war jedoch der Ansturm der Magyaren, auch bekannt als die Ungarn, im 9. Jahrhundert.
Die Magyaren tauchten 862 in der Region auf, als sie aus den osteuropäischen Steppen flohen, die von mächtigeren Stämmen überrannt worden waren. Im Jahr 896 kamen die Magyaren in größerer Zahl und ließen sich auf dem Gebiet nieder, das später als ungarische Tiefebene bekannt wurde. Obwohl die Ungarn zunächst als Söldner im fränkischen Heer dienten, begannen sie damit, sich gegenseitig zu bekämpfen. Das ungarische Pferdeheer war in den ersten Jahren des Konflikts überlegen und hatte keine Mühe, die umliegenden Gebiete zu überfallen. Sie besiegten die Mährer im Jahr 906 nach Chr. und vernichteten im darauffolgenden Jahr das bayerische Heer bei Pressburg. Die von den Karolingern gegründeten Markgrafschaften brachen unter dem Druck der Ungarn zusammen, und die bayerische Grenze wurde bis zur Enns zurückverlegt. Die Ungarn terrorisierten die Region in den nächsten fünfzig Jahren, doch 955 besiegten König Otto I. und der Deutsche Bund die Ungarn, die sich den bayerischen Rebellen anschlossen.
Ottos Sieg brachte ihm Prestige und Macht, die er nutzte, um sich 962 zum römisch-deutschen Kaiser ernennen zu lassen. Eine seiner ersten Handlungen als Kaiser war die Rückgewinnung des Landes östlich der Enns, und er gründete eine neue Mark mit der vorungarischen Gesellschaft, die noch immer in dieser Region lebte. Im Jahr 976 stand Leopold I., der erste Markgraf der Babenberger, an der Spitze der Mark. Doch die Bayern gaben sich noch immer nicht zufrieden und drängten die Grenze der Mark immer weiter in den Osten entlang der Donau, bis sie 1002 das Gebiet um das heutige Wien erreichten. Zuvor, im Jahr 976, wurde Karantanien zu einem eigenständigen Herzogtum, das in das Land von Kärnten umbenannt wurde. Dort wurden ebenfalls Markgrafschaften eingerichtet, ebenso wie in Krain und der Steiermark.
Als die Region Ostarrichi im Jahr 996 erstmals namentlich erwähnt wurde, war das noch nicht der endgültige Beginn der österreichischen Geschichte. Die Region hatte bereits ein sehr komplexes Erbe mit verschiedenen Stämmen und Völkern, die das Gebiet bewohnten. Keine der Gruppen, die zuvor auf dem Gebiet des heutigen Österreichs lebten, ist wirklich verschwunden, und sie alle haben dem Gebiet ihren Stempel aufgedrückt. Die Bajuwaren waren am zahlreichsten und bildeten den Großteil der österreichischen Gesellschaft. Aber die Alemannen waren in den westlichen Regionen, in Richtung Bodensee, am zahlreichsten. Alle Deportationen, Evakuierungen und Schlächtereien, die in dieser Region stattfanden, blieben unvollständig. Die moderne österreichische Demografie spiegelt also die Geschichte des Landes wieder, mit seinen vielen germanischen, slawischen, ungarischen, keltischen und sogar römischen Spuren, die noch immer in seiner sozialen Struktur zu finden sind.
Die Babenberger
Ungarn konvertierte im Jahr 1000 nach Chr. unter der Herrschaft von König Stephan I. zum Christentum. Die Bayern drängten sich immer noch in Richtung der Ostgrenze des Reiches, aber nun hatten sie es mit einem christlichen Feind zu tun, der ihrem Handeln neue Grenzen setzte. Obwohl der deutsch-ungarische Konflikt zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendet war, wurde der Donauraum relativ stabil. Diese Stabilität ermöglichte die Entwicklung von regionalen Machtblöcken. Einer dieser Blöcke war der österreichische Block unter der Führung der Babenberger. Im Norden und Osten traf Österreich auf die nicht-germanischen, aber christlichen Königreiche Böhmen, Ungarn und Polen. Im Vergleich zu diesen großen Königreichen erschien der Markgraf von Österreich als ein unbedeutender politischer Akteur. Schließlich war er, zumindest bis 1156 nach Chr., dem Herzog von Bayern unterstellt.
Die ersten babenbergischen Markgrafen kontrollierten nur einen kleinen Teil des heutigen Österreichs. Salzburg gehörte zu Bayern und entwickelte sich zu einem kirchlichen Territorium mit einem Erzbischof heran. In Tirol blieben kleine Herrschaftstümer bis zum 12. Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung bestehen, als die Grafen schließlich die Kontrolle über das gesamte Gebiet erlangten. Vorarlberg blieb ein Feudalgebiet unter alemannischem Einfluss. Kärnten und die Steiermark im Süden und Südwesten entwickelten sich unabhängig voneinander. Im Jahr 976 nach Chr. wurde Kärnten niederländisch und blieb für die Dauer seines Bestehens eine schwindende Macht. Das Gebiet war oft von internen Konflikten geplagt, und nachdem die Ostmark auseinandergebrochen war, verlor Kärnten einen Großteil seines Territoriums. Zu den verlorenen Gebieten gehörten Krain, Istrien, Verona und Friaul. Die Steiermark war zunächst hauptsächlich von Slawen besiedelt, geriet aber bald unter die Kontrolle der Traungauer. Sie regierten von ihrer Burg in Steyr aus, die der gesamten Region den Namen Steiermark gab.
Die zweite Familie, die in diesem Gebiet an die Macht kam, war die von Ottokar, und im Jahr 1180 nach Chr. erhielt Ottokar IV. den Status eines Herzogs, was bedeutete, dass die Steiermark nicht länger Bayern unterstellt war. Doch die Unabhängigkeit währte nicht lange. Ottokar scheiterte an dem Versuch, einen Erben zu zeugen, und so wurde 1186 nach Chr. der Georgenberger Pakt unterzeichnet. Darin stimmte der schwerkranke Ottokar IV. dem Vorhaben zu, die Steiermark Herzog Leopold V. von Österreich und seinem Sohn Friedrich zu überlassen, die beide aus dem Geschlecht der Babenberger stammten. Die Babenberger übernahmen 1192 nach Chr., nach dem Tod Ottokars IV., die Herrschaft über die Steiermark.
Die Mark der Babenberger war nur eine von vielen in dieser Region. Und selbst in ihr hatte die Dynastie nicht die volle Kontrolle inne. Ein Großteil des Territoriums wurde von kirchlichen Behörden wie den Erzdiözesen Salzburg und Passau kontrolliert. Der Rest des Territoriums unterlag dem Feudalsystem und wurde daher von Adelsfamilien kontrolliert. Die Babenberger hatten nur ihr eigenes Lehnsgebiet vollständig unter ihrer Kontrolle. Sie begannen jedoch damit, ihren direkten Besitz durch Heirat, Vererbung, Abtretung und Kauf zu vergrößern. Dennoch blieben andere Adelsfamilien mächtig, und die gesamte österreichische Region war einem ständigen Machtkampf ausgesetzt. Die Babenberger versuchten, die Region durch Vereinbarungen mit anderen Familien oder durch militärische Auseinandersetzungen zu befrieden. Sie führten die Ministerialen ein, Personen, die aus der Leibeigenschaft herausgehoben und in Machtpositionen gebracht wurden. Eine davon war die Familie Kuenring. Sie waren Leibeigene der Babenberger, erhielten aber große administrative und militärische Verantwortung, weil sie sich als loyal gegenüber der Familie erwiesen. Im Laufe der Zeit entwickelten sich die Ministerialen zu einem neuen Adelsgeschlecht, das weiterhin im Dienste der Babenberger stand. Sie stellten eine potenzielle Machtquelle dar, die gegen die herzogliche Macht anderer Adelsfamilien eingesetzt werden konnte. Aber die Babenberger konnten sich ihrer rivalisierenden Adelsfamilien nicht einfach entledigen. Sie standen in gegenseitiger Abhängigkeit und mussten zusammenarbeiten, um ihre Mark gegen die sehr mächtigen Nachbarn zu verteidigen. Bis zum 13. Jahrhundert gelang es den Babenbergern jedoch, weiterhin an Macht zu gewinnen. Durch ihr unternehmerisches und diplomatisches Geschick erlangten sie die Kontrolle über Österreich und die Steiermark. Außerdem gelang es ihnen, sich durch Heirat mit der Herrscherfamilie des Heiligen Römischen Reiches, den Hohenstaufen, zu verbünden.
Die Babenberger Herzöge waren risikofreudig, aber das mussten sie auch sein. Der Erfolg der mittelalterlichen Dynastien war eine reine Lotterie, bei der nur die Mutigsten mitspielen konnten. Die besten Pläne konnten leicht durch einen plötzlichen Tod in einer Schlacht oder durch eine Krankheit vereitelt werden. Die Unvorhersehbarkeit wurde auch durch die ständigen Kämpfe der Kaiser gegen die päpstliche Macht erhöht. Diese Krise begann im Jahr 1076 nach Chr. mit dem Investiturstreit. Kirche und Staat stritten sich um die Möglichkeit, Bischöfe und Äbte zu ernennen. Das Ergebnis war ein fünfzig Jahre dauernder Krieg in Deutschland. Während dieses Konflikts wechselten die Babenberger oft die Seiten oder dienten sogar beiden Seiten gleichzeitig, je nachdem, was für sie von Vorteil war. Zwei der babenbergischen Markgrafen erwiesen sich als herausragende Akteure im kaiserlich-päpstlichen Konflikt. Leopold III. (1073-1136 nach Chr.) wurde Markgraf, nachdem sein Vater, Leopold II., vom römischen Kaiser Heinrich IV. wegen seiner Opposition gegen die kaiserliche Macht vorübergehend abgesetzt worden war. Er unterstützte den Aufstand von Heinrich V., dem Sohn Heinrichs IV., und wurde für seine Verdienste zum Heiligen erklärt. Gleichzeitig war er auch beim Kaiser beliebt und gewann die Hand der Schwester Heinrichs V., Agnes von Waiblingen. Diese Heirat steigerte das Ansehen der Babenberger erheblich, belastete aber auch das Engagement der Familie in dem Konflikt. Nach der Heirat musste sich Leopold III. aus der kaiserlichen Politik zurückziehen, arbeitete aber weiterhin an der Befriedung des österreichischen Adels.
Leopold VI. (1176-1230 nach Chr.) verfolgte ein ähnliches politisches Muster wie sein Vorgänger Leopold III. Er unterstützte seine Verwandten, die regierenden Hohenstaufen, blieb aber auch ein Förderer der Kirche und gründete verschiedene Klöster in ganz Österreich. Darüber hinaus beteiligte er sich an den Kreuzzügen im Nahen Osten und in Westeuropa (gegen die Muslime in Spanien). Außerdem verheiratete er seine Tochter mit dem Sohn von Kaiser Friedrich II, Heinrich VII. Im Jahr 1230, kurz vor seinem Tod, vermittelte Leopold VI. eine Einigung im kaiserlich-päpstlichen Konflikt. Österreich war zu dieser Zeit bereits ein Herzogtum, und Leopold VI. verstärkte seine Kontrolle über das Land, indem er mehrere Städte wie Linz, Freistadt und Wels aufkaufte.