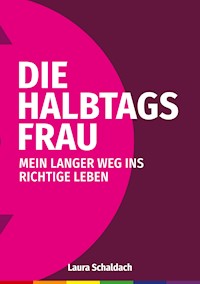
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Buch handelt davon, -wie mein Leben damals, 1956, war, als ich geboren wurde und danach, -wie wir als Familie gelebt haben in unserem Siedlungshaus in Weiß, mit den Eltern meines Vaters, der Mutter meiner Mutter, mit Vater und Mutter und uns vier Jungen, -wie wir in der Nachkriegs- und Wiederaufbauzeit gelebt haben, -wie das Leben unter uns Kindern in den beengten Verhältnissen und mit den aus heutiger Sicht schwer traumatisierten Eltern und Großeltern so ablief, -was mit mir los war, warum ich nicht wie die anderen war und warum ich nicht wusste, wo ich hingehöre und wer und was ich bin. Ich schreibe darüber, -wie ich es geschafft habe, fast 60 Jahre meines Lebens zu kämpfen -immer gegen den gleichen Gegner - mich selbst, -was ich einerseits alles unternommen habe, um anderen gegenüber männlich zu erscheinen und -wie ich anderseits teils gefährliche Wagnisse eingegangen bin, um mich selbst zu täuschen - bis ich nach einer gescheiterten Ehe endlich die Frau getroffen habe, die mir geholfen hat. Ich nehme meine Leserinnen und Leser auf einen langen Lebensabschnitt mit vielen Höhen und Tiefen, intimen Details sowie vielen Ängsten und Unsicherheiten mit. Diesmal mit einer starken Partnerin an der Seite Es ist das Buch von einem Jungen im späten Nachkriegsdeutschland, der weiß, dass er eigentlich ein Mädchen ist. Informativ, traurig aber auch voller lustiger Anekdoten erwartet die Leserin und Leser die Geschichte eines spannenden Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist der für mich tollsten Frau der Welt, meiner Ehefrau Gisela, gewidmet.
Ich wünsche dir, dass du jeden Tag vom Morgen bis zum Abend fröhlich bist. Mögest du immer Glück haben und ein Lied in deinem Herzen.
(Aus dem Buch „Mit irischen Segenswünschen durch das Jahr“ Von Liane Frank und Reinhold Schönemund)
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Geburt, Wohnverhältnisse und Familienmitglieder
Erinnerungen an meine Kindheit und Jugend
Geschichte aus der Kindheit – Weihnachten bei uns zu Hause
Geschwister untereinander und in Beziehung zu Eltern und Großeltern
Meine Schulzeit
Meine Aufgaben und Arbeiten in der Familie
Berufliches
Letzter Versuch – Nepal
Halbtagsfrau
Schlusswort
Danksagung
Einleitung
Dies ist mein zweites Leben.
Das Erste dauerte viel zu lange. Nicht die schöne Zeit mit meiner jetzigen Ehefrau, sondern die Zeit, in der ich nicht wusste, wer ich bin und was ich bin.
Die Zeit des Zweifelns und der Traurigkeit einerseits sowie der Euphorie andererseits. Dem gegenüber die Zeit der neidischen Blicke meinerseits, auf das was ich sein wollte und nicht konnte.
Dann auch die Zeit der Suche, der Suche nach Endgültigkeit meines Ichs und der Fall in die Endlosigkeit zerstörter Träume. Aber auch eine Zeit des Schaffens, um mir selbst etwas zu beweisen, was ich aber nicht war.
Nun also mein zweites Leben, von dem ich hoffe, dass es wenigstens so lange dauert wie das erste. Mit ihm hat mein endgültiges Glück begonnen. Das Glück, von dem ich immer wusste, dass es für mich bestimmt, aber ewig lange nicht erreichbar war.
Aber jetzt der Reihe nach das, was mir in Erinnerung geblieben ist als drittgeborenem Jungen der Familie.
Nichts deutete darauf hin, dass der Schein trog.
Geburt, Wohnverhältnisse und Familienmitglieder
Geboren wurde ich im Juli 1956 und es macht mich ganz schön stolz, dass das in Köln, im Severinsviertel, in der Alteburger Straße war. In dem Gebäude ist heute eine Tagesklinik untergebracht, damals war es eine Geburtsklinik und mein Jahrgang war ganz schön stark. Neun Tage später wurde ich, genau kann ich das natürlich nicht wissen, entweder in der Ev. Kartäuserkirche getauft, die fast um die Ecke steht, oder, was eher zutrifft, in der Krankenhauskapelle durch den Pfarrer der Kartäuserkirche. Da meine Eltern kein Geld für eine große Tauffeier hatten, wurde alles im kleinen Rahmen abgehalten. Anwesend waren wahrscheinlich außer meinen Eltern noch die Patinnen, eine Lehrerin aus Bad Zwischenahn aus der Verwandtschaft meiner Mutter und die Tochter eines Kollegen meines Vaters.
Mein Vater, geboren in Scharpau im Kreis Danzig, war nach Krieg und Gefangenschaft in Russland über Faßberg nach Köln gekommen, wo er in den Polizeidienst eintrat. Im Jahr 1950 heiratete er meine Mutter, die mit ihrer Mutter aus Ortelsburg in Ostpreußen geflüchtet und zuerst in der damaligen Ostzone gestrandet war. Das war nach sicherlich nur sehr kurzem Kennenlernen passiert. Zum Zeitpunkt meiner Geburt war mein Vater 37 Jahre alt und wie meine alte Geburtsurkunde aussagte, war er Polizei-Hauptwachtmeister. Meine Mutter, die 1928 in Kobulten/Ostpreußen geboren wurde, war damals 28 Jahre alt.
Im Jahr 1956 gab es schon meinen ältesten Bruder, der 1951 und einen Bruder, der 1954 geboren wurde. Der vierte Sohn wurde ca. drei Jahre nach mir, 1959, geboren. Danach haben meine Eltern wohl aufgehört, weil, wie sie später erzählten, das gewünschte Mädchen schon vier Mal vorher nicht gelingen wollte.
Meine Eltern hatten 1954 ein neu erbautes Siedlungshaus in der bis 1974 selbständigen Gemeinde Rodenkirchen am Rande von Köln, im Dörfchen Weiß, erworben. Weiß sah damals so aus, wie man sich einen weißen Fleck auf der Landkarte vorstellt. In unserem Ortsteil gab es nur einige Siedlungen, sonst nichts. Man konnte unendlich weit sehen. Die Straßen waren, bis auf die Hauptstraße, Feldwege, was ja gar nicht schlimm war, denn Autos gab es kaum. Im eigentlichen Dorf gab es dann schon mehr Häuser und teils bessere Straßen.
Seit dem Jahr 1927 gab es schon eine Buslinie die von Rodenkirchen über Weiß nach Sürth von einem privaten Unternehmen, den Gebrüdern Pütz, betrieben wurde.
Heute ist Weiß ein Stadtteil von Köln und dicht bebaut. Einige lokale Prominente aus Sport und Musik haben sich den Ort sogar als Wohnort ausgewählt.
Bei dem damaligen Gehalt meines Vaters war der Kauf eines Hauses für meine Eltern sicherlich sehr mutig. Meine Mutter war ja nicht berufstätig, so wie die meisten Frauen in dieser Zeit.
Die gefundene Gehaltsaufstellung vom März 1953, abgedruckt auf der nächsten Seite, besagt Folgendes:
Bruttogehalt
341,00 DM
Netto
276,67 DM
Abzüglich: (?)
6,00 DM
Notopfer Berlin
1,35 DM
Beamtenbund
3,25 DM
Straßenbahn
5,20 DM
Kartoffeln für die Saat
20,00 DM
Vorschuss
18,00 DM
Abschnitt Polizei (?)
10,00 DM
Polizeisportverein
0,30 DM
Kirche
0,60 DM
Gesamtabzug
64,70 DM
Restbetrag
211,97 DM
Unser Haus war ein typisches Siedlungshaus von 1954 in einer Reihe mit sieben weiteren gleichartig gebauten, 1 1/2-stöckigen, Häusern mit Stallungen und viel Land. Vor dem riesigen Grundstück und zum Dorf hin, wie oben erwähnt, nur weite Felder und ein viele Kilometer weites Sichtfeld. Rechts davon noch einmal eine ähnliche Siedlung und auch dahinter nichts. Die meisten der Häuser waren von Vertriebenen gekauft worden, also Menschen aus den ehemals deutschen Gebieten Ostpreußen, Schlesien und aus dem Sudetenland. Irgendwie hatten die, im Gegensatz zu den Einheimischen, deutlich mehr Risikobereitschaft. Die konnten ja eigentlich auch nicht mehr verlieren, als sie sowieso schon verloren hatten. Die meisten Siedler mussten, ebenso wie meine Großeltern, alles stehen und liegen lassen, um vor den anrückenden Russen flüchten zu können. Aber hier in Weiß, heute Köln-Weiß, zählte das erlittene Leid nicht mehr so viel, denn es ging um den Neuaufbau, um eine neue Existenz in neuer Umgebung. Dafür hielt man hier aber auch mehr zusammen und man kannte sich gut in der Nachbarschaft. Das eigentliche, „gewachsene“ Dorf befand sich in Richtung Süden direkt am Rhein, der einen großen Bogen um unser Dorf machte. Direkt im Rheinbogen gab es viel Wald. Die vielen kleinen Häuser des Dorfes zeugten von der Zeit als im Dorf noch Fischer und „kleine“ Handwerker lebten. Die hatten nicht so viel Geld, um größer zu bauen, oder wohnten in Häusern, die schon lange zur Familie gehörten und zu der Zeit baute man so. Jedenfalls waren etliche Häuser auch ganz schön alt. Für uns waren das immer die Hexenhäuschen, dazwischen waren aber auch schon Neubauten im damaligen Stil.
Durch die „ausgelagerten“ Siedlungen bestand anfangs nicht viel Kontakt mit den „Einheimischen“. Das war auch so mit Freundschaften unter uns Kindern, zumal die „Dörfler“ hauptsächlich katholisch waren. Die Zugewanderten aus dem Osten, die man hier auch Pimocken nannte, waren aber hauptsächlich evangelisch.
Im Dorf stand eine kleine Schifferkapelle, damals noch eine Ruine, und eine 1954 erbaute, katholische Kirche mit Kindergarten. Wegen der wenigen Evangelischen gab es weit und breit auch keine evangelische Kirche. Dafür gab es aber den Tischler Wildenberg, der gleichzeitig Bestatter war, auf der Weißer Hauptstraße, einen kleinen Schuhmacherladen, unseren Friseur Müller gegenüber dem Konsum, zwei Bäckereien, einen Metzger und das kleine Fahrradgeschäft Berg, welches auch einige, kleine Spielwaren anbot. An dessen Schaufenster blieben wir Kinder deswegen sehr häufig stehen und schauten sehnsüchtig auf die für uns nicht erschwinglichen Waren. Später kam noch das Farbengeschäft Pick in der Sackgasse am Rhein hinzu und es eröffnete ein Lebensmittelladen an der Ecke Weidengasse. Heute gibt es trotz der vielen Einwohner kein Lebensmittelgeschäft und auch keinen Metzger mehr. Damals bekamen wir Kinder beim Metzger Auf der Ruhr immer eine Extrascheibe Fleischwurst, die wir gerne annahmen und sofort verzehrten. Natürlich gab es auch einige Bauern mit vielen Ackerflächen und einen Obstbauern. Sogar eine Bootswerft war da. Direkt am Rhein, wo auch sonst. Dort führten zwei dicke Schienen vom Werftgebäude aus ins Wasser des Rheins, auf denen wir Kinder häufig balancierten. Kurz vor der Kreuzung Weißer Hauptstraße und Heinrichstraße stand auch mal eine Gasolin-Tankstelle und um die Ecke auf der Heinrichstraße war kurz vor dem Bauernhof ein kleines Haushaltswarengeschäft in einem Wohnhaus. Ich glaube die ältere Dame hieß Läser. Auf der Ruhr stand noch die bekannte Gaststätte Keil mit dem großen Saal für Veranstaltungen.
In unserem Siedlungsgebiet gab es nichts, beziehungsweise doch, es gab da einen kleinen Lebensmittelladen in einem Wohnhaus. Meine Mutter erzählte noch lange davon, dass sie für den Inhaber oftmals die Beträge selbst zusammenrechnen musste. Kopfrechnen war wohl nicht seine Stärke oder meine Mutter konnte einfach schneller rechnen. Es gab eben noch nicht überall Registrierkassen und überhaupt noch keine, auf denen das Wechselgeld gleich mit angegeben wurde. Wenn wir aber „richtig“ einkaufen wollten, mussten wir immer nach Rodenkirchen fahren. Das war dann auch der Hauptort der Gemeinde Rodenkirchen mit den vielen Ortsteilen, zu denen auch unser Dorf gehörte. Da gab es dann auch größere und mehr Geschäfte, auch Ärzte sowie unsere evangelische Kirche, später auch ein großes Ärztehaus mit der Kreissparkasse im Untergeschoss.
Ärzte gab es bei uns im Dorf keine. Unser Hausarzt wohnte in Sürth, dem Nachbarort am Rhein. Heute steht auf diesem Gelände ein Supermarkt. Der Arzt machte regelmäßig Hausbesuche mit seinem alten Mercedes. Viele Autos gab es ja noch nicht, sodass wir direkt sahen, wenn der Arzt vorfuhr, um nach den Großeltern oder uns Kindern zu sehen. Natürlich hatten auch wir damals kein Auto, geschweige denn ein Telefon. Mein Vater fuhr auf seinem Panther-Rad über die spärlich ausgebaute Weißer Straße bis Rodenkirchen, denn Fahrrad- oder Gehwege gab es noch nicht. Dort war die Straßenbahnendhaltestelle der Linie 16 nach Köln, wo mein Vater, als Polizeibeamter, seinen Dienst im Eigelsteinviertel leistete. Sein Fahrrad stellte er immer im Keller der Ev. Volksschule in Rodenkirchen ab und fuhr mit der Bahn zur Dienststelle nach Köln. Das war bestimmt nicht einfach, besonders, weil mein Vater im Schichtdienst arbeiten musste und zu manchen Zeiten fuhr die einzige Bahn sicher nur sehr selten.
Unser Haus befand sich, wie erwähnt, auf einer riesigen Fläche und zählte als landwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetrieb. Dazu hatten wir noch ein Stück Weideland tief im nahen Wald, direkt am Rhein, gepachtet, um genug Futter für unsere Tiere mähen zu können. Tiere hatten wir ganz viele. Das waren Schafe, Hühner und Gänse, später Ziegen und noch später auch Kaninchen.
Zum Haus führte ein langer Weg. Das Haus war etwas erhöht gebaut worden, weil das Gartenland zur Weißer Straße etwas abfiel. Der Eingang zum Haus befand sich an der Seite in einem Vorbau – rechts im Vorbau, 2 Stufen hoch, war die Eingangstür, geradeaus die Waschküche und links ging es in die Stallungen.
Das Haupthaus hatte im unterkellerten Erdgeschoss hinter der Haustüre ein hohes, helles Treppenhaus mit der hölzernen Treppe zur ersten Etage und hinter der Kellertüre einen betonierten Abgang zum Keller. Ich weiß nicht, wie oft wir als Kinder von oben auf dem Geländer heruntergerutscht sind. Das war nur ein kurzer Rutsch, weil die Treppe einen scharfen Bogen machte. Deshalb musste man das Vergnügen eben öfters wiederholen. Dann war da im Hausflur links noch die Tür ins Badezimmer. Dieses war ausgestattet mit einer weiß-emaillierten Badewanne, einem Kohlebadeofen, den man zum Baden lange vorheizen musste, einem Waschbecken und dem WC. Wenn ich mich recht erinnere, gab es im Bad gestrichene Wände. Jahre später ließen meine Eltern vom Sohn eines Arbeitskollegen meines Vaters einfache, dunkelgrüne Fliesen türhoch verlegen. Die Toilette war noch mit einem Druckabspülhebel ausgestattet und es gab nur kaltes Wasser aus dem Wasserhahn des Waschbeckens. Nach Jahren wurde eine Steckdose verlegt und ein Boiler unter dem Waschbecken eingebaut, der das Wasser elektrisch erhitzte. Ein höher gelegenes, kleines Fenster sorgte für Helligkeit und Belüftung.
Hinter dem Treppenhaus kam man durch eine Türe in den schmalen Flur. In allen Zimmertüren der Flure befanden sich im oberen Teil der Türen drei kleine Fensterscheiben, damit in den Flur etwas Helligkeit aus den angrenzenden Zimmern fiel. Wenn man da hindurch in den Flur kam war links im Flur die Küche. Diese war der Lebensmittelpunkt unserer Familie. Hierin gab es einen niedrigen Geschirr- und Vorratsschrank, dessen obere Türen mit einem Glaseinsatz versehen waren, einen großen Ausziehtisch und einen Kohleherd zum Kochen. Der Herd wurde mit Holz und Briketts befeuert und das lange Ofenrohr heizte den Raum, leider auch im Sommer, stark auf. Als Kinder haben wir in den Backofenteil, der sich hinter einer Klappe des Herdes verbarg und immer mit erwärmt wurde, Äpfel hineingelegt. Nach längerer Garzeit konnten wir sie als Bratäpfel verzehren – das war mit Zimt und Zucker ein Genuss, denn Süßigkeiten gab es für uns kaum. Dafür gab es bei uns immer Obst von unseren Bäumen. Unsere Boskop-Äpfel wurden immer in Holzkisten gelegt, die mit Zeitung ausgeschlagen waren. Diese Kisten stapelten wir im Keller, um auch im Winter Äpfel essen zu können. Gegenüber der Küche befand sich das kleine Kinderzimmer, welches wir lange zu dritt bewohnten.
Geradeaus kam man in das Wohnzimmer, rechts darin befand sich noch die Tür zum Schlafzimmer. Wie damals üblich, waren die Räume nicht besonders groß, reichten jedoch für die Familie, als wir Kinder noch klein waren. Selbst wenn Besuch da war gab es kein Platzproblem. Alle Räumlichkeiten unten waren von draußen mit schweren Fensterläden ausgestattet, die man nach dem Aufklappen links und rechts am Haus mit einem Halter festmachte. Im Winter bildeten sich in den Räumen die nicht beheizt waren und im Treppenhaus immer Eisblumen auf der Einscheibenverglasung. Mit einem warmen Finger drückten wir manchmal Löcher in die schönen Eisgebilde oder hauchten die Scheiben an, um sie wieder zu vereisen.
Im Obergeschoss befand sich eine kleine Kammer im Bereich des Hausflures. Dann war da die Flurtüre. Dahinter gelangte man links in das obere WC, das zu der Wohnung meiner Großeltern gehörte. Die Eltern meines Vaters waren ehemals Bauern aus der Danziger Gegend. Rechter Hand kam man in das kleine Zimmer meiner Großmutter mütterlicherseits. Alle Räume oben hatten auf einer Seite eine Dachschräge. Die Eltern meines Vaters bewohnten geradeaus im oberen Korridor eine 2-Zimmer-Wohnung mit zwei großen Fenstern auf der Giebelseite und einer Kochnische in der Dachschräge. Weil ihr Zimmer so klein war hielt sich meine andere Großmutter, unsere Oma Winkler, auch meist unten bei uns auf, wo sie auch viel im Haushalt und Garten half und meiner Mutter damit die viele Arbeit erleichterte. Im Treppenhaus des Obergeschosses gab es ja die erwähnte, kleine Kammer, die zeitweise als Schlafraum und später als Vorratsraum genutzt wurde.
Vorrat war für meine Eltern immer eine wichtige Angelegenheit. Beide Elternteile hatten Furchtbares durchgemacht. Mein Vater mit Kriegsteilnahme und russischer Gefangenschaft, wo ganz viele Gefangene an Erschöpfung und durch Hunger starben. Meine Mutter hatte durch Flucht und großen Mangel in Ostdeutschland - damals russische Besatzungszone - gelitten. Das sollte meinen Eltern so nicht mehr passieren. Unsere Vorratshaltung war dann nicht nur auf die unten im Keller gelagerten, eingemachten Lebensmittel beschränkt, sondern wir hatten kartonweise Vorräte an Knäckebrot, Nudeln Dosenmilch, Mehl, Zucker und Konserven. Dazu gab es Kerzen, falls der Strom ausfallen würde. So war die Überbrückung einer Notlage für eine gewisse Zeit gesichert. Irgendwann kam dann noch eine Gefriertruhe für Fleisch und Früchte, die dann nicht mehr in Gläsern aufwendig eingekocht werden mussten, dazu.
Diese Einstellung, man muss richtigerweise sicher sagen, dieses Trauma meiner Eltern, hat auch mich noch als erwachsenen Menschen geprägt und auch ich sorgte für reichlich Vorräte im Haushalt, was natürlich auch den Betrieb einer Gefriertruhe einbezog.
Vom Obergeschoss führte noch eine steile Einschubleiter auf unseren Spitzboden, der auch als Abstellraum genutzt wurde. Dort musste man beim Betreten aber immer auf den teilweise aufgenagelten Brettern laufen. Wenn man daneben trat, fiel man mit dem Fuß durch die Obergeschossdecke.
Auch unsere Kellerräume, von denen einer den Großeltern zugeordnet war, wurden dringend gebraucht. Da gab es die eingemachten Vorräte, für die meine Mutter und unsere Oma Winkler im Sommer sorgten. Beide Frauen waren immer sehr fleißig. In einem Keller hatten wir sogar einen Eisschrank mit einer dicken Tür und einem Fach für Trockeneis - den habe ich aber nie in Betrieb erlebt. Auch eine Räucherkammer mit einer Blechtüre, worin Fleisch haltbar gemacht werden konnte, befand sich in diesem Keller. Nach 1963 lagerte mein Vater darin seinen aus Johannisbeeren oder Kirschen selbst gemachten Wein, von dem ich noch heute eine Flasche hege und pflege. Und natürlich mussten die Kohlen für unsere Öfen auch im Keller gelagert werden. Ich kann mich daran erinnern, dass ich im jugendlichen Alter, mit Geschwistern und unserer Oma die Kohlen aufstapelte.
Diese ließ der „Kohlenmann“ Sack für Sack, über eine Rutsche in den Keller rutschen. Dazu mussten wir uns unten im Keller schnell Platz schaffen, um die Kohlen ordentlich zu stapeln, denn ansonsten fielen die überall hin und wir konnten den Grundstock nicht aufbauen. Unsere Oma band sich dazu immer ein dickes Kopftuch um, damit die Haare nicht allzu schwarz wurden. Der ganze Raum war erfüllt mit dichtem Staub, den man bei einfallendem Sonnenschein sehr gut sehen konnte. Aber auch das Kopftuch schaffte es nicht, den feinen Staub zurückzuhalten. Natürlich trugen wir auch keinen Mundschutz. Wenn wir nach getaner Arbeit aus dem Keller kamen, sahen wir schlimmer aus als die Schornsteinfeger – überall waren wir schwarz. Hände und Gesicht konnte man sich mit etwas Mühe schon vom Staub befreien, aber zur richtigen Reinigung gab es nur eines – ein Vollbad mit viel Sunlicht - Kernseife, die meine Eltern immer in großen blau-gelben Packungen, auch auf Vorrat, kauften. Mit der Kernseife wurden natürlich auch unsere Haare und das Gesicht gewaschen. Haarwaschmittel war uns fremd. Das Brennen in den Augen von der Seife war für uns Kinder immer schrecklich und manchmal auch zum Weinen. Wenn man nach dem Bad noch lange genug den schwarzen Schleim aus der Nase schnaubte und frische Bekleidung anzog, fühlte man sich aber wieder wie neu.
Im Anbau an das Haus befand sich die erwähnte Waschküche mit einem großen beheizbaren Bottich für Kochwäsche und später einer halbautomatischen Waschmaschine. Der Spülgang erfolgte in großen Zinkwannen, die mit Wasser befüllt werden mussten. Es war wirklich eine schwere Arbeit, die triefend nasse, heiße Wäsche aus dem Bottich in die Wanne zu hieven und klarzuspülen. Im Anbau gab es dann noch die Ställe für Schafe, Gänse und Hühner. Nachdem wir keine Hühner, Gänse und Schafe mehr hatten, hielten wir uns eine Ziege namens Susi, die später ein kleines Ziegenkitz mit dem Namen Leni bekam. Wir hatten auch immer einige Katzen gegen die Mäuse. Über dem Stall befand sich der Heuboden, der von außen per Leiter erreichbar war. Ich kann mich erinnern, dass ein Bauer mit Traktor und Wagen das Stroh bis ans Tor brachte, was dann mit der Schubkarre ans Haus gefahren und mit einer Forke auf den Heuboden gehievt werden musste. Heu machten wir im Sommer selber. Dafür wurde Klee auf unserem Land angebaut und auch die Wiese des Pachtgrundstückes am Rhein dafür genutzt. Mit der Sense wurde dann das Grün gemäht und mehrfach gewendet, bevor es getrocknet auf den Heuboden gebracht wurde. Den aromatischen Duft von frischem Heu habe ich heute noch in der Nase.
Bewacht wurde unser ganzes Grundstück von unserem Schäferhund, Astor. Wenn die schwarzen Johannisbeeren auf den Sträuchern pflückreif waren, fraß Astor diese oft direkt vom Strauch. Heruntergefallene Beeren ignorierte er. Auf Astor folgte noch eine Hündin aus dem Tierheim die Nixe genannt wurde und dann deren Nachwuchs, ein Mischlingsrüde mit dem Namen Nero.
Im großen Vorgarten gab es eine Wiese und bis auf den Gehweg rundherum Blumenrabatten, aber auch Büsche, die im Sommer schön blühten. Eine Birke, eine Edeltanne und ein Kirschbaum mit Süßkirchen waren die größten Bäume im Vorgarten. Um die unbefestigten Gartenwege, die zum Wochenende fast zeremoniell immer fein geharkt wurden und um ein kleines, rundes Beet am Kirschbaum kümmerte sich meist unser Opa. Er pflegte besonders sein rundes Beet unter dem Kirschbaum, bestückt mit kleinblütigen, blauen Bodendeckern und Rosen, intensiv. An der Seite wuchs saurer Rhabarber, den wir Kinder oft roh mit Zucker aßen.
Für uns Kinder waren die Wohnverhältnisse oft sehr beengt. Ich kann mich daran erinnern, dass wir zu dritt im kleinen Kinderzimmer gegenüber der Küche schliefen. Ein Raum von ca. 12 qm. Als 1965 mein Großvater starb, wurde die große Wohnung meiner Großeltern verkleinert. Damit erhielt meine Großmutter mütterlicherseits endlich ein größeres Zimmer zur Giebelseite mit mehr Lichteinfall. Im Zimmer hatte meine Oma eine Couch, einen Tisch, einen Schrank und das Schrankbett, worauf sie selbst schlief, während ich eine Weile bei ihr auf der Couch nächtigte.
Als wir dann keine Ziegen und anderes Vieh mehr hatten, wurde der größere Stall zu einem Zimmer umgebaut. Dort schlief dann mein ältester Bruder und später auch ich mit ihm. Ich kann mich daran erinnern, dass mein Bruder, der ja viele Jahre älter war als ich, eines Morgens gegen 3.00 Uhr seinen alten Fernseher angemacht hat, um Cassius Clay boxen zu sehen. Clay gewann 1964 seinen WM-Titel. Der Rückkampf 1965 endete ja bereits nach 105 Sekunden. Clay, oder Ali, wie er sich später nannte, war auch der Schwarze, der 1967 seinen Weltmeistertitel aberkannt bekommen hatte. Er weigerte sich, den Wehrdienst in Vietnam abzuleisten. Dafür nannte er seinen Glauben und die Ungleichbehandlung der Afroamerikaner in Amerika. Seine Gefängnisstrafe dafür brauchte er nur nicht anzutreten, weil er eine Kaution zahlen konnte.
So richtige Privatsphäre war bei uns beiden Brüdern aber auch nicht vorhanden und wegen des Altersunterschiedes waren wir auch nicht sehr eng miteinander. Dafür hatte ich aber auch etwas zu viel Respekt ihm gegenüber gehabt, denn er besuchte schon eine Realschule und hatte dadurch andere Freunde, bei denen er sich oft aufhielt. Natürlich gab es auch andere Interessensgebiete.
Meine nächste Station war dann der Vorraum zu diesem ehemaligen Stall und dann Zimmer meines Bruders und mir. Bis dahin war dieser schmale, längliche Raum als Lager- und Wirtschaftsraum genutzt worden. Hier konnte ich dann endlich und zum ersten Mal „ein wenig eigene Luft atmen“, auch wenn es sich um das Durchgangszimmer meines Bruders handelte, wodurch er in sein jetzt alleiniges Zimmer gehen musste. Wenn mein Bruder abends noch nicht zu Hause war, durfte ich meine Türe nicht abschließen, denn ich lag ja im Durchgangszimmer. Das Zimmer war mit höchstens 8 qm auch sehr klein. Ich hatte aber einen Schrank, ein Bett und sogar einen kleinen, abschließbaren Schreibtisch, den ich aber auch für meine Schulaufgaben brauchte. Vorher musste ich die in der Küche machen, was viel Ablenkung bedeutete.
Im Winter heizte ich meinen Raum mit einem kleinen Kohleofen, wobei ich abends dafür sorgen musste, dass die Glut der Kohlen sich bis zum Morgen hielt. Dann war es ganz einfach, das Feuer mit einer weiteren Kohle morgens wieder in Gang zu bringen, ich brauchte so kein neues Feuer mit Holz und Papier entfachen und es einbrennen lassen. Wichtig war aber auch, die Asche mit einem Rüttler des Ofens, welcher den runden Rost in Bewegung setzte, in den Aschebehälter zu schütteln. Dann bekam das Feuer mehr Luft und die Asche musste ich dann zur damals noch eisernen Tonne bringen. Bei den heutigen Plastiktonnen wäre das nicht möglich gewesen, das würde diese Tonnen zum Schmelzen bringen. Das Einheizen im Winter war dann auch eine Aufgabe vor der Schule, damit ich es beim Heimkommen schön warm hatte. Wenn es draußen auf den Wegen Eis oder Schnee gab, wurde die Asche nicht in die Tonne geschüttet, sondern zum Abstumpfen der Gehwege verstreut damit kein Passant auf unserem Stück an der Straße zu Schaden kam.
Als ich 14 oder 15 Jahre alt war, half ich meinem Vater, einen Raum auf unserem Speicher zu meinem neuen Zimmer auszubauen. Dazu trennten wir mit einer Rigipswand vom Speicher ein Stück ab, so dass im hinteren Teil des Speichers ein Raum für mich entstand. Um zu diesem zu gelangen, musste ich über die schmale Leiter hoch und durch den Abstellraum im vorderen Teil des Speichers gehen. Dünne Glaswolle und dünne braune Pappe waren die minimale Isolierung gegen die Kälte unter den Dachpfannen und im Sommer war es manchmal ganz schön heiß in meinem Dachzimmer. Dafür hatte ich wirklich mein eigenes Reich mit abschließbarer Tür. Zwei kleine Dachschrägenluken brachten mir etwas Licht in mein Zimmer und in der Giebelwand gab es drei runde Belüftungslöcher die ich notdürftig mit Papier verstopfte, um Wind und Kälte zurückzuhalten. Bei Bedarf und Neugierde konnte ich diese Papierstopfen aber entfernen und hindurchsehen und so heimlich feststellen, was auf der Straße los war. Von meinem Mobiliar von unten nahm ich alles außer dem Schrank mit, denn der passte nicht in den Spitzbodenraum. In der Dachschräge hatten wir dafür Schränke, grob mit Kanthölzern, Holzlatten und Tischlerplatten selbst gezimmert. Ich habe später noch einmal ein abschließbares Fach darin installiert, so dass meine „geheimen Sachen“ und Ersparnisse gegen Unbefugte geschützt waren. Weil der Schrank senkrecht in die rechte Schräge gebaut worden war, befand sich dahinter noch ein Hohlraum von ca. 80 cm Breite, wo ich später, um mehr Platz zu haben, meine Matratze hineinschob. Wenn einer das nicht wusste, hätte er mich nie gefunden. In diesem gemütlichen Hohlraum war ich nahezu „unsichtbar“. Oben hatte ich aber auch einen Elektroofen und damit war das Problem Beheizung wesentlich komfortabler. Einziger Negativ- und zugleich Positivpunkt war die steile Bodeneinschubtreppe zu meinem Spitzboden. Das war ja mehr eine Leiter und die knarrte ordentlich beim Betreten. Wenn ich später nach Hause kam, musste ich schon sehr behutsam hochsteigen, um meine Eltern, die nach dem Tod meiner Großmutter ihr Schlafzimmer nach oben verlegt hatten, nicht aufzuwecken. Auch ein Alkoholrausch oder nur ein einfaches Stolpern wäre fatal gewesen, denn neben der Treppe ging es direkt steil nach unten in den Hausflur. Ich fand die Zeit unter der Dachspitze aber immer sehr schön und wegen der steilen Treppe kam selten mal jemand herauf. Ich brachte oben einen Summer an, der von unten bedient werden konnte. Über diesen Summer wurde ich dann immer gerufen, wenn etwas anstand oder das Essen fertig war. Das war auch überaus von Vorteil, als ich meine erste Freundin, welche später meine erste Ehefrau wurde, kennenlernte. Da wir da oben meist ungestört waren und, wie erwähnt, auch die Türe abzuschließen war, konnte es passieren, dass wir uns, wenn meine Mutter zum Kaffee rief – wir trafen uns anfangs meist sonntags bei mir – wegen des „Spielens“ schnell wieder richtig ankleiden mussten. Einmal, das war uns sehr peinlich, hatte meine Freundin sich die Bluse falsch zugeknöpft. Meine Eltern merkten das jedoch nicht oder wollten es nicht merken, aber es reichte ja schon, dass wir das selbst bemerkten, und so war es uns schon sehr peinlich. Wenn es abends mal später wurde, rief meine Mutter schon mal hoch, dass es Zeit wird, meine Freundin nach Hause zu bringen.
Es gab aber auch mal eine Zeit, in der ich erheblichen Streit mit meinen Eltern hatte, weil meine Freundin ihrer Meinung nach zu oft bei uns war. Dann ging ich dem einfach aus dem Wege, verkroch mich in meinem Zimmer und drehte die Musik so richtig auf, um meinen Frust aller Welt kundzutun. Die Musik aufdrehen konnte ich aber auch ohne Grund, wenn ich gut gelaunt war. Dann sang ich die alten Schlager, deren Texte ich fast alle kannte, auch gerne mal lautstark mit.
Ich weiß nicht, ob sich meine Eltern irgendwann mal Sorgen um unsere Verhütung gemacht hatten, zumindest war ich ja „aufgeklärt“ worden. Nicht von meinen Eltern, denn diese umgingen das Thema stets großräumig und waren froh, als ich im achten oder neunten Schuljahr einen Zettel mit einer Einwilligungserklärung mit nach Hause brachte. Da ging es um die Einwilligung von den Eltern, damit man uns in der Schule Sexualkundeunterricht erteilen durfte. Den haben meine Eltern natürlich sofort unterschrieben, denn ich glaube nicht, dass sie Sexualität irgendwann selbst zum Thema gemacht hätten. Der Unterricht in der Schule fand dann auch statt, verstanden habe ich im allgemeinen Gelächter der Klasse aber nicht viel vom Thema und es war mir noch lange unklar, wo die Kinder nun aus dem Bauch kommen würden. Das hätte ich aber meine Mutter auch nie fragen können, denn zu Hause wurde, ich denke aus falscher Scham, auch nie über den Unterricht gesprochen. So habe ich auch nie Zärtlichkeiten zwischen meinen Eltern erlebt, genauso aber auch fast keine Streitereien oder Gespräche übers Geld. Wenn mein Vater zur Arbeit fuhr, gab es von meiner Mutter höchstens mal einen flüchtigen Abschiedskuss für ihn. Fast so, als schämten sie sich dafür, wenn wir in der Nähe waren.
Erinnerungen an meine Kindheit und Jugend
Was war das denn?
Ich war ca. drei Jahre alt und meine Mutter war einige Tage nicht zu Hause, weshalb unsere Oma uns versorgte. Dann kamen meine Mutter und mein Vater mit einem Taxi nach Hause und meine Mutter trug etwas auf ihrem Arm, was in eine Decke eingewickelt war. Natürlich war uns drei Jungens erst einmal nicht bewusst, dass wir nun zu viert waren. Keiner hatte vorher mit uns darüber gesprochen.
Dieser Moment ist im Nachhinein meine erste, bewusste Erinnerung. Da war ich drei Jahre und drei Monate alt.
Das Oberhaupt der Familie war unausgesprochen mein Vater, ein Polizeibeamter, mit einer Autorität die niemand anzweifelte. Besonders in seiner - damals dunkelgrünen - Uniform strahlte er Autorität aus. Meine Mutter, neun Jahre jünger als er, versuchte ihm immer alles recht zu machen und diesem Gedanken hatten auch wir uns unterzuordnen.
Wir wohnten, wie schon erwähnt, in einem Einfamilienhaus mit Stallungen und einem für uns Kinder unendlich, riesigem Garten. Aber wer meint, im Haus hätten wir genug Platz zum Wohnen gehabt, der hat das vorige Kapitel wohl überschlagen. Im Haus wohnten ja noch die Großeltern väterlicherseits und die Großmutter mütterlicherseits. Wir Kinder mussten deshalb ordentlich zusammenrücken. Deswegen waren wir ja zu dritt im einzigen Kinderzimmer, im Erdgeschoss, untergebracht. Das war dann mehr unser Schlaf- als ein Spielzimmer. Ein Spielzimmer hatten wir auch gar nicht nötig, denn Spielsachen in der heutigen Form gab es für uns sowieso kaum. Unser Spielen spielte sich draußen ab. Da gab es nicht nur Gelände genug, sondern auch unsere Haus- und Nutztiere. Dazu zählte ein Hund, einige Katzen, Hühner, Gänse, Schafe und später auch Ziegen. Der Garten wurde regelmäßig bepflanzt, um mit den Feldfrüchten und den Obsterträgen die Familie zu versorgen.
Ich erinnere mich, dass ich meiner Mutter immer gerne im Haushalt geholfen habe. Durch diverse Belobigungen hat sie das natürlich auch geschickt gefördert und mir machte es Spaß, das zu machen, was meine Mutter auch machte. Ich entsinne mich einer Situation, für die ich mir besser nicht versuchte ein Lob einzuholen. Da muss ich ungefähr vier Jahre alt gewesen sein. An dem Morgen war meine Mutter mit Bügeln im Wohnzimmer beschäftigt. Das Wohnzimmer, welches sich neben dem Schlafzimmer befand, war ein kleiner Raum zur Straßenseite. Es war ausgestattet mit einem niederen Vitrinenschrank, der links eine Seite für Geschirr und rechts die Seite hatte, wo mein Vater seine Uniformen hineinhängte. Es gab auch ein Sideboard und einen kleinen, runden Tisch mit zwei schmalen, dunkelroten Armsesseln. Ein großer, dunkler Esstisch mit ebensolchen Polsterstühlen und ein Kohleofen zum Beheizen des Raumes rundeten das Gesamtbild ab. Alles war schon sehr gedrängelt und nun standen auch noch das Bügelbrett und der große Wäschekorb darin, aus dem meine Mutter frisch gewaschene Wäsche entnahm, um sie mit dem Bügeleisen zu glätten.
Das gefiel mir und es sah leicht aus. „Das kann ich auch“, sagte ich mir. Dann kam der Moment, in dem ich zur Tat schreiten und meiner Mutter eine Freude machen wollte. Gerade als sie mit gebügelter Wäsche das Zimmer verließ, um diese in den Schrank im Kinderzimmer einzusortieren, griff ich nach meinen grünen Lieblingssöckchen, die mit dem bunten Rand, um ans Werk zu gehen. Das Bügeleisen war richtig schwer und ordentlich heiß und so stellte ich es auf die Söckchen. Das musste funktionieren, denn so hatte ich es beobachtet. Doch bei mir ging es genau verkehrt herum. Statt, dass die Söckchen schön glatt wurden, schrumpelten sie blitzartig zusammen - sie schmolzen förmlich und wurden immer kleiner und härter. Mein Schreck war riesengroß. Das durfte niemand sehen. Sofort stellte ich das Bügeleisen wieder an seinen Platz, so als ob nichts geschehen wäre. Mit schlechtem Gewissen entfernte ich die Söckchenreste vom Bügelbrett und lief so schnell, wie ich nur konnte, zur damals noch schweren, eisernen Mülltonne, um sie verschwinden zu lassen. Ganz tief unten drin hat sie dann auch keiner mehr gefunden, und mein Geheimnis blieb fest in mir verschlossen. Ihr könnt verstehen, dass Bügeln von dem Moment an nicht mehr mein Ding war.
Ein trauriges Kapitel meiner jüngsten Kindheit ist mir auch noch in Erinnerung: Es war der Tag, an dem wir Besuch eines Cousins meiner Mutter mit seiner Frau hatten. Klaus, so hieß er, besaß einen großen Motorroller, was uns Kinder natürlich zum Staunen brachte. Mit diesem und seiner Frau Lilo auf dem Sozius kam er zu uns gefahren. Klaus war auch der Maler, der unser Bad gestrichen und den Terpentin stehen gelassen hatte, von dem ich unbedingt probieren musste. Damals war ich wohl gerade 3 Jahre alt gewesen, so erzählten später meine Eltern. Meine Neugier brachte mich auf sofortigem Weg ins Krankenhaus, wo man nebenbei auch erstmals feststellte, dass meine inneren Organe komplett verkehrt herum „eingebaut“ waren, also z. B. habe ich das Herz wirklich am rechten Fleck und nicht wie die allermeisten Menschen mit der Spitze nach links. Aber das nur am Rande.
Es war ein sehr heißer Tag, und die Erwachsenen versammelten sich im Wohnzimmer. Um das Zimmer etwas zu beschatten, wurden auch noch die schweren Fensterläden von außen geschlossen. Vor diesem Fenster auf dem geharkten Weg, der um die große Wiese verlief, stand mein schönes, neues Schaukelpferd und ich wollte unbedingt damit schaukeln. So kletterte ich mühselig von oben hinein. Das klappte auch wunderbar und ich schaukelte träumend, wahrscheinlich auch den lauten Stimmen aus dem Wohnzimmer zuhörend. So ging es eine ganze Weile, bis ich irgendwann keine Lust mehr dazu hatte. Deshalb erhob ich mich, um auf dem gleichen Weg, auf dem ich mühselig in das Schaukelpferd gekommen war, wieder herauszuklettern. Ich hielt mich deshalb am umlaufenden Holzgeländer meines „Pferdes“ fest und stieg auf den Sitz. Doch egal, wie ich es auch versuchte, das Schaukelpferd setzte sich sofort in Bewegung, so dass ich es mit der Angst zu tun bekam. So musste ich mich wieder setzen, bis es sich beruhigte und aufhörte zu schaukeln. An der Situation änderte sich aber nichts. Ich brauchte jetzt unbedingt Hilfe. So laut ich konnte, rief ich nach meinen Eltern, doch meine dünne Stimme blieb wegen der lauten Stimmen im Wohnzimmer und der geschlossenen Fensterläden ungehört - so oft ich auch rief. So kam in mir immer mehr Verzweiflung auf. Ganz allein und im heißen Sonnenschein hielt ich es nicht mehr aus. Von den Erwachsenen kam aber immer noch keine Hilfe, so dass ich mich sehr allein gelassen fühlte. Letztendlich blieb mir nur noch ein Versuch das Schaukelpferd zu verlassen. Ich musste zwischen den Gitterstäben hindurch herauskommen. Deshalb steckte ich meinen Kopf zwischen einem Stab und dem schwarz-weißen Kopf meines „Pferdes“ hindurch. Zuerst ging das sogar ganz leicht, und nach und nach sollte mein Körper folgen. Irgendwann kam jedoch der Punkt, an dem ich weder hinaus noch zurückkonnte. Von lauter Panik und Anstrengung getrieben habe ich dann fürchterlich geweint. Wer schließlich meine Eltern über mein Elend informiert hat weiß ich nicht, aber endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, kam Hilfe. Zuerst war mein Vater aber genauso ratlos wie ich. Um mich aber schnellstmöglich aus meiner Situation befreien zu können und wohl um mich zu beruhigen, wurde schließlich der Fuchsschwanz, eine größere Handsäge, herbeigeholt und der schöne Kopf meines Schaukelpferdes abgesägt, um Platz für meine Befreiung zu haben. So kam ich zwar wieder frei, doch das Vergnügen in meinem Schaukelpferd zu schaukeln, war damit auch beendet.
Ich kann mich auch noch an folgende unschöne Begebenheit erinnern, als ich noch ziemlich klein und sicher noch kein Schulkind war. Ich fuhr mit meinem Vater mit der Straßenbahn nach Köln. Ich weiß heute nicht mehr, warum wir das ohne Geschwister bzw. ohne meine Mutter taten. Das war total unüblich in unserer Familie. Ich weiß nur aus meiner bildlichen Erinnerung, dass wir auf der Strecke über die Kölner Ringe unterwegs waren und am Rudolphplatz ausgestiegen sind. Damals hatten Busse und Bahnen noch einen Schaffner, an dem man vorbeimusste und der die Aufsicht in der Bahn hatte. Auch Tickets konnte man da kaufen. Beim Aussteigen hatte mein Vater wohl nicht auf mich aufgepasst, als sich plötzlich die Tür wieder schloss, während mein Fuß noch in dieser steckte. Es hat sehr wehgetan. Ich habe wohl auch schrecklich geheult, bis der Fuß wieder frei war und wir die Bahn endgültig verlassen konnten. Jedenfalls war ich total erschrocken und stand noch länger unter dem Schock des traumatischen Ereignisses. Im Gedächtnis ist mir dazu noch geblieben, dass mein Vater auf dem Platz mit einem dort diensthabenden Kollegen über diesen Vorfall sprach. Auf dem Platz befand sich auch eine kleine, weiße Kabine, die über Stufen erreichbar war. Von dort oben machte ein Polizist in weißem Mantel und Mütze (wohl wegen der besseren Sichtbarkeit) die Verkehrslenkung über den damals sicherlich noch mäßigen Autoverkehr. Was wir beide in Köln gemacht haben weiß ich nicht mehr. Es kann sein, dass mein Vater mit mir seine Dienststelle aufgesucht hat, um noch irgendetwas zu regeln.
Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich, wenn ich mit meiner Mutter in der Straßenbahn unterwegs war, aufstehen oder mich auf ihren Schoß setzen musste, wenn die Bahn voller wurde. Damals war das noch selbstverständlich, dass man als Kind für ältere Leute oder auch schon für Erwachsene den Platz räumte, oder besser gesagt räumen musste. Wenn ich heute sehe, dass man einer Mutter einen Platz anbietet und die sich dann nicht setzt, sondern ihr Kind darauf platziert, kann ich das nicht verstehen. Genau so wenig, wie viele Jugendliche sich nicht daran stören, ob da ein Behinderter oder alter Mensch in die Bahn kommt. Das interessiert leider viele überhaupt nicht. Vorbildlich stehen dann meist erwachsene Menschen, vor allem auch Männer mit ausländischen Wurzeln auf, die das offensichtlich auch gelernt haben oder vielleicht einfach mehr Respekt vor ihren älteren Mitmenschen haben.
So mit zehn Jahren interessierte ich mich schon für das Backen. Meine Mutter backte häufig Kuchen, was unseren Speisezettel sonntags deutlich aufwertete und uns in der Weihnachtszeit besondere Leckereien bescherte. Wir alle waren ganz heiß auf Kuchen. Während des Jahres war das oft ein Streuselkuchen, manchmal auch mit Äpfeln aus unserem Garten oder eine Bisquitrolle mit Marmelade, die meine Mutter in der Obstsaison in Mengen einkochte. Zu Weihnachten gab es immer Pfefferkuchen, ein Lebkuchen mit eingedrückten Mandeln auf den einzelnen Stücken. Ebenso gab es dann Mohnkuchen, ein gerollter Hefeteig mit Mohnfüllung. Dazu musste der in Milch erhitzte Mohn erst einmal mit dem Fleischwolf gemahlen werden. Natürlich gab es auch Mürbeteigplätzchen, die wir Kinder ausstechen durften. Diese wurden nach dem Backen in großen Dosen auf dem Schrank im Schlafzimmer oder in der Küche aufbewahrt, um uns nicht zu sehr in Versuchung zu führen – aber abschrecken konnte uns die Höhe nicht und oft fanden wir einen Weg zu dem herrlichen Gebäck, um heimlich zu naschen. Während des Backens durften wir aber immer die Schüsseln vom Teig auslecken oder Kantenstücke probieren. Backen, das wollte ich dann auch mal ausprobieren. Meine Mutter half mir dabei und suchte ein Rezept aus, welches sich auf einer Packung Backpulver befand. Es sollte ein Rodonkuchen mit Rosinen in der Guglhupfform werden. Natürlich hatten wir damals noch keine Küchenmaschine und so musste alles mit der Hand mit einem Holzrührer, der so aussah wie ein Fleischklopfer, gerührt werden. Beginnen musste ich dann damit, die Margarine schaumig zu rühren. Meine Mutter half mir zwar dabei, damit ich die einzelnen Arbeitsschritte auch der Reihenfolge nach machte, aber arbeiten musste ich alleine. Irgendwann war der Teig dann fertig und ich konnte den Rührteig in die Form füllen und den Kuchen in den Ofen stellen. Auf das Ergebnis war ich nachher ganz stolz, ich hatte meinen ersten Kuchen gebacken. Diesem sollten noch unzählige in meinem Leben folgen.
Ich war so zwölf Jahre alt. Ich weiß nicht wer auf die Idee kam, dass ich ein Musikinstrument erlernen sollte. Mein ältester Bruder hatte mal das Flötenspiel gelernt und mein Vater träumte von einem Konzert der Kinder zu Weihnachten. Fasziniert war ich immer vom Klavierspiel, dafür war aber kein Geld da. Also bekam auch ich eine hölzerne Blockflöte und einen Kurs der Volkshochschule in meinem Schulgebäude in Sürth. Das war mal ein Vergleich und man kann sich vorstellen, wie begeistert ich an die Sache dran ging. Der Kurs fand nachmittags statt, denn damals gab es noch keinen Nachmittagsunterricht der Schule. Also fuhr ich dorthin und musste feststellen, dass der Kurs bereits einige Male ohne mich stattgefunden hatte und ich damit die Grundtechniken nicht mitbekommen hatte. So hing ich ständig durch und wusste nicht richtig wovon gesprochen wurde. Auch wie ich die angesagten Übungen machen sollte kam mir nicht in den Sinn. Spaß machte das keinen und Fortschritte gab es bei mir überhaupt nicht. Nur die hätten mich vielleicht doch noch motivieren können. Aber trotzdem fuhr ich immer brav mit meinem Fahrrad nach Sürth. So war ich wieder mal auf dem Weg zum Unterricht. Die Flöte befand sich in einem Beutel an meiner Lenkstange, als mein Fahrrad eine abrupte Bremsung machte. Ich fiel fast vom Sattel und hörte es nur noch krachen und aus der Flöte waren mehr Teile geworden als die üblichen beiden zum Reinigen. Das wars dann erst einmal. Als ich das „Unglück“ dann zuhause beichtete, war das Entsetzen so groß wie meine Hoffnung, dass dieses Kapitel nun zu Ende sei. Aber die Freude dauerte nicht lange und nach einiger Zeit bekam ich eine neue Blockflöte. Diese bestand dann aber aus Plastik. Vielleicht hatte da ein Schild mit dem Hinweis auf die totale „Unzerstörbarkeit“ dieses „wertvollen“ Instrumentes drangehangen, weshalb meine Eltern diese gekauft hatten. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war der Kurs bis zur Beschaffung der neuen Flöte wieder einige Stunden ohne mich fortgeführt worden. So bekam ich überhaupt keinen Anschluss mehr und ich verweigerte die weitere Teilnahme. Das ließ man mir dann endlich auch durchgehen.
Als ich im jugendlichen Alter war, hatte ich große Probleme mit „Naselaufen“. Wahrscheinlich war das zu der Zeit schon eine allergische Reaktion, aber man nahm das zuhause nicht richtig zur Kenntnis. Damals war es aber auch noch nicht so bekannt, dass es Allergien gab. Wenn es bei mir wieder losging, setzte ich mich bei Fahrten in Bus oder Bahn nicht mehr hin, weil ich mich schämte, es mir peinlich war und ich immer meinte, dass ich andere belästigen würde, wenn ich wieder mein Taschentuch herausholen musste. Damals gab es auch noch keine Papiertaschentücher, sondern nur die aus Stoff. Von denen hatte ich eine ganze Menge zur Konfirmation bekommen. Irgendwie war das aber immer eine Schweinerei und peinlich, wenn die vom Schnauben schon feucht waren und man kein frisches dabeihatte. Oft erwischte es mich gerade auch dann, wenn ich etwas vorhatte. Das war dann schon wie eine Manie. Ich hoffte, dass meine Nase dabei nicht wieder laufen würde, konzentrierte mich aber so sehr darauf, dass meine Nase meinte, noch mehr anschwellen zu müssen. Allein schon der Gedanke an einen Termin oder dass ich etwas Besonderes vorhatte, ließ sie anschwellen. Zuhause fand man das aber nie merkwürdig oder dachte nach, ob ich vielleicht an einer Allergie litt und ein Arztbesuch angezeigt wäre. Irgendwann war ich deswegen dann doch mal bei einem HNO-Arzt in Rodenkirchen. Dieser empfahl mir, die Nasenscheidewand wegen einer vorhandenen Verengung zu verkürzen. Der Platz dort sei zu eng und damit nicht richtig belüftet. Für mich war das gar keine Frage, weil ich alles tun wollte, um Linderung zu bekommen. Meine Eltern hingegen fragten erst mal ihren Heilpraktiker, der total dagegen war. Ich setzte mich aber durch und ließ mir unter großen Qualen im Krankenhaus in Porz Teile der Nasenscheidewand entfernen. Ich weiß noch, dass während der OP - der mechanische Akt der Entfernung wurde damals noch mit Hammer und Meißel bei nur lokaler Narkose durchgeführt - die Schmerzen so groß waren, dass ich wohl zusammengesackt war. Ich schluckte dabei auch sehr viel Blut, was mich kurz nachdem ich wieder zu mir kam, zum Erbrechen brachte. Ich erinnere mich auch noch gut daran, dass ich in einem Zimmer lag, wo auch ein Vater mit seinem kleinen Sohn untergebracht war. Beide hatten die Mandeln operiert bekommen. Der Vater machte ständig Blödeleien und das gerade auch während des Essens. Ich quälte mich dann sehr, weil ich lachen musste, während meine Nase dick mit Tamponaden ausgestopft war und ich wegen des vollen Mundes sowieso nicht mehr richtig atmen konnte. Aber es war einfach lustig mit den beiden und die Zeit verging schnell. Nach der OP ging es mir jedoch deutlich besser und lange Zeit hatte ich Ruhe vor dem ewigen „Naselaufen“.
Ich erinnere mich auch noch an einen Sonntag, da war ich vielleicht 13 oder 14 Jahre alt. Alle in der Familie außer mir waren krank, lagen im Bett und hatten Grippesymptome. Meine Mutter hatte am Vortag ein Kaninchen aus der Kühltruhe geholt. Davon hatten wir ganz viele, die wir als Nahrung für uns, zum Verkauf im Dorf, oder bei den Kollegen meines Vaters, züchteten. So hatten wir Fleisch und mussten es nicht extra kaufen. Zurück zum besagten Sonntag: Meine Mutter glaubte, mich mit der Aufgabe betrauen zu können, das Mittagessen für die ganze Familie zuzubereiten. Also arbeitete ich auf ihre Anweisung und pendelte dazu zwischen dem Bett meiner Mutter und der Küche. Ich schälte Kartoffeln, bereitete Rotkohl vor und spickte das Kaninchen mit Speckstücken auf den Läufen. Das klappte recht gut und irgendwann war alles gar und es gab ein wirklich leckeres Essen. So bekam unsere Familie trotz der Erkrankung meiner Mutter ein komplettes, gelungenes Mittagessen. Als „gute Hausfrau“ war ich dann so stolz über das Lob, dass ich hinterher auch noch den Berg Geschirr abwusch.
Grundsätzlich kamen wir Kinder beim Essen immer zuletzt dran und der Vater erhielt das größte Stück Fleisch. Der Spruch unserer Mutter lautete dann immer: „Kinder und Katzen müssen warten“. Es war auch klar, dass es Mäkelei beim Essen nicht gab. Was auf den Tisch kam, musste auch gegessen werden. Oft gab es auch sehr einfaches Essen. Erhitzte Milch mit Mehlklunkern und Zucker half da schon mal den Geldbeutel zu schonen.
Als wir älter waren, gab es zwischen uns Geschwistern und unserem Vater häufig große Diskussionsrunden bei Tisch. Jeder wollte etwas zum Thema sagen, was aber bei uns zusammen nicht sehr einfach war. Natürlich war es für uns selbstverständlich, dass unsere Eltern nicht in allem Recht haben durften. Manchmal ging es nur darum, dass uns unsere Lehrer etwas gesagt hatten, was unserem Vater nicht gefiel. Für uns war das aber schon deshalb richtig, weil es eine Lehrkraft gesagt hatte. Dann ging es meist so laut zur Sache und wir schrien uns förmlich an, dass die Nachbarn denken mussten, dass wir uns schlügen. Heute weiß ich, dass das keine gute Erziehung bzw. dass mein Vater da kein gutes Vorbild war, denn lange habe ich diese falsche Art der Auseinandersetzung noch gepflegt und dadurch viel Stress in meiner eigenen Familie gehabt.
Schlimm war auch, dass meine Eltern ständig davon sprachen, dass unsere Heimat ja nicht ihre Heimat sei. Ihre Heimat lag ja in Ostpreußen bzw. in Danzig. Irgendwie war das immer ihr Ziel geblieben dort wieder zu leben, auch wenn sie nie einen Schritt in dieser Richtung unternahmen. Durch die jährlichen Heimattreffen der ehemaligen Volksgemeinschaften wurde diesem Gedanken aber immer wieder neue Nahrung gegeben. Manchmal wurden wir dahin mitgenommen. Vor allem meine Mutter und ihre Mutter fanden dort immer ehemalige Nachbarn, Bekannte und Verwandte, mit denen sie reden konnten. Auch die Stimmung, mit dem regelmäßigen Absingen aller Strophen des Deutschlandliedes, war immer beeindruckend. Wir Kinder, innerhalb der großen Schar Menschen, fanden meist Möglichkeiten auf oder hinter der Bühne zu spielen. Damals waren diese Treffen eine Veranstaltung für das Wiedersehen mit Menschen der Heimat. So wie sie waren, sind wir ja auch von zu Hause geprägt worden. Besuchsweise wollte mein Vater entgegen dem Willen meiner Mutter aber nie die alte Heimat, wo heute Polen leben, besuchen. Den damaligen Zwangsumtausch von Deutsche Mark in Zloty, so sagte er immer, wolle er den Polen „nicht in den Hals werfen“. Wenn einmal im Monat das abonnierte Ostpreußenblatt kam, stürzten sich meine Eltern aber regelrecht auf die Artikel. So ließen sie sich in ihrer Meinung weiter bestärken und zogen uns mit in ihre Sichtweise der Welt. Die war zwar nicht rassistisch, aber schon sehr konservativ. Für meine Mutter wurde der Wunsch die alte Heimat zu sehen erst wahr, als mein Vater schon tot war und meine heutige Frau und ich sie dorthin begleiteten.
Wenn damals Besuch aus Köln zu uns kam - das waren der Onkel und die Tante meines Vaters - wurde mit verklärten Blicken hauptsächlich von der alten Heimat gesprochen. Da ich oft zuhörte, waren die genannten Ortschaften und Gegebenheiten bei mir fest im Kopf verankert, was mir beim Besuch mit meiner Mutter dort sehr geholfen hat.
Bis ins hohe Alter sprach mein Vater bei jeder Gelegenheit vom Krieg und seiner Gefangenschaft in Russland. Beides war so grausam, dass er nicht mehr loslassen und sich nicht so richtig über sein aktuelles, friedliches Leben freuen konnte. Er hatte, das war mir zu spät klar geworden, ein riesiges Trauma davongetragen. Oft erzählte er wie seine Kameraden, jung wie er, im Schützengraben verbluteten oder in der Gefangenschaft wegen mangelnder Ernährung gestorben waren. Es gab wohl auch einen regen Tauschhandel mit den Marken für Essen und Genussmittel in der Gefangenschaft. Viele Mitgefangene tauschten dann ihre Fett- gegen Zigarettenmarken ein und überlebten deshalb nicht. Mein Vater war Gott sei Dank zu der Zeit Nichtraucher.
Seine Wutausbrüche bei Verfehlungen von uns Kindern, wie auch die ständigen Ansagen, was die Nachbarn wohl von uns denken würden, wenn …, waren aufgrund seiner Erlebnisse sicher kein Zufall. Die Familie sollte nicht unangenehm auffallen.
Was mich durch die Äußerungen meines Vaters sehr belastete, waren die Gedanken an einen Krieg und meine vielen Albträume von einem Krieg. Das Szenario ging mir lange Zeit sehr nah und ich hatte tatsächliche Angst vor einem Krieg, die sich erst mit dem Älterwerden langsam verlor.
Was die Äußerungen meines Vaters bei meinen Geschwistern ausgelöst haben vermag ich nicht zu sagen, mich prägte das alles aber sehr deutlich. Heute weiß man ja, dass selbst die zweite Generation nach der der Kriegsteilnehmer noch unbewusst durch die Ereignisse geprägt wird. Das geschieht dann durch Handlungen und Worte von deren Eltern. In meinem Fall durch mich an meine Kinder.
Ich kann mich nicht erinnern, dass wir als Kinder mit unseren Eltern jemals in eines unserer Nachbarländer gefahren wären, oder dort Urlaub gemacht hätten. Ich spürte, dass meine Eltern davor Angst hatten, was da wohl mit ihnen passieren würde. So bauten sie förmlich Mauern um sich. Als ich viele Jahre später mit meinem älteren Bruder in seinem klapprigen VW mal in die Niederlande fuhr, hatte ich durch das Verhalten meiner Eltern und deren Angst vor Fremdem tatsächlich ein bisschen Beklemmungen. Diese legten sich dann auch erst, als es auf der Rückfahrt ordentlich regnete und ein Scheibenwischer ausfiel, weshalb er kaum etwas sehen konnte. Mit einem Handwischer musste ich versuchen, durch das Seitenfenster die Scheibe freizuhalten. So war ich damit beschäftigt und vergaß die unnötigen Gefühle vor der „Fremde“ wieder.
Heute ist Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Beiträge werden sogar speziell für Kinder gemacht. Sendungen, die auch schon Kindern Wissen vermitteln oder sie in ferne Welten mitnehmen, werden extra kindgerecht erstellt. Erwachsene schauen gerne Krimis oder Spielfilme. Ich schaue gerne „Heile-Welt-Filme“. Dies vor allem vor dem Schlafengehen, weil ich sonst oft aufwühlende Träume habe.
Das war natürlich nicht immer so. Wir hatten im Kindesalter lange Zeit überhaupt keinen Fernseher zuhause. Dann sind wir zu Nachbarn gegangen, die bereits über ein Gerät - damals noch mit Zimmer- oder Stabantenne auf dem Dach - verfügten. Eines Tages bekamen wir dann auch ein Fernsehgerät, weil unsere Oma sich an den Kosten beteiligte. Das Gerät war in einem kleinen Schrank untergebracht, damit es optisch auch ins Zimmer passte. Es gab damals nur das erste und zweite Programm. Die Sendungen fingen am späten Nachmittag mit der Kinderstunde an und endeten am späten Abend mit der Nationalhymne. Tagsüber war werktags nur ein sogenanntes Testbild zu sehen. Damit konnte man erkennen, ob die Antenne auch richtig ausgerichtet war. Innerhalb der Woche durften wir Kinder nicht viel sehen, aber sonntags gab es die amerikanischen Serien um den Hund Lassie, das Pferd Fury oder „Die kleinen Strolche“. Diese Familienserien durften wir sehen und warteten auch immer gespannt auf den nächsten Sonntag - auf die nächste Folge.
Manchmal wurden auch Operetten verfilmt oder es gab Familiensendungen mit Musik, bei denen das Fernsehballett des jeweiligen Senders nach der Musik tanzte. Wenn unsere Eltern und natürlich die Oma das samstags oder sonntags schauten, durften wir natürlich dabeibleiben. Dadurch sind mir auch heute noch viele Operettenmelodien und die Namen der damaligen Gesangsstars bekannt.
Für die Traditionen in Köln hatten meine Eltern jedoch kein Verständnis. Außer manchmal auf die Kirmes, wo wir Kinder eventuell eine oder zwei Mark fürs Karussell erhielten, gingen sie zu keiner Veranstaltung. Als wir später einen richtig großen Karnevalszug in Weiß bekamen, schaute meine Mutter nur verschämt hinter der Gardine auf die sich aufstellenden Wagen, statt sich an den Straßenrand zu stellen und die Stimmung zu genießen. Auch das prägte mich lange und veränderte sich erst in meiner ersten Ehe, wo die Verwandten meiner damaligen Frau alle „karnevalsjeck“ waren.
Geschichte aus der Kindheit – Weihnachten bei uns zu Hause
Was ich gerne höre, sind Geschichten, die alle von uns erzählen können. Zum Beispiel Geschichten die mit Weihnachten zu tun haben.
Das Weihnachtsfest hat sich in den vielen Jahren, an die ich mich erinnern kann, deutlich verändert. Meine Eltern und Großeltern berichteten von langen Vorbereitungen in ihrer alten Heimat im Osten Deutschlands. Da war es Weihnachten noch richtig kalt und der Schnee war sehr hoch. Die Menschen die man liebte, waren alle in der guten Stube versammelt Diese wurde nur zu besonderen Gelegenheiten und wenn Gäste kamen betreten. Allein das gab schon eine besondere Stimmung, und so wurde dafür auch ein schöner Baum im Wald geschlagen und aufgestellt. Die Familie versammelte sich und feierte. Sie feierte richtig mit vielen echten Kerzen auf dem Baum und überall waren Lichter aufgestellt. Elektrisch war da nichts dran.
Da war aber auch der Glaube noch sehr tief in den Menschen verwurzelt, denn sie lebten mit der Natur und waren auf diese angewiesen, um ernährt zu werden. Das Gefühl, dass Gott das alles gegeben hatte, steckte tief drinnen. Auch gegenüber Feldern und Tieren, welche die Großeltern Schaldach auf ihrem Bauernhof hatten, war der Respekt groß und so behandelten sie alles.
Bei diesen Weihnachtsfeiern, so erzählte meine Mutter, wurde natürlich kräftig gesungen und die Kinder freuten sich auf kleine Geschenke. Dann gab es meistens Bekleidung zum Anziehen, welche von Mutter oder Oma selbst gestrickt oder genäht worden war.





























