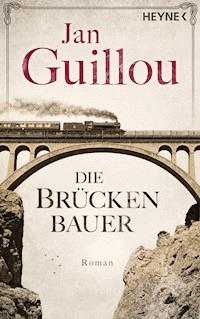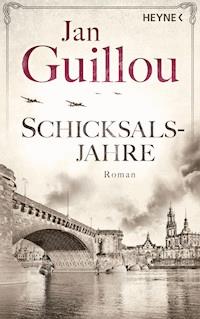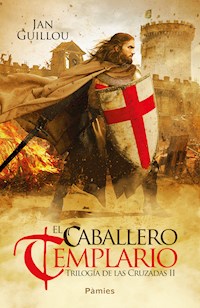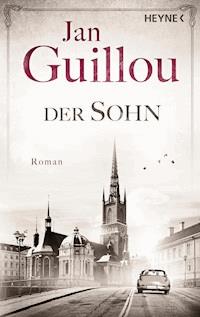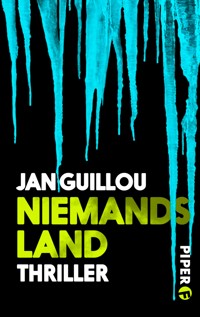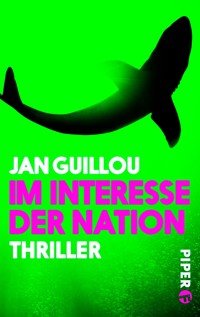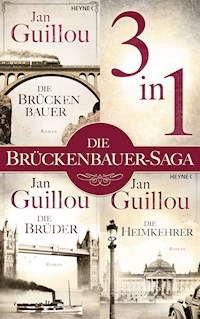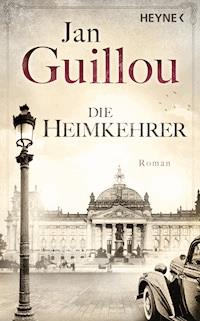
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Brückenbauer-Serie
- Sprache: Deutsch
Schweden im April 1918: Lauritz, der älteste der drei Brückenbauer, residiert mit seiner Familie nahe Stockholm. Als Direktor eines Bauunternehmens hat er es zu Wohlstand gebracht. Seine Brüder Oscar und Sverre leben und arbeiten in Berlin. Doch mit dem Erstarken der Nationalsozialisten ändert sich alles. Oscars Dienste sind nicht mehr gefragt, und Sverre muss als Homosexueller um sein Leben fürchten. Die Flucht zu Bruder Lauritz scheint der einzige Ausweg zu sein. Eine Zeit quälender Ungewissheit beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Jan Guillou
DIE
HEIMKEHRER
Roman
Aus dem Schwedischen von Lotta Rüegger
und Holger Wolandt
Das Buch
Der wohlhabende Ingenieur Lauritz hat sich mit seiner deutschen Frau Ingeborg und den vier Kindern in Stockholm niedergelassen. Seine Brüder Oscar und Sverre wohnen unterdessen in Berlin, wo Oscar über den größten Immobilienbesitz der Stadt verfügt. Auch er ist mit einer Deutschen verheiratet, der Adeligen Christa von Moltke. Während in Deutschland der Faschismus wächst, sorgt sich Lauritz um seinen ältesten Sohn Harald, der Gefallen an den nationalsozialistischen Parolen findet. Die Zeit nach dem ersten Weltkrieg, die mit Modernität und Avantgarde begann, mit Filmen von Chaplin, Gemälden von Grosz und Romanen von Döblin, entwickelt sich mehr und mehr zu einem Albtraum, in dem Verfolgung und Schikane den Alltag beherrschen. Oscar und Sverre beschließen, Berlin den Rücken zu kehren, was sich jedoch als riskantes Unterfangen herausstellt.
Der Autor
Jan Guillou wurde 1944 im schwedischen Södertälje geboren und ist einer der prominentesten Autoren seines Landes. Seine preisgekrönten Kriminalromane um den Helden Coq Rouge erreichten Millionenauflagen. Auch mit seiner historischen Romansaga um den Kreuzritter Arn gelang ihm ein Millionenseller, die Verfilmungen zählen in Schweden zu den erfolgreichsten aller Zeiten. Heute lebt Jan Guillou in Stockholm.
Lieferbare Titel
Die Brückenbauer
Die Brüder
I – Saltsjöbaden
April 1918
Er sehnte sich nach Deutschland. Als sie in Bergen den Zug über die Hardangervidda bestiegen hatten, war er noch davon ausgegangen, die Heimreise nach Deutschland anzutreten. Stattdessen saß er nun auf einem Steg an einem Fjord, der ebenso weit von Bergen wie von Berlin entfernt war.
In Schweden hieß es im Übrigen nicht Fjord, sondern Fjärd. Schwedisch war eine lustige Sprache, leicht zu verstehen, aber schwer zu schreiben. Er war sich fast wie ein Erstklässler vorgekommen, der das Lesen erst noch lernen musste. Inzwischen hatte er die anderen fast eingeholt und würde im Herbst in der dritten Klasse anfangen, falls Deutschland nicht endlich siegte und die ganze Familie nach Hause zurückkehren konnte.
Wenn er mit seinen Klassenkameraden Schwedisch sprach, gab es immer ein paar Spielverderber, die behaupteten, er klänge eher norwegisch als schwedisch. Aber das spielte keine Rolle. Er hatte geschworen, nie mehr Norwegisch zu sprechen.
Über dem Fjord oder Fjärd stauten sich große, bauschige Wolken, in denen sich die englischen Flieger gerne versteckten, wenn sie zu ihrem großen Entsetzen seinen roten Dreidecker Fokker Dr.I entdeckten. Sie lagen auf Kurs drei Uhr etwa zweihundert Meter unter ihm und hatten die Gefahr noch nicht erkannt. Es handelte sich um sechs in V-Formation fliegende Maschinen. Er zögerte keine Sekunde, rollte nach rechts ab, steuerte im Sturzflug den Anführer an, feuerte drei schnelle Salven mit seinem doppelten Maschinengewehr ab, richtete das Flugzeug auf, vollführte einen Looping nach links und steuerte den Feind von Neuem an. Dieser hatte inzwischen erkannt, wer ihn attackierte, geriet in Panik und nahm augenblicklich Kurs auf die hohen Quellwolken. Sie wussten sehr gut, dass sie gegen Manfred Freiherr von Richthofen keine Chance hatten. Es gelang diesem, noch einen weiteren Engländer abzuschießen, ehe die vier übrigen Flieger in den Wolken verschwanden.
Jetzt gab es nur eine Strategie, da sich die Engländer in den Wolken vermutlich trennen und in verschiedene Richtungen fliehen würden. Er zog seine Maschine steil an, um sich über den Wolken freie Sicht nach unten zu verschaffen. Er musste sich steil von oben fallen lassen, um während des Sturzflugs Tempo zu gewinnen, da ihre Sopwith Camels schneller waren als seine Fokker.
Diesen Preis zahlte er gerne für seine drei Tragflächen: Was er durch sie an Geschwindigkeit einbüßte, gewann er an überlegener Manövrierfähigkeit hinzu.
Er hatte Glück, wie es auch ein guter Torwart brauchte, als er plötzlich tief unter sich auf elf Uhr außer Schussweite zwei Sopwith Camels erblickte, die sich von ihm entfernten. Die Wolkenwand, in die sie verschwinden wollten, war recht dünn, sie würden bald in ein großes wolkenfreies Gebiet gelangen. Er vollführte eine Rolle und tauchte mit Vollgas durch die Wolken.
Seine Berechnungen stimmten punktgenau. Er holte die beiden feindlichen Maschinen in dem Augenblick ein, als sie den wolkenfreien Luftraum erreichten. Der Rest wäre eigentlich Routine gewesen, aber nachdem er die beiden Engländer abgeschossen hatte, tauchte direkt hinter ihm wie aus dem Nichts eine weitere Sopwith Camel auf. Das war ärgerlich, solche Situationen konnten normalen Fliegern, ja, selbst deutschen Kameraden, das Leben kosten.
Er musste rasch handeln und einen kühlen Kopf bewahren. Er wartete ab, bis die Engländer so nahe herangekommen waren und die ersten Kugeln an ihm vorbeipfiffen, dann zog er den Steuerknüppel maximal an sich heran, richtete das Flugzeug steil in die Höhe und ging vom Gas. Er stand eine Sekunde still in der Luft, ehe er rasend schnell abwärtszutrudeln begann und der erstaunte Engländer, der das Vorhaben des Roten noch gar nicht erfasst hatte, an ihm vorbeischoss. Da eröffnete er das Feuer und durchlöcherte die feindliche Maschine der Länge nach, wobei zugegebenermaßen wohl auch ein wenig Glück im Spiel war.
Danach gab er wieder Gas, parierte die Drehung mit den Rudern und steuerte den Heimatflughafen an. Vier Engländer an einem Vormittag mussten reichen. Es war ohnehin Zeit zum Mittagessen. Anschließend konnte er sich mit frischer Kraft, aufgetankter Maschine und vollen Magazinen erneut ins Gefecht begeben. Sein Rekord lag bei elf Abschüssen an einem Tag, aber das würde er heute wohl nicht mehr schaffen, sofern er nicht auf eine Formation amerikanischer Anfänger stieß.
Während des intensiven Luftgefechts waren die Quellwolken über dem Baggensfjärd nach Südwesten getrieben. Es war ein klarer, warmer Tag, der Frühsommer verhieß, obwohl erst April war.
Eigentlich wollte er Stichling angeln, darum hatte er auch den Schlüssel zum Bootssteg mitgenommen. Er legte sich auf den Bauch und schaute zwischen den Brettern hindurch. Das Wasser war klar, und das Sonnenlicht drang bis auf den Grund, fast wie zu Hause, das hieß fast wie auf Osterøya. Sand, einzelne Tangbüschel, winzige Miesmuscheln und vier oder fünf Barsche. Aber nicht ihnen galt dieser Einsatz. Er hatte eine Aufgabe, die mit Präzision und erfolgreich ausgeführt werden musste.
Sein erster Versuch war missglückt, und das durfte sich nicht wiederholen. Seine Mutter Ingeborg hatte ihm seine Fehler erläutert. Der Stichling war ein Nestbauer, daher war es klug, ein großes Einmachglas mit ein wenig Tang auszulegen. Aber das war nicht das Wichtigste. Zur Laichzeit waren die schönsten Fische normalerweise die Männchen, das galt sowohl für Stichlinge als auch für Forellen und Saiblinge. Stichlingsmännchen schimmerten metallisch smaragdgrün oder auch blau und rubinrot.
Sein Fehler war gewesen, nur Männchen zu fangen, sie ohne Tang oder Seegras in einem Glas einzusperren und sich einzubilden, dass sie dort Frieden halten würden. Stattdessen hatten sie sich gegenseitig umgebracht, und kurz darauf hatte auch der Sieger den Bauch nach oben gedreht.
Dieses Mal wollte er ein schönes Männchen und zwei glanzlose Weibchen einfangen. Wenn eines der Weibchen starb, weil es von der Rivalin, dem Männchen oder von beiden getötet wurde, konnten die Überlebenden trotzdem noch eine Ehe eingehen.
Die Weibchen zu fangen war einfach, denn sie zirkulierten vor dem Nest des Männchens. Er spießte einen Regenwurm auf eine gebogene Stecknadel, weil er einen Haken ohne Widerhaken brauchte, damit die Fische, wie seine Mutter ihm erklärt hatte, unverletzt blieben. Wenig später schwammen zwei Weibchen in seinem Einmachglas.
Männchen zu fangen erwies sich als schwieriger. Sie versteckten sich, schienen keinen Appetit zu haben, führten aber überraschende Blitzattacken auf den Regenwurm an der Stecknadel oder auf eines der Weibchen aus, um gleich wieder in ihr Nest zu verschwinden. Ihm war jedoch aufgefallen, dass das Männchen, wenn man mit dem Regenwurm auf das Dach des Stichlingnestes klopfte, wütend hervorschoss und den Regenwurm eher zerbiss und verletzte, statt ihn zu verspeisen. Diesen Augenblick musste man abpassen und es schnell nach oben ziehen, ehe es losließ. Nach vier oder fünf Versuchen hatte er schließlich neben den zwei Weibchen auch ein Männchen in seinem Glas und konnte zufrieden nach Hause gehen. Auftrag ausgeführt, zumindest so weit.
Er schloss das schwarze Schmiedeeisentor des Bootsstegs ordentlich hinter sich ab, wie es ihm sein Vater aufgetragen hatte, denn der Steg war privat.
Der Heimweg führte ein kurzes Stück die Strandpromenade entlang, aber das Einmachglas mit den drei hitzigen Fischen wurde immer schwerer, weil er es mit vor sich gestreckten Armen halten musste, damit das Wasser nicht auf seine Sonntagskleider, das Matrosenhemd mit dem frisch gestärkten blauen Kragen und die marineblauen langen Hosen schwappte. Es würde definitiv einfacher sein, über den Källvägen zum Kücheneingang zu schleichen, statt die große Treppe von der Strandpromenade aus zu nehmen.
Auf dem steilen Källvägen traf er zwei Nachbarsfrauen bei ihrem Sonntagsspaziergang. Er machte einen Diener, wobei er das Einmachglas am ausgestreckten Arm vor sich hielt, als wolle er es ihnen schenken. Neugierig begutachteten die beiden seinen Fang, und er versuchte, ihnen seinen Plan mit der Stichlingsheirat zu erklären. Momentan wirkten die Fische allerdings nicht sehr kooperationswillig. Sie hatten begonnen, sich zu bekämpfen, und eine der Nachbarinnen machte einen Scherz über die Liebe, den er nicht verstand. Dann tätschelten sie ihm den Kopf und setzten ihren Spaziergang, wahrscheinlich zum Grand Hotel, fort.
Als er in die Küche huschte, strömte ihm der Duft von Sonntagsbraten und frisch gebackenem Brot entgegen. Die Köchinnen hasteten hin und her und sprachen über Lebensmittelmarken und Rationierung, verstummten jedoch, als sie ihn sahen. Verlegen machte er einen Diener und eilte an der Mädchenkammer und der Anrichte vorbei.
Das große Esszimmer war leer, und mit dem Tischdecken war noch nicht begonnen worden, was Gutes verhieß. Vielleicht gab es dann nur ein bescheidenes Mahl im Kreis der Familie, obwohl an Wochenenden oft Gäste kamen. Und ganz richtig, als er an dem kleinen Esszimmer vorbeiging, war dort eines der Serviermädchen damit beschäftigt, das Tafelsilber zu putzen. Gut. Also gab es nur ein bescheideneres Abendessen. Bei größeren Veranstaltungen musste er immer mit am Tisch sitzen und langweilte sich, weil die Erwachsenen unendlich lange tafelten und sich unterhielten. Seine kleinen Geschwister hatten es bei solchen Gelegenheiten besser, sie durften mit Marthe im kleinen Esszimmer essen.
Seine Arme waren müde, und er musste die Fische einen Augenblick auf der untersten Treppenstufe unter den beiden Palmen abstellen. Dann erklomm er die Treppe und ging bis ans Ende des Korridors zu seinem Zimmer, wo er sich endlich seiner Bürde auf dem Schreibtisch entledigen konnte. Er holte ein Handtuch aus dem Badezimmer, trocknete das Einmachglas ab und betrachtete es eine Weile, um herauszufinden, welchen Verlauf das Experiment dieses Mal nehmen würde.
Es sah leider nicht sonderlich vielversprechend aus. Die beiden Weibchen versuchten, sich unter einem Seetangbüschel zu verstecken. Das Männchen, dessen schöne Farben zu verblassen begannen, schwamm hektisch im oberen Teil des Behälters herum und stieß immer wieder mit seinem kleinen Maul gegen das Glas, auf der Suche nach einem Weg in die Freiheit.
Er war sich unschlüssig. Immerhin stellte es einen kleinen Fortschritt dar, dass bislang keiner der Stichlinge wie beim letzten Versuch getötet worden war, als er nur Männchen gefangen hatte, was zum sofortigen Krieg mit hundertprozentigen Verlusten geführt hatte.
Mutter kannte sich mit solchen Dingen am besten aus, war aber wie jeden Sonntag nach Neglinge geradelt, um den Arbeiterkindern auf der anderen Seite der Bahngleise, auf der Nordseite, die er nicht betreten durfte, zu helfen. Aber das glich sich aus, denn die Arbeiter und ihre Kinder durften ohne Genehmigung die Bahngleise auch nicht in der entgegengesetzten Richtung überqueren. Warum das so war, hatte ihm niemand aus seiner Klasse erklären können.
Mutter hatte von einem Aquarium und mehr Platz gesprochen, damit keine Panik unter den Gefangenen ausbrach, die auf eine mangelnde Sauerstoffversorgung in strömungsfreiem Gewässer zurückzuführen sein könnte. Genau wie Menschen benötigten Fische Sauerstoff zum Atmen, obwohl es natürlich viel mühsamer war, Sauerstoff durch die Kiemen aufzunehmen, als die Luft direkt einzuatmen.
Eventuell gab es zwischen dem Gerümpel auf dem Speicher ein altes Aquarium. Aber dort oben durften sich die Kinder nicht alleine aufhalten, weil es so viele Dinge gab, an denen sie sich verletzen konnten. Vielleicht gab es ja noch ganz andere, geheimnisvollere Gründe für dieses Verbot, die aber eigentlich nur seine kleinen Geschwister betrafen und nicht den ältesten Sohn, der im Herbst in die dritte Klasse kam.
Die Bodentreppe begann vor dem Zimmer seines kleinen Bruders Karl und war mit einem dicken grünen Teppich versehen, damit die Familie spätabends und frühmorgens nicht von den Dienstboten geweckt wurde.
Der Dachboden war eine riesige Schatzkammer. Die Dachbalken rochen durchdringend nach Holz und Teer. Leise schlich er an den drei Türen der kleinen Mönchszellen vorbei, wie die Zimmer des Dienstpersonals genannt wurden, ohne dass er recht begriff, warum, schließlich waren alle Bedienstete Frauen.
Er wusste sehr gut, dass es nicht gestattet war, die Zimmer anderer Personen in ihrer Abwesenheit zu betreten, aber seine Neugier war zu groß. Er schlich also zurück und drückte vorsichtig die Klinke der letzten Tür hinunter.
Das Erste, was ihm auffiel, als er über die Schwelle trat, war das überraschend helle Licht und die Aussicht, die so viel schöner war als in seinem eigenen Zimmer. Er konnte das ganze Grundstück, den Hang zur Strandpromenade mit der in den Felsen gehauenen Treppe, den Bambushain, der sich bald in einen Märchenwald verwandeln würde, die Pflanzung mit den Silbertannen in der anderen Richtung, die Beete, die der Gärtner gerade mit roten, blauen und weißen Blumen bepflanzte, sowie die gesamte Bucht, den Hotelviken mit dem Grand Hotel und dem vorgelagerten Restaurangholmen überblicken.
Abgesehen von der Aussicht hatte das Zimmer nicht viel zu bieten. Unter dem schmalen gemachten Bett stand ein Nachttopf. Auf dem kleinen Nachttisch stand eine der Zigarrenkisten, die sein Vater an die Hausangestellten verteilte, damit sie darin ihre Habseligkeiten aufbewahren konnten. Neben der Tür hingen ein paar Kleider, zwei schwarze Kleider, zwei weiße, frisch gestärkte Schürzen und diese weißen Dinger, die wie ein Diadem im Haar getragen wurden.
Er schämte sich. Denn obgleich es in diesem Zimmer sicher nicht viel zum Ausspionieren gab, war es nicht recht, hier einfach so einzudringen. Ein wohlerzogener Junge tat so etwas nicht. Man musste den Dienstboten mit Respekt begegnen.
Verlegen schlich er sich in das große Abenteuer zurück und schloss leise die Türe hinter sich. Die riesige Schatzkammer war nur schwer zu überblicken, da ein heilloses Durcheinander herrschte, Skier und Schlitten aus Holz mit stahlbeschlagenen Kufen, zwei rote Tretschlitten, ein Fahrrad mit so einem idiotisch riesigen Vorderrad, wie es heutzutage niemand mehr benutzte, altmodische Eiskunstlauf-Schlittschuhe aus schwarzem, rissigem Leder hingen reihenweise an der hinteren Wand, große Truhen mit Messingbeschlägen, alte Nähmaschinen, die mit den Füßen angetrieben wurden, ähnlich wie das Harmonium, auf dem die Lehrerin morgens immer ein Kirchenlied spielte, merkwürdige schwedische Fahnen mit einer kleinen aufgenähten norwegischen Flagge lagen in einem unordentlichen Haufen auf einer Truhe, ausrangierte Wohnzimmermöbel waren aufeinandergestapelt, und in einer versteckten Ecke entdeckte er sogar eine kleine Kanone auf einer richtigen Lafette.
Weiter reichte die Sicht in die eine Richtung nicht. Er machte kehrt, ging zur Speichertür und an dieser vorbei. Es fiel nur ein wenig spärliches Licht durch ein paar kleine Dachfenster in der Höhe. Irgendwo gab es sicher einen Lichtschalter, aber er wusste nicht, wo.
Ein Aquarium war nirgends zu sehen, dafür ein Berg riesiger Laternen, große rote Bälle mit chinesischen Schriftzeichen und längliche Stoffleuchten, die man wunderbarerweise auf allen vieren kriechend wie auf einer Expedition hätte erforschen können. Wovon er jedoch Abstand nahm, da er Sonntagskleidung trug.
Im Übrigen lagerten hier überwiegend Möbel, Schreibtische und Schränke, die höher waren als ein erwachsener Mann, eine Maschine mit einem großen Rad mit Handgriff, deren Funktion er nicht verstand. Es fand sich hier alles Erdenkliche, jedoch kein Aquarium. Aber Aquarien waren zerbrechlich, vielleicht sollte er in den großen schwarzen Truhen nachschauen?
Nein, die waren mit Kleidern vollgepackt, die nach Mottenkugeln rochen.
Seine Enttäuschung nahm weiter zu, als er wieder in sein Zimmer kam. Eines der Stichlingsweibchen war schwer verletzt und würde sicher sterben. Das Männchen rang an der Wasseroberfläche nach Luft und war nun deutlich bleicher als zu Anfang. Das andere Weibchen drückte sich noch immer unter dem Tangbüschel an den Boden des Glases.
Er wollte nicht, dass auch dieses Mal wieder alle Fische starben, aber um das zu verhindern, gab es nur eine Möglichkeit. Resolut begab er sich mit dem Einmachglas in sein Badezimmer, kippte alles in die Toilette und zog die Spülung. Es war nicht sicher, dass sie überleben würden, wenn sie jetzt mit gewaltigem Tempo durch die Abflussrohre in die Bucht vor dem Hotel rauschten. Aber es würde nur eine Minute dauern, bis sie wieder in frischem Wasser atmen konnten.
Er musste sich ein Aquarium zu Weihnachten wünschen, das war die einzige Möglichkeit, da er eben erst seinen achten Geburtstag gefeiert hatte und es bis zu seinem nächsten Geburtstag viel zu lange dauerte.
Trotz besserer Planung und Vorbereitung war er wieder erfolglos gewesen. Aber wie Vater immer sagte, jedes Versagen bedeutete einen Sieg für den, der sich zusammenriss, es erneut versuchte und besser machte.
Beim Essen hatte Vater etwas schlechte Laune, und Johanne stocherte in ihrem Essen herum, obwohl es Kalbsbraten mit Sahnesoße und zum Dessert Baiser gab. Mutter wies sie wie üblich tadelnd darauf hin, dass die Kinder in Neglinge vor Glück weinen würden, wenn man ihnen ein solches Mahl vorsetzte. Ein Jahr zuvor hatte es in Neglinge Hungerkrawalle gegeben, und der Landsturm hatte eingreifen müssen.
Johanne erwiderte schmollend, sie wisse nicht, was Krawalle seien oder der Lanzwurm. Da musste Vater dann doch schmunzeln und meinte, genau deshalb habe er sich bislang dem Militär ferngehalten. Er habe Dringlicheres zu tun, als hungrige Arbeiter in Schach zu halten und eine Woche seiner kostbaren Zeit zu verschwenden.
Draußen in der Welt herrschte Krieg, und wäre er eingezogen worden, hätte er zweifellos seine Pflicht getan. Es war ihm recht lange gelungen, der Einberufung mit dem Hinweis auf seine Geschäftsreisen nach Berlin zu entgehen, aber jetzt hatten die Kanaillen gemerkt, dass in der Schlussphase des Krieges alle Wege nach Berlin gesperrt waren.
Trotzdem, ermahnte er Johanne, solle man dankbar für das Essen sein, das einem der Herrgott gebe.
Während des Essens sprachen alle Norwegisch außer Harald, der sich hartnäckig an das Deutsche hielt, solange er nicht sicher war, dass seine schwedische Aussprache gut genug war und er nicht wie ein Norweger klang.
*
Karlsson war mit dem Auto vorgefahren und hatte das Tor geöffnet. Ingeborg und die vier Kinder standen vor der Garage, um Vater, der nun in den Krieg zog, zum Abschied zu winken.
Sie hatte es wie ein Spiel organisiert, aber als er jetzt vor seiner Familie stand, fand Lauritz das Arrangement eher peinlich und melodramatisch als verspielt. Zur Not, aber wahrhaftig nur zur Not, konnte man behaupten, er »zöge in den Krieg«, wobei seine militärischen Einsätze ebenso nichtssagend wie kurz ausfallen würden.
Spiel oder nicht, jetzt war es zu spät für einen Rückzieher. Er nahm Rosa auf den einen und Johanne auf den anderen Arm und küsste sie zum Abschied. Harald und Karl gab er männlich die Hand, und Ingeborg küsste ihn theatralisch und tat so, als müsse sie sich eine Träne aus dem Augenwinkel wischen. Diese Ironie wusste er in diesem Augenblick gar nicht zu schätzen und hatte das Gefühl, dass sie sich über ihn lustig machte.
Er trug einen Wolfspelzmantel über dem Arm, da die Nächte im April noch empfindlich kalt sein konnten und die Einberufenen aufgefordert worden waren, warme Kleidung mitzubringen. Der Landsturm stellte keine Uniformen, nur ein Gewehr mit Bajonett sowie einen Dreispitz im Stil des 18. Jahrhunderts, wie ihn die schwedischen Truppen Karl des XII. getragen hatten, die in Norwegen besiegt worden waren.
Es war jedoch ein schöner Morgen, und Karlsson hatte für ihn das Verdeck heruntergeklappt. Lauritz zog seine Ledermütze auf und klappte seine Schutzbrille herunter, setzte sich hinters Lenkrad, salutierte scherzhaft, legte den ersten Gang ein und beschleunigte Richtung Tor. Auf dem Källvägen blickte er noch einmal zurück. Seine Familie winkte hinter ihm her, als würde er ans andere Ende der Welt reisen. Erst da sah er ein, wie rührend und komisch die Situation eigentlich war. Er lachte und winkte zurück.
Unterhalb des Källvägen öffnete sich der Blick auf die Hotelbucht und das strahlend weiße Grand Hotel zwischen den niedrigen, windgebeugten, für die schwedischen Schären typischen Kiefern, die so anders aussahen als die mächtigen, hohen Tannen auf Osterøya. Er bog nach links auf die Strandpromenade ein und schaltete in einen höheren Gang.
Jetzt war er zumindest auf dem Weg, daran ließ sich nichts ändern. Jeder Mann musste seinen Einsatz für das Vaterland leisten, obwohl es für ihn nicht selbstverständlich war, Schweden als das Vaterland zu betrachten. Aber er war nun einmal gebürtiger Staatsbürger der schwedisch-norwegischen Union und jetzt auf dem Weg, seine Pflicht zu tun, obwohl rein militärisch betrachtet nicht ganz nachvollziehbar war, worin diese Pflicht bestand. Deutschland würde das ihm freundschaftlich verbundene Schweden wohl kaum angreifen, Russland war bereits besiegt und hatte ohnehin genug mit seiner Revolution um die Ohren. Gegen welchen Feind sollte er Saltsjöbaden also überhaupt verteidigen?
In Kürze würde er seinen Dienst beim Landsturm antreten, den er sich als eine Kombination aus Pfadfindern und Heimwehr vorstellte, bei dem die zu Jungen oder zu Alten ihren Militärdienst ableisteten. Er war mit seinen fast 43 Jahren auch bald zu alt für den Landsturm.
Körperliche Arbeit scheute er nicht, im Gegenteil. Das war es nicht. Aber mit Dreispitz, Gewehr und Bajonett Saltsjöbaden gegen einen nicht existierenden Feind zu verteidigen kam ihm geradezu lächerlich vor. Sollten die Russen aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz ausgerechnet Saltsjöbaden angreifen, würden sie sich kaputtlachen, wenn sie auf die in die Jahre gekommenen Soldaten aus dem 18. Jahrhundert stießen. Das konnte er im Stillen hoffen, nur war es wenig wahrscheinlich.
Aber hier ging es nicht um Wahrscheinlichkeit, sondern ums Prinzip und um Gerechtigkeit, denn es war die Schuldigkeit aller, die Last mit den Brüdern zu teilen, reichen wie armen. Dagegen ließ sich nichts unternehmen, und er musste sich wie alle anderen zum Dienst einfinden.
Natürlich hatte er gewisse Vorkehrungen getroffen, um sich die kurze Zeit in dieser Witzarmee zu erleichtern. Deswegen saß er auch selbst am Steuer des Wagens, der nun zum »Hauptquartier«, einem Zeltlager am Pålnäsviken, fuhr. Das Normale wäre gewesen, Karlsson mit dieser Aufgabe zu betrauen.
Er hätte auch einen stärkenden Spaziergang dorthin unternehmen können. Von der Strandpromenade nach Neglinge, über die Brücke zum Arbeiterviertel von Saltsjöbaden, hätte er nicht länger als eine halbe Stunde gebraucht. Zügig lange Strecken zurücklegen konnte er immer noch.
Es war natürlich kein Zufall, dass das Quartier im Arbeitergebiet nördlich der Bahn lag. Hätte man einen russischen Angriff von See befürchtet, wäre eine Befestigung weiter östlich, Richtung Algö, sinnvoller gewesen. Aber die Hungerkrawalle im Vorjahr hatten den Ausschlag gegeben. Sie hatten nicht nur in Saltsjöbaden, sondern im ganzen Land stattgefunden. Es war nicht ganz klar, was die Randale in Saltsjöbaden ausgelöst hatte, und Ingeborg und er waren ohnehin erst später zugezogen. Offenbar war es um eine Schiffsladung verrotteter Rüben und um hungrige Kinder gegangen. Die Proteste waren ausgeartet und als Krawalle bezeichnet worden, und man hatte den Landsturm herbeizitiert. Und hier war man also immer noch stationiert, obwohl es hieß, Saltsjöbaden habe die anstelligsten Arbeiter in Schweden, die allesamt für Wallenberg tätig waren.
Als er auf den provisorischen Kasernenhof am Pålnäsviken zwischen den Zeltreihen einbog, fand er dort keinen ausgewiesenen Parkplatz vor und hielt daher vor dem größten Zelt mit der schwedischen Marineflagge und den Fahnen des Landsturms. Er stieg aus und schob seine Schutzbrille in die Stirn.
Da sich schwerlich an eine Stofftür klopfen ließ, betrat er ohne Umschweife das Zelt, das offenbar dem Stab zur Unterbringung diente. An ein paar wackligen Tischen saßen vier Offiziere, zwei davon in ordentlichen Armeeuniformen mit deutlichen Rangabzeichen, die ihm jedoch nichts sagten. Er ging davon aus, dass der dickste in der Mitte das Sagen hatte, weil die zwei anderen nur provisorische Uniformen trugen. Alle vier schauten verstört hoch und starrten ihn feindselig an.
»Was fällt Ihnen ein, hier so nassforsch reinzuplatzen?«, fragte der Dicke in der Mitte. Er trug genau wie ein echter deutscher Offizier ein Monokel.
»Ich bin Direktor Lauritz Lauritzen und melde mich zum Dienst«, entgegnete er. »Mit wem habe ich die Ehre?«
»Ich bin Major von Born. Warten Sie bitte draußen, bis Sie gerufen werden, Direktor Lauritzen!«, befahl der Obermotze.
»Wo kann ich bitte meinen Wagen abstellen?«, erkundigte sich Lauritz so ungerührt, wie er nur konnte. Ein unbehagliches Gefühl beschlich ihn.
»Was wollen Sie damit sagen, Herr Direktor? Sind Sie mit dem Auto gekommen?«
Vor Verblüffung ließ der Major sein Monokel fallen, fing es aber elegant mit der rechten Hand auf.
»Ich muss allerdings nicht nur das Automobil versorgen, im Kofferraum steht außerdem eine Kiste Kognak, die vielleicht an einem passenderen Ort verwahrt werden sollte«, sagte Lauritz, als sei es das Selbstverständlichste der Welt.
Dem war natürlich ganz und gar nicht so. Kognak war wie alle anderen alkoholischen Getränke streng rationiert.
Ungläubig starrten die vier Offiziere ihn an.
»Inspektion!«, befahl der Major, und alle vier erhoben sich und verließen das Zelt. Sie versammelten sich um den Wagen und versuchten, sachkundig auszusehen, einer von ihnen trat sogar vor und versetzte dem Vorderreifen probeweise einen Tritt.
Bei dem Wagen handelte es sich um einen Hispano-Suiza, 1917 gebaut, von dem es, soweit Lauritz wusste, nur drei Exemplare in Schweden gab. Die lange Motorhaube glänzte schwarz, die runden Scheinwerfer aus Messing waren frisch poliert und der Rahmen, der den silbernen Kühlergrill umgab, ebenfalls. Das Innere des Wagens war mit blutrotem Leder ausgekleidet.
Lauritz beantwortete einige Fragen über Pferdestärken und Höchstgeschwindigkeit und öffnete dann den Kofferraum, von dem er annahm, dass er das eigentliche Objekt der Inspektion darstellte. Die vier Offiziere betrachteten andächtig die stabile Holzkiste, in der die mit Holzwolle gepolsterten Kognakflaschen standen.
»Hauptmann Johansson, angenehm!«, stellte sich der Mann vor, den Lauritz für die Nummer zwei hielt, und streckte seine Hand aus.
Auf dieselbe Art stellten sich die beiden Landsturmoffiziere vor.
»Lauritzen wird zum Dienst im Stab abgestellt!«, befahl Major von Born.
Die Dinge begannen sich in wünschenswerter Weise zu entwickeln, und so ging es auch weiter, nachdem die Kiste mit dem Kognak diskret in das Stabszelt getragen worden war.
Die Abteilung 117 Saltsjöbaden des Landsturms hatte zwei Aufgaben, erfuhr Lauritz, als der Major mit ihm das Quartier und die Bauarbeiten inspizierte, deren Ziel ein langer Schützengraben fünfzig Meter oberhalb des Strandes war. Verschwitzte, grimmige Männer gruben auf einer fast hundert Meter langen Strecke. Als Lauritz nach dem Zweck dieser Baumaßnahme fragte, erhielt er eine vage Antwort, die er dahingehend deutete, dass der Russe, falls er Schweden trotz seiner Revolution angreifen und für die Landung ausgerechnet Saltsjöbaden wählen sollte, und zwar just jenen Strand, an den der Landsturm verlegt worden war, dann würden alle Mann den Schützengraben besetzen, um von dort aus den Feind niederzukämpfen.
Lauritz konnte nicht glauben, dass diese militärische Aufgabe ernst gemeint war. Sie kam ihm eher wie eine Art Placebo vor, wie seine Ehefrau es ausgedrückt hätte, eine Maßnahme, die Männer zu beschäftigen, nachdem sie nun einmal den Regeln und Prinzipien gemäß zu den Fahnen gerufen worden waren, um das Vaterland zu verteidigen.
Die Abteilung 117 Saltsjöbaden des Landsturms erfüllte sicherlich noch eine andere, ernsthaftere Funktion.
In der Tat war ihr die Aufgabe zugefallen, die Kommunisten zu internieren und zu bewachen, und zu diesem Zweck war nach geltendem Recht die Tennishalle neben dem Grand Hotel als Gefangenenlager requiriert worden. Eine gründliche Inventur der Kommunisten Saltsjöbadens hatte ergeben, dass es hier nur ein Exemplar gab, den Tischler Gottfrid Lindau. Dieser Kommunist saß jetzt ordnungsgemäß in der Tennishalle ein, und es oblag dem Landsturm, ihn zu bewachen. In Drei-Stunden-Schichten wurde tagsüber um die Tennishalle patrouilliert. Nachts wurde Gottfrid unter der Bedingung, dass er nicht ausriss, sich selbst, seiner Lektüre und seinem Schlaf überlassen.
Lauritz hatte den Eindruck, dass die bescheidene Präsenz des Kommunismus in Saltsjöbaden geradezu eine Enttäuschung darstellte. Und nicht zuletzt den Tennisspielern der Gemeinde musste unangenehm aufstoßen, dass die Tennishalle auf diese Art blockiert wurde, wenn auch mit Verweis auf die Sicherheit des Reiches. Die Tennisenthusiasten konnten sich jedoch damit trösten, dass man bald wieder im Freien spielen konnte.
Wie auch immer gehörte es zu den angenehmeren Aufgaben, mit einer Mauser M/96 mit aufgepflanztem Bajonett um Gottfrid und die Tennishalle zu patrouillieren.
Daher ergab es sich fast von selbst, dass Lauritz, der zusammen mit seinem Kognakvorrat beim Stab einquartiert worden war, diesen Dienst versah, der überdies dadurch vereinfacht wurde, dass er mit dem eigenen Auto zum Grand Hotel fahren konnte.
Er kam sich ausgesprochen albern vor, als er zum ersten Mal mit Wolfspelz – das schöne Frühlingswetter war Kälte und Schneeregen gewichen –, Gewehr, Bajonett und Dreispitz auf dem ausgetretenen Postenweg seinen Rundgang um die Tennishalle begann. Nicht nur, dass ihm diese Aufgabe vollkommen sinnlos vorkam und von nützlicher Arbeit in seinem Büro in Stockholm abhielt, sondern es war fast schlimmer noch, so lächerlich ausstaffiert gute Miene zu sinnlosem Spiel zu machen und Respekt vor der Landesverteidigung an den Tag zu legen.
Als er sich das nächste Mal zum Dienst einfand, war der Kollege, den er ablösen sollte, unauffindbar, ehe er zu Lauritz’ großem Erstaunen durch die angeblich abgeschlossene Haupttür der Tennishalle ins Freie trat, in derselben Aufmachung wie er selbst, jedoch ohne Pelz, und ihm zuwinkte. Lauritz war Architekt Westman nur einmal flüchtig bei einem Frühstück auf dem Stützpunkt begegnet und hatte bei dieser Gelegenheit mit ihm vereinbart, sich bald einmal ausführlicher über den Bau von Eigenheimen zu unterhalten.
Als er Westman nun erstaunt fragte, ob es passend oder überhaupt zulässig sei, den Kommunisten sozusagen von innen zu bewachen, erhielt er erst nur ein wegwerfendes Lachen zur Antwort, gleich darauf aber eine scherzhafte Erläuterung, dass Bewachung aus nächster Nähe noch sicherer für das Reich wäre. Außerdem stelle Gottfrid eine äußerst interessante Bekanntschaft dar, er sei sowohl gebildet als auch höflich, vielleicht ein wenig reserviert, aber das sei im Hinblick auf die Umstände durchaus verständlich. Jedenfalls solle er nur hineingehen und ihm Guten Tag sagen, Gottfrid habe gegen Gesellschaft nichts einzuwenden. Und auch das sei nachvollziehbar, schließlich sei er ein einsamer Kommunist.
Lauritz nutzte diese erste Gelegenheit nicht, den Kommunisten in der Tennishalle kennenzulernen. Er war sich nicht ganz im Klaren, warum, doch irgendwie erschien es ihm noch undenkbarer, als mit Mauser-Gewehr, Dreispitz und ernst patriotischer Miene herumzulaufen. Aber seine Neugier war geweckt und schon bald stärker als seine recht diffusen Vorstellungen von der Etikette beim Bewachungsdienst.
Drei Tage später, als der Stab per Bahn nach Stockholm reiste, um dort an einer geheimen Besprechung der Verbindungsoffiziere teilzunehmen, die vermutlich in einem der besseren Restaurants der Stadt stattfand, versah er den Abenddienst. Es war immer noch kalt, der Frühling ließ auf sich warten.
Der Kommunist saß unter dem Netz des Centre-Courts, vermutlich weil dort die Beleuchtung am besten war. Auf dem Tisch vor dem Internierten waren Bücher aufgestapelt, recht viele davon sogar auf Deutsch. Lauritz stellte sich vor und erklärte, sein Kollege Westman habe gesagt, man dürfe durchaus zu einem kleinen Plausch eintreten. Der Kommunist erhob sich, gab Lauritz die Hand, holte einen Stuhl und schob ihn an den Tisch. Dann bedeutete er Lauritz, Platz zu nehmen. Lauritz wusste nicht recht, wie er das Gespräch beginnen sollte, und versuchte das Eis zu brechen, indem er einen silbernen Flachmann mit Kognak aus der Tasche zog. Der Kommunist erwies sich jedoch als Abstinenzler.
Ein peinliches Schweigen folgte, während sie einander betrachteten. Lauritz hatte sich eher einen grobschlächtigen Mann mit schwarzer Schirmmütze und einem roten Rauschebart vorgestellt, Gottfrid stellte in dieser Hinsicht eine klare Enttäuschung dar. Er war recht groß und schlank und trug einen kleinen, gepflegten Schnurrbart, und sein gewelltes Haar lenkte die Gedanken eher auf Tanzrestaurants als auf brüllende Volksmassen im Winterpalast in Petrograd.
Die Unterhaltung war anfangs recht zäh.
»Es gab also nur einen Kommunisten unter den dreitausend Einwohnern des Ortes?«, fragte Lauritz.
»2826, sofern es seit meiner Internierung keinen Zuwachs gegeben hat«, berichtigte ihn Gottfrid. »Aber im Übrigen stimmt es, dass alle anderen Sozialdemokraten sind, das heißt natürlich nur nördlich der Bahn. Aber dort wirst du ja wohl kaum wohnen?«
»Nein«, gab Lauritz zu und beschloss zu ignorieren, dass ihn der andere duzte. »Ich wohne an der Strandpromenade 2.«
»Dann bist du also ein ganz legaler Rechter?«
»Wie zu hören ist, bin ich eigentlich Norweger.«
»Was ja nun keine politische Zuordnung ist.«
»Meine Gattin Ingeborg ist jedenfalls Sozialdemokratin«, versuchte sich Lauritz aus der Affäre zu ziehen.
Erstaunlicherweise funktionierte seine Taktik. Gottfrids Miene hellte sich auf.
»Ingeborg«, rief der Tischler. »Bist du mit der Doktorin verheiratet? Eine feine Frau, das muss ich wirklich sagen. Ich meine nicht fein wie die Damen von der Strandpromenade, sondern ein guter Mensch. Du musst wissen, dass sie für die freiwillige Arbeit, die sie in Neglinge leistet, allgemein sehr geschätzt wird.«
Damit war das Eis gebrochen. Ingeborg hatte zu Hause noch keine Praxis eröffnet und verbrachte viel Zeit damit, sich um die Kinder der Armen in Neglinge zu kümmern. Der Respekt, den ihr das einbrachte, färbte jetzt unverdient auf ihren Mann ab.
Da Saltsjöbaden ein neu entstandener, von Wallenberg gegründeter Ort ohne Geschichte war, fragten Bewohner, die einander zum ersten Mal begegneten, gerne nach dem Anlass des Zuzugs. Dieses Gesprächsthema ergab sich ebenso selbstverständlich wie andernorts das Wetter.
Nach dem Generalstreik 1909, einem Kampf, den die Arbeiter verloren hatten, war Gottfrid, der genau zehn Jahre jünger war als Lauritz, auf die schwarze Liste geraten und hatte demzufolge keine Arbeit bekommen. Die Polizei hatte den Arbeitgeberverband mit detaillierten Verzeichnissen versorgt. Nach sechs schweren Jahren hatte er von der Möbelfabrik in Moranviken in Saltsjöbaden gehört, die ihn anfänglich nicht interessiert hatte, denn wer wollte sich schon gerne in Wallenbergs Privatzoo niederlassen? Aber ein Arbeitsloser konnte nicht wählerisch sein, und der Besitzer der Möbelfabrik, Axel Andersson, gehörte nicht der Arbeitgebervereinigung an und kümmerte sich nicht um irgendwelche schwarzen Listen, sondern nur darum, ob jemand ein guter Tischler war und nicht trank. Jetzt wohnte Gottfrid mit Frau und Kindern in einer Einzimmerwohnung in Neglinge und beherbergte außerdem noch seinen Bruder auf der Küchenbank, da dieser kein Dach über dem Kopf hatte. Aber das würde sich sicherlich ändern.
Lauritz hatte nur vage von dem Generalstreik 1909 gehört. Damals wohnte er noch in Bergen und wusste nichts von schwarzen Listen. In seiner Funktion als Arbeitgeber, der er zugegebenermaßen war, hatte er noch nie Konflikte mit den Arbeitern gehabt. Es galt, die richtigen Vorarbeiter anzuheuern, ordentliche Kerle, denen sowohl er als auch die Arbeiter vertrauten und die den Akkord aushandelten. Der beste Vormann, den er je gehabt hatte, war ein Bahnarbeiter namens Johan Svenske gewesen, falls er von dem schon mal gehört habe.
Gottfrid kannte ihn nicht, aber Lauritz’ Geschichte von dieser bemerkenswerten Form der Klassenzusammenarbeit, wie er es nannte, interessierte ihn außerordentlich, und er stellte eine Menge eifriger Fragen.
Hatten Lauritz’ Arbeiter denn nie gestreikt? War es nicht einmal zu einem kleinen spontanen Streik gekommen? Verhandelten die Vormänner oder er selbst mit den Gewerkschaften? Wer entschied über Entlassungen, er selbst oder die Vormänner?
Lauritz fühlte sich peinlich verunsichert, da ihn derartige Fragen bislang überhaupt nicht beschäftigt hatten. Im Baugewerbe passte sich die Zahl der Angestellten stets der Konjunktur und den lokalen Rahmenbedingungen an. Im Augenblick sah es in Schweden recht düster aus, in Norwegen hingegen etwas besser.
Es galt also, eine kleine Zahl monatlich entlohnter Angestellter zu haben, die ihrerseits nach anstehenden oder annullierten Baumaßnahmen weiteres Personal anheuerten oder entließen.
Gottfrid schien skeptisch und entschied sich, das Gesprächsthema zu wechseln.
Wie hatte es Lauritz nach Saltsjöbaden verschlagen, kannte er etwa Wallenberg?
Lauritz räumte ein, dass diese Vermutung zutraf, erklärte aber auch, dass die Familie nach Stockholm gezogen war, da man gezwungen gewesen war, Bergen zu verlassen. Eine traurige Geschichte, die natürlich auf den Krieg zurückzuführen war. Seine Frau Ingeborg war ja schließlich Deutsche, wie Gottfrid vielleicht bereits wusste, da er ihr in Neglinge begegnet war?
Nein, Gottfrid hatte angenommen, dass sie Norwegerin war, genau wie Lauritz.
Nun, sie war Deutsche, fuhr Lauritz in seiner Geschichte fort, was bedeutete, dass die Kinder halb Norweger, halb Deutsche waren, was zu Beginn des Krieges keine Rolle gespielt hatte. Nach der deutschen Einleitung des totalen U-Bootkrieges waren jedoch immer mehr norwegische Seeleute der Handelsflotte umgekommen. Die Hafenstadt Bergen hatte es besonders hart getroffen. Daraufhin war es für Deutschstämmige wie seine Frau und deren Freunde immer schwieriger dort geworden.
Als Erstes waren die Freunde verschwunden, was erträglich war, weil alle hofften, dass sich das nach dem Krieg wieder einrenken würde.
Aber als ihr Sohn Harald in die Schule gekommen war, hatte sich etwas Schreckliches ereignet. Seine Schulkameraden hatten ihn fast zu Tode geprügelt, und er war auf dem linken Auge fast erblindet. Der Junge war traumatisiert, wie seine Frau Ingeborg es ausdrückte, er hatte einen schweren Schock erlitten, der dazu geführt hatte, dass er kein Norwegisch mehr sprach. Das hatte den Ausschlag gegeben. Die Firma besaß ein Büro und einige Immobilien in Stockholm, daher war man mehr oder weniger Hals über Kopf dorthin aufgebrochen.
Ein weiterer Zwischenfall hatte zwar weniger seiner Familie, aber umso mehr ihm selbst zugesetzt. Seine Rennjacht der größten Klasse, der einzige Gegenstand, den er je geliebt hatte und von dem er sich nie hatte trennen wollen, war von einigen Schuljungen in Brand gesteckt worden. Allein die verkohlte Ruderpinne war ihm geblieben.
In Stockholm war er dann Wallenberg begegnet, der ihm von seinem Projekt, einer modernen utopischen Gemeinde am Meer, erzählt hatte. Lauritz hatte die Idee von Anfang an großartig gefunden und sich diese Ansicht bis in die Gegenwart bewahrt. Den Kindern bot sich hier nur dreißig Bahnminuten von der Stadt entfernt ein viel gesünderes Umfeld.
Tja, auf diese Weise sei er also nach Saltsjöbaden geraten, berichtete Lauritz, aus Gründen, die sich einerseits sehr von jenen des schwarzgelisteten Gottfrid zu unterscheiden schienen, andererseits vielleicht auch nicht. Lauritz und seine Familie waren durch den Hass auf die Deutschen, den es hier nicht gab, hierhergenötigt worden. Im Gegenteil. Schweden stand auf der Seite Deutschlands, und die Königin war Deutsche. Hier hatten die Kinder in der Schule nichts zu fürchten.
Gottfrid Lindau hatte sehr aufmerksam, und ohne Lauritz mit Fragen zu unterbrechen, zugehört. Vielleicht hatte er instinktiv verstanden, dass der aus Bergen geflüchtete Ingenieur noch niemandem seine Geschichte erzählt hatte, jedenfalls nicht so drastisch kurz gefasst. Ihm selbst kam es zumindest so vor, als hätte er sie für sich selbst zusammengefasst, eine überraschende Beichte vor einem ihm vollkommen fremden Tischler, der noch dazu ein internierter Kommunist war.
»Wie kommt der Junge denn jetzt in der Schule zurecht? Ich vermute, dass er die Schule in Tattby und nicht die kostenlose Schule in Neglinge besucht. Und wie steht es mit dem Norwegischen?«, fragte Gottfrid nach einem langen nachdenklichen Schweigen.
»Er spricht jetzt Schwedisch«, erwiderte Lauritz, wobei sich seine Miene aufhellte. »Ich habe den Eindruck, dass er gelegentlich noch norwegische Worte einflicht, aber sein Schwedisch ist in der Schule sehr gelobt worden.«
»Wusstest du, dass hier in Saltsjöbaden Schwedens beste Werft liegt?«, fragte Gottfrid, den es zu erleichtern schien, dass die schwarzen Wolken, die sich über der Unterhaltung zusammengebraut hatten, rasch weitergezogen waren.
»Nein«, erwiderte Lauritz, »das wusste ich nicht. Können Schweden Boote bauen? Aber, Scherz beiseite, was für Boote werden dort gebaut?«
»Segelboote, Rennboote. Plyms Werft in Neglinge, du solltest ihr einen Besuch abstatten. Ich weiß, wovon ich spreche.«
»Woher? Kennst du dich mit Regatten aus?«
»So wenig wie mit Golf und Tennis, aber ich bin Tischler und habe mein ganzes Leben lang mit meinen Händen und mit Holz gearbeitet. Und was ich da unten bei Plym gesehen habe, hat mich überzeugt.«
Aus Höflichkeit versuchte Lauritz seine Skepsis zu verbergen. Der Bau eines modernen Rennsegelbootes erforderte mehr als nur gleichmäßige Leimfugen. Aber einen kurzen Höflichkeitsbesuch könnte er der Werft ja durchaus einmal abstatten. Wenn er einmal nichts Besseres zu tun hatte.
»Wie lange wirst du hier noch einsitzen müssen?«, fragte er, um das Thema ebenso resolut zu wechseln wie vor ihm Gottfrid.
»Bis der Krieg vorbei ist, vermute ich. In ihrer unergründlichen Weisheit glaubt unsere Obrigkeit, dass Frieden auf Erden einkehrt, sobald Deutschland gesiegt hat. Weil Russland es ihrer Meinung dann nicht mehr wagen wird, Schweden anzugreifen, und ein einzelner Kommunist in Saltsjöbaden wieder auf freien Fuß gesetzt werden kann.«
Zum ersten Mal während ihrer Unterhaltung musste Lauritz lachen und hätte dem anderen beinahe wieder die Taschenflasche mit dem Kognak hingehalten, besann sich dann aber und nahm einfach nur selbst einen Schluck.
»Himmel«, erwiderte er. »Wir wollen auf einen raschen deutschen Sieg hoffen, dieses grausige Elend währt nun schon viel zu lange. Könntest du bitte auf mein Gewehr aufpassen, während ich kurz in die Büsche verschwinde?«
*
Mit überraschender Kraft ging der Frühling direkt in den Sommer über. Zu dieser Zeit trauerte Harald, er war untröstlich und weinte sich oft in den Schlaf, wenn er glaubte, dass ihn niemand sah oder hörte. Alles war schwarz. Nicht einmal auf die langen Sommerferien konnte er sich freuen. Manfred von Richthofen, das größte Fliegerass aller Zeiten, war tot.
Die idiotischen Engländer brüsteten sich damit, den Roten Baron in einem ehrlichen Luftgefecht und nach hartem Kampf abgeschossen zu haben, was natürlich nicht stimmte. Eine verirrte Gewehrkugel, ein Zufallstreffer, verdammtes Pech, wie es sich zuvor nur zwei Mal zugetragen hatte.
Seine Mutter Ingeborg versuchte ihn auf jede nur erdenkliche Weise auf andere Gedanken zu bringen. Sie fuhr sogar nach Stockholm und kaufte ihm ein 25-Liter-Aquarium, aber auch das konnte ihn nur ein paar Tage lang ablenken. Die Stichlinge laichten im Frühling, und nur dann war der Unterschied zwischen Männchen und Weibchen zu erkennen. Im Sommer waren sie alle graugrün und hielten sich nicht mehr im seichten Wasser unter dem Steg auf, zumindest hatte er keinen einzigen Fisch mehr entdecken können. Und der eigentliche Auftrag, der ihm missglückt war und den er bis zum Erfolg wiederholen musste, galt den Stichlingen und keiner anderen Art. Es war also ausgeschlossen, die Stichlinge durch kleine Barsche zu ersetzen, obwohl auch die sehr schön waren.
Sein Vater Lauritz versuchte es mit einer eher fliegerromantischen oder vielleicht auch kriegerischen Methode. Er fertigte eine Konstruktionszeichnung von Richthofens Albatros Dr.I auf Millimeterpapier aus der Firma in Stockholm an und besorgte auch alles andere, was dafür nötig war, Balsaholz, Skalpelle, Japanpapier und schwarzen, weißen und roten Lack. Als die erste Tragfläche nach mehreren missglückten Versuchen fertig war, führte er vor, wie man das Japanpapier anfeuchtete, ehe man es auf der Tragfläche festklebte. Dabei galt es, behutsam vorzugehen und nicht zu viel Leim zu verwenden, da dieser Klumpen bilden konnte. Während es trocknete, zog sich das Papier zusammen und lag so gespannt auf der Tragfläche, dass man mit den Fingern vorsichtig darauftrommeln konnte. Dann war der Zeitpunkt für den roten Lack gekommen.
Als Harald glaubte, die Technik zu beherrschen, und an der nächsten Tragfläche arbeitete, rutschte er mit dem Skalpell ab und schnitt sich tief in das Gelenk des linken Daumens. Seine Mutter brachte ihn schimpfend in ihre Praxis im Erdgeschoss, während er den linken Arm über den Kopf hielt, und ermahnte ihn. Zu seiner Verteidigung bat er sie trotzig, die Verletzung ohne Betäubung zu nähen, da es sich ohnehin nur um lappri, eine Lappalie, handelte. Als sie das schwedische Wort nicht verstand, wäre ihm beinahe ein norwegisches herausgerutscht, aber er konnte sich noch in letzter Sekunde beherrschen.
Nachdem seine Mutter die Wunde gereinigt und eine chirurgische Nadel, Faden und kleine Schere bereitgelegt hatte, wiederholte er seinen Wunsch, ohne Betäubung genäht werden zu wollen, wobei er natürlich davon ausging, dass sie sich auf so eine fixe Idee nicht einlassen würde. Aber sie blickte nur nachdenklich drein, als sei der Vorschlag wirklich zu erwägen, zuckte dann mit den Achseln, willigte ein und forderte ihn auf, ihr seinen Daumen entgegenzustrecken.
Da war es zu spät, es sich anders zu überlegen, und ihm blieb nichts anderes übrig, als die Zähne zusammenzubeißen. Zwei Stiche waren nötig, aber kein Laut kam über seine Lippen.
Eine Weile fühlte er sich stolz und gut gelaunt, und sein Vater lobte seine Tapferkeit. Vielleicht war genau das die Absicht seiner Mutter gewesen.
Aber bald war die abgrundtiefe Trauer wieder da. Er begann sogar am deutschen Sieg zu zweifeln, da sich nun auch die Amerikaner auf die Seite der Angreifer geschlagen hatten und der Vater immer nachdenklicher wirkte, wenn er die Kriegsberichte in den schwedischen Zeitungen las. Außerdem durfte er die Skalpelle jetzt nur noch im Beisein des Vaters verwenden, aber dieser hatte sehr viel im Büro in Stockholm zu tun und kam in der Regel immer erst zum Abendessen nach Hause.
An einem regnerischen Tag lag Harald auf seinem Bett und las ein schwedisches Buch über Karl XII. und seine Siege gegen die Russen. Aus diesem Buch hatte er auch das Wort lappri, Lappalie, das der Heldenkönig hinsichtlich einer Schussverletzung am Fuß verwendet hatte. Da kam seine Mutter herein und schlug ihm vor, sie auf ihrer wöchentlichen Visite nach Neglinge zu begleiten. Eigentlich wollte er lieber weiterlesen, da er sich mitten in einer sehr spannenden Episode befand, die Kavallerie wollte die Russen gerade in die Knie zwingen. Aber ein Besuch in der verbotenen Zone war auch sehr reizvoll. Endlich würde er sich ein Bild davon machen können, ob der Unterschied zwischen den Arbeiterkindern und seinesgleichen wirklich so groß war, wie einige seiner Klassenkameraden behaupteten.
Der Regen spielte keine Rolle, da seine Mutter nicht mehr mit dem Fahrrad fahren musste. Karlsson pumpte Benzin aus großen Fässern, die unter einer Plane ganz hinten in der Garage standen. Das Benzin war zwar rationiert, aber die Lauritzens erhielten Benzin mit derselben Mühelosigkeit wie Kalbfleisch und Bohnenkaffee.
Als Erstes wollte seine Mutter Patienten im Zimmer der Schulschwester in der Volksschule in Neglinge empfangen. Er durfte im Behandlungsraum bleiben, wenn sie Jungen untersuchte, musste sich aber ins Nebenzimmer begeben, wenn es sich bei den Patienten um Mädchen handelte. Den Müttern der Jungen erzählte sie, sie habe ihren Sohn dabei, da sonst niemand auf ihn aufpassen würde, was alle zu glauben schienen, obwohl es sich um eine doppelte Lüge handelte. Zum einen war er zu groß für ein Kindermädchen, zum anderen war im Haus an der Strandpromenade immer jemand da.
Es war seltsam, mit anzusehen, wie seine Mutter andere Jungen mit derselben Zärtlichkeit behandelte wie ihn. Zu fast allen, die sie untersuchte, genauer gesagt zu ihren Müttern, sagte sie dasselbe: dass Kaffee schädlich sei und in höchstem Grade zur Unterernährung der Kinder beitrage. Einige erhielten ein Rezept, das von umständlichen Erklärungen begleitet war. Die Medizin müsse in der Apotheke in Nacka geholt werden, aber das Rezept sei als Fahrkarte dorthin gültig und die erstandene Medizin als Fahrkarte für den Rückweg. Die Eisenbahngesellschaft sei von dieser Regelung unterrichtet. In der Apotheke müsse dann mitgeteilt werden, dass die Medizin auf das Konto von Lauritzen gehe.
Das konnte nur bedeuten, dass sie Medizin verschenkte. Wusste der Vater davon?
Ein auffälliger Unterschied zwischen ihm, den Klassenkameraden in Tattby und den Arbeiterkindern in Neglinge waren natürlich die Kleider. Hier war man sommerlich und bequem gekleidet, aber ordentlich und mit Stil. Ein weiterer Unterschied bestand darin, dass fast alle Jungen, die seine Mutter untersuchte, sehr mager waren, worauf sie unentwegt hinwies und besonders betonte, es sei besser, nur sehr wenig oder überhaupt nichts zu essen, als Kaffee zu trinken.
Auch das war ein Unterschied. Die Kinder in Neglinge tranken Kaffee, das taten weder er selbst noch seine Klassenkameraden. Zum sonntäglichen Abendessen bekam er Wein, allerdings mit Wasser verdünnt, Kaffee jedoch nie.
Nach der Sprechstunde in der Volksschule wollte Mutter noch Hausbesuche machen, und Karlsson, der sich in Neglinge nicht auskannte, musste immer wieder anhalten und nach dem Weg fragen. Er erhielt gelegentlich recht ungehaltene Antworten, bis man seine Mutter auf dem Rücksitz entdeckte und dann doch freundlich den Weg erklärte.
In den Mietskasernen hinter dem Bahnhof erwartete Harald noch eine weitere Besonderheit. Nicht die Arbeiterkinder und ihre Krankheiten, die sich nicht von der Sprechstunde in der Volksschule unterschieden, auch nicht die Ermahnungen hinsichtlich Kaffee, Rezepten und Bahnfahrt, sondern die Art der Unterbringung der Menschen hier. Es war wie im Gefängnis, zumindest so, wie Harald sich ein Gefängnis vorstellte. Es gab keinen Platz, um sich zurückzuziehen, wenn das kranke Kind ein Mädchen war, denn die ganze Familie wohnte in einem Zimmer. Hatte ein Kind eine ansteckende Krankheit, konnte es nicht in einem eigenen Zimmer liegen. Männer, die noch nicht Mumps gehabt hatten, mussten sich bei einem Arbeitskollegen oder Verwandten einquartieren, bis ihre Kinder genesen waren.
Bei den Arbeitern roch es komisch, das war ein weiterer Unterschied. Nicht unbedingt ekelig, aber sehr anders.
Auf dem Heimweg saß er schweigsam auf dem Rücksitz und hielt die Hand seiner Mutter. Die Gedanken schwirrten auf diese hektische Art in seinem Kopf herum, wie wenn man sich das Hirn zermartert, aber nicht recht weiß, was dabei herauskommt. Es ging immer im Kreis.
Als das Auto über die Neglinge-Brücke fuhr, die die Arbeiter oder Dienstboten nicht ohne Genehmigung überqueren durften, empfand er eine regelrechte Erleichterung, als würde er aus einer fremden Welt zurückkehren. Am Ende der Bucht ragte der hohe Kirchturm auf, und die Häuser, die die Straße säumten, waren vertraut. Im Ringvägspark gingen Erwachsene spazieren, und Kinder vergnügten sich auf Schaukeln und Wippen.
Er hatte tausend Fragen, wusste aber nicht, wo er beginnen sollte. Seine Mutter half ihm nicht, sie lächelte nur sanft und drückte ihm ab und zu die Hand, ein heimliches Signal, das besagte, dass man sich mochte.
»Mutter, ich muss dich etwas fragen!«, bekam er schließlich mit Mühe über die Lippen.
»Ja, mein kleiner Freund, was willst du mich fragen?«
»Waren wir bei armen Leuten?«
»Ja, allerdings.«
»Dann sind wir also reich?«
»Ja, allerdings.«
Diese Erkenntnis traf ihn wie ein Schlag ins Gesicht, hart und vollkommen überraschend. Worte wie reich und arm hatte er bislang nur mit der Welt der Märchen, fern der Wirklichkeit, in Verbindung gebracht. Reich wie ein Troll. Arm wie eine Kirchenmaus.
Dann gab es so etwas also wirklich, obwohl es eine Art Geheimnis darstellte.
Alle seine Klassenkameraden wohnten in ähnlich großen Häusern wie er, aus Holz und rot angestrichen, weiß verputzt wie ihr eigenes oder gelb und braun, manchmal mit einem hohen Turm, manchmal auch ohne. Einige Familien besaßen ein Auto, andere fuhren mit der Bahn. Man besuchte sich gegenseitig und wurde immer zu Kakao und Zimtschnecken eingeladen.
Niemand wäre je auf den Gedanken gekommen zu sagen: »Hurra, wir sind reich.« So etwas wurde auf keinen Fall laut ausgesprochen, das wussten alle. So war es einfach. Über Geld wurde nicht gesprochen.
Er sah nachträglich ein, dass die Bemerkung seiner Mutter, dass die Kinder in Neglinge vor Glück weinen würden, falls sie Kalbsbraten bekämen, tatsächlich zutraf.
Eine große Frage drängte darauf, gestellt zu werden, aber seine Gedanken überschlugen sich, sein Gehirn arbeitete auf Hochtouren, und er konnte sich einfach nicht darauf besinnen.
»Ist das nicht wahnsinnig ungerecht?«, platzte er schließlich heraus.
Seine Mutter, die anderen Gedanken nachzuhängen schien, sah ihn erstaunt an. Sie hielten vor der roten Ampel an der Endstation der Saltsjöbanan am Grand Hotel, und der Zug ratterte gerade vorbei.
»Ja«, bestätigte seine Mutter ernst. »Wenn man das Leben der Neglinge-Kinder mit dem deinen vergleicht, so ist es in der Tat sehr ungerecht.«
»Ist die Armut der Grund dafür, dass die Kinder in Neglinge von dem vielen Kaffee so mager werden?«
»Ja, das könnte man sagen.«
»Warum trinken wir keinen Kaffee?«
»Das tun wir, aber unser Kaffee besteht nicht aus geröstetem Roggen, Baumrinde, geteerten Hanfseilen und was weiß ich noch alles.«
Bei dieser verwirrenden Antwort ging die Schranke bimmelnd hoch, und das Auto fuhr an. Er musste nochmals intensiv nachdenken, bis ihm eine neue Frage einfiel.
»Mutter, dass wir reich sind und die Leute in Neglinge arm, ist das gottgewollt? Vater sagt doch immer, dass alles in Gottes Hand liegt?«
»In dieser Hinsicht sind dein Vater und ich sehr unterschiedlicher Auffassung. Ich würde eher sagen, dass wir mehr Glück gehabt haben als die Armen.«
Die kurze Fahrt war bald zu Ende, sie waren wieder in der Strandpromenade angelangt. Nie zuvor hatte er darüber nachgedacht, dass das nahe gelegene Neglinge eine ganz andere Welt war als das hier.
Auch das Grundstück, das das Haus umgab, stellte eine Welt für sich dar, wenn nicht gar mehrere. Dort durfte er tun und lassen, was er wollte, solange er sich innerhalb der Betonmauer hielt. Es gab keinen besseren Ort in Saltsjöbaden, um Cowboy und Indianer zu spielen. Die große Höhle im Laubwäldchen, die die Erwachsenen eigentlich für ihre Sommerfeste und auch schwedische Krebsfeste nutzten, für die sicher die großen Lampions auf dem Speicher vorgesehen waren, eignete sich bestens für das Indianerlager.
Auf dem Spielplatz unter den alten Eichen, mit Schaukel, Klettergerüst und Rutschbahn neben dem Haus des Chauffeurs, konnte man Bogenschießen üben. Als fertig ausgebildeter Indianer konnte man dann an der Höhle vorbei den Hang hinunter zu dem Wäldchen aus Silbertannen und Lärchen schleichen und Eichhörnchen jagen, die mit einem Pfeil nur sehr schwer zu treffen waren. Als es ihm einmal gelungen war, tat es ihm einfach nur furchtbar leid, obwohl der Schuss phänomenal gewesen sein musste. Nachdem er das schwer verletzte Eichhörnchen vom Boden aufgehoben hatte, um ihm zu helfen, hatte es keuchend mit mehreren Atemzügen in der Sekunde geatmet, was seine Mutter später als Hyperventilation bezeichnet hatte. Es starb in seinen Händen, und er hatte ein paar Tränen vergossen, obwohl Vater gesagt hatte, in der Familie Lauritzen werde nicht geweint.
Danach wollte er dem Eichhörnchen ein Indianerbegräbnis bereiten und lud seine kleinen Geschwister dazu ein. Es wurde keine sonderlich geglückte Veranstaltung. Das kleine Tier lag auf einem Holzgestell, um seine letzte Reise zu den Geistern der Vorväter anzutreten. Aber das Eichhörnchen stürzte ab, noch ehe alles richtig Feuer gefangen hatte, und bald stank es beißend nach verbrannten Haaren. Das fand Johanne ekelig und fing an zu heulen, was keine große Rolle spielte, weil sie ein Mädchen war.
Man konnte sich hier aber auch auf Himalaja-Expeditionen begeben. Es gab zwei bekannte und erprobte Routen. Die steilere führte vom Silbertannenwald zum Spielhaus. Der Weg war steil und während des eigentlichen Aufstiegs abenteuerlich, endete aber immer mit einer Enttäuschung, da einen oben ein Spielhaus und keine schneebedeckte Hochebene erwartete. Schlimmstenfalls stand auch noch Johanne in Schürze und mit Kopftuch vor dem Spielhaus und wollte ihn zu einer imaginären Tasse Tee einladen.
Die andere Route war besser. Sie begann am Ende des Silbertannenwalds beim Haupttor an der Strandpromenade, wo sich der Wald lichtete und in vereinzelte Eichen und Buchen überging. Dort ignorierte man die Treppe und erklomm die Steigung zur Fahnenstange, die auf dem höchsten Punkt des Grundstücks aufragte.
Dort hatte Vater am 17. Mai die norwegische Flagge gehisst und damit einige Nachbarn verärgert, was in gewisser Hinsicht nachvollziehbar war. Hier in Schweden sollte man sich vermutlich auf schwedische Fahnen beschränken, obwohl die norwegische schöner war.
Vom Fuß der Fahnenstange konnte der Abstieg zum Bambushain, in dem die hellgrünen Pflanzen jetzt zu Beginn des Sommers noch ganz weich waren, in Angriff genommen werden. Dort konnte er sich mit der Machete, die er im hintersten Winkel des Speichers gefunden hatte, einen Weg durch das frühsommerliche Dickicht bahnen. Er war sich nicht sicher, ob es sich um eine echte Machete handelte, bis sie schließlich beschlagnahmt wurde. Da erfuhr er, dass es sich um ein Haumesser handelte, wie es die schwedische Flotte im 19. Jahrhundert verwendet hatte. Es eignete sich hervorragend, um sich damit durch die schwülen Bambuswälder am Fuße des Himalaja zu kämpfen, da es sowohl schwer als auch scharf war.
Zugegebenermaßen viel zu gut. Es trug ihm ordentlich Schelte ein. Und nicht genug damit, sein Vater verfügte auch noch, dass er an dem Familienausflug, ein Ganztagesausflug in die äußeren Schären, nicht teilnehmen durfte. Der Vater hatte sich ein großes Motorboot aus Mahagoni zugelegt, das sehr schnell war und einen beachtlichen Lastraum hatte, da es vorher einem berühmten Schnapsschmuggler als Transportmittel gedient hatte. Nach seiner Festnahme war das Boot beschlagnahmt und meistbietend verkauft worden. Da kaum jemand Lust verspürte, in einem berühmten Schmugglerboot herumzufahren, hatte der Vater es billig erstanden und in ein Familienboot mit zwei Salons und Schlafzimmern umbauen lassen. Jetzt sollte es mit einem längeren Ausflug eingeweiht werden. Die russischen U-Boote waren mittlerweile aus der Ostsee verschwunden, die nun wieder privaten Bootsausflüglern zugänglich war.
Die Strafe schmerzte sehr, als er in sein Zimmer hinaufgehen musste, während seine kleinen Geschwister lärmend ihre Sachen für den Ausflug zusammenpackten.
Natürlich bereute er es, den Bambushain in Wirklichkeit und nicht nur, was ebenso gut gewesen wäre, in der Fantasie abgeholzt zu haben, aber es war ein gutes Gefühl gewesen, mit dem schweren blanken Stahl die Bambusstämme zu fällen. Geschehen war geschehen und konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden, und die Strafe war nicht ungerecht.
Als er glaubte, die anderen seien bereits weggefahren, klopfte es unerwartet an der Tür, und seine Mutter trat ein. Sie sah ganz und gar nicht streng aus.
»Hat mein kleiner dummer Junge seine Tat jetzt genug bereut?«, fragte sie.
Eine Viertelstunde später ging die gesamte Familie vom Privatsteg an der Strandpromenade an Bord der mahagoniglänzenden Motorjacht, wie man bessere Boote nannte. Vater war bester Laune und trug eine Seglermütze mit Schirm und dem Wappen der Königlichen Schwedischen Segelgesellschaft.
Mit einer Geschwindigkeit von 25 Knoten nahmen sie Kurs auf die äußeren Schären, die sie im Handumdrehen erreichen würden, um sich dort eine einsame Insel zum Schwimmen, Picknicken und Sonnen zu suchen.
Er hatte das Gefühl zu fliegen, als er im offenen Teil des Cockpits saß, den Fahrtwind spürte und den Duft des Meeres einsog, der ihn an zu Hause, an Norwegen, erinnerte. Nein, korrigierte er sich, an die norwegische Westküste, nicht an zu Hause, denn zu Hause, das war Deutschland.
Deutschland hatte gerade die erwartete Schlussoffensive in Frankreich eingeleitet, bald würde Paris fallen, und dann war der Krieg endlich zu Ende. Dann konnte er nach Berlin fahren.
In rasendem Tempo flogen Inseln und Holme vorbei, und die Bugwellen des Bootes schlugen schäumend an die Ufer. Es war ein schwindelndes, unbegreifliches Glücksgefühl, dessen sich Harald nur ein ganz klein wenig schämte, da ja Manfred von Richthofen gefallen war.
II – Berlin
1923
Vermutlich war er vor allem Afrikaner. Wenn ihn nachts Albträume aus dem Krieg heimsuchten oder ihn die Fieberattacken schüttelten, dann träumte er immer auf Swahili.
Im Übrigen müsste man seine Nationalität errechnen. Achtzehn Jahre hatte er in Tanganjika gelebt, ehe man ihn 1919 als Kriegsgefangenen nach Europa verschifft hatte. Und er war achtzehn Jahre alt gewesen, als er Norwegen verlassen hatte, um in Dresden zu studieren. Die Jahre in Norwegen und in Afrika hielten sich also die Waage. Über die halbe norwegische Zeit seines Lebens war er jedoch ein Kind gewesen, während der Jahre in Afrika hingegen ein erwachsener Mann.
Was Deutschland betraf, konnte er seine fünf Studienjahre in Dresden mit den vier letzten in Berlin addieren und war also fünfzig Prozent so deutsch wie norwegisch oder afrikanisch.
Christa würde diese Überlegungen natürlich von der Hand weisen und erklären, dass es ganz seiner begrenzten Ingenieursseele entspräche, sich das Dasein mittels Rechenschieber zurechtzubiegen. Zweitens, dass die Frage der Nationalität ohne Belang, die momentane nationalistische Gesinnung nur ein Ausdruck der reaktionären Bestrebungen der Rechten und einzig und allein die Klassenzugehörigkeit entscheidend sei.
Der Klassenstandpunkt und nicht die Klassenzugehörigkeit, berichtigte er sich. Christa war dieser Unterschied sehr wichtig. Kein Wunder, schließlich war sie vor ihrem Abstieg zur bürgerlichen Frau Lauritzen, falls sie denn wirklich so bürgerlich waren, Freiherrin gewesen.
Er selbst war in einer Fischerfamilie an der norwegischen Westküste in einem Haus mit Torfdach zur Welt gekommen, und es gab in ganz Deutschland keinen einzigen Kommunisten, der diese noble Abstammung nicht anerkannt hätte. Diesen Standpunkt teilten die Kommunisten gewissermaßen mit den Rechten und den Nationalisten. Sie betrachteten ihn als einen Vorzeigearier, einen Angehörigen der höchsten Kaste innerhalb des germanischen Volksstammes. Es handelte sich um dieselbe abwegige Wikingerverehrung, die seine Brüder und er bereits während ihres Studiums in Dresden kennengelernt hatten.