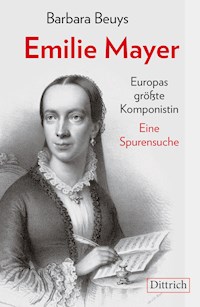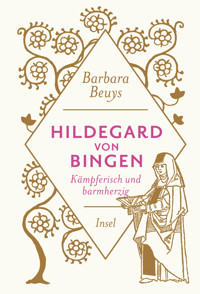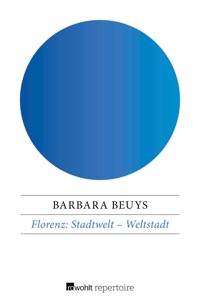21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Lagerkommandantin verkündet das Todesurteil. Da schneidet sich die Gefangene Mala Zimetbaum mit einer Rasierklinge in die Pulsadern. Ein SS-Mann packt sie am Arm. Mala reißt sich frei, schlägt ihm ins Gesicht und ruft: »Mörder, bald werdet ihr bezahlen müssen.« Und zu den Tausenden jüdischen Frauen, die im Lager Auschwitz-Birkenau gezwungen sind, Malas Ermordung mitanzusehen: »Habt keine Angst, das Ende ist nah … gebt nicht auf, vergesst niemals.« – Es ist der 15. September 1944.
Mala Zimetbaum wird 1918 in Brzesko, östlich von Krakau, in eine jüdisch-polnische Familie geboren. Nach einem Aufenthalt in Mainz vor 1918 leben die Eltern mit ihren vier Kindern ab 1928 in Antwerpen. Eine wirtschaftlich florierende Stadt, wo Mala in einem Modegeschäft arbeitet. Im Juli 1942 wird Mala bei einer Razzia festgenommen und im September ins Frauenlager Auschwitz-Birkenau deportiert. Dort hat sie als Läuferin und Dolmetscherin Einblick in alle Vernichtungsaktionen. Klug und risikobereit nützt sie ihre Informationen und leistet erfolgreich Widerstand: Sie rettet weibliche Häftlinge vor der Selektion ins Gas, verschafft Kranken leichtere Arbeit, knüpft Kontakte zwischen Widerstandsgruppen. Dann verliebt sie sich in den polnischen Häftling Edward Galinski. Ihnen gelingt die Flucht aus dem Lager, doch nach dreizehn Tagen werden sie wieder gefasst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Barbara Beuys
Die Heldin von Auschwitz
Leben und Widerstand der Mala Zimetbaum
Mit zahlreichen Abbildungen
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Insel Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2023.
Originalausgabe © Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2023
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Umschlagillustration: Seven Resist - Disorder Rebel Store, Berlin
eISBN 978-3-458-77796-0
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
1
. Kapitel
Was die Geburtsurkunde erzählt
.
20
. Januar
1918
: Mala, das jüngste Kind einer jüdisch-polnischen Familie, wird in Brzesko geboren – Im Zentrum spürt man bis heute den bürgerlich-freundlichen Charakter
2
. Kapitel
Wie die Juden nach Polen kamen
. Eine beispiellose Erfolgsgeschichte, die im
19
. Jahrhundert ein bitteres Ende findet
3
. Kapitel
Auf nach Mainz
. Die Eltern ziehen mit drei Kindern an den Rhein – Jüdische Reformgemeinde und Orthodoxe: ein Teil der wohlhabenden Mainzer Gesellschaft – Der Erste Weltkrieg durchkreuzt alle Pläne
4
. Kapitel
Zwischenstationen
. Zurück in Brzesko – Vater Pinkas Zimetbaum geht nach Ludwigshafen
5
. Kapitel
Antwerpen
:
Gekommen
,
um zu bleiben
. Eine Chronologie des Wiedersehens
6
. Kapitel
Malas neues Zuhause
. Eine weltoffene Metropole: lebenslustig, wirtschaftlich erfolgreich und modern – Hier ist Belgiens größte jüdische Gemeinde – Erfolgreich auf einer renommierten städtischen Schule – Ein Job im Modegeschäft
7
. Kapitel
Gegensätze kreativ verbinden
. Eintauchen in die westliche Kultur – Freizeit in der zionistischen Jugendbewegung
8
. Kapitel
Durch demokratische Wahlen
Reichskanzler
. Adolf Hitler und das nationalsozialistische Deutschland
9
. Kapitel
Boykott als Widerstand
. Die jüdischen Gemeinden in Antwerpen verteidigen die »Rechte der Juden« – Bei flämischen Nationalisten wächst der Judenhass in bürgerlichen Kreisen – Belgien wird Ziel jüdischer Flüchtlinge
10
. Kapitel
Antwerpen
:
Zentrum antijüdischer Organisationen
. Eine Fluchtwelle löst neue antisemitische Krawalle aus – Vielfältige jüdische Kulturszene – Die Presse distanziert sich nicht – Hitler-Deutschlands Erfolge werden zum Vorbild – Das Lieblingschanson kommt aus Paris
11
. Kapitel
Eine Freundschaft beginnt
. Ab
1938
ist Charles Sand Malas ständiger Begleiter – Das Novemberpogrom in Deutschland bringt neue Flüchtlingsströme – Geschlossene Grenzen – Wer es ins Land schafft, darf bleiben
12
. Kapitel
Brutale Gewaltaktion in
jüdischen Vierteln
. Antwerpens Hafen öffnet sich für jüdische Flüchtlinge – Hitler beginnt mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg – Dänemark wird überfallen – Belgien ist überzeugt: Uns passiert nichts
13
. Kapitel
Krieg
:
Beginn der deutschen Besatzung
–
die jüdische Gemeinschaft schätzt das
»
kleinere Übel
«. Die deutsche Militärverwaltung gibt sich kompromissbereit – Das Leben im besetzten Antwerpen normalisiert sich – Die Jüdin Mala behält ihren Arbeitsplatz und genießt mit Charles ihre Freizeit –
1
. »Judenverordnung« im Oktober
1940
14
. Kapitel
Der Optimismus bleibt
. Berufsverbote nicht entscheidend – Das kulturelle Leben blüht – Organisierter Gewaltausbruch im jüdischen Viertel – Ist Mala im belgischen Widerstand aktiv? – Schulausschluss für jüdische Kinder
15
. Kapitel
Erste öffentliche Razzia, Antwerpen, Juli 1942
. Auch Mala trägt den gelben Stern – Sie könnte in die
USA
auswandern – Schild im Eiscafé: »Verboten für Hunde und Juden« – Am Hauptbahnhof verhaftet
16
. Kapitel
Von Fort Breendonk nach Mechelen
. »Spricht jemand Deutsch?« – Arbeit im neuen Sammellager – »Mir geht es gut« –
10000
Befehle zum Arbeitseinsatz – Transport I ins Ungewisse
17
. Kapitel
Erste nächtliche Razzien
. Die Familien werden aus ihren Wohnungen geprügelt – Ein Fluchtplan misslingt – Mala rettet ihre Neffen – Verfolgung auf offener Straße
18
. Kapitel
Mala im Transport
X
in Richtung Osten
. Hunde bellen, Männer brüllen: »Raus hier!« – »Ausziehen!« – Mala wird Nr.
19880
im Frauenlager Auschwitz-Birkenau
19
. Kapitel
Der Weg in die Vernichtung
. Madagaskar? – »Gut und richtig«, findet Hitler – Auch Sibirien ist keine Lösung – Neue Pläne müssen her – Die deutschen Eliten sind mit Eifer dabei –
KZ
Auschwitz ist zu klein – Zyklon B heißt die Lösung
20
. Kapitel
Berlin bestimmt Deportationsquote
. Gutes Geschäft für die Reichsbahn –
10000
Arbeitsbefehle an jüdische Menschen in Belgien – Ein neues Auschwitz-Lager für die Frauen
21
. Kapitel
Mit Privilegien Menschenleben retten
. Die Macht der
SS
-Frauen ist grenzenlos – Ohne Funktionshäftlinge geht es nicht – Mala stellt sich in den Dienst der Mörder und Täterinnen
22
. Kapitel
Läuferin Mala ist nicht korrumpierbar
. »Mädchen, seid mutig!« – Wohin fahren die Menschen in den Lastwagen? – Niemals ein Schlag ins Gesicht – Leichtere Arbeit für Kranke und Schwache – Die Lebensverhältnisse im Frauenlager: miserabler als in allen anderen
23
. Kapitel
Wir bleiben wir selber
. Mala verbreitet die neuesten Nachrichten – Ihre Autorität hilft den deportierten Griechen – Minister Goebbels im Berliner Sportpalast: radikalste Ausrottung – Die französische Sprache öffnet ein Erinnerungstor
24
. Kapitel
Über
20000
Gefangene im Frauenlager
. Das neue Orchester spielt Märsche zum Arbeitsbeginn – Ein »Familienlager« für Roma und Sinti entsteht –
4
Krematorien arbeiten jetzt Tag und Nacht – Postkarten an die Schwester
25
. Kapitel
Hat Mala Kontakt zum Widerstand
im Lager
? Giza Weissblum erkennt Mala im Lager wieder – Alma Rosé, deportierte Topmusikerin aus Wien, übernimmt das Frauenorchester – Tausende hören Konzerte im Lager – Mit riskanten Tricks gegen die Todesliste
26
. Kapitel
Der Beginn einer Liebe
. Mala Zimetbaum, Jüdin, und Edward
Gali
ń
ski
, katholischer Pole, folgen ihren Gefühlen – Treffpunkt Röntgenraum im Frauenlager
27
. Kapitel »
Mutig bis zur Verrücktheit
«. Mala bleibt ihrem doppelten Leben treu – Ein Kunstporträt für den Geliebten – Die mörderische Ungarn-Aktion beginnt –
4
Krematorien schaffen die Verbrennung nicht mehr – Der Fluchtplan zu dritt wird konkret
28
. Kapitel
Eine jüdische Frau gefährdet die Flucht
. Das Fluchtmotiv: Der Welt sagen, was in Auschwitz geschieht – Mala wirkt stiller und trauriger – Stolz und Hass bleiben – Edeks Freund verweigert sich der Flucht – Mala vertraut ihre Pläne
5
Frauen und
1
Mann an
29
. Kapitel
Mala und Edek überlisten die SS
:
Die flucht aus Auschwitz
-
Birkenau gelingt
. Edek trägt eine
SS
-Uniform, Mala den Overall eines männlichen Häftlings – Der Overall fliegt ins Kornfeld – Den
SS
-Mann begleitet nun eine nette Frau
30
. Kapitel
Das Frauenlager ist begeistert
. Die
SS
-Frauen sind empört – Keine romantische Idee – Ein Kassiber von Edek – Der verhängnisvolle Anruf
31
. Kapitel
In Einzelzellen im Todesblock
. »Ich war unendlich glücklich« – Schmeichelnde Verhörmethoden und Folter – Keine Namen werden verraten – Unterstützung durch andere Häftlinge – Charles Sand, der Ex-Verlobte, eine Nummer in Auschwitz – Im Männerlager wird ein Galgen aufgestellt
32
. Kapitel
Die Schlinge wartet schon
. Edek
Gali
ń
ski
fügt sich nicht – »Es lebe Polen«
33
. Kapitel
Die unvergessliche blutige Ohrfeige
. Zurück im Frauenlager – Mala zückt eine Rasierklinge –
SS
-Blamage vor Tausenden – »Meine Schwestern, fürchtet Euch nicht!« – Gnadenschuss, Gift oder lebendig verbrannt? – Eine Kraft über den Tod hinaus
Nachwort
Bildteil
Dank
Quellen- und Literaturhinweise
Ungedruckte Quellen in Archiven
Gedruckte Quellen und Literaturhinweise
Abbildungsnachweise
Personenregister
Informationen zum Buch
1. Kapitel
Was die Geburtsurkunde erzählt
20. Januar 1918: Mala, das jüngste Kind einer jüdisch-polnischen Familie, wird in Brzesko geboren – Im Zentrum spürt man bis heute den bürgerlich-freundlichen Charakter
1918
Die Familie war festlich gekleidet, die Stimmung feierlich-fröhlich, gemischt mit Neugier. Kerzen brannten. In der hebräischen Bibel lädt der 121. Psalm für einen solchen Freudentag zum Gebet ein: »Der Ewige ist dein Hüter / … Der Ewige hütet dich vor allem Bösen / behütet deine Seele. / Der Ewige bewacht dein Gehen und Kommen / von nun an bis in Ewigkeit.« Vor einer Woche, am 20. Januar 1918, einem Sonntag, hatte Chaja Feigel Schmalzer in dem Städtchen Brzesko, rund 55 Kilometer östlich von Krakau, zu Hause ihr sechstes Kind geboren, nach jüdischem Kalender am 7. Schwat 5678. Es ist durchaus möglich, dass ihr Mann, Pinkas Zimetbaum, während der Geburt seiner Frau mit dem Beten von Psalmen Beistand leistete.
Weil es ein Mädchen war, fand am 26. Januar 1918 die feierliche Namensgebung statt. Gewöhnlich wird der Name eines Mädchens vom Vater in der Synagoge beim Schabbat-Gottesdienst eine Woche nach der Geburt verkündet. Doch auch für fromme gesetzestreue Juden konnte es Ausnahmen geben. In diesem Fall wurde die häusliche Namensfeier durch die Autorität des Namensgebers bekräftigt. Diese Information und alle folgenden der Feier sind präzise in der Geburtsurkunde, die sich in Brzesko erhalten hat, aufgezeichnet.
Josef Schmalzer, der Großvater mütterlicherseits, der am 26. Januar 1918 im Kreis der Eltern und Geschwister seiner Enkelin den Namen Malke gab, hebräisch »Königin«, war mit dem Amt des Schammes – jiddisch »Diener« – in einer der vier steinernen Synagogen von Brzesko betraut.
Der Schammes trägt Verantwortung für die reibungslosen religiösen Abläufe in einer jüdischen Gemeinde, deren Verwaltung und kümmert sich um ein ausgewogenes soziales Leben. Dass dieses Amt nur ein vorbildlicher religiöser Jude ausüben darf, bestätigt der Grabstein für Josef Schmalzer auf dem jüdischen Friedhof von Brzesko. Der 1925 Verstorbene erfüllte nicht nur alle Gebote Gottes, er »liebte die Tora-Schüler und kauerte sich in ihren Schatten … und seine Seele stieg zum Himmel«. (Die Tora – »Lehre« – enthält die fünf Bücher Mose, den ersten Teil der hebräischen Bibel.)
Erinnerung ist ein Grundpfeiler jüdischer Identität, ob es die Geschichte der Juden durch die Jahrtausende betrifft oder die Generationen der Familie, aus denen das Individuum stammt. Der Tod beendet kein Leben.
Das neugeborene Mädchen war nach dem Willen des Großvaters ein Familienpfand der Erinnerung, denn drei ihrer Urgroßmütter trugen den Namen Malka bzw. Mala. Da keine Quelle aussagt, mit welcher Namensvariante das kleine Mädchen im Familienkreis aufwuchs, aber da es im Rückblick für alle »Mala« war, darf dieser Name ihr Leben kennzeichnen.
Es sind zwei Töchter und ein Sohn, die mit den Eltern am 26. Januar 1918 Malas Geburt feiern: Gittla (*1908), Salamon Rubin (*1909) und Marjem Jochwet (*1914 in Mainz). Doch die Freude über die kleine Mala war unzertrennlich mit der Erinnerung an Chiel (1906-1907) und Juda (1911-1914) verbunden; für immer würden die früh Verstorbenen als Söhne und als Brüder der drei lebenden Geschwister im Gedächtnis bleiben.
Die Eltern, Pinkas Zimetbaum und Chaja Schmalzer, wurden 1881 in Brzesko geboren; 1905 haben sie dort geheiratet – zweifach. Denn sie vollzogen ihre Heirat nicht nur als Trauung unter der »Chuppa«, dem jüdischen Hochzeitsbaldachin. Sie schlossen auch eine Ehe nach zivilrechtlichen Vorgaben. Weshalb Mala in ihrer Geburtsurkunde die Kennzeichnung »legitim« erhält.
Ihr Vater dagegen galt nach dem weltlichen Gesetz als »illegitim«, weil seine Eltern, Malas Großeltern – Berl Hartman und Marjem Jochwet Zimetbaum – allein nach dem jüdischen Gesetz heirateten. Die Folge war ein ziemliches Durcheinander in staatlichen Papieren, die Malas Vater betrafen: Mal wurden sie auf Pinkas Zimetbaum, mal auf Pinkas Zimetbaum-Hartman ausgestellt. Mala und ihre Geschwister nutzten die Chance und wählten als Erwachsene je nach Vorliebe Zimetbaum oder Hartman zu ihrem Nachnamen.
Malas offizielle Geburtsurkunde nimmt die weltliche Dimension ebenso ernst wie die religiöse: »Das Kind wurde durch Chane Reiser, Hebamme in Brzesko, auf die Welt gebracht.« Welche Wertschätzung dieser weibliche Beruf im Judentum hat, lässt sich an Grabsteinen des Mittelalters ablesen. Nur bei Hebammen wird nach dem Tod auf dem Grabstein ihr Beruf eingemeißelt, und wieder zeigt sich die Kraft jüdischer Erinnerung.
Das 2. Buch Mose berichtet, dass der Pharao den hebräischen Geburtshelferinnen Schifra und Pua, die damals wie das ganze jüdische Volk in Ägypten lebten, einen mörderischen Befehl gibt: »Wenn es ein Sohn ist, sollt ihr es töten; ist es aber eine Tochter, mag es leben.« Doch die beiden Frauen widersetzten sich der Vernichtung ihres Volkes und »ließen die Knaben am Leben«.
Vom alten Ägypten zurück nach Brzesko, das in einer osteuropäischen Kulturlandschaft lag, die seit Jahrhunderten von der jüdischen Bevölkerung geprägt wurde – Galizien. Als Pinkas Zimetbaum und Chaja Schmalzer in Brzesko ein Paar wurden, wo die meisten ihrer Vorfahren zu Hause waren, hatte sich gerade Schreckliches, aber auch Erstaunliches ereignet. Schrecklich war das Feuer, das 1904 ausgebrochen war, allein über 300 jüdische Häuser vernichtet und das städtische Leben zerstört hatte. Doch dank der Tatkraft des Bürgermeisters Henoch Klapholz stieg Breszko in den folgenden Jahren als modernisierte und rundum erneuerte Stadt wie Phönix aus der Asche. Das war doppelt erstaunlich: Denn mit Henoch Klapholz stellte die jüdische Mehrheit von Brzesko zum ersten – und einzigen – Mal den ersten Bürgermeister. Bis dahin war der oberste Bürger der Stadt selbstverständlich ein Katholik und sein Stellvertreter ein Jude.
Die Juden in Brzesko hatten kein Problem damit, bei Verteilung der höchsten städtischen Ämter zurückzustehen. Wussten sie doch, dass ihre religiöse Welt- und Lebenssicht von der christlichen Minderheit akzeptiert wurde. Seit Generationen war jeden Dienstag im Zentrum von Brzesko Markttag. Aus der Umgebung kamen vor allem jüdische Bauern und Händler mit Kutschen und Pferdewagen, um ihre Waren anzubieten. An den Ständen drängten sich Juden und Christen bis zum Sonnenuntergang, kauften und verkauften, tauschten mit großem Hallo Neuigkeiten aus – ein lebendiger Ort friedlich-fröhlicher Kommunikation. Fiel jedoch ein jüdischer Feiertag auf einen Dienstag, verzichteten die Christen ohne Murren auf den Markt. Ähnliches geschah freitags: Die Sitzungen des Gemeinderats wurden selbstverständlich vor Sonnenuntergang beendet. Denn zu diesem Zeitpunkt begann für die jüdischen Vertreter der Schabbat, an dem Ruhe höchste religiöse Pflicht war.
Entscheidend für das grundsätzlich konfliktfreie Miteinander war, dass radikale soziale Unterschiede sich in beiden gesellschaftlichen Gruppen in Grenzen hielten. Auf den Fotos im Regionalmuseum von Brzesko ist auch die ärmere jüdische Bevölkerung vertreten, die in Holzbaracken lebte, kaum Arbeit hatte und von regelmäßiger Hilfe der jüdischen Gemeinschaft abhängig war. Ein solider Teil der jüdischen Bevölkerung jedoch lebte in gutbürgerlichen Verhältnissen. Sie waren Unternehmer, Kaufleute und Handwerker; es gab jüdische Rechtsanwälte, Richter und Ärzte.
Wer heute auf einer Bank im gepflegten Zentrum von Brzesko, dem ehemaligen Marktplatz, sitzt, sieht dieselben Häuser wie einst Chaja Schmalzer oder Pinkas Zimetbaum, wenn sie dienstags auf den Markt oder wenn er in eine Synagoge ging: eine bunte Mischung, gelb und blau gestrichen, roter Sandstein, steinerne Dekorationsgirlanden, große runde Fenster, spitze Türme.
Die Häuser am Marktplatz sind Zeugen einer Vergangenheit, als viele Juden zu einem schönen Gesamtbild der städtischen Gemeinschaft beitrugen. Und keine Hemmungen hatten, ihren Glauben sichtbar an den Haustüren durch eine Mesusa – hebräisch »Türpfosten« – zu bezeugen. In einigen wenigen Türrahmen von Häusern im Umfeld des Marktplatzes hat sich die Silhouette dieser schlanken Kapsel erhalten. Im Innern einer Mesusa steht auf einem Zettel ein zentraler Text der Tora: »Höre, Israel! Der Ewige ist unser Gott; der Ewige ist Einer.«
In dieses städtische Umfeld wurde Mala Zimetbaum geboren; zehn Jahre wird es ihr Zuhause sein. Ihre Eltern besaßen kein eigenes Haus, davon zeugen die Geburtsurkunden ihrer Kinder. Jedes Mal ist eine andere Wohnung in Brzesko angegeben, allerdings nur nummeriert, so dass sich nicht ausfindig machen lässt, wo in der Stadt die Familie lebte. Der Kaufmann Pinkas Zimetbaum gehörte nicht zu den wohlhabenden Juden der Stadt. Die Familie konnte sich nur Mietwohnungen leisten.
Jede Feier geht einmal zu Ende, führt aus dem zeitlosen Miteinander zurück in die Gegenwart. Wenn die Erwachsenen an diesem Sonntag, dem 26. Januar 1918, die Kerzen löschten, war ihnen umgehend wieder bewusst, dass sie auch im kleinen abgeschiedenen Brzesko in einer Welt lebten, die aus den Fugen geraten war. Eine neue Weltordnung bahnte sich an, erzwungen durch einen Krieg, der seit 1914 vor allem Europa erschütterte.
Die Menschen in Brzesko lebten in der österreich-ungarischen Doppelmonarchie, in einem Landstrich, der bis zum Ende des 18. Jahrhunderts als »Galizien« zu Polen gehörte. Die Mehrheit der Bevölkerung war seit Langem jüdischen Glaubens. In seinem vierten Jahr schien sich dieser Krieg 1918 für Österreich und das mit ihm verbündete deutsche Kaiserreich immer tiefer in eine Niederlage zu verstricken.
Für die jüdischen Menschen in Brzesko war diese Aussicht durchaus mit Hoffnungen verbunden. Dabei kam ihnen die Erinnerung an weit zurückliegende historische Zeitabläufe zugute, die fest in ihrem Gedächtnis verankert waren. Die Geschichte der Juden in Polen über rund 500 Jahre war ein lebendiges Vermächtnis, das ihre Glaubensgenossen zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Stolz und selbstbewusster Tatkraft erfüllte. Wie ihre Vorfahren vertrauten sie darauf: Der Gott Israels würde alle begleiten, die neue Wege einschlugen. Dieses Grundvertrauen erfüllte jeden polnischen Juden, auch Pinkas Zimetbaum und Chaja Schmalzer. Sie gaben es selbstverständlich an ihre Kinder weiter. Auch Mala Zimetbaums Blick auf die Welt und ihr Leben ist grundlegend von dem Wissen um diese gemeinsame jüdische Vergangenheit geprägt worden.
2. Kapitel
Wie die Juden nach Polen kamen
Eine beispiellose Erfolgsgeschichte, die im 19. Jahrhundert ein bitteres Ende findet
1264-1900
Es war im Jahr 1565, als der päpstliche Legat in Polen aufschrieb, was ihm aufgefallen war: Es gab in diesem Land »große Massen von Juden, die nicht so verachtet sind, wie es anderswo der Fall ist. Sie leben nicht in einem Zustand der Erniedrigung, und sind nicht auf verächtliche Berufe beschränkt«. Sie konnten ohne Beschränkungen Medizin oder Astronomie studieren, mussten keine Zeichen an der Kleidung tragen, um sich von Christen zu unterscheiden. Und »sie verfügten über alle Bürgerrechte«.
Juden und Christen mit gleichen Rechten, gleichermaßen human behandelt? Undenkbar für den Mönch in Wittenberg, der seit 1518 gegen den Papst in Rom rebellierte. 1543 ließ Martin Luther seine Schrift »Über die Juden und ihre Lügen« veröffentlichen, präzisierte darin seinen theologisch begründeten Hass auf alles Jüdische und stellte Forderungen, deren Umsetzungen er von den politisch Verantwortlichen erwartete: Man soll die Synagogen in Brand setzen und vom Erdboden verschwinden lassen. Man soll die Häuser der Juden zerstören. Juden sollen auf den Straßen des Reiches keinen Schutz mehr genießen. Noch besser wäre es, sie aus dem Land zu jagen. Es sind protestantische Städte und Territorien, die Luthers Forderungen erfüllen und die jüdischen Menschen vertreiben. Es sind geistliche katholische Landesherren wie die Bischöfe in Mainz und Paderborn, die vertriebenen Juden in den 1570er Jahren in ihren Ländern Schutz bieten und sie als Händler und Unternehmer willkommen heißen.
Diese einladenden Gesten, nicht ohne politische Hintergedanken im Kampf gegen Luthers Anhänger, die Protestanten, können die radikalen antijüdischen Maßnahmen der katholischen Länder in den Jahrhunderten zuvor nicht verdecken. Aber Schwarzweißschablonen werden der europäischen Periode in der Geschichte der Juden, von denen ab dem 9. Jahrhundert die Mehrheit in Europa lebte, nicht gerecht. Ihr Einstieg in Europas Geschichte im frühen Mittelalter war kein finsteres Kapitel. Das Herrscherhaus der Karolinger, vor allem Ludwig der Fromme, der Sohn Karls des Großen, nahm die Juden unter seinen Schutz. Sie konnten zum Wohl des Landes freien Handel treiben. Von der Nordsee bis zu den Alpen, von der Elbe bis zum Atlantik lebten christliche und jüdische Familien als Nachbarn zusammen, die sich mit Achtung und Verständnis begegneten und Konflikte in ihr Miteinander integrierten.
Im 10. Jahrhundert wuchsen in den Städten längs des Rheins durch die gleichen christlichen Bautrupps die Wände der ersten Synagogen neben denen der ersten Kathedralen in den Himmel. Die Rabbis der jüdischen Gemeinden von Speyer, Worms und Mainz gehörten zu den führenden Autoritäten ihres Glaubens in Europa. 1120 stellte der Papst in Rom die Juden unter seinen Schutz, verurteilte jede Art von Zwangstaufen.
Doch mit dem Beginn des 13. Jahrhunderts begannen christliche Herrscher mit kirchlicher Rückendeckung den Juden ihren Schutz zu entziehen, verfolgten sie und verbrannten ihre Schriften. 1290 vertrieb England die jüdische Bevölkerung aus dem Land, Frankreich folgte 1306. Aber als die Verfolgungen begannen, wies der Gott Israels seinem Volk einen rettenden Ausweg: »Da fiel ein Zettel vom Himmel herab: Geht nach Polen!« Schon das Wort verhieß Gutes, denn »po-lin« bedeutet auf Hebräisch »hier nächtige«. Auch diese Erzählung ging ein in den Schatz der jüdischen Geschichte. Und dahinter stecken Fakten.
Es war im Jahr 1264, da ergriff der großpolnische Herzog Boresław der Fromme die historische Chance und erließ eine Schutzverordnung für die Juden in seinem Land, das Statut von Kalisz. Es garantierte ihnen gleiche Rechte, sogar Privilegien, was den Handel und die Niederlassung in Städten und Dörfern betraf, und gab die Zusage, ihre Gemeinden, die sie selbst verwalten durften, gegen Angriffe in Schutz zu nehmen. So öffnete sich für die im westlichen Europa verfolgten jüdischen Menschen ein rettender Ausweg in Polen. Über Jahrhunderte stand der katholische polnische Adel zu seinem Wort, überzeugt, dass die Wirtschaftskraft der Juden, ihre Handelskontakte weltweit und ihr generelles Engagement zum Wohl des Landes dem Wohlstand der ganzen Bevölkerung nutzen würden.
Das Zeugnis des päpstlichen Legaten von 1565 bestätigt es: Die Juden in Polen waren Händler und Kaufleute, aber ebenso in vielen Handwerksberufen tätig. Neben einer kleinen Oberschicht hatte sich eine breite jüdische Mittelschicht gebildet. Juden verwalteten die Güter des katholischen Adels, besonders in der Ukraine, und schlossen sie an den europäischen Wirtschaftskreislauf an. Sie wurden Pächter von Mühlen und Gastwirtschaften und zu Mittlern zwischen ländlicher und städtischer Bevölkerung. Katholische und jüdische Männer, Frauen und Kinder trafen sich nicht nur auf den Wochenmärkten, sondern auch zum gemeinsamen Feiern an ihren jeweiligen Festtagen.
Mit den günstigen Lebensbedingungen wuchsen das Interesse an Wissenschaft und Kultur und das jüdische Selbstbewusstsein. Während die Juden im westlichen Europa die Sprache ihrer christlichen Nachbarn übernahmen, entwickelten die Juden aus dem deutschsprachigen Raum, die in größter Zahl nach Polen zogen, ihre eigene Sprache. Die wurde zum Motor einer eigenen Kultur. Die Immigranten hielten am Mittelhochdeutsch des 15. und 16. Jahrhunderts fest. Vermischt mit hebräischem, aramäischem und slawischem Vokabular, entwickelte sich daraus im Osten eine eigene Sprache mit eigener Syntax: »jiddisch« – jüdisch. Die Stadt Brzesko wird den jiddischen Namen »Briegel« erhalten.
Ab dem 16. Jahrhundert entstehen in polnischen Städten jüdische Druckereien, die zahlreiche Werke für eine breite Leserschaft, darunter viele Frauen, in Jiddisch veröffentlichen. 1618 erscheint ein »Ratgeber« für Frauen, von Rebekka, der Tochter eines Rabbis, verfasst. Aus dem Jahr 1620 hat sich der Druck einer »Wayberbibel« eines Rabbis in Krakau erhalten.
In dieser Zeit wurde nach und nach bei jüdischen Männern eine Kleidung populär, die sie von den Christen unterschied: ein langer schwarzer Kaftan umgab den Körper, auf dem Kopf eine schwarze Mütze. Außerdem wurde es Brauch, einen langen Bart wachsen und die sogenannten Peies, Locken, zu beiden Seiten des Gesichts an den Schläfen vom Haupthaar herabhängen zu lassen. Wie es im 3. Buch Mose von Gott vorgeschrieben ist: »Ihr sollt den Rand Eures Hauptes nicht runden, und du sollst nicht zerstören den Rand deines Kinnbartes.«
Auch in Polen litt die jüdische Bevölkerung von Zeit zu Zeit unter Pogromen und Plünderungen, oftmals ausgelöst durch Hasskampagnen von Mönchen. Aber es blieb bei vereinzelten Attacken, weil König und Adel ihre schützende Hand weiterhin über die jüdische Bevölkerung hielten. Während in Deutschland 1348/49, als die Pest ausbrach, die jüdischen Menschen aus fast allen Städten vertrieben wurden, weil man sie für die Urheber dieser Katastrophe hielt. Ab 1495 konnten die Juden in Spanien nur noch wählen zwischen katholischer Taufe und Vertreibung. Die Zahlen der Juden, die in Europa von West nach Ost zogen, sprechen für sich: Um 1500 lebten in Polen-Litauen rund 24000 Juden, das waren 1 Prozent der Gesamtbevölkerung. Um 1650 sind es insgesamt rund 500000 Juden, die 5 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen.
In Brody, damals Polen, heute Ukraine, lebte Israel ben Elieser. Vor der Heirat Synagogendiener, hatte er sich davon frei gemacht, meditierte und entwickelte neue religiöse Rituale. Seine Frau führte eine Gastwirtschaft, um die Familie zu ernähren. Um 1700 geboren, löste er sich mit 36 Jahren aus der selbstgewählten Einsamkeit und reiste als Wunderheiler und charismatischer Menschenfreund über Land. Ob Krankheit oder Ernteschäden, Kinderlosigkeit oder tiefe Depression, dieser Mann brachte den Menschen mit heilender Magie die Lebensfreude zurück. Seine Erklärung: Er kannte das Geheimnis des göttlichen Namens – den kein Jude aussprechen durfte – und hatte als Auserwählter den Auftrag, dessen geheimnisvolle Kräfte zum Wohl der Menschen zu nutzen.
Wie ein Lauffeuer sprachen sich seine übernatürlichen Fähigkeiten bei den Juden im polnischen Galizien herum. Die immer zahlreicher werdenden Anhänger zeichnen ihn mit dem hebräischen Titel »Baal Schem Tow«, »Meister des Guten Namens«, aus; nach jüdischer Tradition mit den Anfangsbuchstaben auch zum Bescht verkürzt.
Wenn der Baal Schem Tow sich mit Hunderten seiner Anhänger traf, verkündete er keine abgehobenen gelehrten Sprüche, sondern berührte mit seinen Erzählungen die Herzen. Jeder durfte seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Die einen stöhnten und weinten, anderen wurde durch die extreme Nähe des Göttlichen der ganze Körper durchgeschüttelt. Auch zu den Mahlzeiten am Schabbat drängten sich Hunderte um den Meister, der jeden Toast fröhlich erwiderte – Le Chaim! Auf das Leben! Es wurde gesungen, getanzt und in die Hände geklatscht.
Mit dem Bescht etablierte sich erstmals im Judentum eine geistliche Autorität, die sich als Zaddik – »Heiliger« – verstand, sich direkt von Gott berufen fühlte, die Mitglieder unterschiedlicher Gemeinden um seine Person scharte und damit den Rabbi, der jeweils für eine Gemeinde zuständig war, auf den zweiten Platz verwies. Der Bescht bekam viele Schüler, jüdische Männer, die seine Anweisungen für ein erfülltes jüdisches Leben übernahmen. Es dauerte nicht lange, und einige dieser Schüler fühlten sich ebenfalls als Gottes Agenten und stießen auf Menschen, die sie zu ihrem Zaddik auserwählten.
Heftige Opposition von Gemeinden und ihren Rabbis gegen diese neuen Juden und ihre Führer, die in den Augen der Etablierten Ketzer waren, blieb nicht aus. Es ging auch um Machtansprüche, denn in keinem Land der Welt lebten um diese Zeit so viele Juden wie in Polen. Und doch kam es zu keiner Spaltung im Judentum. Der Baal Schem Tow und die folgenden Generationen von Zaddikim wollten keine jüdische Sekte gründen, sich nicht von der Gemeinschaft der Juden lösen, zu deren Verständnis seit Urzeiten scharfe Kontroversen gehörten. So entstand im 18. Jahrhundert im Osten Europas ein neuer kraftvoller Zweig am Stamm des Judentums, der bis heute weltweit als Chassidismus, »chassidut« hebräisch für Frömmigkeit, lebendig ist.
Schon in der Generation nach dem Bescht gaben die Zaddikim ihr Wanderleben auf, gründeten jeweils einen eigenen »Hof«, wo sie mit einer Mischung aus Magie und Herzensfrömmigkeit auftraten und schriftliche Botschaften verbreiteten. Sie verdrängten die innere Zerrissenheit der Menschen und der Welt nicht, sondern machten sie zum Kern ihres paradoxen Trostes. »Nichts ist so heil wie ein zerbrochenes Herz«, predigte Rabbi Nachman von Bratzlaw, der Urenkel des Baal Schem Tow, seinen Getreuen. Als er 1810 im Osten von Galizien, in Uman, begraben wird, bekennt sich über die Hälfte der Juden im ehemaligen Polen, das Russland und Österreich unter sich aufgeteilt haben, als Chassiden, Anhänger eines Zaddiks.
Der Zaddik war erfolgreich, weil er mythische Erlösungshoffnungen mit praktischen Lösungen für irdische Schwierigkeiten verband. Doch die neue religiöse Massenbewegung im polnischen Judentum kollidierte mit einem geistigen Aufbruch in Westeuropa, der in allen Bereichen nur die Vernunft als einzigen Maßstab gelten ließ. »Aufklärung« hieß das Zauberwort, das für die intellektuelle Elite in Politik und Kultur, Wissenschaft und Religion – Christen, Juden, Ungläubige – die Verheißung für eine radikal neue Welt in sich trug.
Der aufgeklärte jüdische Philosoph und Schriftsteller Moses Mendelssohn nannte die jiddische Sprache »Kauderwelsch« und fällte damit zugleich ein abschätziges Urteil über die polnisch-jüdische Lebenskultur. Noch vernichtender fiel das Urteil aus, wenn es sich um die religiöse Substanz der jüdisch-chassidischen Mehrheit in Polen handelte. »Ihre Geisteswelt versumpft zu einem unerquicklichen Aberglauben«, schrieb Heinrich Heine 1822 in seinem Bericht einer Polenreise. Und er fügte hinzu, »das Äußere der polnischen Juden ist schrecklich«. Dass jüdische Männer vor allem am Schabbat und den Feiertagen runde Pelzhüte auf dem Kopf trugen, die sich in Größe und Form je nach der Dynastie ihres Zaddik unterschieden, dazu Knickerbocker und weiße Strümpfe, war für den aufgeklärten Dichter ein weiterer Beweis für die primitive Welt der Juden im Osten. Es war der Anfang einer Entwicklung vom stereotypen Klischee und Vorurteil über Juden in Osteuropa, vor allem die polnischen, das sich im Laufe des 19. Jahrhunderts immer fester in den Köpfen von Juden und Nichtjuden im westlichen Europa festsetzte.
Acht Jahre nach der Notiz von Heinrich Heine wurde 1830 der 37-jährige Gelehrte Chaim Halberstam, der sich seit seiner Jugend offen zum Chassidismus bekannte, Rabbi von Nowy Sacz. Die Stadt, jiddisch Zans, liegt gut 50 Kilometer südlich von Brzesko. Als er 1876 starb, strömten Tausende zum Begräbnis des »Chaim von Zans«, längst einer der angesehensten Zaddiks im Land.
Nur fünf Jahre nach dem Tod des hoch verehrten Gelehrten wurde 1881 in Brzesko Pinkas Zimetbaum geboren. Seine Großmutter Malka Zimetbaum – Malas Urgroßmutter – stammte aus Zans, Nowy Sacz. Chasside zu sein und den Weisungen eines Zaddiks zu folgen, war in diesem Landstrich seit über hundert Jahren eine weit verbreitete Lebensform jüdischer Identität. Keine Quelle sagt, ob Malas Urgroßeltern – mütterlicherseits und/oder väterlicherseits – und deren Kinder und die Enkelgeneration zu den Anhängern von Chaim Halberstam zählten. Doch ob Nowy Sacz oder Brzesko: Jüdische Männer mit auffallend großen Pelzhüten an den Feiertagen gehörten zur Mehrheit in den Straßen, und das Wissen um diese religiöse Richtung wird allen aus der Familie Zimetbaum von Kindheit an vertraut gewesen sein.
Während der Chassidismus sich mit den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts im polnischen Judentum etabliert hatte, brachte die industrielle Revolution, die sich gegen Ende des Jahrhunderts auch in Osteuropa ausbreitete, Unruhe und ein tiefgreifendes soziales Gefälle in die jüdische Bevölkerung Polens. In Brzesko konnte sich das wohlhabende jüdische Bürgertum den wirtschaftlichen Veränderungen anpassen und unterstützte großzügig die jüdischen Familien, die der Umbruch in die Armut führte. Doch in den Dörfern, wo Juden als Pächter, Gastwirte und Zwischenhändler fest in die Mittlerfunktion zwischen Adel und Landbevölkerung eingebunden waren, fand eine große Anzahl keinen Zugang zur industriellen Herstellung. Viele jüdische Handwerker und Tagelöhner verarmten, weil der mechanisierte Arbeitsablauf in den neuen Fabriken mit der religiös begründeten Ruhe am Schabbat und an den vielen jüdischen Feiertagen nicht vereinbar war.
Hinzu kommt, dass eine sich ausbreitende antijüdische Stimmung von der katholischen Kirche brutal angestachelt wurde. Seit 1880 kommt es zu Verfolgungen, Pogromen. Wieder sind es Zahlen, die zumindest eine sichtbare Veränderung anzeigen. Zwischen 1880 und 1910 verließen offiziell 236504 Juden Galizien, wo die meisten Juden im österreichischen Kaiserreich lebten, und emigrierten in die USA. Aber war es allein die wirtschaftliche Not, die zu einer so radikalen Entscheidung führte?
Je mehr die Zahlen stiegen, desto hartnäckiger hat sich das Klischee vom verarmten Ostjuden festgesetzt, der sein Heil nur noch in der unüberlegten Flucht ins Unbekannte sah, primitiv, ahnungs- und gedankenlos. Unbeachtet blieb der religiös-kulturelle Untergrund, der die chassidischen Juden mit einem jüdischen Selbstbewusstsein ausstattete, das sie geradezu aufforderte, keine Angst vor Veränderungen zu haben. Nicht aufgeben, das Leben bejahen und im Vertrauen auf Gottes Beistand neue Wege gehen, war ein religiöser Grundpfeiler des Chassidismus und seiner Erfolgsgeschichte in Osteuropa.
Die lebendige Erinnerung daran gehörte zum wesentlichen Gepäck eines jeden jüdischen Menschen, der aus einem Landstrich fortzog, wo seinem Volk über Jahrhunderte Schutz und Würde geboten wurde wie nirgendwo sonst in Europa. Ebenfalls ist nicht zu unterschätzen, wie sehr der zunehmende antijüdische Hass, der sich in Gewalt entlud, die Entscheidung polnischer Juden zum Weggang beeinflusste. Bestärkt von der Überzeugung, dass ein solches Wagnis von göttlichem Segen begleitet war.
Pinkas Zimetbaum und Chaja Schmalzer waren beide 24 Jahre alt, als sie heirateten. Die Heirat im Kindesalter, lange feste Tradition im chassidischen Judentum, galt nicht mehr als göttliche Verpflichtung. Sie waren acht Jahre verheiratet, hatten 1907 Chiel, den Erstgeborenen, begraben, als sie mit drei kleinen Kindern – Gittla, Salamon Rubin und Juda – 1913 Brzesko verließen, um weit im Westen am Rhein einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.
3. Kapitel
Auf nach Mainz
Die Eltern ziehen mit drei Kindern an den Rhein – Jüdische Reformgemeinde und Orthodoxe: ein Teil der wohlhabenden Mainzer Gesellschaft – Der Erste Weltkrieg durchkreuzt alle Pläne
1913-1917
»Händler« nennt ihn das Adressbuch der Stadt Mainz, als Pinkas Zimetbaum 1913 im ehemaligen jüdischen Viertel, mitten im Zentrum und nahe am Dom, in der Rechengasse 9 im Hinterhaus, 1. Stock, mit seiner Familie eine Wohnung bezieht. Die Rechengasse ist vom kompletten Umbau dieser Gegend nach dem Zweiten Weltkrieg verschluckt worden. »Ehemals« traf schon damals zu, denn gegen Ende des vorigen Jahrhunderts waren nach und nach die jüdischen Familien aus dem Viertel fortgezogen, das der Landesherr – Kurfürst und Erzbischof in einer Person – ihnen im 17. Jahrhundert als einzigen Lebensraum in der Stadt zugewiesen hatte. 700 Jahre nachdem einer seiner Vorgänger die Juden mit dem Versprechen rechtlicher Gleichstellung in die christliche Stadt gelockt hatte, überzeugt, sie würden Wohlstand und Stabilität bringen.
So kam es auch, und zugleich wurde Mainz dank seiner gelehrten und verehrten Rabbis bald von den jüdischen Gemeinden in Europa als die Nachfolgerin Jerusalems verehrt. Nach dem Blutbad, das christliche Banden 1096 im Gefolge der Kreuzzüge in den jüdischen Gemeinden von Speyer bis Xanten anrichteten, Mainz nicht ausgenommen, aber war es vorbei damit, dass Christen und Juden sich als Nachbarn verstanden. 1438 wurden alle Juden, Männer, Frauen und Kinder, aus Mainz vertrieben. Knapp zweihundert Jahre später gingen rund 20 Familien das Risiko ein, sich wieder in der Stadt niederzulassen, errichteten 1630 eine Synagoge und ernannten einen Rabbiner.
Wer heute durch die Mainzer Innenstadt geht und von der Klarastraße in die Vordere Synagogenstraße einbiegt, kann die gewaltige gläserne Wand nicht übersehen, die mehrere Etagen des modernen Baukomplexes verdeckt, der hier nach 1993 entstanden ist. Am unteren Rand gibt die Inschrift auf einer großen eisernen Platte Auskunft über die ungewöhnliche Installation: »Auf diesem Gelände … wurde 1671 das Judenviertel den Mainzer Juden als Wohngebiet zugewiesen.« Und die Zeichnung auf der riesigen Glasfassade erinnert in Originalgröße an die Tür der Synagoge, die hier zwischen 1853 und 1912 stand.
Es war der Kurfürst und Erzbischof, der die Juden, die aus freien Stücken nach ihrer Vertreibung wieder zurück nach Mainz kamen, in ein Wohnghetto gezwungen hatte, das die Juden nur an Sonn- und Feiertagen verlassen durften. Als die Franzosen 1798 das linksrheinische Gebiet eroberten und in Mainz eine Republik ausriefen, erhielt die jüdische Bevölkerung die rechtliche Gleichstellung mit den Christen. Die beruflichen Beschränkungen entfielen, jüdische Männer konnten wählen, in welchem Gewerbe sie Handel treiben wollten und wo in der Stadt sie mit ihrer Familie eine Wohnung bezogen. (In Preußen mussten sie bis 1869 auf diese Gleichstellung warten, in Deutschland insgesamt bis 1871.)
Die erlebte Gemeinschaft im Judenviertel blieb für die meisten erst einmal ihr freiwilliges Zuhause. 1853 wurde im Viertel zwischen Vorderer und Hinterer Synagogenstraße eine neue Synagoge errichtet, die zum Anlass für einen tiefen Bruch wurde. Die Mehrheit der Gemeinde wünschte sich in der Synagoge eine Orgel, bisher undenkbar in einem jüdischen Gotteshaus. Viele Gebete sollten zudem auf Deutsch und nicht mehr auf Hebräisch gesprochen werden. Eine Minderheit protestierte vehement gegen diese Ketzerei; ein interner Konflikt, der inzwischen nichts Besonderes mehr war. Die jüdische Gemeinde in Mainz spiegelt die Entwicklungen, die die deutsche jüdische Bevölkerung im Lauf der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in zwei Lager geteilt hatte.
1821 gründeten jüdische Studenten in Berlin einen »Verein für Cultur und Wissenschaft des Judentums«. Es war ihr Ziel, dass die jüdische Glaubensgemeinschaft die »Umarbeitung von Bildung und Lebensbestimmung zu jenem Standpunkt« erreichte, »zu welchem die übrige europäische Welt gelangt ist«. Eine Welt, die im Geist der Aufklärung dem Individuum einen freiheitlich-kritischen Umgang mit uralten Traditionen und eine Öffnung zur Moderne zugesteht, auch in der Religion.
Was das praktisch bedeuten konnte, dafür wurde die jüdische Gemeinde in Hamburg, die größte in Deutschland, im selben Jahr zum Vorbild. Auch hier forderten die Reformer, wie sie nun genannt wurden, eine Orgel und endlich sollte der Vorhang beseitigt werden, der die Frauen im oberen Rang vom Innenraum der Synagoge, wo die Männer saßen und die religiösen Rituale vollzogen wurden, ausschloss. Der heftige Protest kam auch hier von einer Minderheit. Trotzdem schlossen die beiden Lager, die in wesentlichen Teilen ein entgegengesetztes Verständnis über die geistige Ausrichtung und die Praxis des Judentums hatten, einen revolutionären Kompromiss. Die Gemeinde blieb eine Einheit und berief zwei Rabbiner, bei denen sich jeweils die Reformer und die Orthodoxen, wie sie allmählich genannt wurden, mit ihrem unterschiedlichen Verständnis vom Judentum zu Hause fühlten.
Nachdem sich in Mainz die Reformer beim Synagogenbau durchgesetzt hatten, schloss sich die orthodoxe Minderheit zur »Israelitischen Religionsgesellschaft« zusammen. Weil ihre Mitglieder aus wohlhabenden Kreisen kamen, konnte 1856 eine eigene Synagoge am Flachsmarkt, ebenfalls im jüdischen Viertel, gebaut und ein eigener Rabbi berufen werden. Aber nach außen blieb die jüdische Gemeinde von Mainz eine einheitliche Körperschaft.
Inzwischen fühlte sich die Mehrheit der deutschen Juden den Reformern verbunden, sah Religion als eine Privatsache, die sie nicht hindern sollte, am Leben der modernen Gesellschaft teilzuhaben. Auch als überzeugte Juden wollten jüdische Frauen und Männer fröhliche Stunden in einem Wirtshaus verbringen, wo die Speisen und der Wein nicht nach den orthodoxen Speisegeboten koscher zubereitet wurden. Trotz der aufgebrochenen Gegensätze verband die allermeisten Juden weiterhin ein Gefühl der Solidarität, gefestigt von gemeinsamen 1000-jährigen Erinnerungen, die die jüdische Gemeinschaft im Innersten zusammenhielten.
1908 etablierte sich unter den Juden in Mainz eine dritte Gruppe, die sich als »Israelitischer Humanitätsverein« bezeichnete und ein Beth Hamidrasch, hebräisch für »Lehrhaus«, einrichtete. Es waren jüdische Familien aus Polen, die in der Stadt am Rhein auf ein besseres Leben hofften, denen aber die westlichen Prägungen ihres Glaubens, ob reformiert oder orthodox, fremd waren. Im Beth Hamidrasch konnten sie ihren Gott nach dem gewohnten polnischen Ritus verehren.
Dass jüdisches Leben in Mainz seit der Mitte des 19. Jahrhunderts vielfältig aufblühte, hatte sich herumgesprochen. Die umfassenden beruflichen und wirtschaftlichen Erfolge in der jüdischen Bevölkerung stießen nicht auf Ablehnung bei der christlichen Mehrheit. Antisemitische Parteien konnten in Mainz keine nennenswerte Anhängerschaft gewinnen. Jüdische Männer saßen im Stadtvorstand und in der Handelskammer, engagierten sich intensiv im Kultur- und Vereinsleben der Stadt. So klein ihre Gemeinschaft auch war: Im Jahr 1900 lebten 3104 Juden in Mainz, 3,7 Prozent der Bevölkerung. Im Deutschen Reich insgesamt lag der Anteil der jüdischen Bevölkerung bei rund 1 Prozent. 1912 wurde in der Hindenburgstraße Ecke Josefstraße, weit außerhalb vom alten jüdischen Viertel, die neue Synagoge der liberalen Gemeinschaft eingeweiht, ein prachtvoller Rundbau mit weithin sichtbarer Kuppel, in dem rund 1000 Menschen Platz fanden. Ganz Mainz, Juden wie Christen, feierte dieses Ereignis stolz als gemeinsamen Ehrentag.
Dass Pinkas Zimetbaum und Chaja Schmalzer 1913 mit ihren drei Kindern nach Mainz aufbrachen, hatten sie sicherlich gründlich überlegt. Informationen über die positive Situation der Juden in Mainz und günstige Erfahrungen von zuvor Ausgewanderten werden ihren Weg nach Brzesko gefunden haben. Und nachvollziehbar ist, dass die Fremden mit polnisch-jüdischem Hintergrund ihr Quartier im ehemaligen Judenviertel in der Rechengasse aufschlugen, auch wenn die Adressbücher verraten, dass christliche und jüdische Familien hier seit Jahrzehnten Tür an Tür wohnten. Aber immer noch lebten hier mehr jüdische Mieter und Hauseigentümer als in anderen Stadtteilen, darunter Elektromeister und Handwerker, Wäscherinnen und Kaufleute, Verkäuferinnen und Händler im Kleingewerbe.
Wann genau die Familie am Rhein ankam, ist unbekannt. Ob Chaja Schmalzer schon schwanger war? Am 20. März 1914 hat die 33-Jährige in Mainz ihr fünftes Kind zur Welt gebracht. Die Umstände dieser Geburt liegen im Dunkeln. Die Namenswahl aber ist nachvollziehbar, denn im Juli 1913 war die Mutter von Pinkas, Marjem Jochwet Zimetbaum, in Brzesko gestorben. Auf dem jüdischen Friedhof dort nennt ihr Grabstein sie »eine bedeutende Frau, bescheiden, die den Geboten Gottes folgte«. Im Gedenken an die Tote konnte ihr Sohn mit seiner Familie im Mainzer Hinterhaus nach jüdischer Tradition die Geburt der Enkelin als einen Freudentag feiern.
Der Sommer hat gerade begonnen, als im fernen Sarajewo am 28. Juni 1914 der Thronfolger der österreich-ungarischen Monarchie und seine Frau ermordet werden. In kürzester Zeit führt die Frage, wer die Hintermänner dieses Attentates sind, zu einer heftigen Krise zwischen Österreich und Russland, die von ihren jeweiligen Bündnispartnern – Deutschland auf der einen, Frankreich und Großbritannien auf der anderen Seite – unterstützt werden.
Am 27. Juli schreibt das Mainzer Journal: »Der gestrige Sonntag stand im Zeichen der Kriegserwartungen.« Bei den Sommerkonzerten in der Stadthalle habe es Begeisterungsovationen für den Bündnispartner Österreich gegeben. Aber auch Protestveranstaltungen der Sozialdemokraten »gegen Krieg und Kriegsgeschrei« finden statt. Die wiederum lösen Gegendemonstrationen aus, »um Kräfte zu sammeln … um in der Stunde der Not … dem Vaterlande zu geben, was dem Vaterlande gebührt«.
Als in Erwartung eines Krieges in Mainz, wie in ganz Deutschland, am 1. August 1914 die Mobilmachung ausgerufen wird, herrscht freudige Zustimmung bei Christen und Juden. Männer beider Konfessionen melden sich freiwillig zum Kriegsdienst, um ihr Vaterland zu verteidigen. Den 1. Stock im Hinterhaus der Rechengasse 9 wird der Aufruhr dieser turbulenten Tage nicht erreicht haben. Hier trennt eine Mauer schmerzlichster Gefühle die Familie seit dem 30. Juli von der übrigen Welt. Im Sterberegister vom jüdischen Friedhof in Mainz, hier erstmals dokumentiert, ist am 30. Juli 1914 der Todestag von »Juda Zimmetbaum« eingetragen und für den 31. Juli seine Beerdigung. Als Geburtsjahr wird 1911 vermerkt.
Die Beerdigung des kleinen Juda spätestens am Tag nach seinem Tod war für die jüdischen Eltern gemäß den Geboten ihres Glaubens selbstverständlich. Ebenso, dass sie sich mit ihren drei Kindern, darunter ein gerade 4 Monate alter Säugling, die folgenden 7 Tage vollständig vom Leben ringsum zurückzogen. Während eine Kerze für den toten Sohn und Bruder brennt, sitzt die Familie in ihrer Wohnung auf dem Boden, erfüllt von Trauer und Trost, die in ihren Gebeten zum Gott Israels Ausdruck finden. Für Nachbarn und Bekannte ist es eine heilige Pflicht, die Trauernden in dieser Woche zu begleiten und zu unterstützen, mit Gebeten für die Seelen wie mit Nahrung für den Leib.
Auch wenn ihre Ankunft in Mainz nicht viel länger als ein Jahr zurücklag, wird der Händler Pinkas Zimetbaum Kontakte zu jüdischen Männern und Frauen gefunden haben, die sich in dieser schweren Zeit um die Familie kümmern. Der tiefe Schmerz ist verbunden mit der Überzeugung, dass sich die Seele des kleinen Juda vom Körper getrennt hat. Der Tod ist nicht das Ende, sondern der Übergang in eine andere Welt.
Von diesem unerschütterlichen Glauben künden auch die hoch aufgerichteten steinernen Monumente auf dem Mainzer jüdischen Friedhof an der Unteren Zahlbacher Straße, direkt neben dem städtischen Hauptfriedhof. Er wurde 1881 eröffnet, als der Vorgänger-Friedhof belegt war, der bis ins 11. Jahrhundert zurückgeht, der älteste jüdische Friedhof nördlich der Alpen. Der Begräbnisplatz für den kleinen Juda ist präzise im Sterberegister ausgewiesen: Feld 5, Reihe 9, Nummer 31. Er liegt auf der Fläche rechts vom Hauptweg in der letzten Reihe, wo hinter dichtem Grün nur ein Zaun den jüdischen vom städtischen Hauptfriedhof trennt.
Eine Mazewa, hebräisch für »Grabstein«, wird ein Jahr nach dem Sterbetag aufgestellt. Im Schatten der steinernen Gedenken für die erwachsenen Toten haben sich auf dem Mainzer jüdischen Friedhof einige wenige kleine Kindergrabsteine erhalten. Einer für Juda Zimetbaum ist nicht darunter, seine Spur verliert sich in der Zeit. Aber auf diesem stillen Fleckchen Erde gilt für Juda das Gleiche wie für Rosa Sczupak, die 1911 mit vier Jahren in Mainz starb und deren Grabstein sich erhalten hat: »Tief betrauert von Eltern und Geschwistern.«
Der Tod auch des zweiten Sohnes war sicher ein Schock, doch er hat die Familie nicht abgehalten, sich weiter auf das neue Leben in Mainz zu konzentrieren. Wenn Eltern und Kinder vom Hinterhaus in die Rechengasse gingen und in das umliegende Viertel, bewegten sie sich in einer Gesellschaft, wo die Mehrheit Christen waren, im Gegensatz zum heimatlichen Brzesko. Doch niemand hinderte jüdische Menschen daran, den kurzen Weg zum Dom einzuschlagen und den gewaltigen Bau zu bestaunen. Dass die Neuankömmlinge Jiddisch sprachen, wird das Eingewöhnen erleichtert haben. Die entfernte Verwandtschaft zwischen jiddischer und deutscher Sprache schob die Fremdheit zwischen Juden und Christen gleich beim ersten Zusammentreffen ein wenig zur Seite.
Als Händler wird Pinkas Zimetbaum Kontakt zur orthodoxen Minderheit innerhalb der deutschen Juden in Mainz gehabt haben. Wer im Zentrum durch die Flachsmarktstraße ging, konnte das Gebäude Nr. 2 mit der »Antiquitätenhandlung« nicht übersehen, zu deren Kunden der Erzbischof und der Großherzog von Hessen zählten. Die christliche und die weltliche Obrigkeit hielten sich selbstverständlich daran, dass Isidor Reiling, der Besitzer, sein Geschäft am Schabbat geschlossen hielt.
»Mein Vater war orthodoxer Jude. Aus Überzeugung, aus Tradition und aus Stolz«: Das schrieb Netti Reiling, die sich als Schriftstellerin den Namen Anna Seghers gab, über ihren Vater Isidor Reiling. Er hatte die »Kunst- und Antiquitätenhandlung« seines Vaters David übernommen, der sich 1853 mit anderen Glaubensgenossen von der liberal-reformierten Mehrheit der Mainzer Juden trennte und zusammen mit anderen wohlhabenden Juden den Bau einer eigenen orthodoxen Synagoge möglich machte. Als Isidor Reiling, »israelitischer Religion«, am 24. November 1900, einem Samstag, auf dem Standesamt in Mainz die Geburt seiner Tochter Netti anzeigte, wurde am Ende des Eintrags kommentarlos vermerkt: »von dem Anzeigenden wegen Sabbaths nicht unterschrieben und nicht mit einem Handzeichen versehen.« Aktivitäten, die einem orthodoxen Juden am Schabbat verboten waren.
Isidor Reiling besaß ein persönliches Gebetspult in der vordersten Reihe der orthodoxen Synagoge. Wie die gesamte Familie wuchs Netti mit koscherem Essen, ohne Schweinefleisch, auf, fuhr am Schabbat nicht mit der Straßenbahn und hatte ein hebräisches Gebetbuch für Kinder. Aber so wie der Vater selbstbewusst und angesehen in der christlichen Oberschicht von Mainz verkehrte, keinen Bart trug und sich wie seine Frau nach neuester westlicher Mode kleidete, förderten die Eltern den Kontakt Nettis mit christlichen Freundinnen. Mit ihnen feierte sie christliche Festtage, und umgekehrt besuchten die Freundinnen Netti an jüdischen Feiertagen.
In einer angesehenen Privatschule wurde die 7-Jährige drei Jahre auf die Höhere Mädchenschule am Petersplatz vorbereitet, in der auch etliche jüdische Lehrerinnen unterrichteten. Von dort wechselte Netti Reiling 1917 in die »Großherzogliche Studienanstalt«. Hier machte sie Ostern 1920 Abitur, studierte mit voller Unterstützung der Eltern in Köln und Heidelberg, wo sie 1924 promovierte. Assimilation war für die orthodoxen deutschen Juden kein Schimpfwort.
Vom erneuten wirtschaftlichen Aufschwung, den Mainz und die Region ringsum mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts erlebten, hat wohl auch Familie Zimetbaum profitiert. Und knapp zwei Jahre nach ihrer Ankunft erfahren, wie schnell sich die Begeisterung der Einheimischen, die beim Ausbruch des Krieges im August 1914 hohe Wellen schlug, verflüchtigte.
Schon 1915 brach die regionale Wirtschaft zusammen, weil ihr Herzstück, der Handel mit dem »Erbfeind« Frankreich seit Kriegsbeginn ein radikales Ende fand. Im selben Jahr musste das »Amt für die Unterstützung von Kriegsfamilien« schon über 9000 Mainzer Familien versorgen, weil der väterliche Ernährer Soldat oder schon im Krieg getötet worden war. Getreide und Gemüse wurden knapp und mit »Brotkarten« rationiert.
Dass ein Krieg ihre berechtigten Hoffnungen auf ein besseres Leben in Mainz in so kurzer Zeit zerstören würde, damit konnten Pinkas Zimetbaum und Chaja Schmalzer nicht rechnen. Das Auf und Ab des Kriegsgeschehens zu verfolgen und die militärische Lage zu beurteilen, war selbst für deutsche Patrioten kaum möglich. Aber dass mit dem vierten Kriegsjahr das kaiserliche Deutschland in die Defensive geriet und die Stimmung der Menschen in Mainz merkbar nach unten ging, werden auch Pinkas Zimetbaum und seine Frau gespürt haben. Nun galt es neu nachzudenken, denn offenbar lag den beiden Zugewanderten aus Brzesko daran, sich nicht vom Schicksal treiben zu lassen, sondern ihr Leben aktiv zu gestalten.
Für das Jahr 1917 gibt es eine letzte Eintragung im Adressbuch der Stadt Mainz über Pinkas Zimetbaum, wohnhaft in der Rechengasse 9, 1. Stock im Hinterhaus. Im selben Jahr muss er mit seiner Frau und den Kindern Gittla, Salamon Rubin und der 3-jährigen Marjem Jochwet Mainz verlassen haben. Am 20. Januar 1918 wird Mala Zimetbaum in Brzesko geboren.
4. Kapitel
Zwischenstationen
Zurück in Brzesko – Vater Pinkas Zimetbaum geht nach Ludwigshafen
1918-1926
Es war eine turbulente Zeit. Während eine Woche nach der Geburt die Namensgebung der kleinen Mala im Familienkreis gefeiert wurde, begann in der Welt draußen das letzte Kriegsjahr, in dessen Verlauf die jahrhundertealten politischen Ordnungen in Europa endgültig auseinanderbrachen. Für alle Polen, Christen wie Juden, die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts unter fremder Herrschaft – von Russen, Deutschen, Österreichern – leben mussten, war ein neuer souveräner Staat greifbar nahe. Am 11. November 1918 wurde in Warschau unter dem Jubel der Bevölkerung die unabhängige Republik Polen ausgerufen.
Auch Brzesko gehörte dazu. Doch wer hier als zukünftiger polnischer Bürger jüdischen Glaubens sich auf eine gute Zukunft freute, dessen Freude wurde im Keim erstickt. Am 12. November stürmten bewaffnete Bauern aus dem Umland durch die Straßen, plünderten gezielt jüdische Häuser und ermordeten acht Juden. Es war der Anfang einer blutigen Welle von mindestens 150 antijüdischen Exzessen, die 6 Wochen lang den neuen polnischen Staat erschütterten und über 100 jüdische Menschenleben forderten. Eine irrationale Mischung extremer Gefühle, bei denen die Begeisterung über ein freies Polen in brutale Exzesse gegenüber den polnischen Juden umschlug. Ein antisemitischer Sturm, der im März 1919 erneut durch das Land zog.
Als am 28. Januar 1919 im Schloss von Versailles der Friedensvertrag unterzeichnet und damit der Erste Weltkrieg offiziell an sein Ende kam, war das Verhältnis zwischen den neuen Nachbarn Polen und Sowjetrussland keineswegs friedlich gestimmt. Beide fühlten sich innerhalb ihrer neuen Grenzen benachteiligt. Die Russen wollten ihr Territorium im Westen erweitern, die Polen machten Ansprüche auf das Land jenseits ihrer Ostgrenze geltend.
Im Sommer 1919 brach der Krieg zwischen Polen und Sowjetrussland aus. Als russische Truppen Mitte August 1920 auf Warschau zumarschierten, schien der Sieger festzustehen. Doch den polnischen Soldaten gelang eine militärische Wende, und Sowjetrussland war so geschwächt, dass es am 18. März 1921 im Vertrag von Riga den Polen im Osten erhebliche Landgewinne – vor allem Galizien und große Teile der Ukraine – überließ. Eine Herausforderung, das Zusammenleben der 30 Millionen Menschen im neuen polnischen Staat friedlich zu gestalten: zwei Drittel waren Polen, 5 Millionen Ukrainer, 3 Millionen Juden, 2 Millionen Deutsche, 1,2 Millionen Weißrussen, dazu kamen Litauer, Ungarn, Tschechen – Frauen und Kinder inbegriffen.
Jüdische Menschen machten im Schnitt 10 Prozent der polnischen Bevölkerung aus, in den Städten 22 Prozent. Aufgrund ihrer positiven Geschichte in Polen war es für sie selbstverständlich, gleichberechtigt und solidarisch am Erfolg der Polnischen Republik mitzuarbeiten. Doch mit der immer lauter werdenden Parole der katholischen Kirche – »polnisch sein bedeutet katholisch sein« – wurden sie als Fremde im eigenen Land abgestempelt. Und der Staat setzte diese Diskriminierung mit folgenschweren rechtlichen Einschränkungen im Zusammenleben um.
Die Anzahl jüdischer Schulen wurde beschränkt, ebenso die Zahl der Juden, die Handwerksberufe ergreifen durften. Eine Katastrophe für die jüdischen Erwerbstätigen, von denen rund 80 Prozent im Handwerk tätig waren. Die medizinische Fakultät der Universität Warschau vergab von 200 Plätzen 2 an jüdische Bewerber; in Krakau wurden von 400 Juden, die sich um einen Platz bewarben, nur 13 zugelassen. Mit dem Argument, es gäbe nicht genug ungetaufte Leichen für die Anatomie, denn an christlichen durften Juden keine Kenntnisse erwerben.
Kein Wunder, dass die Zahl der polnischen Juden, die das Land in Richtung Westen verließen, wieder anstieg. Und sich zusehends mehr von ihnen Gedanken über ihre Zukunft machten – und die ihrer Kinder, darunter auch Pinkas Zimetbaum und Chaja Schmalzer. Sie waren nicht nur auf theoretische Vermutungen angewiesen; dank ihrer vier Jahre in Mainz konnten sie Vergleiche anstellen. Solche Ungleichbehandlung hatte es im christlich geprägten Rheinland nicht gegeben. Vielleicht ein entscheidender Grund, in ähnlicher Umgebung einen zweiten Aufbruch zu wagen und keinen radikalen Wechsel in die USA, wie die meisten polnisch-jüdischen Emigrantenfamilien in den 1920er Jahren.
Für 1925 ist Pinkas Zimetbaum im Adressbuch der Stadt Ludwigshafen eingetragen. Er hat keine eigene Wohnung, sondern lebt zusammen mit russischen Juden im Haus einer jüdischen Witwe in der Wredestraße 38. Weitere Information über sein Leben in Ludwigshafen gibt es nicht. Doch im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung spricht dieser dokumentierte Mosaikstein dafür, dass Chaja Schmalzer mit den vier Kindern vorerst in Brzesko bleibt. Das Familienoberhaupt wollte offenbar die Chancen für einen Neuanfang in der unbekannten Stadt am Rhein erkunden, bevor er mit seiner Frau eine endgültige Entscheidung traf. Chaja Schmalzer würde in Brzesko für das Wohl der Kinder sorgen, alle nötigen Entscheidungen treffen. Das bedeutet auch: Sie muss den Lebensunterhalt verdienen. Kann sie das? Darf sie das als jüdische Frau?
Dass Chaja Schmalzer, inzwischen Anfang vierzig, wie alle polnischen Jüdinnen fest in der osteuropäischen Orthodoxie verwurzelt ist, daran besteht kein Zweifel. Ebensowenig, dass die Orthodoxie das gesamte Leben streng nach den religiösen Gesetzen – sehr unterschiedlich für Männer und Frauen – ausrichtet. Doch was bedeutet das konkret für das Miteinander von Frau und Mann über die Jahrhunderte? Unabhängig von den negativen Vorurteilen, die im 19. Jahrhundert gegenüber dem polnischen Judentum entstanden sind.
In der hebräischen Bibel ist der Beginn des Menschengeschlechtes eindeutig. Über den 7