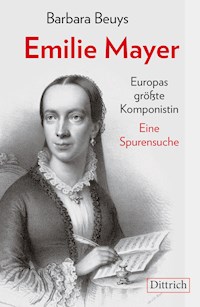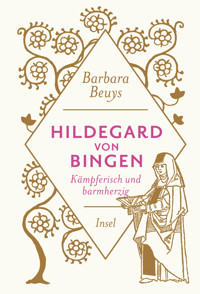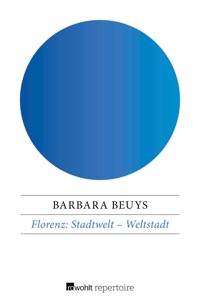9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Barbara Beuys schildert in diesem erstmals 1987 erschienenen Buch eindrucksvoll das gesamte Panorama des Widerstands, Jahr für Jahr, von 1933 bis 1945. Sie erzählt vom Widerstand der Arbeiterbewegung wie von der Entwicklung des konservativen Widerstands. Es geht um die Schicksale von Menschen, um das gefährliche Leben im Untergrund, um Folter und Tod. Es geht um politische Illusionen und Widersprüche, aber auch um außerordentliche Beispiele von Mut und Standhaftigkeit. Gemessen am Erfolg sind Adlige wie Arbeiter im Kampf gegen den Nationalsozialismus gescheitert. Doch dieses Buch will den Widerstand in seiner ganzen Breite, will Licht- und Schattenseiten der jüngeren deutschen Vergangenheit in Erinnerung rufen. Die Autorin schildert, wie einsam die Widerstandskämpfer aller politischen Lager starben und wie sehr sich am Ende alle den besten Traditionen und Werten der europäischen Geschichte verpflichtet fühlten, Maßstäbe für die Gegenwart zu setzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 814
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Barbara Beuys
Vergeßt uns nicht
Menschen im Widerstand 1933–1945
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Barbara Beuys schildert in diesem erstmals 1987 erschienenen Buch eindrucksvoll das gesamte Panorama des Widerstands, Jahr für Jahr, von 1933 bis 1945. Sie erzählt vom immer noch unbekannten Widerstand der Arbeiterbewegung wie von der Entwicklung des konservativen Widerstands. Es geht um die Schicksale von Menschen, um das gefährliche Leben im Untergrund, um Folter und Tod.
Über Barbara Beuys
Barbara Beuys, 1943 geboren, aufgewachsen im Rheinland; Studium der Geschichte, Philosophie und Soziologie, 1969 Promotion in Geschichte. Barbara Beuys war Redakteurin bei der Zeitschrift «Merian» in Hamburg.
Inhaltsübersicht
Es ist nicht möglich, die Vergangenheit zu schildern, ohne ihr die Färbung unserer eigenen Gefühle zu geben.
Heinrich Heine
Einleitung
Im Jahre 1964 antworteten auf die Frage «Wenn Sie von einem Deutschen hören, er habe als Soldat oder Beamter während des Krieges insgeheim in einer Widerstandsgruppe gearbeitet, spricht das für oder eher gegen ihn?» nur 29 Prozent der Deutschen in der Bundesrepublik, es spreche für ihn. Zwanzig Jahre später waren 60 Prozent aller Bundesbürger der Meinung, daß der Widerstand gegen das NS-Regime «einen Menschen auszeichnet». Knapp 70 Prozent der 1984 Interviewten fiel zum 20. Juli 1944 der Name Stauffenberg ein. Doch obwohl dieses Datum in der Geschichte der Bundesrepublik zum Synonym für Widerstand geworden ist, konnten sich nur 12 Prozent an Carl Goerdeler erinnern, und auch andere Männer aus dem engsten Verschwörerkreis um Stauffenberg sind längst aus dem Gedächtnis entschwunden.
Wie der Widerstand im «Dritten Reich» nach 1949 in den beiden deutschen Staaten aufgenommen, verarbeitet oder verdrängt wurde, das ist selbst schon wieder Geschichte geworden. Die Bundesrepublik stellte die Männer des 20. Juli–Adlige, Militärs, hohe Beamte, einige Sozialdemokraten – aufs Podest und nannte ihr Handeln eine patriotische Tat. Die gleichen ehrenhaften Motive sprach sie den kommunistischen Widerstandskämpfern ab und schloß diese 1952 im Bundesentschädigungsgesetz von Wiedergutmachungszahlungen aus, weil die Kommunisten «nach dem 23.5.1949 die freiheitlichen Grundrechte» bekämpft hätten. Die Ermordeten und Gefolterten mußten im Zeichen des Kalten Krieges herhalten für die politische Auseinandersetzung. Die DDR machte den Widerstand der Kommunisten zum Bestandteil ihrer Staatsdoktrin, ließ keinerlei kritisches Nachdenken über die Rolle der KPD im Nationalsozialismus zu und verbannte ihrerseits die Verschwörer des 20. Juli aus der ehrenvollen Erinnerung. «Monopolbourgeoisie» und «reaktionäre Militärs» hatten angeblich mit dem Attentat nichts anderes im Sinn, als den «deutschen Imperialismus» zu retten.
Mitte der sechziger Jahre wurde die Bundesrepublik durch den Frankfurter Auschwitz-Prozeß jenseits aller Feiertagsreden sehr konkret mit den Verbrechen der jüngsten Geschichte konfrontiert. Das Schweigen brach auf, historische Tabus wurden zerstört, die «Widerstandshelden» vom Sockel gestoßen. Die Täter von damals, die sich so nahtlos im emsigen Treiben von Wiederaufbau und Wirtschaftswunder in die Demokratie gefügt hatten, endlich zur Rechenschaft zu ziehen; den Juristen und Professoren, den Medizinern und Theologen, die den NS-Machthabern so willfährig gedient hatten, endlich die biedermännische Tarnkappe zu entreißen – auch das war Antrieb für die 68er Revolte der Studenten.
Dann schlug das Pendel wieder zurück. Das Erbe Preußens erlebte in Ausstellungen und Aufsätzen eine Renaissance – diesseits und jenseits der Demarkationslinie. Nicht nur Luther und Bismarck wurden von der DDR neu entdeckt. Zum 40. Jahrestag des Attentats in der Wolfsschanze wurde aus der «reaktionären Aktion» eine «mutige Tat von historischem Rang».
In der Bundesrepublik fanden sich seit den siebziger Jahren Historiker, die den Widerstand der Kommunisten und der Arbeiterbewegung insgesamt erforschten. Schülergruppen und engagierte Bürger gingen zu den Überlebenden, um deren Erinnerungen festzuhalten, und machten den Widerstand zu einem Thema der jungen oral history. Verdrängte Stätten der Verfolgung wurden entdeckt, ausgegraben – nicht selten gegen den Protest der heute dort Lebenden.
Immer umfangreicher wurde die Literatur zum Widerstand. Es erschienen Einzeluntersuchungen über «Widerstand und Verfolgung» in Mannheim und Essen, Duisburg und Braunschweig, Köln und Bremen und vielen anderen Orten (wenngleich es immer noch etliche weiße Flecken gibt). Das ist ein großes Verdienst, und nur auf Grund solcher regionalen Detailarbeiten ist dieses umfassende Buch über «Menschen im Widerstand» erst möglich geworden. Auch etliche zusammenfassende Darstellungen liegen vor. Aber sie spalten den Widerstand, die Namen, Statistiken und Dokumente kapitelweise nach Sachgruppen auf. Die Kirchen und die Jugend, die SPD und die KPD, die Konservativen und die Militärs werden jeweils für den gesamten Zeitraum von 1933 bis 1945 zusammengefaßt.
Dieses Buch ist der Versuch, den deutschen Widerstand in der Zeit des Nationalsozialismus zusammenhängend chronologisch zu erzählen. Jahr für Jahr wird geschildert, welche Menschen und welche Gruppen sich den Zwängen und Verführungen der Diktatur nicht anpaßten. Es wird der Alltag im Nationalsozialismus aufgezeigt, weil nur so zu verstehen ist, wie einsam die Widerstandskämpfer aller politischen und gesellschaftlichen Strömungen handelten, litten und starben. Es ist von Strukturen die Rede, von Parteiprogrammen und allgemeinen Entwicklungslinien. Aber daneben kommen die Menschen zu Wort, die für ihre Überzeugungen ihr Leben aufs Spiel setzten und das ihrer Familie dazu. Widerstand bedeutete im Alltag: untertauchen in die Illegalität, gehetzt werden, ständig das Quartier wechseln, vor verschlossenen Türen stehen, kein Geld haben, stets auf der Hut und in Angst vor den Verfolgern leben, Lüge und Verstellung praktizieren, keinen Kontakt mehr zur Familie und den Freunden haben. Und immer lebte man mit der Gewißheit, daß am Ende nicht nur KZ oder der Henker standen, sondern Brutalität und Folter warteten, mit denen die Gestapo aus ihren Opfern die Namen von Mitstreitern herauspreßte.
Damit es kein Mißverständnis gibt: Die Deutschen unter Hitler waren kein Volk von Widerstandskämpfern. Die große Mehrheit hat sich ohne Zwang dem «Führer» anvertraut und dem Terror gegenüber allen, die sich dem nationalsozialistischen Regime nicht beugten, zustimmend bis tatenlos zugesehen. Wer nicht mitjubelte, wer den Arm zum «Hitler-Gruß» nur hob, um nicht aufzufallen, war völlig isoliert und sehr einsam. Doch es gilt auch: Die Zahl der Menschen, die trotzdem Widerstand leisteten, ist viel größer, als es vom öffentlichen Bewußtsein bisher wahrgenommen wird. Auch neuere Veröffentlichungen in der Bundesrepublik haben den Kampf der Kommunisten und der kleinen radikalen Parteien und Gruppen vom linken Rand des politischen Spektrums gegen den Nationalsozialismus nicht in die Traditionen dieser Republik integrieren können. Der Widerstand der Arbeiterbewegung ist bei uns immer noch ein unbekannter Widerstand. Ebenso hat mancher Geistliche, ob evangelisch oder katholisch, mancher Mediziner und Lehrer, mancher Gewerkschafter keine Beachtung gefunden neben den übermächtigen «Helden» des 20. Juli.
Unbestritten ist, daß keine Gruppierung so entschieden vom ersten Tag an den Nationalsozialisten Widerstand leistete wie die KPD. Von den 360000 Mitgliedern haben zwischen 1933 und 1945 rund 150000 für längere oder kürzere Zeit in Gefängnis, Zuchthaus oder KZ gesessen, wohl 20000 Kommunisten sind ermordet worden. Die deutsche Sozialdemokratie entschied sich 1933 zuerst gegen den Kampf im Untergrund, weil dies ihrer Tradition zutiefst widersprach. Sie setzte auf Legalität und Vernunft und hoffte, die neuen Machthaber durch Zugeständnisse zu besänftigen, als diese den Untergang der Arbeiterkultur schon längst beschlossen hatten. Gemeinsam war SPD und KPD bis weit in das Jahr 1934 hinein die Illusion, der Hitlerspuk werde über Nacht verschwinden bzw. die Mehrheit sich in einem Volksaufstand erheben.
Dem Jahr 1933 gilt in diesem Buch ein ausführliches Kapitel, weil nichts so lehrreich ist, wie die Anfänge einer Entwicklung zu kennen, und weil Widerstand vom Januar 1933 an geleistet wurde. Es gab nicht nur im Frühjahr wilde Folterorgien der SA-Trupps, sondern das ganze erste Jahr der Diktatur war – vor den Augen der Bürger – erfüllt von systematischem Terror gegen Andersdenkende. Die Gewerkschaftshäuser wurden ebenso gestürmt wie die Redaktionen von SPD-Zeitungen. Akten und Mobiliar flogen auf die Straße und wurden angezündet, tagelang brannten die Feuer. Aus ordentlichen Sitzungen wurden SPD-Stadtverordnete hinausgeprügelt, ohne daß es Protest gab. Mit Erstaunen erlebten selbst die Nationalsozialisten, wieviel an Brutalität die Deutschen duldeten, wenn sie jene traf, die als verfemte Außenseiter galten wie Juden und Kommunisten, oder als Vertreter der verhaßten Republik von Weimar wie die Sozialdemokraten.
Und weil die Motive der Widerstandskämpfer des Jahres 1933, ihre Differenzen und ihre Hoffnungen, nur zu verstehen sind im Rahmen der Entwicklung seit 1918, wird zu Beginn dieses Buches die Zeit der Republik ausführlich geschildert: Wie jene sich zur Demokratie von Weimar verhielten, die – früher oder später – gegen das NS-Regime Stellung bezogen. Es wird erinnert an die blühende Kultur der Arbeiterbewegung, die den Verfolgten Kraft gab, ihren Idealen treu zu bleiben, und die doch von den Verfolgern innerhalb weniger Wochen bis auf den Grund zerstört wurde und bis heute keinen angemessenen Platz gefunden hat in den Museen und Traditionen der Bundesrepublik.
Die Organisationsformen von KPD und SPD konnten sich in der Illegalität nicht halten, 1935 waren sie weitgehend zerschlagen. 1937 hatte die Gestapo auch die kleinen Gruppen im Untergrund vernichtet. Trotzdem ging der Widerstand weiter und führte in den Kriegsjahren zu erstaunlichen Aktivitäten. Neue Zentren der KPD bildeten sich in Berlin und Sachsen, in Thüringen und im Ruhrgebiet, in München gab es Ableger und in Pommern, in Hamburg wie in Magdeburg. Illegale Zeitschriften und Flugblätter wurden wieder in größerer Zahl gedruckt. Und das zu einer Zeit, als der Terror der Machthaber immer mörderischer wurde und der Widerstandskämpfer bei der Mehrheit als doppelter Verräter galt: weil er die Niederlage Hitler-Deutschlands herbeisehnte, ohne die es keine Befreiung vom Nationalsozialismus gab.
Es waren die Kriegsgefahr 1938 und dann der Krieg, die zur Opposition der Konservativen – der Adligen, Militärs und Beamten – führten. Es war eine Elite, die erkennen mußte, daß sie dem Diktator zur Macht verholfen hatte, um die 1918 verlorenen Privilegien zurückzuerhalten. Die allermeisten waren keine Demokraten, ihre Visionen für die Zeit nach Hitler wollten Frieden und Gerechtigkeit, aber auch Deutschlands Stellung als Großmacht erhalten. Manche träumten gar, den «guten Kern» des Nationalsozialismus in die neue Zeit zu retten.
Auch die Kommunisten wollten keine Demokratie, erbittert hatten sie die Republik von Weimar bekämpft und die Sozialdemokraten als «Sozialfaschisten», das heißt Steigbügelhalter Hitlers, beschimpft. Sie erschreckten die Mehrheit der Deutschen mit ihrem politischen Programm, eine Räterepublik nach sowjetischem Muster einführen zu wollen und sich sklavisch mit den Interessen der Sowjetunion zu verbinden. Erst in den Kriegsjahren, von der Moskauer Zentrale abgetrennt, kam es bei deutschen Kommunisten im Widerstand zu einer vorsichtigen Abnabelung von diesem übermächtigen Vorbild, rückten eigene deutsche Interessen in den Vordergrund und wurde die Verteidigung demokratischer Rechte beschworen.
War das nur Taktik, um die alten Ziele zu vernebeln? Hatte der Wolf Kreide gefressen? Niemand kann diese Frage überzeugend beantworten, denn die führenden kommunistischen Widerstandskämpfer der letzten Kriegsjahre sind alle ermordet worden. Ein Beispiel für die gnadenlose Verfolgung der Kommunisten ist die blutige Statistik der Mitkämpfer und Sympathisanten um den KPD-Funktionär Wilhelm Knöchel, der im Januar 1942 illegal von Amsterdam ins Reich reiste, um den Widerstand seiner Genossen neu zu organisieren und auszuweiten. Im Januar 1943 begann die Gestapo, die Knöchel-Gruppe aufzurollen, bis zum Sommer waren über 200 Menschen verhaftet: 23 von ihnen wurden zum Tode verurteilt und hingerichtet; 9 wurden während der Untersuchungshaft ermordet, in den Tod getrieben oder nahmen sich in letzter Freiheit das Leben; einer tötete sich im Augenblick der Verhaftung; 4 starben nach der Verurteilung im Zuchthaus; 7 wurden ins KZ verschleppt und dort umgebracht; 4 wurden im April 1945 bei Nacht und Nebel erschossen; 3 starben nach der Befreiung an den Folgen der Haft.
Es brauchte drei Jahre hartnäckiger Bemühungen und vieler Diskussionen, bis im April 1987 ein sozialdemokratischer Senator in Hamburg seine Zustimmung gab, die Gesamtschule Altona in Bruno-Tesch-Schule umzubenennen. Der Arbeiterjunge war 1932 von einem ordentlichen Gericht freigesprochen worden, den Tod von SA-Männern beim «Altonaer Blutsonntag» mitverschuldet zu haben. Die Nationalsozialisten, kaum an der Macht, verhafteten Bruno Tesch und verurteilten ihn zum Tod auf dem Schafott. Im Morgengrauen des 1. August 1933 wird der 20jährige, mit drei Gesinnungsgenossen, enthauptet. Sein letzter Brief ist erhalten geblieben: «Wir sterben, wie wir gekämpft haben. Vergeßt mich nicht! Vergeßt mich nicht!»
Bruno Tesch war im Kommunistischen Jugendverband aktiv, deshalb das Zögern der SPD-Behörde, 55 Jahre nach seinem Tod. Denn immer noch ist die positive Bewertung des gesamten Widerstandes umstritten, wird nicht Gerechtigkeit geübt, sondern werden Vorurteile gepflegt und Argumente vorgetragen, die den Widerstand – immer noch – für den aktuellen politischen Alltag dienstbar machen sollen. Dabei bedeutet eine Würdigung des kommunistischen Widerstandes keineswegs, seine Fehler, Versäumnisse und Irrwege zu verschweigen. So muß diskutiert werden, ob die KPD in den ersten Jahren des NS-Regimes den Opfermut und die Leidensfähigkeit ihrer Mitglieder leichtfertig für irreale Ziele ausgenutzt hat. Aber für kommunistische wie für konservative Widerstandskämpfer müssen die gleichen Kriterien gelten: daß sie alle aus Fehlern und Erfahrungen gelernt und am Ende als deutsche Patrioten ihr Gewissen über die Interessen eines Standes oder einer Partei gestellt haben.
Der Widerstand der Männer um Stauffenberg und Goerdeler war lange zwiespältig. Doch als am Ende die Bombe gezündet wurde, wußten die Verschwörer, daß sie als Verräter enden würden und es nur noch darum ging, für die Nachgeborenen ein Zeichen zu setzen. Auch für die Opfer vom kommunistischen Teil der Arbeiterbewegung muß gelten, was als Maßstab und Motivation für die Toten des 20. Juli akzeptiert wird: daß sie für ein besseres, ein menschliches Deutschland starben und ihre Nation vor dem Verderben bewahren wollten. Gemessen am Erfolg sind Kommunisten wie Konservative gescheitert. Die einen konnten die Arbeiter nicht zum Aufstand bewegen, die anderen nicht genug Mitstreiter unter ihresgleichen in den Machtzentralen gewinnen, um den Diktator zu stürzen. Aber unbestritten muß die moralische Lauterkeit sein, mit der die einen wie die anderen das eigene Leben und die Existenz ihrer Familie riskierten, um Werte vor der Vernichtung zu bewahren, die den besten Traditionen europäischer Geschichte entstammen.
Judith Vallentin arbeitete während des Krieges in der illegalen KPD-Gruppe um Robert Uhrig in Berlin mit. Sie reiste als Kurier nach Thüringen und Sachsen und verwaltete die Gelder der Gruppe. Zum Tode verurteilt, schrieb die 39jährige Ende Oktober 1944 an ihre Tochter: «Im Augenblick mußt Du ja einen großen Schmerz tragen. Vergrab Dich nicht darin … ‹Freude schöner Götterfunken› ist Beethovens schönstes Werk, und er schrieb es in seiner elendsten Zeit … Ich muß jetzt Schluß machen, bleib stark und tapfer … Ich ertrage alles mit innerer Ruhe und Gefaßtheit.» Robert Uhrig schrieb seiner Frau Charlotte zum Abschied: «Mein letzter Gedanke gilt Dir und einer freien Menschheit.» Solche letzten Briefe sind typisch für kommunistische Widerstandskämpfer. Nicht politische Dogmen werden beschworen, obwohl diese Frauen und Männer als treue Parteigenossen gestorben sind, sondern die humanistischen Ideale einer bürgerlichen Welt, die die Arbeiterkultur sehr ernst genommen hat und ihren Söhnen und Töchtern tief ins Herz pflanzte. Es waren Arbeiter, die im «Dritten Reich» für diese Ideale starben, während die Bürger zu Zynikern wurden oder die Menschlichkeit und die Würde des einzelnen im Rausch nationaler Größe mit Füßen traten.
Die moralische Verurteilung des kommunistischen Widerstandes in der Bundesrepublik entspringt einem aggressiven Antikommunismus, der zur Zeit des «Dritten Reiches» alle Kreise umfaßte – von Ausnahmen abgesehen bis zuletzt auch die konservativen Widerstandskämpfer – und von den Nationalsozialisten geschickt ausgenutzt und geschürt wurde. In den fünfziger Jahren zur Zeit des Kalten Krieges wurde Antikommunismus dann zum Kitt der eben entstandenen Republik und mündete in die «Totalitarismusthese»: Kommunismus und Nationalsozialismus, totalitäre Ideologien, sind identisch, – wodurch jede Auseinandersetzung mit dem kommunistischen Widerstand überflüssig wurde. Diese alte These ist im Historikerstreit des Jahres 1986 wieder hochgekommen, als es darum ging, ob die NS-Verbrechen den Untaten Stalins vergleichbar sind, vielleicht sogar von ihnen angeregt wurden.
Jean Améry, ein österreichischer Jude, ein Widerstandskämpfer, dem die Erfahrungen des Exils, der Folter und der Haft in Auschwitz 1978 das Leben nahmen, wehrte sich gegen solche Gleichsetzung: «Man hat uns bis zum Überdruß Hitler und Stalin, Auschwitz, Sibirien, die Warschauer Gettomauer und die Berliner Ulbrichtmauer zusammen genannt wie Goethe und Schiller, Klopstock und Wieland. Nur andeutend sei hier im eigenen Namen und auf jede Denunziationsgefahr hin wiederholt, was in einem vielbefeindeten Interview Thomas Mann einmal gesagt hat: daß nämlich der Kommunismus, wie schrecklich er sich zeitweilig auch darstellen möge, immerhin eine Idee vom Menschen versinnbildliche, während der Hitlerfaschismus überhaupt keine Idee war, sondern nur eine Schlechtigkeit.»
Es ist zu billig, mit dem Hinweis auf die Verbrechen von Hitler und Stalin Nationalsozialismus und Kommunismus über einen Leisten zu schlagen. «Erkämpft das Menschenrecht» singen die Arbeiter vieler Nationen seit Generationen. Niemals wäre solches einem Nationalsozialisten in den Sinn gekommen. Menschenrechte waren für ihn «Humanitätsduselei». Folter an einzelnen, die Versklavung ganzer Völker waren nicht Abirrungen, sondern Wesen der NS-Ideologie, die im «Rassegedanken», durch «Zuchtwahl» und «Ausrottung», ihre Vorstellungen von einer besseren Welt realisieren wollte.
Indem die deutschen Kommunisten gegen diese Ideologie kämpften, wurden sie nicht zwangsläufig zu Handlangern stalinistischer Verbrechen. Wer käme auf die Idee, Stalins westlichen Verbündeten im Weltkrieg ähnliches vorzuwerfen? Daß die deutschen Kommunisten damals in Stalin und der Sowjetunion ihr einziges Heil sahen, ist ihnen nicht anzulasten. Auf wen sonst hätten sie in KZ, Zuchthaus und Untergrund – abgeschnitten von allen ungefilterten Informationen – hoffen sollen? Eine nachträgliche kritische Auseinandersetzung mit dem Hitler-Stalin-Pakt ist dadurch allerdings nicht überflüssig geworden.
Der Widerstand der Arbeiterbewegung ist ein Schwerpunkt dieses Buches, der sich von selbst ergibt, wenn man nicht vergißt und nicht verdrängt. Darüber werden die bekannten Namen nicht vernachlässigt. Aber in einem solchen Gesamtzusammenhang verschieben sich liebgewordene Proportionen, kommen auch andere zu ihrem Recht. Es schmälert den Ruhm und den Mut der Geschwister Scholl nicht, wenn man von einer ähnlichen Gruppierung in Hamburg weiß oder von zwei Münchner Kommunisten, die zur gleichen Zeit im Alleingang Flugblattaktionen durchführten. Das Attentat vom 20. Juli 1944 ist nicht weniger verdienstvoll, wenn man im chronologischen Zusammenhang erzählt, was Stauffenberg zur Zeit der «Köpenicker Blutwoche» Ende Juni 1933 schreibt, als in diesem Berliner Arbeiterviertel rund 500 Menschen verhaftet und 91 von ihnen zu Tode gefoltert werden: «Bei aller gleichschaltung und dem gesetz der totalität: für uns ist das alles nicht neu und schon jetzt ist zu sehen: keine partei, sondern herren machen umwälzungen und jeder der für seine herrschaft einen sicheren sockel sich baut, ist ob seiner klugheit zu loben.»
Im Zusammenhang erst wird deutlich, welche treibende Kraft im Widerstand junge Menschen waren: nicht nur als einzelne oder in Jugendgruppen wie zum Beispiel in der katholischen Kirche, sondern als engagierte Genossinnen und Genossen bei SPD und KPD. Sie hielten in den ersten Jahren der Diktatur die Arbeit im Untergrund aufrecht, als die bekannten Funktionäre – vor allem bei den Kommunisten – fliehen mußten oder von der Gestapo gefaßt wurden.
Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen über die Definition von Widerstand, und gewiß darf man mit dieser Bezeichnung nicht leichtfertig umgehen. Nicht jeder Jugendliche, der bei den Edelweißpiraten oder anderen Gruppierungen mitmachte, war ein Gegner des NS-Regimes. Doch als die Gestapo 1938 die jugendlichen «Meuten» in Leipzig entdeckte, kam der Erste Senat des Volksgerichtshofs aus Berlin in die Messestadt. Die Jugendlichen wurden in zwei Prozessen des Hochverrats angeklagt, weil sie «bei der Ablösung des nationalsozialistischen Staates durch den Kommunismus entscheidend mitwirken» wollten und zu Zuchthausstrafen zwischen einem und acht Jahren verurteilt.
Die Protestanten der Bekennenden Kirche leisteten lange einen «Widerstand wider Willen». Immer wieder beteuerten sie ihre Loyalität zum NS-Staat und zum «Führer». Ihre jungen Pfarrer drängten sich zum Wehrdienst, Pastor Martin Niemöller hat 1933NSDAP gewählt. Das hinderte die Machthaber nicht, ihn und andere Theologen ins KZ zu stecken, viele Geistliche mit Predigtverbot zu belegen und in der Bekennenden Kirche ihren Feind zu sehen.
Ob man von Widerstand spricht oder neuerdings von Resistenz, ob man Aktionen meint wie das Verschicken von Flugblättern, ob man auf die eindrucksvollen Prozessionen der katholischen Arbeiter in den Jahren 1934/35 sieht oder an das Abhören feindlicher Sender denkt, das während des Krieges meist mit dem Tode bestraft wurde – die Grenzen des Begriffs sind fließend; letztlich bestimmte die Gestapo, was Widerstand war. Jede Definition engt ein, schließt aus. Im Nationalsozialismus war jeder ein Gegner, der sich dem totalen Anspruch des Staates auf Leib und Seele entzog; der sich Hitlers Warnung «biegen oder brechen» nicht unterwarf, sondern Rechte und Werte hochhielt oder aktiv verteidigte, die nicht nur ihn selbst oder seine Gruppe betrafen, sondern ebenso den Nachbarn, den Mitmenschen.
Was über den deutschen Widerstand in Dokumenten, Interviews, Aufsätzen, Einzel- und Sammelwerken vorliegt, ist in diese Gesamtdarstellung eingegangen. Sie soll ein repräsentatives Bild ergeben, auch wenn viele Namen und viele Schicksale unerwähnt bleiben mußten und längst nicht alle Verästelungen ausgebreitet werden konnten. Die Auswahl fiel schwer, weil alle, die sich dem Unrecht nicht beugten, ein Anrecht darauf haben, daß ihre Qualen und ihre Standhaftigkeit nicht vergessen werden. Aber ein Buch, das gelesen werden möchte und nicht nur im Regal stehen soll, darf einen gewissen Umfang nicht überschreiten.
Deshalb auch können die Deutschen, die außerhalb Deutschlands den braunen Ungeist bekämpften, hier nur summarisch erwähnt werden: Rund 400000 Deutsche gingen ins Exil und verloren ihre Heimat, 40000 aus politischen Gründen, die übrigen, weil sie «rassisch» Verfolgte waren; in allen von Deutschland besetzten Ländern engagierten sich Deutsche in der dortigen Résistance, in Frankreich waren es ungefähr tausend. Das Strafbataillon 999 wurde 1942 aufgestellt, damit «Wehrunwürdige» sich «bewähren» konnten, rund 30 Prozent dieser Soldaten waren politisch Verfolgte. Auch in den Arbeitslagern und im KZ wurde unter schwierigsten Bedingungen der Widerstand organisiert. Einige Schriftsteller gingen in die sogenannte Innere Emigration. Ob ihr Rückzug und ihre Anpassung an manche Mechanismen des Regimes Kapitulation und politische Naivität waren, ist umstritten. Doch darüber darf nicht vergessen werden, daß die Schriften von Ernst Wiechert, Werner Bergengruen, die Gedichte von Oskar Loerke und Reinhold Schneider von Hand zu Hand wanderten, immer wieder neu abgeschrieben wurden und den Zeitgenossen als Ermutigung erschienen.
Wer den langen Zug der Opfer sieht, der Gequälten und Ermordeten, wird die Vokabel «Widerstand» auf andere Zeiten nur mit äußerster Vorsicht anwenden, aber um so entschiedener dafür eintreten, die allerersten Anzeichen von Menschenverachtung und Minderheitenverteufelung, von Unrecht und Gewaltanwendung zu bekämpfen. Wer die Geschichte des Widerstandes der Deutschen gegen den Nationalsozialismus in seiner ganzen Breite kennt, fragt, warum im neu entfachten Streit um die nationale Identität der Widerstand als Teil dieser Identität nicht genannt wird. Dabei könnte er Beispielhaftes aus dunkler Zeit dokumentieren und den Deutschen die Licht- wie die Schattenseiten ihrer jüngsten Geschichte in Erinnerung halten.
Viele der Opfer für eine menschliche Welt haben den letzten Gang aufrecht angetreten, weil sie überzeugt waren, daß ihr Schicksal nicht vergessen würde. Es war das Trachten ihrer Gegner, die Erinnerung an jene, die Widerstand leisteten, auszulöschen. Das galt nicht erst für die Toten des 20. Juli, deren Asche über die Rieselfelder von Berlin verstreut wurde. Die Sozialdemokratin Minna Cammens wurde im März 1933 in Breslau verhaftet, als sie Flugblätter verteilte. Nach wenigen Tagen erhielt ihr Mann per Post eine Zigarrenkiste mit Asche zugeschickt und einen Zettel, auf dem stand: «Minna Cammens, geborene Hannen, am 25.3.1933 verhaftet, starb in Schutzhaft an Herzschlag. Auf eigenen vor ihrem Tod ausgedrückten Wunsch wurde sie eingeäschert. Es ist nicht gestattet, die Öffentlichkeit von ihrem Ableben zu unterrichten.» Der Hamburger KPD-Mann Edgar André, seit März 1933 in Haft, wurde am 4. November 1936 mit dem Handbeil hingerichtet. Aus den Akten: «Die Beisetzung ist in aller Stille und unter strengster Verschwiegenheit vorzunehmen. Ferner wird gebeten, die Grabnummer dem beauftragten Beamten der Staatspolizei zu übergeben, die Eintragung in das dortige Buch so vorzunehmen, daß der Name des Toten nicht daraus hervorgeht.»
Wer die Erinnerung an diese Toten verdrängt und nicht wachhält, verschafft den Mördern einen späten Sieg. Wer jedoch der Erinnerung nicht ausweicht, sondern in ihr eine erlösende Kraft für Gegenwart und Zukunft sieht, wird allen Versuchen wehren, die Opfer mit den Tätern auf eine Stufe zu stellen.
Die Kommunisten im Untergrund wie die konservativen Verschwörer in den Hinterzimmern der Macht wußten, daß ihre Pläne und ihre Aktionen Außenstehenden sinnlos erscheinen mußten und daß direkte Erfolge fast aussichtslos waren. Im Januar 1942 schrieb Helmuth James von Moltke seiner Frau: «Ohne Mut ist gar nichts zu machen. Man muß sich nur vornehmen, daß man sich durch nichts kleinkriegen und von dem rechten Weg abbringen läßt.» Am Ende des gleichen Jahres kämpfte der Kommunist Wilhelm Knöchel in der illegalen Zeitschrift «Der Friedenskämpfer» gegen die Devise vom «Abwarten» in den eigenen Reihen: «Was heute nottut, ist Mut und nochmals Mut, Begeisterung, Kühnheit, Todesverachtung jedes einzelnen …»
Jenseits aller politischen Differenzen, die tief gingen und eine vielleicht erfolgreiche Zusammenfassung aller Kräfte unmöglich machten, und jenseits aller zeitbedingten Unterschiede, geben die Frauen und Männer des Widerstandes ein Beispiel, worauf es in extremen, scheinbar aussichtslosen Situationen ankommt. Die uralte Hoffnung, daß David den Goliath mit einem Stein besiegen kann, stirbt nicht, solange es Menschen gibt, die nicht zögern und nicht abwarten, wenn es um Gut und Böse geht; die nicht nach dem Nutzen fragen, sondern ihren Idealen und damit sich selber treu bleiben, während alle um sie herum dem Diktator zujubeln. Der Schriftsteller Primo Levi, italienischer Jude, ein Widerstandskämpfer, der zusammen mit Jean Améry in Auschwitz den Tod überlebte, der immerzu gegen das Vergessen anschrieb und sich darüber im April 1987 das Leben nahm, hat den jüdisch-russischen Partisanen des Zweiten Weltkriegs ein Lied als Denkmal gesetzt. Der Refrain heißt: «Wer für mich, wenn nicht ich? Wie, wenn nicht so? Wann, wenn nicht jetzt?»
In der Nacht vom 7. auf den 8. September 1943, Berlin war gerade bombardiert und auch das Zuchthaus in Plötzensee getroffen worden, ordnete der Reichsjustizminister eine beschleunigte Vollstreckung der Todesurteile an. In den folgenden fünf Nächten und Tagen wurden in Plötzensee 250 deutsche und ausländische Häftlinge erhängt, darunter ein katholischer Jugendführer aus dem Rheinland, ein Sozialdemokrat aus Dresden, Kommunisten aus Berlin und der tschechoslowakische Journalist Julius Fučík. Im Frühjahr 1943 war der Widerstandskämpfer Julius Fučík in Prag von der Gestapo entdeckt und verhaftet worden. Dort schmuggelte ein Aufseher aus der Zelle, was der Gefangene für die Menschen in glücklicheren Zeiten aufgeschrieben hat:
«Um eines bitte ich: Ihr, die ihr diese Zeit überleben werdet, vergeßt nicht. Vergeßt weder die Guten noch die Bösen. Sammelt geduldig Zeugnisse über alle, die für sich selbst und für euch gefallen sind. Eines Tages wird das Heute Vergangenheit sein, man wird von der großen Zeit und von den namenlosen Helden sprechen, die Geschichte machten. Ich möchte festhalten, daß es keine namenlosen Helden gab. Daß sie Menschen waren, die einen Namen, ein Gesicht, die Sehnsüchte und Hoffnungen hatten, und daß deshalb der Schmerz auch des allerletzten unter ihnen nicht geringer war als der Schmerz des ersten, dessen Name überdauert. Ich möchte, daß sie allesamt euch immer nahebleiben wie Bekannte, wie Verwandte, wie ihr selbst.»
1918–1929 Die Demokratie von Weimar: Ihre Feinde – ihre Freunde
Am 10. November 1918 erstürmte das Erste Garde-Regiment zu Fuß erfolgreich die Höhe 249 bei Sedan. Am Tag danach akzeptierte eine deutsche Delegation im Wald von Compiègne bei Paris die Waffenstillstandsbedingungen der Siegermächte. Die Waffen schwiegen. Das Reich war geschlagen. Am 11. Dezember zog das Erste Garde-Regiment blumengeschmückt, mit klingendem Spiel und silbergewirkten Fahnen in die traditionsreiche Garnisonsstadt Potsdam ein, an der Spitze eines Zuges Henning von Tresckow, Träger des Eisernen Kreuzes und mit 17 Jahren jüngster Leutnant der Armee. Einer Armee, deren oberster Kriegsherr nach Holland geflüchtet war und die seit dem 9. November 1918 einer Republik zu dienen hatte. Denn an jenem Tag war die Staatsmacht dem Parteivorsitzenden der SPD, Friedrich Ebert, zugefallen, weil die Planer und Antreiber dieses Krieges sich nun vor der Verantwortung der Niederlage drückten.
In diesen Novembertagen schrieb der 38jährige Major im Oberkommando des Heeres, Ludwig Beck, nach Hause: «Im schwersten Augenblick des Krieges ist uns die … von langer Hand her vorbereitete Revolution in den Rücken gefallen.» Wie Beck waren von nun an Millionen Deutsche überzeugt, daß «Revolution» und «Demokratie» identisch wären und das Reich um den Sieg gebracht hätten. Die «Dolchstoßlegende» vergiftete von Anfang an das Klima in der Republik. Ebenfalls im November 1918 erhielt der pommersche Gutsbesitzer Ewald von Kleist in Schmenzin eine Vorladung des soeben gebildeten Arbeiter- und Soldatenrates. Er solle sich zur nächsten Sitzung einfinden. Der adlige Landmann zerriß das Papier. Für ihn gab es keine Demokratie, sondern war der König von Preußen wider alles Recht an der Ausübung der Regierung gehindert.
Was Gutsbesitzer und Offiziere demonstrierten, entsprach den Überzeugungen und Erwartungen der großen konservativen Mehrheit in Adel und Bürgertum. Eine Mehrheit, auf die sich das wilhelminische Deutschland bei seinem demokratiefeindlichen Kurs im Innern und seinen Expansionsversuchen hatte stützen können. Ihre Vertreter gaben nach dem äußerlichen Zusammenbruch ihrer Welt sofort die Losung aus, mit der die soeben mehr zufällig geborene Weimarer Republik fertig werden mußte und an deren trotzigem Anspruch sie schließlich scheitern sollte: Im Felde unbesiegt! Das hieß: Rache für den Frieden von Versailles, in den der Waffenstillstand von Compiègne schließlich mündete. Es bedeutete zugleich die grenzenlose Verachtung jener, die diesen Frieden akzeptierten und für die Republik standen. Als «Novemberverbrecher» und «Vaterlandsverräter» waren sie abgestempelt.
Die deutschen Kirchen, die im Krieg gepredigt hatten, daß Gott auf seiten der deutschen Bataillone stand, verbündeten sich mit den Feinden der Republik und sagten ungeniert, was sie von der Außenpolitik der jungen Demokratie hielten. Wenn der Pastor Paul Konrad im Winter 1918/19 in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche die Kanzel bestieg, war das Gotteshaus stets gefüllt – von Kaisertreuen, die wußten, daß sie Trost und Zuspruch erhielten. Seinen Konfirmanden gab der Pastor den Leitspruch mit ins Leben: «Evangelisch bis zum Sterben. Deutsch bis in den Tod.» Als im September 1919 in Dresden der 1. Deutsche Evangelische Kirchentag nach dem Krieg zusammenkam, sagte dessen Präsident: «In einem Weltkrieg ohnegleichen, nach einem mehr als vierjährigen heldenmütigen Ringen ohnegleichen, gegen eine ganze Welt von Feinden ist unser Volk zusammengebrochen. Die Herrlichkeit des deutschen Kaiserreichs, der Traum unserer Väter, der Stolz jedes Deutschen ist dahin … Dem furchtbaren Krieg hat ein furchtbarer Friede kaum ein Ende gesetzt.»
Das traditionelle Bündnis von «Thron und Altar» hatte die deutschen Lutheraner so fest an das Schicksal des Reiches gekettet – der Kaiser war ihr oberster geistlicher Leiter –, daß mit dem Zusammenbruch dieses Reiches auch ihr Schicksal besiegelt schien. Das Leben in einer anderen Staatsform und die Absage an einen militärischen Nationalismus waren für die meisten Protestanten undenkbar. Erst im November 1918 wagten alle diejenigen evangelischen Theologen, die sich zum 400. Geburtstag Luthers im Oktober 1917 gegen den Krieg erklärt hatten, ihren Namen preiszugeben: «Wir deutschen Protestanten reichen im Bewußtsein der gemeinsamen christlichen Güter und Ziele allen Glaubensgenossen, auch denen in den feindlichen Staaten, von Herzen die Bruderhand.» Selbst dieses Minimum evangelischer Solidarität blieb weiterhin rar. Die Kirchenleitungen ordneten 1919 einen jährlichen Trauersonntag an – als Protest gegen Versailles und die «Kriegsschuldlüge». Die Anordnung wurde zehn Jahre später ausdrücklich erneuert.
Der Feuerofen des Krieges hatte nur wenige geläutert. In den Stahlgewittern an der Front, in Blut und Dreck hofften die Alteren auf ein größeres Deutschland und die ganz Jungen noch dazu auf eine Bewährung: Der Adel der Schlacht sollte sie zum Manne machen.
Zu den jungen Soldaten, die im Winter 1918/19 heimkehrten, gehörte auch Adolf Reichwein. Er war ein überzeugter «Wandervogel», Vertreter einer Generation, die in der Jugendbewegung ihren Protest gegen die verknöcherte Welt der Erwachsenen auslebte – und nach dem Abitur sofort und freiwillig in den Krieg gezogen war. Der 18jährige, der im Ausbildungslager auf etliche «Wandervögel» traf, hatte im April 1917 an seine Eltern geschrieben: «Wir Wandervögel wünschen uns natürlich nichts anders als möglichst bald einen Transport nach Frankreich, denn es wäre bitter, wenn wir das Kriegsende im Rekrutenlager erleben müßten.» Im Juli war es soweit: «… denn am 1. August gehts zur Front! Ein denkwürdiger Tag, und ein gutes Vorzeichen, am 4. Jahrestag unsres siegreichen Krieges in die Reihen der Kämpfer vorne zu treten.» Adolf Reichwein kam aus einer liberal-bürgerlichen Lehrerfamilie. Bei aller nationalen Begeisterung war ihm ein kritischer Blick auf die Schlachtfelder ringsum noch möglich. Er machte den Versuch, das Völkermorden zu analysieren, ohne ihm eine radikale Absage zu erteilen: «Der moderne Krieg wühlt derart alle Kräfte und Gegenkräfte durcheinander, daß keine Partei ohne ernste Krise ihn überstehen kann. Diese Krise birgt unwillkürlich in sich das wirkliche positive Kulturmoment des Krieges, indem sie als Heilmittel gegen sich selbst soziale Reformen auslöst.» Der Krieg nicht als Instrument, um die alten Strukturen zu bewahren, sondern im Gegenteil als Katalysator einer besseren, gerechteren Zeit.
In Darmstadt trug im November 1918 ein Flugblatt die Konsequenz solcher Gedanken der jungen Kriegsgeneration an die Öffentlichkeit. Eine Zeitschrift warb unter neuem Namen und neuem Programm um Leser: «Die ‹Dachstube› ist zu Ende. Sie hat gesammelt, gesichtet, geschult. Das ist erfüllt. Jetzt gilt es mehr, gilt den Umriß der neuen Welt aufzuzeichnen, für ihn kämpfen; Schweigen ist Verrat. Ein neues Publikum marschiert herauf. Größere Ziele gebietet uns die Zeit. Wir errichten das Tribunal. Wir stehen zu dem Neuen gegen das Verrottete.» Monatlich für 50 Pfennig sollte das «Tribunal» erscheinen, als Herausgeber zeichnete Carlo Mierendorff. Im Frühjahr 1914 hatte der Darmstädter Bürgersohn sein Abitur gemacht, im Herbst war er als Kriegsfreiwilliger in Rußland eingesetzt werden. Von der Front schickte er literarische Versuche in die Heimatstadt, wo Gymnasiasten die «Dachstube» gegründet hatten. Eine von vielen radikalen Zeitschriften, die ein Zeichen setzen wollten. Die Sprache sollte die Spießbürger aufrütteln, provozieren, als ein erster Schritt, den Lauf der Dinge verändernd zu gestalten.
An die westliche Front zurückgekehrt, bei Langemarck, wo Hunderte von jungen Freiwilligen zwecks Erstürmung einer Anhöhe in den Tod geschickt wurden, erhielt Carlo Mierendorffaus der Hand des Kaisers das Eiserne Kreuz. Trotzdem kam er zurück aus dem Krieg mit der Überzeugung: Nie wieder. Der gleichaltrige Carl Zuckmayer wurde Autor für das «Tribunal» und Mierendorffs Freund: «Wir waren vom Krieg geprägt und gezeichnet, aber wir fühlten uns vom Krieg nicht zerstört. Wir hatten ihn überlebt und überwunden, wir hatten unsere heile Haut heimgebracht, jetzt wollten wir vorwärts, in ein anderes Stadion, wo es galt, neue, kühnere Kämpfe zu wagen. Wir blickten auf die Kriegszeit zurück, ohne verklärende Romantik, aber auch ohne Selbstmitleid, Bitterkeit oder Klage.»
Es war die Einsicht der Außenseiter. Den meisten Kriegsteilnehmern, auch den jüngeren, ging es in diesem November 1918 wie dem 29jährigen Gefreiten Adolf Hitler, der sich wegen einer Gasvergiftung im Lazarett befand und das Ende des Krieges als «die entsetzlichste Gewißheit» seines Lebens empfand: «Während es mir um die Augen wieder schwarz ward, tastete und taumelte ich zum Schlafsaal zurück, warf mich auf mein Lager und grub den brennenden Kopf in Decke und Kissen. Seit dem Tage, da ich am Grabe der Mutter gestanden, hatte ich nicht mehr geweint … Nun aber konnte ich nicht mehr anders.» Die Zeitgenossen am Ende des Ersten Weltkrieges sahen voller Ängste in die Zukunft; verzweifelt klammerten sie sich an das Vergangene; trauerten, ohne nach der eigenen Schuld zu fragen; blieben überzeugt, daß im Kampf die Lösung für alle Probleme zwischen den Menschen und den Völkern liege. Die militärischen Kategorien von «Freund und Feind» wurden als Richtschnur in die Demokratie übernommen.
Das trotzige Aufbäumen der Mehrheit gegen alles Neue, die Verweigerung jeden Dialogs mit denen, die Erben der Niederlage geworden waren, werden um so schwerer begreifbar, wenn die Scheinwerfer sich auf die neuen Repräsentanten staatlicher Macht richten: An ihrer Spitze Friedrich Ebert, erst Übergangskanzler, dann Präsident der verfassunggebenden Versammlung in Weimar und schließlich bis zu seinem Tod 1925 vom Volk gewählter Präsident der Republik. Niemand konnte diesem Sozialdemokraten vorwerfen, Wegbereiter der Revolution zu sein. «Verlaßt die Straßen! Sorgt für Ruhe und Ordnung!» lautete sein erster Aufruf am 9. November 1918. Und gemäß dieser Maxime hat er stets versucht, Politik zu betreiben, mochten die Zeiten auch noch so verworren sein. Friedrich Ebert war ein Sozialist und Demokrat, und nichts konnte ihn in seiner Überzeugung wankend machen, daß die parlamentarische Demokratie die sozialistische Gesellschaft bringen würde – ohne blutige Revolution.
Damit war er nicht allein. Die Arbeiter- und Soldatenräte, die im Winter 1918/19 überall als Organe der Selbstverwaltung entstanden, waren keineswegs Horte von Radikalität und Anarchie. Nur ihre Gegner haben sie so diffamiert und Geschichtsschreiber diese Verzeichnung allzu lange übernommen und als historische Wahrheit ausgegeben. In fast allen Räten hatten gemäßigte Sozialisten die Mehrheit, und auch Rosa Luxemburg vom radikalen linken Flügel war überzeugt: «Die Revolution braucht keinen Terror.» Die sozialistische Front hatte sich allerdings gespalten und viele Arbeiter waren an ihrer SPD irre geworden. Im August 1914 hatte Karl Liebknecht als einziger SPD-Abgeordneter im Reichstag gegen die Bewilligung der Kriegskredite gestimmt, im Dezember 1915 waren es schon 43 Abgeordnete. Ab 1916 kam es zu immer größeren Streiks gegen den Krieg und für einen baldigen Frieden. Als der Rausch der Kriegsbegeisterung verflog, waren es die Arbeiter, die als erste zur Besinnung kamen und von ihrer Partei eine andere Politik forderten. Als diese Politik ausblieb, verließ eine beachtliche Minderheit die SPD und fand sich 1917 in der Unabhängigen Sozialistischen Partei Deutschlands (USPD) zusammen. Ganz links im sozialistischen Spektrum stand der Spartakusbund, der trotz seiner geringen Anhängerschaft durch die politische Begabung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht Aufsehen erregte. Die Abspaltungen und Auseinandersetzungen in der Arbeiterbewegung waren auch deshalb so bitter, weil sich alle Fraktionen selbstverständlich weiterhin zur sozialistischen Familie zählten. Ihr Traum von einer besseren Welt war der gleiche geblieben, mochten sich auch die Wege dorthin getrennt haben. Alle hatte die Arbeiterkultur tief geprägt.
Der Münchner Robert Eisinger war 1918 mit 18 Jahren in die USPD eingetreten. Von seinem Vater – einem kleinen Angestellten und SPD-Mann – beeinflußt, hatte er die Haltung der SPD zum Krieg als Verrat empfunden. Sein Ideal war ein internationaler Sozialismus und Pazifismus. Der junge Eisinger war Marxist. Aber seine Vorstellung von der «Diktatur des Proletariats» trug wenig klassenkämpferische Züge: «Ich dachte dabei keineswegs an die Verstaatlichung aller Industriezweige, sondern vielmehr an deren Übergang in den Allgemeinbesitz eines Volkes. Ich dachte auch niemals bei diesem Gedanken an das sogenannte Proletariat als nur einer Klasse der Arbeiterschaft, sondern immer an das Volksganze, an die Herrschaft des Volkes im Gegensatz zur Herrschaft des Kapitals.» Es ging Eisinger, der im Dezember 1918 Kurier für die Münchner Räteregierung wurde, um ein großes allgemeines Ziel. Und der Münchner hätte sicherlich unterschrieben, woran der Bochumer Arbeitersohn Heinrich König, der schwer verletzt aus dem Krieg heimkehrte und wie sein Vater aktives SPD-Mitglied war, 1918 felsenfest glaubte: «Die Idee des Sozialismus wird alle Stürme und Krisen siegreich überstehen.»
An den Realitäten gemessen, schien solche Überzeugung naiv. Ein Aufstand der Spartakisten im Januar 1919 in Berlin gegen die Regierung Ebert endete im Desaster. Rosa Luxemburg, die von der Weisheit dieses Kampfes keineswegs überzeugt war, und Karl Liebknecht wurden brutal ermordet. Ihre Mörder gehörten zu den sogenannten Freikorps, Freiwilligenverbände, die alle aufnahmen, die dieser Republik den Kampf geschworen hatten. Es waren Männerbünde, in denen ehemalige Berufssoldaten und Bürger, die sich nach dem Krieg nicht mehr in die zivile Ordnung fügen konnten, hemmungslos ihren Haß auf das «rote Gesindel» auslebten. Haus für Haus durchkämmten sie in Berlin die Bezirke, in denen die Spartakisten kämpften. Die Männer der Freikorps jagten die Aufständischen wie Tiere in die Hinterhöfe und erschossen sie dort in Gruppen zu 15 oder 20 Mann.
Eine Mehrheit in der SPD war bereit, den angeblichen Teufel mit Beelzebub auszutreiben. «Einer muß halt den Bluthund machen», sagte Gustav Noske, ein alter SPD-Kämpfer, der nicht zögerte, wenn einmal eine Entscheidung gefallen war. Und für ihn hieß die Entscheidung in diesem Winter 1919: gegen die radikalen linken Brüder und Schwestern, die ihre Utopien auch mit Gewalt durchsetzen wollten, ist jeder Verbündete recht. Männer wie Ebert und Noske waren eher bereit, den traditionellen Machteliten aus den Zeiten des Kaiserreiches – und Feinden der SPD – zu trauen, als den Abweichlern aus den eigenen Reihen. Bei den Funktionären der Partei war die Angst vor der Spontaneität der Massen und vor ungewohnten Situationen größer als die Risikofreude, die Chance zu einem wirklichen Neuanfang in Staat und Gesellschaft wenigstens auszuloten und Reformen zu wagen, statt bestehende Strukturen um jeden Preis zu bewahren. Man darf nicht die Augen verschließen vor dem Haß, mit dem die verschiedenen Lager der Arbeiterbewegung gleich zu Beginn der Republik einander tiefe Wunden schlugen. Die Spartakisten gingen mit ihren Waffen gegen Sozialisten vor, als sie das Regierungsviertel stürmten. Der sozialdemokratische «Vorwärts» schrieb nach dem Mord über Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht: «Sie haben sich selbst bekannt als Bürgerkriegshetzer, als Proletariermörder, Brudermörder, und ewig muß ihnen das furchtbare Wort in den Ohren gellen: Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden.»
Die Art, wie Gustav Noske mit den Spartakisten fertig wurde, imponierte einem Mann, der aus ganz anderem Holz geschnitzt war. Als Noske während des Aufstands im Berliner Süden Quartier nahm und dann mit den kämpfenden Truppen in die Stadt marschierte, wich der Kapitänleutnant Wilhelm Canaris nicht von seiner Seite. Er hatte Noske schon in Kiel assistiert, wo der SPD-Mann beim Arbeiter- und Soldatenrat für Ordnung sorgte. Canaris war in einer großen Villa in Duisburg mit Kindermädchen, Gärtner und Chauffeur aufgewachsen und Marineoffizier geworden. Mit der Demokratie konnte er sich kein Leben vorstellen. Führernaturen faszinierten den zierlichen, nervösen Canaris ebenso wie das verschwörerhafte Tun der rechtsradikalen Freikorps, unter denen er bald viele Freunde gewann.
Den Gegnern der Republik blieb nicht verborgen, in welchem Dilemma die SPD aufgrund der Regierungsverantwortung steckte. Rücksichtslos versuchten sie, der Demokratie von Weimar den Todesstoß zu versetzen. Im März 1920 wurde wieder das Regierungsviertel gestürmt, diesmal von der rechtsradikalen Freiwilligenbrigade Ehrhardt, die Wolfgang Kapp zum Reichskanzler ausrief. Ewald von Kleist, auf seinem pommerschen Besitz gut unterrichtet, gehörte zu denen, die sofort auf Kapps Seite traten. Eigenmächtig ließ er den Landrat in die Kaserne sperren und übernahm selbst die Amtsgeschäfte. Es ist fast ein Wunder: Der Putsch von rechts scheiterte, obwohl die Regierung von Berlin nach Stuttgart flüchten mußte und die Reichswehr sich weigerte, gegen die Putschisten vorzugehen.
Es waren die Arbeiter, die sich in diesen Märztagen 1920 mit einem Generalstreik eindeutig hinter die Republik stellten und sie am Leben hielten. Doch als im Ruhrgebiet bewaffnete Arbeiter – nachdem Kapp aufgegeben hatte – den Streik für mehr Demokratie fortsetzten, ließen die regierenden Berliner Genossen die Reichswehr aufmarschieren und die Freikorps eingreifen. Es war ein ungleicher Kampf, und wieder wüteten jene mörderisch im Namen der Republik, die ihre ärgsten Feinde waren. Ein Freikorpssoldat, der im Ruhrkampf eingesetzt wurde, schrieb nach Hause: «Selbst die Verwundeten erschießen wir noch. Die Begeisterung ist großartig.» Ende März war alles vorbei. Unübersehbar waren die Menschenmassen, die den gefallenen Arbeitern in den Städten an der Ruhr das letzte Geleit gaben. Die meisten Toten erhielten ein Grab auf dem Ehrenfriedhof. Rote Fahnen mit Trauerflor ragten aus der Menge, der Arbeitersängerchor sang, Arbeiter schossen eine Ehrensalve über die Särge. Auch bürgerliche Beobachter konnten sich der Eindringlichkeit dieser Demonstrationen nicht entziehen. Von der Gewalt besiegt, zeigten die Arbeiter auf ihre Weise, daß der Kampf um mehr Gerechtigkeit und soziale Reformen nicht gegen die Republik gerichtet war, sondern geradezu ein Beweis für ihren Glauben an das Neue, das sich im November 1918 angekündigt hatte.
Im gleichen Jahr, 1920, zog sich die SPD aus der Regierung zurück und blieb bis 1928 in der Opposition. Sie verlor viele Wähler und kam nie mehr über 30 Prozent hinaus. Trotzdem war sie bis 1932 die stärkste Partei der Republik und konnte sich auf ihren Rückhalt in der Arbeiterschaft verlassen. Denn während die Bürger den Zerfall ihrer Welt und ihrer Werte beklagten und mit dem Untergang der alten Ordnung Halt und Hoffnung verloren hatten, retteten die Arbeiter ihr Milieu, ihre sozialen Strukturen und Tugenden in die neue Zeit. Sie waren fest in der Arbeiterkultur verankert, gleichgültig, ob sie rechte oder linke Sozialdemokraten waren, oder ob sie zur KPD gehörten, die seit 1920, als die USPD sich spaltete und ihre Mehrheit zur damals winzigen KPD überwechselte, eine Massenpartei geworden war.
Mit dem Augenblick der Geburt entschied sich, wer zur großen sozialistischen Gemeinschaft gehörte. Nicht Programme, nicht Rebellion gegen die Eltern, nicht grüblerisches Suchen machten damals den Sozialisten, sondern die Familie. Als der Bergmann Wilhelm Honecker Ende 1918 aus dem Krieg in seine Heimatstadt Wiebelskirchen an der Saar zurückkam, hatte sein ältester Sohn Erich gerade die Hälfte des ersten Schuljahres hinter sich gebracht. Honecker, zusammen mit seiner Frau seit vielen Jahren in der SPD, trat nach seiner Heimkehr in die USPD über, weil er die Unterstützung der Kriegspolitik durch die SPD nie verstanden hatte. Viele Jahre später erinnerte sich Erich Honecker, der nach 1945 in der DDR Karriere machen würde, an diese Zeit: «Ab Ende 1918 trafen sich Kollegen und Freunde meines Vaters bei uns zu Hause in Wiebelskirchen. Er hatte nichts dagegen, wenn ich ins Zimmer kam, ich durfte nur nicht stören. Man diskutierte politische Themen, vor allem die Situation im Bergbau und in der Stahlindustrie … An vielen Abenden hörten alle zu, wie mein Vater aus den Werken von Karl Marx, Friedrich Engels, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht vorlas. Natürlich verstand ich damals so gut wie gar nichts. Aber die Atmosphäre dieser Zusammenkünfte, das entschlossene Bemühen, Zusammenhänge zu verstehen, das Vertrauen untereinander, ihr Wunsch nach politischen Veränderungen und auch die Namen der großen Revolutionäre, deren Worte mein Vater vortrug, faszinierten mich und machten einen unauslöschlichen Eindruck auf mich.»
Im November 1918 erlebt der Sechsjährige, daß eine Gemeinschaft von Menschen – über die Familie hinaus – von einer Idee begeistert und fest zusammengehalten werden kann. Und in der Familie erfährt er, wie die Welt draußen beschaffen ist und wie man sie verstehen kann: «Mein Vater erklärte mir auf seine einfache Weise, warum die Reichen reich und die Armen arm sind; warum es Kriege gibt, wer von ihnen profitiert und wer unter ihnen leidet.» Der Rückblick des Erich Honecker ist kein verklärtes Kindheitsidyll und keine plumpe Propaganda. Es gibt zu viele ähnliche Erinnerungen von Männern und Frauen aus Arbeiterfamilien, die keinen Zweifel lassen: Es waren die Eltern, die ihren Kindern durch ihr Vorbild, durch eine sorgfältige und verantwortungsbewußte Erziehung ohne Zwang oder große Worte etwas mit auf den Weg gaben, das bei den meisten Heranwachsenden zur eisernen Ration wurde, zu einem Teil ihrer Persönlichkeit und ihres Lebens, dem sie treu blieben.
Auf drastische, aber ebenso selbstverständliche Weise erlebte in Augsburg der achtjährige Eugen Nerdinger, in was für einer Tradition er stand. Im Frühjahr 1919 zogen die Truppen, die die Münchner Räterepublik zusammengeschossen hatten, durch die Stadt und räumten dort gleich mit auf – wie sie es verstanden. Vater Nerdinger, Arbeiter und Sozialdemokrat, nahm seinen Sohn zum Anschauungsunterricht mit auf die Straße: «Bei diesem Stadtrundgang habe ich einen für mein ganzes Leben entscheidenden Eindruck erhalten … Ich sah die Kanonen, die von den Anlagen der Maria-Theresia-Schule aus gegen die Stadt, gegen das Rathaus gerichtet waren. Plötzlich bemerkte ich an einem Gully an der Volkhartstraße eine braune Blutlache. Ich fragte meinen Vater, was da geschehen sei, und er sagte: ‹Da werden’s halt einen von uns erledigt haben!› Und ich habe mich dann in einer instinktiven Bewegung zum Gully niedergebeugt und meine Handfläche auf die Blutkrusten gepreßt. Noch heute fühle ich die Empfindung, die ich dabei hatte.» Die Worte der sozialistischen Theoretiker und die Erinnerung an sozialistische Traditionen wurden für die Kinder in den Arbeiterfamilien zu moralischen Wegweisern, zu Werten und allgemeinen Regeln, die das Leben in der Familie und weit darüber hinaus prägten.
Willi Bohn wurde 1900 in Gotha geboren. Seine Mutter kam aus einer Bauernfamilie, sein Vater baute Instrumente und war in der SPD aktiv. «In unserem Elternhaus, da stand die Losung meines Lebens angeschrieben. Wo wir wohnten, da gab’s noch kein Gas und kein elektrisches Licht, das Wasser mußte aus dem Keller herauf in den dritten Stock geholt werden. Und in unserer Wohnküche war ein großer Handtuchhalter mit einem Überhandtuch, auf dem stand: ‹Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!›» Was wie eine Phrase fürs Poesiealbum klingt, war für Willi und seinesgleichen eine Aufforderung, nach der man handelte. Willi Bohns Vater starb früh. Doch die Arbeitskollegen sammelten über Jahre an jedem Weihnachtsfest, damit die Familie keine Not litt und der Junge eine bessere Schule besuchen konnte. Sozialistische Moral im besten Sinn war handfeste, praktizierte Humanität.
Als die Väter 1914 in den Krieg ziehen mußten, wurden die Mütter zu Alleinerziehenden. Nicht selten waren sie berufstätig und versuchten, allen Anforderungen gerecht zu werden. Elisabeth Ostermeier war ein Jahr alt, als ihr Vater eingezogen wurde: «Meine Mutter mußte damals als Gleisarbeiterin bei der Eisenbahn arbeiten. Trotzdem habe ich nur gute Erinnerungen an meine Kindheit … So weit ich mich zurückerinnern kann, war unsere Mutter immer für uns da, immer zugänglich und ausgeglichen. Ja, ich kann wohl sagen, daß ich als Kind umsorgt wurde.» Die Mutter stand 1917 als «Aufrührerin» vor Gericht, weil sie die Arbeiterinnen einer Schuhfabrik in Harburg bei Hamburg dazu angestiftet hatte, mehr Lohn zu fordern. Für die Kinder bedeutete das ganz und gar keine Schande, sondern die Konsequenz dessen, wofür ihre Eltern eintraten: «Daß mein Vater aktiver Sozialdemokrat war – wie eigentlich alle Väter aus unserem Freundeskreis –, war für uns Kinder so selbstverständlich, daß wir nie darüber gesprochen haben. Offenbar hatte das ja auch seine Ordnung; Lebenshaltung und Vorbild unserer Eltern ließen keinen Zweifel daran aufkommen.»
Keinen Zweifel gab es auch über die Mittel, mit denen ein Arbeiter im Leben etwas werden und die Gesellschaft insgesamt verändern konnte. Elisabeth Ostermeier: «Wir wurden zu dem Bewußtsein erzogen, daß Wissen und Argumente im Leben ausschlaggebend sind und daß Gewalt keine geistige Auseinandersetzung ersetzen kann, also unangebracht und dumm ist. Ein schlichtes Konzept – aber ungeheuer eindringlich. Ein roter Faden für das ganze Leben.» Bildung: Sie war für Arbeiterkinder der Schlüssel zum Erfolg, zu qualifizierteren Berufen, zu besserem Verdienst, um den meist elenden Wohnverhältnissen zu entkommen. Aber sie bedeutete für die Arbeiterfamilie noch mehr. Mindestens so intensiv wie die bürgerliche Klasse hatten die Proletarier die Ideale der Aufklärung aufgenommen. Wissen sollte nicht nur die Verbesserung materieller Verhältnisse bringen, sondern die volle Entfaltung des Menschen. Der neue, der bessere Mensch, an den sie glaubten, für dessen Reich der Freiheit sie kämpften, kannte seinen Schiller, seinen Goethe. Er war unersättlich in seinem Hunger nach Information und seinem Wunsch nach Erkenntnis. Der Sozialismus erklärte die Welt und deckte die Gesetze auf, nach denen die Geschichte ablief.
Bildung ist Macht: Die Arbeiter nahmen die Devise der bürgerlichen Welt ernst. Und weil die Bürger ihre Bildungsprivilegien teuer zu Markte trugen, schufen sich die Arbeiter ihre eigenen Institutionen. (Sie konnten kein Schulgeld zahlen, sich kein Studium und keine Referendarzeit leisten, in der man nichts verdiente.) So hart die Arbeit auch war und so lang der Arbeitstag, am Abend wurde weitergelernt. Dann wurden die Bücher aus dem Schrank geholt, die man über die «Büchergilde Gutenberg» oder den «Bücherkreis» besorgt hatte. Dann ging man zu Vorträgen, die der Ortsverein organisierte. Die Gegenwelt der Arbeiter hatte sich zu Kaisers Zeiten entwickelt, als die Sozialisten per Gesetz verfolgt wurden. Damals machte man die Erfahrung: Wissen ist ein Schatz, den niemand fortnehmen kann und mit dem sich die Welt verändern läßt. Das war die Botschaft, die die Eltern an ihre Kinder weitergaben. Und sie hatte trotz Krieg und Zusammenbruch der alten Ordnungen für die Arbeiter nichts von ihrer Glaubwürdigkeit und Faszination verloren.
Die Kinder und Enkel nahmen in den zwanziger Jahren das Erbe der Arbeiterbewegung mit Begeisterung auf: «Wir hatten starke Bildungsinteressen, geistige Bedürfnisse, die zu stillen uns die uns umgebende Welt verwehrte. Darum hatten wir ein System der Schulung entwickelt. Wir haben Vorträge von Genossen gehört, die meist Lehrer waren; wir haben die Bindung an die Tradition der Arbeiterbewegung und ihrer Geschichte gesucht, Sprach- und andere Kurse an der Volkshochschule belegt und uns um Verständnis für Kunst und Kultur bemüht.» So Eugen Nerdinger, der die Blutlache eines erschossenen Arbeiters in Augsburgs Straßen nicht vergessen konnte. Wie alle Arbeiterkinder verbrachte er seine Freizeit mit seinesgleichen: im Arbeitersportverein, beim Arbeitersängerbund und vor allem in der SAJ, der Sozialistischen Arbeiterjugend.
Das Gemeinschaftsgefühl in einer Gruppe außerhalb der Familie begann für die Arbeiterkinder bei den «Kinderfreunden». Ursprünglich als Elternorganisation gegründet, die Ausflüge und Spielnachmittage für Kinder durchführte, entwickelte sich daraus eine Institution, in der Kinder ihre Freizeit selbst organisieren konnten und sich ihre eigene Ordnung gaben. Ältere Kinder, die meist den «Roten Falken» angehörten, gaben den Ton an. Leitbild war die sozialistische Erziehung, die bei den «Roten Falken» in neun Geboten zusammengefaßt war. Unter anderem hieß es: «Wir bekennen uns zur Arbeiterklasse und treten für sie ein … Wir sind hilfsbereit … Wir schützen die Natur und achten alles, was zum Nutzen der Gesellschaft geschaffen wird … Wir meiden und bekämpfen den Alkohol- und Nikotingenuß … Wir halten uns sauber und gesund.»
Mary Fried, 1906 in eine Münchner Arbeiterfamilie geboren, verbrachte Anfang der zwanziger Jahre ihre Freizeit bei den «Kinderfreunden»: «Wir haben mit den Kindern, fast alles Arbeiterkinder, Ausflüge gemacht oder auch Lesenachmittage … Wir hatten einen wunderbaren Kontakt zu unseren Kindern, dabei waren wir ja auch nicht älter als 17, 18 … Wir waren Helfer, keine Funktionäre. Wir waren keine Autoritätspersonen, im Gegenteil, wir haben oft heftig diskutiert mit den Jugendlichen.» Solche Freizeit war Einübung in die Solidargemeinschaft, als die sich die Arbeiterklasse verstand: Edel sei der Mensch, hilfreich und gut; eine Gemeinschaft, die unter sich blieb. Die Gesellschaft war in eine bürgerliche und eine proletarische Kultur gespalten. Ob Sportler oder Sänger, Jäger oder Kraftfahrer, Schach- oder Freidenkerenthusiast – die Arbeiter hatten für alles ihre eigenen Vereine. Die Kneipen und Gaststätten, in denen man sich abends traf, waren fest in sozialistischer Hand.
Die Arbeiterkultur beeinflußte wesentliche Entwicklungen in der Pädagogik und den freien, weltlichen Schulen. Dort gab es für alle eine Chance, an offener Bildung und solidarischer Moral teilzuhaben. Elisabeth Ostermeier, aus der Arbeiterfamilie in Harburg, südlich von Hamburg, hat davon profitiert – zumindest eine Zeitlang: «Meine Eltern haben auch versucht, uns allen dreien so viel Wissen mitzugeben, wie sie nur irgendwie selbst vermitteln oder bezahlen konnten. Der Besuch einer höheren Schule kostete damals ja noch Geld. Wir Mädchen kamen zunächst genauso wie der Sohn auf die Mittelschule. Uns mußten die Eltern aber bald schweren Herzens wieder runternehmen … Nur für den Sohn war es nach aller Voraussicht unbedingt nötig, daß er einen guten Beruf ergreifen und eine Familie ernähren konnte … Ich hatte dann das Glück, auf die Freie Weltliche Schule in Harburg zu kommen. Sie entstand durch Zusammenarbeit von Lehrern und Eltern mit dem Ziel, Arbeiterkindern bessere Bildung zu vermitteln. Die Gründer waren Sozialdemokraten. Mein Vater war im Vorstand dieser Schule, in der das Wissen nicht autoritär eingepaukt wurde.» Diese Schulen versuchten, die Isolierung des einzelnen aufzuheben: «Die Schule hatte sogar ein Schullandheim, wo die Eltern mitarbeiteten. Hier haben wir Kinder gelernt, in einer Gemeinschaft eigene Wünsche auch mal zurückzustellen, mehr in größerer Verantwortlichkeit, für andere mitzudenken.» Nahtlos wuchs Elisabeth Ostermeier in andere Gemeinschaften hinein: «Ähnlich waren die Ziele der Kinderfreunde, denen ich seit meinem zwölften Lebensjahr angehörte, und später der Arbeiterjugend, in die ich selbstverständlich wie andere Jugendliche, mit denen ich vertraut war, hineinkam.»
Arbeiterkinder waren stolz auf ihre Herkunft. Denn es gab ja einen Ort, wo die Welt mit ihren Ungerechtigkeiten erklärt und das proletarische Rückgrat gestärkt wurde. Auch für Erich Honecker in Wiebelskirchen oder Mary Fried in München gilt, woran sich Elisabeth Ostermeier erinnert: «In unserer Familie waren politische Gespräche so selbstverständlich, daß wir als Kinder nicht auf die Idee gekommen sind, das könnte woanders nicht so sein. Mir ist auch sehr früh – ich denke so mit zwölf Jahren – bewußt geworden, um was es meinen Eltern und den anderen Erwachsenen, die wir kannten, ging: Sie wollten die Lebensbedingungen der arbeitenden Bevölkerung verbessern … Ich hole so weit aus, um klarzumachen, was für mich meine Familie bedeutete – und der gleichgesinnte Kreis, der sie umschloß: Eine Insel von Redlichkeit und Anständigkeit …»
Nach der Familie wurden die Jugendorganisationen der Arbeiterparteien den Arbeiterkindern zur zweiten Heimat. Eugen Nerdinger trat 1923 in Augsburg in die Sozialistische Arbeiterjugend (SAJ) ein: «Ich habe in der SAJ Heimat gefunden – sie war mir mehr als Familie in den folgenden Jahren. Die SAJ war Teil jener sozialistischen Gegenwelt, welche die Arbeiterbewegung gegen die sie umgebende bürgerliche Welt aufrichtete. Mehr als die Partei machte sie schon damals den Versuch, einen sozialistischen Lebensstil zu entwickeln und vorzuleben.» Käthe Jacob, ein Kölner Arbeitermädchen, schloß sich mit Gleichgesinnten zur Florian-Geyer-Gruppe zusammen, weil ihnen die traditionellen sozialistischen Jugendgruppen zu wenig aufmüpfig waren: «Wir hatten unsere Probleme, auch manches Persönliche. Aber was ein junger Mensch braucht und sucht, das gab mir unsere Gemeinschaft: Kameradschaft, Kennenlernen von Schönem, Freude am Schönen, politische Diskussionen.» Es war ein optimistisches Weltbild, das die Arbeiterkinder in dieser prägenden Phase ihres Lebens entwickelten, das ihnen Schwung und Hoffnung gab und den Glauben, die Welt auf friedlichem Wege schöner und lebenswerter für alle zu machen. Käthe Jacob vergaß nicht, was sie von einer kommunistischen Lehrerin in einem Vortrag hörte: «‹Wir wollen nicht nur Wein trinken, wir wollen ihn auch aus schönen Gläsern trinken.› Sie hatte damit ein Wort ausgesprochen, das auf mich hätte zugeschnitten sein können. Die Erkenntnis, daß die Probleme des Kättchen us der Kasparstroß, die Probleme der meisten Arbeiterkinder, daß sie erklärbar und überwindbar sind – bestimmt zu einem großen Teil, ließ mich Kommunistin werden.»
Gertrud Mayer, die aus einer Hamburger Arbeiterfamilie kam, ging ebenfalls in die Kommunistische Partei. Es war ein Entschluß, der das Leben bestimmte und auch so verstanden wurde, Verheißung und Verpflichtung zugleich: «Und ich erinnere mich noch gut, was ich damals machte, weil ich wußte, an dem Tag gab es das Parteibuch. Ich habe mich schön gemacht, habe mein bestes Kleid angezogen, mir die Haare hübsch gemacht und alles so richtig zurecht gemacht. Ich weiß, daß ich ungeheuer stolz war, als ich das Buch bekam, und ein ähnliches Gefühl hatte, nur war das sehr viel intensiver, wie damals, als ich in die Jugendbewegung eintrat: so, nun bin ich zu Hause, also das Gefühl der persönlichen Verbundenheit mit der Partei. Ich habe mich einfach ein Stück größer gefühlt.»
An ihrer Treue zum sozialistischen Erbe gab es keine Zweifel, aber nicht wenigen Arbeiterkindern war die SPD zu träge, zu sehr eine Partei der Alten geworden. Die meisten Funktionäre und Politiker schreckten vor grundlegenden Reformen zurück, weil sie zu Kaisers Zeiten so am besten gefahren waren. Auch der Statistik nach wurde die Partei in der Republik zusehends älter. Waren 1907 rund 75 Prozent aller Mitglieder in der SPD unter 40 Jahren, so sank ihr Anteil am Ende der zwanziger Jahre auf gerade 44 Prozent. Das Durchschnittsalter der SPD-Fraktion im Weimarer Reichstag betrug 50 bis 55 Jahre, 1890 waren es knapp 40 Jahre gewesen. Einer wie Julius Leber, Jahrgang 1891, Redakteur am sozialdemokratischen «Lübecker Volksboten», galt den Genossen als jugendlicher Heißsporn. Leber, studierter Volkswirt, aus einfachsten Verhältnissen aus dem Elsaß stammend, nannte die bürgerliche Gesellschaft «ebenso denkfaul wie gefräßig» und forderte 1923 im Lübecker Wahlkampf von seiner Partei einen «Kampf … bis dem reaktionären Senat das Genick gebrochen» sei. Doch viele Wähler, die bis dahin in Lübeck SPD gewählt hatten, schreckten solche Töne ab. Grund genug für die Partei, wieder leiser zu treten. Der Jugend allerdings gefiel solche Kompromißbereitschaft nicht, sie wanderte weiter nach links.