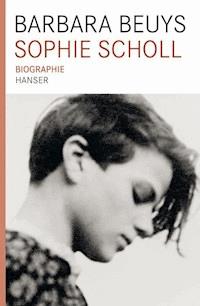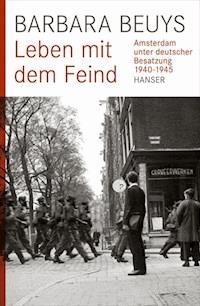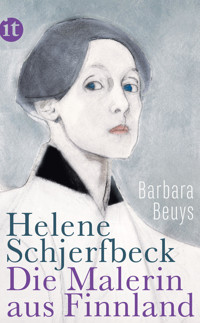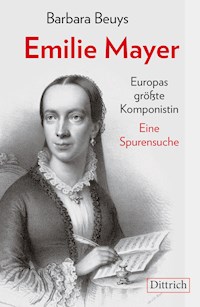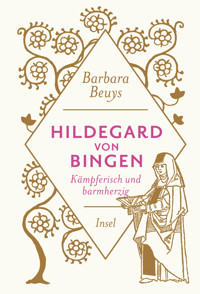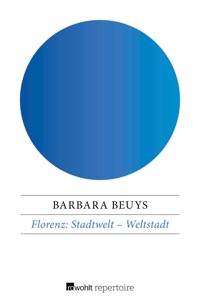10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Keiner würde sich heute an den Theologieprofessor Martin Luther erinnern, wenn er nicht wirklich etwas zu sagen gehabt hätte. Dennoch erfahren wir in Schule und Kirche viel mehr von den äußeren Umständen seines Lebens als von seiner Theologie, seinem Wort. Doch für eben dieses Wort wurden einst Menschen vertrieben und getötet; aus seiner Theologie entwickelten sich die evangelischen Kirchen, die Einfluß nahmen auf die Politik, auf das private und öffentliche Leben der Menschen bis heute. Die Historikerin Barbara Beuys zeigt uns einen anderen, unbekannteren Luther. Fasziniert und mit kritischer Sympathie berichtet sie von dem Weg dieses theologischen Feuerkopfes und der Wirkung eines Mannes über fünf Jahrhunderte, dessen radikaler Glaube auch heute noch eine Herausforderung ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 946
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Barbara Beuys
Und wenn die Welt voll Teufel wär
Luthers Glaube und seine Erben: Fünfhundert Jahre Protestantismus
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Keiner würde sich heute an den Theologieprofessor Martin Luther erinnern, wenn er nicht wirklich etwas zu sagen gehabt hätte. Dennoch erfahren wir in Schule und Kirche viel mehr von den äußeren Umständen seines Lebens als von seiner Theologie, seinem Wort. Doch für eben dieses Wort wurden einst Menschen vertrieben und getötet; aus seiner Theologie entwickelten sich die evangelischen Kirchen, die Einfluß nahmen auf die Politik, auf das private und öffentliche Leben der Menschen bis heute.
Über Barbara Beuys
Barbara Beuys, geboren 1943, Studium der Geschichte, Philosophie und Soziologie, 1969 Promotion mit einer Arbeit über die US-Präsidenten.
Weitere Veröffentlichungen bei Rowohlt:
«Der Große Kurfürst. Der Mann, der Preußen schuf»
«Familienleben in Deutschland. Neue Bilder aus der deutschen Vergangenheit»
«Am Anfang war nur Verzweiflung. Wie Eltern behinderter Kinder neu leben lernen»
Inhaltsübersicht
Für Anna
Ich fürchte mich nicht, ich bin unerschrocken und unverzagt, mir ist nicht traurig, ich bin guten Muts und sorge mich nicht. Denn es ist da wohl Trübsal und Jammer vorhanden, die mich sauer ansehen und gern wollten, daß ich mich vor ihnen fürchten und sie um Gnade bitten sollte. Aber ich weise sie ab und spreche: Lieber Butzemann, friß mich nicht, du siehst wahrlich scheußlich genug aus für den, der sich vor dir fürchten wollte. Aber ich habe einen andern Anblick, der ist desto lieblicher, der leuchtet mir, wie die liebe Sonne, bis ins ewige Leben hinein, daß ich dich kleines, zeitliches, finsteres Wölklein und zorniges Windlein nicht achte.
Martin Luther 1530 in seiner Schrift
«Das schöne Confitemini»
über den 118. Psalm
Wer Luther intensiv studiert und dabei nie die Versuchung verspürt hat: Hier weht die reine Luft des Evangeliums, ich muß zur lutherischen Kirche übertreten – der hat Luther nicht wirklich verstanden.
Otto Hermann Pesch,
katholischer Professor am Fachbereich
Evangelische Theologie
der Universität Hamburg, im Sommer 1981
Einleitung: Der unbekannte Luther
Für Goethe war die Sache ganz einfach: «Unter uns gesagt, ist an der ganzen Sache nichts interessant als Luthers Charakter, und es ist auch das Einzige, was der Menge eigentlich imponiert. Alles übrige ist ein verworrener Quark, wie er uns noch täglich zur Last fällt.» Geschrieben wurde das 1817, dreihundert Jahre nachdem der Mönch Martin Luther in Wittenberg 95 Thesen gegen den Mißbrauch des Ablaßwesens verfaßte und damit eine akademische Diskussion in Gang bringen wollte. 1981, knapp fünfhundert Jahre nach Luthers Geburtstag, zählte der Lutherische Weltbund 69728787 Menschen rund um den Globus, die sich zum Glauben Martin Luthers, diesem «verworrenen Quark», bekennen. Die meisten Lutheraner – 52256572 – leben in Europa und davon die Mehrheit – 22506172 – in der Bundesrepublik Deutschland. Imponierende Zahlen, aber überzeugen sie auch? Schließen sich nicht heute sehr viele Zeitgenossen Goethes abschätzigem Urteil an? Am Ende des 20. Jahrhunderts steht für sie fest: Luthers Glaube geht uns nichts mehr an.
Aber kennen wir diesen Glauben wirklich? Um das zu prüfen, gibt es nur einen Weg: Wir müssen diesen Menschen ernst nehmen. Martin Luther war Mönch mit Leib und Seele. Fünfzehn Jahre seines Lebens, im besten Mannesalter, hat er Gott auf diese Weise mit Überzeugung gedient. Er vergrub sich nicht in seiner Zelle, sondern machte schnell Karriere in seinem Orden. Außerdem war er Professor der Theologie. Sein Leben lang hat ihn das mit Stolz erfüllt. Gegenüber Kaiser und Papst und Kritikern aus den eigenen Reihen hat er sich auf seine theologische Qualifikation berufen. Als Theologe gehörte er zur Elite der mittelalterlichen Welt. Seine Theologie war es, die die römische Kirche ins Wanken brachte. Sie ist das Fundament der evangelischen Kirchen, die sich nach seinem Tod bildeten.
Es war Luthers Theologie, die die Menschen aufhorchen ließ und sie begeisterte, so viele Mißverständnisse es auch gab. Nie zuvor hatte ein Professor seinen theologischen Elfenbeinturm verlassen und das Volk teilnehmen lassen an seiner Theologie, die aus seinem Glauben gewachsen war. Das Geheimnis von Luthers Erfolg liegt zu einem ganz großen Teil in der Offenheit und in der Glaubwürdigkeit dieses Mannes. Bei ihm gab es keine Kluft zwischen Theologie und Glaube, zwischen Leben und Lehre.
Damit stellt sich von selbst die Herausforderung des Jubiläums 1983, an dem Luthers 500. Geburtstag gefeiert wird: Dieses Leben nicht verkürzt darzustellen, sondern mit seinem wichtigsten Teil, Luthers Glauben, zu erzählen. Das ist der erste Teil. Um über eine bloß punktuelle Sicht der Geschichte hinauszukommen, bleiben zwei Aufgaben: in die mittelalterliche Vergangenheit einzutauchen, die diesen Mönch geprägt hat; und die Entwicklungslinien in die Zukunft nach ihm weiterzuziehen in die lutherischen Kirchen, die den Glauben dieses Mannes als ihr wichtigstes Erbe hüteten, durch die Jahrhunderte weitergaben und veränderten.
Die Vergangenheit: Das ist eine katholische Kirche, die ihre Schäflein nicht linientreu disziplinierte, sondern ein bunter Haufen, bei dem die Freude am Diskutieren zu den theologischen Tugenden zählte. Die Vergangenheit: Das ist eine Vielfalt theologischer Schulen und die theologische Tradition seines Ordens, die Luther vor allem beeinflußte. Die Vergangenheit: Dazu gehört die tiefe Frömmigkeit einer Zeit, für die Gott im Mittelpunkt aller Dinge stand. Und Menschen, die in jenem Jahrhundert, als Luther geboren wurde, voller Engagement versuchen, mündige Christen zu werden und nicht alles in ihrer Kirche, der sie selbstverständlich treu waren, schweigend hinzunehmen.
Die Zukunft: Das sind die Kirchen, in denen sogleich nach Luthers Tod ein unerbittlicher Kampf um das rechte Erbe ausbricht. Evangelische Christen verketzern und vertreiben sich gegenseitig. Die Zukunft: Das ist der Pietismus, der in Preußen tiefe Wurzeln schlägt und außerhalb der lutherischen Kirchen theologische Strömungen ermuntert, in der die Frau eine ungewöhnlich aktive Rolle spielt. Die Zukunft: Dazu gehört der Einfluß, den evangelische Kirchenmänner auf die deutsche Aufklärung genommen haben. Als Reaktion auf die aufgeklärte Theologie folgt im 19. Jahrhundert ein Bündnis zwischen protestantischen Kirchen und konservativem Nationalismus, das das offizielle Christentum blind macht für die Probleme und Forderungen der Arbeiterschaft. Dieser radikale Nationalismus begünstigt während der Weimarer Republik eine evangelisch-völkische Theologie. Die Mehrheit der evangelischen Christen hat den Worten Hitlers treuherzig Glauben geschenkt, und so wird die lutherische Kirche – von einzelnen und Minderheiten abgesehen – mitschuldig an einer Entwicklung, in der das Unrecht herrscht, die Opfer keine Beschützer finden und niemand die Würde des Menschen in der Öffentlichkeit verteidigt.
Wenn Martin Luther mehr ist als ein ferner Punkt im Strom der Geschichte, auf den sich aus Anlaß einer runden Gedenkzahl der Scheinwerfer richtet, dann muß zugleich mit dieser Person ihre Vergangenheit und ihre Zukunft – die unsere Vergangenheit ist – beleuchtet werden. Natürlich darf auch Luthers Gegenwart nicht fehlen, in der sich die Reformation keineswegs so schnell und revolutionierend ausbreitet, wie uns das die Geschichtsbücher erzählen. Ob Müntzer oder Zwingli, ob Calvin oder der stille Graf Schwenckfeld: sie alle kommen in diesem Buch zu Wort. Doch die Klammer, die alles zusammenhält, ist Luthers Glaube, seine Theologie. Die äußeren Stationen seines Lebens, seine Krankheiten und seine Stimmungen, werden in diesem Buch nicht unterschlagen. Wo politische Entwicklungen den Lauf der Ereignisse bestimmen, wird der Leser an ihnen teilnehmen. Das alles ist aber nicht das Entscheidende in Luthers Leben. Und es kann weder Maßstab noch Bezugspunkt für die Geschichte der evangelischen Christen sein. Der Sturm deutscher Landsknechte auf Rom oder Luthers Steinleiden helfen uns nicht weiter, wenn wir wissen wollen, ob sich jene Theologie, die den Nationalsozialismus als Erfüllung des Christentums pries, auf Luther berufen kann. Darum ist der Glaube Martin Luthers der rote Faden in diesem Buch, die Fackel, die Licht bringen soll in eine wichtige Dimension deutscher Geschichte, die die Historiker bisher allzusehr im Dunkeln gelassen haben.
Gott war bisher eine Sache der Theologen. Ein Kreis von Eingeweihten verständigt sich in einer Sprache, die für die allermeisten Menschen schon lange fremd und nichtssagend geworden ist. Wem sagen die Begriffe Rechtfertigung und Gnade, Auferstehung oder Heiliger Geist noch etwas? Es sind leere Worthülsen geworden. Dabei hat gerade der Mönch aus Wittenberg einen formelhaften, unpersönlichen Glauben bekämpft. Der Protestantismus hat sich von diesen Ursprüngen fortentwickelt. Die Einheit von lebendigem Glauben und Theologie, die Luther so entschieden und überzeugend lebte, ist in seinen Kirchen mit den Jahrhunderten immer mehr verlorengegangen. Zugleich ist die Unkenntnis über die Anfänge und über Luthers Glauben immer größer geworden. Professor Gerhard Müller, früher Kirchenhistoriker und jetzt Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche von Braunschweig, ist nicht der einzige, der die «Luther-Vergessenheit» seiner Kirche beklagt und feststellt: «Man liest ihn nicht einmal mehr.» Nicht nur das kirchliche Fußvolk, auch viele Pfarrer sind damit gemeint. Sie haben sogar eine gute Entschuldigung.
Wer glaubt, daß in fünfhundert Jahren genug Zeit war, um sich mit dem Reformator gründlich wissenschaftlich auseinanderzusetzen, den wird ein Blick in die evangelische Lutherforschung staunen lassen. 1883 erschien der erste Band der sogenannten Weimarer Lutherausgabe, in der erstmals Luthers Werke nach modernen historisch-kritischen Gesichtspunkten und umfassend herausgegeben wurden. Dieser Band enthält auf den ersten 229 Seiten alles, was Luther vom Beginn seiner Vorlesungstätigkeit 1509 bis zu den Ablaßthesen 1517 schriftlich hinterlassen hatte – nach dem Stand der Forschung 1883. Keine einzige seiner frühen Vorlesungen war darunter. Der gleiche überarbeitete Weimar-Band von heute – die Edition ist inzwischen auf gut hundert Bände angewachsen – bietet dem Leser 2800 Seiten. Alle Aufzeichungen Luthers über seine ersten Vorlesungen, in denen der Grund seiner Theologie gelegt wurde, sind nämlich erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt und erst nach der Jahrhundertwende herausgegeben worden. Alles, was bis dahin über den Mönch aus Wittenberg geschrieben wurde und bis heute entscheidend das Lutherbild prägt – unter anderem alle wissenschaftlich fundierten Biographien –, ist ohne diese wesentlichen Kenntnisse zustande gekommen. Immanuel Kant, der vielbeschworene Philosoph des Protestantismus, hat in seinem Leben von Luther nicht viel mehr als dessen Kleinen Katechismus gelesen.
Hat die evangelische Lutherforschung in den vergangenen hundert Jahren diese Lücke geschlossen? Wissen wir heute wenigstens alles über den «jungen» Luther? Der Leipziger Theologe und Kirchenhistoriker Helmar Junghans ist pessimistisch. In der ersten Nummer der Zeitschrift «Luther» der Luther-Gesellschaft, Jahrgang 1982, schreibt er: «Trotz riesiger Anstrengungen ist das Ergebnis niederschmetternd. Es gibt zwar eine große Anzahl verdienstvoller Einzeluntersuchungen, die Entzifferung und Kommentierung dieser frühen Luthertexte hat große Fortschritte gemacht, aber es fehlt eine allgemein anerkannte Gesamtdarstellung der Entwicklung Luthers zum Reformator.» Erst langsam machen sich evangelische Kirchengeschichtler mit der Theologie des späten Mittelalters vertraut und mit der Geschichte des Humanismus, zu der Luther auch gehört, wenngleich ihn auf Grund seiner Theologie ein tiefer Graben von diesen mittelalterlichen Aufklärern trennt. Es gibt aber nicht nur wesentliche Forschungslücken. Auch das Bild, das die Fachleute zeichnen, ist höchst uneinheitlich. Fast alle wesentlichen Entwicklungen und Aspekte der lutherischen Theologie sind heute unter evangelischen Experten umstritten.
Positiver sieht es auf den ersten Blick bei der Konkurrenz aus. Nachdem die Katholiken vierhundert Jahre lang nur Haß und Polemik für den Mann übrig hatten, der in ihren Augen schuld war an der Kirchenspaltung, kam nach dem Ersten Weltkrieg eine dramatische Wende. Der Kirchenhistoriker Sebastian Merkle weigerte sich, weiterhin zu glauben, «daß nur der der beste Katholik sei, der das Höchste in Verunglimpfung Luthers leistet». So steht es 1929 in seinem Aufsatz über «Gutes an Luther und Übles an seinen Tadlern». Merkle war nicht der letzte Katholik, der wegen solcher Äußerungen bei der kirchlichen Hierarchie in Mißkredit geriet. Dasselbe passierte dem Katholiken Joseph Lortz, als er 1939/40 mit seinem zweibändigen Werk über die Reformation in Deutschland endgültig einer gerechten katholischen Sicht auf Luther und seine Zeit zum Durchbruch verhalf.
Inzwischen gibt es schon die vierte Generation katholischer Lutherforscher, die mit Faszination und ohne konfessionelle Scheuklappen den Mönch aus Wittenberg studiert und betroffen feststellt, wie katholisch er war. Ihre Anstrengungen und ihr Forscherfleiß erhielten 1966 Anerkennung von der Gegenseite, als zum erstenmal katholische Lutherforscher zu einem internationalen evangelischen Lutherkongreß nach Finnland eingeladen wurden. Doch ihr führender Vertreter, Otto Hermann Pesch, katholischer Professor für Systematische Theologie am Fachbereich Evangelische Theologie der Universität Hamburg, warnt nach zwei Seiten vor zuviel Optimismus. Professor Pesch: «Nur eine ganz dünne Oberschicht an ökumenischer Begegnung interessierter katholischer Christen weiß überhaupt von den geschilderten Entwicklungen.» Und: «Der Gesamteindruck ist, daß sich die Amtskirche in bedrückender Weise gegenüber der Feststellung eines Konsensus mit lutherischer Theologie selbst da reserviert zeigt, wo ihn in der Theologie die Spatzen von den Dächern pfeifen.»
Wie dünn die Decke ist, unter der der konfessionelle Zwist der Vergangenheit begraben liegt, zeigte sich im Herbst 1980. Mit Druckerlaubnis der katholischen Bischöfe erschien «Zum Besuch des Papstes» im Land der Reformation eine «Kleine deutsche Kirchengeschichte». Der katholische Freiburger Kirchenhistoriker Remigius Bäumler schildert darin Luther als den Mann, der geradewegs auf die Kirchenspaltung zusteuerte. Distanzlos zitiert er Luthers Gegner: Seine Hochzeit sei durch Unzucht und Gelübdebruch befleckt. Kein kritisches Wort über die römische Kirche. Es soll nicht zu gering veranschlagt werden, daß Katholiken aus den verschiedensten Lagern sich schnell und entschieden von solcher verzerrten Lutherinterpretation distanzierten. Übersehen wurde bei aller berechtigten Aufregung der größere Skandal: Daß die katholische Kirche eine deutsche Kirchengeschichte herausgab, in der die evangelischen Kirchen – nachdem das Zeitalter der Reformation geschildert ist – nicht existieren. Unter den Überschriften «Die deutsche Kirche 1803–1933» und «Die Kirche in der Weimarer Republik und im NS-Staat» ist ausschließlich von der katholischen Kirche die Rede.
Und was soll man davon halten, daß im März 1982 der Stadtkaplan der Pfarrei St. Moritz in Augsburg, ehrenamtlich im Pressedienst des Bischofs von Augsburg tätig, 95 Thesen herausgibt, in denen unter anderem steht: «Der Rom-Haß Luthers kann nur verglichen werden mit dem Juden-Haß Hitlers.» Und: «Luther war auch ein Judenhasser und Hitler ein Rom-Hasser.» Das unausgesprochene Fazit: Beide sind gleich schlimm. Der Bischof hat inzwischen seine Mißbilligung ausgesprochen, im Presseamt arbeitet der Kaplan nicht mehr, und er distanzierte sich von den Thesen, die der katholischen Glaubenslehre widersprechen. Die Hitler-Parallele gehört nicht dazu. Ansonsten ist er als Stadtkaplan unbehelligt, und der evangelische Kreisdekan nannte das Ganze «eine innerkatholische Angelegenheit».
Der Gang durch die Lutherforschung zeigt: Widersprüche und Unkenntnisse, zugleich positive Ansätze, aber ohne Rückhalt bei der Mehrheit der Kirchensteuer zahlenden Christen. Übrig bleibt: Kapitulation oder die Bereitschaft, das Risiko auf sich zu nehmen und die Theologie nicht länger allein den Theologen zu überlassen. Den Streit der Experten und die Lücken bei den Laien als Chance zu nutzen. Niemand macht zu diesem Experiment mehr Mut als Luther, der die Laien in Sachen Theologie nicht als unmündige Kinder behandelte und Mißverständnisse in Kauf nahm. Und es gibt indirekte Unterstützung von unerwarteter Seite.
Im Januar 1982 räumte die Ost-Berliner «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft» ein, daß die theologische Sicht der Reformation in der DDR während der vergangenen drei Jahrzehnte «generell zu abwertend» gewesen sei. Schon im September 1981 hatten Wissenschaftler in der SED-Zeitschrift «Einheit» ungewöhnliche Thesen aufgestellt. Darin wird als Forschungsziel für das Lutherjahr 1983 angestrebt, sowohl «das Eigenleben und die Selbständigkeit der Theologie als auch deren Einbindung in die Traditionen» herauszuarbeiten. Ob protestantische, katholische oder marxistische Lutherforscher – für alle gilt das Urteil von Professor Bernhard Lohse, evangelischer Fachmann für die Reformationszeit: «Niemand sollte vorschnell meinen, das allein richtige Lutherbild gewonnen zu haben.» Das gilt natürlich auch für das vorliegende Buch.
Der rheinische Katholizismus, in dem die Autorin aufgewachsen ist, war frei von polemischer Verzerrung, aber gesättigt mit der Gewißheit, der richtigen Kirche zuzugehören, wenn am Sonntag triumphierend gesungen wurde: «Dank sei dem Herrn, der mich aus Gnad’ zur wahren Kirch’ berufen hat, nie will ich von ihr weichen.» Am Karfreitag wurde – den Protestanten zum Trotz – Hausputz gemacht und die Teppiche kräftig im Freien geklopft. Es lag auch ein bißchen Bosheit in dieser Demonstration, aber sie war eher augenzwinkernd. Es war einfach praktisch, diesen höchsten evangelischen Feiertag, der einem Katholiken damals nicht sonderlich viel bedeutete, zu nutzen.
Das waren die vierziger und fünfziger Jahre. Auch wenn die Bischöfe mit aller Macht und Disziplinierung auf einem einheitlichen Profil bestehen, die katholische Kirche ist seit dem II. Vatikanischen Konzil in den sechziger Jahren eine andere geworden. Meine erste intensive Begegnung mit der protestantischen Welt kam um diese Zeit, als ich – Laie und katholisch – mit zwei anderen Laien von der traditionsreichen Württembergischen Bibelanstalt in Stuttgart ausgewählt wurde, das Neue Testament aus dem Englischen in ein verständliches Deutsch zu übersetzen. Das «NT 68» entstand, das inzwischen – in redigierter Fassung – Auflagen in Millionenhöhe erreicht hat. Damals begann meine kritische Sympathie für die Kirche des Martin Luther.
Gekauft wird die Bibel, aber betrifft ihr Inhalt uns noch? Glaube und Aktualität: das scheint nicht mehr zusammenzupassen. Endgültig seit dem 19. Jahrhundert, als Technik und Naturwissenschaft ihren Siegeszug antraten, sind die Fronten klar: Auf der einen Seite Wissenschaft und Fortschritt, eine menschliche Zukunft und der Optimismus, auf alle Fragen eine Antwort geben zu können. Auf der anderen Seite der Glaube, der eigentlich nichts als Aberglaube ist, weltfremd, von vorgestern, menschenfeindlich. Und weil der Glaube immer mit der Kirche identifiziert wurde – sie hatte ja auch das Monopol auf Gott –, verzichtete man auf beides. Atheismus gehört seitdem zum modernen Menschen wie der Glaube zum Mittelalter.
Doch es gab einige, die erkannten schon in den zwanziger Jahren, daß die Kritiker der Religion damit einem Mißverständnis aufgesessen waren. Die «Jungsozialistischen Blätter» schrieben 1925: «Die atheistische Formel, ‹wir brauchen und mögen keinen Gott mehr›, und die Erklärung der Religion zur Privatsache, mit dem geheimen Hintersinn, jede Religion sei doch bloßer Götzenkult, haben sich all ihrem Modernitätsdünkel zum Trotz überlebt … Heute sind diese atheistischen Gedanken nicht mehr das Vorwärtsweisende, heute sind sie ausgesprochener Konservatismus … Das gerade Gegenteil wäre richtig. Die leer ausgegangenen Seelen der Menschen strecken heute wieder hungrige Hände aus im tosenden Lärm der modernen Zivilisation … Wenn Sozialismus mehr sein will als bloßes Wirtschaftsprogramm … muß er in irgendeiner noch zu findenden Form den ganzen Menschen erfassen, vor allem diesen heimlichsten und tiefsten Teil des Menschen: sein religiöses Bewußtsein und seine religiöse Sehnsucht.» Es war die Erkenntnis einer Minderheit. Religion blieb tabu. Das Thema war erledigt. Kein Mensch, der ernst genommen werden wollte, nahm außerhalb von Pfarrhäusern und Kirchen Worte wie Gnade oder Erlösung in den Mund. Gott ist tot, riefen selbst die Theologen.
Die Wende kam Ende der sechziger Jahre. Der Philosoph der Kommunistischen Partei Frankreichs, Roger Garaudy, ergriff die Initiative zu einem Dialog zwischen Kommunisten und Katholiken. Der deutsche Soziologe Max Horkheimer, an dessen Verachtung für die Religion bisher niemand gezweifelt hatte, schrieb 1971 ein Buch über «Die Sehnsucht nach dem ganz anderen». Es war nicht nur der Vietnam-Krieg, der die Studenten-Rebellion auslöste. Rudi Dutschke oder Ulrike Meinhof artikulierten das Unbehagen einer Generation, die vom Wohlstand umgeben war und erkannte, daß der Mensch nicht vom Brot allein lebt; die hungerte nach mehr Gerechtigkeit, Wärme und Solidarität. Die Jesuspeople missionierten unter der Jugend, und die Jugendsekten begannen, erste Anhänger zu gewinnen.
Der marxistische Philosoph Ernst Bloch hat die neuen alten Fragen in seinem «Prinzip Hoffnung» auf den Punkt gebracht: «Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns?» Immer deutlicher kamen die Grenzen der Wissenschaft zum Vorschein. Mehr noch: Was einst als die Erlösung von allem Übel geglaubt worden war, wurde fragwürdig. Das Blatt hat sich endgültig gewendet. Der Mensch fühlt sich erdrückt von Maschinen, der Technik ausgeliefert in einer zerstörten Welt. «No future» heißt die radikalste Reaktion auf eine solche Zukunft. Dagegen steht Ernst Bloch: «Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen.» Nichts anderes ist der Kern von Religion.
Wir müssen uns frei machen von der Vorstellung, daß Religion etwas mit Kirche oder – ausschließlich – mit Christentum zu tun hat. Religion handelt vom Glauben, ohne den es keine Hoffnung gibt. Ein solcher Glaube ist nicht von vorgestern, ist nicht dumpfer Aberglaube, sondern ein weiter Blick über Grenzen hinweg. Ludwig Feuerbach, der Theologie studierte und dann der Philosoph des Atheismus wurde, hat das mitten im 19. Jahrhundert hellsichtig analysiert: «Der Glaube ist die frohe Aussicht, daß der heutige Tag nicht der letzte unter der Sonne ist, daß vielmehr auf Heute Morgen kommt und was daher heut nicht ist, morgen ist … Der Unglaube schränkt den Umfang des Möglichen nur auf den engen Kreis seiner bisherigen Erfahrungen ein; aber der Glaube bindet sich nicht an die Schranken der Vergangenheit; er glaubt an die Möglichkeit des bisher Unmöglichen. ‹Dem Glaube ist nichts unmöglich.› Der Unglaube ist daher kleinmütig, klug, ja überklug … befangen, zaghaft; der Glaube hoch gesinnt … resolut, kühn, frei, sorglos.»
Für Martin Luther, den Menschen des Mittelalters, war der Glaube auf Gott gerichtet. Doch die Kraft, die zeitlos dahintersteckt, hat er für alle formuliert: «Und wenn die Welt voll Teufel wär / und wollt uns gar verschlingen, / so fürchten wir uns nicht so sehr, / es soll uns doch gelingen.» So heißt es in der dritten Strophe des protestantischen Kampfliedes «Ein feste Burg ist unser Gott». Der Glaube schafft etwas scheinbar Widersprüchliches: Er weist auf ein fernes Ziel und motiviert gerade dadurch, intensiv in der Gegenwart zu leben und sie auf diese Zukunft hin zu verändern.
Luthers Theologie, in deren Mittelpunkt die Gnade steht, hat mit dem Menschen zu tun. Sie ist – entgegen dem Klischee – keine Freikarte, sich aus den Händeln dieser Welt herauszuhalten. Wer als evangelischer Christ unter den Nazis schweigend litt, aber den Mund hielt über das Unrecht der anderen, konnte sich auf Martin Luther nicht berufen. Ein Glaube ohne Konsequenzen im Leben war für ihn tot. Schon 1520 schrieb er in einer Abhandlung «Von den guten Werken», den Christen, sie müßten «allem Unrecht widerstreben, wo die Wahrheit oder Gerechtigkeit Gewalt und Not leidet».
Es war gerade Luthers Theologie, die den Theologen Dietrich Bonhoeffer, 1945 im KZ ermordet, dazu brachte, sich den politischen Verschwörern gegen Hitler anzuschließen. Er hielt seiner Kirche den Spiegel vor, weil sie die Theologie von der Gnade nicht ernst nahm: «Überall Luthers Worte und doch aus der Wahrheit in Selbstbetrug verkehrt … Ein Volk war christlich, war lutherisch geworden, aber auf Kosten der Nachfolge, zu einem allzu billigen Preis … Die Lehre der Schüler war also unanfechtbar von der Lehre Luthers her, und doch wurde diese Lehre das Ende und die Vernichtung der Reformation.»
Der Mensch, der über sich selbst und andere nachdenkt; der darüber verzweifelt, was ein Mensch dem andern antut und wozu der Mensch getrieben werden kann, findet im wesentlichen zwei entgegengesetzte Antworten. Erstens: Der Mensch ist gar nicht so schlecht. Schuld sind die Umstände. Ändert man sie, bekommt man einen anderen Menschen. Das glaubten Luthers humanistische Zeitgenossen ebenso wie der Aufklärer Rousseau. Dagegen setzt der Christ Martin Luther das gleiche pessimistische Menschenbild wie das jüdische Alte Testament: Der Mensch ist in Sünden empfangen und geboren. Er ist von Natur aus böse. Oder wie es der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich in der Sprache des 20. Jahrhunderts sagt: Der Mensch ist ein «in seinem Ursprung unfriedliches Wesen». Einen Beweis für die Richtigkeit der einen oder anderen Behauptung gibt es nicht. Die Geschichte des Menschen pendelt zwischen beiden Extremen. Sie wird eine ständige Auseinandersetzung darum bleiben. Gottfried Benn, Arzt, Dichter und Pfarrerssohn, hat sie auf die lapidare Formel gebracht: «Die Krone der Schöpfung, das Schwein – der Mensch …»
Wir spüren heute wenig von der Krone der Schöpfung. Eher fühlen wir, wie kaputt der Mensch ist, wie leer, sich und anderen entfremdet. Religion, auch das hat Karl Marx gesagt, ist der Seufzer der bedrängten Kreatur. Man möchte ergänzen – der Seufzer nach Erlösung. Die Erfahrung, die Martin Luther in den Augenblicken machte, als er keine Hoffnung mehr auf Erlösung hatte, ist dem Menschen unserer Zeit so fern nicht: «Da bleibt nichts anderes übrig als der nackte Schrei nach Hilfe, ein schreckliches Seufzen, das nicht weiß, wo Hilfe zu finden ist. Da ist die Seele mit dem gekreuzigten Christus weit ausgespannt, daß man alle ihre Gebeine zählen kann, kein Winkel in ihr, der nicht angefüllt wäre mit tödlicher Bitternis, mit Entsetzen, Angst und Traurigkeit – und dies alles scheint ewig zu währen.»
Vielleicht ist es heute deshalb vielen peinlich, mit Religion in Verbindung gebracht zu werden, weil immer noch der Eindruck vorherrscht, das sei eine Sache für Kinder, Alte – und Frauen. Sieht man genauer hin, so liegt in diesem verächtlichen Urteil unbewußt ein Lob. Es bescheinigt den Frauen, eine Antenne zu haben für wesentliche Fragen und entgegen allem Fortschrittsglauben festgehalten zu haben an der Erkenntnis, daß nicht alles machbar ist und der Mensch mehr, als was er sich in seinem Kopf ausdenkt. Es ist der Theologie nicht gut bekommen, daß sie über zweitausend Jahre eine Bastion der Männer blieb.
Luther war entgegen vielen Legenden kein «männlicher» Mann. Er akzeptierte seine Frau auch als geistigen Partner und informierte sie in seinen Briefen über theologische Auseinandersetzungen. Er hatte keine Hemmungen zu weinen, wenn ihm danach zumute war. Heinrich Heine, Deutscher und Jude, hat ihn besser als alle anderen gezeichnet: «Derselbe Mann, der wie ein Fischweib schimpfen konnte, er konnte auch weich sein wie eine zarte Jungfrau. Er war manchmal wild wie der Sturm, der die Eiche entwurzelt, und dann war er wieder sanft wie der Zephyr, der mit Veilchen kost.» Doch Luther hatte geradezu Angst davor, Gefühlen im Glauben Raum zu geben. In diesem Bereich mochte er keine Tränen. Das Wort sollten die Menschen in sich aufnehmen. Luthers Glaube war kopflastig. Auch das gehört zu seinem Erbe.
Religion hat mit der Zeit und dem Kulturkreis zu tun, in den jeder Mensch geboren wird. Luther war ein ungewöhnlich religiöser Mensch. Er lebte im christlichen Mittelalter. Sein Glaube war deshalb gebunden an den christlichen Gott und an eine christliche Kirche. Sein radikaler Glaube erwuchs aus radikalen Fragen an diesen Gott, der für ihn immer ein «verborgener Gott» war; kein jovialer Großvater mit weißem Bart. Der Glaube an einen solchen unbegreiflichen Gott ist kein billiger Seelentrost, keine Versicherung auf das Jenseits.
Karl Rahner, der große alte Mann der katholischen Theologie, hat die Weise, auf die ein Mensch im 20. Jahrhundert überhaupt noch an Gott glauben kann, den «wahren Agnostizismus» genannt: «Man wendet sich nicht ab, man hält stand, man nimmt die Unbegreiflichkeit seiner Existenz wirklich an, und zwar eben in einer wirklichen Annahme als sinnvolle und Hoffnung in sich bergende. Wenn man dies aber wirklich tut, dann ist im Grunde schon Gott angenommen …» In einem solchen Glauben könnte sich Luther mit seiner Erfahrung wiederfinden. Und nicht nur er.
Mönche streiten gern
Am Anfang war das Wort. Als Jesus, der Sohn eines Zimmermanns aus Nazareth, im Alter von dreißig Jahren durch Palästina wanderte, kam er am Galiläischen Meer vorbei und sah zwei Fischer, die ihre Netze ins Wasser warfen. Und er sagte zu ihnen: «Folget mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen.» Es waren Petrus und Andreas, zwei Brüder, und auf sein Wort hin folgten sie ihm. Drei Jahre später stand Jesus in Jerusalem vor Pilatus, dem römischen Statthalter, angeklagt von hohen jüdischen Priestern. Was hatte er getan? Er sah es so: «Ich habe frei öffentlich geredet vor aller Welt. Ich habe allezeit gelehrt in der Synagoge und in dem Tempel, wo alle Juden zusammengekommen, und habe nichts im Verborgenen geredet.» Das Wort ist eine Macht. Die Mächtigen haben es stets gewußt.
Als der Mann am Kreuz gestorben war, zogen jene, die seine Worte gehört hatten, in die Welt, um sie allen mitzuteilen. Andere schrieben im letzten Drittel des ersten Jahrhunderts auf, was Jesus gesagt hatte. So wie man es ihnen erzählte. Denn mit eigenen Ohren hatte keiner der Männer gehört, was seitdem als Gottes Wort gilt: das Evangelium, die «frohe Botschaft». Doch das Wort kann immer doppeldeutig und mißverständlich sein. Auch das geschriebene schützt nicht vor hitzigen Diskussionen und Streit. Paulus, der missionierende Apostel, drohte den Galatern, einer Gemeinde in der heutigen Türkei, in einem Brief: «Wenn jemand euch das Evangelium anders predigt, als ihr es von mir empfangen habt, der sei verflucht.»
Die Geschichte der Christen kennt keinen idyllischen Urzustand, keine reine Lehre, die erst in späteren Zeiten durch Ketzereien und Anpassungen an die Welt getrübt und verzerrt worden ist. Der Glaube an Jesus als den Sohn Gottes war umstritten von Anfang an, weil das Wort, ohne das dieser Glaube nicht lebensfähig ist, keine eindeutige Botschaft weiterträgt. Ist das so wichtig? Wenn ein Mensch überzeugt ist, daß er eine Seele hat, auf die ein ewiges Leben bei Gott oder bei dem Teufel wartet, dann kann ein Wort entscheidend sein. Es ist ja auch nicht irgendeines, sondern kommt von dem, der als Gottes Sohn gilt. Die Worte des Evangeliums sind für den gläubigen Christen Gottes Wort. Aber wer entscheidet, wenn es zum Streit darüber kommt? Wer hat auf Erden in Sachen Gott das letzte Wort?
Die römisch-katholische Kirche entschied sich erst 1870 für eine Autorität, die in letzter Instanz bei strittigen Glaubensfragen ein Machtwort spricht. So viele Ketzer die Päpste auch verurteilen und verbrennen ließen, das Dogma ihrer Unfehlbarkeit ist nicht viel mehr als hundert Jahre alt. In den frühen Jahrhunderten, als die ersten christlichen Dogmen und Lehrsätze sich langsam in den Auseinandersetzungen bildeten, war man nicht zimperlich, sich die Meinung zu sagen. Augustinus, berühmter Kirchenvater und Bischof von Hippo, im heutigen Algerien, ließ sich im Kampf gegen solche Christen, die er für Abweichler von der reinen Lehre hielt, zu immer radikaleren Aussagen provozieren. Als er schließlich behauptete, jeder Mensch sei schon im Augenblick der Geburt von Gott für den Himmel oder die Hölle bestimmt, erhielt er Widerspruch in der Sache und im Grundsätzlichen.
Die Mönche auf der winzigen Insel Lerin vor Marseille wollten keinen Gott, der dem Menschen keine Entscheidungsfreiheit ließ. Einer von ihnen, Vincentius, ließ sich von Augustinus zu der Überlegung anregen, mit welchen Maßstäben man den wahren katholischen Glauben messen soll, da ganz offensichtlich das Evangelium unterschiedlich ausgelegt werden kann. Unter dem Pseudonym Peregrinus schrieb er 434 nach Christus, der untrügliche Beweis sei die Tradition, nämlich das, «was an allen Orten, zu allen Zeiten, von allen geglaubt wird». Dieser Tradition müssen sich alle beugen, seien sie nun Bischof von Hippo oder von Rom. (Übrigens haben die Bischöfe von Rom – die sich später Papst nannten – die Konzilien der ersten Jahrhunderte, auf denen grundsätzliche und bis heute verbindliche Lehren des Christentums aufgestellt wurden, weder einberufen, noch waren sie überhaupt anwesend.)
Die Lust am Diskutieren und Disputieren verging den Christen so schnell nicht. Im Gegenteil: Sie wurde ein fester Bestandteil des kirchlichen Lebens. Nur wer gut streiten konnte, war im christlichen Mittelalter ein guter Theologe. Wer es zur Meisterschaft darin brachte, zog die besten Geister Europas an seinen Lehrstuhl, bildete eine eigene Denkschule – lateinisch: schola – aus, und seine Schüler trugen seine Gedanken weiter. Nichts anderes bedeutet der Begriff «Scholastik», der als Etikett für die Blütezeit der mittelalterlichen Theologie benutzt wird. Es entstanden immer neue theologische Schulen, immer subtilere theologische Systeme, mit denen man bis in den Himmel reichen wollte.
An welcher Universität der Meister auch lehrte, gleichgültig welche Schule er vertrat, er gehörte stets jener Elite an, die in den mittelalterlichen Jahrhunderten Kultur, Bildung und sogar den technischen Fortschritt verkörperte. Es war die hohe Zeit der Mönche. (Auch gar nicht so wenige Nonnen – gelehrt, geistreich und tiefgläubig – haben Einfluß genommen auf ihre Umgebung und mit den Großen in Welt und Kirche korrespondiert. Die Lehrstühle allerdings blieben ihnen versagt.)
In den Bibliotheken der Klöster überlebte die Literatur der heidnischen Antike und wurde auf kostbare Pergamente gemalt. Die Mönche rodeten das Land und machten es fruchtbar. Die Zisterzienser waren nicht nur führend in der europäischen Eisenproduktion und in der Schafzucht. Europas Weinberge gehen auf ihre kundigen Hände zurück. Die Orden der Bettelmönche – Dominikaner und Franziskaner – besetzten die wichtigsten theologischen Lehrstühle der christlichen Welt in Oxford und Paris.
Dominikaner und Franziskaner – dem gleichen Armutsideal, dem gleichen Wort Gottes verpflichtet – waren sich keineswegs freundlich gesonnen. Wie zwei feindliche Armeen kämpften sie um die ewigen Wahrheiten und keineswegs nur mit intellektuellen Waffen. Mit Franziskus von Assisi, der im 13. Jahrhundert Menschen für sein ohnmächtiges Christentum begeistert hatte, glaubten seine Mitbrüder und seine Nachfolger im Orden an die Lehre von der Unbefleckten Empfängnis Marias. Der berühmte Kirchenlehrer Thomas von Aquin, ein Dominikaner, lehnte sie ab und mit ihm sein Orden. Der Streit ging über Jahrhunderte. Es gab Päpste, die die Franziskaner, und solche, die die Dominikaner unterstützten. Keiner wollte eine endgültige Entscheidung treffen, und so war trotz allem Lärm auf den unterschiedlichen Kanzeln kein Katholik verpflichtet, an die Unbefleckte Empfängnis zu glauben.
Im Jahre 1509 schließlich inszenierten vier Dominikanermönche in Bern ein «Marienwunder», um die franziskanischen Marienverehrer zu blamieren. Der Plan ging schief. Die Dominikaner büßten auf dem Scheiterhaufen. Die Sache selbst blieb weiterhin offen und umstritten. Erst 1854 erklärte Pius IX. in seiner Bulle «Ineffabilis Deus» – «Der unaussprechliche Gott» –, daß Maria «von jedwedem Makel der Sünde allzeit frei, und ganz schön und vollendet, eine Fülle der Unschuld und Heiligkeit zur Schau trüge, wie sie größer unter Gott gar nicht vorstellbar ist, und wie sie niemand außer Gott auch nur in Gedanken erreichen kann … Alle wissen aber auch, mit welchem Eifer diese Lehre von der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau-Gottesgebärerin von den angesehensten Ordensfamilien, den berühmten theologischen Hochschulen und den ausgezeichnetsten Vertretern der Gottesgelehrtheit weitergegeben, erklärt und verteidigt worden ist.» Mit dieser Bulle ist seit 1854 jeder Katholik im Gewissen verpflichtet, an eine Lehre zu glauben, die von ausgezeichneten Vertretern der Theologie über Jahrhunderte bekämpft worden ist.
Die Päpste schlugen sich im Streit der Professoren-Mönche mal auf die eine, mal auf die andere Seite. Theologische Impulse gingen von Rom nicht aus. Man ließ nur zu gern die Mönche für sich arbeiten. Die taten es willig und begeistert, fühlten sich aber gerade deshalb zu beißender Kritik an der römischen Kirche und den Stellvertretern Christi berechtigt. Mönche und Nonnen nannten die Mißstände laut beim Namen. Katharina, die Tochter eines Wollfärbers aus Siena, machte sich 1376 auf den gefährlichen Weg nach Avignon, wo die Päpste seit Jahrzehnten in luxuriöser Gefangenschaft des französischen Königs lebten. Sie drang tatsächlich bis zum Papst vor und sagte seiner Heiligkeit vor Kardinälen und Prälaten ins Gesicht, «daß die Sünden des päpstlichen Hofes bis nach Siena stinken». Es war ein Jahrhundert, in dem der Widerspruch zwischen päpstlichen Ansprüchen und christlicher Lebensweise selbst mit Dutzenden von Bannflüchen nicht mehr zuzudecken war. Feierliche Verdammungssprüche des Herrschers auf dem Stuhle Petri hinderten im 14. Jahrhundert Kaiser und König nicht mehr, der imperialen päpstlichen Politik entschiedenen Widerstand zu leisten. Kein deutscher Kaiser trat mehr den Gang nach Canossa an. Im Gegenteil, an seinem Hofe fanden jene Mönche Schutz, die als kritische Dissidenten aus dem Machtbereich des Papstes geflohen waren. Theologen im Exil, die in Deutschland darüber nachdachten, wie die verweltlichte Kirche wieder zu ihrer wahren Aufgabe zurückfinden könnte, und mit ihren Gedanken Sprengstoff für Jahrhunderte lieferten.
Im Dunkel der Nacht vom 26. auf den 27. Mai 1328 gelang es einem halben Dutzend Franziskanermönchen, die Stadt Avignon unbemerkt zu verlassen. Sie schlugen sich bis Aigues-Mortes im Rhonetal durch und nahmen von dort mit einer Galeere Kurs auf die Toskana. Kaum hatte man an der Kurie ihre Flucht entdeckt, setzte der Kardinalbischof von Porto den Mönchen mit einem Trupp Soldaten nach. Doch er kam zu spät. Der hohe Herr hätte sich nicht solche Mühe gemacht, wären da nur ein paar einfache Mönche entlaufen. Tatsächlich handelte es sich um die Elite des Ordens. Geflohen waren unter anderem Michael von Cesena, der Generalminister, Bruder Bonagratia von Bergamo, Jurist und Theologe, und Wilhelm von Ockham, ein englischer Franziskaner. Sie alle waren am päpstlichen Hof als unbequeme Kritiker abgestempelt.
Wir brauchen dem Streit nicht in allen Verästelungen nachzugehen. Der Generalminister der Franziskaner war überzeugt, daß ein Bettelorden keinerlei Eigentum besitzen dürfe. Die Dominikaner nutzten die Gelegenheit, sich von der Konkurrenz abzusetzen, und erklärten, Christus und die Apostel hätten Eigentum besessen und also dürften es die Mönche auch. Der Papst, Johannes XXII., gab den Dominikanern recht und nannte alle, die anderer Meinung seien, Häretiker. Er beschimpfte Michael von Cesena vor Kardinälen und Prälaten und verbot ihm bei Strafe der Exkommunikation und Amtsenthebung, Avignon zu verlassen.
Michael und seine Gesinnungsgenossen waren nicht ohne Grund nach Italien geflüchtet. Als sie am 9. Juli 1328 in Pisa ankamen, wurden sie mit allen Ehren empfangen. Denn Pisa war fest in der Hand des deutschen Kaisers, und der stand seit Jahren in erbitterter Fehde mit dem Papst in Avignon. Im Jahre 1313 hatten sich die Kurfürsten im Deutschen Reich bei der Wahl eines neuen Reichsoberhauptes nicht einigen können. Es kam zu einer Doppelwahl, die schließlich Ludwig von Bayern, aus dem Hause Wittelsbach, nach siegreicher Schlacht für sich entschied. Doch Ludwig, der nicht verhehlte, daß er auch in Italien tatkräftig seine Herrschaft ausüben werde, wartete vergeblich auf die päpstliche Bestätigung seiner Wahl. Statt dessen kam aus Avignon der Befehl, die Regierung niederzulegen, vor dem päpstlichen Gericht zu erscheinen und abzuwarten, wie Johannes XXII. entscheiden werde. Ludwig forderte daraufhin ein unparteiisches Generalkonzil als Richter. Im März 1324 belegte ihn der Papst mit dem großen Kirchenbann. Der Bayer zögerte nicht, von nun an in den Kritikern des Papstes seine Freunde zu sehen. Sein Hof wurde zum Zentrum der Dissidenten. Es läßt sich nicht trennen, was Überzeugung, was politische Taktik war. Ein zeitgenössischer Chronist nennt Ludwig IV. skrupellos und «verwegen in allem, was seine Mittel nur zu erlauben schienen».
Schon 1326 hatte Marsilius von Padua Paris und seinen Lehrstuhl an der Universität verlassen und war nach München geflohen, wo er als Berater des Kaisers freundliche Aufnahme und Auskommen fand. Der geborene Italiener gehörte zu den ersten, die im christlichen Mittelalter über den Sinn des Staates nachdachten, ihm eine eigene Existenzberechtigung gaben und in der weltlichen Macht keinen Wurmfortsatz der geistlichen sahen. Marsilius hatte Medizin, Philosophie und Theologie an der hochgelehrten Pariser Universität unterrichtet, deren Rektor er ein Jahr lang war. Anonym veröffentlichte er 1324 sein Hauptwerk «Defensor Pacis». Eine Schrift zur «Verteidigung des Friedens», der seit dem erneuten Streit zwischen Papst und Kaiser in weiter Ferne lag. Die Lösung, die Marsilius anbot, war revolutionär. Kein Wunder, daß er Paris schnellstens verließ, als dort seine Autorenschaft bekannt wurde.
Der Professor trennte die geistliche Gewalt radikal und umfassend von der weltlichen Gewalt. Der Papst sollte dem Kaiser in der Politik weder hineinreden noch ihm Vorschriften machen. Die Kirche hatte nur eine Aufgabe: die Sakramente zu spenden und, wie Christus, in beispielhafter Armut zu leben: «Christus selbst ist nicht in die Welt gekommen, um über die Menschen zu herrschen … oder sie zu richten oder zu regieren … und folglich hat er die Bischöfe oder Priester von jeder solchen Regierung oder weltlicher Herrschaft ausgeschlossen.» Aus dem Blickwinkel des Evangeliums schmolz der Führungsanspruch des römischen Bischofs zu einem traditionellen Ehrenplatz innerhalb der Gesamtkirche: «Alle waren Priester in der gleichen Weise, und der römische Bischof oder irgendein anderer besitzt keinen umfassenderen priesterlichen Charakter als jeder sogenannte einfache Priester.» Marsilius wollte das Papsttum nicht abschaffen. Er sprach ihm auch einen gewissen Einfluß zu. Nur das letzte Wort gab er ihm nicht. Solchen Gedanken nachzugehen, hinderte Marsilius in München niemand.
Michael von Cesena und seine Begleiter blieben nicht in Pisa. Sie machten sich auf den Weg nach Norden, überquerten die Alpen. Das Barfüßerkloster in München wurde ihre neue Heimat und damit zu einem Zentrum abendländischer Gelehrsamkeit und kritischer Theologie. In Avignon hatte man sie inzwischen verurteilt. Doch die gebannten Mönche gaben auch im Exil das Nachdenken nicht auf. Am intensivsten tat es der englische Franziskaner Wilhelm von Ockham. Unter dem Einfluß des Marsilius und der aktuellen Politik beschäftigte er sich in München vor allem mit dem Verhältnis von Kirche und Staat. Ockham entdeckte im Evangelium die Freiheit als maßgeblichen Wegweiser und ging in seinen Konsequenzen noch über Marsilius hinaus.
Auch der Engländer wollte das Papsttum nicht stürzen. Der Bischof von Rom ist für ihn der Stellvertreter Christi. Aber einer, der seine Schafe behüten und nicht – wie es tatsächlich geschah – melken, scheren und schlachten soll. Die Päpste haben nach Ockham weltliche Macht an sich gerissen, statt sich auf ihren geistlichen Auftrag zu beschränken. Diesen Auftrag aber müssen sie ohne Zwang ausüben. Kein Christ soll etwas gegen sein Gewissen glauben, denn «das Gesetz des Evangeliums ist ein Gesetz der Freiheit». Ockham stützte sich auf Paulus: «Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen.» Wenn der einzelne seine Entscheidung letztlich in eigener Verantwortung treffen muß, verliert auch ein Konzil seine umfassende Bedeutung. Ockham ist mißtrauisch gegenüber Mehrheitsentscheidungen in Glaubensdingen. Er will sich nur auf die Vernunft und die klare Lehre der Heiligen Schrift verlassen. Wird ein Papst zum Häretiker, wie Johannes XXII. nach Ockhams Meinung, muß ein Christ, der das erkannt hat, ihn öffentlich entlarven und ihm den Gehorsam verweigern.
Die Lehre des Marsilius über die Trennung von geistlicher und weltlicher Gewalt baut Ockham weiter aus. Er spricht von den zwei Reichen – dem weltlichen und dem geistlichen –, die nichts miteinander zu tun haben. Die weltlichen Reiche sind direkt von Gott eingesetzt und unterstehen nicht der päpstlichen Gewalt. Ein Priester – und wenn er der Papst ist – darf nur dienen, nicht herrschen. Ockhams Beweismittel ist die Bergpredigt. Wir dürfen uns vorstellen, daß Wilhelm und Marsilius, der Engländer und der Italiener, manche Stunde im Kloster zusammensaßen oder vor den Toren Münchens spazierengingen. Das Latein war ihre gemeinsame Sprache.
Von allen klugen Köpfen, die damals in München zusammenkamen, ist Wilhelm von Ockham als der einflußreichste in die Geschichte eingegangen. Er wurde zum Meister, dem nach seinem Tod noch über Jahrhunderte die Schüler folgten. Nicht nur wegen seiner kirchenpolitischen Schriften. Vor allem auch, weil er ein Meister der Definition war und von unerbittlicher Strenge, wenn es um die Sprache ging. Da durfte nicht gepfuscht und geschludert werden. Alles mußte klar sein und eindeutig. Diese Qualität vor allem hatte Martin Luther im Sinn, als er zwei Jahrhunderte später voller Stolz sagte, daß er aus der Schule des Ockham komme.
Damit es keine Mißverständnisse gibt: Marsilius, Ockham und die anderen kritischen Mönche wollten nichts Neues auf die Beine stellen. Sie fühlten sich keineswegs als «moderne» Geister, sondern als Verteidiger der wahren Tradition. Sie wünschten sich zurück zu den Anfängen. Zurück zur Heiligen Schrift und weg von den juristischen Vorschriften der Kurie. Zurück zu einem evangelischen Leben in Armut und Askese und weg von päpstlicher Pracht und Herrlichkeit. Die römische Kirche, nun in Avignon zu Hause, war für sie zur Hure geworden, die sich an die Welt verkauft hatte.
Als die Reformer bei Nacht und Nebel Avignon verlassen hatten und in den Schutz des gebannten Kaisers flohen, meldeten die weltlichen Gesandten an der Kurie diese Sensation ihren Herren in ganz Europa. Ordensbrüder auf der Wanderschaft quer über den Kontinent brachten die Nachricht nach Monaten, vielleicht erst nach Jahren in einige Klöster. Was am Hofe Ludwig IV. geschah, wer seine Berater waren, welche Politik er trieb: kein Sprecher verkündete es dem Volk. Keine Zeitung verbreitete die Nachrichten. Es gab keine Öffentlichkeit. Eine hauchdünne adlige Elite regierte. Das war ihr Geschäft und nicht die Theologie. Doch die theologische Welt war nicht weniger elitär. Wer nicht in Oxford oder Paris studiert hatte, brauchte gar nicht erst mitzureden. Weder Ockham noch Marsilius kamen auf die Idee, ihre Botschaft unters Volk zu bringen oder Anhänger um sich zu scharen. Jene radikalen Schriften, aus denen heute die Fachleute zitieren, mußten in zeitraubender Handarbeit nachgemalt werden. Dann lagerten die wenigen kostbaren Handschriften in den Klosterbibliotheken. Kein Laie bekam sie zu Gesicht.
Bildung und Kultur, Bergbau und Schafzucht standen keineswegs am Anfang der Ordensgeschichte. Die christlichen Einsiedler, die sich in die Wüsten Ägyptens zurückzogen, und die Männer, die im 6. Jahrhundert mit dem heiligen Benedikt in Italien Europas erste Mönchsgemeinschaft bildeten, hatten sich der Welt verweigert. Sie gingen in die Einöde und wollten nur zwei Dinge tun: beten und mit ihrer Hände Arbeit das wenige, was sie für ihr asketisches Leben brauchten, pflanzen und ernten. Nur hundert Jahre später rief der Bischof von Rom sie zurück in die Welt und gab ihnen den Auftrag, den Kontinent nördlich der Alpen zu missionieren.
Die Mönche, die zu den germanischen Völkern zogen, kamen als Boten einer anderen Kultur, die nicht nur fremd, sondern sehr mächtig und eindrucksvoll schien. Die Barbaren wurden gelehrige und begierige Schüler und machten die Mönche zu einem Teil der neuen Gesellschaft, einem Grundpfeiler der politischen und wirtschaftlichen Ordnung, die Europa weit über ein Jahrtausend prägte.
Von Zeit zu Zeit gab es den Versuch auszubrechen und Ansätze, das Rad der Zeit zurückzudrehen und den Sinn des Ursprungs wiederzugewinnen. Einen der faszinierendsten machte ein reicher Bürgersohn aus Assisi. Bruder Franz wollte für sich und seine Mitschüler nichts besitzen von den Gütern dieser Welt, und sehnte sich nach einer armen Kirche. Sein Zeitgenosse, der Spanier Dominikus, hatte ähnliche Ideen. Die Bettelorden entstanden. Franziskus hatte seinen Brüdern ausdrücklich auch die geistigen Reichtümer verboten. Ein Theologiestudium und kluge Bücher waren für ihn ein Hindernis auf dem Weg zu Gott. Aber Radikalität ist keine Massentugend. Die Nachfolger sind immer eine Nummer kleiner, gehen ihre eigenen Wege. So kamen die Bettelmönche auf die berühmten theologischen Lehrstühle in Oxford und Paris. Aber nicht alle wollten sich anpassen. So stritten die Reformer mit dem Papst, wie arm ein Mönch sein müsse oder dürfe.
«Und fest laßt uns wissen, daß nichts uns zugehört als die Laster und Sünden.» So hat es Franziskus formuliert. Es ist die Überzeugung, die am Anfang des Mönchtums steht: Die Welt ist von Grund auf schlecht. Der Mensch ist schlecht. Nur wer umkehrt, sich ändert und Buße tut sein Leben lang, kann gerettet werden vor den Flammen der Hölle. Darum wurde Demut die höchste Tugend der Mönche, so oft man sie auch vergaß. Doch zugleich wuchs das Gefühl, etwas Besonderes zu sein und zu jener kleinen Schar zu gehören, die von Gott auserwählt war. Es entstand ein Sendungsbewußtsein, das seinen Auftrag direkt von Gott herleitete und deshalb jederzeit umschlagen konnte in unbarmherzigen Fanatismus, das Buße forderte, Demut predigte und doch keine Gnade kannte. Der Hochmut der Mönche stand an der Spitze aller Lasterkataloge.
Mit dieser Spannung mußte fertig werden, wer sensibel war. Einer, der der Gefahr erlag, war Savonarola; ein italienischer Dominikanermönch, der in seinen Predigten unermüdlich die Sünden der fetten Prälaten und verdorbenen Päpste anprangerte. Savonarola wollte die Kirche reformieren, seinen Orden und die Gesellschaft. Er vertrieb die Medici unter dem Jubel des Volkes aus Florenz. Eine düstere, sittenstrenge Herrschaft begann. So hatte sich das Volk seine Zukunft nicht vorgestellt. 1498 wurde der Mönch auf dem großen Platz mitten in der Stadt erdrosselt und verbrannt.
Es ist verständlich, daß viele Mönche den Widerspruch ihrer Existenz nicht aushalten konnten. Sie gingen den leichteren Weg. Sie quälten sich nicht ständig um ihr Heil oder das der Kirche. Sie lebten brav, unauffällig und unangefochten. Manch einer ging auch den Sünden des Fleisches nach. Das Ziel, das die Gründer gesteckt hatten, war zu hoch und das Verflochtensein in die Welt nicht rückgängig zu machen. Mit den Jahrhunderten nahm das Reservoir an geistlicher und geistiger Kraft in den Klöstern ab. Als Savonarola in Florenz starb, schien die große Zeit des mittelalterlichen Mönchtums vorbei. Oder würde noch einmal jemand heranwachsen, der sich und der Welt ein radikales christliches Ziel setzte?
Die neue Frömmigkeit
Als Martin Luther, der angehende Jurist, im Sommer 1505 von einem Tag auf den anderen das Studium abbrach und ins Kloster der Augustiner zu Erfurt eintrat, entschlossen, für den Rest seines Lebens ein Mönch zu sein, war sein Vater entsetzt. Mit antikirchlichen Gefühlen und mangelnder Frömmigkeit hatte das nichts zu tun. Hans Luther war ein gläubiger Mann und fest in der einen, katholischen Kirche verwurzelt. Aber er spürte wie viele seiner Zeitgenossen, daß der Stand der Mönche keine Zukunft mehr hatte. Die Orden selbst verschlossen ja die Augen nicht vor dem Niedergang ihrer Gemeinschaften. Zwar beklagten sie die «Unfruchtbarkeit der Zeiten», die «Schädlichkeit des Fortschritts» und «daß bei vielen Menschen die Liebe erloschen ist». So die Generalversammlung der Zisterzienser 1494. Aber sie vergaßen nicht, sich an die eigene Brust zu schlagen. Sie prangerten die «Ungeheuerlichkeit des schlechten Treibens von Äbten und Mönchen» an. Wie kritische Mönche vor ihnen, sahen die Zisterzienser gegen Ende des 15. Jahrhunderts das Heil nur in der Rückkehr zu den Ursprüngen: «Es geht nicht darum, in dem in geistigen und weltlichen Dingen ruinierten Orden irgendwelche neuen Erfindungen einzuführen, sondern ihn zurückzuführen zum Leben, zu den Zeremonien und zu den Einrichtungen der heiligen Väter …»
Wir sind in jenem Jahrhundert angekommen, an dessen Ausgang im November 1483 Martin Luther geboren wurde. Es ist an der Zeit, den geistlichen Stand zu verlassen und sich dem kirchlichen Fußvolk zuzuwenden. Sein Alltag ist von Hagelschlag und Mißernten, vorteilhaften Geschäftsabschlüssen und Festen ebenso geprägt, wie von Fastentagen und Messen, feierlichen Prozessionen und inbrünstigen Gebeten vor wundertätigen Reliquien.
Nach den immer neuen Pesteinbrüchen während des 14. Jahrhunderts, den Seuchen und Hungersnöten, an denen insgesamt wohl 20 Prozent der Menschen in Europa starben, geht es wieder bergauf. Endlich, ab 1470, werden mehr Menschen geboren als zu Grabe getragen. Die Wirtschaft stabilisiert sich, gewinnt neue Dynamik. Etwas unter 90 Prozent der Bevölkerung leben auf dem Land. Doch wir dürfen nicht an die erbärmlichen Verhältnisse denken, unter denen bäuerliche Landarbeiter östlich der Elbe in der sogenannten Neuzeit ihr Leben zubringen mußten. Der mittelalterliche Bauer war kein Sklave. Obwohl an seine Scholle gebunden, war er ein persönlich freier Mann. In den meisten Landschaften war die Handarbeit, die er seinem Grundherrn schuldete, längst in Naturalien, in Abgaben von seiner Ernte, umgewandelt worden.
Im Dorf gab es – wie in der städtischen Gemeinschaft – arm und reich, unten und oben. Mus und Brei als typisch bäuerliche Nahrung hielten erst die kommenden kümmerlichen Jahrhunderte bereit. In den Haushaltsplänen des Grafen Joachim von Oettingen, der auf der Burg Hochberg bei Nördlingen residierte und 1520 starb, ist genau aufgezählt, was die Wächter, Knechte, Arbeiter und Bauern als Tagesration zu essen bekamen: Morgens eine Suppe, mittags eine Suppe und Fleisch, Kraut, eine mit Pfeffer – damals ein kostbares Gewürz –, angemachte Fleischbrühe oder eingemachtes Fleisch, Gemüse oder Milch und zum Abend wieder Suppen und Fleisch, Rüben und Fleisch, Gemüse oder Milch. Insgesamt kommt man pro Tag und Kopf auf fast zwei Drittel Kilogramm Fleisch. Auf dem Tisch des Grafen stand die doppelte Menge an Gerichten, außerdem Wildbret, Geflügel und Fisch.
Es wurde auch in diesem Jahrhundert gehungert. Aus Thüringen berichtet 1438 der Chronist, daß die Menschen in den Dörfern tot umfielen. Es gab keinen, der sie begraben konnte, und ein Stückchen Brot war nicht zu bezahlen. Doch solche Notzeiten waren kein Dauerzustand, sondern Einbrüche in einer generell positiv verlaufenden Konjunktur. Mit der nächsten guten Ernte sank der Getreide- und damit der Brotpreis wieder. Geld wurde frei. Der Konsum stieg. Damit sind wir in den Städten angelangt, denn sie waren, über das ganze Reich verstreut, die wirtschaftlichen Magnete im Kraftfeld der Wirtschaft. Hier wurde produziert, umgesetzt und nicht wenig konsumiert. Ein dichtes Netz von Straßen und Wasserwegen durchzog den Kontinent, schaffte Alltags- und Luxuswaren in die kleinsten Nester. Die mittelalterliche Wirtschaft war offen und grenzüberschreitend. Der mittelalterliche Mensch war ausgabefreudig und allem Neuen gegenüber aufgeschlossen.
Das Modell für die soziale Struktur in der Stadt ist die Pyramide. Reiche, alteingesessene Bürger und gut verdienende bildeten eine dünne Spitze. Doch am Ende des 15. Jahrhunderts konnten auch die kleinen Handwerker und die Arbeiter nicht klagen. Im Durchschnitt lagen die Löhne über den Preisen für Nahrungsmittel und Gebrauchswaren. Das Ernährungsbudget für die fünfköpfige Familie eines Würzburger Bauarbeiters in diesen Jahren erlaubte pro Person 2240 Kalorien täglich. Sehr viel mehr, als sich eine Arbeiterfamilie am Beginn des 19. Jahrhunderts leisten konnte.
Einen ganz besonderen Boom erlebten die Städte im Sächsischen. Hier wurde Silber, Kupfer und Kohle aus den Bergen geholt, so gefragt wie nie zuvor in Europas Geschichte. Fünfzehn neue Städte wurden in dieser Region im letzten Drittel des Jahrhunderts gegründet. Allen voran das prächtige Annaberg, dessen neue gotische Kirche wie ein Weltwunder bestaunt wurde. In Nürnberg blühte die Uhrenindustrie, und bald verdrängte die Stadt an der Pegnitz das «heilige Köln», bis dahin unangefochten die reichste und größte Stadt im Reich. Augsburg wurde Finanzzentrum, und die Familien der Fugger und Welser gewannen mit ihrem Geld zusehends an Einfluß in den politischen Geschäften.
Umdenken müssen wir, was die Größe dieser Städte betrifft. Rund fünftausend gab es um 1500 im Deutschen Reich. In nur 5 Prozent von ihnen lebten mehr als dreitausend Menschen. Köln, die größte, hatte 40000 Bewohner, Lübeck rund 25000, Frankfurt 15000, Hamburg nicht mehr als fünftausend. Städtisches Leben und städtischer Reichtum waren nicht an die Quantität gebunden. Auch wo nur tausend oder dreitausend Menschen in den winkligen Gassen wohnten, kamen die Güter aus aller Welt ins Haus, produzierten Handwerker ihre Waren, die Kaufleute dann weit über das Land schafften. Kultur und Bildung waren kein Monopol der Mönche mehr, sondern auch in den Häusern der Bürger zu Hause. Handwerker und Kaufleute, Männer und Frauen überhäuften die Bildhauer und Maler mit Aufträgen. In manchen städtischen Gebieten des Deutschen Reiches konnten immerhin schon 10 Prozent der Bewohner lesen und schreiben. Das war ein revolutionärer Durchbruch in Europa.
Keine mittelalterliche Stadt ist denkbar ohne die Türme der Kirchen und Kapellen, das Geläut der Glocken, die Nonnen und Mönche in ihren schwarzen, braunen und weißen Trachten, den wehenden Hauben und spitzen Kapuzen. Die geistlichen Männer und Frauen genossen die Annehmlichkeiten der Stadt. Die Bürger spendeten reichlich. Doch die Gesetze der Stadt galten für die geistliche Schar nicht. Sie mußten keine Steuern zahlen und vor keinem weltlichen Gericht erscheinen. Ihre Häuser und Kirchen waren unangreifbare, immune Inseln innerhalb der Stadtmauern.
Den Bürgern, so fromm sie waren, bedeutete diese Sonderexistenz zunehmend ein Ärgernis. Sie versuchten, die geistlichen Bezirke voll in das städtische Leben mit allen seinen Rechten und Pflichten zu integrieren. Der größte Teil der Geistlichkeit, die Bischöfe an der Spitze, wehrten sich mit allen Mitteln. Der Konflikt zwischen Bischof und Bürgern war deshalb so erbittert, weil es keineswegs nur um geistliche Belange, sondern um hochpolitische Standesinteressen ging. Denn die Bischöfe, Nachfolger der Apostel, kamen ausnahmslos aus dem adligen Stand (so blieb es – mit Ausnahmen – bis ins vorige Jahrhundert). Wer in der Hierarchie der katholischen Kirche einen oberen Platz einnehmen wollte – als Bischof, Domherr, Abt –, mußte blaues Blut durch viele Generationen nachweisen. Ein tiefer Graben trennte die hohe Geistlichkeit vom niederen Klerus, der beim Gottesdienst oder Beichthören als einziger mit dem Kirchenvolk in Kontakt kam.
Die Bürger in der Stadt waren mit der Zeit nicht nur politisch mündiger geworden. Sie nahmen auch in kirchlichen Dingen nicht mehr alles schweigend hin. Das 15. Jahrhundert brachte die Bürger nach vielen mühsamen Anläufen ihrem Ziel einen großen Schritt näher: mündige Christen zu sein, die mitsprechen dürfen, wenn es um das Heil ihrer Seelen geht. Sie wollten bei allem nie bestrittenen Respekt die Kirche nicht mehr als ferne, bedrohliche Macht, sondern als Teil ihrer Welt erleben. Was in Augsburg geschah, ist typisch für diese Entwicklung. Wer Augsburg damals besuchte, konnte glauben, schon jenseits der Alpen zu sein. Breite Straßen durchzogen die Stadt, in schattigen Laubengängen lagen die Geschäfte. Kirchen und Bürgerhäuser zeugten vom Geschmack und Geld der Bürger. Das Geld spielte auch im Kampf der Stadt gegen ihren Bischof eine nicht unerhebliche Rolle. Die Bürger waren bereit, für ihre Freiheit zu zahlen und wirtschaftliche Verluste in Kauf zu nehmen.
Im Jahre 1413, als die Kirche gespalten war und zwei Päpste Anspruch auf den römischen Stuhl erhoben, wurden auch in Augsburg zwei Kandidaten zum Bischof gewählt. Die adligen Domherren unterstützten den einen, der Rat der Stadt hartnäckig den anderen Bewerber. Der Papst entschied schließlich zugunsten der Domherren. Doch die Bürger gaben nicht nach. Auch als sie 1418 dafür mit dem Bann belegt wurden, die Herzöge von Bayern den Handel mit der Stadt abbrachen und die meisten Geistlichen die Stadt verließen. Kranke starben ohne die Letzte Ölung, Kinder wurden nicht getauft. Eine schreckliche Vorstellung für alle, die an die Wirkungen der Sakramente glaubten. Es gab erst Frieden, als der Papst 1424 einen dritten, Peter von Schaumberg, zum Bischof ernannte.
Bischof Peter prozessierte von 1450 bis 1456 gegen die Stadt, um die alte Sonderstellung seines Standes wiederherzustellen. Sogar ein Krieg drohte, bis auf beiden Seiten die Vernunft siegte und man einen Kompromiß schloß. Zum drittenmal stand man sich in diesem Jahrhundert vor Gericht gegenüber, als Peters Nachfolger es 1474 ablehnte, den angesehenen Augsburger Bürger Bernhard Artzt in das Domkapitel aufzunehmen. Die Tradition stand auf der Seite des Bischofs. Bisher hatte es immer nur adlige Domherren gegeben. Und so sollte es bleiben. Sieben Jahre dauerte der Prozeß an der römischen Kurie. Die Stadt führte ihn für ihren Bürger – und verlor. Aber vor zu einfachen Schlußfolgerungen muß man sich zu allen Zeiten hüten. Der gleiche Bischof Peter, der so zäh um seine alten Privilegien kämpfte, verschloß sich dem Ruf nach Reformen nicht und unterstützte die Bürger, als sie – von Rom allein gelassen – zur Selbsthilfe schritten. Denn die gleichen Bürger, die gegen geistliche Bevormundung in städtischen Angelegenheiten prozessierten, waren sehr dafür, daß in den Klöstern, wo ihre Söhne und Töchter untergebracht waren, Zucht und Ordnung herrschten.
Das Dominikanerkloster St. Katharina war das Versorgungsinstitut für die unverheirateten Töchter der Patrizierfamilien. Obwohl die Ordensregeln strengste Isolierung von der Welt vorschrieben, ließen sich die Nonnen im Kloster von Familienangehörigen besuchen, verfügten über eigenes Geld und gingen sogar ungeniert in der Stadt spazieren. Ein Reformversuch im Jahre 1357 führt zu nichts. Da wandte sich der Rat der Stadt 1441 in einem Brief an den Ordensprovinzial, klagte über die ständigen Verstöße gegen die Regel und bat um gemeinsame Beratungen über die Mißstände. Schon vierzehn Tage später wurden die Schwestern von St. Katharina von ihrem geistlichen Vorgesetzten an die strenge Klausur erinnert. Man würde sie notfalls mit weltlicher Hilfe durchsetzen. Als sich nichts änderte, schritt der Rat mit gutem Gewissen zur Tat. Er bestellte Maurer, um die Klostermauern zu erhöhen und die Sprechgitter zuzumauern. Doch die Nonnen hielten nichts von christlicher Friedfertigkeit. Sie kamen mit «stangen und pratspießen und schlugen und stachen zu den maurern und zu den werkleuten und triben sie all ab mit gewalt». Dann läuteten die Gottesfrauen Sturm und unterstellten sich dem Schutz des Bischofs. Der untersagte den Nonnen schließlich alle Besuche. Eine Äußerlichkeit. Wirkliche Reformen konnte auch er nicht durchsetzen.
Auch die adligen Herren gewannen in Laufe des 15. Jahrhunderts ein immer größeres Mitspracherecht in kirchlichen Dingen. Vom Herzog von Kleve hieß es, er sei in seinem Territorium Kaiser und Papst. Ganz entsprach das nicht der Wahrheit, denn wenn zum Beispiel der Papst eine Stadt mit dem Bann belegte und kein Priester eine Messe halten durfte, war der Landesherr machtlos. Doch es wurde selbstverständlich, daß er in den Klöstern seines Gebiets nach dem Rechten sah und bei der Ab- und Einsetzung von Äbten und Bischöfen kräftig mitmischte.
Den Fürsten und Herren lag vor allem daran, daß die Klöster ertragreiche Wirtschaftsbetriebe waren. Aber nicht wenige Landesväter waren ehrlich bemüht, auch geistliche Reformen durchzusetzen, da nur allzu oft die geistliche Aufsicht versagte. Es ging ihnen ähnlich wie der städtischen Obrigkeit. Johann Neunhauser, Gesandter des Bayernherzogs in Rom, versuchte vergeblich, an der römischen Kurie für seinen Herrn das Recht zu erlangen, die arg verweltlichten Regensburger Klöster zu visitieren. Enttäuscht schrieb er nach Hause, «das zu Rom di visitacion und reformacion nit wol gefürdert sondern mer gehindert werden …»