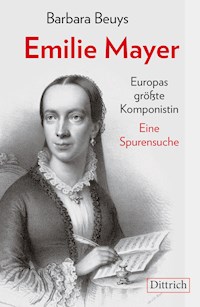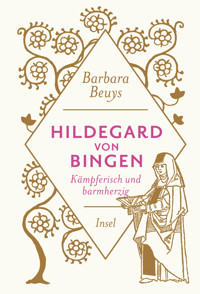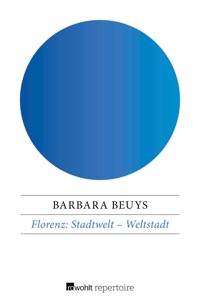9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
In unserer Gesellschaft der Gesunden und Leistungsfähigen wird die Tragik von Familien mit behinderten Kindern kaum wahrgenommen. Die bekannte Autorin Barbara Beuys hat mit Eltern behinderter Kinder viele Gespräche geführt und in Selbsthilfegruppen zugehört. Daraus ist dieses Buch für die Eltern behinderter Kinder entstanden, weil nichts soviel Mut macht wie die Erfahrungen anderer. Es ist auch geschrieben für die Freunde und Verwandten dieser Eltern, die der «behinderten Familie» meist hilflos gegenüberstehen. Hier erzählen vor allen Dingen Eltern, die es geschafft haben, zusammen mit ihrem behinderten Kind neu leben zu lernen. Sie zeigen, wie sie ihrem Kind helfen, glücklich zu sein, und wie sie für sich selbst neue positive Erfahrungen gewinnen konnten. Die Erstausgabe erschien 1984 unter dem Titel «Am Anfang war nur Verzweiflung. Wie Eltern behinderter Kinder neu leben lernen».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Barbara Beuys
Eltern behinderter Kinder lernen neu leben
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
In unserer Gesellschaft der Gesunden und Leistungsfähigen wird die Tragik von Familien mit behinderten Kindern kaum wahrgenommen. Die bekannte Autorin Barbara Beuys hat mit Eltern behinderter Kinder viele Gespräche geführt und in Selbsthilfegruppen zugehört. Daraus ist dieses Buch für die Eltern behinderter Kinder entstanden, weil nichts soviel Mut macht wie die Erfahrungen anderer. Es ist auch geschrieben für die Freunde und Verwandten dieser Eltern, die der «behinderten Familie» meist hilflos gegenüberstehen.
Über Barbara Beuys
Barbara Beuys, Jahrgang 1943, ist im Rheinland aufgewachsen. Studium der Geschichte, Philosophie und Soziologie in Köln, Promotion 1969. Barbara Beuys ist Journalistin seit 1970 (Stern, Merian, ZEIT-Magazin). Außerdem lieferbar: «Vergeßt uns nicht», «Familienleben in Deutschland», «Florenz: Stadtwelt – Weltstadt» sowie «Und wenn die Welt voll Teufel wär».
Inhaltsübersicht
Wie alles anfing
«Zeichnen Sie bloß kein Schreckensbild!» war die spontane Reaktion bei Eltern und Selbsthilfegruppen, zu denen ich Kontakt aufnahm, um von den Betroffenen zu erfahren, wie eine Familie mit einem behinderten Kind in unserer Gesellschaft lebt und ob sie mit dieser schweren Krise fertig werden kann.
Viel zu häufig machen Ängste, Hilflosigkeit und Mißtrauen ein unverkrampftes Miteinander von behinderten und nichtbehinderten Menschen, obwohl sie Tür an Tür leben, immer noch unmöglich. Da herrscht die Angst, von oben herab bejammert und bemitleidet zu werden, weil die Tochter oder der Sohn im Wettrennen um Erfolg, Anerkennung und Leistung nicht mithalten kann. Eltern sind verletzt, weil die Liebe zu ihrem Kind – die selbstverständlichste Sache der Welt – von Nachbarn wie Freunden in Frage gestellt wird, nur weil dieses Kind den allseits akzeptierten Vorstellungen von Schönheit, Gesundheit und geistiger Entwicklung nicht entspricht. Mütter und Väter argwöhnen nach bitteren Erfahrungen, daß die angebotene Hilfe aus Pflichtbewußtsein geleistet wird oder dem überlegenen Gefühl entspringt, der Stärkere zu sein. Sie wollen kein Mitleid.
Doch hinter der Stärke, die die «Gesunden» demonstrieren, steckt oft sehr viel Schwäche und vor allem Angst, diese Schwäche zuzugeben. Sie sind hilflos, weil sie nicht wissen, wie sie sich gegenüber einem Menschen verhalten sollen, der im Rollstuhl sitzt, der nicht sprechen oder hören kann, der auch als Erwachsener nicht größer als ein Kind ist. So erstarren die Gesichtszüge der Umstehenden in der U-Bahn oder im Kaufhaus, wo doch ein aufmunterndes Lächeln Wunder wirken könnte.
Eltern haben ein schlechtes Gewissen, weil ihr Kind ohne körperliche oder geistige Handicaps aufwächst und sie sich nicht vorstellen können, daß auch eine «behinderte Familie» Spaß am Leben hat. Nichtbehinderte sind verunsichert und voller Ängste, weil der Behinderte sie daran erinnert, daß die Werte, nach denen sie leben, und die Ziele, die sie sich setzen, schon morgen sinnlos sein können. Aber der Mensch ist ein Meister im Verdrängen zukünftiger Probleme. Wenn ihn nicht einmal die Gewißheit des Todes zum Umdenken zwingt, wieviel weniger Krankheit oder Behinderung.
Familien mit einem behinderten Kind leben am Rande der Gesellschaft, getrennt und isoliert von vielem, das den Nichtbehinderten selbstverständlich ist. Anfang der siebziger Jahre erschienen die ersten Bücher, die auf den Skandal der Benachteiligung aufmerksam machten, das Thema Behinderung – begleitet von provozierenden Aktionen – in die Öffentlichkeit brachten und das Selbstbewußtsein der Betroffenen stärken wollten. Junge Behinderte schrieben über ihr Leben und gründeten eigene Zeitschriften «Zur Emanzipation Behinderter und Nichtbehinderter». Es folgten Bücher von Experten, die sich mit ihrem Engagement und ihrem Fortschrittsglauben in bezug auf Behindertenarbeit kritisch auseinandersetzten. Väter und vor allem Mütter behinderter Kinder schrieben sich ihre Erfahrungen von der Seele, schilderten ausführlich die Probleme einer bestimmten Behinderung und halfen damit Eltern, die in ähnlicher Situation waren.
Daneben gab und gibt es zwei Arten von Büchern, die für die Betroffenen keine Hilfe sind. Kommentar einer Mutter über solche Ratgeber: Entweder malen sie die Situation rosarot oder sie sind von einer schrecklichen Sachlichkeit. Es gibt Bücher über mongoloide Kinder mit Fotos, die sind zum Heulen, reine Horrorvisionen. Das sollte verboten werden.
In meinem Buch stehen nicht die Kinder, sondern die «behinderten Eltern» im Mittelpunkt. Ich versuche aufzuzeigen, was sich im inneren Kreis der Familie und in bezug zur Außenwelt ereignet. Was zerstört wird und wie sich Neues entwickelt. Eltern kommen ausführlich zu den Lebenssituationen und Problemen zu Wort, mit denen alle konfrontiert werden, die ein behindertes Kind haben. Ihre Aussagen sind hervorgehoben.
Mein Buch erzählt keine Fallgeschichten. Es ist der Versuch, die subjektiven Erfahrungen von vielen zu bündeln und für viele andere – unabhängig von der jeweiligen Behinderung – nutzbar zu machen.
Dieses Buch lebt auch von einer Hoffnung: Daß es einem nichtbehinderten, aber engagierten Zeitgenossen möglich ist, Dolmetscher sein zu können zwischen zwei Welten, die sich so oft sprachlos gegenüber stehen. Angst, Hilflosigkeit und Aggressionen der Nichtbehinderten können letztlich nur durch Erfahrung abgebaut werden. Doch zu den ersten Schritten auf dem Weg der Normalisierung gehören Informationen und Kenntnisse darüber, welche Katastrophe die Behinderung erst einmal bedeutet und wie unendlich schwer wir alle es den Eltern machen, die aus Verzweiflung und Trauer zu einem neuen Leben finden möchten.
Bücher können die Welt nicht verändern. Aber wenn sie ein bißchen Mut machen, ein paar Mißverständnisse beseitigen und ein wenig zum Nachdenken anregen, wäre das viel.
Obwohl ich weder persönlich noch im Familienumkreis von Behinderung betroffen bin, ist sie mir seit langem nicht fremd. Vor 22 Jahren fuhr ich nach England, um dort während der Schulferien in einem Heim für Behinderte zu arbeiten und so meine Englischkenntnisse zu verbessern. Auf das, was mich dort erwartete, war ich völlig unvorbereitet. Ich hatte bis dahin Behinderte höchstens im Vorübergehen registriert und mir über ihre Situation nie Gedanken gemacht. Den Schock, den diese erstmalige Konfrontation mit behinderten Menschen bei mir auslöste, habe ich nicht vergessen. Ich blieb, um mich nicht zu blamieren – und machte Erfahrungen, die dieses Buch, obgleich so viele Jahre verstrichen sind, nicht als Zufallsprodukt erscheinen lassen. Denn dem ersten Aufenthalt in Le Court, das auf einem sanften Hügel im schönen südenglischen Hampshire liegt, folgten viele. Mein ganzes Studium lang habe ich dort jedes Jahr die Semesterferien verbracht mit Menschen, bei denen ich mich wohl fühlte.
Le Court war der Gegenstand meiner allerersten journalistischen Anstrengung. Der Artikel erschien im Juni 1964 in der Zeit. Ich zitiere daraus, weil er zeigt, von welchen Eindrücken mein Verhältnis zu behinderten Menschen geprägt wurde und weshalb ich überzeugt bin, daß man unreflektierte Vorurteile ablegen und dazulernen kann: «Leonard Cheshire ist ein Idealist, wie es wahrscheinlich nicht wenige gibt. Als britischer Beobachter beim Abwurf der Atombombe auf Nagasaki erschüttert und aufgerüttelt vom Grauen des Krieges, beschließt er, den zerstörenden Kräften in der Welt ein Werk konstruktiver und tätiger Nächstenliebe entgegenzusetzen … Le Court, das erste Heim, inzwischen durch einen modernen Neubau ersetzt, wird zur Keimzelle der vierzig Heime, die allein heute in Großbritannien bestehen und in denen 926 Körperbehinderte leben. Das Zahlenverhältnis zeigt, daß der Familiencharakter tatsächlich gewahrt bleibt; bei durchschnittlich dreißig Heimbewohnern ist dies keine leere Floskel.»
Captain Cheshire hatte gleich nach dem Krieg für seine Heime eine Lebensregel aufgestellt, die sich noch in den sechziger Jahren für deutsche Ohren revolutionär anhörte: «Die Heime bieten die Atmosphäre und die Freiheit eines Familienlebens.» Ich konnte erfahren, daß dies keine leere Floskel war: «Die Haustür ist nie verschlossen. Wer mitternachts nach Hause kommt, dem hilft die Nachtschwester ohne einen schiefen Blick ins Bett … Was aber tun diese ‹Krüppel› den ganzen Tag? Die Poliokranken und Querschnittgelähmten, die Menschen, denen ein Nervenleiden das Rückenmark zerstört hat, die Arthritiskranken, die spastisch Gelähmten? Niemand, der ein Cheshire-Heim kennt, wird diese Atmosphäre voller Arbeit, Leben und Fröhlichkeit vergessen können. Im ‹workshop› wird genäht, gezeichnet, gehämmert, gebastelt; auf dem Flur hört man das Rattern einer elektrischen Schreibmaschine; in der Dunkelkammer wird entwickelt, und vielleicht ist das Kamera-Team gerade bei einer Aufnahme.
Keiner kann ermessen, was dieses ‹neue Leben› für Menschen bedeutet, die jahrelang von einem Krankenhaus in das andere abgeschoben wurden; die als junge Menschen in einem Altersheim lebendig begraben wurden … Langsam beginnt die englische Öffentlichkeit ihre Vorurteile gegenüber den ‹Gezeichneten› zu revidieren; Rundfunk und Presse haben ihren Anteil daran. Jahrhundertelanges Mißtrauen, Lieblosigkeit und Vorbeisehen können nicht in wenigen Jahren in ihr Gegenteil verkehrt werden, aber Tabus sind durchbrochen, Diskussionen in Gang gesetzt worden. Mit jedem Tag, den wir – im Land des Wirtschaftswunders – zögern, verlängern wir den menschenunwürdigen Zustand von Tausenden.»
Was vor zwanzig Jahren in England schon praktiziert wurde, war um diese Zeit in der Bundesrepublik noch Utopie. Vieles hat sich seitdem zum Besseren geändert. Doch Heime oder Wohngruppen, in denen für erwachsene Behinderte «die Atmosphäre und die Freiheit eines Familienlebens» herrschen, sind immer noch in der Minderzahl, ihre vermehrte Einrichtung eine Verpflichtung für jeden Staat, der sich sozial nennt.
In der Bundesrepublik werden nach realistischen Schätzungen jährlich rund 40000 behinderte Kinder geboren, von denen nach Meinung von Fachleuten die Hälfte durch ärztliche Fehlentscheidungen und Kunstfehler während Schwangerschaft und Geburt unheilbar geschädigt werden. Tausende von Kindern werden durch Unfälle – vor allem im Verkehr – schwer verletzt. Es steigt die Zahl der chronisch kranken Kinder. Zwei Fragen stellen sich Eltern, wenn die Tatsache der Behinderung unumstößlich ist: Schaffen wir es, mit der Behinderung zu leben? Können wir dieses Kind lieb haben?
Die Behinderung bricht in den allermeisten Fällen völlig unerwartet über die Eltern herein. Sie haben keinerlei Informationen oder Erfahrungen. Sie sind belastet mit den Schreckensvisionen aller Nichtbetroffenen: Vor der Geburt meines eigenen behinderten Kindes habe ich um Mütter mit behinderten Kindern einen großen Bogen gemacht und nur gedacht: Die arme Mutter. Ein behindertes Kind zu haben ist nicht zuletzt deshalb eine Katastrophe, weil die Eltern wissen, sie sind zur «Sonderfamilie» geworden. Sie sind ausgestoßen aus der Mehrheit der Gesunden und Tüchtigen. Alle Pläne, alle Lebensziele sind zerstört. Die Welt bleibt stehen. Sie werden nie mehr lachen können, nie mehr unbeschwert und fröhlich sein.
Die Eltern durchleben eine Krise, deren Merkmale zum Teil mit anderen Krisensituationen identisch sind. Das Erlebnis der Verzweiflung und Ausweglosigkeit wird gesteigert durch das Bewußtsein, an einen Menschen gebunden zu sein, der wahrscheinlich sein Leben lang unselbständig und auf Hilfe angewiesen ist. Es wird verstärkt, weil Eltern sehr schnell erfahren, daß sie zwar nicht mehr zum Durchschnitt gehören, aber sehr wohl von der Mehrheit unter Erwartungsdruck gesetzt werden. Sie sind Widersprüchen ausgesetzt, die unerträglich werden können. Wer ein schwer behindertes Kind nicht ins Heim gibt, gilt bei den einen als Übermensch, bei den andern als Verrückter.
Negative Weichen gegenüber der Umwelt werden in den meisten Fällen ausgerechnet von den Menschen gestellt, von denen die Eltern in ihrer Verzweiflung Hilfe und Information erwarten. Bittere Enttäuschung über Ärzte, die sie in der Stunde der Wahrheit im Stich ließen, die weder Mitgefühl zeigten noch konkrete Hinweise darüber gaben, wie das behinderte Kind sich entwickeln würde, kommt bei vielen Eltern noch nach Jahren hoch. Dieses Urerlebnis steht für viele Familien zusammen mit dem Schock über die Behinderung am Anfang: Sie sind ganz allein.
Die verstörte Reaktion von Freunden und Verwandten scheint diese Erfahrung zu bestätigen. Sie sind hilflos oder versuchen zu trösten, wo es in diesem Augenblick keinen Trost geben kann. Auch sie trifft die Diagnose «behindert» völlig unvorbereitet.
Die Eltern selbst brauchen alle Energie für sich selber und ihr Kind. Sie stecken noch zu tief in der Verzweiflung, um sich mitteilen zu können. Erst Jahre später wagen die Eltern sich einzugestehen, was allen Eltern-Kind-Klischees widerspricht: Daß die Liebe zu ihrem Kind sich nicht in dem Augenblick einstellte, als sie es zum erstenmal im Arm hielten: Das erste Jahr hat meine Tochter nur gegessen und geatmet. Sie zeigte überhaupt keine Reaktionen, und ich hatte keinen großen Kontakt zu ihr. Es war eine schwere Zeit. Erst als ich andere Mütter sah, die mit ihren behinderten Kindern ganz normal umgingen, da konnte ich meine Tochter so annehmen, wie sie ist.
Es ist das Beste, was Eltern behinderter Kinder passieren kann: Wenn sie von anderen betroffenen Eltern erfahren, daß man als Familie in das Zusammenleben mit einem behinderten Kind langsam hineinwächst. Wenn Eltern, die Schlimmstes durchgemacht haben, ihnen sagen: «Die Welt bleibt nicht für immer stehen. Eines Tages geht das Leben weiter.» Die Sorgen um die Zukunft verflüchtigen sich, und man beginnt, intensiv in der Gegenwart zu leben. Man lernt, kleine Schritte zu machen, und zwar einen nach dem anderen. Man empfindet über die kleinen Fortschritte des Kindes eine große Freude. Man entwickelt Phantasien und Kräfte, die man sich vorher nie zugetraut hätte. Man hilft seinem Kind, glücklich zu sein und gewinnt dabei für sich selber etwas. Es ist für Außenstehende kaum nachvollziehbar, was Eltern erleben, wenn ein Baby über zwei Jahre keinerlei Reaktionen zeigt und dann eines Tages ganz unerwartet das so oft vergebliche Lächeln der Eltern erwidert und zurücklächelt – zum erstenmal nach 730 langen Tagen. Man lernt etwas, das überall wichtig wäre, aber nur selten zusammenkommt – realistisch zu sein ohne zu resignieren: Die Erwartungen flachen mit der Zeit ab, aber die Hoffnung geben wir nie auf.
Es bleibt noch genug für die Negativseite: Das schlechte Gewissen, nicht alles für sein Kind getan zu haben, ist ein ständiger Begleiter der Eltern. Sie hoffen in den ersten Jahren auf Wunder, die sich nie einstellen. Vor allem die Mütter gehen davon aus, sich für dieses Kind aufopfern zu müssen und für sich selber keine Zeit mehr haben zu dürfen. Kinder sind noch schwerer konsequent zu erziehen, wenn eine Behinderung alle Unarten entschuldigt. Die Eltern lehnen jede Hilfe von Nachbarn und Freunden ab, weil angeblich nur sie selber mit ihrem Kind richtig umgehen können. Sie haben oft Angst vor Integration in Kindergarten und Schule, weil es dann für die Familie keinen Schonraum mehr gibt. Die Eltern verzichten auf weitere Kinder, um nur für das behinderte da zu sein. Aber nichts ist so verletzend und verunsichernd wie das Verhalten der Umwelt. Mit brutaler Offenheit erfahren die «behinderten Familien» immer wieder, daß sie nicht dazu gehören. Daß sie stören und lästig sind. Solche Einstellungen der anderen wie die Empfindungen der Betroffenen fallen nicht vom Himmel.
Betroffen und mitgeprägt von der vorwiegend traurigen Geschichte der Behinderten in unserem Kulturkreis sind wir alle, die «normalen» Familien wie die «behinderten». Nur wenn wir dieses historische Erbe nicht vergessen und verdrängen, kann die feste Mauer der Vorurteile abgebaut werden, kann das gegenseitige Verständnis wachsen.
Wie im antiken Griechenland – der «Wiege des Abendlandes» – die Elite über Behinderungen dachte, sagt uns der Philosoph Platon. In seiner Utopie eines idealen Staates gibt es eine Anweisung, wie sich die Behörden gegenüber neugeborenen Kindern zu verhalten haben: «Die Kinder der Schwächeren oder irgendwie mißgestaltete verbergen sie an einem geheimen und unbekannten Ort, wie es sich gehört.» Der große Aristoteles dachte ähnlich. Der berühmte Gesetzgeber Solon hat im 6. Jahrhundert schwächlichen Neugeborenen das Lebensrecht per Gesetz abgesprochen. Ammen waren verpflichtet, mißgestaltete Säuglinge zu «beseitigen». Im antiken Rom, wo die Aussetzung von Neugeborenen erlaubt war, traf es natürlich nur jene, die nicht gesund waren.
Neben der griechisch-römischen hat vor allem die christliche Tradition das europäische Bewußtsein beeinflußt. Für den Anfang, vor aller Institutionalisierung des Christentums, geben die Evangelien eine eindeutige Botschaft: Der Sohn Gottes sitzt nicht an den Tischen der Mächtigen, sondern solidarisiert sich mit den Benachteiligten, den Armen, den Behinderten. Sie werden durch seine Wunderkraft besonders ausgezeichnet: Lahme gehen, Blinde sehen, Stumme reden wieder. Jesus verspricht denen, die in dieser Welt die Letzten sind, daß sie im Reich Gottes die Ersten sein werden. Ganz hat das Christentum diese Provokation nicht vergessen. Findelhäuser wurden errichtet, in denen während des Mittelalters Kranke und Behinderte, für die keine Familie sorgte, eine Zuflucht fanden. Auf Grund eines religiösen Gelübdes werden seit Jahrhunderten in Geel, im heutigen Belgien, in fast jeder Familie behinderte Menschen aufgenommen, die voll in die Gemeinschaft integriert sind.
Der Glaube, im Jenseits für gute Werke hier auf Erden belohnt zu werden, ist vielen fragwürdig geworden. Doch er war im katholischen Mittelalter tatsächlich der Antrieb für handfeste, praktische Nächstenliebe, die vielen zugute kam, die sonst elendig zugrunde gegangen wären. Geblieben ist eine andere, negative Einstellung gegenüber den Behinderten aus einer fernen Zeit, in der selbst die Frömmigkeit der Gebildeten nicht ohne Magie und Dämonenglaube auskam. Der Teufel war eine Realität, und er verkörperte sich in jenen Menschen, die sichtbar von der Norm abwichen, die fremd und abstoßend waren.
«Wechselbalg» nannte man im Mittelalter ein schwer geistig und körperlich behindertes Kind und war überzeugt, daß es vom Teufel gezeugt oder untergeschoben sei. Martin Luther wurde bei Tisch mehrmals auf einen solchen «Wechselbalg» angesprochen. Er nannte ihn «eine Masse Fleisch ohne Seele» und empfahl, «ihn zu ersticken», weil man dadurch dem Teufel eine Niederlage beibrachte. Noch die Nationalsozialisten haben ihr Programm zur «Vernichtung lebensunwerten Lebens» mit dem Hinweis auf Luther zu rechtfertigen versucht. Der evangelische Pastor Heinrich Matthias Sengelmann, Gründer der Alsterdorfer Anstalten für geistig Behinderte in Hamburg, hat im vorigen Jahrhundert Luther in diesem Punkt ausdrücklich widersprochen und seine Zeitgenossen darauf aufmerksam gemacht, wie fließend die Linie zwischen «normal» und «unnormal» ist: «Wo sollte die Grenze sein und wer sollte sie bestimmen? Wer sollte sagen: Dies Kind muß, jenes darf nicht getötet werden?» An den Teufel glauben viele Christen nicht mehr, aber immer noch stellen sich irrationale Gedanken und abwehrende Gefühle beim Anblick von Behinderten ein. Als habe ein dunkles Schicksal die Eltern strafen wollen; als sei Behinderung selbstverschuldet; als könne in einem gestörten Körper keine Seele wohnen.
Während der Französischen Revolution wurden die Geisteskranken aus ihren menschenunwürdigen Verliesen befreit. Die Aufklärung brachte Pädagogen, Mediziner und auch Geistliche zu der Überzeugung, daß jeder Mensch – auch der «schwachsinnige» und körperlich behinderte – erziehbar ist. Der Schweizer Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi schrieb gegen Ende des 18. Jahrhunderts, daß «auch Kinder von äußerstem Blödsinn, die durch gewohnte Härte dem Tollhaus geopfert werden, durch liebreiche Leitung … vom Elend eines eingesperrten Lebens errettet und zur Gewinnung ihres Unterhalts und zum Genuß eines freien und ungehemmten Lebens geführt werden können».
Auch die neuen christlichen «Anstalten für Schwachsinnige», die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in zunehmender Zahl gegründet wurden, ließen sich von diesem modernen Geist anstecken. Bethel bei Bielefeld, das 1867 auf Initiative des Pastors Friedrich von Bodelschwingh entstand, soll für viele stehen. Es war und ist ein Ort für die Schwächsten in unserer Gesellschaft. Es waren evangelische und katholische Geistliche und Mitarbeiter in den Anstalten überall im Land, die alles taten, um während der NS-Zeit das verbrecherische «Euthanasie-Programm» zu stoppen und die Heimbewohner vor der Ermordung zu bewahren. Zwischen 1939 und 1945 sind über 100000 Behinderte – Erwachsene und Kinder – von den Nazis umgebracht worden. Aber die Frage, ob die Kirchen mit den Unmenschen zu sehr paktierten, um ihre Schützlinge zu retten, ist so abwegig nicht. Vieles spricht dafür, daß sie – bei aller Fürsorge – damals von der jahrhundertealten Überzeugung nicht loskamen, daß Behinderung Strafe oder Schuld der Eltern ist, die sie als göttliche Warnung klaglos erdulden mußten.
Die «Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens» war keine Erfindung der Nationalsozialisten. Dafür plädierten in der gleichnamigen Schrift 1920 der Jurist Karl Binding und der Psychiater Alfred E. Hoche. Der Fortschrittsglaube des 19. Jahrhunderts, von gewaltigen Erfolgen auf den Gebieten der Technik und Industrialisierung, der Wirtschaft und der Naturwissenschaften genährt, hielt alles für machbar, alle Krankheiten in naher Zukunft für heilbar. Angefeuert von einem primitiven Darwinismus, der die Parole in Umlauf brachte, daß auch im menschlichen Bereich sich am Ende der Stärkste und Beste durchsetzt, wurde alles unter dem Aspekt der Nützlichkeit betrachtet. Auf dem 5. Kongreß für Heilpädagogik 1930 in Köln empfahl der Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Köln seinen Zuhörern, «davon Abstand zu nehmen, hochgradig Schwachsinnige mit unendlicher Mühe zu fördern, mit dem Endergebnis, daß sie vielleicht etwas hinzugelernt haben, aber doch niemals sozial brauchbar werden». Theorien, daß Schwachsinn erblich sei und geradewegs in die Kriminalität führe, wurden auf solchem Nährboden dankbar aufgenommen, zumal sie von anerkannten Medizinern und Juristen verbreitet wurden.
Es verwundert nicht, daß die staatlichen Hilfsschulen – zuerst 1859 in Preußen gegründet – sich nach 1933 nicht mehr als Förderung für den einzelnen verstanden, sondern nur noch «die Gefahr einer kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Volksschädigung» abwenden wollten. Die Sonderpädagogik sprach selbst von «völlig Bildungsunfähigen», und der Staat zog 1938 die Konsequenzen. Ein Reichsschulpflichtgesetz trat in Kraft, dessen § 11 bestimmte: «Bildungsunfähige Kinder und Jugendliche sind von der Schulpflicht befreit». Eine schlimme «Schulweisheit», an der unser abendländisches Erbe nicht unschuldig ist: Als ob Bildung nur mit dem Kopf zu tun hat; als ob nicht jedes Kind Anspruch darauf hat, entsprechend seinen Fähigkeiten in der Schule gefördert zu werden. Der Paragraph 11 wurde nach 1945 in der gesamten Bundesrepublik übernommen. Wer in der Hilfsschule nicht mitkam, wurde vom Schulunterricht «befreit». Die Allgemeinheit hatte ihre Schuldigkeit getan. Der Behinderte wurde in die Familie abgeschoben. Finanzielle Hilfen waren weitgehend unbekannt. Heimplätze gab es kaum. Die Familie mußte für ihren Behinderten dasein. Rund um die Uhr. Lebenslänglich.
Das blieb so bis Ende der 50er Jahre. Wo alle für das Wirtschaftswunder schufteten, dachte keiner an die, die nicht die Ärmel hochkrempeln konnten. Es waren die Eltern der behinderten Kinder, die endlich nicht mehr alles schweigend erdulden wollten. Als erste bundesweite Verbände wurden 1958 die «Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind» und 1959 der «Bundesverband für spastisch gelähmte und andere Körperbehinderte» als Selbsthilfegruppen von Eltern gegründet. Langsam wachten die Experten und Politiker auf. In einem «Gutachten der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder zur Ordnung des Sonderschulwesens» von 1960 steht der Satz: «Diejenigen Kinder, deren Erziehbarkeit und Bildbarkeit so gering sind, daß sie weder in Schulen noch in Heilpädagogischen Kindergärten gefördert werden können, haben auch ein Anrecht darauf, als Menschen beachtet und behandelt zu werden.» Ein bißchen spät wurde den Pädagogen klar, wie kopflastig der europäische Mensch ist und wie er über seinen geistigen Höhenflügen den Körper so weit vergessen und vernachlässigt hat, daß nur der als Mensch galt, der seinen Verstand im Sinne traditioneller Schulbildung weiterentwickelte. Verdrängt und ignoriert wurde, wie sehr Körper und Geist zusammenhängen. Was für eine unendliche Anstrengung es für einen Menschen bedeuten kann, einen gefüllten Löffel geradewegs in den Mund zu führen, wenn die kleinen grauen Zellen aus irgendeinem Grund falsch programmiert sind oder teilweise ausfallen.
Die Gedanken sind frei … Ein schöner und wahrer Satz. Nur dürfen wir nicht vergessen, daß Freiheit und Unabhängigkeit für manche Menschen ganz andere, aber nicht weniger wichtige Dimensionen haben. Unabhängigkeit für einen behinderten Menschen kann bedeuten, selber zu essen und nicht gefüttert zu werden; mit dem Blindenstock zu gehen und nicht geführt zu werden; seine Wünsche zu artikulieren oder sichtbar zu machen, um nicht ständig das tun zu müssen, was andere ihm vorschreiben; ohne Gehör und ohne Sprache mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen und Emotionen auszutauschen; zwischen Marmelade und Wurst wählen zu können, statt hilflos essen zu müssen, was man vorgesetzt bekommt.
Wenn Wissen, wenn Bildung frei machen, müssen sie auch diese Dimensionen des Menschen umfassen. Chancengleichheit in der Bildung heißt dann für Behinderte, die Möglichkeit zu haben, sich solche Fähigkeiten aneignen zu können. Etwas zu lernen und immer wieder üben zu können – vielleicht über Monate und Jahre –, das der Nichtbehinderte ohne Anleitung gleichsam im Vorübergehen aufnimmt. Es muß für die Eltern behinderter Kinder bedeuten, für solche Einrichtungen, die ein Grundrecht einlösen, nicht extra zur Kasse gebeten zu werden. Wenn wir alles tun, um die Klügsten zu fördern, mit welchem Recht halten wir uns bei denen zurück, die auf Grund körperlicher oder geistiger Schädigungen ein Höchstmaß an Förderung und Entwicklungshilfe brauchen?
Wir müssen endlich aufhören, das Menschsein auf bestimmte Merkmale und Fähigkeiten einzuengen. Welchen Filter wir auch zugrunde legen, immer wird es Menschen geben, die durch die Maschen fallen und diesen Ansprüchen nicht genügen. Zu Ende gedacht, führt Spezifizierung dahin, daß alle, die die aufgestellten Kriterien nicht aufweisen, diskriminiert und schließlich «ausgemerzt» werden, weil sie keine «richtigen» Menschen sind.
Für das «Wesen des Menschen» gibt es nur eine Definition: Es ist offen und nicht festgelegt; es kann sich in unzählige Richtungen entwickeln. Der Mensch ist ein Teil der Natur. Und diese Natur ist nicht auf Starrheit und Uniformität, sondern auf Flexibilität und Vielfalt angelegt. Mehrheiten neigen dazu, sich selber als Norm hinzustellen. Das ist legitim, solange alle, die außerhalb dieser Norm leben, in ihrem Anderssein anerkannt und gleichberechtigt sind. Solange sie nicht zu Außenseitern werden und als Sündenböcke zur Zielscheibe der Aggressionen aller «normalen» Zeitgenossen.