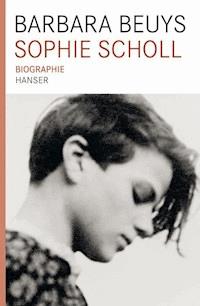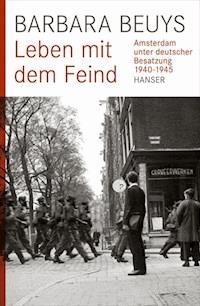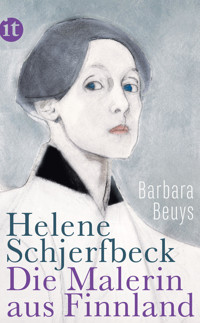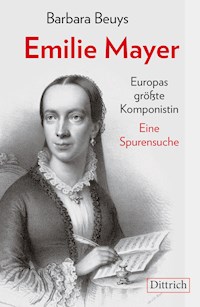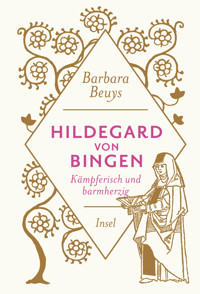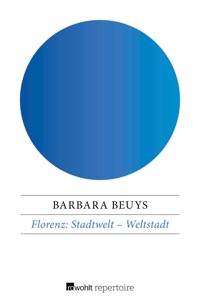Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sexismus und Emanzipation – die Wurzeln der heutigen Diskussion liegen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Im deutschen Kaiserreich gewinnen die Frauen an Einfluss und werden allmählich zu einem wichtigen Teil des öffentlichen Lebens. Sie sind erstmals berufstätig, sind Ärztinnen und Künstlerinnen, arbeiten in Büros und Postämtern und setzen sich für das Wahlrecht ein. Frauenvereine bringen Themen wie Sexualität und Scheidung zur Sprache. Doch mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs findet die soziale Revolution ihr vorläufiges Ende. Barbara Beuys beschreibt lebendig und anhand vieler Lebensbilder den Ausbruch der Frauen aus dem alten Geschlechtermodell. Eine große Erzählung von der Gesellschaft vor hundert Jahren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Barbara Beuys
Die neuen Frauen –
Revolution im Kaiserreich
1900–1914
Carl Hanser Verlag
ISBN 978–3–446–24542-6
Alle Rechte vorbehalten
© Carl Hanser Verlag München 2014
Schutzumschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München Motiv: © akg-images
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Inhalt
Vorgeschichte
Wurzeln: »Die Freiheit ist unteilbar«
Mit der Zeitung für die Revolution – Mit dem Gesetz gegen politische Teilnahme – Louise Otto, Auguste Schmidt und Henriette Goldschmidt gründen einen Verein
»Also vorwärts«: Studium jenseits der Grenze
Franziska Tiburtius: Examen in Zürich, Ärztin in Berlin – Bürgerinnen im neuen Reich – Hedwig Dohm: Menschenrechte haben kein Geschlecht – Professor Treitschke: Gegen Frauen und Juden – Erste weibliche Poliklinik
Höhere Töchter: Zur Heirat verdammt?
Das »Paradepferdchen« bricht mit dem Bürgertum – Gabriele Reuter: Aus Ägypten in die Provinz – Agnes Bluhm: Umweg als Lehrerin – Clara Zetkin: Harte Jahre in Paris – Ein Backfisch träumt vom hohen Turm – Helene Langes »Gelbe Broschüre« macht Schlagzeilen – Die Kronprinzessin: Das Ende der Hoffnungen
Die Emanzipation nimmt Fahrt auf
Als Journalistin für die SPD nach Stuttgart – Als fünfte Ärztin nach Berlin – Stille Tage in München und eine zündende Idee – Ein Frauen-Netzwerk entsteht – Alice Salomon und die »Mädchengruppen«
»Nicht bloß wegen der Männer auf der Welt«
Durch Heirat von Elberfeld nach Berlin: Else Lasker-Schüler – Zum Gymnasialkurs: Hermine Edenhuizen setzt sich durch – Lebensgemeinschaften – Skandalös: Gabriele Reuters Bestseller – Die Schlacht um das BGB – Minna Cauer: Radikal, aber solidarisch – Henriette Fürth: Acht Kinder und berufstätig
»Das Recht der Frau, über sich selbst zu verfügen«
Frauenclubs: Für Arbeiterinnen und Bürgerfrauen – Demütigend: 2 Frauen unter 300 Studenten – Emanzipation in der Mädchenliteratur –
Frauen gehen auf Kreuzfahrt – Paula Becker: Ein eigenes Zimmer
in Worpswede – Clara Zetkin heiratet einen Jüngeren –
Else Lasker-Schüler verrät den Vater ihres Sohnes nicht
Ab 1900
Von Männerbünden und weiblichen Marksteinen
Eine Welt ohne Scham und Zucht – Bei Siemens: Eine Frau übernimmt – Breslau: Clara Immerwahr, die erste Chemikerin – Karen Danielsen: Die »sexuelle Frage« taucht auf – »Die Frau als Hausärztin« klärt auf – Konkurrenz: Mit allen Mitteln gegen Ärztinnen – Alice Salomon:
Kuchen und Sahne zur Promotion
Gegen viele Widerstände: Frauen erobern neue Berufe
Weibliche Profis im Fürsorgeamt – Das Frankfurter Modell – Die besseren Nerven: Das Fräulein vom Amt – Schrille Propaganda für die Frau am Herd – Erfolgreich: Der Internationale Frauenkongress – Am Kaiserhof:
Verstaubter Glanz – Katholische Frauen emanzipieren sich
Beruf und Familie – geht das? Es geht!
Scheidung – geht das? Es geht!
Arbeitsehe in Worpswede: Der Ehemann ist einverstanden – Ein eigenes Zimmer: Clara Habers Ehemann grollt – Henriette Fürth ernährt die Familie – Das Ende des Tabus: Scheidung im Kaiserhaus – Else Lasker-Schüler: Die neue Liebe ist ein junger Mann – Lehrerinnen bleiben ledig – Neue Diakonissen werden selbständig
Sex vor der Ehe – warum nicht?
Mütter müssen immer bei ihren Kindern sein – eine Lüge!
Eine Beziehung zu Dritt und kein Duell – Heirat: Karen Horney, geb. Danielsen – Elisabeth Macke: Die Braut ist schwanger – Die Angst der Männer vor dem Weiber-Staat – Das Vereinsverbot fällt – Alice Salomons Werk: Die Soziale Frauenschule – Henriette Fürths Utopie: Ganztagsschulen – Paul genießt das Landschulheim
Rassenhygiene: Die Neue Frau und der Neue Mensch
Gabriele Reuters »Tränenhaus«: Die Schande unehelicher Kinder – Wer ist Lili? – Der Bund für Mutterschutz und die freie Liebe – Zuchtwahl: Fremdbestimmung oder Emanzipation? – Ida Gerhardi: Kunstagentin zwischen Paris und Berlin – Zarathustra: Held der jungen Frauen
Skandal: Der Kaiser und seine weibischen Freunde
Auf der Anklagebank: Homosexualität – Asta Nielsen:
Das Kino ist weiblich – Hermine Edenhuizen: Flucht von Köln
nach Berlin – Karen Horney schafft Familie und Studium –
Else Lasker-Schüler: Ruhm, Scheidung und kein Geld – Frankfurt: Erfolgreicher Frauen-Protest
Gegen den Trend: Die Antifeministen verbünden sich
Für das Wahlrecht auf die Straße – Katholikinnen werden politisiert – Berlin im Glanz des Frauenkongresses – Lehrer und Postbeamte fürchten weibliche Konkurrenz – Partnertausch in Lankwitz – Heirat nur mit Ehekontrakt – Starke Frauen im Film – Rassenhygieniker fordern »neuen Gebärtyp« – Vertriebsleiterin mit Prokura
Das Jubeljahr 1913: Frauen setzen Akzente
Auch die Mädchen sind dabei – Männlicher Heldentod: Sterben
ist tabu – Mutter-Blut macht Staatsbürger – Der Streit um
den Gebärstreik – England: Bürgerkrieg ums Stimmrecht –
Ein mutiger Film: »Die Suffragette« – Karen Horney: Ärztin,
zwei Kinder und Freud’sche Abende – Elisabeth Macke: Mit Baby nicht zum Festbankett
Sommer 1914 – Die Frauenbewegung und der Burgfriede
Gut vernetzt: Kongress in Rom – Alice Salomon fährt nach Dublin – August 14: Kein ungeteilter Kriegsjubel – Gertrud Bäumer gewinnt die SPD-Frauen – Clara Zetkin: Allein gegen den Krieg – Henriette Fürth fordert patriotische Opfer – Lily Brauns Roman: Einsatz für das Vaterland
Der Krieg: Kein Motor für die Emanzipation
Anita Augspurg: Kampf gegen das Ende der internationalen Frauensolidarität – Therese von Bayern: Pazifistin im Königshaus – Johanna Boldt schmeißt den Laden – Elisabeth Macke: Mitwisserin des Grauens – Clara Immerwahr: Tödliche Verachtung für den Ehemann –
Karen Horney macht Schluss mit dem Penisneid
Anhang
Verzeichnis der Abbildungen
Literatur
Register
Vorgeschichte
Wurzeln: »Die Freiheit ist unteilbar«
Mit der Zeitung für die Revolution – Mit dem Gesetz gegen politische Teilnahme – Louise Otto, Auguste Schmidt und Henriette Goldschmidt gründen einen Verein
Welch ein Ziel, was für eine Aufgabe: »Dem Reich der Freiheit werb’ ich Bürgerinnen.« Es ist das Motto der Frauen-Zeitung, deren »No. 1« mit dieser Unterzeile am 21. April 1849 erscheint und die sich in aufgewühlten Zeiten vier Jahre auf dem Zeitungsmarkt halten kann. Herausgeberin ist die dreißigjährige Schriftstellerin Louise Otto, eine »Tochter aus gutem Hause« in Meißen, die mit knapp siebzehn Jahren Waise geworden war und in allem Unglück das große Glück hatte, ein ausreichendes Erbe anzutreten: Sie war nicht, wie die meisten ihrer bürgerlichen Zeitgenossinnen, auf eine Heirat zur Versorgung angewiesen. Das junge Mädchen fühlte sich zur Schriftstellerin berufen, und das war auch die einzige Berufsmöglichkeit für Frauen ihres Standes, weil es dazu keiner professionellen Ausbildung bedurfte. Denn dergleichen gab es nicht für sie, mit Arbeit hatten nur Arbeiterinnen etwas zu schaffen. Am zierlichen Schreibtisch mit Feder und Tinte zu hantieren und romantische Fantasien aufs Papier zu bannen, das passte gerade noch ins bürgerliche Frauenbild.
Aber Louise Otto ging es nicht um schöne Geschichten. Sie wollte durch ihr Schreiben »nicht allein in und mit meiner Zeit leben, sondern auch für sie«. Zielstrebig und selbstbewusst hatte sie sich mit Gedichten, engagierten Zeitungsartikeln und sozialkritischen Romanen einen Namen gemacht. Ihr war früh klar geworden: Nur wer als Frau den Schritt auf die Bühne der Öffentlichkeit wagte, die nach herrschender Sitte und Moral ausschließlich von Männern besetzt war, konnte Aufmerksamkeit wecken für eine Idee, eine gerechte Sache. Louise Otto war entschlossen, den Frauen eine Stimme zu geben.
Mit einem Leserbrief an die Sächsischen Vaterlandsblätter in Dresden mischte sich Louise Otto 1843 in die Diskussion um »die Teilhabe des weiblichen Geschlechts am Staatsleben« ein. Von da an wurde der Bereich Frauen und Politik zu ihrem Lebensthema, vor allem in ihren Zeitungsartikeln. Oft war sie für längere Zeit in Leipzig, der Stadt der Verlage, Schriftsteller und Künstler, und knüpfte als alleinstehende Frau viele Beziehungen. Mit Robert Blum, dem radikalen Demokraten und Herausgeber der Sächsischen Vaterlandsblätter, und seiner Frau war sie eng befreundet. Als 1846 ihr Roman Schloss und Fabrik erschien, hatte zuvor der staatliche Oberzensor eingegriffen und damit das Aufsehen um die mutige Verfasserin und ihr sozialkritisches Werk noch vergrößert.
Zwei Jahre danach, im Februar 1848, jagten die Pariser ihren König davon, und der revolutionäre Funke sprang auf die deutschen Länder über. Studenten und Professoren, Kaufleute, Rechtsanwälte und Handwerker gingen auf die Straße und forderten in hitzigen Versammlungen von ihren Landesfürsten Freiheit und demokratische Verfassungen. Zum Zeichen ihrer Solidarität und demokratischen Gesinnung ließ Louise Otto an ihrem Haus in Meißen »triumphierend« die schwarz-rot-goldene Fahne flattern, das Symbol der Revolution. Es blieb nicht bei symbolischen Handlungen.
»Wohlauf denn, meine Schwestern,« fordert sie in der ersten Nummer der Frauen-Zeitung im April 1849, »vereinigt Euch mit mir, damit wir nicht zurückbleiben, wo alles um uns und neben uns vorwärts drängt und kämpft. Wir wollen auch unser Teil fordern und verdienen an der großen Welt-Erlösung, welche der ganzen Menschheit, deren eine Hälfte wir sind, endlich werden muss. Wir wollen unser Teil fordern: das Recht, das Rein-Menschliche in uns in freier Entwicklung aller unserer Kräfte auszubilden, und das Recht der Mündigkeit und Selbständigkeit im Staat.« Über ein Jahr alt war die Revolution nun. Triumph und Scheitern lagen dicht beieinander.
In den deutschen Fürstentümern und Königreichen hatten die Herrscher unter dem öffentlichen Druck die Minister des alten Regimes entlassen und liberale eingesetzt; die Zensur bei Zeitungen und Schriften aller Art abgeschafft, gleiches Recht für alle versprochen. Und der revolutionäre Schwung sollte mit der Freiheit auch die nationale Einheit bringen. Im Mai 1848 versammelten sich in der Frankfurter Paulskirche rund achthundert Abgeordnete zum ersten gesamtdeutschen Parlament, gewählt von Männern über fünfundzwanzig, die einen selbständigen Beruf hatten. Es sollte eine Verfassung beschließen für einen Staat, in dem endlich alle Deutschen – so wie Engländer oder Franzosen – in einer Nation zusammenlebten.
Louise Otto unterstützt die Revolution von 1848, gründet die erste gesamtdeutsche Frauenzeitung, schreibt populäre Romane, engagiert sich für die Arbeiterinnen und fordert 1871 Mitbestimmung der Frauen im Deutschen Reich.
Nach endlosen Debatten, von vielen Frauen auf der Galerie der Frankfurter Paulskirche mit Missfallen oder Zustimmung begleitet, einigte sich die Mehrheit der Abgeordneten auf eine Verfassung für ein einiges Deutschland. An der Spitze des neuen Deutschen Reiches sollte als Kaiser der Deutschen der König von Preußen stehen, nicht als Fürst von Gottes Gnaden, sondern ein Souverän des Volkes. Im Januar und März 1849 wurden die »Grundrechte des deutschen Volkes« und die neue Verfassung rechtskräftig als Reichsgesetze verkündet.
»Dem Reich der Freiheit werb’ ich Bürgerinnen«: Louise Ottos Unternehmung einer Frauen-Zeitung hatte mit den Erfahrungen zu tun, die Tausende von Frauen im Revolutionsjahr 1848 gemacht hatten. Als Gefährtinnen im Kampf für die Freiheit, die demokratische Frauenvereine zur Unterstützung gründeten, Geld sammelten, Fahnen bestickten, Flugblätter entwarfen und verteilten, gefährliche Kurierdienste taten, vereinzelt sogar auf Barrikaden standen, waren sie den Männern willkommen. Doch wo es ums Grundsätzliche ging, da standen die Helferinnen abseits und alleine. Louise Otto hat gleich auf der zweiten Seite der ersten Nummer der Frauen-Zeitung scharf und nüchtern analysiert, was die Revolution den Frauen gebracht hat: »Und nun lasst uns einmal fragen, wie viele Männer gibt es denn, welche, wenn sie durchdrungen sind von dem Gedanken, für die Freiheit zu leben und zu sterben, diese eben für alles Volk und alle Menschen erkämpfen wollen? Sie antworten gar leicht zu Tausenden mit Ja! Aber sie denken bei all ihren endlichen Bestrebungen nur an eine Hälfte des Menschengeschlechts – nur an die Männer. Wo sie das Volk meinen, da zählen die Frauen nicht mit. Aber die Freiheit ist unteilbar!« Ein kurzer Blick in die Gesetze für den neuen deutschen Staat, der doch ein demokratischer sein soll, genügt: Louise Otto fordert eine Revolution in der Revolution. Denn am Eingang zum Reich der Freiheit, das die Paulskirchen-Männer geschaffen hatten, steht: Für Frauen kein Zutritt.
In den Grundrechten der neuen Verfassung heißt es in Artikel 2 § 7: »Die Deutschen sind vor dem Gesetze gleich.« Und in Artikel 6 § 28: »Es steht einem jeden frei, seinen Beruf zu wählen und sich für denselben auszubilden, wo und wie er will.« Die Sprache verrät es: damit waren nur die Männer gemeint. Die Diskriminierung der Frauen in allem, was Politik, Bildung, Rechte und Teilnahme am öffentlichen Leben betraf, war so tief verankert, dass es keiner Worte bedurfte.
Eine berufstätige Bürgerstochter? Unmöglich, undenkbar: Für Mädchen war auch im demokratischen Staat nicht an eine schulische Bildung gedacht, die über das Abitur an die Universität führte – das blieb Männersache. Wer unbedingt über Sticken und Klavierspielen hinaus tätig werden wollte und kein Talent zum Schriftstellern hatte, für den gab es seit den 1840er Jahren private höhere Töchterschulen mit angeschlossenem privatem Lehrerinnenseminar. Bedingung für diesen einzigen bürgerlichen Frauenberuf mit Ausbildung, so diffus sie auch war: zölibatär zu leben. Wenn eine Frau heiratete, war sie automatisch entlassen, denn mit der Heirat hatte sie ja ihren eigentlichen Beruf ergriffen: als Ehefrau und Mutter zu leben. In der Politik galt das gleiche Ausschlussverfahren: Die Revolutionäre von 1848/49 hatten nur Männern das Wahlrecht zugestanden, um männliche Abgeordnete für den Reichstag zu wählen. Wähler oder wählbar ist »jeder unbescholtene Deutsche« heißt es im Reichsgesetz vom 12. April 1849, und das war wörtlich zu nehmen.
Louise Otto will die Opferrolle von Frauen abschaffen. Die Frauen-Zeitung ist ihr Angebot und eine Plattform für alle »Schwestern«, den Kampf für Freiheits- und Menschenrechte selber in die Hand zu nehmen: »Wir wollen unsere Kräfte aufbieten, … dass wir den großen Gedanken der Zukunft: Freiheit und Humanität (was im Grunde zwei gleichbedeutende Worte sind) auszubreiten suchen in allen Kreisen, welche uns zugänglich sind …« Eine tollkühne Vision, quer zu allen Strömungen und Machtverhältnissen der Zeit: Für Louise Otto gehört die »Frauenfrage« in die Mitte von Politik und Gesellschaft. Bescheidenheit ist weder Frauen-Zier noch weibliche Tugend. Die Frauen »werden sich vergessen sehen«, wenn sie »vergessen, selbst an sich zu denken«.
Die Botschaft von politischer Freiheit und Emanzipation der Frauen geht an Leserinnen aus bürgerlichem Hause. Aber Louise Otto legt ihnen eindringlich ans Herz: auch mit denen solidarisch zu sein, »welche in Armut, Elend und Unwissenheit vergessen und vernachlässigt schmachten«. Gemeint sind die Arbeiterinnen. Auch das ist eine revolutionäre Forderung, denn zwischen ihnen und den Frauen des Bürgertums klafft ein Abgrund. Die Herausgeberin schließt ihr Editorial selbstbewusst mit einem Appell: »Wohlauf, meine Schwestern, helft mir zu diesem Werke!«
Drei Tage nach dem erstmaligen Erscheinen der Frauen-Zeitung lehnte der preußische König am 24. April 1849 ab, wofür sich die Mehrheit der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche ausgesprochen hatte: Er sollte Kaiser aller Deutschen werden. Doch im Berliner Schloss dachte man anders: Ein Herrscher von Volkes Gnaden – niemals. Ein König war nur seinem Gott verantwortlich. Damit lag die gesamte Verfassungskonstruktion für das neue Deutsche Reich in Trümmern. Für die adligen Machthaber in den übrigen deutschen Ländern war es das Signal, die liberalen Minister wieder zu entlassen, die mit liberalen Bürgern besetzten Parlamente aufzulösen und die alten feudalen undemokratischen Zustände wiederherzustellen.
Nicht alle, die auf die Freiheit gesetzt hatten, resignierten. In Sachsen, im Rheinland, in Baden brachen Aufstände aus und Frauen machten mit. In der fünften Ausgabe vom 19. Mai 1849 – die Frauen-Zeitung erschien immer samstags – stand unter der Rubrik »Blicke in die Runde«: »An dem Kampf des sächsischen Volkes in Dresden vom 3. bis 9. Mai haben auch viele Frauen teilgenommen, und zwar aus allen Ständen. Viele halfen mit am Barrikadenbau, schleppten Steine und Meublen herzu … Noch andere nahmen sich der Verwundeten an, verbanden sie … mitten unterm Kugel-Regen auf offner Straße oder trugen sie in ihre Häuser.« Und sie waren auch Kämpferinnen: »Eine Jungfrau, deren Bräutigam, ein Turner, am ersten Tag gefallen war, hat eine Barrikade drei Tage lang mit Löwen-Mut verteidigt und mit ihrem Pistol viele Soldaten niedergeschossen, bis sie selbst von einer feindlichen Kugel gefallen ist.«
Preußen schickte seine Truppen los. Nach blutigen Gefechten im Südwesten Deutschlands musste das restliche Heer der Aufständischen, die in der Festung von Rastatt eingeschlossen waren, im Juli 1849 kapitulieren. Führende Köpfe, Frauen inbegriffen, flohen außer Landes; die Zahl der deutschen Auswanderer in die Vereinigten Staaten von Amerika stieg in diesem Jahr auf 250 000. Die Sieger vollstreckten 27 von 61 Todesurteilen und warfen Tausende ins Gefängnis, die sich für Freiheit und Einheit engagiert hatten, sei es mit dem Schwert, sei es mit der Feder. Die bürgerliche Revolution von 1848 war gescheitert.
In den deutschen Staaten hatten wieder die konservativ-reaktionären Kräfte das Sagen. Zwar blieben die Verfassungen, die erst 1848 durchgesetzt worden waren, bestehen, aber um entscheidende Rechte bereinigt. Die deutschen Fürsten waren wieder die Herren im Land – von Gottes Gnaden. Der Adel als eigener Stand war nicht abgeschafft, wie es die demokratische Reichsverfassung vorgesehen hatte. Das Bürgertum, seine männliche Hälfte vor allem, musste weiterhin in allen Belangen hinter den Privilegien des Adels – der ein Prozent der Bevölkerung ausmachte – und seinem Herrschaftsanspruch zurückstecken. Auch den Frauen, die während der Revolution in großer Zahl gegen ihre traditionelle Geschlechterrolle rebelliert hatten, erteilte die neue alte Obrigkeit eine Lektion.
Zu den kleinen Freiheiten nach 1849 gehörte die Möglichkeit, sich je nach politischer Richtung in festen Strukturen zu verbinden. Liberale und konservative Politiker gründeten Parteien; die Arbeiter fanden sich in Vereinen zusammen. Nur die Männer natürlich, das musste nirgendwo festgeschrieben werden. Von den Liberalen bis zu den Arbeiterführern, von Rechts bis Links war man sich einig: Politik blieb Männersache. Doch die Obrigkeit war misstrauisch geworden. Die Frauenvereine, die sich während der Revolution und noch nach deren Scheitern gebildet hatten, um die Familien der getöteten und gefangenen Revolutionäre zu unterstützen, waren ihr ein Dorn im Auge. Was konnte die Frauenzimmer, waren sie erst auf den Geschmack gekommen, daran hindern, sich in Zukunft mit Männern zusammenzutun? Auch auf die Männer war kein Verlass, das hatten die vergangenen Monate gezeigt. Das Schlupfloch, das die Vereine boten, musste geschlossen werden.
Am 18. Mai 1850 schreibt Louise Otto einen langen bissigen Artikel über das neue preußische Vereinsgesetz, »eine Herabwürdigung des weiblichen Geschlechts«, die »unseres Jahrhunderts und einer aufgeklärten zivilisierten Nation unwürdig« sei. Der Kern des Gesetzes stellt die Frauen auf eine Stufe mit den Minderjährigen, den Unmündigen: »Für Vereine, welche bezwecken, politische Gegenstände in den Versammlungen zu erörtern, gelten … nachstehende Beschränkungen: a) sie dürfen keine Frauenspersonen, Schüler und Lehrlinge als Mitglieder aufnehmen; b) … Frauenspersonen, Schüler und Lehrlinge dürfen den Versammlungen und Sitzungen solcher politischen Vereine nicht beiwohnen.« Falls dennoch Frauen angetroffen werden und sich nach Aufforderung der Polizei nicht entfernen, »so ist Grund zur Auflösung der Versammlung oder der Sitzung vorhanden«.
Mit dieser Maßnahme, so Louise Otto, seien die Frauen »der heiligsten Menschenrechte beraubt« worden. Offenbar fürchte die Obrigkeit die Teilnahme der Frauen am öffentlichen Leben und verbanne sie aus den Vereinen, um sie in »Küche und Kinderstube zu kasernieren«. Wie könne Preußen, der »Staat der Intelligenz«, nur so dumm sein, denn »Gedanken sind und bleiben ewig zollfrei … trotz diesem Vereinsgesetz«. Die »deutschen Frauen« haben erkannt, »dass wir allein nur die wahre Begeisterung in der Seele der zartesten Kinder erwecken können, dass in unserer Hand die Zukunft derdeutschen Freiheit liegt«.Louise Ottos Kampfgeist war ungebrochen. Doch bis 1908 wird das Vereinsgesetz als abschreckende Drohung über allen Aktivitäten von Frauen schweben, die auch nur im Ansatz politisch genannt werden können. (Das preußische Gesetz war Vorbild für ähnliche in Bayern und Sachsen, womit de iure weit über die Hälfte der deutschen Frauen betroffen waren und de facto alle: Dass Hamburg, Bremen, Baden und Württemberg solche Verbote nicht kannten, blieb mehr als fünfzig Jahre unbekannt.)
Die Zeiten waren rauh geworden für alle, die sich keine Untertanenmentalität zulegen wollten. Doch die Herausgeberin der Frauen-Zeitung verspricht im Juni 1850 ihren Leserinnen, »ihrem Wahlspruch unwandelbar treu« zu bleiben, auch wenn sie davon ausgeht, »unter polizeilicher Aufsicht« zu stehen. Louise Otto macht keine Abstriche an der politischen Ausrichtung ihrer Zeitung, die inzwischen über Deutschland hinaus gelesen wird, in der Schweiz und in Frankreich, sogar aus New York kommt ein begeisterter Leserinnen-Brief. Als Anfang Dezember 1850 der Artikel »Ein Blick auf die politischen Gefangenen« von Louise Otto erscheint, fühlt sich die Obrigkeit von dieser Kritik so herausgefordert, dass die Ausgabe nachträglich konfisziert wird.
In der Frauen-Zeitung vom 21. Dezember 1850 informiert Louise Otto über den »§ 12 des Entwurfs eines Pressgesetzes für das Königreich Sachsen«, die nächste Diskriminierung: »Die verantwortliche Redaktion einer Zeitschrift dürfen nur … männliche Personen übernehmen oder fortführen …« Das gilt auch für die Mitredakteure. Die Herausgeberin nennt es eine »neue Unmündigkeitserklärung der Frauen«. Selbst in diesen reaktionären Zeiten ein starkes Stück, »wenn man Frauen durch ein solches Gesetz sagt, dass sie nicht fähig oder würdig sind für einen Beruf, der ihnen bisher noch niemals und nirgends streitig gemacht worden ist«.
Louise Otto will das Heft des Handelns behalten. In der folgenden Ausgabe erscheint zum 31. Dezember 1850 ihr »Abschiedswort«. Ausführlich erinnert sie an ihr »Programm« in der ersten Nummer vom 21. April 1849 und ist überzeugt: »Die Frauen-Zeitung hat gehalten, was sie versprochen … Sie hat ›dem Reich der Freiheit Bürgerinnen geworben‹, sie hat unzählige Frauen aufgeweckt aus ihrem Halbschlummer und angeregt, ›ihr Teil zu fordern‹…« Louise Otto stellt ihre Frauen-Zeitung von sich aus ein, bevor die Umstände sie dazu zwingen, und sie nimmt den Trost mit, »dass die Frauen-Zeitung heute nicht für immer begraben wird. … Es werden wieder andere, menschlichere Zeiten kommen … Dann wird die Frauen-Zeitung wieder erstehen mit neuer Kraft in dem altem Geist«. Getreu ihrer Maxime, die Sache der Frauen stets in einem politischen Gesamtzusammenhang zu sehen, stellt sie unter den Augen der Zensur ihre Vision in die Öffentlichkeit: »… dann werden wir wieder frei sprechen und schreiben dürfen, und … man wird dann keines mehr uns weigern von alle den Rechten, die jetzt vielleicht noch in Frage sind. … Bis dahin, lebet wohl – auf Wiedersehen! Die Redaktion.«
Es war nicht das Ende der Frauen-Zeitung. Von Briefen und Aufmunterungen überwältigt, den einzigartigen überregionalen Leuchtturm der Frauensache zu erhalten, macht Louise Otto am 5. Februar 1851 weiter. Um vor dem sächsischen Pressegesetz geschützt zu sein, liegt der neue Druckort in Gera im Fürstentum Reuß jüngere Linie, und die Herausgeberin gibt die Redaktionsleitung an die dortige männliche Verlagsleitung ab. Eine Formalität, Louise Otto schreibt weiterhin. Und sie nennt ihren Leserinnen den Preis für das journalistische Weiterleben: Politischen Klartext konnte sie nicht mehr schreiben, sie will sich vor allem »sozialen Angelegenheiten« zuwenden. Sie vertraut darauf, dass ihre Leserinnen zwischen den Zeilen lesen und den »Ideenschmuggel« erkennen können. Im November 1851 verspricht sie stolz, »wenigstens mit den Ketten zu klirren, die man nicht lösen kann«.
Das sächsische Innenministerium hatte inzwischen die Obrigkeit im Fürstentum Reuß informiert, dass Louise Otto sich mit ihrer Zeitung das Ziel gesetzt habe, »die Grundlagen des bestehenden Rechts und der gesellschaftlichen Ordnung zu untergraben« und »das weibliche Geschlecht zum Umsturz geneigt zu machen«. Das Frauenzimmer sei immer noch »gemeingefährlich«. Prompt durchsucht die Polizei die Druckerei und verhört den Verleger. Doch nichts Belastendes wird gefunden, die Frauen-Zeitung erscheint ungehindert bis Ende Juni 1852. Dann gibt es keine weiteren Ausgaben mehr, auch keine Erklärung, keinen Hinweis, warum. Anfang 1853 taucht sie genau so rätselhaft wieder auf, gedruckt in Leipzig, wo der neue Verleger auch die redaktionelle Leitung hat. Sie heißt nun Deutsche Frauen-Zeitung, aber Briefe von Louise Otto lassen keinen Zweifel, dass es die Fortführung ihrer Zeitung ist und sie daran redaktionell mitarbeitet.
Allerdings mehren sich die Auseinandersetzungen mit dem neuen Leipziger Verleger, sie betreffen den persönlichen Umgang wie den Inhalt der Zeitung. Zum 1. Juli 1853 wird der dritte Versuch der Frauen-Zeitung scheitern. Diesmal ist es endgültig, und Louise Otto schreibt erleichtert, »jetzt denke ich nur an den Ärger, den ich bei jeder Nr. hatte, Druckfehler u. Anderes, u. bin vollkommen ausgesöhnt mit diesem Ende«.
Die Korrespondenz mit diesen Informationen führt zu August Peters, der im Königreich Sachsen eine Zuchthausstrafe als politischer Gefangener verbüßt. Im Revolutionsjahr 1848 hatte Louise Otto den engagierten Demokraten als Herausgeber der Dresdener Wochenzeitung Die Barrikade brieflich kennengelernt. Sie schrieb für seine Zeitung, es entwickelte sich eine intensive Brieffreundschaft. Der gescheiterte Aufstand im Mai 1849 brachte Peters als aktiven Kämpfer in den Kerker. 1852 haben sich Louise Otto und August Peters verlobt. Im Sommer 1856 wurde er entlassen, gezeichnet von den brutalen Haftbedingungen. Die beiden heirateten und lebten seit 1860 in Leipzig, wo sie zusammen die Mitteldeutsche Volkszeitung herausgaben. August Peters starb 1864.
Die enorme schriftstellerische Produktion nach dem Ende ihrer Frauen-Zeitung legt Zeugnis ab, dass die vierunddreißigjährige Louise Otto ungebrochen die nächste Etappe ihres Lebens gestaltete. Fast jährlich erscheint ein Roman, mindestens in drei Bänden, in dem sie die Revolution von 1848 oder Frauenthemen behandelt. Ungebrochen ist auch ihre Fähigkeit, Menschen zu gewinnen und Netzwerke unter Frauen aufzubauen. Zu den neuen Freundinnen in Leipzig zählt bald Auguste Schmidt. Die junge Lehrerin hatte es 1861 von Breslau in die lebendige sächsische Großstadt gezogen. Leipzig bedeutete für Auguste Schmidt einen Karrieresprung, denn sie wurde Leiterin einer angesehenen »höheren Privattöchterschule«. Es dauerte nicht lange, bis die beiden Zugezogenen mit Henriette Goldschmidt bekannt wurden, der Frau des liberalen Leipziger Rabbiners. Sie engagierte sich für eine Reform der Frauenbildung und für moderne Kindergärten nach dem Modell des Pädagogen Friedrich Fröbel. Die drei Frauen trafen sich regelmäßig und haben nicht nur eine Tasse Tee getrunken.
Auguste Schmidt ist Leiterin einer angesehenen höheren Töchterschule in Leipzig und gründet 1865 mit Louise Otto und Henriette Goldschmidt den Allgemeinen Deutschen Frauenverein (ADF). Ihre Forderung: gleichberechtigte Bildung für Frauen.
Der Blick auf ihre Zeit war ernüchternd. Bei den Bürgern war der 48er-Ruf nach Freiheit und demokratischer Beteiligung – der Männer – an den Staatsgeschäften verstummt. Sie hatten sich den reaktionären Machtverhältnissen angepasst, zumal eine positive Wirtschaftsentwicklung steigenden Wohlstand brachte. Und dann wurde 1862 vom preußischen König ein neuer Ministerpräsident eingesetzt, der zwar nichts von Freiheit hielt, aber die frustrierten Liberalen mit der Aussicht köderte, unter seiner und Preußens Führung die deutsche Einheit zu verwirklichen. Welchen Weg er dazu einschlagen würde, verkündete Otto von Bismarck, der neue Ministerpräsident, im September 1862 im preußischen Abgeordnetenhaus: »Nicht auf Preußens Liberalismus sieht Deutschland, sondern auf seine Macht … nicht durch Reden oder Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden –, das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen – sondern durch Eisen und Blut.« Die Liberalen verstanden. Ihr Scheitern als Revolutionäre unter dem Motto »Durch die Freiheit zur Einheit« lag an der falschen Reihenfolge. »Einheit und Freiheit« hieß nun die Parole, für die sie sich begeisterten. Der Einheit musste sich alles unterordnen.
Louise Otto-Peters, Auguste Schmidt und Henriette Goldschmidt haben dem resignierenden Zeitgeist nicht ihre Ideale geopfert – gleiche Rechte für Frauen in allen Bereichen als Teil der Freiheits- und Menschenrechte. Sie fanden einen Weg, dem Verbot politischer Anteilnahme und Betätigung zum Trotz, wie es das Vereinsgesetz von 1850 für Frauen festschrieb, die Sache der Frauen weiterzubringen und in der öffentlichen Aufmerksamkeit zu halten.
Im März 1865 gründeten die drei Frauen den Leipziger Frauenbildungsverein; im Oktober luden sie zu einer deutschen Frauenkonferenz nach Leipzig ein und gründeten den Allgemeinen Deutschen Frauenverein (ADF). Sein Hauptzweck wurde mit § 1 der Statuten am 17. Oktober 1865 von der Konferenz verabschiedet: »Der Allgemeine deutsche Frauenverein hat die Aufgabe, für die erhöhte Bildung des weiblichen Geschlechts und die Befreiung der weiblichen Arbeit von allen ihrer Entfaltung entgegenstehenden Hindernissen mit vereinten Kräften zu wirken.« Wenn das kein politisches Ziel war, so umständlich und wenig konkret es formuliert war. Und gerade darin liegt die listige Klugheit der Gründerinnen: Bildung als Schlüssel zu erkennen, der eine ganze Welt aufschließt und hinausführt aus den traditionellen Bezügen und Fesseln, dazu fehlte den Aufsehern, Zensoren und Machthabern in den Amtsstuben jedes Vorstellungsvermögen. Der Verein wurde zum gesamtdeutschen Katalysator. In Städten und Gemeinden bildeten sich lokale Frauenvereine, um sich als gemeinsame Front in der Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen und Forderungen zu stellen.
Den drei Frauen war daran gelegen, nicht nur die Lage der bürgerlichen Frauen zu verbessern. Sie kritisierten die elenden Arbeitsumstände von Fabrik- und Heimarbeiterinnen und organisierten in Leipzig Abendschulen und Fortbildungskurse, zu denen Arbeiterinnen eingeladen waren. Dass ein moderner Verein auf die Macht der Medien angewiesen war, musste diesen Pionierinnen niemand erzählen. Schon ab Dezember 1865 gaben Auguste Schmidt und Louise Otto die Vereinszeitschrift Neue Bahnen heraus, benannt nach einem Roman von Louise Otto, der im Jahr zuvor erschienen war und sich mit dem Thema weiblicher Berufstätigkeit befasste.
Interessierte Männer waren willkommen bei der ersten gesamtdeutschen Frauenkonferenz, auch wenn der Allgemeine Deutsche Frauenverein ausdrücklich ein Verein von Frauen für Frauen war. Der Drechslermeister August Bebel, Vorsitzender des Leipziger Arbeiterbildungsvereins, war 1865 unter den Eingeladenen. Er kannte und schätzte die drei Gründerinnen. Dreieinhalb Jahre später, im April 1869, gehörte Bebel als Vorsitzender des Verbandes Deutscher Arbeiterbildungsvereine bei einer Konferenz in Eisenach zu den Mitbegründern der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Als es um die Grundsätze der neuen Partei ging, votierte die Mehrheit der Teilnehmer für die Forderung nach einem Allgemeinen Wahlrecht für alle Männer ab Zwanzig. August Bebel zählte mit seinem Antrag, auch Frauen in das Wahlrecht einzuschließen, zur Minderheit.
Und überhaupt: Wen interessierten schon Frauenfragen in diesen aufregenden politischen Zeiten. Nur neun Monate nach Gründung des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, im Sommer 1866, hatte die preußische Armee in einem Blitzkrieg Österreich geschlagen, und damit die brisante Frage entschieden, unter welcher Führung sich die einheitliche Deutsche Nation bilden sollte – Österreichs oder Preußens. Otto von Bismarck, dem preußischen Ministerpräsidenten, der diesen Bruderkrieg bewusst eingefädelt hatte, jubelte die Mehrheit der Deutschen zu und wartete gespannt auf seinen nächsten politischen Schachzug.
Louise Otto hatte den Leserinnen in der ersten Nummer ihrer Frauen-Zeitung eingeschärft: Es liegt an den Frauen, aktiv zu werden. Im November 1867 trauten sich einundneunzig großbürgerliche Frauen in Berlin und gründeten einen Verein für Frauen mit einem revolutionären praktischen Ziel. Es war der Verein der Berliner Künstlerinnen und Kunstfreundinnen, der schon 1868 soviel Geld von Spenderinnen und Spendern zur Verfügung hatte, dass in seiner neuen Mal- und Zeichenschule mit dem Unterricht begonnen werden konnte. Junge Frauen erhielten durch den Verein erstmals in Deutschland eine professionelle Ausbildung zur Künstlerin, denn das Studium an den Kunsthochschulen war ihnen verboten. Von einer prominenten Absolventin werden wir noch hören: Paula Modersohn-Becker wird nach der Jahrhundertwende nach Paris aufbrechen, und es in die Avantgarde der modernen Malerei schaffen.
Der Aufbruch der Frauen, die sich als »Neue Frauen« empfanden, ist eine Erfolgsgeschichte und Teil des Aufbruchs der deutschen Gesellschaft im Kaiserreich bis zum August 1914, als der Große Krieg einen tiefen Einschnitt brachte. Es ist überfällig, diesen Prozess als die Erfolgsgeschichte der Frauen zu erzählen. Sie bedeutet eine historische Zäsur, eine Revolution, die in die Geschichte von Freiheits- und Menschenrechten gehört.
Es gab innerhalb der Frauenbewegung Diskussionen und Widersprüche, heftigen Streit inbegriffen. Ja warum denn nicht? Was im Rückblick zählt, sind die radikal neuen Lebensentwürfe, die Frauenvereine erkämpften und einzelne Frauen als Pionierinnen lebten. So gesehen, wirft die Frauengeschichte auch ein Licht auf das zweite Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, als die »Frauenfrage« plötzlich wieder Gesellschaft und Politik beschäftigt und als »zeitgenössischer Feminismus« Schlagzeilen macht. Ungelöste Fragen erscheinen modern und aktuell, für die schon vor über hundert Jahren engagierte Frauen gerechte Lösungen gefordert haben.
So wie die Wurzeln der Frauenbewegung bis in die Revolution von 1848 reichen, gehört zum Kern deutscher Geschichte, wie im Kaiserreich zwischen 1871 und 1900 Frauen Breschen in ideologische Mauern schlugen, und sich zusammentaten, um Reformen einzufordern. Diese Zeitspanne, als vieles im Werden war und sich die Gegner der Emanzipation mit schrillen Pamphleten Gehör verschafften, hat jene Frauen geprägt, die dann nach 1900 auf breiter Front in die Öffentlichkeit traten und der Neuen Frau endgültig Kontur gaben.
»Also vorwärts«: Studium jenseits der Grenze
Franziska Tiburtius: Examen in Zürich, Ärztin in Berlin – Bürgerinnen im neuen Reich – Hedwig Dohm: Menschenrechte haben kein Geschlecht – Professor Treitschke: Gegen Frauen und Juden – Erste weibliche Poliklinik
Aufgebrochen war sie weit im Osten, von der Insel Rügen, wo sie den Bruder gesundpflegte, der sich ein Jahr zuvor, mitten im deutsch-französischen Krieg, als Militärarzt mit Typhus angesteckt hatte. Es war ein »melancholischer« Tag im Herbst 1871, als Franziska Tiburtius quer durch Deutschland in Richtung Südwesten fuhr, am Schwarzwald den Rhein entlang nach Süden. Der Tag »ging in einen finstern, sternenlosen Abend über, als der Zug in den Bahnhof von Zürich einfuhr«, schreibt sie Jahrzehnte später im Rückblick auf ihr Leben. Am nächsten Morgen war der Blick frei auf den See und die Weite der Berge – »also vorwärts«.
Erinnerungen hatten die lange Bahnfahrt begleitet. In der Rückschau sah Franziska Tiburtius »jenes kleine braune Ding mit den fliegenden Zöpfen, wehendem Kleidchen und flinken Beinen, das wie ein getreuer Pudel hinter einer ganzen Schar Knaben und Mädchen herläuft, die über den Gutshof rasen …« und fragte sich, »ob ich das wirklich bin«. Es war eine Kindheit auf dem väterlichen Gut nahe dem berühmten Kap Arkona von Rügen, und sie das jüngste von neun Geschwistern. Der Wunsch war stark, zu lernen und sich zu beweisen, und da blieb für eine junge Frau kaum eine Wahl: Sie ging hinaus als Erzieherin, erst auf das pommersche Festland, dann, im Frühjahr 1870, zu einer Familie nach England, das war schon etwas Besonderes. Zwischen ihr und dem älteren Bruder gingen Briefe hin und her, und irgendwann deutete er vorsichtig an, dass sie ebenso wie er Talent zum ärztlichen Beruf habe.
Nein, dachte sie lange, »ich kann es nicht. Das geht nicht«. Kein weiteres Nachdenken. Aber dann lernte sie eine Kollegin ihres Bruders kennen, die in den USA das Zahnarztexamen bestanden hatte, und zurück in Deutschland, wo Frauen Abitur und Studium verboten waren, nach zähem Verhandeln die Approbation erlangte und in Berlin eine Praxis aufmachte. Als Henriette Tiburtius wird die Kollegin wenig später Franziskas Schwägerin und mit dem gelebten Beispiel ermutigt sie Franziska, etwas zu wagen, das zwar nicht in Deutschland, aber innerhalb Europas in der Schweiz realisierbar war.
An der Universität Zürich, 1833 gegründet, dürfen Frauen seit 1864 studieren. Drei Jahre später legte die erste Studentin, eine Russin, ihr Medizinexamen ab. Franziska Tiburtius ist 1871 eine von 21 Studentinnen in Zürich, 1872 werden es schon 112 sein. Die Achtundzwanzigjährige wird bei der Immatrikulation vom Rektor persönlich freundlich begrüßt, akzeptiert die Studenten-Regel, nachts keinen Lärm auf den Straßen zu machen, ein Handschlag, »und die Sache war abgetan«.
Beim ersten Erscheinen im Präpariersaal wurde es unangenehm für die wenigen Studentinnen inmitten der männlichen Übermacht: Geschrei, Gejohle, Pfiffe. Als der Professor erscheint, erwartet die Studenten ein Donnerwetter, dass ihnen der Spott für immer vergeht. Von nun an begleitet Wohlwollen die Frauen bei ihrem Studium und gerechte Behandlung. Franziska Tiburtius bleiben die folgenden fünf Studienjahre in Zürich »hell und leuchtend« in Erinnerung.
Vor allem, weil sich gleich in den ersten Tagen eine dauerhafte Freundschaft zwischen ihr und Emilie Lehmus entwickelte. Die Dreißigjährige kam aus einem Pfarrhaus in Fürth und hatte schon ein Zürcher Jahr als erste deutsche Medizinstudentin hinter sich. Die beiden Frauen arbeiteten diszipliniert zusammen und genossen an den Sonntagen die Umgebung: »Wir waren beide gut zu Fuß, liebten das Wandern …. in irgendeinem Bauernhaus gab es wohl Brot und Milch und Käse oder gute Butter. – Abends zum See zurück, um noch den Anschluss an einen Dampfer zu gewinnen, den ›Lumpensammler‹, der die verspäteten Ausflügler heimbrachte.« Es war ein glückliches, freies Leben im Schatten umwälzender politischer Veränderungen.
Als Tiburtius und Lehmus sich im Herbst 1871 in Zürich treffen, ist die eine, aus Rügen gebürtig, eine Staatsangehörige im Königreich Preußen, die andere hat die Staatsbürgerschaft des Königreiches Bayern, in dem Fürth lag. Dass sie Deutsche sind, ist mit keinem offiziellen Papier belegt, sondern eine diffuse Bezeichnung aus gemeinsamer Vergangenheit, als diese beiden Länder zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gehörten, das unter dem Ansturm Napoleons 1804 auseinandergebrochen war. Als die beiden Frauen ihr Studium begannen, hatte der preußische Kanzler Otto von Bismarck gerade durch »Eisen und Blut« sein Ziel glorios erreicht: die deutsche Einheit. Nach dem siegreichen Krieg gegen Österreich 1866, war am 2. September 1870 Frankreich von einem gemeinsamen deutschen Heer unter preußischer Führung bei Sedan vernichtend geschlagen worden. Nun gab es auf dem Kontinent kein Land mehr, das sich einem einheitlichen Deutschen Reich widersetzen würde.
Franziska Tiburtius geht 1871 als eine der ersten deutschen Frauen zum Medizinstudium nach Zürich, weil in Deutschland Frauen nicht studieren dürfen. 1876 eröffnet sie in Berlin eine Praxis, 1898 wird sie mit anderen berufstätigen Frauen den ersten Berliner Frauenclub gründen.
Überall in Deutschland brach Jubel aus über den nationalen Kreuzzug. Bei einer Siegesfeier in Leipzig im Neuen Theater stimmte am 3. September der Prolog in die nationale Begeisterung ein: »Gott hat gerichtet! Unser ist der Sieg! / Voll Lorbeern blühen die Gräber unserer Toten … es sind / Der ganzen Weltgeschichte größte Wochen!« In Berlin verkündete am nächsten Tag die Vossische Zeitung, das sei »der endliche Sieg der Wahrheit über die Lüge, … der Sittlichkeit über die Verdorbenheit, der Gesundheit über die moralische Fäulnis«. Der evangelische Pastor Friedrich von Bodelschwingh, Gründer der Anstalten in Bethel für chronisch Kranke und Behinderte, wird für den »Sedanstag« als nationalen Feiertag werben, weil an jenem Tag »die Hand des lebendigen Gottes so sichtbar und kräftig in die Geschichte eingegriffen« hat. Die sozialdemokratischen Zeitungen distanzierten sich vom »Preußenhass« einiger weniger »Vaterlandsverräter« und waren vom nationalen Gedanken »beseelt«. Nur die Katholiken standen voller Misstrauen abseits und erwarteten nichts Gutes von der preußisch-protestantischen Dominanz, wenngleich sich auch das katholische Bayern in das neue Deutsche Reich eingliederte.
Kühl kalkulierend schaffte es Bismarck in den folgenden Wochen und Monaten, auf der Woge nationaler Begeisterung und mit zähen Verhandlungen aus den deutschen Königreichen, Fürstentümern und Stadtstaaten erstmals einen einheitlichen deutschen Staat zu zimmern. Eingegangen in das kollektive historische Gedächtnis der Deutschen ist der 18. Januar 1871, als im eiskalten Spiegelsaal zu Versailles, dem Symbol einstiger französischer Größe, der preußische König zum deutschen Kaiser ausgerufen wurde. Kein Abgesandter eines Parlamentes der deutschen Länder war zugegen, dafür prägen über sechshundert Offiziere in bunten Uniformen und glänzend schwarzen Stiefeln das Bild. Noch war Krieg, und die deutschen Armeen belagerten Paris. Doch nur zehn Tage später musste Frankreich in einen Waffenstillstand einwilligen und am 10. Mai 1871 in Frankfurt am Main den endgültigen Friedensvertrag unterzeichnen. Am 28. Juni rollte in Berlin ein Zug mit neun Eisenbahnwagen ein, beladen mit der ersten Rate von insgesamt fünf Milliarden Goldfrancs Kriegsentschädigung, die das besiegte Frankreich zu zahlen sich verpflichtet hatte.
Am 10. Dezember 1871 war das Werk der nationalen Einheit vollendet: Der Norddeutsche Reichstag, das entscheidende Gremium, nimmt die Verfassung des Deutschen Reiches an, mit dem preußischen König als deutschem Kaiser. Als Kaiser wird er den Reichskanzler ernennen, – das neue gesamtdeutsche Parlament, der von Männern gewählte Reichstag, hat keinen Einfluss darauf. Der Reichskanzler wird auch immer preußischer Kanzler sein. Otto von Bismarck übernimmt als erster beide Ämter. Die nationale Einheit, ein Ziel der gescheiterten Revolution von 1848, ist endlich erreicht, auch wenn die schwarz-rot-goldene Flagge, die für Freiheit und Demokratie steht, vom neuen Deutschen Reich nicht übernommen wird. Bismarck hält von beidem nichts. Das Deutsche Reich hat am Anfang auch keine einheitliche Hymne. Dennoch: Die beiden deutschen Frauen, die mit ihrem Medizinstudium am Anfang der 1870er Jahre in Zürich einen »Sprung ins Dunkle« ohne jedes Vorbild wagen, werden in ein verändertes Vaterland zurückkehren.
Emilie Lehmus, in Zürich 1875 zum Dr. med. promoviert, zählt mit Franziska Tiburtius zu den ersten Ärztinnen in Deutschland. Die beiden gründen, obwohl ihnen die Approbation verweigert wird, in Berlin die erste Poliklinik für Frauen.
Der Jubel um die siegreich heimkehrenden Soldaten und um das neue deutsche Kaiserreich war bei den Deutschen nahtlos übergegangen in den Taumel um das Goldene Kalb, der fast die gesamte Bevölkerung erfasst hatte: Gründerzeit heißt die kurze Spanne Zeit zwischen Sommer 1871 und Frühjahr 1873 und das ist wörtlich zu nehmen. Es wird gegründet, was das Zeug hält: Aktiengesellschaften, hinter denen sich windige Klitschen verstecken oder die nur auf dem Papier existieren, werden angepriesen als gewinnträchtige Zukunftsinvestitionen. Die Milliarden Goldfrancs Kriegsentschädigung aus Frankreich kommen nicht nur dem Eisenbahnbau und der Schwerindustrie zugute; auch die Renten der Kriegsopfer werden aufgestockt. Die Aussicht auf schnellen Gewinn ist zu verführerisch, grenzenlos der Glaube an unendliches Wachstum. Zwischen 1871 und 1873 werden 726 neue Aktiengesellschaften gegründet, von 1790 bis 1870 waren es 276. Wie im Rausch wird das Geld von Groß und Klein ausgegeben und angelegt, wie im Fieber steigen die Kurse.
Nicht jeder verliert im Rausch über nationale Größe und große Gewinne seinen Verstand. Die renommierte Schriftstellerin Louise Otto, die in Leipzig lebt und als erste Vorsitzende – zusammen mit Auguste Schmidt – den Allgemeinen Deutschen Frauenverein (ADF) leitet, nutzt die veränderte politische Konstellation und den nationalen Aufbruch als neuen Schub für die alten Frauen-Forderungen. Sie hat das Leitmotiv der Revolution von 1848/49, als sie mit der Frauen-Zeitung dem »Reich der Freiheit« Bürgerinnen warb, nicht vergessen: Freiheit und Einheit – das eine ist ohne das andere nichts.
1872 erscheint Louise Ottos Roman Deutsche Wunden, der in vier Bänden einen weiten aktuellen Bogen schlägt von der Misere deutscher Kleinstaaterei vor 1871 bis zum Stolz auf das neue Einheitsgefühl und den mutigen Einsatz der Frauen in den Lazaretten während des Krieges, dem Dienst der Soldaten ebenbürtig. Dem Erfolg nach außen müssen aber Reformen im Innern der Nation folgen, zu denen »die Frauen so gut berufen wie die Männer« seien, »auch wenn sie noch nicht gleichberechtigt sind«. Die jetzt dreiundfünfzigjährige Louise Otto schließt den letzten Band der DeutschenWunden mit einer radikalen Vision: Die Gründung des neuen Reiches sei erst vollendet, wenn die Töchter Germanias, »wie es schon in den ältesten deutschen Zeiten der Fall war, mit abzustimmen haben, ob Krieg sein soll oder Frieden – erst dann werden alle deutschen Wunden geheilt sein«.
Zwei Jahre zuvor, als im Kriegsherbst 1870 der Sieg der deutschen Armeen absehbar war, hatte Auguste Schmidt in der Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins den politischen Umbruch genutzt, um für die Frauen politische Forderungen zu stellen. Alle, die seit langem für die »Frauenrechte« eintreten, schrieb sie in den Neuen Bahnen, hätten stets darauf hingewiesen, »dass die Frauen mit ihren Interessen sich nicht nur beschränken und beschränkt werden sollen auf das Haus, auf die Familie … Fordern wir nicht Alle, dass die Frau bürgerliche Rechte und Pflichten übe und erlange, wie der Mann, dass sie nicht nur Glied der Familie sei sondern auch Glied des Staates: Bürgerin?« Mit der offiziellen Aufgabenstellung, für gleiche Bildung und freie Berufsmöglichkeiten der Frauen einzutreten, hatte der ADF 1865 auf die reaktionäre Stimmung reagiert und auf das Vereinsverbot für Frauen, das jede politische Tätigkeit unmöglich machte. Louise Otto und Auguste Schmidt ließen mit dem Beginn des Kaiserreichs keinen Zweifel, dass sie im Dienst der Frauenbewegung ihren politischen Kopf weiterhin einsetzen und für die Frauen gleiche Rechte in allen Bereichen einfordern würden. Die Reaktion männlicher Zeitgenossen ließ nicht lange auf sich warten.
Die dröhnenden Parolen, die angesehene und gebildete Männer ab 1870 Schlag auf Schlag gegen die Frauenbewegung ins deutsche Land schicken, offenbart, dass die Rufer auf breiter Front von Angstfantasien bedrängt werden. Die Herren beschwören die traditionelle Aufteilung zwischen den Geschlechtern, wie sie von der Natur und von Gott für alle Zeiten vorgegeben sei: Frauen gehören ins Haus, den Männern gehört die öffentliche Bühne.
Der Bonner Geschichtsprofessor Heinrich von Sybel, Jahrgang 1817, macht 1870 den Auftakt mit seiner Schrift Über die Emanzipation der Frau: »So hat es die Natur gewollt, und so wird es im wesentlichen bleiben, … Das Gebiet der Frau ist das scheinbar Enge und Einförmige des inneren häuslichen Lebens; die Dömane des Mannes ist die weite Welt da draußen, Wissenschaft, die Rechtsordnung, der Staat.« Die Frau sei allein für »die innere Beseelung des Hauses« zuständig.
Es folgt Philipp von Nathusius, Jahrgang 1842, der sich als Verteidiger radikalkonservativer Positionen in Politik und protestantischer Theologie hervortut, 1871 mit dem Pamphlet Zur Frauenfrage: »Ihnen gelehrte Bildung zu geben, … ist eine Erniedrigung der Frauen … und zugleich eine Beraubung der Männer, die in ihrer eigenen Wissens-Plackerei darauf angewiesen sind, eine Erquickung an der ungelehrten und deshalb sehr oft klügeren und weiseren Frau zu haben.«
Die Naturwissenschaftler dürfen nicht abseits stehen, wenn es darum geht, die Bastion der männlich dominierten Welt mit allen ihren Privilegien zu verteidigen. Der Münchner Professor für Anatomie Theodor Bischoff, Jahrgang 1807, veröffentlicht 1872 seinen Beitrag Das Studium und dieAusübung der Medicin durch Frauen: »Es fehlt dem weiblichen Geschlechte nach göttlicher und natürlicher Anordnung die Befähigung zur Pflege und Ausübung der Wissenschaften und vor Allem der Naturwissenschaften und Medizin.« Grundlage dieser Feststellung ist Bischoffs Überzeugung, dass die Frau »in allen Beziehungen dem Kinde näher steht als dem Mann«. Der Professor vergisst nicht zu prophezeien, die Anwesenheit von Frauen in Gymnasien und Universitäten »gefährde das sittliche Wohl der männlichen Teilnehmer auf das allerschlimmste«.
Die Gründung von Frauenvereinen und deren Forderungen hatten die führenden Männer des öffentlichen Lebens bisher mit Nichtachtung übergangen. Doch das Netzwerk der Vereine und Frauenzeitschriften, das die Forderungen der Emanzipation im Schneeballsystem quer durchs Kaiserreich anwachsen ließ, erschreckte die Herren der Schöpfung. Und seit die Universität von Zürich Frauen offen stand und 1870/71 die ersten beiden deutschen Frauen dort mit dem Medizinstudium begannen, war Totschweigen nicht mehr möglich. Schlimmer noch: Zur gleichen Zeit erklärte ein Zürcher Professor auf die Frage: Sind die Frauen fähig, Medizin zu studieren? in der Berliner Zeitschrift Frauen-Anwalt: Frauen seien nicht nur in diesem Fach befähigt »den männlichen völlig ebenbürtige Leistungen zu erreichen«. Er geht davon aus, »dass sie sich dem Studium der Theologie, der Jurisprudenz, der Geschichte und der Naturwissenschaften mit dem gleichen Erfolg zuwenden« werden. »Wir in Zürich«, erklärt der Kollege aus der Schweiz, »sehen nicht ein, warum nicht auch Frauen umfassende Kenntnisse in Volkswirtschaft und Statistik, in Finanzwissenschaften und Verwaltungswesen sich erwerben und in öffentlichen Stellungen verwerten sollen.« Ausdrücklich bezeichnet er höhere politische Ämter als Frauen-kompatibel.
Für Deutschland eine Horrorvorstellung. Wer hier Rang und Namen hatte, vom äußersten rechtskonservativen bis zum liberalen Flügel, fühlte sich in den 1870er Jahren berufen, sich mit schärfsten Attacken gegen den Untergang der männlich regierten Welt zu stemmen. Selbst der Mediziner Rudolf Virchow, eine Leuchte seines Faches, berühmt für seine bahnbrechenden Forschungen wie seine fortschrittlich-liberale Haltung in sozialen und politischen Fragen, reiht sich ein in die Front derer, die vehement das traditionelle Frauenbild verteidigen.
Über die Revolutionäre von 1848, in deren Reihen auch Virchow kämpfte, hatte Louise Otto nüchtern bemerkt, wenn sie lautstark »Freiheit« rufen, dann »zählen die Frauen nicht mit«. Für die einflussreichen Liberalen im Deutschen Kaiserreich hatte sich daran nichts geändert, das machte Professor Virchow in seinem Aufsatz Das Weib und die Zelle überdeutlich: »Das Weib ist eben nur Weib durch seine Generationsdrüse; alle Eigentümlichkeiten seines Körpers und Geistes oder seiner Ernährung und Nerventätigkeit: die süße Zartheit und Rundung der Glieder … jener schöne Schmuck der Kopfhaare … diese Tiefe des Gefühls … diese Sanftmut, Hingebung, Treue – kurz alles, was wir an dem wahren Weibe Weibliches bewundern und verehren, ist nur eine Dependenz des Eierstockes.« Eine Zelle, das ist logisch, hat keinen Anspruch auf Selbstbestimmung und Freiheitsrechte.
Das Gesetz von 1850, das Frauen verbot, an politischen Versammlungen teilzunehmen oder sich gar in politischen Vereinen zu organisieren, galt auch im neuen deutschen Kaiserreich. Die Strategie der Leipziger Gründungsfrauen Louise Otto und Auguste Schmidt bewährte sich: Als der Allgemeine Deutsche Frauenverein mit seinen vielen »Ablegern« in ganz Deutschland ab 1865 gleichberechtigte Bildungschancen forderte, öffnete sich zugleich eine Diskussionstür für politische Gleichberechtigung, ohne dass die Obrigkeit gemäß dem Vereinsverbot gegen die Frauenvereine vorgehen konnte. Denn Otto und Schmidt erkannten, dass Politik sich keineswegs nur auf Parteien und Wahlrecht, – so wichtig sie sind –, beschränkt, sondern in der modernen Gesellschaft über viele Organisationsformen gestaltbar ist.
Ein Glücksfall kam hinzu: Eine kluge Einzelkämpferin widerlegte mit Ironie, Witz und scharfem Verstand in vier Schriften zwischen 1872 – Was diePastoren von den Frauen denken – und 1876 – Der Frauen Natur und Recht – die Vorlagen der elitären Verteidiger der »Herrenrechte«. Hedwig Dohm, Jahrgang 1831, hatte 1853 das Lehrerinnenexamen gemacht, aber sogleich in Berlin Ernst Dohm, den Chefredakteur der politisch-satirischen Zeitschrift Kladderadatsch, geheiratet. Fünf Kinder hatten die beiden und führten einen gastlichen Salon, wo sich Theodor Fontane, die Schriftstellerin Fanny Lewald, Franz Liszt und andere Größen aus der Kultur und dem sozial-liberalen politischen Spektrum wohlfühlten. Außer Haus trat Hedwig Dohm nicht in Erscheinung. Umso mehr Aufsehen erregte ihr »Kampf auf dem Papier«, wo sie radikal für die Frauenemanzipation eintrat, die für sie selbstverständlich eine politische Emanzipation war: »Solange es heißt: der Mann will und die Frau soll, leben wir nicht in einem Rechts-, sondern einem Gewaltstaat.«
Stichwort »Frauenstudium«: »Die Frau soll studieren … weil jeglicher Mensch Anspruch hat auf die individuelle Freiheit, ein seiner Neigung entsprechendes Geschäft zu treiben«. Frauen sind keine Männer. Hedwig Dohm setzt auf die Differenz der Geschlechter und begründet so die Kreativität und den Eigenanteil der Frauen in allen Bereichen, also auch in der Wissenschaft. Frauen besitzen »eine vom Manne verschiedene geistige Organisation« (verschieden aber nicht von geringerer Qualität); deshalb sind sie imstande »neue Formen der Erkenntnis, neue Gedankenrichtungen der Wissenschaft zuzuführen«.
Hedwig Dohm konnte prägnant und einprägsam formulieren. Der letzte Satz aus ihrer Schrift Der Frauen Natur und Recht von 1876 hat Karriere gemacht durch alle folgenden Epochen: »Die Menschenrechte haben kein Geschlecht.« Damit nahm sie den Faden auf, den Louise Otto in ihrer Frauen-Zeitung ausgelegt hatte – »die Freiheit ist unteilbar«. Die Forderung, die Hedwig Dohm daraus ableitet, ist politischer Sprengstoff: »Für mich liegt der Anfang alles wahrhaften Fortschritts auf dem Gebiet der Frauenfrage im Stimmrecht der Frauen. … die Gewährung des Stimmrechts ist der Schritt über den Rubikon.« Die zierliche, zurückhaltend bis schüchterne Hedwig Dohm besuchte keine Versammlungen, hielt keine öffentlichen Vorträge. Zwar hatte sie Kontakt zu Berliner Frauen, die in Frauenvereinen ähnliche Gedanken vertraten. Doch sie konnte ihre politischen Ansichten offen vertreten ohne auf Institutionen Rücksicht nehmen zu müssen.
Louise Otto und Auguste Schmidt, die Herausgeberinnen der NeuenBahnen, Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, mussten dagegen die Folgen ihrer Artikel bedenken. Jede politische Andeutung war dem Verein laut Gesetz verboten. Zudem gab es unter den inzwischen rund 10 000 Vereinsmitgliedern unterschiedliche Meinungen. Das hinderte die Zeitschrift nicht, entschiedene Ansichten zu vertreten: »Macht das Weib stark und geachtet durch … einen gründlich erlernten Beruf, der ihr Unabhängigkeit sichert auch ohne einen Ernährer, ohne die Tugend-Leibwache, d. h. den Ehemann, Vater, Bruder etc. hinter sich zu haben.« Eine »wahrhaft gebildete, geistig überlegene Frau« muss nicht mehr demütig und unterwürfig durchs Leben gehen.
Hedwig Dohm tritt nicht öffentlich auf. Doch in ihren Schriften fordert die fünffache Mutter mit beißender Ironie ein Ende der »Herrenrechte« und als der »Frauen Natur und Recht« 1876 eine radikale rechtliche und politische Emanzipation.
Hedwig Dohm war bewusst, dass ihr unverblümter Kampf für die politischen Rechte der Frauen eine radikale Zukunftsverheißung war und vielen Frauen in der aktuellen Situation eine »Torheit«. Sie hatte deshalb Verständnis für die Vertreterinnen der Frauenbewegung, die Schritt für Schritt vorgingen und nicht mit dem Kopf durch die Wand steinharter Traditionen und Machtverhältnisse wollten. Ihr Rat war, dem »Grundsatz praktischer Leute« zu folgen und »nur das Erreichbare zu wünschen«. Hedwig Dohms Vision aber traf die Männerherrschaft ins Herz. Ihre besten Vertreter fühlten sich aufgefordert, den neumodischen Ideen entgegenzutreten.
Heinrich von Treitschke, Professor an der Berliner Humboldt-Universität, war der absolute Meinungsführer, was die Glorifizierung preußisch-deutscher Geschichte und die nationale Größe des neuen Kaiserreichs betraf. In seinen Vorlesungen, die er ebenso außerhalb Berlins hielt, prägte er die männliche Studenten-Elite auch mit seinen gesellschaftspolitischen Vorstellungen. Für Treitschke waren »unsere germanischen Vorfahren von gesundem Sinne, wenn sie die Weiber von der Regierung ausgeschlossen haben«. Fakten musste der angesehene historische Experte nicht liefern, seine Autorität genügte: »Obrigkeit ist männlich; das ist ein Satz, der sich eigentlich von selbst versteht.« Dazu noch ein handfestes Argument: »Regieren bedeutet: bewaffneten Männern gebieten, und dass bewaffnete Männer sich den Befehl eines Weibes nicht gefallen lassen.«
Einen interessanten Blick in sein männliches Innenleben fügt der Professor noch hinzu, um die gesamte »Frauenfrage« ins Lächerliche zu ziehen und jede weitere Argumentation für überflüssig zu erklären. Ein prominenter Verbündeter der Emanzipation war der englische Philosoph John Stuart Mill, für den die Freiheit der Ausgangspunkt aller Überlegungen war. Von seiner Frau Harriet Taylor Mill beeinflusst, wie er öffentlich betonte, kämpfte er in England für das Frauenstimmrecht und ein reformiertes Scheidungsrecht. 1869 erschien Stuart Mills Schrift Subjection of Women. Unter dem Titel Die Hörigkeit der Frau löste die kurz danach erschienene deutsche Übersetzung heftige Diskussionen aus. Treitschke meinte, Mill entschuldigen zu können: »Er hatte einen entsetzlichen Blaustrumpf zur Frau, mit der ich nicht acht Tage hätte zusammen leben können. Das imponierte aber dem gutmütigen Mann, und er kam zu der verflixten Idee, dass die Frau gleichberechtigt sei dem Manne.«
Während in Deutschland die Professoren – samt den Studenten – verächtlich von »Blaustrümpfen« redeten, bestanden in Zürich die beiden ersten deutschen Medizinstudentinnen »sehr gut« ihre Examina und erwarben den Titel »Dr. med.«, Emilie Lehmus 1875, Franziska Tiburtius 1876. Wie ihre männlichen Kollegen mussten sie anschließend ein Jahr als Volontärärztin in einem Krankenhaus absolvieren, ohne Gehalt versteht sich. Auf ihre Anfragen erhielten beide Frauen von allen deutschen Kliniken Absagen – bis auf die Königliche Entbindungsanstalt in Dresden. Hier machte Dr. Lehmus ihr praktisches Jahr und ging 1875 nach Berlin, als erste ausgebildete Ärztin für »Kinder und Frauen« in Deutschland. 1876 folgte ihr Dr. Tiburtius, ebenfalls nach einer Assistenzzeit in Dresden. Beide Frauen waren entschlossen, sich in der Reichshauptstadt als Ärztinnen mit eigener Praxis niederzulassen.
Wieder war es ein »Sprung ins Dunkle«, denn alle zuständigen Instanzen in Ministerien und Berufsverbänden erklärten rigoros, dass die Zürcher medizinische Ausbildung in Deutschland nicht anerkannt werde, die beiden Frauen deshalb keine Approbation erhielten und nach deutschem Recht unter die Kurpfuscher zu zählen seien. Wenn sie es dennoch versuchen wollten, bitteschön, die Obrigkeit würde nicht die Polizei schicken. »Unter diesen Umständen«, schreibt Franziska Tiburtius später in ihren Erinnerungen, »war es besonders vorteilhaft, dass die beiden ersten weiblichen Ärzte zusammenstanden. … Lehmus und ich wussten genau, dass wir uns in jedem Fall aufeinander verlassen konnten.«
Kaum hatte jede ihre eigene Praxis im Haus der Geschwister eingerichtet, »fanden wir uns auch zusammen in einer regelmäßigen gemeinsamen Arbeit«, von der die beiden seit Zürich träumten. Ein reicher Industrieller, dessen Frau von der Zahnärztin Henriette Tiburtius, Franziskas Schwägerin, behandelt wurde, stellte unentgeltlich eine Wohnung im Hinterhof eines seiner Häuser in der Alten Schönhauserstraße zur Verfügung. Mit einfachster Einrichtung entstand hier eine Poliklinik für Arbeiterfrauen, und schon in der ersten Sprechstunde fanden sich zwölf Frauen in dem kleinen Wartezimmer ein. Bald waren es vierzig, mehr konnten die beiden Ärztinnen auch mit langer Nachtarbeit nicht behandeln. Wer konnte, zahlte zehn Pfennig, das reichte für Beleuchtung und Heizung.
Tiburtius und Lehmus griffen für die erste weibliche Klinik oftmals in die eigene Tasche. Das fiel umso leichter, da sich langsam aber stetig ihre privaten Wartezimmer füllten. Die Satire-Blätter, die sich die umstrittene Frauen-Premiere nicht entgehen ließen, waren daran nicht unbeteiligt: »Der ›Kladderadatsch‹ brachte eine reizende Darstellung der Ereignisse in der Klinik der weiblichen Ärzte, Dr. Romulus und Dr. Remus, die sich natürlich beide in den gleichen Patienten verlieben und in bittere Feindschaft zu einander geraten. Es erwies sich als vorzügliche Reklame.« Irgendwann allerdings reichte es den Ärztinnen. Als Franziska Tiburtius in einer Gesellschaft Ernst Dohm kennenlernte, Chefredakteur des Kladderadatsch – und Ehemann von Hedwig Dohm –, hatten die beiden »eine überaus anregende Plauderstunde«. Am Ende versprach der Zeitschriftenmacher, »uns künftig in Ruhe zu lassen, was er auch treulich gehalten hat«. Auch der Herausgeber des Ulk verzichtete nach einem Gespräch auf »weitere scherzhafte Angriffe«.
Die ärztlichen Fachzeitschriften, wenn sie überhaupt von den weiblichen Kollegen Notiz nahmen, waren von der »völligen Hoffnungslosigkeit des Unternehmens« überzeugt. Kommentar von Franziska Tiburtius: »Die beiden Ärztinnen standen der Kontroverse kühl gegenüber: – abwarten!« Ähnlich gelassen meisterten die beiden Frauen auch die persönliche Begegnung mit ärztlichen Kollegen, die ihnen unverhohlen ihre Geringschätzung zeigten: »Da hieß es ruhig bleiben, das Gesicht wahren, unentwegt seines Weges gehen …« Nur einmal in den Anfangsjahren wurde Franziska Tiburtius fast aus der Ruhe gebracht. Ein Kollege, mit dem sie die Diagnose einer todkranken Patientin besprechen wollte, beendete das Fachgespräch schnell und fuhr unvermittelt fort: »Aber sagen Sie mal, warum haben Sie nicht geheiratet?« – »Ich bin selten so überrascht gewesen«, heißt es in den Erinnerungen. Franziska Tiburtius blieb ledig und hat sich sehr bald im Netzwerk Berliner Frauen engagiert, das noch vor der Jahrhundertwende fortschrittliche Frauenprojekte ideell und materiell unterstützte.
Risikobereitschaft, Einsatz und ärztliches Können der ersten beiden Ärztinnen wurden belohnt, zumal ihnen trotz fehlender staatlicher Genehmigung niemand ihre Berufsausübung streitig machte: »Von Anfang oder gegen Mitte der achtziger Jahre an standen L. und ich schon ziemlich fest auf gewonnenem Boden; wenn auch nicht de jure, so hatten wir doch de facto die gleiche Stellung mit anderen praktischen Ärzten: das Publikum wusste von keinem Unterschied.« Zuerst hatten die vornehmen Familien ihre kranken Köchinnen und Hausmädchen geschickt, um die Medizin-Pionierinnen zu testen. Dann erschienen die Kinder samt Erzieherinnen und am Ende in der Regel »die gnädige Frau selbst«.
Die 1870er Jahre, an deren Ende Lehmus und Tiburtius ihre Aufsehen erregenden Karrieren begannen, waren insgesamt ein turbulentes und vom hitzigen öffentlichen Streit geprägtes Jahrzehnt. Auffallend ist, wie sich die Bilder gleichen: Die Häme und Aggression, mit der Emanzipationsforderungen von Frauen abgeschmettert wurden, wendeten Professoren und andere bürgerliche Meinungsmacher ebenso gegen die jüdischen Bürger. Auch hier ging es Schlag auf Schlag. Wilhelm Busch, der populäre Dichter-Zeichner, gab 1872 in seiner Bildgeschichte Die frommeHelene den Ton an: »Und der Jud mit krummer Ferse / Krummer Nas’ und krummer Hos’ / Schlängelt sich zur hohen Börse / tiefverderbt und seelenlos.« 1873 erscheint ein Pamphlet des Journalisten Wilhelm Marr, das bis 1879 zwölf Auflagen erlebt: Der Sieg des Judentums über das Germanentum. Der Autor gibt sich den Anschein, aus wissenschaftlich-objektiver Sicht – »vom nicht confessionellen Standpunkt aus« – vor der jüdischen »Rasse« zu warnen, die nach »Weltherrschaft« strebe. Seine Wortschöpfung »Antisemitismus« sollte dem Judenhass einen neutralen Ansatz verschaffen.
1873 ist das Jahr, in dem auf die rauschhafte Goldgräber-Stimmung der Gründerzeit ein veritabler Kater folgte. Im Frühjahr stürzten an den Börsen in Wien und Berlin die Kurse ins Bodenlose; die Aktien-Hausse erwies sich als ein papierener Schwindel, hinter dem keine konkreten Werte standen. Im deutschen Kaiserreich brach die Hochkonjunktur ein, den großen wie den kleinen Spekulanten blieben statt der künstlichen Gewinne nur sehr konkrete finanzielle Verluste. Schock, Empörung und die schnelle Suche nach einem Sündenbock: Der Liberalismus hatte Schuld. Doch der war nicht fassbar. Wer steckte dahinter? Die Juden. Die Juden hatten Schuld.
1874 begann Die Gartenlaube, eine beliebte Familienzeitschrift mit rund zwei Millionen Lesern, eine Artikelserie über den »Börsen- und Gründungsschwindel in Berlin«. Kapital an sich ist nichts Schlechtes, wurde das Publikum belehrt, wenn es sich um das »schaffende Kapital« der Christen handelte. Von Übel ist das »raffende Kapital« der Juden und das habe zum Börsenkrach, zu Wirtschaftskrise und Depression geführt. Als Konsequenz solle man sie allerdings nicht »abschlachten«, sondern ihnen die Luft zum Atmen nehmen.
1875 legte die konservativ-protestantische Kreuz-Zeitung mit einer anti-jüdischen Artikel-Serie nach. Ihr Vorwurf: »Wir werden ja zur Zeit von den Juden eigentlich regiert.« Damit wurde indirekt auch Reichskanzler Bismarck angegriffen, denn das geneigte Lesepublikum wusste, dessen Vermögensverwalter war ein bekannter jüdischer Bankier. Die einflussreiche katholische Zeitung Germania, von einem Kaplan geleitet, wollte nicht fehlen, wenn es gegen den »verjudeten Liberalismus« ging. Sie nannte die Juden »Reichsfeinde« und propagierte 1875 die Losung: »Kauft nicht vom Juden«.
1878 gründete der protestantische kaiserliche Hofprediger Adolf Stoecker die Christlich-Soziale Arbeiterpartei. Sie soll die Arbeiter dem »unpatriotischen« und »unchristlichen« Einfluss der Sozialdemokratie entreißen. Als die Arbeiter diesem Angebot nicht Folge leisten, machte Stoecker seine Gruppierung zur ersten deutschen antisemitischen Partei. 1879 verkündet er als Parteiprogramm »Unsere Forderungen an das moderne Judentum«. Bei dem »Kampf ums Dasein« zwischen Christen und Juden stehe »Rasse gegen Rasse«. Bei höheren Positionen wie Richtern, Lehrern, Direktoren müsse die Zahl der Juden deutlich beschränkt werden.
Gegen Ende des Jahres 1879 goss der Historiker Treitschke in den angesehenen Preußischen Jahrbüchern noch Öl ins antisemitische Feuer. Scheinheilig beklagte er in einem Aufsatz die »Roheit« der Kritik an den Juden, um dann die allgemeine »Unruhe« in Bezug auf die »Judenfrage« positiv aufzunehmen und dem »Semitentum« eine »schwere Mitschuld an jenem schnöden Materialismus unserer Tage« zu geben. Treitschke, dessen Ansehen unter den Eliten des Kaiserreichs kaum zu überschätzen ist, breitet ein Sündenregister gegen »den Juden« aus und schließt den Kreis scheinheilig-infam mit einer Parole, die sich angeblich in Kreisen höchster Bildung ausbreite: »Die Juden sind unser Unglück.« Der Berliner Professor hat mit diesem Aufsatz den Antisemitismus im Bürgertum des Kaiserreichs salonfähig gemacht. Es ist der gleiche Treitschke, dessen Tiraden gegen Blaustrümpfe, Emanzipation und Gleichberechtigung im gleichen Jahrzehnt von Studenten – nicht nur in Berlin – als wissenschaftliche Fakten aufgesogen wurden. Zur gleichen Zeit arbeiten in der Klinik in der Alten Schönhauserstraße unaufgeregt und erfolgreich die zwei Ärztinnen, die allein durch ihre Existenz solche Tiraden als das Pfeifen im dunklen Wald entlarven.