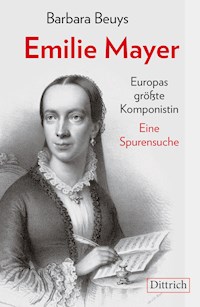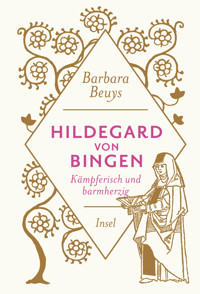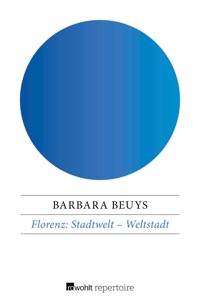9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Schon Jahrzehnte vor der Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahre 70 siedelte die Mehrheit aller Juden außerhalb Palästinas, sprach nicht hebräisch, sondern griechisch. Zur Zeit des Kaisers Augustus lebten in der Hauptstadt Rom bereits 50 000 Juden. Ein halbes Jahrtausend später, nach dem Untergang des Imperium Romanum in den Wirren der Völkerwanderung, hatte sich jüdisches Leben an andere Stätten West- und Südeuropas verlagert. Barbara Beuys erzählt in ihrem anschaulichen, konkreten Stil, wie die Juden in den vielen Ländern Europas eine Heimat fanden, die ihnen als Minderheit nur zu oft auch eine Hölle war. Über vielen Einzelstudien ist die europäische Sicht der jüdischen Geschichte lange vernachlässigt worden, besonders im Blick auf Antike und Mittelalter. Barbara Beuys setzt hier einen Schwerpunkt und zeigt, wie vor allem in diesen Epochen trotz Verfolgung und Isolation die Juden auch Bürger und Nachbarn waren. Selbstbewußt und flexibel begegneten sie der Kultur der Mehrheit – ob Islam oder Christentum. Die Zentralperspektive der Autorin bleibt durch alle Zeiten die Religion, das Herzstück des Judentums. Aus ihrem jüdischen Glauben entwickeln Europas Juden eine eigene Geschichte und Kultur, die zugleich auf vielfache Weise von ihrer Umgebung mit geprägt werden – ob sie unter spanischen Muslimen oder Katholiken leben, unter calvinistischen Holländern oder im katholischen Polen. Dieses gehaltvolle, figurenreiche und vital erzählte Buch kann wieder einen Zugang bahnen zu einer großen, vergessenen Tradition Europas. Hier können Männer und Frauen entdeckt werden, die als gelehrte, konfliktfreudige, poetische, erfolgreiche, erfinderische und widerspruchsvolle Persönlichkeiten jüdische Geschichte spiegeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1147
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Barbara Beuys
Heimat und Hölle
Jüdisches Leben in Europa durch zwei Jahrtausende: Religion, Geschichte, Kultur
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Schon Jahrzehnte vor der Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahre 70 siedelte die Mehrheit aller Juden außerhalb Palästinas, sprach nicht hebräisch, sondern griechisch. Zur Zeit des Kaisers Augustus lebten in der Hauptstadt Rom bereits 50 000 Juden. Ein halbes Jahrtausend später, nach dem Untergang des Imperium Romanum in den Wirren der Völkerwanderung, hatte sich jüdisches Leben an andere Stätten West- und Südeuropas verlagert.
Barbara Beuys erzählt in ihrem anschaulichen, konkreten Stil, wie die Juden in den vielen Ländern Europas eine Heimat fanden, die ihnen als Minderheit nur zu oft auch eine Hölle war.
Über vielen Einzelstudien ist die europäische Sicht der jüdischen Geschichte lange vernachlässigt worden, besonders im Blick auf Antike und Mittelalter. Barbara Beuys setzt hier einen Schwerpunkt und zeigt, wie vor allem in diesen Epochen trotz Verfolgung und Isolation die Juden auch Bürger und Nachbarn waren. Selbstbewußt und flexibel begegneten sie der Kultur der Mehrheit – ob Islam oder Christentum.
Die Zentralperspektive der Autorin bleibt durch alle Zeiten die Religion, das Herzstück des Judentums. Aus ihrem jüdischen Glauben entwickeln Europas Juden eine eigene Geschichte und Kultur, die zugleich auf vielfache Weise von ihrer Umgebung mit geprägt werden – ob sie unter spanischen Muslimen oder Katholiken leben, unter calvinistischen Holländern oder im katholischen Polen.
Über Barbara Beuys
BARBARA BEUYS, Jahrgang 1943, promovierte Historikerin und Journalistin; arbeitete als Redakteurin beim «Stern», bei «Merian», bei der «Zeit».
Frühere Veröffentlichungen:
1979: «Der Große Kurfürst. Der Mann, der Preußen schuf»
1980: «Familienleben in Deutschland. Neue Bilder aus der deutschen Vergangenheit»
1982: «Und wenn die Welt voll Teufel wär. Luthers Glaube und seine Erben»
1984: «Am Anfang war nur Verzweiflung. Wie Eltern behinderter Kinder neu leben lernen»
1987: «Vergeßt uns nicht. Menschen im Widerstand 1933–1945»
1992: «Florenz: Stadtwelt – Weltstadt. Urbanes Leben von 1200 bis 1500»
Inhaltsübersicht
… unsere Mutterstadt, der Ort unserer Väter. Die uralte Gemeinde, die hochgelobte unter allen Gemeinden des Reichs …
Rabbi Salomo bar Simson in seiner Mainzer Chronik der Kreuzzugsverfolgungen, Mitte des 12. Jahrhunderts
Inmitten der Reichtümer und Freuden des fröhlichen Asiens bin ich ein armer, müder Reisender … unter der sengenden Sonne Afrikas ein elender, hungernder und dürstender Verbannter. Was nun Europa, ach Europa, du meine Hölle auf Erden …
Samuel Usque «Trost für die Leiden des Volkes Israel», Ferrara 1553
Wir halten nicht mehr Kastilien und Portugal, sondern Holland für unser Vaterland …
Rabbi Menasseh ben Israel beim Besuch des Prinzen von Oranien in der Amsterdamer Synagoge, 1642
Insbesondere aber haben wir anjetzo gleichen Beruf mit den übrigen Bewohnern unseres Vaterlandes – wir sind keine Fremdlinge mehr aus dem Alterthum …
Leopold Zunz im Tempel der Berliner Reformer, 1821
Das Vaterland ruft euch zur Verteidigung seines Rechts, seiner Ehre, seiner unzertrennlichen Einheit. Auf denn, folgt seinem Rufe mit freudigem Herzen, mit glühendem Eifer … Zeigt euch als echte Söhne Ungarns, so wie als würdige Nachkommen der Hasmonäer …
Rabbi Löw Schwab vor jüdischen Freiwilligen, die für Ungarns Unabhängigkeit gegen Österreich in den Krieg ziehen, 1848
Frankreich, ich werde dich nicht verleugnen, weil du für einen Augenblick das Ansehen verloren hast … Nein, ich werde dich im Unglück nicht verlassen …
Isaak Lévy, Oberrabbiner von Colmar, als er 1872 von Elsaß-Lothringen, das die Deutschen annektiert hatten, nach Frankreich zog.
Schluss/Ganz gleich, ob gross, ob klein, man hat uns diesmal alle umgebracht.
Jizchak Katzenelson in «Dos lied vunem ojsgehargtn jidischn volk». Im Mai 1944 wurde er mit seinem Sohn in Auschwitz ermordet.
Heimat und Hölle
1. Eine eigene Geschichte – als Nachbarn in Europa
Am 11. November 1994 stand in der Pariser Zeitung «Le Monde» diese Anzeige: «Am 11. November 1942 verließ der 45. Konvoi für das Vernichtungslager Auschwitz das Internierungslager Drancy mit 745 Juden, davon 106 Kinder unter 17 Jahren. Unter ihnen meine Schwester Arlette Montelmacher, 22 Monate alt. Mein Bruder Georges Montelmacher, 16 Jahre alt. Meine Mutter Berthe Montelmacher … Kein Vergeben, kein Vergessen.» Auschwitz muß der Ausgangspunkt sein für jedes Buch, das sich nach 1945 mit der Geschichte der Juden in Europa befaßt. Jenes größte von sechs Vernichtungslagern, die die Deutschen in Polen installierten, um den Völkermord an Europas Juden mit größtmöglicher Effizienz «wie am Fließband» zu betreiben. Auschwitz steht für die tödliche Konsequenz, mit der die Nationalsozialisten ab 1933 in Deutschland und nach der Entfesselung des Zweiten Weltkrieges mit dem Überfall auf Polen in fast allen Ländern Europas die Juden systematisch aus der menschlichen Gemeinschaft ausgrenzten, demütigten, Mißhandlungen, Qualen und Folterungen aussetzten und über den physischen Tod hinaus mit ihrer gesamten Kultur auszulöschen versuchten.
1939 lebten weltweit 16 Millionen Juden, die Mehrheit von ihnen in Europa. Bis 1945 waren durch den deutschen Vernichtungsfeldzug mindestens 5,29 Millionen Juden in Europa ermordet, und die Zentren jüdischen Lebens hatten sich als Folge der Schoa in andere Kontinente verlagert. Dabei ist es geblieben: 1995 lebte die Mehrheit der 13,9 Millionen Juden weltweit in den USA (rund 5,8 Millionen) und dem Staat Israel (4,4 Millionen). Die größte jüdische Stadt ist New York mit 1,45 Millionen jüdischen Einwohnern, gefolgt von 500000 Juden in Los Angeles. In Jerusalem leben rund 400000 Juden, und in Europa hat Paris die größte jüdische Gemeinschaft (350000).
Fünfzig Jahre nach der Befreiung durch die sowjetische Armee trafen sich am 27. Januar 1995 Juden aus allen Kontinenten auf dem ehemaligen Lagergelände von Auschwitz. Es begann ein Jahr der Erinnerungen, die sich als wirkungsmächtiger erwiesen als alle Verdrängungsversuche. Mehr als je zuvor waren Juden, die die ihnen zugedachte Vernichtung überlebt haben, bereit, Zeugnis zu geben von einer Zeit persönlicher Erniedrigung und kollektiven Sterbens. Die einen hatten es sich sogleich nach der Befreiung aus den Lagern von der Seele geschrieben, anderen schien das Überleben nur im Schweigen möglich. Erst Jahrzehnte nach der Katastrophe brachen auch jene ihr Schweigen, die während der Verfolgung als Kinder von ihren Eltern fortgegeben wurden, damit wenigstens einige Juden der nächsten Generation überlebten. Diese «Untergetauchten» berichteten von dem Trauma gespaltener Identität zwischen ihrer jüdischen Herkunft und der überlebensnotwendigen Anpassung an die christlichen Rituale der Mehrheit, die ihre Retter und ihre Verfolger stellte.
Sarah Kofman, als Kind erst allein, dann mit Mutter und Geschwistern in Paris untergetaucht, während ihr Vater, der orthodoxe Rabbi, auf den Todestransport nach Auschwitz verschleppt wurde, wählte die Philosophie als Beruf, um das Grauen durch Abstraktion zu verdrängen: «Ich mache mir keine Bilder – das hat mich gerettet.» Fünfzig Jahre später stellte sie sich in einem «autobiographischen Fragment» den Bildern. Nach diesem Bericht über ihre Kindheit, als sie gezwungen wurde, zentrale jüdische Lebensweisen zu verleugnen, um den Mördern zu entkommen, setzte Sarah Kofman im Oktober 1994 ihrem Leben ein Ende.
Binjamin Wilkomirski hat wieder seinen eigenen Namen, und das ist fast ein Wunder. Denn das kleine Kind, das nach Majdanek verschleppt wurde und eine Odyssee durch die Lager überlebte, während Vater, Mutter, Brüder und alle anderen Verwandten ermordet wurden, erhielt 1945 in der Schweiz einen neuen Namen, ein neues Geburtsdatum, einen neuen Geburtsort in Polen. Längst erwachsen geworden, begann Binjamin Wilkomirski in jahrelanger Recherche «Erinnerungsfetzen» zusammenzufügen und aufzuschreiben. Im Gedächtnis blieb auch, wie lange nach dem Ende des Lagers die Realität dieser Welt alle neuen Wirklichkeiten überlagerte.
Nach kurzem Aufenthalt in einem Kinderheim kommt Binjamin in eine Schweizer Pflegefamilie, die ihm als erstes befiehlt, alles zu vergessen, was war. Die Frau führt ihn durch das Haus und zeigt dem Kind auch den Vorratskeller: «Ich traute meinen Augen kaum. Da waren Holzgestelle! Und auf den Holzgestellen lagen Äpfel; die Holzgestelle aber glichen Holzgestellen, die ich kannte. Ich glaubte nicht mehr, was sie sagte.» Dann geht es in den Raum mit der Kohlenheizung, und die Frau bemerkt beiläufig, daß man damit auch warmes Wasser machen kann. «Die Frau öffnete eine halbrunde Klappe, nahm die Schaufel, warf ein wenig Kohle hinein, ich konnte die Flammen sehen. Entsetzt starrte ich auf das Ungeheuer. Also doch! Mein Verdacht war richtig. Ich bin in eine Falle geraten. Die Ofenklappe ist zwar kleiner als normal, aber für Kinder geht es. Ich weiß es, ich habe es gesehen, man kann auch mit Kindern heizen … Meine Gedanken überschlugen sich: Ich hatte doch recht! Man will mich täuschen. Deshalb soll ich vergessen, was ich doch weiß. Das Lager ist noch da. Alles ist da! dachte ich.»
Schweigen prägte auch die Kindheit jener Generation, die nach 1945 in die Familien von jüdischen Überlebenden geboren wurden. In bester Absicht verschwiegen die Eltern ihren Kindern, warum sie ohne Großeltern aufwuchsen. Warum es weder Onkel noch Tanten noch Cousinen zum Spielen gab. Sollten die Eltern ihren Kindern erzählen, welche Erniedrigungen sie durchlebt hatten? Welche Schuldgefühle sie quälten, weil sie hilflos zusehen mußten, wie die ihnen liebsten Menschen verhungerten, brutale Schindereien nicht überlebten, in die Gaskammern getrieben wurden, wo sie elendig erstickten?
Jahrzehnte nach Auschwitz begannen langsam Gespräche zwischen den Generationen, die der Vernichtung entkommen, und denen, die im Schatten von Auschwitz aufgewachsen waren. In Israel und anderswo stellen Juden sich die Frage, wieviel Raum die Schoa im kollektiven Gedächtnis und im Leben der Juden einnehmen soll. Niemand muß ihnen sagen, daß Vergessen unvorstellbar ist. Gedenken und Erinnern gehören unauslöschlich zu Israel und seinem Gott. Yad Vashem, die Jerusalemer Gedächtnisstätte an die Opfer des Völkermords, steht im Zeichen der Zusage Gottes an jeden einzelnen Juden, die der Prophet Jesaja im sechsundfünfzigsten Kapitel überliefert: «So gebe ich ihnen / in meinem Haus / und meinen Mauern / Handmal und Namen / mehr wert als Söhne und als Töchter; / ich gebe ihnen ewgen Namen / der nimmer wird getilgt.»
Die ununterbrochene Erinnerung verbindet als unzerstörbare Kette seit biblischen Zeiten Religion, Geschichte und Kultur der Juden. Die Feste des jüdischen Kalenders bewahren nicht nur seit dreitausend Jahren herausragende Ereignisse aus der Geschichte des Gottesvolkes. Jeder Jude ist nach göttlichem Gebot verpflichtet, sich jedes Jahr aufs neue an sie zu erinnern, als sei er selbst dabeigewesen. Und es gibt eine göttliche Gewichtung der Ereignisse. Der Gott Israels hat den Juden aufgetragen, sich einmal im Jahr an ihren Todfeind Amalek zu erinnern, aber täglich der Befreiung aus Ägypten zu gedenken.
Soll, darf Auschwitz wie ein schwarzer Block des Todes für immer den Zugang zum Leben der Juden in Europa verdunkeln, die dort durch zwei Jahrtausende ihre eigene Geschichte hatten? Es wächst die Zahl der jüdischen Stimmen, die dafür plädieren, jüdischer Geschichte vor Auschwitz ihren eigenen Platz zu geben und sie nicht ausschließlich aus dem Blickwinkel der Vernichtung zu betrachten. Wenn Erinnerung unteilbar ist, dann dürfen die Mörder, die zusammen mit den Menschen die Erinnerung auslöschen wollten, nicht im nachhinein triumphieren.
Doch ein zweiter Einwand schließt sich an: War Auschwitz nicht der logische Schlußpunkt einer endlosen Kette von Vertreibung und Verfolgung, Elend und Tod für die jüdische Minderheit durch die christliche Mehrheit? Was gäbe es darüber hinaus Wichtiges oder Unbekanntes zu berichten von der Geschichte der Juden in Europa? Der große Gelehrte Salo Wittmayer Baron aus Galizien, der 1930 als erster jüdischer Wissenschaftler an einer historischen Fakultät eine Professur für jüdische Geschichte erhielt – an der New Yorker Columbia University –, hat schon 1938 gegen ein solches «tränenreiches Konzept jüdischer Geschichte» argumentiert. Und er ist dabei geblieben, daß dies eine Verzerrung der tatsächlichen Entwicklung sei.
Die innerjüdische Diskussion über die eigene Geschichte ist nicht neu. Joseph ha-Kohen, dessen Eltern aus Spanien vertrieben worden waren, veröffentlichte 1558 in Italien die hebräische Schrift «Emek ha-Bacha» (Tal der Tränen). Diese Sammlung der Leiden seines Volkes sollte die Hoffnung auf eine baldige Ankunft des Messias und die Rückkehr ins Heilige Land stärken. Genau die gegenteilige Meinung vertrat gegen Ende des Jahrhunderts sein Glaubensbruder David Gans aus Lippstadt in Westfalen, der sich in Prag niedergelassen hatte und dort als kenntnisreicher Astronom mit dem berühmten Tycho Brahe zusammenarbeitete.
Im Vorwort zu seinem Werk «Zemach David» (Sproß Davids), das sowohl eine Chronik der jüdischen wie der nichtjüdischen Geschichte enthält, vermerkt der Autor nicht nur, daß er seine Leser nach harter Tagesarbeit unterhalten möchte. Er will ihnen auch Mut machen, sich den Herausforderungen der christlichen Umwelt positiv zu stellen. Er habe, so David Gans 1592, «für eine Generation geschrieben, die des Exils müde ist». David Gans liebte sein Westfalen, immer mal wieder reiste er dorthin, und in Prag fühlte er sich zu Hause. Er wollte an der Moldau mit seiner Familie nicht wie auf gepackten Koffern leben, die Rückkehr nach Jerusalem stets im Hinterkopf.
Der Widerspruch zwischen dem religiösen Ideal und der durch Generationen gewachsenen Bodenständigkeit außerhalb Palästinas begleitet die Juden seit biblischen Tagen. Der einhundertsiebenunddreißigste Psalm erinnert sie an den Schwur ihrer nach Babylon vertriebenen Vorfahren: «Dort an den Strömen Babels weilten wir / ach, weinten wir / wenn Zijons wir gedachten! … Vergäß ich dein, Jeruschalaim / versagte meine Rechte / es klebte meine Zunge mir am Gaumen / wenn ich dein nicht gedächte …» Doch beim Propheten Jeremia ist auch zu lesen, welchen Befehl Gott den jüdischen Deportierten gab: «Baut Häuser und bewohnt sie, pflanzt Gärten und eßt ihre Frucht! … Und strebt nach dem Wort der Stadt, dahin ich euch fortgeführt habe, und betet für sie zu dem Ewigen, denn mit ihrem Wohl wird auch euch wohl sein.» Als sie ins Heilige Land zurückkehren konnten, blieben Tausende von Juden an den Wassern Babels und bildeten rund 450 Jahre vor unserer Zeitrechnung die erste freiwillige jüdische Gemeinde im Exil.
Allein im antiken Rom, wo dieses Buch beginnt, lebten zur Zeit des Kaisers Augustus rund 50000 Juden sicher im Schutz der Staatsmacht, die die jüdische Religion samt ihren religiösen Gesetzen überall im Römischen Reich anerkannte. In Ägypten und Mesopotamien existierten große, blühende Gemeinden. So schwankend auch die Gesamtzahlen sind, eines ist sicher: Noch bevor die Römer im Jahre 70 n. Chr. den Tempel in Jerusalem zerstörten und den Staat Israel endgültig zerschlugen, befand sich die Mehrheit aller Juden außerhalb von Palästina.
Dem Untergang des antiken römischen Imperiums folgten im Abend- wie im Morgenland chaotische Jahrhunderte. Als mit den muslimischen Reichen im Osten und den fränkischen Königen im Westen Stabilität und Ordnung zurückkehrten, waren die jüdischen Gemeinden in Ägypten und im Vorderen Orient untergegangen. In der Zwischenzeit hatten sich Juden in Spanien und Frankreich, Deutschland und Italien niedergelassen. Spätestens ab dem 9. Jahrhundert lebte die Mehrheit aller Juden in Europa. Die europäische Epoche in der Geschichte der Juden begann.
War die Alte Welt für die Juden nur ein «Tal der Tränen»? Dieses Buch erzählt jüdische Geschichte in Europa nicht entlang der Bruchstelle von Verfolgung und Unterdrückung und nicht als eine Geschichte des Antisemitismus. Sosehr die Juden davon betroffen wurden, so selbstverständlich dies auf den folgenden Seiten weder ausgelassen noch relativiert wird: Diese Aspekte sind ursächlich ein Problem der christlichen Mehrheit. Nicht die Perspektive der Mehrheit soll im Mittelpunkt dieses Buches stehen, sondern das Leben der Juden. Aus dieser Perspektive zerfällt das Bild von der angeblich passiven Minderheit, die kein Eigenleben und keine Aktivitäten entwickelte und nur Opfer war. Für die Juden blieb Europa durch zwei Jahrtausende beides: Heimat und Hölle.
Wer sich bemüht, die Geschichte der jüdischen Minderheit so weit wie möglich aus ihrer Sicht und mit ihren Zeugnissen zu erzählen, bekommt die Mehrheit ohnehin von selbst in den Blick – allerdings ebenfalls mit neuen Erfahrungen. Die bewußte religiöse Eigenständigkeit der Juden war über Jahrhunderte keineswegs mit sozialer Isolation gekoppelt. Es gab gegenseitige Achtung und ein Verständnis zwischen jüdischen und christlichen Nachbarn, das Konflikte aushielt und in ein realistisches Miteinander integrierte. Dies betrifft vor allem das frühe Mittelalter, das auch in diesem Punkt weniger finster war als die neue Zeit. Ihm wird deshalb in diesem Buch viel Raum eingeräumt. Nicht zuletzt, weil es für diese frühe Zeit interne Zeugnisse über jüdisches Leben gibt, die bei der christlichen Mehrheit ohne Parallelen sind: die schriftlichen Gutachten der Rabbinen über strittige Auslegungen des religiösen Gesetzes, das alle Bereiche des Lebens umfaßte.
So erfahren wir von Ehestreitigkeiten und Erbschaftsangelegenheiten, Steuerklagen und Nachbarschaftskonflikten in den Gemeinden. Zugleich werden viele Anfragen entschieden, die sich für einen Juden aus dem Zusammenleben mit den christlichen Nachbarn ergeben. Verhält ein Jude sich gesetzestreu, wenn der Ochse, den er sich mit einem Christen teilt, von diesem am Samstag – dem geheiligten und strikt arbeitsfreien jüdischen Schabbat – eingesetzt wird? Ja, entscheidet definitiv um die Mitte des 11. Jahrhunderts Rabbi Isaak ben Menachem der Jüngere aus Orléans, der an der Mainzer Talmudakademie studiert hatte, damals die angesehenste nördlich der Alpen.
Unter der Führung ihrer Tora- und Talmudgelehrten, die nicht selten erfolgreiche Kaufleute sind, reagieren die Juden in den unterschiedlichen Ländern Europas flexibel und keineswegs abwehrend auf die jeweiligen Kulturen. Ihre Alltagssprache ist Latein oder Griechisch, Arabisch oder Spanisch, Französisch, Deutsch oder Italienisch. Das hindert ihre Dichter nicht, unter dem Islam vollendete hebräische Geschichte zu schreiben. Jüdische Einheimische mehrten den Reichtum der islamischen Königreiche in Spanien und dienten den Kalifen als Politiker und Feldherren. Sie waren Bürger im christlichen Spanien, Gelehrte und Vertraute bei Hofe. Sie erhielten weitgehende Privilegien von den deutschen Königen und waren als Pioniere der Urbanität wesentlich an der Entwicklung einer städtischen Kultur im deutschen Reich beteiligt. 1307 wurde die jüdische Gemeinde von Koblenz in die Gemeinschaft der Bürger aufgenommen. Aus der Offenheit gegenüber der Mehrheitskultur und dem Selbstbewußtsein auf die eigenen Werte und Traditionen entstand ein kreatives Wechselspiel.
Es schützte die jüdischen Gemeinden nicht vor absurden Vorwürfen von tödlicher Konsequenz. England, Frankreich und Spanien waren die ersten Länder, die die Juden aus ihrer Heimat im Exil vertrieben. Im territorial zersplitterten Deutschland häuften sich ab dem dreizehnten Jahrhundert die Verfolgungen. Trotzdem kehrten die Juden nicht selten an den Ort ihrer Väter zurück. Rabbiner Jakob J. Petuchowski, der durch einen Kindertransport nach England im Mai 1939 der Vernichtung entging, während seine verwitwete Mutter in Berlin zurückbleiben mußte, schwor sich damals, nie wieder deutschen Boden zu betreten. Es sei denn, er erhalte eine «offizielle» Einladung. Das geschah 1973, und Rabbiner Petuchowski fuhr schweren Herzens in das Land der Mörder. Mit jedem weiteren Aufenthalt verstand er seine frühen Vorfahren besser: «Die Städte, aus denen die mittelalterlichen Juden vertrieben wurden, waren doch ihre Heimat. Seit vielen Generationen hatten sie in ihnen gelebt. Selbst ihre religiösen Gebräuche waren oft mit der heimatlichen Landschaft verbunden, und auf dem ‹guten Ort›, wie man den jüdischen Friedhof nannte, lagen die Ahnen begraben, die die ‹Kette der Tradition› durch die Jahrhunderte bezeugten. … Wenn daher die Möglichkeit auftauchte, sich wieder in die alte Heimat zu begeben, dann begab man sich – trotz aller bösen Erinnerungen – dorthin zurück. Ob das klug war oder politisch angemessen, sei einmal dahingestellt. Es geht hier um Gefühle, die mit politischer Klugheit oder Angemessenheit wenig zu tun hatten.»
Bis weit ins neunzehnte Jahrhundert hinein war jüdisches Leben in allen Bereichen von der Religion geprägt. Darum wird dieses Buch versuchen, den selbstverständlichen Vollzug der Religion im Alltag und den Geist jüdischer Frömmigkeit als Herzstück auch der jüdischen Geschichte in Europa zu schildern. Zudem haben die Vorurteile, Verzerrungen und negativen Stereotypen der christlichen Kirchen und Theologen gerade in diesem zentralen Punkt verheerende Folgen gehabt. Als versteinerter, nicht erneuerungsfähiger Glaube wurde das Judentum gebrandmarkt und der Gott des Alten Testamentes – so die abwertende Bezeichnung der Christen für die hebräische Bibel – als rachsüchtig und unerbittlich diffamiert. Zugleich hat die Kirche auf dem dunklen Hintergrund dieses negativen Judentums höchst erfolgreich jüdische Glaubensgrundsätze als typisch christlich für sich reklamiert.
Bis heute sind Christen wie nichtjüdische Atheisten überzeugt, das Gebot der Nächstenliebe unterscheide die christlich-abendländisch Ethik wesentlich – und positiv – von der jüdischen. Dabei fordert Gott im dritten Buch Mose im neunzehnten Kapitel von den Juden in Erinnerung an ihre Knechtschaft in Mizraim, dem Ägypterland, klipp und klar: «Und wenn sich ein Fremdling bei dir aufhält in eurem Land, so sollt ihr ihn nicht bedrücken. Wie ein Volksgeborener von euch soll euch der Fremdling sein, der sich bei euch aufhält, und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn Fremdlinge wart ihr im Land Mizraim, ich bin der Ewige, euer Gott.»
Keine Tugend fordert dieser Gott von den Juden so oft ein wie Gerechtigkeit gegenüber den Schwachen, den «Witwen und Waisen». Und über Generationen hinweg haben Juden auf das Versprechen ihres Gottes im fünften Buch Mose im vierten Kapitel vertraut: «Denn ein erbarmender Gott ist der Ewige, dein Gott, er wird dich nicht sinken lassen und nicht verderben und wird des Bundes mit deinen Vätern nicht vergessen, den er ihnen beschworen.» (Alle Zitate dieses Buches aus der hebräischen Bibel stammen aus der deutschen Übersetzung von Naftali Herz Tur-Sinai, der sich nicht scheut, deutsche Orthographie und Grammatik souverän zu ignorieren, um so nahe wie möglich am hebräischen Original zu bleiben. Mehr zu seiner Person unter «Hinweise».)
Nur wenn Europas jüdische Minderheit in ihrer Besonderheit, die für die Mehrheit auch Fremdheit bedeutet, akzeptiert wird, erschließt sich der Reichtum ihrer Traditionen, die Vielfalt und Buntheit ihres Lebens in den jeweiligen Ländern – auf dem felsenfesten Fundament gemeinsamer Glaubensüberzeugungen. Männer und auch Frauen können entdeckt werden, die als gelehrte, konfliktfreudige, poetische, erfolgreiche und widerspruchsvolle Persönlichkeiten eigenständige jüdische Geschichte spiegeln. Dieses vorausgesetzt, gehören sie aber endlich als große Europäer in die Geschichtsbücher. Ob Rabbi Gerschom ben Jehuda in Mainz, der gelehrte Raschi in Troyes, der spanische Dichter Salomo ibn Gabirol aus, Rabbi Leon Modena im Ghetto von Venedig, Rabbi Menasseh ben Israel in Amsterdam, der Bankier Diego Teixeira und die Kauffrau Glückel von Hameln in Hamburg – sie alle sind auch Teil einer gemeinsamen Geschichte aller Europäer.
Neben dem katastrophalen Einschnitt, den der Völkermord in Europa für das Judentum insgesamt bedeutet, steht als epochales, alles veränderndes Ereignis die Gründung des Staates Israel im Jahre 1948. Mit ihm begann eine lebhafte innerjüdische Debatte über die Situation der Juden in der weltweiten Diaspora. War es ihre Pflicht «heimzukehren» und damit nur noch eine Frage der Zeit, bis alle Juden ihren Platz im neuen jüdischen Staat finden würden? Seit Israel nach den Friedensschlüssen im Nahen Osten auf dem Weg zu einer nie gekannten Normalisierung ist, scheint sich auf beiden Seiten neues Selbstbewußtsein und neuer Diskussionsstoff einzustellen. Was verbindet einen Juden in der Diaspora mit einem Israeli? Haben sie eine gemeinsame jüdische Identität? So unterschiedlich die Antworten auch ausfallen, die große Mehrheit der Juden außerhalb Israels ist entschlossen, beides zu verbinden: ihre Loyalität zu Israel und ihren Anspruch, in vielen Ländern der Welt zu Hause zu sein.
Im westlichen Europa leben heute mit 1,1 Millionen Juden rund vier Prozent aller Juden weltweit. In der ehemaligen Sowjetunion sind es rund 1,25 Millionen und im übrigen Osteuropa 125000. Niemand weiß, ob der Exodus russischer Juden anhalten wird und ob die Neuanfänge jüdischer Gemeinden in Osteuropa tatsächlich eine umfassende Wiederbelebung jüdischen Lebens bewirken können. Frankreich ist mit 600000 Mitgliedern die größte Gemeinschaft im Westen, vor England mit rund 300000. Um die 30000 Juden leben in Holland und Italien. In Belgien sind es rund 35000. Am Ende der Skala stehen die Schweiz (19000), Spanien (15000), Österreich (8000), Griechenland (5000) und Irland (1800). In der Bundesrepublik Deutschland zählte die jüdische Gemeinschaft bis zum Fall der Mauer knapp 30000 Mitglieder. Diese Zahl hat sich seitdem durch Zuwanderer aus den GUS-Staaten auf knapp 60000 erhöht und steigt weiter.
Vielleicht hat keine Religion Widerspruch und permanente Auseinandersetzung, Meinungsverschiedenheiten und die hartnäckige Überprüfung endgültiger Wahrheiten so zu ihrem Lebenselixier gemacht wie das Judentum. Der Talmud, neben der Tora das zweite heilige Buch dieser Religion, entfaltet geradezu eine Kultur der Kontroverse. Und die Gründungsväter des rabbinischen Judentums, die sich sogleich nach der Zerstörung des zweiten Tempels ans Werk machten, scheuten sich nicht, in Fragen von höchster Brisanz ihre Ratlosigkeit zu gestehen. «Wir haben keine Antwort auf die Frage, warum die Bösen Glück haben und die Frommen leiden müssen», sagt Rabbi Janni im Talmud.
Die Frage nach dem Sinn des Leidens hat Auschwitz den Juden wiederum, aber beispiellos, gestellt. Sie allein sind befugt, darüber mit ihrem Gott zu hadern und kontroverse Antworten zu geben. Rabbiner Richard L. Rubenstein, 1924 in New York geboren, markiert die eine äußerste Grenze: «Ich habe oft darauf hingewiesen, daß ein Gott, welcher der menschlichen Verehrung würdig sein soll, seinem angeblich erwählten Volk Auschwitz zugefügt haben könne, anstößig ist … Ich habe mich für das entschieden, was Camus mit Recht den Mut zum Absurden genannt hat, den Mut, lieber in einem sinn- und zwecklosen Kosmos zu leben, als an einen Gott zu glauben, der seinem Volk Auschwitz zufügt.» Rabbiner Michael Wyschogrod, 1928 in Berlin geboren, gibt diese Antwort: «Der Gott Israels ist ein erlösender Gott … wie sehr dies in den Augen des Unglaubens falsch sein mag. … Wenn es nach dem Holocaust eine Hoffnung gibt, so deshalb, weil für die Gläubigen die Stimme der Propheten lauter spricht als Hitler und weil die göttliche Verheißung über die Krematorien hinwegweht und die Stimme von Auschwitz zum Schweigen bringt.»
Sache der Menschen ist es, die Vergangenheit mit ihrem Alltag, mit ihren Höhen und Abgründen ins Gedächtnis zu rufen. Nicht als Museumsstück, sondern als eine Geschichte von Handelnden und Leidenden, deren Anstrengungen und Widersprüche, Sehnsüchte und Enttäuschungen fortwirken in die Gegenwart.
2. Der Gott vom Sinai: Anstiftung zum Widerspruch
Am Anfang ist das Paradox. Die fünf Bücher Mose, das Allerheiligste des Judentums, jene Schriften, die nach der Überlieferung göttlichen Ursprungs sind und deshalb als die Tora (Weisung, Lehre) verbindlicher als alle anderen in der hebräischen Bibel, verkünden einen Gott mit zwei Gesichtern. Der eine ist unendlich und unergründlich, unwandelbar, unerschütterlich und unnahbar, sein Name unaussprechlich. Er ist ein ewiges Geheimnis, dem sich der Mensch in Furcht und Schrecken beugt.
Dieser Gott befahl dem Mose, die jüdischen Stämme nach dem Auszug aus Ägypten für drei Tage in ein Lager am Berg Sinai zu führen, um sie dort auf das Erscheinen Gottes und die Übergabe der Gebote vorzubereiten. Was dann geschah, steht im zweiten Buch Mose im neunzehnten Kapitel: «Es war nun am dritten Tag, als es Morgen wurde, da waren Donnerschläge und Blitze, und eine schwere Wolke lag auf dem Berg und ganz gewaltiger Posaunenschall ertönte. Und es erbebte alles Volk, das im Lager war. Und Mosche führte das Volk aus dem Lager heraus, Gott entgegen; und sie stellten sich am Fuße des Berges auf. Der Berg Sinai war aber ganz in Rauch, weil sich der Ewige in Feuer auf ihn hinabgelassen hatte, und sein Rauch stieg auf wie der Rauch des Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte gewaltig. Und der Posaunenschall wurde immer mächtiger und mächtiger … Und das ganze Volk gewahrte die Donnerschläge und die Flammen und den Posaunenschall und den rauchenden Berg. Und da das Volk es gewahrte, erbebten sie und blieben von ferne stehen. Und sie sprachen zu Mosche: ‹Rede du mit uns, und wir wollen hören, nicht aber möge Gott mit uns reden, sonst müßten wir sterben.›»
Dieser Gott gab den Juden am Sinai durch Mose nicht nur die zehn Gebote, sondern viele, nach der Tradition genau sechshundertdreizehn Vorschriften, die den Dienst der Priester am Opferaltar ebenso in allen Einzelheiten regelten wie den Alltag der Männer und Frauen. Nicht nur in der Verehrung eines einzigen Gottes sollen sich die Juden vom Götterglauben der sie umgebenden Völker unterscheiden. Ihre Nahrungszubereitung und ihre Kleidung, ihr Haarschnitt und ihre Rechtsordnung, ihr Familienleben und ihre Feste sollen der übrigen Welt Zeichen sein, daß Gott die Juden als seine Bundesgenossen auserwählt hat.
Aus der Wolke am Sinai nannte dieser Gott auch den folgenschweren Preis für dieses Privileg, der für alle folgenden Generationen gelten würde, denn die Juden aller Zeiten stehen im Geiste mit am Sinai: «Wenn ihr aber nicht auf mich hören und alle diese Gebote nicht üben werdet, und wenn ihr meine Satzungen verachtet, und wenn eure Seele meine Rechtsvorschriften verabscheut, daß ihr alle meine Gebote nicht übt, daß ihr so meinen Bund brecht: So werde auch ich euch dieses tun und über euch verhängen Schrecken, Schwindsucht und Fieber, die die Augen hinschwinden und die Seele verschmachten lassen … Und ihr werdet das Fleisch eurer Söhne essen, und das Fleisch eurer Töchter werdet ihr essen … Euch aber werde ich unter die Völker zerstreuen und hinter euch das Schwert zücken; so wird euer Land öde sein und eure Städte werden zur Wüstenei.»
Aber dieser unerbittliche, erbarmungslos scheinende Gott zeigte ein ganz anderes Gesicht, als er dem Mose mitten in der Wüste Ägyptens – dem biblischen Mizraim – aus einem brennenden Dornbusch zurief: «Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Jizhaks und Jaakobs … Gesehen habe ich das Elend meines Volkes, das in Mizraim ist, und sein Schreien ob seiner Treiber habe ich gehört; denn ich weiß seine Leiden. So bin ich herabgestiegen, es zu erretten aus der Gewalt Mizraims, und es hinaufzuführen aus jenem Land in ein schönes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig fließt …» Und Gott hielt sein Versprechen. Er erbarmte sich der versklavten Juden und führte sie hinaus aus dem Ägypterland. Er spaltete die Wasser und machte das Meer für die Flüchtenden zu trockenem Boden. Er ließ die Wasser zurückfluten und vernichtete Pharao mit allen seinen Wagen, den Reitern und dem gesamten Heer.
Es war der gleiche Gott, der Noah eine Arche hatte bauen lassen, bevor er die Sintflut auf die Erde schickte, weil die Bosheit der Menschen groß war und es ihn reute, daß er sie geschaffen hatte. Doch er rettete Noah und versprach ihm und seinen Söhnen nach dem Abfließen der Wassermassen: «Und ich errichte meinen Bund mit euch, daß nie wieder alles Fleisch vertilgt werde von den Wassern der Flut, und daß nie wieder eine Flut werde, die Erde zu verderben … Meinen Bogen habe ich ins Gewölk gesetzt, und er soll Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde.» So beschreibt die heilige Schrift der Juden im ersten Buch Mose, daß lange vor dem exklusiven Bund am Sinai ihr Gott einen Vertrag mit den Menschen schloß. Einen Vertrag, in dem Gott sich einseitig bindet und seiner Nachsicht mit den Menschen keine Grenzen setzt. Und der Regenbogen ist Zeuge, daß er ihn nie aufgekündigt hat.
In den Geboten vom Sinai warnt Gott die Juden vor engen Kontakten mit den fremden Völkern. Doch im gleichen Atemzug fordert er im dritten Buch Mose im neunzehnten Kapitel: «Und wenn sich ein Fremdling bei dir aufhält in eurem Land, so sollt ihr ihn nicht bedrücken. Wie ein Volksgeborener von euch soll euch der Fremdling sein, der sich bei euch aufhält, und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn Fremdlinge wart ihr im Land Mizraim.» Ehen zwischen Juden und Fremden verbietet der Gott vom Sinai. Doch die in der Bibel mit einem eigenen Buch ausgezeichnete Rut, die Urgroßmutter des großen Königs David, ist eine Fremde aus dem Volk der Moabiter.
Gott erwartet, daß die Juden seine Gesetze bedingungslos ausführen, ohne nach Gründen und Erklärungen zu fragen. Aber er will sie deshalb keineswegs unter die Knute toter Buchstaben zwängen. Durch den Mund des Mose ließ er seinem Volk sagen, was der Sinn dieses Gehorsams sei: Der Mensch soll den göttlichen Satzungen folgen, «daß er durch sie lebe». Im fünften Buch Mose im dreißigsten Kapitel steht die energische Forderung, sich für das Leben zu entscheiden: «Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch! So wähle das Leben, auf daß du lebst, du und dein Same.»
Die Tora, die fünf Bücher Mose, ist für das Judentum die eiserne Ration ewiger Wahrheiten, und sie scheut sich nicht, vor aller Augen einen paradoxen Gott zu entfalten. Der Gott, der durch Mose in der Wüste spricht, stiftet einen ewigen Bund und eherne Gesetze für sein Volk und wird zugleich aufgrund seiner Widersprüche zum Anstifter einer höchst dynamischen Religion. Weil dieser Gott in sich selbst fundamentale Gegensätze umfaßt, ist die Auseinandersetzung mit der Tora, den göttlichen Wahrheiten, seit dem verhüllenden Auftritt des Ewigen am Berg Sinai Motor des Judentums. Sie ist seit Jahrtausenden Lebenselixier für ein ganzes Volk wie für die Frömmsten unter ihnen.
Der Widerspruch selbst begann lange vor dem Sinai, als der wohlhabende Nomade Abram im nördlichen Syrien seine Zelte abbricht und mit seiner Frau, seinen Herden und Hirten in das südlich gelegene Kanaan zieht. Das erste Buch Mose beschreibt es im zwölften Kapitel: «Und der Ewige sprach zu Abram: ‹Zieh du aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und vom Haus deines Vaters nach dem Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein.» Und weil der Patriarch Abram untadelig war, schloß Gott auch mit ihm einen Bund: «Und ich will meinen Bund setzen zwischen mir und dir … und du wirst werden zum Vater eines Heeres von Völkern.» Von nun an hieß er Abraham. In Hebron ist der Stammvater des jüdischen Volkes mit seiner Frau Sara begraben. In jenem «Land von Milch und Honig», in das Generationen später – nach der Versklavung in Ägypten und langer Wüstenwanderschaft – der Gott Abrahams, Saras, Isaaks und Jakobs, der auch der Gott vom Sinai ist, die Juden führte.
Dieses Land westlich des Jordan in der Senke zum Mittelmeer wurde für die Juden heiliges Land, weil es Gott gehörte, der ihnen jeden Besitz daran versagte: «Das Land aber soll nicht für immer verkauft werden; denn mein ist das Land, denn Fremdsassen seid ihr bei mir.» Weil es Gottes Land war, war es heiliges Land. Weil es heiliges Land war, war es im religiösen Sinne rein, denn es stand in einer direkten Beziehung zu Gott. Die übrige Welt dagegen, die Gott nicht ausdrücklich zu seinem Besitz erklärt hatte, war – unter diesem religiösen Blickwinkel – unrein. Das bedeutet keineswegs Minderwertigkeit, denn nach der Bibel hat Gott die ganze Welt erschaffen und unmißverständlich für gut erklärt. Rein und unrein sind für den frommen Juden keine Kategorien von Gut und Böse. Diese Trennung errichtet auch keine sozialen Barrieren. Sie kennzeichnet vielmehr den Zustand der Heiligkeit, auf den das gesamte jüdische Volk verpflichtet wird. Seit dem Ereignis am Sinai gilt Gottes Forderung aus dem dritten Buch Mose für den jüdischen Gelehrten wie für den jüdischen Bauern: «So heiligt euch, damit ihr heilig werdet, denn heilig bin ich.»
Wenn nur das Land Israel heilig, das heißt rein, war, konnte auch nur dort ein Jude die Gebote seines Gottes voll erfüllen und rein, das heißt heilig, sein. Bekräftigt wurde diese Bindung an das Land Israel, als der weise König Salomo im vierhundertachtzigsten Jahr nach dem Auszug aus Ägypten, so berichtet es das erste Buch der Könige in der hebräischen Bibel im sechsten Kapitel, in Jerusalem einen prächtigen Tempel baute. Im Innersten des Tempels, dem Allerheiligsten, stand seit Beginn des ersten Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung die Bundeslade mit den Gesetzestafeln vom Sinai, die vorher in einem Zelt ihren Platz hatte. Und der Ewige sprach zu Salomo: «Ich heilige dieses Haus, das du gebaut hast, meinen Namen dort hinzusetzen für ewig, daß meine Augen und mein Herz dort seien alle Tage.»
So wurde Jerusalem vor Jahrtausenden zum Zentrum des geheiligten Landes. Auf dem Altar des Tempels hielten die Priester die Feuerglut am Leben, und täglich stiegen der Brandgeruch und der Rauch der Tier- und Speiseopfer empor zum Herrn. Im Jahre 597 vor unserer Zeitrechnung jedoch eroberte der babylonische König Nebukadnezar die Stadt auf dem Berg und zwang die weltliche und geistliche Elite der Juden, rund zehntausend Menschen, ins Exil nach Babylon. Zehn Jahre später setzten bei einem Aufstand die Babylonier Jerusalem mitsamt dem Tempel in Brand und deportierten nochmals Zehntausende.
Was den Juden ursprünglich wie eine endzeitliche Katastrophe erschien, erwies sich als tröstliche Revolution ihres Glaubens. Der Ewige, der bei Tag in einer Wolkensäule und bei Nacht in einer Feuersäule vierzig Jahre mit ihnen durch die Wüste gezogen war, hatte sich nicht an ein Haus aus Stein gekettet und war auch nicht an die Heiligkeit des Landes Israel gebunden. Der Prophet Ezechiel sah und verkündete seinem Volk, wie die Herrlichkeit Gottes den Jerusalemer Tempel vor der Zerstörung verlassen hatte. Die Verbannten konnten sicher sein, daß der Ewige mit ihnen ins Exil gegangen war. Als eine neue Generation im Jahre 538 die Gelegenheit bekam, zurückzukehren nach Jerusalem und einen zweiten Tempel zu bauen, zog sie daraus einen radikalen Entschluß: Viele Juden blieben an den Wassern Babylons, die ihnen offenbar zur Heimat geworden waren. So entstand – zum ersten Mal seit es das Land Israel als Heimstätte der Juden gab – in der Fremde, in der Zerstreuung (hebräisch: Galut; griechisch: Diaspora) eine große jüdische Gemeinde. Aus dem zwangsweisen Exil war die freiwillige Diaspora geworden, bestärkt durch den Propheten Jeremia. Er hatte die nach Babylon Verschleppten lange vor der möglichen Rückkehr ermuntert, im Exil Wurzeln zu schlagen, wie es im neunundzwanzigsten Kapitel seiner Schriften steht: «So spricht der Ewige der Scharen, der Gott Jisraels, zu allen Deportierten, die ich aus Jeruschalaim fortgeführt habe: Baut Häuser und bewohnt sie, pflanzt Gärten und eßt ihre Frucht! Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter, daß sie Söhne und Töchter gebären; mehrt euch dort und mindert euch nicht. Und strebt nach dem Wohl der Stadt, dahin ich euch fortgeführt habe, und betet für sie bei dem Ewigen, denn mit ihrem Wohl wird auch euch wohl sein.»
Die babylonischen Juden blieben. Sie fühlten sich zu Hause in einem fremden, nach ihren Glaubensvorstellungen unreinen Land. Sie erfüllten die Gebote, soweit es ihnen möglich war. Sie vergaßen nicht Jerusalem, das heilige Zion, und viele Kontakte gingen hin und her. Sie beteten in ihren Synagogen und blieben inmitten der vielen Götter dem Einzigen und Ewigen treu, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der sich als unnahbar und menschenfreundlich zugleich offenbart hatte. Und sie sollten in ferner Zukunft eine bedeutende Rolle für das Überleben des Judentums spielen. Mit der jüdischen Gemeinde, die freiwillig in Babylon blieb, begann vor zweieinhalb Jahrtausenden eine neue Epoche für das Judentum. Wer blieb, wählte für sich und seine Kinder das Schicksal einer religiösen und nationalen Minderheit und damit die ständige Auseinandersetzung zwischen Aneignung einer anderen Kultur, die ihre Spuren hinterließ, und Abgrenzung, um die eigene Kultur zu bewahren. Mit Babylon beginnt eine zweite jüdische Existenz, die nicht mehr fortzudenken ist aus der Geschichte: jüdisches Leben außerhalb von jenem heiligen Land, das der Ewige den Juden anvertraut hat. Seit dem babylonischen Exil gilt, daß auch in der Diaspora Juden über Generationen dem Glauben ihrer Väter und Mütter treu sind und die Lehre der Tora bewahren.
Ein halbes Jahrtausend später, als in Israel der Jude Jesus Freunde und Anhänger um sich sammelt, berichtet der Jude Philo aus Alexandria, ein unermüdlicher Vermittler zwischen griechischer Kultur und jüdischer Religion, stolz von den Niederlassungen seiner Glaubensgenossen an den Küsten des Mittelmeers und in den Weiten Asiens: «Jerusalem ist nicht nur die Hauptstadt des Landes Judäa sondern auch der meisten anderen Länder wegen der Kolonien, die es von Zeit zu Zeit zu den Nachbarn Ägypten, Phönizien und Syrien ausgeschickt hat … zu den fernen Ländern Pamphylien, Kilikien; in Asien bis nach Bithynien und die entfernten Gegenden von Pontus. Ebenso nach Europa, nach Thessalien, Böotien, Makedonien, Ätolien, Attika, Argos, Korinth und die besten Teile des Peloponnes. Nicht nur die Kontinente sind voll von jüdischen Kolonien sondern ebenso die bekanntesten Inseln wie Euböa, Zypern und Kreta.»
Die Mutmaßungen zur Zeit des Philo, daß allein in Ägypten eine Million Juden lebte, ist übertrieben. Aber in die Hunderttausende geht ihre Zahl dort sicherlich, denn das Land war nach Baylonien zum zweiten Schwerpunkt der Diasporajuden geworden. Allein in der Weltstadt Alexandria bewohnten sie zwei Stadtviertel. Umstritten ist auch die Statistik für alle damals lebenden Juden. Die Schätzungen bewegen sich zwischen fünf und zwölf Millionen. Doch zwei Entwicklungen stehen mit Beginn der römischen Kaiserzeit, als Augustus das römische Weltreich begründet, außer Zweifel: Bis auf die jüdischen Gemeinden in Babylonien, das zum Reich der Parther gehört, leben alle Juden inzwischen unter römischer Herrschaft; außerdem ist die große Mehrheit der Juden jetzt in der Diaspora zu Hause und nicht mehr in Palästina, dem ihnen von Gott zugewiesenen Land.
Wie weit sich die Bewohner Israels in alle Ecken der damals bekannten Welt vorgewagt hatten, schildert indirekt, aber eindrucksvoll die Apostelgeschichte im Neuen Testament der Christen. Es ist ein Bericht über jene Juden, die fünfzig Tage nach dessen gewaltsamem Tod am Pessachfest zu ihrem Meister Jesus hielten und sich in der Stadt des Tempels zu gemeinsamem Gebet versammelt hatten. Wie jedes Jahr feierten die Juden zu diesem Zeitpunkt Schawuot, das Fest des ersten Schnitts auf den Feldern. Es ist eines von drei Wallfahrtsfesten, an denen jeder männliche Jude gemäß der Tora zum Gottesdienst im Tempel verpflichtet war. Wer es sich leisten konnte, kam aus fernen Ländern als Pilger in die Heilige Stadt, die sich in diesen festlichen Zeiten in einen Bazar fremder Kulturen und Sprachen verwandelte – verbunden durch den Glauben an den einen Gott.
Die Apostelgeschichte erzählt, wie an diesem Schawuot, in christlicher Tradition das erste Pfingstfest, der Geist Gottes in Flammenzungen auf die Freunde und Anhängerinnen Jesu herabkommt, und alle plötzlich in verschiedenen Sprachen reden können. Das bleibt nicht verborgen unter den übrigen Pilgern. «Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt … Außer sich vor Staunen riefen sie aus: ‹Die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa! Wie kommt es, daß wir sie in unserer Muttersprache reden hören? Unter uns sind Parther, Meder und Elamiter, Leute aus Mesopotamien und Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten, dem libyschen Zyrene und aus Rom, aus Kreta und Arabien, Menschen jüdischer Herkunft und solche, die sich der jüdischen Gemeinde angeschlossen haben.»
Rom, der Mittelpunkt des Imperiums, ist dem christlichen Verfasser der Apostelgeschichte als einzige Stadt nicht ohne Grund eine Erwähnung wert. Doch lange bevor Christen in die Stadt am Tiber kamen, waren jüdische Gemeinden dort heimisch geworden. Im antiken Rom beginnt die Geschichte von Europas Juden.
Antike
3. Im alten Rom: Marcia, eine gute Jüdin
Im Schutz des Staates: zwölf Gemeinden unter Kaiser Augustus – Im Spiegel der Katakomben – Proselyten sind willkommen
Im Oktober des Jahres 59 vor unserer Zeitrechnung fand in der Nähe des Forum Romanum eine öffentliche Gerichtsverhandlung unter freiem Himmel statt. Viele Zuschauer hatten sich eingefunden. Die einen waren gekommen, weil der Fall ihre persönlichen Interessen betraf; die andern wollten sich den Auftritt des berühmten Cicero nicht entgehen lassen, der zusammen mit einem Kollegen den Angeklagten verteidigte. Es war Lucius Valerius Flaccus, ein Römer aus bestem Hause. Als Gouverneur der römischen Provinz Kleinasien hatte er drei Jahre zuvor das Gold beschlagnahmt, das die dort lebenden Juden gesammelt hatten, um es als ihren jährlichen Beitrag zum Unterhalt des Tempels nach Jerusalem zu schicken. Die Maßnahme des Flaccus war ein unerhörter Präzedenzfall, der ein religiöses Gebot verhinderte, das für alle Juden außerhalb von Palästina selbstverständlich war und sie mit ihren Glaubensgenossen im Heiligen Land verband. Gott selbst hatte im zweiten Buch Mose für jeden Juden einen halben hebräischen Schekel jährlich als Zuschuß für das Haus des Ewigen festgelegt; zwei Denare nach römischer und zwei Drachmen nach griechischer Währung. Die illegale Beschlagnahmung dieser Tempelsteuer war eine von mehreren Anklagen gegen die Amtsführung des Flaccus. Kein Wunder, daß die Nachricht vom bevorstehenden Prozeß sich unter den Juden Roms wie ein Lauffeuer verbreitet hatte und sie voller Spannung den Auftritt Ciceros erwarteten.
Wie üblich hatte der gefeierte, aber auch gefürchtete Redner der Hauptstadt seinen Auftritt als Schlußpunkt geplant. Maliziös warf Cicero dem Hauptankläger Laelius vor, schon mit der Auswahl des Verhandlungsortes Stimmung gegen den Angeklagten zu machen: «Wir kommen nun zu dem Punkt, der das Gold betrifft, das jüdische Gold. Nur wegen dieser Anklage hast du diese Örtlichkeit gewählt, Laelius, und diesen Mob. Du weißt, was für eine große Gruppe sie bilden, wie einmütig sie zusammenhalten, wie einflußreich sie in der Politik sind. Ich werde leiser sprechen und gerade so laut, daß mich die Geschworenen noch hören können. Denn es gibt genug Individuen, um diese Juden gegen mich und gegen jeden guten Römer aufzuhetzten …»
Cicero, der alte Fuchs, verschmähte keine Tricks. Ein Prozeß war für ihn wie ein Theaterstück, in dem er seine Rolle spielte, unabhängig von seiner persönlichen Meinung. Doch bei aller Lust an Übertreibungen, die seiner Sache dienten, wollte er sich durch seine Argumente nicht lächerlich machen. Lassen wir die diskriminierenden Töne beiseite, so enthüllt Ciceros Plädoyer, daß um die Mitte des ersten Jahrhunderts v. Chr. die Juden einen unübersehbaren Teil der römischen Bevölkerung ausmachten.
Für die Historiker liegen die Anfänge im dunkeln. Für die jüdischen Mitbürger des Cicero gehörte zum Schatz ihre Erinnerungen ein Ereignis, das Eingang in die hebräische Bibel fand, die gelehrte Juden im ägyptischen Alexandria aus dem Hebräischen ins Griechische übertragen hatten. Diese heilige jüdische Schrift in griechischer Übertragung, später als Septuaginta von den Christen hoch geschätzt und Grundlage der lateinischen Übersetzung des Kirchenvaters Hieronymus, war zur Bibel der Juden in der antiken Diaspora geworden. Sie lag im Toraschrein ihrer Synagogen, und im Gottesdienst wurde aus ihr vorgelesen. Denn die Juden außerhalb von Palästina hatten die Umgangssprache des römischen Weltreichs angenommen. Griechisch war zu ihrer Muttersprache geworden, das Hebräische ging fast ganz verloren.
Die hellenistische Kultur war übermächtig. Auch Jerusalem – Wallfahrtsort für jährlich Hunderttausende aus allen Teilen der Diaspora, Stadt des erwarteten Messias und des zukünftigen Weltgerichts – ist stärker von der griechischen Denk- und Lebensart geprägt worden als lange angenommen. Neben dem orientalischen Aramäisch, das das Hebräische verdrängt hatte, war Griechisch in Palästina zur zweiten Umgangssprache geworden. Vierzig Prozent aller erhaltenen Inschriften aus dem Jerusalem zu Beginn unserer Zeitrechnung sind griechisch. Jesus hat diese Sprache auf jeden Fall verstanden, wahrscheinlich auch ein wenig gesprochen. Paulus schrieb seine Briefe auf griechisch, und wenn er seine jüdische Bibel zitierte, dann ausschließlich in der Septuaginta-Übersetzung.
Die Septuaginta hat – im Gegensatz zur späteren, von den jüdischen Gelehrten kanonisierten Bibel – die zwei Bücher von den Makkabäern überliefert. Aus dem ersten Buch erfuhren die römischen Juden im achten Kapitel, wie alt die guten Beziehungen zwischen Rom und Palästina schon waren. Judas Makkabäus, erfolgreicher Anführer im Aufstand der jüdischen Bevölkerung gegen die syrische Fremdherrschaft, hatte im Jahre 161 v. Chr. zwei Vertraute von Jerusalem nach Rom gesandt, um Verbündete zu gewinnen: «So reisten Eupolemus und Jason nach Rom; es war ein sehr weiter Weg. Dort gingen sie in die Ratsversammlung und trugen ihr Anliegen vor. Sie sagten: ‹Judas, der auch der Makkabäer genannt wird, und seine Brüder und das Volk der Juden haben uns zu euch geschickt. Wir wollen eurer Friedensordnung beitreten, einen Beistandspakt mit euch schließen und in die Liste eurer Freunde und Bundesgenossen aufgenommen werden.› Der Antrag fand die Zustimmung der Ratsmitglieder. Die Ratsversammlung stellte eine Urkunde aus, deren Wortlauf auf Bronzetafeln eingraviert und nach Jerusalem geschickt wurde …»
Vier Menschenalter später nahm die Freundschaft eine makabre Wende. Im innerjüdischen Streit von einer Partei gerufen, stürmte Pompejus 63 v. Chr. in Jerusalem den Tempelberg. Seine Soldaten metzelten die diensthabenden Priester im Vorhof des Tempels nieder. Dann betrat der Feldherr aus Rom das Allerheiligste des Tempels, zu dem selbst unter den Juden allein der Hohepriester Zugang hatte. Pompejus beging ein ungeheures Sakrileg, auch wenn die göttliche Strafe nicht auf dem Fuße folgte. Vielmehr fand das Königtum der Makkabäer sein Ende, und Palästina kam unter die Oberherrschaft der römischen Weltmacht.
Als Pompejus im Oktober 61 seine Siege im Vorderen Orient mit einem aufwendigen Triumphzug am Tiber feierte, werden viele römische Juden den Anblick ihrer Glaubensgenossen aus Palästina, die zu Hunderten in Ketten dem Triumphwagen folgen mußten, nicht ertragen haben. Doch alle taten sich zusammen, um diese Glaubensgenossen, für die als Sklaven in den römischen Haushalten großer Bedarf war, so schnell wie möglich freizukaufen. Und das erwies sich als gar nicht so schwierig. Es hatte sich nämlich herumgesprochen, daß dieser Staat, so rücksichtslos er auch im internationalen Machtkampf seine Interessen verteidigte, die vielen Religionen in seinem weiten Reich nicht nur duldete, sondern ihre freie Ausübung schützte – egal, ob es Freie oder Sklaven betraf. Die jüdischen Sklaven konnten bei ihren römischen Herren darauf bestehen, gemäß den Vorschriften ihrer Religion nur bestimmte Dinge zu essen und am Schabbat nicht zu arbeiten. Verständlich, daß die meisten Herren sie gegen Bezahlung gerne wieder loswurden. So wuchs der Anteil der Juden in Rom in den Jahrzehnten vor der Zeitenwende erheblich. Der Ärger des Cicero über die jüdische Lobby, der sich in seiner Rede beim Flaccus-Prozeß Luft macht, hat einen wahren Kern.
Glaubt man der Überlieferung, dann versammelten sich im Jahre 4 v. Chr. über achttausend römische Juden auf dem Palatin, um eine Delegation aus Palästina zu unterstützen, die im Tempel des Apollo von Kaiser Augustus empfangen wurde. Für diesmal hatten die Juden kein Glück, doch zehn Jahre später tat der Kaiser, was die Juden einst von ihm gefordert hatten: Er setzte den verhaßten Herodessohn Archelaus in Palästina ab und verbannte ihn nach Gallien. Die eindrucksvolle Demonstration der römischen Juden für ihre Glaubensgenossen entsprach ihrer stattlich gewachsenen Zahl. Neuere Forschungen sind bereit, die maximale Schätzung von fünfzigtausend Juden in der Hauptstadt des Weltreichs zu akzeptieren, bei einer Gesamtbevölkerung von rund einer Million Menschen. Die Mehrheit der Juden, auch wenn viele ihrer Vorfahren Sklaven waren, besaß das römische Bürgerrecht. Sie mischten mit beim vielfältigen, aufregenden Treiben der Metropole und konnten die spöttisch-bösartigen Zeilen der Satiriker ohne Ängste zur Kenntnis nehmen, falls sie von ihnen hörten.
«Aber wenn der Tag des Herodes da ist, wenn die veilchenbekränzten Lampen, die auf den schmutzigen Fenstersimsen verteilt sind, ihre dicken Rauchwolken ausgespuckt haben, wenn die schlappen Schwänze der Thunfische sich auf den Tontellern runden und wenn die hellen Krüge bis an den Rand mit Wein gefüllt sind, beißt du dir heimlich auf die Lippen und erbleichst beim Sabbat der Beschnittenen.» Der Dichter Persius hat im fünften Jahrzehnt des ersten nachchristlichen Jahrhunderts am Freitag abend einen Spaziergang durch Trans Tiberim gemacht. So hieß das römische Stadtviertel Trastevere, als die Römer noch Latein sprachen. Nicht zufällig war es bei der städtischen Neugliederung unter Kaiser Augustus zur letzten, der XIV. Region, ernannt worden. Jenseits vom urbanen Zentrum am rechten Ufer des Tiber hatten die Zuwanderer aus alle Herren Länder – die das römische Weltreich nach und nach eroberte und sich als Provinzen einverleibte – ihr Quartier gefunden. In den hohen, überfüllten Mietblocks lebten bis zu hundert Menschen. Die engen Straßen erfüllte beißender Geruch, und der Lärm ebbte kaum ab. Manchmal stürzte krachend ein schlecht gebautes Mietshaus zusammen. Den Überschwemmungen des Tiber waren die Bewohner ebenso hilflos ausgeliefert wie der drückenden Hitze in den Sommermonaten.
In Trastevere – zwischen Afrikanern und Asiaten, Griechen und Ägyptern, Germanen und Syrern – haben sich die ersten römischen Juden und die meisten ihrer Nachkommen während der Antike einquartiert, weil sie sich Besseres nicht leisten konnten. Sie gehören zu denen in der Weltstadt, die froh sind, mit ihrer Familie täglich über die Runden zu kommen. Sie arbeiten in Wäschereien, in den Lagerhäusern und Werften am Fluß. Sie tragen Getreide, Holz und Steine von den Schiffen an Land und das begehrte Frischwasser durch die Straßen, die nicht an Wasserleitungen angeschlossen sind. Wer keine Arbeit findet, versucht sich als Bettler oder Wahrsagerin durchzuschlagen. Wer ein bißchen gespart hat, wagt den Sprung in den Stadtteil Subura. Dort, nordöstlich vom Forum Romanum und unweit der großen Paläste, ist stets etwas los. Bei Tag überbieten sich die Händler und Marktschreier. Bei Nacht erscheinen junge Männer und leichtlebige Damen. Hier gibt es für Juden die Chance, als Schneider oder Glasbläser Kunden zu finden oder ein Lebensmittelgeschäft aufzumachen.
Von den Juden im antiken Rom haben sich keine schriftlichen Zeugnisse erhalten, und kein steinerner Rest, der an sie erinnert, ist an der Oberfläche geblieben. Gemessen daran gibt es erstaunlich viel über sie zu erzählen. Zum einen kennen wir ihren privilegierten Status gemäß dem römischen Recht. Zum andern haben außer den antijüdischen Ausbrüchen, die heidnische Römer zu Papier brachten – darunter so prominente wie Seneca, Juvenal oder Tacitus –, stumme Zeugen die Jahrtausende unter der Erde überdauert und uns mehr Informationen überliefert als von jeder anderen Diasporagemeinde. Diese Zeugen sind aus Mörtel und Stein. Sie waren den Toten zugeeignet und geben seit ihrer Entdeckung ein umfassendes Bild vom Leben.
Für die Juden Palästinas war es nichts Besonderes, natürliche Höhlen als Grabkammern zu wählen. Warum sollten die römischen Juden nicht das Tuffsteingelände außerhalb der Stadtmauern nutzen und unterirdische Friedhofstädte in den weichen Stein hauen, wie ihre heidnischen Mitbürger es taten? Insgesamt sechs Katakomben wurden bisher in Rom entdeckt, deren Wände und Inschriften mit jüdischen Symbolen geschmückt sind, allen voran der siebenarmige Leuchter, die Menora.
Beim Erforschen des weitverzweigten Netzes von Gängen, mehrstöckigen Nischen und Kammern mit Tausenden von Gräbern wurden in den drei größten jüdischen Katakomben knapp sechshundert Inschriften gefunden. Damit gibt es in Rom mehr historische jüdische Inschriften als irgendwo sonst auf der Welt. Alles, was wir über Familie, Beruf und Lebensalter, über die Synagogen und die Kunst der römischen Juden sagen können und über ihre Bereitschaft, die Einflüsse der sie umgebenden Kultur aufzunehmen, setzt sich aus den Fragmenten der Katakomben zusammen.
Ohne eine gesicherte Rechtsgrundlage wäre die Stadt am Tiber den Juden wohl kaum zur Heimat geworden. Im Bürgerkrieg nahmen die römischen Juden gegen den verhaßten Pompejus, der den Jerusalemer Tempel geschändet hatte, und für Cäsar Partei. Ihre Glaubensgenossen in Alexandria standen ebenfalls auf Cäsars Seite. Aus Palästina eilte sogar der Hohepriester mit einer Truppe nach Ägypten, um Cäsars Soldaten mit Proviant zu versorgen. Der Sieger vergaß den Anteil der Juden an seinem Erfolg nicht. Cäsar erließ jene Edikte, die – zusammen mit den Ergänzungen seines Nachfolgers Augustus – zur Magna Charta der Juden im antiken Rom und im gesamten römischen Imperium wurden. Trotz mancher Irritationen blieben sie im Laufe der drei folgenden Jahrhunderte unumstößliches römisches Recht. Das Judentum war «religio licita», eine «erlaubte Religion» mit allen Vorteilen, die dieser Status mit sich brachte.
Die jüdischen Gemeinden bildeten sozusagen eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Die Juden besaßen Versammlungsfreiheit und durften so leben, wie es bei ihnen «nach Väter Sitte» üblich war. Wer ihre Synagogen beschädigte, wurde bestraft. Jüdische Männer waren nicht nur vom Militärdienst, sondern von allen religiösen Zeremonien im Zusammenhang mit dem Kaiserkult befreit. Gab es für die ärmeren Schichten Roms staatliche Zuwendungen an Geld und Getreide, so durften die Juden sie einen Tag später abholen, wenn die Verteilung auf einen Schabbat fiel. Religiöse Toleranz war die Grundlage einer Realpolitik, die dem römischen Vielvölkerstaat Dauer verlieh. Daß dies nicht nur Lippenbekenntnisse blieben, zeigte sich, als die Weltmacht von den Juden Palästinas und später von der jüdischen Diaspora im östlichen Mittelmeerraum in verzweifelte Kriege verwickelt wurde. Die römischen Juden hatten darunter nicht zu leiden. Sie wurden für das Verhalten ihrer Glaubensgenossen in anderen Teilen des Reiches nicht haftbar gemacht. Roms Führungsschichten waren zu klug, um mit Hilfe von religiösen Pressionen politische Ziele durchzusetzen.
Es waren die Juden von Trastevere, die zur Zeit des Pompejus erstmals in Rom eine jüdische Katakombe anlegten. Der unterirdische Friedhof von Monteverde liegt westlich der heutigen Bahnstation Trastevere im Distrikt Monteverde Nuovo. Als immer mehr Juden nach Subura zogen, wurde ihnen der Weg nach Monteverde zu weit, und so entstand gegen Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts eine zweite Katakombe außerhalb der Porta Pia im Nordosten der Stadt. (Knapp zweitausend Jahre später bewohnte der Diktator Mussolini direkt über den antiken jüdischen Gräbern in der Via Nomentana die Villa Torlonia.) Im zweiten Jahrhundert hatten die jüdischen Bürger Bedarf für einen dritten unterirdischen Friedhof, den sie nahe der Via Appia Antica anlegten.
Die Inschriften auf den marmornen Grabtafeln oder jene, die direkt in den Mörtel, der die Grabnischen schloß, geritzt oder gemalt wurden, verraten, daß die Familie im Zentrum des jüdischen Lebens stand. Die Toten sollen nicht nur als Individuen, sondern als Ehemann und Vater, als Ehefrau und Mutter, als Sohn oder Tochter, Großmutter oder Enkelkind im Gedächtnis bleiben. Zugleich spricht trotz wiederkehrender Formeln und Attribute ein persönlicher Schmerz aus den kurzen Zeilen. Einige Mitglieder der Gemeinde sind erstaunlich alt geworden: Eine Frau zählte 96, ein Mann 110 Jahre. Doch vor allem ist die Rede von Eltern, die ihre Kinder betrauern. Bei Kindern unter zehn Jahren war die Sterberate am höchsten, wobei es mehr Jungen als Mädchen traf. «Für Nunnus Verna, der 7 Jahre und 2 Monate lebte. Vernaclus und Archigenia setzten diesen Stein ihrem Sohn, den sie sehr vermissen.» Immer wieder wird auf beide Eltern hingewiesen: «Hier liegt Probus, ein Kind, das 2 Jahre, einen Monat und 3 Tage lebte. Er liebte seinen Vater, liebte seine Mutter. Friede seinem Schlaf.» Ein Stiefvater beklagt, daß er nicht mehr für den Toten tun kann: «Könnte ich, der dich ernährte, Justus, mein Kind, in einen goldenen Sarg legen … Hier liege ich, Justus, 4 Jahre alt, 8 Monate, Trost meines Stiefvaters. Theodotus, der Stiefvater, seinem allersüßesten Kind.»
Die kleinen Kindernischen liegen oft zu Dutzenden beieinander. Mitten darin ist ein Grab für zwei, um im Tode die nicht zu trennen, die in ihrem kurzen Leben Freunde waren: «Hier liegen Fortunatus und Eutropius, Kinder, die sich liebten: Fortunatus, der 3 Jahre und 7 Monate lebte, und Eutropius, der 3 Jahre und 7 Monate lebte. Friede ihrem Schlaf. Sie starben am gleichen Tag.» War es ein Unglücksfall oder vielleicht die Malaria, die im Sommer oft als Epidemie auftrat und an der Tausende starben? Manchmal wurde das intime Beisammensein der Familie über den Tod hinaus aufrechterhalten: «Hier liegt Primitiva mit ihrem Enkel Euphrenon. Friede ihrem Schlaf.» Unbesehen der eigenen Trauer versuchte ein Elternpaar seinem kleinen Sohn Mut zu machen, den es, kaum geboren, im dunklen Labyrinth unter der Erde zurücklassen mußte: «Hier liegt Samuel, ein Kind, 1 Jahr und 5 Monate. Friede seinem Schlaf. Sei unverzagt. Keiner ist unsterblich.»
Die Einsicht in die Sterblichkeit des Menschen verband sich für die Juden Roms mit dem Glauben an ein Leben nach dem Tod, wie er sich bei der Mehrheit aller Juden seit dem Ende des ersten vorchristlichen Jahrhunderts durchgesetzt hatte. Dahinter stand die Überzeugung, daß Gottes Macht grenzenlos ist und deshalb auch über den Tod hinausgeht. Wie man sich diese Auferstehung vorzustellen habe, war ungewiß, sicher nur, daß auch in dem neuen Leben Körper und Seele zusammensein würden. Vielleicht sind Anklänge daran in den Katakomben selten, weil es noch ein junger, diffuser Glaube ist. Vorherrschend ist die beliebte Formel «Friede ihrem/seinem Schlaf». Um so eindrucksvoller ist das Gedicht in lateinischen Hexametern, mit dem ein betrübter Ehemann seiner Frau Regina ein Denkmal setzt. Nach einundzwanzig Jahren, vier Monaten und acht Tagen hat der Tod ihre Gemeinschaft brutal beendet. Was bleibt als Trost? «Sie wird wieder leben, sie wird wieder das Licht sehen. Sie kann hoffen, zu jenem ewigen Leben aufzuerstehen, das nach unserem wahren Glauben den Gerechten und Frommen bestimmt ist. Sie hat es verdient, in jenem heiligsten Land ein Heim zu finden.» Dann zählt der Ehemann die Tugenden auf, die seine beschwörende Zuversicht rechtfertigen: Regina war fromm und führte ein keusches Leben, sie wurde von allen geliebt und beachtete das jüdische Gesetz – «wegen all dieser Taten ist dir zukünftiger Segen gewiß. In diesem Glauben findet dein trauernder Ehemann seinen einzigen Trost».
Unter den Juden Roms gab es auch Zyniker. In der Katakombe von Trastevere, wo Regina begraben ist, hat sich ein gewisser Leo für die Hinterbliebenen einen Spruch ausgedacht, dessen unausgesprochene Drohung unüberhörbar ist: «Meine Freunde, ich erwarte euch hier.»