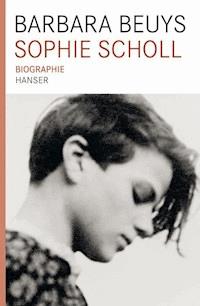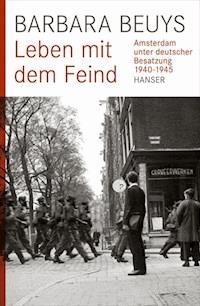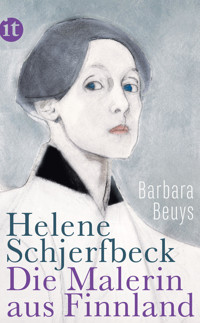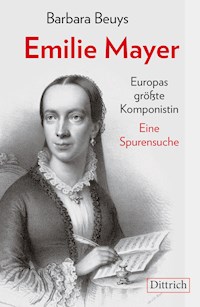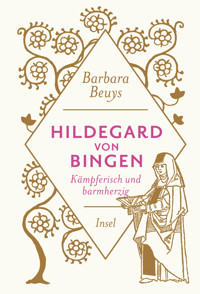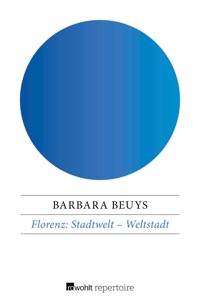9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer dieses Buch liest, muß alles vergessen, was er bisher über die Geschichte der Familie gehört hat: die Großfamilie unter einem Dach vereint; Kinder, die in Geborgenheit aufwachsen, der Vater als Tyrann und die Mutter als Heimchen am Herd. Das alles sind Klischees. Barbara Beuys deckt ungewohnte historische Zusammenhänge auf, zitiert zeitgenössische Quellen, läßt Zeugen aussagen, wie es wirklich gewesen ist. Hier wird durch zwei Jahrtausende deutsche Geschichte erzählt. Aber nicht als Abbild großer Politik und Abfolge von Kriegen, Verträgen und Herrscherhäusern, sondern als Einblick in vielfältige Formen des Zusammenlebens. Barbara Beuys erzählt die private Geschichte der Menschen, die vom Auftauchen der Germanen bis heute im Gebiet des Deutschen Reiches zu Hause waren: Wie haben sie gelebt? Welche Gefühle hatten die Eheleute zueinander? Wie prägte die Berufstätigkeit der Eltern das Familienleben im Mittelalter? Welchen Einfluß hatte die kirchliche Sexualmoral wirklich?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 813
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Barbara Beuys
Familienleben in Deutschland
Neue Bilder aus der deutschen Vergangenheit
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Wer dieses Buch liest, muß alles vergessen, was er bisher über die Geschichte der Familie gehört hat: die Großfamilie unter einem Dach vereint; Kinder, die in Geborgenheit aufwachsen, der Vater als Tyrann und die Mutter als Heimchen am Herd. Das alles sind Klischees.
Barbara Beuys deckt in diesem Buch ungewohnte historische Zusammenhänge auf, zitiert zeitgenössische Quellen, läßt Zeugen aussagen, wie es wirklich gewesen ist.
Über Barbara Beuys
Barbara Beuys, geboren 1943, Studium der Geschichte, Philosophie und Soziologie, 1969 Promotion mit einer Arbeit über die US-Präsidenten.
Weitere Veröffentlichungen bei Rowohlt: «Der Große Kurfürst», «Und wenn die Welt voll Teufel wär. Luthers Glaube und seine Erben. Fünfhundert Jahre Protestantismus», «Am Anfang war nur Verzweiflung. Wie Eltern behinderter Kinder neu leben lernen» und «Vergeßt uns nicht. Menschen im Widerstand».
Inhaltsübersicht
Unter jedem Grabstein liegt eine Weltgeschichte
Heinrich Heine
Was wir alles nicht wissen
Es ist ein Dutzend Jahre her, da saß ich an der Kölner Universität in den Vorlesungen von Professor René König. Fach: Soziologie. Thema: die Familie. Keiner seiner deutschen Kollegen hat sich über so viele Jahre so umfassend, intensiv und zugleich offen für alle neuen Aspekte mit diesem Thema beschäftigt. Ob es um die deutsche Familie geht oder die Indianer in den Pueblos von Neu-Mexiko – Forschung und Lehre stehen auf den Schultern dieses Grandseigneurs der deutschen Soziologie. Ein Mann übrigens, der die Präzision der Wissenschaft auf faszinierende Weise mit der Kunst der freien erzählenden Rede verbindet. Seit den Kölner Jahren hat mich die Familie als Gegenstand der Neugier und des Studiums begleitet. Daß für jemanden, dessen Neigung vor allem der Geschichte gilt, in diesem Zusammenhang die Soziologie am Anfang stand, ist nicht Zufall, sondern Spiegelbild der allgemeinen Entwicklung.
Die Soziologie entstand im 19. Jahrhundert als eine Wissenschaft, die nicht nur die Beziehungen zwischen Individuum und Gesellschaft bloßlegt, sondern Modelle entwickelt, Strukturen baut, die über die Wirklichkeiten gestülpt werden. Bei ihrer Geburt stand die Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft Pate. Dieser kritische Blick auf die Gegenwart ist wesentlicher Bestandteil geblieben, ob der Soziologe Feldforschung bei den Südseeinsulanern betreibt oder die moderne Industriegesellschaft unter die Lupe nimmt.
Ganz anders die Geschichtswissenschaft: Ihr Feld ist die abgeschlossene Vergangenheit. Sie hat es nur mit Toten zu tun. Die können sich nicht mehr rechtfertigen oder erklären. Sie haben ihr Leben gelebt – eingezwängt von vielerlei Bedingungen, die sie nicht ändern konnten. Doch das hat ihre Individualität nicht aufgehoben. Es gibt keine kollektiven Zahnschmerzen, wie Ludwig Marcuse notierte. So groß die Zwänge waren und so unwirtlich die Zeiten, so viele Erklärungen oder Anklagen wir aus dem Rückblick zustande bringen: Das Leid oder das Glück des einzelnen ist darin nicht aufgehoben. Es bleibt deshalb die Mahnung an den Geschichtserzähler: fair zu sein, gerecht, ja – im Zweifel für die Toten zu entscheiden. Sie können sich nicht wehren.
Weil es um Menschen geht, müssen wir uns auch endlich frei machen von der Vorstellung, Geschichte – in ein Koordinatensystem gebannt – sei eine aufsteigende Linie von einfachen primitiven Formen zu komplizierten Systemen; Aufstieg des Geistes von den Niederungen in die Höhe. Es ist verblüffend, wie oft dieses Modell von denen für die Vergangenheit aufgestellt wird, die es in der Gegenwart heftig bekämpfen. Nur ein Beispiel: Die meisten Soziologen, aber auch ein Historiker wie Edward Shorter («Die Geburt der modernen Familie») stimmen darin überein, daß sich Gefühle zwischen Eltern und Kindern erst in den letzten dreihundert Jahren entwickelt haben. Die Logik dieser Zeitgenossen: Kinder waren nur Arbeitskräfte, und vor allem entwickelt man keine Gefühle zu Wesen, von denen man weiß, daß sie höchstwahrscheinlich nicht lange leben werden. Stellt man diese These vom Kopf auf die Füße, dann bedeutet das: Unsere Zuneigung ist abhängig vom Fortschritt der Medizin. Ich liebe einen Menschen nur, wenn ich vorher weiß, daß er gesund ist. Was für ein Materialismus der Gefühle! Zudem ein Blick in die Vergangenheit, der nur die Maßstäbe der Gegenwart gelten läßt und deshalb unfähig ist, die Menschen einer anderen Zeit zu verstehen.
Tatsächlich gab es Jahrhunderte, die ihren Trost darin fanden, daß die Gestorbenen es bei Gott besser hatten als die Zurückgebliebenen. So schwer es uns fallen mag: Frömmigkeit darf nicht mit Fatalismus verwechselt werden. Gar nicht davon zu sprechen, daß diese angeblich kalte Beziehung zwischen Eltern und Kindern über den längsten Teil unserer Geschichte nicht mit Dokumenten belegt wird, sondern eine Hypothese ist, die man als Tatsache ausgibt. Hören wir nur einen Betroffenen. Nach dem Tod seiner Tochter Elisabeth, die mit zehn Monaten starb, schrieb Martin Luther: «Merkwürdig, was für ein trauerndes, fast weibisches Herz es mir hinterlassen hat; so sehr bin ich von Jammer erfüllt. Ich hätte nie vorher geglaubt, daß ein Vaterherz so weich gegenüber seinen Kindern sein könnte.»
Vieles, was für die Familie vergangener Zeiten als selbstverständlich gilt, wird in diesem Buch mit den Aussagen von Zeitgenossen widerlegt oder zumindest mit einem dicken Fragezeichen versehen. Bei diesem Thema kommt einem immer sofort der Balladenanfang ins Gedächtnis, der die ganze Vergangenheit wie in der Nußschale zusammenpreßt: «Urahne, Großmutter, Mutter und Kind/In dumpfer Stube beisammen sind.» Der Vater war auch da. Er werkelte und klopfte. Die Kinder sahen zu. Die Frau saß am Spinnrad oder stand in der Küche. Alles wurde selbst gemacht – Wurst und Butter, Kleider und Sauerkraut, Brot und Kerzen. Die Familie, das waren mindestens drei Generationen, die unter einem Dach lebten, eine abgeschlossene Festung bildeten, in der die Kinder geborgen aufwuchsen. «Großfamilie» heißt das Schlagwort und «die Familie als wirtschaftlicher Kleinbetrieb».
Davor schiebt sich sogleich ein anderes Bild. Nicht weniger selbstverständlich. Allerdings – wenn man es mit dem ersten vergleicht – dann passen beide nicht so recht übereinander: der Vater als Haustyrann, die Mutter als Heimchen am Herd, ihre Ehe nichts anderes als ein «ökonomisches Zweckbündnis». Auch zwischen ihnen gab es keine Liebe. Das Stichwort: patriarchalische Familie. Ein drittes Bild, ebenfalls immer wieder unwidersprochen ausgemalt: Es waren Industrialisierung und Kapitalismus, die im vorigen Jahrhundert einerseits die idyllische Einheit zerstörten, andererseits aber auch den Patriarchenstatus des Vaters untergruben. Die Frau wurde berufstätig, gewann neues Selbstbewußtsein. Emanzipation heißt das.
Das größte Phänomen: Alle diese in sich paradoxen Darstellungen werden von den Ideologen unterschiedlichster Lager unangefochten in den hitzigen Debatten über die Familie seit Jahren vorgebracht. Jede Gruppe saugt ihren Honig aus einer anderen Vergangenheit. Dabei gilt für alle Bilder, die sich in unser Gedächtnis gegraben haben: Es sind Thesen oder Modelle, die Soziologen im Laufe der letzten hundert Jahre aufgestellt haben – in Unkenntnis bzw. mit sehr beschränktem Wissen von historischen Verhältnissen, Grundlagen, Quellen.
In den Schulen werden diese Auffassungen über die historische Entwicklung der Familie heute an die nächste Generation weitergegeben: «Sie war die kleinste Wirtschaftseinheit, weil in ihr die Menschen gemeinsam erzeugten und verbrauchten … Sie umfaßte drei Generationen, die Großeltern, Eltern und Kinder. Dazu kamen das Gesinde, eine oft nicht geringe Zahl ledig gebliebener Onkel und Tanten und vor allem viele Kinder. Die Tafel war groß, und der hungrigen Mäuler waren viele. Die Industrialisierung hat diesen Familientyp gründlich zerstört.» («Arbeitsmaterialien für den politischen Unterricht».)
Es soll nicht verschwiegen werden, daß sich auch Zweifel an der mittelalterlichen Großfamilie eingestellt haben. Doch Konsequenzen für das Verhältnis zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern wurden daraus nicht gezogen. Unter dem neuen Namen der «großen Haushaltsfamilie», bei der es sich «nicht ausschließlich um Blutsverwandte» handelt, leben die alten Funktionen der Großfamilie und der angebliche Bruch zur Kleinfamilie in vollem Umfang weiter: «Die Kleinfamilie (Gattenfamilie) des 19. Jahrhunderts entstand im Zusammenhang mit der Industrialisierung und der Trennung von Wohnplatz und Arbeitsplatz. Die Produktionsmittel befanden sich nun nicht mehr im Bereich des ‹Hauses›. Damit verlor die patriarchalische Autoritätsstruktur des Vaters als Vorstand des ‹ganzen Hauses› eine wirtschaftliche Komponente.» (I. Weber-Kellermann: «Die Familie», ausführlich zitiert in «Texte für den politischen Unterricht».)
Wir wollen den Soziologen und Volkskundlern die Versuche, Vergangenheit mit ihren Methoden aufzuhellen, nicht vorwerfen. Ihr Feld ist nicht die Geschichte, und sie waren zweifellos die ersten, die sich mit diesem Thema beschäftigten. Über Jahrzehnte gab es keine historischen Forschungen, auf die sie zurückgreifen konnten. Das hat sich geändert. Längst beschränkt sich die Wissenschaft von der Geschichte nicht mehr auf Kriege, Verträge und Herrscherhäuser. Sie kümmert sich um die Unterschichten im Mittelalter wie um die Moral seiner Kaufleute, um die Säuglingsernährung im 18. Jahrhundert wie um die Freizeit der Arbeiter im folgenden. Wer heute noch den Historikern vorwirft, den Alltag vergangener Zeiten zu vernachlässigen, blamiert nur sich selbst. Allerdings sind diese Forschungen weit verstreut und meist nicht unter dem Stichwort «Familie» zu finden. Wer sich aufmacht, Familienleben über zweitausend Jahre darzustellen, muß sich auf die Suche begeben wie ein Archäologe. A propos: Die Archäologie des deutschen Mittelalters – abseits von Domen und Burgen – steckt noch in den Kinderschuhen. Doch hat man bei Ausgrabungen von Kloaken schon einiges mehr über den Alltag erfahren.
Noch ein Einwand: Ist denn nicht – mit der wachsenden Aktualität dieses Themas – in den vergangenen Jahren die Geschichte der Familie bereits geschrieben worden? Die Geschichte der Kindheit? Wer diese Bücher kennt, weiß, daß da ein wenig Etikettenschwindel getrieben wurde. Meist handelt es sich nur um die letzten dreihundert Jahre – mit der Begründung, vorher habe es gar keine Familie gegeben. Und geht es weiter zurück, dann werden die Jahrhunderte im Geschwindschritt übersprungen und zusammengefaßt, Hochzeitsriten und germanische Volksbräuche zitiert und vor allem ein Geschichtsbild entworfen, über das die Forschungen der Historiker in den letzten Jahrzehnten längst hinweggegangen sind. Vor allem das Bild vom Mittelalter hat sich radikal geändert.
Das Mittelalter ist ein Schwerpunkt dieses Buches, eine Epoche, die länger als ein Jahrtausend dauerte und die – von Klischees abgesehen – völlig aus unserm Horizont verschwunden ist. Jede Schilderung von Familienleben in der Neuzeit muß in die Irre gehen, wenn sie nicht versucht, diesen großen Brocken deutscher Geschichte ins Bewußtsein und ins Bild zu bringen.
Wonach fragen Untersuchungen, die sich mit der Familie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschäftigen? Sie fragen nach den Berufen der Eheleute. Sie beschreiben, wie die Mobilität – das Auto – und die neuen Kommunikationsmittel – Radio, Fernsehen, Telefon – das Familienleben beeinflußten, veränderten. Sie sehen in die Schulen, Diskotheken oder Vereine. Niemand käme auf die Idee, mit einem Blick ins Wohnzimmer das Familienleben erfassen zu können. Gelten für die Vergangenheit andere Regeln? Ich glaube nicht. Wer etwas wissen möchte über die germanische Familie oder die im Mittelalter, muß ebenfalls von der Stube hinaus in die Straße treten. Er muß das Leben in seinen vielfältigen Aspekten erfassen. Er darf Beruf und Schule, Wirtschaft und Moral nicht auslassen, denn Familienleben und die Welt draußen sind nicht zu trennen. Wer wissen will, wie das Familienleben ablief und was es prägte, muß ein möglichst umfassendes Bild von der Vergangenheit zeichnen. In diesem Sinn ist der Untertitel des Buches nicht nur ein hoher Anspruch, sondern sagt sehr genau, was hier versucht wird. Ein Wagnis, sicherlich. Dessen bin ich mir bewußt. Aber das muß auf sich nehmen, wer versucht, die vielen einzelnen Forschungsergebnisse aus neuester Zeit zueinander zu bringen und zu verknüpfen. Nicht als unangreifbare Festung, sondern als Ausgangspunkt zu neuen Diskussionen.
Schon bei den Germanen müssen wir etwas Wichtiges lernen. Nach ihrem ungeschriebenen Recht – das uns nur in der ihnen fremden lateinischen Sprache überliefert ist – trug die Frau selbst keine Verantwortung. Sie wanderte von der Vormundschaft ihrer Eltern oder Verwandten in die Vormundschaft des Ehemannes. Der sie schlagen, auspeitschen, verkaufen, ja töten konnte. Kann sich aber in einer Ehe ein Partner zum unumschränkten Herrn aufschwingen, wenn beide im Kampf gegen die Natur völlig aufeinander angewiesen sind? Es gibt Parallelen in Kulturen unseres Jahrhunderts. Die Marschbeduinen im Mündungsdelta von Euphrat und Tigris lebten bis vor wenigen Jahren fern aller Zivilisation auf kleinen künstlichen Inseln. Selbstverständlich sind sie fromme Moslems. Doch ihre Frauen tragen keinen Schleier, treten selbstbewußt und selbständig gegenüber Fremden auf. Sie sind nach der Arbeitsteilung in der Ehe für das Vieh verantwortlich. Eine lebenswichtige Aufgabe, die sie völlig in eigener Regie handhaben. Alleine fahren sie auf ihren Booten in entfernt gelegene Gebiete, um Nahrung und Schilf zu holen. Mag im Koran auch anderes über die Rolle der Frau stehen. Wir können uns im eigenen Haus umsehen: Erfahren wir nicht selber täglich, wie groß auf vielen Gebieten die Kluft zwischen Theorie und Praxis ist? Und das muß ja nicht immer zu Lasten der Praxis gehen. Rechtliche Konstruktionen allein garantieren jedenfalls kein getreues Abbild der Wirklichkeit.
Auch von Karl dem Großen wird in diesem Buch erzählt, einem Menschen voller Lebensfreude, der die Geselligkeit im Kreis seiner Familie liebte. Und da höre ich einen Einwand: Man solle sich lieber an den kleinen Mann halten und die Herrschenden vergessen, weil sie stets von der Geschichtsschreibung bevorzugt wurden. Noch ein Mythos, der bei genauem Hinsehen nicht standhält. Einige wenige Persönlichkeiten – Barbarossa oder Friedrich II. –, Verträge, die die führenden Männer abschlossen, oder Kriege, in die sie ihr Land stürzten, gaukeln uns vor, wir wüßten über die Herrschenden Bescheid. Dabei sind selbst viele mittelalterliche Könige für uns im Dunkel. Von ihren Frauen gar nicht zu reden. Die paar Urkunden, die die Jahrhunderte überdauerten, sagen gar nichts über sie persönlich aus. Denn da steht nichts von ihren Gefühlen, und immer waren es andere, die über sie schrieben.
Der Herrscher im deutschen Mittelalter war kein absolut Regierender. Der Adel bestimmte. Eine Elite von vielleicht fünf Prozent der Bevölkerung. Wer sich über sie informieren möchte, wird kein Buch finden, das ihr Leben im Mittelalter umfassend beschreibt. Es gibt keines, und wahrscheinlich wird es nie eins geben. Wir haben viel zu wenig Zeugnisse, um diese Elite Gestalt werden zu lassen. Und wenn einmal in den Urkunden ein Name auftaucht, bringt er uns nicht weiter. Denn bis ins 13. Jahrhundert gab es keine Familiennamen. Der Vorname allein verriet in höheren Kreisen, woher einer kam. Er wurde innerhalb der Familie weitergegeben, vom Vater auf den Sohn, von dem auf den Enkel. Auch nächste Verwandte durften ihn benutzen. Hat der Forscher von einer adligen Familie aus gleichem Zeitraum ein paar Urkunden, in denen derselbe Name auftaucht, steht er vor einem Puzzle, das meistens unlösbar ist. Wer ist der Vater? Wer der Sohn? Oder handelt es sich vielleicht um einen Vetter? Für adelige Frauen gilt das gleiche.
Aus diesen Zeiten nicht nur einen Namen zu haben, sondern eine Person damit identifizieren zu können, läßt den Erzähler aufatmen. Will er Geschichte plastisch werden lassen, muß er ein doppeltes Wagnis auf sich nehmen: von einzelnen Persönlichkeiten Allgemeines herleiten und zugleich aus dem Allgemeinen individuelles Leben formen. Das gilt nicht nur für den frühen Adel, sondern ebenso für das städtische Bürgertum, das am Ende des 13. Jahrhundert in einzelnen Haushaltsbüchern und Kaufmannsbüchern erstmals faßbar wird. Je mehr man forschte, desto größer wurden die weißen Flecken auf der historischen Landkarte. Heute kann ein angesehener deutscher Professor die Frage stellen, ob das ganze Rittertum nicht «ein Hirngespinst» sei. Der Ritter, Symbol christlich-abendländischer Kultur, ist zum Streitobjekt der Forschung geworden. Ob er adlig war oder nicht, und woher er überhaupt kam, bleibt wohl sein Geheimnis. Nur über eins ist man sich inzwischen einig: Die deutschen Minnesänger dürfen wir nicht befragen, wenn es um adliges oder ritterliches Leben geht. Was sie in ihren Liedern erzählen, übernahmen sie aus der französischen Dichtung. Sie stellten ein Ideal auf, halfen, es zu verbreiten. In Wirklichkeit dachten die Burgherren nicht an «minne» und eine «liebe frouwe», sondern an den Ertrag ihrer Milchkühe und Felder.
Genau so unbrauchbar für den Alltag der Eheleute ist, was Thomas von Aquin, der Kirchenlehrer, über die Ehe oder die Sexualität schrieb. Selbst von den Theologen kannte für Jahrhunderte – vor dem Buchdruck – nur eine Handvoll in Europa seine Schriften, von den Laien gar nicht zu reden. Das gleiche gilt für andere berühmte Persönlichkeiten des Mittelalters. Doch wir haben zu diesem privaten Bereich einige Zeugnisse von anderen, die dem Volk aufs Maul schauten, sich seinen Fragen stellten und ganz konkrete Ratschläge gaben. Es sind die Mönche der Bettelorden, am Anfang des 13. Jahrhunderts entstanden, deren berühmtester deutscher Vertreter für diese Zeit Berthold von Regensburg ist. Tausende hörten ihm zu. Seine Predigten wurden mitgeschrieben – aber niemand kam auf die Idee, etwas über seine Herkunft zu schreiben, sein Alter, seine Person. Unwichtig. Wir müssen umlernen. Dafür erfahren wir, daß Familien-, Ehe- und Kinderprobleme immer wieder von seinen Zuhörern angeschnitten werden. Kein Zweifel: Hauptakteure in diesem Buch sind jene, deren Name in keinem Lexikon steht. Besonders aus den ersten drei Jahrhunderten nach der Reformation bis hinein in die Aufklärung werden Menschen und ihre Lebensläufe dargestellt, Ehepredigten und Leichenreden zitiert, die bisher in den Archiven der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel schlummerten, für diesen Zeitraum eine der größten Fundgruben auf dem Kontinent.
Die Herrschenden oder die berühmt Gewordenen werden erwähnt, wenn von ihnen Typisches zu berichten gilt. Wenn sie Ideale vorlebten, denen andere zu folgen versuchten. Oder wenn es kritische Anfragen gibt. Hat Martin Luther den protestantischen Eheleuten mehr von der Freiheit eines Christenmenschen gebracht oder ungewollt mit seiner Ehe-Theologie der absolutistischen Obrigkeit jede Rechtfertigung gegeben, so viele und so hohe Ehehindernisse wie nie zuvor während des Mittelalters aufzubauen? War die neue Moral der Romantiker tatsächlich so fortschrittlich, wie sie sich gab?
Quellen und zeitgenössische Dokumente kommen ausführlich zu Wort, um ein lebendiges Bild vom Alltag der Menschen über zweitausend Jahre hinweg entstehen zu lassen. Aber ich bin nicht so naiv, an die wertfreie Aussage von Fakten zu glauben. Auch in diesem Buch gibt es Meinungen, Urteile, wird Geschichte durch das Temperament des Autors gesehen. Sonst wäre dieses Buch wie ein Porträt, dem die Augen fehlen. Vergangene Ereignisse werden mit darauf folgenden Entwicklungen verknüpft, Verbindungen zu unserer Gegenwart gezogen.
Die «Verknüpfungsgabe» hat Wilhelm von Humboldt die wichtigste Eigenschaft des Geschichtsschreibers genannt. Der Historiker steht nicht unter dem Zwang, Modelle aufstellen zu müssen; Widersprüche um jeden Preis aufzulösen; Wahrheiten zu verkünden. Geschichte handelt vom Leben. Leben jedoch ist immer voller Widersprüche. Sie machen auch vor der Wahrheit nicht halt. Unanfechtbare Wahrheiten gibt es nicht, sagt der alte Stechlin bei Fontane. Und wenn, dann sind sie langweilig.
Bei den heidnischen Germanen
Im Dorf an der Wesermündung
Die Ehe als Notgemeinschaft
Opfer für die Göttinnen
Die Geschichte der deutschen Familie begann vor knapp zweitausend Jahren in Rom. Dort empfing Cornelius Publius Tacitus, Sproß aus alter, angesehener Familie, Offiziere, Kaufleute und Reisende in seinem Studierzimmer. Alles wollte er wissen über jene Barbaren nördlich der Alpen, die drei Generationen zuvor, im Jahre neun nach Christus, die Legionen des Feldherrn Varus vernichtet und so die römischen Besatzer aufgehalten. Durch diese Niederlage blieb das Land östlich des Rheins das «freie Germanien». Im fernen Rom, der Weltmetropole mit 400000 Einwohnern, störte die verlorene Schlacht nicht weiter. Das Weltreich schien für die Ewigkeit gebaut.
Tacitus, der Historiker, dachte anders. Er blickte nach Norden, weil ihn das Treiben in seiner Vaterstadt ekelte. Er hatte sie satt, seine Mitbürger – Männer wie Frauen –, die ihre Langeweile mit Ehebruch, Mätressen, Liebhabern und nächtlichen Gelagen totschlugen. Je mehr er hörte, desto stärker imponierten ihm jene Germanenstämme, die so ganz anders waren: unverbraucht und unverdorben. So jedenfalls erzählte man es ihm. Vor allem stand bei ihnen die Familie in hohem Ansehen und galt nicht als lästige und überflüssige Konvention. Die Frauen lebten «in Zucht und Keuschheit, nicht verdorben durch lüsterne Schaustellungen oder verführerische Gelage». Kinder waren kein lästiges Übel, sondern ein Segen.
Je länger er schrieb, desto schärfer gerieten dem Tacitus die Gegensätze. Er hielt seinen Landsleuten den Spiegel vor und stempelte aus der Ferne zu einmaligen germanischen Tugenden, was der Kampf ums Überleben einem Naturvolk aufzwang. So entstand um das Jahr 100 nach Christus die «Germania». Rund 40 Taschenbuchseiten füllen die Aufzeichnungen des Tacitus heute. Es ist das einzige schriftliche Zeugnis über jene Menschen, die zu Beginn der neuen Zeitrechnung zum erstenmal in einem fest umrissenen Raum – zwischen Rhein und Elbe – auftauchen: die Germanen. Es sind verschiedene Stämme, kein einheitliches Volk. Diese Menschen als die ersten Deutschen in Beschlag zu nehmen, wäre grobe Täuschung. Es läuft keine gerade Entwicklungslinie von den Bewohnern Germaniens zu jenem späteren Gebilde, das den diffusen Namen Deutschland trägt. Allerdings sind solche gewaltsam hergestellten Traditionen keine Erfindung der neuesten Zeit.
Entstanden ist diese Legende schon vor 500 Jahren, als ein Manuskript der «Germania» von den deutschen Humanisten entdeckt wurde. Was für ein Fund zur Zeit der Reformation! Da ließ es sich ja mit Händen greifen, was sie in ihren Schriften verkündeten: «Daß die Germanen den Römern ganz und gar nicht unterlegen, weil sie ja immer Treue, Keuschheit, Gerechtigkeit, Freigiebigkeit und Lauterkeit pflegten.» So Jakob Wimpfeling, der am Beginn des 16. Jahrhunderts die erste Geschichte der Deutschen schrieb. In die damalige Gegenwart übersetzt: Luther gegen Rom! Was Tacitus über die Germanen schreibt, hat die Forschung inzwischen in vielem bestätigt. Nur vergaßen die klugen Köpfe im 16. Jahrhundert und manchem späteren, daß die Zeit nicht stehengeblieben war. Daß die Menschen im Deutschen Reich nicht denen vergleichbar sind, die im «freien Germanien» lebten. Und weil es so gut ins Bild paßte, nahmen die Nachgeborenen dann noch ein bißchen aus der skandinavischen Edda, die erst tausend Jahre nach der christlichen Zeitrechnung entstanden war, und dazu kamen noch die Heldenlieder von Siegfried und Brunhilde, auch nicht älter. Der Germanen-Mythos wuchs mit jedem Jahrhundert. Das 19. machte daraus steinerne Denkmäler und romantische Opern. Die Ideologen des Tausendjährigen Reiches übernahmen alles und kochten ihr eigenes blutiges Süppchen daraus. Die Wirklichkeit läßt sich aus alledem nicht herausfiltern und das deutsche Wesen noch weniger.
Warum die Germanen trotzdem am Anfang der deutschen Familiengeschichte stehen: Was die Männer und Frauen im Land zwischen Rhein und Elbe vor zweitausend Jahren dachten, die Traditionen, denen sie sich unterwarfen, die Art und Weise, wie sie als Eheleute miteinander lebten, die Götter, denen sie opferten – das alles stieß seit dem siebten Jahrhundert zusammen mit den Lehren der christlichen Missionare, die nicht nur einen neuen Gott, sondern auch eine neue Moral lehrten. Beides mit Gewalt durchzusetzen, halfen ihnen bald die christlichen germanischen Könige. Manches aus der alten heidnischen Zeit versank, wurde vergessen. Anderes nahm nur äußerlich eine andere Gestalt an. Wieder anderes veränderte sich und verband sich mit den fremden Lebensformen auf eine neue Weise.
Mit jedem Jahrhundert kamen andere Einflüsse hinzu: jüdische, arabische. Das Mittelalter entdeckte die griechischen Philosophen wieder. Alles befruchtete sich gegenseitig. Nichts blieb, wie es war. Das Leben ist konservativ und flexibel zugleich. Eine europäische Kultur entstand, die sich länger als ein Jahrtausend christlich nannte. Die Germanen, die sich während der Völkerwanderung über den ganzen Kontinent verstreuten, große Teile eroberten und beherrschten, stehen am Anfang dieses Prozesses. Und das allerdings ist historisch: Sie werden zum erstenmal faßbar in jenem Gebiet, das später Kernland des Deutschen Reiches ist.
Um ihr Leben nachzuzeichnen, ihren Alltag abseits von den Legenden faßbar zu machen, dürfen wir uns nicht auf spätere Aufzeichnungen stützen. Wir sind auf Spitzhacke und Bagger angewiesen, auf Grabbeilagen und dunkle Flecken, die die Pfosten germanischer Holzhäuser – selbst längst verrottet – im Boden hinterlassen haben. Es waren zwischen zwei und fünf Millionen Menschen, die zur Römerzeit als Vieh- und Ackerbauern in Germanien lebten. Der einheitlichste deutsche Siedlungsraum – und bis heute am besten erforscht – war Schleswig-Holstein und die Nordseeküste bis hinunter zur Wesermündung. Hier lebten in kleinen Siedlungsinseln zwischen lichten Wäldern vor zweitausend Jahren 200000 bis 250000 Germanen. Folgen wir ihnen bis in die Wesermündung. Heute noch heißt der Uferstrich nördlich von Bremerhaven «Land der Wurten». Wurten oder Warften nennt man die künstlichen Hügel aus Meeresboden, Mist und anderen Abfällen, auf denen die Germanen schon in vorchristlicher Zeit an der unbedeichten Nordseeküste ihre Dörfer planten. Ob die Flut einen Teil der Wurt zerstörte oder ob das Haus abbrannte, immer wieder wurde eine Schicht auf die andere gebaut. Bis zu sieben Meter wuchsen die Wohnhügel in die Höhe. Jetzt sieht man im Wurtenland nur die platte Marsch. Die Jahrhunderte haben das Land verändert. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg begannen die Archäologen durch die grünen Wiesen hindurch in die Germanenzeit vorzustechen. Schicht um Schicht trugen sie die Hügel ab, die sie unter der Ebene entdeckten und fanden den germanischen Alltag, so wohlkonserviert wie nirgendwo sonst.
Feddersen Wierde, zwischen 1955 und 1963 ausgegraben, war eins von acht Wurtendörfern an der Wesermündung, die im zweiten und dritten Jahrhundert n. Chr. ihre Blütezeit hatten. Jedes Dorf besaß 40 bis 50 Gehöfte, in denen 300 bis 500 Menschen lebten. Unter den langgezogenen Reetdächern wohnten Menschen und Tiere in einer großen dreischiffigen Halle, die viereinhalb bis siebeneinhalb Meter breit und manchmal bis zu dreißig Meter lang war. Das Vieh stand in getrennten Boxen aus Flechtwerk. In den größten Häusern konnten 50 Rinder untergebracht werden. Die Boxen entlang lief eine Jaucherinne, und in dem Teil, wo die Bewohner lebten, flackerte ein offenes Feuer, standen Webstuhl und Mühlsteine in einer Ecke. Hier, in der warmen, fensterlosen Wohnhöhle, hatte die Frau des Hauses das Sagen. Im altfriesischen Recht heißt es: «Wo man eine Frau heimführt mit Hörnerklang, mit Schar und Geleite, da soll sie immer den ehelichen Stuhl besitzen.» Wenn im antiken Griechenland die Männer tafelten, mußten sich die Frauen im Nebenzimmer aufhalten. Bei den Germanen saßen sie gleichberechtigt neben dem Mann und hoben die gefüllten Trinkhörner an den Mund. Das Zusammenleben war nicht nur eine Frage der Architektur. Es gab ja keine Küche, in die man die Frau hätte abschieben können. Sie war ein wichtiger Partner in der Arbeitsgemeinschaft Ehe und mit ihrer Arbeit nicht nur auf das Haus beschränkt. Die Kleidungsstücke, die sie webte, waren lebenswichtig, denn in den Jahrhunderten vor der Zeitwende hatte sich das Klima auf dem Kontinent permanent verschlechtert. Im dritten Jahrhundert nach Christus war die Durchschnittstemperatur auf neun Grad gesunken. Die Frau bereitete die Nahrung zu, wofür man eine Menge Kraft brauchte. In der vorrömischen Zeit wurden die Weizenkörner zwischen zwei Steinen zerrieben. Das dauerte bei einem Kilogramm 40 bis 60 Minuten. Jetzt, in Feddersen Wierde, erledigte das die Hausfrau in 15 bis 20 Minuten, denn sie besaß eine Mühle: zwei runde Steine, durch eine Achse zusammengehalten, und nur der obere brauchte in Drehung versetzt zu werden.
Die Frau war auch für das Vieh zuständig und half bei der Ernte. Hinter dem Haus lag ein Garten mit lebenswichtigem Gemüse, das sie anpflanzte: Bohnen, Möhren und Rettiche. Und hatte sie ein wenig Zeit, ging sie hinaus zum Kräutersammeln, um die Familie gegen Krankheiten zu schützen. Das Leben stellte nur eine Aufgabe: satt zu werden. Das schaffte man am besten zu zweit. Die Ehe war eine Notgemeinschaft, in der jeder in eigener Verantwortung einen wesentlichen Teil zum Überleben beitrug. Der einzelne, ob Mann oder Frau, konnte es nicht allein schaffen. Er brauchte einen Partner. Denn die Existenz einer weitverzweigten Sippe, die dem einzelnen Halt und Stütze bot, wird heute von ernsthaften Historikern bestritten: «Überdies sagen die Quellen nichts von einem Sippenverband … so zeigt sich, daß kaum etwas am hergebrachten Sippenbegriff unbestritten bleibt.» Den Mythos der Sippe hatte das 19. Jahrhundert entwickelt. Er basiert auf einer irrationalen «Gemeinschaft des Blutes». Was für Jacob Grimm und seine Kollegen eine wissenschaftliche Theorie war, haben die Nationalsozialisten dann in blutige Wirklichkeit umgesetzt.
Wenn es schon keine weitverzweigte Sippe gab, die alle band, wie stand es mit der Großfamilie, die Eltern, Kinder und Großeltern umfaßte? Ein unwiderlegbares Argument gegen diese Familienform – von den Germanen bis ins 19. Jahrhundert – ist die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen. Weil die Germanen seit dem dritten Jahrhundert nach Christus ihre Toten nicht mehr verbrannten, sondern die Leichname bestatteten, ist das «Knochenmaterial», das untersucht werden kann, unbegrenzt, und die Archäologen sind inzwischen – unter Ausnutzung modernster technischer Hilfsmittel – wahre Zauberkünstler geworden. Sie bestimmen aus den Skeletten nicht nur Geschlecht und Alter, Krankheiten und Blutgruppen, sondern sogar den Cholesterinspiegel! Durch den Computer geschleust, summierten sich die Knochenfunde auf dem Germanen-Friedhof Hamfelde im Kreis Lauenburg an der Elbe zu folgender Statistik: Wer hier vor 2000 Jahren lebte, hatte im Durchschnitt die Chance, 27 Jahre alt zu werden. Die Hälfte aller lebenden Menschen war jünger als 20 Jahre. Damit lagen die Hamfelder sogar etwas über dem Durchschnitt. Die meisten Historiker geben den Germanen in diesen Jahrhunderten 20 bis 22 Jahre. In den vielen mittelalterlichen Jahrhunderten, die folgten, stiegen die Lebenschancen in guten Zeiten auf 35. Noch 1870 hatten sie im Deutschen Reich die 40 nicht überschritten.
Am gefährlichsten waren in diesen frühen germanischen Jahrhunderten die ersten Jahre: 65 Prozent aller Kinder überlebten sie nicht. Wer davonkam, hatte ungewöhnliches Glück, wenn er seinen Großvater oder die Großmutter kennenlernte oder die Tante und einen Onkel. Das war auch eine zweitrangige Frage, wenn kaum eine Chance bestand, daß man überhaupt mit den Eltern aufwuchs. Auf jeden Fall war es eine kleine Familie, in der man lebte. Jedem, wollte er nicht alleine den Kampf gegen Hunger, Krankheit und Naturgewalten aufnehmen, gebot die Vernunft, einen Partner zu suchen. Und wenn es ums Überleben geht, kann sich keiner den Luxus leisten, auf leidenschaftliche Gefühle zu warten. Außerdem war das Angebot knapp. Wer nicht leer ausgehen wollte, mußte bald zugreifen. Im ungeschriebenen Recht der Germanen hatte die Frau keinen eigenen Platz. Sie wanderte von der Vormundschaft ihrer Eltern oder Verwandten in die Vormundschaft des Mannes. Der durfte sie schlagen, peitschen, verkaufen, ja töten. Doch erfahren wir nicht selbst in unserem aufgeklärten Jahrhundert täglich, wie groß die Kluft zwischen Theorie und Praxis sein kann? Das muß ja nicht immer zu Lasten der Praxis gehen. Kann sich einer wirklich zum unumschränkten Herrn aufschwingen, wenn beide so aufeinander angewiesen sind?
Die Ehe war eine private Angelegenheit zum Überleben des einzelnen und zugleich eine öffentliche. Ohne Kinder waren nicht nur die Eltern – falls sie älter wurden – arm dran, sondern die dörfliche Gemeinschaft zum Aussterben bestimmt. Auf diese Gemeinschaft jedoch war die Familie genauso angewiesen wie die Ehepartner untereinander. Nur zusammen mit den Nachbarn konnte man der Flut trotzen, die Häuser wieder aufbauen und bei schlechter Ernte die Nahrungsmittel teilen. Kleinfamilie und Gemeinschaft bildeten die entscheidenden Pole im Leben jedes Germanen, beide eng aufeinander angewiesen. Strenge Regeln waren der Kitt, der die Gemeinschaften funktionsfähig hielt. Die verheiratete Frau blieb für die anderen Männer tabu, die unverheiratete Tochter mußte unberührt in die Ehe gehen. Eifersucht ist in gemeinsamen Notlagen ein schlechter Ratgeber. Lockere Sitten kann sich nur erlauben, wer mehr hat, als er zum Leben braucht. Deshalb fand keine Gnade, wer gegen die fundamentalen Regeln des Zusammenlebens verstieß.
In solchen Grenzsituationen zeigte sich allerdings, daß die rechtlose Frau in der Krise nicht auf Gnade hoffen konnte. In den meisten Fällen mußte bei Ehebruch nur die Frau büßen. Es ging aber auch anders. Bei Windeby im Kreis Eckernförde wurde 1952 eine Leiche entdeckt, die das Moor fast zweitausend Jahre konserviert hatte. Ein Mädchen, das knapp fünfzehn Jahre alt geworden war. Die Haare hatte man ihr bis auf ein kleines rotblondes Büschel geschoren. Sie trug nichts außer einem schönen doppelt genähten Pelzkragen und einer Binde über den Augen. Über ihrem Körper lag ein zerbrochener Stab. Beweis für eine Verurteilung? Einige Meter entfernt fand man eine männliche Leiche, mit einer Haselnußrute erdrosselt. Ein Mädchen – verheiratet? – liebte einen Mann. Vielleicht war auch er verheiratet? Als das «Verhältnis» entdeckt wurde, mußten beide im Moor sterben und wurden versenkt? Die Geschichte kann sich so zugetragen haben. Im achten Jahrhundert nach Christus berichtet der Germanenmissionar Bonifatius von den heidnischen Sachsen: Eine Frau, die Ehebruch begangen hatte, mußte sich selbst erdrosseln. Dann wurde ihr Leichnam verbrannt und über diesem Scheiterhaufen ihr Liebhaber aufgehängt.
Grausame Sitten. Doch sie sprechen keineswegs gegen die wichtige Stellung, die die Frau bei den germanischen Stämmen einnahm. Dafür zeugt ein Bereich, mit dem man nicht leichtfertig umging: der germanische Himmel. Muttergottheiten, die für die Fruchtbarkeit von Menschen, Tieren und Pflanzen verantwortlich waren, spielten dort eine bedeutende Rolle. Bei Tacitus gibt es eine geheimnisvolle Schilderung von der Verehrung einer Göttin: «Auf einer Insel des Ozeans ist ein heiliger Hain, in ihm ist ein geweihter Wagen, der mit einem Tuch überdeckt ist. Nur dem Priester ist es erlaubt, ihn zu berühren. Er merkt es, wenn die Göttin im Heiligtum anwesend ist, spannt dann Kühe an den Wagen und geleitet die Göttin mit großer Ehrfurcht. Freudig sind jetzt die Tage, festlich geschmückt all die Orte, welche die Göttin ihrer Ankunft und ihres Besuches würdigt … bis derselbe Priester die Göttin, die des Verkehrs mit den Menschen müde ist, in das Heiligtum zurückbringt. Dann werden Fahrzeug und Decken, und, wenn man es glauben will, die Gottheit selbst in einem verborgenen See abgewaschen. Dabei dienen Sklaven, die sofort der See verschlingt.»
Bis heute ist dieser Kult nirgendwo lokalisiert worden. Aber die Einzelheiten hat man, auf viele Plätze verstreut, entdeckt. In den Gräbern fanden sich als Beigaben kleine kostbare Wagen. Noch immer segnet die katholische Kirche mit feierlichen Umzügen und Weihwasser die Felder. Haine, Seen und frische Quellen waren den Germanen seit Urzeiten heilig. Am See von Oberdorla in Thüringen wurden über Jahrhunderte Tiere und auch Menschen geopfert. Dort fand man in einer Hütte am Ufer eine weibliche Kultfigur aus Holz: mit leicht angewinkelten Armen, plastischen Brüsten, einem langen Hals, auf dem ein rundlicher Kopf mit tiefen Augenhöhlen saß. In Thüringen ist auch die Überlieferung von Frau Holle zu Hause. Nach dem Volksglauben empfing sie die Seelen der Toten, bestrafte die Faulen und belohnte die Fleißigen. Erinnerung an eine Göttin, der man in Oberdorla am heiligen See Opfer brachte? In einer eisenhaltigen Quelle in Bad Pyrmont fanden sich viele Opfergaben von Frauen – Schmuck vor allem. Sie werden von einer Muttergottheit Kindersegen erfleht haben.
Am Ende des siebten Jahrhunderts, als die christlichen Missionare ihr Werk begannen, wurde eine seltsame Geschichte aufgezeichnet. Sie erzählt das Leben des iroschottischen Wanderbischofs Kilian. Er bekehrte in einer Burg bei Würzburg den germanischen Herzog Gozbert und dessen Gefolge. Als der Bischof jedoch den Herzog aufforderte, sich von seiner Frau, der Witwe seines Bruders zu trennen, weil die Kirche solche Verwandtenheiraten nicht gestattete, ließ der Machthaber den lästigen Mahner 689 n. Chr. ermorden. Dann fragte er das getaufte Volk, was mit den Mördern geschehen solle. Man bat den Herzog, die Mörder frei zu lassen. Der Christengott würde sich selber rächen. «Wenn es aber anders ist … so wollen wir der großen Diana weiterdienen, wie es auch unsere Väter taten und bislang gut dabei gediehen.» Es spricht alles dafür, daß sich hinter dieser romanisierten Diana eine alte germanische Göttin versteckt.
Herzog Gozbert bringt uns darauf, daß schon etliche Jahrhunderte zuvor in Feddersen Wierde weder Ur-Kommunismus noch Ur-Demokratie herrschten. Die Grabungen brachten es an den Tag: Es standen auf der Wurt Häuser von sehr unterschiedlicher Größe. Manche hatten nur einen winzigen Teil für das Vieh. Das Rätsel löste sich, als man im Innern Werkstattabfälle und Geräte fand: Knochen und Geweih fein gebündelt, Schnitzmesser, Hobel, Raspel und Stemmeisen. Es waren Handwerkerhäuser mit eigener Werkstatt. Hier wurden die bei den Germanen sehr beliebten und oft kunstvoll geschnitzten Kämme aus Knochen und Horn hergestellt, außerdem Holzteller, Löffel und Eimer. Zu jedem germanischen Dorf gehörte in dieser Zeit ein Zimmermann, der vor allem für den Hausbau gebraucht wurde. Wie zwischen den Eheleuten gab es also auch innerhalb der dörflichen Gemeinschaft schon Arbeitsteilung und Spezialisierung. Längst wurde nicht mehr alles innerhalb der Familie hergestellt.
Etwas abseits von den Bauern- und Handwerkerhäusern in Feddersen Wierde lagen deutlich abgesondert eine Festhalle und ein großes Haus ohne Viehboxen. Offenbar war der Besitzer auf die Viehzucht nicht angewiesen und bekam Fleisch und Milch von den übrigen Bewohnern. Auf seinem Grundstück fanden sich Abfälle von metallverarbeitenden Gewerben. Dieser Herr hatte auch den Schmied in seinen Diensten. Entweder gehörte ihm der Grund und Boden und die andern arbeiteten gegen Abgaben für ihn, oder er war ein reicher Händler. In seinem Haus lagen römische Tonscherben, Münzen und Glas. Die Wesermündung war eine wichtige Station auf der Route der römischen Händler, die die Nordseeküste entlang bis nach Skandinavien schifften und an den Flußmündungen Halt machten.
Die sozialen Unterschiede, die die Häuser und Abfälle in Feddersen Wierde verraten, spiegelten sich ebenso in den Gräbern auf dem festen Land. Es gibt heute keinen Zweifel: Die heidnischen Germanen lebten im Prinzip in den gleichen Abhängigkeiten, denen wir im christlichen Mittelalter immer wieder begegnen werden. Es herrschte eine führende Schicht, wir können sie Adel nennen, unter ihnen dienten leibeigene Bauern und Sklaven. Es gab arm und reich, hoch und niedrig. Sicher waren auf dem Herrenhof auch Mägde und Knechte beschäftigt. Denn die Frau des Mächtigen brauchte nicht auf dem Feld zu arbeiten. Wahrscheinlich mußten sie ihren Mann mit mehreren teilen. Die Einehe war für die Germanen keine Frage der Moral, sondern eine des Wohlstandes. Wie konnte ein Ehemann, der mit seinem kleinen Acker gerade eine Frau und ein paar Kinder satt bekam, daran denken, die Verantwortung für eine zweite Frau und noch mehr Nachwuchs auf sich zu nehmen? Die fränkischen Könige während der Übergangszeit zum Christentum hatten – obwohl getauft – unangefochten meist mehrere Frauen.
Die Reichen wollten auf ihren Reichtum auch im Jenseits nicht verzichten. Das galt für Männer und Frauen gleichermaßen. Eines der prächtigsten «Fürstinnengräber» aus dem späten dritten Jahrhundert wurde in Haßleben bei Erfurt entdeckt. Die «Dame von Haßleben» trug vor allem prächtigen Schmuck: Haarnadeln, Münzanhänger, ein Kollier aus Glas und Goldperlen, goldene Mantelschnallen, einen Ring aus Gold und einen aus Glas und silberne Amulettanhänger. In einer kleinen Tasche hatte man ihr dazu ganz alltägliche Dinge mitgegeben: ein silbernes Messer, eine silberne Nadel – die germanischen Damen stickten gerne – und zwei lange dünne Knochennadeln, die sie wahrscheinlich zum Stricken benutzten sollte. Nur wer im Leben einen geachteten Platz hatte, durfte im Tod auf solche Gaben Anspruch erheben.
Frauen waren doppelt kostbar: als Arbeitskraft und weil sie die Kinder zur Welt brachten. Das bedeutete für ihr Leben ein ungewöhnlich großes Risiko. Bei der hohen Kindersterblichkeit waren viele Geburten notwendig, um auch nur den Bestand der kleinen Gemeinschaft zu halten. Mehr als drei Geschwister haben nicht zur gleichen Zeit gelebt. Glauben wir Tacitus, dann wuchsen sie ohne Zwang auf, trieben sich bei dem Vieh herum, sprangen mit Vergnügen in jede Pfütze und waren nicht gerade ein Muster an Sauberkeit. Offenbar legten die Eltern keinen großen Wert darauf. Da die Erwachsenen tagsüber viel Arbeit hatten, waren die Dorfkinder sich selbst überlassen, – bis sie kräftig genug waren, um mitzuhelfen.
Die germanischen Eltern haben nicht aufgeschrieben, was Kinder ihnen bedeuteten. Doch können Menschen unter einem Dach wohnen, alles zusammen erleben und sich gleichgültig sein? Hinter den gläsernen Vitrinen im Landesmuseum von Schleswig stehen Dinge, die eine deutliche Sprache reden: Kleine Kochtöpfe aus Ton für den Puppenladen, die Mutter wird sie getöpfert haben. Bizarre Figuren aus Holz, Schlittschuhe aus Knochen, der Vater hat sie geschnitzt. Und dann liegt dort im Museum ein winziges Skelett, fast zweitausend Jahre alt. Zehn Jahre alt wurde das Kind, dann starb es. Die Eltern, sie lebten in Brunsbüttelkoog an der Elbmündung, begruben ihr Kind in einer Wiege aus Birkenholz unter der Türschwelle ihres Hauses. Als ob sie es in ihrer Gemeinschaft halten wollten, damit es nicht draußen auf dem Friedhof die ungewisse Reise ins Totenreich antreten mußte.
Die Kleinsten hatten auch schon Moden zu ertragen. Im 5. Jahrhundert nach Christus wurden die Thüringer von den Hunnen überrannt und besiegt. Die fremden Besatzer aus dem Osten brachten neue Sitten ins Land. Bald begannen die Eltern, ihren Säuglingen monatelang eine Schnur über Nase, Ohren und Hinterkopf zu binden, wie sie es bei den Kindern der neuen Herren sahen. Auf diese Weise wurde der noch biegsame Schädel steil nach oben gepreßt. Auch diese thüringischen Eierköpfe haben sich in den Gräbern erhalten.
Die Bewohner des «freien Germanien» waren keine Wilden, sondern Menschen, die in Gemeinschaften mit differenzierten sozialen Beziehungen lebten. Die ihren Toten Rasiermesser und Pinzetten, bronzene Schuhschnallen, feinen Schmuck und silberne Nadeln ins Grab legten. Doch sie kämpften ständig ums Überleben, unter Bedingungen, die für uns unvorstellbar grausam und primitiv sind. Vergißt man die Klischeebilder von heldenhaften Männern und blonden Frauen, dann läßt sich mit dem, was wir über den germanischen Alltag wissen, das Leben in der Familie andeuten. Der Mann war kein ewig prügelnder Haustyrann, die Frau weder Heroin noch Sklavin.
Was mit aller Vorsicht für den nördlichen Raum rekonstruiert wurde, findet eine ungewöhnliche und sehr plastische Bestätigung in jenem Gebiet, das die Römer dreihundert Jahre in ihrer Hand hatten, das sie mit ihrer Zivilisation sättigten. Als Cäsar an den Rhein vorstieß, wurde er von den Germanenstämmen nicht nur feindlich empfangen. Die Ubier im Kölner Raum begrüßten ihn als Beschützer vor den ständigen Einfällen feindlicher Brüder aus dem Osten. Als Köln im Jahre fünf nach Christus Provinzhauptstadt wurde, entwickelte sich ein friedliches Nebeneinander zwischen Bauern und Städtern. Die Römer bauten eine prächtige Stadt, außerhalb der Mauern entstanden Fabriken für Tongeschirr, Glasgefäße und Souvenirs jeder Art. Staunend erlebten die Ubier, was sie nie zuvor gesehen hatten. Die Römer merkten schnell, daß sie bei den Bauern, die aus dem Umland zu einem Besuch in die Stadt kamen, eine Menge Waren los wurden.
Nicht nur nützliche. So entstanden in den römischen Fabriken für die einheimische Bevölkerung kleine Skulpturen aus Ton, Nippes, in denen sie sich abkonterfeit sah. Die römischen Arbeiter formten, was ihnen offensichtlich typisch germanisch schien: ein Liebespaar aus einem Stück, Wange an Wange, so eng umschlungen, daß ein gemeinsamer Umhang sie zu umschließen scheint. Klobig, etwas plump, kein Römer hätte sich so dargestellt. Aber um so rührender kommt die Zärtlichkeit der beiden zum Ausdruck. Die Händler mußten wissen, was ihren Kunden gefiel. Und sie modellierten außer dem Paar eine ganze Ubier-Familie in Serie: Vater, Mutter und drei Kinder, aufgestellt zum Gruppenbild. Wird eine solche Idylle hergestellt und verkauft, wenn sie dem Käufer nichts bedeutet? Der Käufer aber muß in jedem Fall ein Germane gewesen sein, denn die Römer stellten sich andere Plastiken in ihre Villen.
Als am Ende des dritten nachchristlichen Jahrhunderts die «Dame von Haßleben» beerdigt wurde, ging für Europa eine verhältnismäßig ruhige Zeit zu Ende. Aus dem östlichen Raum drängten neue Stämme und brachten Bewegung in die Germanen zwischen Rhein und Elbe, die vor diesem Druck nach Westen auswichen. Der Grenzwall, den die Römer zu ihrem Schutz quer durch das Land von Remagen bis an die Donau angelegt hatten, wurde durchbrochen. Der Stamm der Franken eroberte nach 450 das römische Köln und bewohnte dann die antike Stätte. Die Sachsen zogen plündernd die Nordseeküste entlang. Das Unerhörteste war im Jahre 410 n. Chr. geschehen: Der Germane Alarich – Anführer der Goten – zog durch Italien, marschierte mit seinen Truppen in Rom ein und ließ die ewige Stadt plündern. Ein Weltreich war am Ende.
Trotz allem Pathos: Tacitus hatte realistisch in die Zukunft gesehen. Die Barbaren wurden die Erben Roms. Sie zogen neue Grenzen auf dem europäischen Kontinent und veränderten sein Gesicht. Aber sie wurden auch die gelehrigen Schüler der untergegangenen Welt. Germanische und christlich-antike Lebensformen mischten sich über Jahrhunderte zu einem neuen Alltag.
Die Merowinger und ihre Königinnen
Bei den christlichen Merowingern
Prinzessin Redegundesaus Thürigen
Aufstand im Nonnenkloster
Die Königin wird aufgewertet
Anderthalb Jahrhunderte nach dem spektakulären Fall Roms wanderte der aus Venetien stammende Dichter Venantius Fortunatus nach Norden über die Alpen und wurde am Hof des Frankenkönigs Chlothar I. in Poitiers empfangen. Königin Radegunde, Chlothars Frau, eine Fürstentochter aus Thüringen, schilderte dem Dichter, unter welchen Umständen sie Abschied von ihrer Heimat hatte nehmen müssen: «Wie rasch stürzen stolze Reiche zu Boden! Lang sich hinziehende Dachfirste, die in Zeiten des Glücks da gestanden haben, liegen nun, durch die furchtbare Niederlage gebrochen, verbrannt am Boden. Die Halle, die vorher im königlichen Schmuck geprangt hatte, bedeckt jetzt an Stelle gewölbter Decke, glühende Asche, Trauer erregend. Hochragende schimmernde Dächer, die mit rötlichem Metall verziert erglänzten, hat graue Asche niedergedrückt. Fürsten werden unter Feindesgewalt gefangen weggeführt, hoher Ruhm sinkt in elenden Staub hernieder. Die im gleichen jugendlichen Alter blühende Menge kämpfender Jungmannen hat ihr Leben vollendet und liegt im schmutzigen Staube des Todes. Die dicht gedrängte Reihe der vornehmen Königsmannen hat weder Grab noch Totenehren: Das flammende rote Gold mit ihren Haaren noch überstrahlend, liegt sie mit bleichen Gesichtern auf dem Boden hingestreckt! Ach, welch Verhängnis! Unbeerdigt bedecken die Leichen das Feld, und so liegt das ganze Volk in einem einzigen Grab. Nicht allein Troja hat seinen Untergang zu beweinen: ein ebensolches Blutbad hatte auch das Thüringer Land zu erleiden. Hier wird eine würdige Frau an den flatternden Haaren fortgerissen und kann von den heimischen Göttern keinen trauervollen Abschied nehmen. Nicht durfte der Gefangene einen Kuß auf die Haustür drücken und die, welche noch schauen wollten, nicht das Antlitz nach der Wohnung zurückwenden. Der nackte Fuß der Frau trat in das Blut des erschlagenen Gatten, und die zärtliche Schwester schritt vorüber an dem am Boden liegenden Bruder. Aus den Armen der Mutter gerissen, hing der Knabe an ihr nur noch mit seinem Blick, und niemand wusch unter Wehklagen seine Leiche … Ein jeder hat sein eigenes Leid gehabt, ich aber allein das Leid von allen: Der Schmerz des Reiches ist zugleich mein eigener Schmerz. Gut gemeint hat es das Geschick mit den Männern, welche der Feind getötet – ich allein habe alle überlebt und lebe, um sie zu beweinen.»
Es war im Jahre 531 n. Chr., da zogen die fränkischen Könige Theuderich und Chlothar I. aus der Familie der Merowinger, deren Reich von der Bretagne bis in die Hohe Rhön reichte, in Richtung Osten, schlugen am Flüßchen Unstrut, nördlich vom heutigen Erfurt, das Heer des Königreiches Thüringen so vernichtend, daß ihre Krieger über die toten Leiber der Überfallenen trockenen Fußes das Wasser überqueren konnten. Der thüringische König Hermafried und seine Familie zählten zu den wenigen, denen die Flucht gelang. Seine Nichte, Prinzessin Radegunde, und ihr Bruder wurden von den Eroberern als Beute ins Frankenland mitgeführt.
Viele Jahre später, als Venantius Fortunatus von der Prinzessin selbst die Klage über die verlorene Heimat, die Brutalität der Sieger hörte und aufschrieb, da hatte Radegunde längst erfahren, daß die Grausamkeiten der Menschen nicht auf das Schlachtfeld beschränkt sind. Das fremde Land, in das man sie verschleppte, der weite Raum bis zum Atlantik, war eine Generation zuvor endgültig von den Franken erobert worden. Die neuen Herren, ein Zusammenschluß mehrerer germanischer Stämme und ursprünglich zwischen Weser und Rhein zu Hause, waren nach Westen ausgebrochen und hatten die römische Kolonialmacht endgültig aus diesem Teil Europas hinweggefegt. Als der Frankenkönig Chlodwig, der Vater der beiden Thüringen-Eroberer, sich vom Bischof von Reims taufen ließ, zogen die Germanen jene Institution auf ihre Seite, die alle Anstürme der Barbaren und den politischen Zusammenbruch der antiken Welt überstanden hatte: die römische Kirche.
Es sind ihre Vertreter, vor allem der Bischof Gregor von Tours, die uns die Geschichte der merowingischen Königsfamilie überliefert haben. Daß sie diese kulturlosen Krieger verachteten, dürfen wir annehmen. Daß sie die Greuel der heidnischen Könige, für die das Christentum eine zusätzliche magische Kraft bedeutete, die man in seinen Dienst stellte, in den schwärzesten Farben malten, ist ebenso gewiß. Trotz alledem waren es tatsächlich rauhe und oft brutale Sitten, die an diesem Hof herrschten.
Schon unter dem mächtigen Chlodwig brach ein schwer erklärbarer Widerspruch auf. Das Reich, das er zusammenkämpfte, war für ihn Familienbesitz, und das sollte selbstverständlich für die kommenden Generationen so bleiben. Doch Chlodwig akzeptierte nur seine eigene engste Kleinfamilie. Jeder, der aus der weiteren Verwandtschaft als Konkurrent um die Macht in Betracht kam, wurde von diesem Tyrannen ohne Skrupel umgebracht. Eine Tradition, die sich innerhalb der Familie fortsetzte. Blut war für die Merowinger kein so dicker Saft, daß man vor Mord an seinesgleichen zurückschreckte. Das germanische Erbrecht begünstigte solche finsteren Überlegungen. Alle Söhne erbten den gleichen Teil. In unserem Fall gab es deshalb nach Chlodwigs Tod zwei Könige.
Jeder der beiden Brüder, die Thüringen für das Frankenreich unterwarfen, hätte gerne die Nichte des feindlichen Königs geheiratet. Denn das war germanische Überzeugung: Die Familie eines Königs, die sich immer von göttlichen Ahnen herleitete, besaß ein Charisma, ein Heil, das allen anderen Sterblichen abging. Es war gleichermaßen auf ihre männlichen und weiblichen Mitglieder verteilt. Wer eine Frau mit königlichem Blut heiratete, wurde nicht nur Erbe ihres Besitzes, sondern gewann der eigenen Familie noch ein wenig mehr Königsheil hinzu. Da das Angebot an königlich-germanischen Frauen so groß nicht war, führte solche Heiratspolitik zu verwickelten Beziehungen. Chlothar I. gibt das beste Beispiel. Seine sechste Frau, lange nach Radegunde, wurde Vultedrada, die Tochter des Langobardenkönigs. Vultedrada war vor ihrer Ehe mit Chlothar mit Theudebald, dem Enkel von Chlothars Bruder Theuderich verheiratet.
Chlothar I. entschied die Heiratspartie für sich. Radegunde, gerade dreizehn, kam auf einen königlichen Herrenhof bei St. Quentin, wo sie Taufe und Bildung erhielt, wie es sich inzwischen für eine fränkische Prinzessin geziemte. Sie war wohl zwanzig, als sie Chlothar heiraten mußte und in Soissons zur Königin gekrönt wurde. Da eine adlige Frau nicht gefragt wurde, mit wem sie ihr Leben teilen wollte, schon gar nicht in Radegundes Lage, hatte sie in diesem Augenblick keine Wahl. Doch die fremde Prinzessin zeigte, daß ihr Wille so einfach nicht gebrochen werden konnte. Sie pflegte wie zuvor, auch als Königin Arme und Kranke und übte sich in so strenger Askese, daß Chlothar ihr vorwarf, sie benehme sich wie eine Mönchin und nicht wie eine Königin. Als der eigene Mann eines Tages ihren immer noch gefangenen Bruder ermorden ließ, wagte Radegunde auszubrechen. Sie flüchtete in den Schutz des Bischofs von Noyon. Ein gefährliches Unternehmen, denn der König war mächtiger als der geistliche Herr.
Zuerst drohte Chlothar allen Beteiligten. Schließlich gab er nach. Was sollte er mit einer Frau, die ihm keine Kinder gebar? Von der Kirche erhielt der König eine gültige Ehescheidung, dafür schenkte er seiner Ex-Frau große Ländereien bei Poitiers. Radegunde gründete in der Stadt ein Kloster und nahm selbst den Schleier. Mit den Jahren lebten dort fast zweihundert adlige Damen, und Chlothar erkannte bald, wie nützlich diese Einrichtung war. Zwei seiner Enkelinnen, für die es keinen Mann gab, schickte er hinter diese Klostermauern.
Radegunde setzte sich mit ihrer neuen geistlichen Familie scharf von der Welt ab, die ihr nichts als Leid zugefügt hatte. Man kann es ihr nachfühlen. Sie verschrieb sich in Küche und Garten die niedrigsten Arbeiten – unerhört für eine adlige Dame – und verpflichtete ihre Mitschwestern zu Klausur und unermüdlichem Gebet. Solange sie lebte, war offenbar ihr Vorbild stark genug, die Gemeinschaft zusammenzuhalten. Denn kaum starb Radegunde 587, setzten sich die beiden königlichen Enkelkinder an die Spitze einer Protestbewegung. Sie verließen das Kloster und machten klar, warum sie dieses Leben nicht länger führen wollten: «Man erniedrigt uns an diesem Ort, als wären wir nicht Töchter von Königen, sondern von verachtungswürdigen Mägden.» Auf ihre Weise war die zweite Klostergeneration von Frauen genausowenig bereit, sich einem fremden, männlichen Willen zu beugen wie die Gründerin Radegunde.
Die Bischöfe, die den Nonnen ins Gewissen redeten, fanden kein Gehör. Viele geistliche Frauen heirateten, es kamen auch männliche Sympathisanten und alle zusammen besetzten sie eine Kirche in Poitiers. Ihre Forderung: Radegundes zweite Nachfolgerin, die Äbtissin Leubovera, müsse gehen. Als Priester und Bischöfe zu Verhandlungen in die Kirche kamen, wurden sie am heiligen Ort verprügelt. Die aufgebrachten Damen entführten die gichtkranke Äbtissin nebst der Reliquie, und ein Handgemenge zwischen beiden Parteien am Grab der heiligen Radegunde mußte ein Klosterknecht mit seinem Leben büßen. Daß Demut und Gehorsam typisch weibliche Tugenden sind, wollten die aufbegehrenden Frauen nicht akzeptieren. Die Fürstentöchter und ihre Anhängerinnen mischten mit, sie gaben sich nicht mit der Dulderrolle zufrieden.
Die Geschichte ging weiter. Der Äbtissin wurde der Prozeß gemacht. Hinter durchsichtigen Vorwürfen – sie habe sich einen Mann in Frauenkleidern als Diener ins Kloster geschmuggelt – trat schnell der grundsätzliche Dissens zwischen den feindlichen Parteien hervor. Wie Radegunde forderte Leubovera ein strenges klösterliches Leben von denen, die sich der Gemeinschaft anschlossen. Adel war für sie kein Grund zur Laxheit oder zum Müßiggang. Die Äbtissin setzte sich durch und blieb im Amt. Eine Königstochter beugte sich schließlich ihrem Regiment und kehrte zurück. Sie hatte niemanden, der sie aufnahm. Die andere war hartnäckiger. Der König schenkte ihr schließlich einen eigenen Hof, wo sie den Tod der verhaßten Äbtissin abwartete.
Als das nächste Jahrhundert anbrach, zeigte der Protest der königlichen Damen langsam Wirkung. Während der germanische Adel nach und nach die Bischofsstühle im Frankenreich besetzte und die wichtigsten Äbte stellte, wandelte sich auch das Klosterleben. Die unsichtbaren Trennwände zur Außenwelt bekamen Löcher. Geistliche und weltliche Mächte versuchten nicht mehr, streng voneinander abgegrenzt zu leben, sondern miteinander die Welt zu verändern. Die Kirche lebte nicht mehr wie auf einer Insel in einer bestenfalls gleichgültigen Umwelt. Die adligen Nonnen wollten sich nicht mehr abschließen, sondern über die Klostermauern nach außen wirken. Aus der asketischen Kirche wurde eine Adelskirche. Die Rebellinnen von Poitiers hatten einer neuen Entwicklung vorgegriffen. Und so abgenutzt das Wort ist: In ihrem Protest gegen die weltlichen und die geistlichen Väter lag auch ein Stück Emanzipation.
Trotz der Auseinandersetzungen um ihr Kloster wurde Radegunde bald nach ihrem Tod als Heilige verehrt, auch wenn die Rigorosität, mit der sie ihre Ideale von einem christlichen Leben verwirklichte, bei ihren Nachfolgerinnen nicht mehr gefragt war. Die Prinzessin hatte nur getan, was in den Evangelien stand: den Armen zu helfen und den Kranken beizustehen. Ganz ungehört blieb dieser Ruf bei den fränkischen Frauen nicht. Die Männer waren mit dem Handwerk des Krieges vollauf beschäftigt. Da bürgerte es sich langsam ein, daß für christliche Tugenden, die man ohne das Schwert üben konnte, die Frauen zuständig waren.
In der Pfarrkirche in Kempten, im Landkreis Mainz-Bingen, steht ein fränkischer Grabstein, der zu einem Gräberfeld südlich der Kirche gehört und von den Experten ins 6. oder 7. Jahrhundert nach Christus datiert wird. Auf vorgeritzten Linien hat der Steinmetz vor rund 1400 Jahren – in Latein, der Sprache der Besiegten und der Kirche – ein adliges Frauenleben zusammengerafft: «In diesem Grab ruht die Tochter des erlauchten Patrons Mactichild, deren Name genannt wird Bertichildis, der Verstorbenen, die in Frieden lebte eine kurze Zeit, 20 Jahre, 1 Monat. Sie lebte mit ihrem Manne Ebregisel fünf Jahre. Am Samstag zur 8. Stunde wurde sie (entrissen) durch göttliche Gewalt, geliebt im Volk. Den Witwen, Waisen oder Armen (sind) Almosen von ihr für die (Vergebung ihrer) Sünde (gespendet worden). Aus Mißgunst nimmt der Tod, was er nicht mehr zurückgeben kann.»
Nebenbei erfahren wir, daß diese fränkische Adlige mit 15 Jahren heiratete. Ob das die Regel war oder die Ausnahme? Niemand weiß es. Wir müssen es so stehen lassen, wie alle Bruchstücke, die uns über das Leben von Männern und Frauen der Merowingerzeit erhalten sind. Sie können unserer Phantasie nur Anstoß geben wie das Licht von Kerzen, die in dunklen Gewölben aufflackern, eine Szene sichtbar machen und wieder verlöschen.
Die vornehmen Franken, ob noch heidnisch oder schon Christen, behielten für eine Weile den germanischen Brauch bei, ihre Toten mit den Utensilien ihres Alltags und ihres Standes auszustatten. Die Ausgräber der Neuzeit fanden in den Gräbern adliger Frauen nicht nur prächtige Schmuckstücke. Im Rheinhessischen hatte man einer Dame einen Sperber auf die Totenreise mitgegeben, und in einem Grab bei Quedlinburg fanden sich die Knochen von zwei Hunden und einem Beizvogel. Kein Zweifel: Radegunde und ihresgleichen, wenn sie nicht strenge Isolation im Kloster wählten, zogen mit den Herren auf die beliebte Falkenjagd, und sie waren offenbar auch vom anschließenden Gelage nicht ausgeschlossen. Eine Frau, deren Grab 1959 sechs Meter unter dem Chor des Kölner Doms entdeckt wurde – sie war wohl zwischen 20 und 30 Jahre alt, mit außergewöhnlich kostbarem Schmuck ausgestattet –, hatte nicht nur eine Schere, sondern auch ein beschlagenes Trinkhorn zur Seite.
Nur vier Monate später stieß man hinter dem Frauengrab auf eine zweite Grabstätte. Darin hatte man, ebenfalls im 6. Jahrhundert, einen etwa sechsjährigen Jungen gelegt – und auch ihm unzählige nützliche Beigaben mitgegeben. Nicht nur ein richtiges Holzbett, auch Helm und Schild, Schwert, Axt, Spieß und Lanze und was der zukünftige Krieger sonst noch brauchte. Es gab Becher, Flaschen, Nüsse und Früchte und – einen ledernen Beutel, in dem sich eine Nähnadel aus Knochen und ein Wollfaden erhalten hatten. Wäre einem männlichen Wesen solches mit in den Tod gegeben worden, wenn der Umgang mit der Nadel ausschließlich Frauensache war? Eine ungewöhnliche Vorstellung, zugegeben. Doch der Tote unter dem Kölner Dom deutet an: Auch für Germanen lag es durchaus im Bereich des Möglichen, daß ein Mann sich selber die Knöpfe annähte oder ein Loch stopfte, wenn keine weibliche Hand zur Stelle war.
Die kostbare und umfangreiche Ausstattung vieler fränkischer Frauengräber läßt keinen Zweifel daran, daß diese adligen Toten im Leben einen wichtigen Platz eingenommen haben. Die Quellen dieser Zeit bestätigen, was die Gräber anzeigen. Zwar bleibt selbst die Königin stets in der Vormundschaft ihres Mannes und, nach dessen Tod, unter dem Schutz ihres nächsten männlichen Verwandten. Aber langsam bekommt ihre Stimme Gewicht, ihr Einfluß nimmt stetig zu. Rechtlicher Ansatzpunkt ist die «Morgengabe», die der Herrscher nach germanischem Brauch am Morgen nach der Hochzeit seiner Frau vermacht. Es sind große Ländereien und Städte wie Bordeaux, Limoges, Cahors, die den Merowingerköniginnen übergeben werden und deren fürstlichen Unterhalt nach dem Tod des Ehemannes sichern sollen. In diesem Besitz konnte die Königin Herrschaft ausüben, Anweisungen und Befehle geben. Die Morgengabe durfte nur mit Zustimmung der Ehefrau weiterverkauft oder verschenkt werden. Aber nicht nur Ehefrauen, auch Töchter bekamen immer häufiger Ländereien und Städte zum Geschenk, wenngleich der Anspruch darauf nicht einklagbar war, wie die königlichen Nonnen vom Kloster der Radegunde erfahren hatten.
Nicht nur allein im Gebiet der Morgengabe herrschte die Königin. Bald begann sie zusammen mit ihrem Mann königliches Land zu besitzen. Das Kloster St.-Germain des Prés bei Paris, so berichtet uns die Gründungsurkunde, wurde von König Childebert (gestorben 558) und seiner Gemahlin Ultrogotha gemeinsam gestiftet; eine Tradition, die das ganze Mittelalter hindurch fester Brauch war. Und schon Venantius Fortunatus nannte die Königin «domina palatii», die Herrin des Hofes. War es etwa keine hochpolitische Aufgabe, wenn der zukünftige König am Hofe von der Herrin, seiner Mutter, großgezogen wurde? War es nicht natürlich, daß sie für den unmündigen Sohn die politischen Geschäfte führte, wenn der König vor der Zeit aus diesem Leben abberufen wurde?
Seit der Königin Brunichilde (gestorben 614) setzte sich im Frankenreich gegen anfängliche Opposition des Adels die Regentschaft der Königin durch, wenn ihr Mann starb und so ein Machtvakuum entstand. Die Kirche förderte diese Entwicklung durch die eindeutige und unangreifbare Stellung, die sie der Ehefrau nach christlicher Lehre – im Prinzip – gab. Chlothar zeigte sich gegenüber Radegunde, die vor seiner Brutalität in den Schutz der Kirche flüchtete, nicht nur großzügig, als er ihr Ländereien schenkte und den Bau eines Klosters gestattete. Die Aufwertung der Frau hatte im Keim schon begonnen. Es war die Oberschicht, die zuerst davon profitierte. Auch ein Herrscher kann sich dem Zeitgeist nicht entziehen.
Karl der Große und seine Töchter
Der Einfluß der Äbtissinnen
Familienpolitik in der Kirche
Ratgeber einer Mutter für ihren Sohn
Sie saßen in St. Gallen und Fulda, in Trier und Eichstätt. Stunde um Stunde malten sie schwarze Buchstaben und verschlungene Ornamente auf gelbes Pergament und ließen das Leben durch das Raster der Ewigkeit fallen. Alltägliches zählte nicht, nur das Außerordentliche hatte vor ihren Augen Bestand. Alles irdische Tun war Bewährung für das jenseitige Ziel. Der einzelne Mensch verlor seine Persönlichkeit, wurde ein typischer Vertreter seines Standes im Kreislauf der Ordnungen.