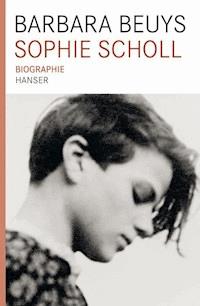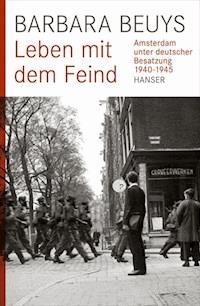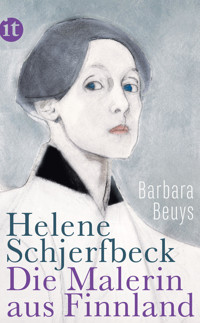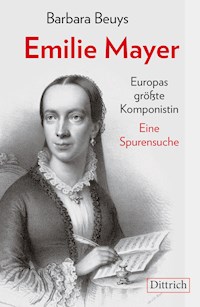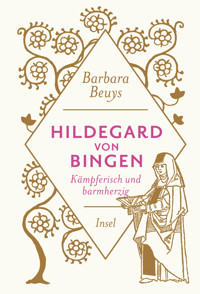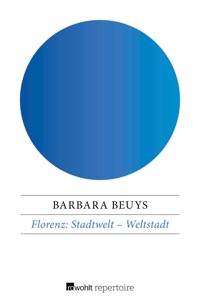
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Stadt der Medici ist allbekannt. Aber was war vorher? Wie in einem Laboratorium der Moderne begann vor über 700 Jahren in Florenz jener Prozeß der Urbanisierung, jene bürgerliche Kultur, die dem Westen seine zivilisatorische Gestalt gab und heute das Gesicht unserer Welt prägt. Die Historikerin Barbara Beuys entwirft ein Panorama der dramatischen Geschehnisse und geistigen Auseinandersetzungen im republikanischen Florenz vom Mittelalter bis zur Renaissance. Hier haben wir erzählte Geschichte, wie nur Barbara Beuys sie zu erzählen versteht: faktenreich, voll neuer Perspektiven und überraschender Fragestellungen, mit einer Vorliebe für die vernachlässigten Seiten des Lebens, mit Herz und auch mit Humor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Barbara Beuys
Florenz: Stadtwelt – Weltstadt
Urbanes Leben von 1200 bis 1500
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Die Stadt der Medici ist allbekannt. Aber was war vorher? Wie in einem Laboratorium der Moderne begann vor über 700 Jahren in Florenz jener Prozeß der Urbanisierung, jene bürgerliche Kultur, die dem Westen seine zivilisatorische Gestalt gab und heute das Gesicht unserer Welt prägt.
In ihrem Buch entwirft die Historikerin Barbara Beuys ein Panorama der dramatischen Geschehnisse und geistigen Auseinandersetzungen im republikanischen Florenz vom Mittelalter bis zur Renaissance.
Über Barbara Beuys
Barbara Beuys, Jahrgang 1943, ist im Rheinland aufgewachsen. Studium der Geschichte, Philosophie und Soziologie in Köln, Promotion 1969. Barbara Beuys ist Journalistin seit 1970 (Stern, Merian, ZEIT-Magazin). Wer die früheren Bücher von Barbara Beuys kennt, etwa «Der Große Kurfürst» (1979), «Familienleben in Deutschland» (1980), «Und wenn die Welt voll Teufel wär. Luthers Glaube und seine Erben» (1982), «Vergeßt uns nicht» (1987), die Geschichte des deutschen Widerstands gegen Hitler, der freue sich jetzt auf die Zeitreise in die Stadtwelt der faszinierenden Weltstadt Florenz.
Inhaltsübersicht
Gerade der Historiker liefert nie umwerfende Enthüllungen, die unsere Weltsicht von Grund auf verändern. Die Banalität der Vergangenheit besteht aus unbedeutenden Besonderheiten, die in ihrer Häufung zuletzt doch ein sehr unerwartetes Bild ergeben.
Paul Veyne, französischer Historiker
Warum Florenz?
Den wohl schönsten Blick auf Florenz hat man vom Kloster San Francesco in Fiesole. Hoch über der Stadt sieht man von den Hügeln auf das rötlichbraune Meer der Dachziegel im weiten Tal. Die Markierungszeichen der Arno-Metropole sind schnell erkannt: der schmale Turm der Badia und der wuchtige des Palazzo Vecchio, links davon ragt Santa Croce weit über die Häuser hinaus, und zur Rechten liegt der weite Komplex von Santa Maria Novella. In der Mitte, direkt neben dem marmornen Leuchtturm des Giotto, lagert der Dom mit seiner Kuppel. Mächtig, selbstbewußt und doch weder aufdringlich noch himmelstürmend. Terra, terra, wie die Italiener sagen. Entschieden diesseitig, erdverhaftet.
Im Zentrum nagen die Gifte der Busse, Autos und Vespas weiterhin an den steinernen Skulpturen, den bronzenen Türen, dem Mauerwerk der Fassaden. Rund sechseinhalb Millionen Besucher kommen jährlich nach Florenz. Auf den Stufen von San Lorenzo sieht der Tourist in der Saison von Frühjahr bis Herbst so manchen, der kein Obdach für die Nacht gefunden hat. Wer allerdings Florenz im Dezember besucht, ist wirklich ein Fremder, dem die Stadt dennoch Einblick gewährt. Das alte centro storico, das historische Zentrum, ist am Sonntagnachmittag bis weit in den Abend ein einziger, großer salotto. Dicht an dicht flanieren die Florentiner durch die Straßen, stehen in Grüppchen an der Piazza della Repubblica. Die Kleidung ist sonntäglich, von konservativer Eleganz, Pelzmäntel sind keine Seltenheit. Die Luft ist frisch. An den Straßenkreuzungen, wo die Maronenverkäufer die Glut unter den braunen Kugeln schüren, steigt ein süßlicher Duft in die Nase.
Ob aus der Vogelperspektive oder mitten im Herzen der Stadt – der Eindruck ist der gleiche: ein Bild von Wohlhabenheit und Schönheit, von Weltläufigkeit und lokalem Stolz, von Gediegenheit und Sinn für das Machbare. Eine bürgerliche Welt.
Die Florentiner waren immer ihre besten Propagandisten. Chronisten schrieben über diese Stadt, lange bevor man andernorts zum eigenen Ruhm zur Feder griff. Dantes Zeitgenosse Giovanni Villani, der 1348 an der Pest starb, begründete seinen Drang, die Geschichte seiner Vaterstadt aufzuschreiben, mit der Erkenntnis, daß die große Zeit Roms vorbei sei und die goldene Epoche von Florenz begonnen habe. Er hatte so unrecht nicht. Zu seinen Lebzeiten noch überflügelte Florenz andere, bis dahin führende Städte der Toskana, vor allem Pisa, Siena und Lucca, und wurde eine europäische Metropole. Florentiner Bankiers machten die Stadt am Arno zur finanziellen Drehscheibe des Kontinents, Könige und Päpste waren ihre Gläubiger. Als Klemens V. 1309 mit seinem gesamten Hofstaat das päpstliche Domizil von Rom nach Avignon verlegte, wurde die Kolonie der Florentiner Bankiers, Kaufleute, Handwerker, Agenten, Gastwirte und Polizisten – insgesamt weit über 500 Personen – bald die größte am Ort.
Florentiner Unternehmer beherrschten den Handel mit importierten, veredelten Tuchen und kostbaren, am Arno gewobenen Stoffen zwischen Lissabon und Konstantinopel. Florentiner Arbeiter waren Experten in der Bearbeitung von Wolle. Handwerker schufen Waren, deren Qualität auf den internationalen Märkten heiß begehrt war – weshalb die wirtschaftliche Potenz der Stadt den 1252 erstmals geprägten Goldflorin, fiorino d’oro, sofort und über Jahrhunderte zur europäischen Leitwährung machte. Aber Florentiner Kaufleute steckten ihr Geld nicht nur in finanzielle Transaktionen und günstige Schiffsladungen. Sie waren von zwei Dingen überzeugt: daß für den ewigen Ruhm ihrer Stadt und ihrer Person nichts eine bessere Rendite versprach, als in Bauten und Kunstwerke zu investieren; und daß zu Lebzeiten der Geldgeber die eindrucksvollen Kirchen, Skulpturen und Fresken den Stolz aller Bewohner auf ihre Stadt mehrten und in den gar nicht so seltenen Krisenzeiten den Willen zum Widerstand gegen eine Welt von Feinden entschieden förderten. Nicht Furcht und Schrecken hielten die Kommune am Arno im Innern zusammen, sondern gemeinsame Überzeugungen, die die Künstler durch ihre Meisterwerke propagierten und öffentlich machten.
Von dieser glorreichen Vergangenheit reden noch heute die Steine in Florenz. Die Touristen kommen nicht nur, weil clevere Reiseveranstalter die Trommel rühren. Trotzdem: Heute ist Florenz eine Stadt in der Provinz, wo arbeitslose farbige Flüchtlinge im Straßenverkauf ihr Glück versuchen; eine Stadt, geplagt von Abgasen, einem verseuchten Fluß und musealen Reichtümern, deren Konservierung Unsummen verschlingt. Wen interessiert da die Vergangenheit? Und außerdem: Füllen die Bücher über Florenz und seine große Zeit nicht Bibliotheken? Ist über diese Stadt nicht mehr geschrieben worden als über jede andere?
Als Florenz seinen Aufbruch zur Metropole begann, an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert, lebten in der Toskana gut 26 Prozent aller Bewohner innerhalb von Stadtmauern. Wie ein Magnet zog die Stadt am Arno die Landbewohner aus der Umgebung an: Um 1200 hatte Florenz rund 40000 Einwohner, um 1300 waren es 110000 Menschen. Nur Flandern konnte es mit einer solchen Konzentration städtischen Lebens aufnehmen. Überall sonst in Europa prägte zu 90 Prozent eine agrarisch-feudale Gesellschaft die Landschaft und die Bewohner. Heute ist es genau umgekehrt. Und dazwischen liegt jener Prozeß der Zivilisation, der ohne Verstädterung, ohne städtische Kultur undenkbar ist und auch in der Sprache seinen Niederschlag gefunden hat: civitas – civiltà – cittadino. Der Bürger ist Städter – cittadino – und lebt im Gegensatz zum contadino, dem Landmann, dem Bauern. Die städtische Kultur ist auch immer eine bürgerliche Kultur.
Kein Zweifel: Die moderne, europäische Welt brach sich endgültig in höfischer Epoche auf dem Umweg über den Absolutismus Bahn. Aber das war eine Ära, in der geistige Enge, staatliche Willkür und Unfreiheit in einem Ausmaß regierten, das den vorangegangenen Zeiten fremd war. Leicht wird darüber vergessen, wie viele Wurzeln unserer Zivilisation zurückreichen in jene Jahre, als die beiden Amerikas noch nicht entdeckt waren und Europas Grenzen, bei aller konfliktträchtigen Vielfalt, ohne Paß überschritten werden konnten.
Die Städte Oberitaliens und der Toskana sind – neben Flandern – Vorreiter der bürgerlichen Politik, Lebensart und Kultur gewesen und Florenz schließlich allen voran. Wie in einem Laboratorium der Moderne haben hier – nach dem Untergang der antiken Welt – Menschen erstmals den Versuch gemacht, auf engem Raum miteinander auszukommen und neue Formen des politischen, sozialen und religiösen Lebens auszuprobieren. Die Aufgabe ist, unter sehr veränderten Bedingungen und Einsichten, gleichgeblieben: Wie schafft man es, daß Menschen unterschiedlicher Gruppierungen, mit sehr verschiedenen Gewohnheiten, Überzeugungen und Lebenszielen auf einem umgrenzten Areal frei zusammenleben und doch aus Überzeugung einen Sinn für Solidarität und Gemeinschaft entwickeln? Wie können sich die Wünsche des Individuums und die Interessen des Ganzen ohne Schaden und Zwänge zusammenfügen? Über diese mittelalterliche «Bürgergesinnung» schreibt der Historiker Arno Borst, sie schaffe «den Raum der Freiheit eines sich selbst beherrschenden Verbandes durch Überordnung des gemeinen Besten über das Eigeninteresse, durch stolze Verwurzelung in der heimatlichen Genossenschaft und, über alle Grenzen hinweg, durch Mitverantwortung für ein menschenwürdiges Dasein aller».
Während im deutschen Reich Bürger und Adlige sich in getrennten Welten entwickelten und selbst jene Städte, die ihren geistlichen oder weltlichen Grundherrn abgeschüttelt hatten, sich ihre Freiheiten immer wieder als Privilegien von diesem – oder dem Kaiser, ihrem Verbündeten – teuer erkaufen mußten, war die Kommune am Arno seit 1250 eine Republik aus eigenem Recht. Schon im Frieden von Konstanz hatten die Städte des Lombardischen Bundes im Jahre 1183 gegenüber Kaiser Friedrich Barbarossa nach blutigen Kämpfen de facto ihre Selbständigkeit errungen. Nun nutzten sie den Kampf zwischen Kaiser Friedrich II. und den römischen Päpsten und das Machtvakuum nach Friedrichs Tod 1250, um sich endgültig aus diesen reichsrechtlichen Fesseln zu befreien. Die Republik, die 1250 in Florenz ausgerufen wurde, hatte – bei allen gravierenden Einschränkungen, besonders zur Zeit der Medici – über 250 Jahre Bestand.
Zu Beginn des 15. Jahrhunderts schreibt Leonardo Bruni, einer der führenden Humanisten und von 1427 bis 1444 Kanzler der Republik Florenz: «Achtsam trägt man dafür Sorge, daß in dieser Stadt die heilige Gerechtigkeit herrscht … daß man an diesem Ort die Freiheit wahrt, ohne die dieses Volk nicht bereit ist zu leben …» Große Worte, von denen die Realitäten weit entfernt waren. In der Republik Florenz regierten die reichsten und wirtschaftlich mächtigsten Geschlechter, das waren 60 bis 70 Familien. Hinter ihnen standen jeweils Cliquen und Parteiungen, die sich die Führenden verpflichtet hatten. Der Florentiner Klüngel, in keinem Gesetz vorgesehen, war die wichtigste Institution am Arno. Die höchsten und hohen, nur kurzfristig bemessenen Ämter in Politik und Verwaltung teilten sich maximal 3000 männliche Florentiner. Doch ein ganz so leeres Wort war die immer wieder beschworene libertà in Florenz trotzdem nicht. So unerreicht die republikanischen Ideale auch blieben, schon ihre beständige Beschwörung hat ihre Wirkung getan.
Als Michel Montaigne 1581 Florenz besuchte, die Kapitale des absolutistisch regierten Großherzogtums Toskana, scheint ihm in den Florentinern ein Abbild der «libertà perduta» auf, jener «verlorenen Freiheit», die längst das Merkmal einer verlorenen Zeit geworden ist. Die freie Kommune am Arno, 1530 endgültig untergegangen, war keine Demokratie im Verständnis des 20. Jahrhunderts. Im Florenz des späten Mittelalters und der Renaissance herrschten soziale Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Nur eine Minderheit besaß das Bürgerrecht. Von den allermeisten Bewohnern dieser Zeit ist keine Spur, kein Hinweis auf ihr Leben, auf ihre Gefühle geblieben. Das ist die eine Seite. (Worüber man nicht vergessen soll, daß in Deutschland die Frauen erst seit 1919 wählen dürfen, und in Köln zum Beispiel zwischen 1288 und 1396 nur rund 15 Patriziergeschlechter die Macht in den Händen hielten, die Kaufleute und Zünfte hatten nichts zu sagen. 500 Jahre später, so belegen es die Soziologen Ute und Erwin Scheuch 1992 in einer Untersuchung, haben rund 200 Personen, der parteiübergreifende Kölner Klüngel, die Stadt am Rhein fest im Griff.)
Trotz solcher Einschränkungen schlägt Gewichtiges zu Buche, ohne das Florenz nicht jene prototypische Rolle in Europa gespielt hätte. In dieser Zeit entwickelte sich am Arno eine für damalige Verhältnisse erstaunlich offene, tolerante Gesellschaft. Die Inquisition kam hier weniger als anderswo zum Zuge. Fremde Künstler waren willkommen, während sie zum Beispiel in Siena eine extra hohe Zunftgebühr zahlen mußten. Arnolfo di Cambio, Bildhauer und Dombaumeister, oder Giotto di Bondone kamen von außerhalb, wurden zu Lebzeiten schon hoch geehrt und selbstverständlich im Dom begraben. Coluccio Salutati und Leonardo Bruni, die berühmtesten Kanzler der Florentiner Republik, aber nicht dort geboren, verkehrten in den höchsten Kreisen der Stadt, wurden zum Motor neuer Entwicklungen. Niemand kam auf die Idee, sie als «Fremde» auf Distanz zu halten. Wenn sich auf der Piazza della Signoria Palla Strozzi, einer der reichsten Bürger von Florenz, Coluccio Salutati und Lorenzo Ghiberti trafen – und bei der Kürze der Wege begegnete man sich ständig irgendwo –, dann diskutierten alle zusammen fachmännisch über das Programm für die neue Bronzetür des Baptisteriums, die gerade in Ghibertis Werkstatt entstand. Oder Palla Strozzi lud die beiden ein, sich bei ihm ein griechisches Manuskript aus klassischer antiker Zeit anzusehen, das er gerade erstanden hatte.
Der Dominikanermönch Girolamo Savonarola war in Ferrara zu Hause. Sein Erfolg in Florenz zwischen 1494 und 1498 beruhte nicht auf finsterer Magie, war kein «Betriebsunfall» in der Florentiner Geschichte. Die Bewohner, quer durch alle sozialen Schichten, begeisterten sich für den Prior vom Kloster San Marco, weil er die Verwirklichung jener utopischen republikanischen Sehnsüchte versprach, die unter den Medici offiziell nicht angetastet, aber doch verleugnet wurden und keine Verteidiger mehr hatten. Die Zünfte besetzten seit 1282 die obersten politischen Ämter. Doch ein rigides, knöchernes Zunftregiment konnte sich am Arno nicht durchsetzen. In zwei Zünften gleichzeitig zu sein war nichts Besonderes, und wer auf dem Markt handelte und verkaufte, ohne Zunftmitglied zu sein, mußte auch nichts befürchten. Die verschiedenen sozialen Schichten lebten nicht im Getto, sondern Tür an Tür. Zwar drängten sich in manchen Gegenden – um Santa Croce und San Frediano vor allem – mehr Arbeiterwohnungen als sonstwo in der Stadt. Aber insgesamt verteilten sich arm und reich gleichmäßig in den Stadtvierteln.
Vernunft heißt die Tugend der Kaufleute, mögen sie noch so oft dagegen verstoßen. Nur wenn Konsens innerhalb der Stadtmauern herrscht, kann die Wirtschaft prosperieren, können Handel und Wandel gedeihen. In Florenz knüpften städtischer Adel und führende bürgerliche Geschlechter schon im Laufe des 13. Jahrhunderts familiäre Bande, taten sich geschäftlich zusammen und hatten so allen Grund, die gleiche Interessenpolitik im Stadtregiment zu vertreten. Mehr als anderswo gelang es dann nach 1350 auch der gente nuova, den neureichen, aus der Toskana eingewanderten Bürgern, zu Ansehen und Ämtern zu kommen.
Die Florentiner Republik hat sich von Anfang an auf das Vorbild aus antiker römischer Zeit berufen. Auch darum ist es wichtig, bis in ihre Anfänge ins 13. Jahrhundert zu leuchten. Der Notar Brunetto Latini, aus angesehener bürgerlicher Familie, wurde 1274 erster Kanzler der Republik. Aus dem Exil in der Provence zurückgekehrt, hat er die Vorliebe für französisch-provenzalische Lebensart an den Arno gebracht, und sein «Tesoretto», eine enzyklopädische Mischung aus Naturwissenschaft, Geschichte, Moral und Politik in Versen und auf italienisch, war eine beliebte Lektüre der Florentiner Kaufleute und Bankiers (die des Lesens und Schreibens sehr viel früher kundig waren als ihre Kollegen nördlich der Alpen). Wie sein Zeitgenosse Remigio de’ Girolami, Dominikaner und Professor an der Klosterschule von Santa Maria Novella, begeisterte sich Latini für das klassische Altertum, besonders die Stoa, Cicero war sein Favorit. Beide predigten als überzeugte Republikaner ihren Landsleuten, das Gemeinwohl über das individuelle Glück zu stellen. Und Remigio, der Mönch, stellte eine provokante, höchst irdische These auf: «Wer kein Bürger ist, ist auch kein Mensch.»
Das junge Christentum hatte in den Städten der Antike die Völkerwanderungen der germanischen Stämme überlebt. Seine Bischöfe kamen aus städtischem Adel und retteten aus Überzeugung das antike heidnische Bildungsgut hinüber in eine neue Zeit. Thomas von Aquin, Landsmann und Zeitgenosse von Latini und Fra Remigio, schuf aus der Synthese von Christentum und aristotelischer Philosophie ein Lehrgebäude, auf das sich die römische Kirche bis heute beruft. Kaum einer nahm Anstoß daran, als im letzten Drittel des 14. Jahrhunderts in Florenz eine Entwicklung begann, zu deren grundlegenden Stiftern und Förderern Luigi Marsili, Mönch im Kloster Santo Spirito, und Ambrogio Traversari zählten, Mönch – später Abt und enger päpstlicher Berater – im Kloster Santa Maria degli Angeli. Im Gegenteil: Alle Gebildeten in Florenz waren stolz auf diese geistlichen Führer und drängten sich zu ihren Diskussionsrunden und Kolloquien in engen Zellen und stillen Klostergärten. Damals begann am Arno eine Bewegung, die unter dem Etikett «Humanismus» in die Geschichte eingegangen ist.
Diese frühen Florentiner Humanisten vertraten – im Gegensatz zu ihren privatisierenden Nachfolgern in den Jahren der Medici-Herrschaft – einen engagierten bürgerlichen Republikanismus, der die Mitglieder der städtischen Elite zu einem aktiven Leben im Dienst der res publica aufforderte. Wie Remigio de’ Girolami ein Jahrhundert zuvor waren Coluccio Salutati und Leonardo Bruni überzeugt, daß nur der wirklich Mensch sei, der sich – gemäß den Idealen der römischen Republik – über die Bildung die bürgerlichen Tugenden angeeignet habe. Der Glanz der Medici-Jahre und ihre gefeierten Nachfolger wie Marsilio Ficino oder Giovanni Pico della Mirandola haben diese frühen Humanisten ins Abseits geraten lassen. Ein Teil ihrer politischen Werte und ihr fester Glaube an die Erziehbarkeit des Menschen finden sich fast 400 Jahre später bei den Vätern der amerikanischen Verfassung wieder.
Es gab nicht wenige Tage im Jahr, an denen Wollarbeiter und Unternehmer, Weber und Maurer ihre Arbeit beiseite legten und auf die Straßen und Plätze gingen. Festlich und fröhlich ging es zu, wenn die Einwohner von Florenz feierten. Es waren religiöse Feste, an denen sich die Stadt ihrer Identität vergewisserte, allen voran der 24. Juni, Namenstag von Johannes dem Täufer, dem Stadtpatron. An solchen Tagen gab es feierliche Prozessionen, in denen religiöse Bruderschaften Szenen aus der Bibel nachstellten, die schönsten Waren kamen in die Auslagen der Geschäfte, kostbare Tücher überdachten die Plätze als Sonnenschutz, und am späten Nachmittag traf man sich zu aufregenden Pferderennen quer durch die Stadt. Das Ensemble der Bauten war Kulisse, und alle Florentiner waren Mitspieler auf öffentlicher Bühne, jeder an seinem Platz. Die Menschen südlich der Alpen lieben das theatralische Spiel, das Drama vor aller Augen mehr als ihre nördlichen Verwandten. Fare bella figura, gute Figur zu machen ist Teil ihres Wesens. Und ganz besonders der Florentiner: «Aus der Fülle zeitgenössischer Nachrichtenquellen, aus Beschreibungen, Traktaten, Biographien, Novellen und Chroniken läßt sich stets die gewichtige Bedeutung herauslesen, welche die Florentiner (übrigens bis heute) der äußeren Erscheinung, Haltung und Kleidung, dem Betragen, den Worten und Gebärden beimaßen, wie sehr sie auf diese Dinge achteten und über deren Beobachtung die eigene und fremde Macht – oder Ohnmacht – erfuhren.» (Volker Breidecker: «Florenz oder: Die Rede, die zum Auge spricht».)
Religiöse Feiertage als politische Demonstrationen, nüchternes kaufmännisches Kalkül und ein unerschütterlicher Glaube an die Kraft der heiligen Bilder und Reliquien, Liebe zum großen Auftritt und tiefes Mißtrauen in den Menschen, städtische Freiheit als Anspruch und Zunftverbot für die unentbehrlichen Wollarbeiter, Begeisterung für die antiken heidnischen Autoren, Auflehnung gegen die päpstliche Autorität und doch keinerlei Zweifel an der alleinseligmachenden römischen Kirche, unbändiger Lokalstolz und kosmopolitische Lebensart, feste Verwurzelung im heimatlichen Stadtviertel und internationales Flair – auch die Welt der Florentiner vor sechs-, siebenhundert Jahren war voller Widersprüche. Das Panorama dieser urbanen, widersprüchlichen Welt chronologisch auszubreiten ist das Ziel dieser Stadtgeschichte.
Sie will nicht die Diskussionen über vermeintliche Mythen, angezweifelte Realitäten, falsche Periodisierungen, so wichtig alle diese Themen sind, fortführen. (Gab es die Renaissance nur im Kopf der Zeitgenossen? Wann hat sie begonnen, wann endete sie?) Natürlich kann dieses Panorama nicht vollständig sein. Es ist ein Versuch, die Fülle der unterschiedlichen Lebenswelten in einem anregenden und aufregenden Zeitabschnitt anzudeuten. Und je größer die Zeitspanne ist, desto mehr muß aussortiert werden. Doch hinter dem Rückgriff bis weit ins 13. Jahrhundert steht die Überzeugung, daß die so vieles überstrahlende Epoche der Medici nicht der absolute Aufbruch in die Moderne ist, als die sie Jacob Burckhardt definiert hat. Die Florentiner Bürger der Renaissance waren tief in der Gedankenwelt und Kultur des späten Mittelalters verwurzelt, jene Epoche, in der die Geschichte ihrer Republik begann.
Revolutionäre Thesen werden in diesem Buch nicht aufgestellt, keine grundsätzlich neuen Antworten auf alte Fragen nach Ursache und Wirkung im Verlauf eines historischen Prozesses gegeben. Vor allem eine Frage scheidet in bezug auf Florenz die Experten: Ist die Krise Produkt einer Entwicklung oder – wie es in Florenz scheint – Motor für Umbruch und Dynamik? Das Knäuel von traditionellen Gegebenheiten und Aufbrüchen zu neuen Ufern bleibt unentwirrbar. Es gilt, keine falschen Ansprüche an die Vergangenheit und ihre Chronisten zu stellen. Wo es um Menschen geht, regieren nicht nur eherne Gesetze, sondern auch Zufall und Freiheit, Eitelkeit und Überschwang. Um noch einmal Paul Veyne, Historiker am Collège de France in Paris, zu zitieren, der jedes Geschichtsbuch ein «Gewebe aus Inkohärenzen» nennt: «Für einen logischen Geist ist dieser Stand der Dinge gewiß unerträglich, doch damit wird zur Genüge deutlich, daß die Geschichte nicht logisch ist. Dagegen gibt es kein Heilmittel und kann es auch keines geben.» (Daß, wer sich an Florenz heranwagt, bei aller Bemühung um mildernde Umstände bitten muß, liegt auf der Hand.)
Was die «unbedeutenden Besonderheiten» betrifft, die die Geschichte ausmachen, so versucht dieses Buch allerdings auch, eine Lücke zu schließen und dem interessierten Florenzliebhaber, der sich jedoch nicht in Spezialliteratur vertiefen kann, Neues zu bieten. Denn die umfassenden Forschungen und Beschreibungen englischer und amerikanischer Experten über die Florentiner Gesellschaft eben jener Epoche zwischen 1200 und 1500 – über Alltag, Familie, Feste – sind in den bisher vorliegenden deutschen Werken in ihrer Breite nicht berücksichtigt. (Gene A. Bruckers solider, nach Themen geordneter Überblick «Florenz in der Renaissance», auf deutsch 1990 erschienen, datiert aus dem Jahre 1969.)
Die neueren Forschungen versuchen, dem Leben der Frauen, Männer und Kinder in Florenz ein wenig mehr auf die Spur zu kommen, auch wenn es sich aufgrund der überlieferten Dokumente fast ausschließlich um die Mitglieder des mittleren und oberen Bürgertums handelt. Ein Mythos ist dabei zerronnen, zumindest was Florenz betrifft: Es war eine männliche Gesellschaft. Frauen hatten in dieser Stadt auch in der Renaissance wesentlich weniger Möglichkeiten, selbständig und eine Person aus eigenem Recht zu sein, als zur gleichen Zeit etwa in Köln, Paris oder Regensburg. Weibliche Berufstätigkeit – als Kauffrau, Unternehmerin oder leitende Zunftmeisterin – war am Arno undenkbar. In den unteren Schichten mußte die Frau dazuverdienen – als lohnabhängige Arbeiterin mit Spinnen oder Weben –, in den oberen regierte sie im Hause, erzog die Kinder, sollte auch gebildet sein, ihren Vergil gelesen haben, und verkörperte mit Schmuck und kostbaren Kleidern das Ansehen der Familie in der Öffentlichkeit. Mehr war nicht drin bei den klugen, aufgeklärten Florentiner Männern, den weitgereisten Bankiers, den humanistischen Gelehrten. Nannina de’ Medici, eine Schwester des großen Lorenzo, heiratete 1466 mit fürstlichem Aufwand Bernardo Rucellai. Die Hochzeit versöhnte die Familie Rucellai, eine der reichsten der Stadt, mit der herrschenden ersten Familie. Für solche hochpolitischen Zwecke waren Töchter, über deren Mitgift sonst die Väter stöhnten, ein ideales Mittel. Dreizehn Jahre später schrieb die ernüchterte Nannina an ihre Mutter: «Wenn man nach eigenen Vorstellungen leben will, darf man nicht als Frau geboren werden.»
Solche direkten Aussagen von Florentiner Frauen sind die absolute Ausnahme. Ungewöhnlich zahlreich jedoch haben sich die Männer in Erinnerungen, Tagebüchern und Notizen verewigt. Und da taucht immer wieder der gleiche, schwerwiegende Vorwurf auf. Das Bild von der «grausamen Mutter» wird beschworen, die das Leben ihrer Kinder emotional und finanziell zerstört habe. Und das ist die Realität: So strikt männerorientiert war die Florentiner Gesellschaft, daß mit dem Tod des Ehemannes die Familie auseinanderbrach. Die Frau unterstand als Witwe wieder ihrer Herkunftsfamilie, die sofort alles tat, um sie erneut zu verheiraten. Die Kinder dagegen gehörten automatisch in den Familienverband des Vaters. Da half kein Bitten und kein Flehen: Es gab fast nur Stiefmütter in Florenz, aber keine Stiefväter und viele Waisenkinder, deren Mütter noch lebten, aber keinen Kontakt zu ihren Kindern haben durften. Die Regeln der Gesellschaft mußten eingehalten werden, auch wenn jene, die sie aufgestellt hatten – die Männer – die Schuld bei den wehrlosen Opfern – den Frauen – suchten und sich als Erwachsene bitter über diese «grausamen Mütter» beklagten. Das durchschnittliche Heiratsalter der Frauen lag bei 17, das der Männer bei 32 Jahren. So waren zerrissene, durch den Tod oder rigorose, ungeschriebene Gesetze zerstörte Familien die Regel, was nicht ohne schwere psychische Verletzungen für alle Beteiligten bleiben konnte.
Die Männer der bürgerlichen Oberschicht heirateten so spät, weil über Jahrhunderte Jugend nichts galt am Arno. Sie hatte Narrenfreiheit, durfte sich bei Prostituierten die Hörner abstoßen und brave Bürger erschrecken, bevor sie mit dreißig Jahren erwachsen wurde und würdig, politische Ämter einzunehmen. Doch mit dem Beginn des 15. Jahrhunderts wurden die bisherigen Maßstäbe auf den Kopf gestellt. In eigenen religiösen Bruderschaften für Jugendliche und in den traditionellen lebenden Schaubildern während der Prozessionen präsentierten sich die Söhne den gerührten Vätern als Vorbilder. Ein Jugendkult entwickelte sich in Florenz, der unter Lorenzo de’ Medici – selbst ein jugendlicher Held – seinen säkularen Höhepunkt erreichte. Savonarola, der anschließende Herr der Stadt, hat diesen Kult geschickt aufgegriffen und mit neuen, religiösen Inhalten gefüllt.
Gino Capponi, aus altem Florentiner Geschlecht, der am 9. Oktober 1406 nach langer, erbitterter Belagerung Pisa eroberte und damit die aggressive Außenpolitik der Florentiner Republik zu ihrem größten Sieg führte, sagte seinem Sohn: «In den Wäldern gewinnt man keine Ehre, die gibt es nur in der Stadt.» Es lag gerade hundert Jahre zurück, daß die Bürger von Florenz beschlossen hatten, mit ihrer Stadt Geschichte zu machen. Der Dom Santa Maria del Fiore, dessen Grundstein am 8. September 1296 unter großer Anteilnahme aller Florentiner gelegt wurde, sollte der ganzen Welt davon künden. Am 25. März 1436 – Mariae Verkündigung und Beginn des neuen Jahres nach dem traditionellen Florentiner Kalender bis 1750 – war es ein Papst, Eugen IV., der die endlich vollendete Kathedrale samt ihrer Kuppel von nie gekannten Ausmaßen in feierlichem Hochamt weihte und mit seiner Präsenz krönte. Mußte es den Bewohnern am Arno nicht wie eine göttliche Bestätigung ihrer Auserwähltheit erscheinen, daß der neue Dom des Todfeindes Siena, einst ausdrücklich als Kontrastprogramm begonnen, seit fast hundert Jahren als Ruine verkümmerte?
An Größe und Ehre ist kein Mangel in der Geschichte von Florenz. Das erweckt auch bei den Nachgeborenen Bewunderung. Aber das Tempo und die Dynamik erschöpfen sich keineswegs in äußeren Zeichen, sondern korrespondieren mit einer inneren Entwicklung. In relativ kurzer Zeit hat sich am Arno eine «zivile» Gesellschaft gebildet. Auch wenn sie sich am Anfang wortwörtlich zusammenraufte, weshalb man neben dem Erfolg der Bürgerkommune die blutigen innerstädtischen Kämpfe aus den ersten Jahrzehnten der Republik nicht ausblenden darf. Am Ende jedoch siegte bei der bürgerlichen Elite – trotz aller Ungerechtigkeiten, allen Klüngels, allen Hochmuts – die Vernunft.
Mit dem Beginn der neuen, modernen Zeit schien die mittelalterliche europäische Stadt untergegangen, ihre «verlorene Freiheit», der Montaigne noch nachtrauerte, obsolet geworden. Die Industrialisierung schuf Massenelend in den Städten und einen urbanen Moloch, zu dem man vergeblich Alternativen suchte. Die «Charta von Athen» deklarierte in den vierziger Jahren die «Gartenstadt» als neues europäisches Ideal. Doch die Flucht in die Peripherie, in die gesichtslosen Vororte brachte nur Verödung, Langeweile und Gewalt. In den sechziger Jahren dann machte der Slogan von der «Unregierbarkeit der Städte» die Runde. Nun, mit dem letzten Jahrzehnt des zweiten Jahrtausends, kommen vertraute Argumente in die Diskussion. Nicht mehr das Ende der Stadt wird ausgemacht, sondern eine «neue Urbanität».
Das World Watch Institute in Washington propagiert die traditionelle europäische Stadt aus der Zeit vor der Industrialisierung als die ideale, ökologisch vertretbare Siedlungsform der Zukunft: Sie biete auf überschaubarem Raum dem Menschen Kommunikation, kulturelle Vielfalt, Pluralität der Lebensformen und – wenn man es denn endlich will – ein Minimum an Energieverschwendung. Im Sommer 1991 hat die Kommission der Europäischen Gemeinschaften in Brüssel ein «Grünbuch über die städtische Umwelt» herausgebracht, das sich mit seinem neuen Konzept «an dem althergebrachten Leben der europäischen Stadt» ausrichtet. Es sind nachdenkliche Stimmen, die nicht verschweigen, daß genug Probleme bleiben, um nicht in nostalgischer Sehnsucht nach dem Mittelalter zu schwelgen. Dafür wäre Florenz in der Zeitspanne von 1200 bis 1500 auch ein untaugliches Beispiel. Die Menschen damals lebten nicht in einer heilen Welt, sondern in einem Kosmos voller Widersprüche.
Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit waren die Ideale der Florentiner Bürger, seit sie sich 1250 aus der Macht von Kaiser und Papst befreiten und eine Republik aus eigenem Recht erstritten. Bürgerliche Humanisten, Mönche und Gelehrte, die sich in der Stadt am Arno zu Hause fühlten, haben diese Utopie in pathetische Worte gefaßt. Auch bei nüchterner Betrachtung verlieren diese Werte über die Jahrhunderte nichts von ihrer Kraft und Herausforderung, unabhängig, wie viele Wünsche die Realität offen ließ.
Doch wie kann man etwas vom Wesen jener Menschen, die damals in Florenz lebten, die die Straßen und Plätze bevölkerten, begreifen und überbringen? Von jener widersprüchlichen Mischung, die den Geist dieser Stadt ausmacht? Gibt es etwas, das typisch ist? Liest man in den «Trecentonovelle», den Novellen des Franco Sacchetti, dann sind es vor allem die Lust am Schabernack, die gekonnte Pointe, der Sinn für Ironie, die den Florentiner auszeichnen. Sacchetti, der im Jahre 1400 starb, war ein erfolgreicher Kaufmann und Beamter seiner Vaterstadt Florenz und schrieb in seiner freien Zeit Geschichten aus dem Alltag jener «lebendigen, flexiblen, urbanen Gesellschaft, die in Florenz aus der historischen Prägung der Kommune entstanden war» (Alice Vollenweider).
Es war eine typische Karriere, und sie beleuchtet noch einmal das Miteinander vieler Welten am Arno: Man lebte nicht im Elfenbeinturm, konnte es gar nicht auf diesem gedrängten Schauplatz zwischen Baptisterium und Ponte Vecchio, zwischen Dom und Priorenpalast, heute der Palazzo Vecchio. Und vielleicht ist die Grundlage für Aufstieg und Erfolg vor allem jener nüchtern beobachtende Blick, dem auch die größten Autoritäten nichts vormachen können. Es war im Jahre 1459, als Papst Pius II. Florenz einen Besuch abstattete. Der Gast wurde mit höchsten Ehren empfangen, seine Sänfte mit Brokat ausgeschlagen, die schönsten Kurtisanen zierten die städtischen Bankette für den Heiligen Vater. Auf der Piazza Santa Croce gab es ritterliche Turniere, auf der Piazza della Signoria sah der Papst mit seinem Gefolge aufwendigen Hetzjagden zu. Als alles vorbei war, schrieb ein Florentiner Chronist: «Die Angelegenheit war von Hoffart gezeichnet, nicht von Heiligkeit. Sie hat uns ein Vermögen gekostet.»
Die Geburt der freien Kommune oder Gegen Kaiser und Papst
«Viva il popolo!» Die engen Straßenschluchten ließen den Ruf widerhallen. Keinem konnte er entgehen. «Viva il popolo!» Immer mehr riefen es sich zu. Der Zug der Menschen schwoll an, jeder gab die Neuigkeit an seine Nachbarn weiter: Wenige Kilometer vor der Stadt waren die Anhänger des Kaisers in erbitterter Schlacht geschlagen worden. Es lebe das Volk! Die Bürger hatten ihn satt, den Kampf zwischen dem Papst und jenem Kaiser aus schwäbischem Geschlecht, dem Staufer Friedrich II., nach der Rechtslage Herr der Stadt. Ein halbes Jahrhundert schon ging dieses Ringen um die Herrschaft über die Welt und die Seelen, für das die Untertanen mit Tod und Zerstörung, Hunger und Armut zahlen mußten. Den Betroffenen bedeutete das Datum der Schlacht nichts, in den Geschichtsbüchern schreibt man 1250.
Florenz war eine Stadt im Bürgerkrieg. Die Mauern und Tore schützten eine Gemeinde, deren Zerstörung im Inneren unübersehbar war. Ganze Häuserblocks und mächtige Wohntürme lagen in Trümmern. Berge von Schutt blockierten die Straßen, Schweine wühlten in verkohlten Resten, die Menschen hatten Mühe, sich ihren Weg zu bahnen. Wer hatte der Stadt solche Zerstörung angetan? Es waren wenige, einflußreiche Familien, die vor allem in den letzten zehn Jahren gegeneinander gewütet hatten, weil sie auf verschiedenen Seiten der Barrikaden standen – hier für den Papst, dort für den deutschen Kaiser. Wurde das Morden zu toll, demonstrierten sie durch Heiratspakte und öffentliche Friedensküsse Versöhnung, um schon beim Festmahl von neuem übereinander herzufallen. Aus steinernen Wohntürmen gossen die Männer Pech und Schwefel auf die Straßen; zu Pferd und Mann gegen Mann bekämpften die Gegner sich in klirrender Rüstung von Häuserblock zu Häuserblock und hatten keine Scheu, selbst auf dem alten Friedhof neben dem Dom sich letzte Gefechte zu liefern.
Die Mehrheit der Florentiner hielt die Türen verrammelt, suchte verzweifelt, nicht hineingezogen zu werden in die Händel der Herrschenden. Und wenn eben möglich, mied man die Stadtviertel – die in dieser Epoche «Sechstel», sestiere, waren –, in denen gerade die ärgsten Kämpfe tobten. Die Schlachtordnung in Florenz wie in ganz Italien teilte die Gegner in zwei feindliche Lager: Guelfen und Ghibellinen. Traditionsbeladene Schlagworte, hinter denen sich mannigfache Motive und Interessen verbargen. Guelfen nannten sich jene, die die Partei des Papstes ergriffen, und Ghibellinen jene, die im Dienst des Kaisers handelten. Dabei waren es nicht einzelne, die für diese oder jene Sache standen und starben, sondern ganze Familien und ihr Anhang. Um im groben Raster zu bleiben: Die Ghibellinen fanden sich vor allem unter den aristokratischen Geschlechtern, die zum Teil aus der Toskana in die Stadt gezogen waren. Die Guelfen vertraten das städtische Großbürgertum, Richter und Notare, aufstrebende Kaufleute und Händler und die geistliche Gemeinde. Diese Elite bildete nach eigenem Verständnis – und dem der Zeitgenossen – il popolo, das Volk von Florenz. Die große Mehrheit der Florentiner, die Arbeiter, Tagelöhner und Handwerker, zählte nicht dazu. Sie alle waren nach mittelalterlichem Recht keine vollwertigen Bürger, egal, ob Frauen oder Männer.
Jetzt, im September 1250, wollte dieses Volk, die tonangebende bürgerliche Schicht der Stadt, kein stummer und verschüchterter Zeuge mehr sein. Die Gelegenheit schien günstig, die alten Parteiungen aus der Stadt zu bannen, den geschlagenen kaisertreuen Ghibellinen die Tore zu verschließen und der Kommune eine neue, unabhängige, republikanische Ordnung zu geben.
Viva il popolo! Vertrauensmänner versammelten sich in San Firenze, draußen vor der Kirche standen Bürger in Waffen, um ihre Vertreter zu schützen. Trotzdem schien es bald ratsam, den Versammlungsort zu wechseln, zu nahe war man den Häuserblocks der adligen Streithähne. So zogen sie hinaus vor die Stadtmauern nach Santa Croce, in die kleine Kirche der Franziskaner. Die Bettelmönche öffneten bereitwillig ihre Tore, denn sie waren als treue Söhne der römischen Kirche nicht nur Feinde des verhaßten Kaisers. Vor allem standen die Jünger des Franz von Assisi mitten im Leben der Kommune, hatten sich nicht zurückgezogen wie die etablierten Orden. Die junge Gemeinschaft der Franziskaner, erst seit knapp dreißig Jahren in den Städten Oberitaliens zu Hause, schickte ihre Jünger in den braunen Kutten zum Predigen auf die Plätze und Straßen. Die Bettelmönche nahmen Anteil an den Sorgen aller Bewohner, trieben erstmals eine ernsthafte Seelsorge, während der traditionelle Klerus nur auf seine Pfründe bedacht war. Die Mönche hatten auch keine Hemmungen, sich handgreiflich in das Getümmel der Straßenschlachten zu stürzen und so die Sache der Guelfen zu verstärken. Und seit jeher waren die Kirchen von Florenz Foren der Öffentlichkeit, geheiligte Räume, in denen man sich in Zeiten der Not versammelte und heftig die unterschiedlichen Meinungen austauschte.
Diesmal ging es erstaunlich einmütig zu. Schon Ende Oktober 1250 wurde die neue Verfassung von Florenz verkündet: il primo popolo wird man diese frühen republikanischen Jahre nennen, «das erste Volk». Der Kaiser, bisher immer noch offizielles Stadtoberhaupt, verlor endgültig alle Rechte am Arno. Das Volk hatte nun alle Gewalt. Allerdings: Am Arno entwickelte sich keine Republik gemäß dem Demokratie-Verständnis des 20. Jahrhunderts. Es herrschte in dieser ersten Republik von Florenz nur eine Minderheit, jene oberste soziale Schicht, die sich kraft Herkommen, Reichtum und Ellenbogen an die Spitze der Gesellschaft gesetzt hatte. Aber sie war zu zwei Dingen entschlossen: diese Position freiwillig nicht mehr abzugeben und Frieden in der Stadt zu halten. Eine Miliz wurde gebildet, in der jeder Florentiner im Alter von 15 bis 70 Jahren dienen mußte. Sie wurde organisiert in zwanzig gonfaloni, Genossenschaften oder Nachbarschaftsverbänden, die seit Urzeiten den sozialen Kern von Florenz bildeten. In den Nachbarschaften kannte jeder jeden – mit seinen Stärken und seinen Schwächen. Diese Miliz sollte die Bürger vor der Willkür der Mächtigen schützen, neue Kämpfe nach dem alten Muster im Keim ersticken und die Stadt gegen Angriffe von außen verteidigen.
Wenn die Glocke der Kirche im sestiere auf die verabredete Weise schlug, erschien ein jeder Mann mit Schild, Helm und Waffe bei seinem Nachbarschaftsverband, durch ein gemeinsames phantasievolles Abzeichen deutlich gekennzeichnet. Da gab es den grünen Drachen im roten Feld, die weiße Leiter auf schwarzem Grund, eine grüne Schlange auf gelbem, ein springendes Pferd auf grünem Feld. An der Spitze aller Verbände stand nach der neuen Verfassung der Capitano del Popolo, der immer von auswärts kam, um nicht durch familiäre Bande innerhalb der Stadt verführbar und erpreßbar zu sein. Er hatte im Machtspiel der Kommune die Aufgabe, die Einhaltung der Verfassung und die neuen Rechte der Bürger zu gewährleisten, und führte, wenn nötig, das Volk von Florenz in den Krieg.
Ebenfalls von außerhalb kam der Podestà, seit Jahren schon eine beliebte Institution der Kommunen Norditaliens, um den inneren Frieden zu wahren. Er war – neben dem Capitano – der oberste Beamte der Stadt und repräsentierte sie. Er sprach Recht, lebte in einem eigens gemieteten Haus, um von keiner Partei vereinnahmt zu werden, brachte seine eigenen Diener und Notare mit. Als Zeichen seines Amtes trug der Podestà eine rote Samtkappe und ein langes Gewand aus kostbarem Brokat.
Als feste städtische Institutionen gab es die Räte, außerdem größere und kleinere Versammlungen. Die eigentliche Regierungsgewalt im Primo Popolo von 1250 aber lag bei den zwölf anziani, den Ältesten, die alle zwei Monate neu gewählt wurden. Auch sie mußten sichtbar Abstand von der Menge und den Mächtigen halten: Sie wohnten alle zusammen im Stadthaus und durften nur gemeinsam ihren Amtssitz verlassen. Die Anzianen bildeten das beschlußfassende Organ der Stadt. Ohne sie lief nichts in diesen Jahren. Die Ältesten entschieden über jede Ausgabe, jedes Bündnis, jeden Heereszug. Jedes Gerichtsurteil konnten sie nach Belieben mildern oder verschärfen. Von diesem entscheidenden Machtzentrum waren die Mitglieder der städtischen Adelsfamilien, die mit Argwohn auf die neue Verfassung sahen, die die bürgerliche Elite sich gegeben hatte, ausgeschlossen. Sie durften nur im Generalrat der Dreihundert und im Spezialrat der Neunzig ihre Stimme erheben. Doch dort kam nichts auf die Tagesordnung, was die Anzianen nicht zuvor gebilligt hatten.
Die Ältesten trafen sich zu ihren Beratungen manchmal dort, wo lange schon in Florenz Politik gemacht worden war, im Baptisterium, der Taufkirche San Giovanni, gleich neben der alten Kathedrale, die der heiligen Reparata gewidmet war. Damals herrschte drangvolle Enge im Herzen der Stadt. Westlich vom Baptisterium stand der bischöfliche Palast, im Osten war der schmale Raum zur Kathedrale von einem Hospital verbaut, daneben lag ein innerstädtischer Friedhof. Im Innern von San Giovanni hatten Meister aus Venedig gerade die Gerüste verlassen, denn ihr prächtiges Rundum-Mosaik in der Kuppel war fertig geworden.
Viva il popolo! Das Volk hatte gesiegt, kein Blutstropfen war beim Umsturz im Innern verloren worden. Und damit den Mächtigen von gestern bewußt wurde, daß die Willkürherrschaft verfeindeter aristokratischer Familien über die Stadt für alle Zeiten vorbei war, wurden sogleich Zeichen gesetzt. Die neue Regierung erließ eine Verordnung, nach der kein Geschlechterturm in Florenz höher als 29 Meter sein durfte. Was darüber lag, mußte auf dieses Maß geschleift werden.
Die alten Geschlechtertürme prägten unübersehbar die Silhouette der Stadt. Wohl dreihundert an der Zahl waren bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts in den Himmel von Florenz gewachsen. Trutzige Bauten, von Turmgesellschaften organisiert, zu denen sich mehrere Familien, manchmal ganze Straßenzüge zusammenschlossen. Der Adel aus dem Contado, dem toskanischen Umland von Florenz, der schon vor Generationen in die Stadt gezogen war, hatte die Symbole einer feudalen Zeit mit hinüber in die städtische genommen. Viele andere Kommunen der Toskana zeigten ein ähnliches Profil. Die Wohntürme waren immer mehr zu Fluchtburgen im innerstädtischen Krieg geworden. Hier konnten die verfeindeten Familien über Wochen und Monate aushalten, Pfeile und Wurfgeschosse auf den Gegner schleudern. Doch nun hatte das Volk gesiegt, hatten die Machtsymbole von gestern ihre Schrecken verloren. Viva il popolo!
Der Stadt schien das neue Regiment gut zu bekommen. Gerade zwei Jahre war die Volksverfassung alt, da erfuhr die Welt, wer in Florenz die Herren waren, was die Kommune am Arno so kräftig am Leben hielt und was sie wert war. Florenz nahm sich heraus, was eigentlich nur dem Kaiser zustand: Die Kommune prägte eine goldene Münze, den fiorino d’oro, und sie wußte, was sie tat. In kürzester Zeit wurde der Florin aus Florenz Europas Währung Nummer eins und blieb es über Jahrhunderte. Denn dahinter stand nicht nur strengste Kontrolle, so daß die Arbeiter bei Herstellung der Münzen kein Gramm für die eigene Kasse unterschlagen konnten. Vor allem fußte der goldene Florin (Abkürzung fl.) auf der Kraft einer städtischen Wirtschaft, die dabei war, alle italienischen und alle europäischen Konkurrenten, die bislang weit vor Florenz gelegen hatten, zu überrunden. (Gulden wurde der adäquate Begriff für den fiorino, und noch heute ist hfl. die offizielle Abkürzung für den holländischen Gulden.)
Mit der Verfassung des Primo Popolo von 1250 hatten die vornehmsten und gewichtigsten, die sieben «größten Zünfte» der Stadt, die arti maggiori, das Heft in die Hand genommen. Aus ihren Reihen kamen die Ältesten, vor allem aus der einflußreichen arte di calimala. In der Calimala hatten sich Großhändler und Unternehmer, die einfache Tuche nach Florenz importierten, dort veredeln und färben ließen und dann wieder ausführten, zusammengetan. Meist waren sie zugleich auch Bankiers. Vom Prestige her wurde die Calimala nur übertroffen von der Zunft der Richter und Notare. Es folgte die arte di cambio, die Zunft der Geldwechsler, deren Arbeitsplatz die Tische am Alten und am Neuen Markt waren. Später, unter veränderten wirtschaftlichen Bedingungen, bildeten Wollhändler und Produzenten von einheimischen Tuchen die Wollzunft, arte della lana, die Seidenhersteller versammelten sich in der arte di Por Santa Maria, der Seidenzunft. Ärzte und Apotheker trafen sich in einer gemeinsamen Zunft, und schließlich gab es noch eine Zunft für die Kürschner und Pelzhändler, die gut im Geschäft waren. Die feinen Leute am Arno trugen mit Vorliebe Hermelin, Fischotter und Marder, die man bei den Pelzgroßhändlern in Pisa einkaufte und in Florenz aufs schönste und beste verarbeitete.
Die Kaufleute der Calimala kamen aus Familien, die seit langem in der Stadt am Arno lebten wie die Cavalcanti, Pazzi, Bardi oder Acciaiuolo, die Cerchi, Mozzi und die Frescobaldi. Kraft ihres Reichtums bildeten sie quasi ein bürgerliches Patriziat, und es war nicht ungewöhnlich, daß sie in die adligen städtischen Geschlechter einheirateten. Das neue Geld paarte sich gerne mit dem alten Ansehen und umgekehrt. Nicht ohne Spott berichtet der Chronist: «Jeder Tag erlebt einen gemeinen, aber reichen Mann, der eine arme, aber adlige Frau heiraten will.»
Die adligen Familien der Donati, Buondelmonti, Adimari, Tornaquinci (später Tornabuoni) und Uberti ließen sich an Stolz und Hochmut von niemandem übertreffen. Vielleicht war es gerade das Selbstbewußtsein dieser magnati, das ihnen die Freiheit gab, sich den neuen städtischen Wirtschaftsformen zu öffnen, als sie sahen, wie erfolgreich man auf diese Weise zu Geld kommen konnte. Und die Bürgerlichen hatten nichts dagegen. So wurden in Florenz auch Männer von Adel, die innerhalb der Mauern lebten und die Arbeit nicht scheuten, als Bankiers und Kaufleute in die Zünfte, vor allem die Calimala, aufgenommen. Wer nicht gänzlich verarmt war, konnte seine Erträge mit den ererbten Gütern im Umland durch städtische Gewinne komplettieren. So vermischten sich in Florenz mit den Generationen zwei Gesellschaftsschichten und Kulturen. Stadt und Land tauschten Menschen, Waren und Ideen aus. Ritter und Kaufmann, Bürger und Adlige sahen sich nicht nur täglich in den Straßen, sondern machten zusammen Geschäfte, verheirateten Söhne und Töchter miteinander. Oft taten sie es nicht aus Überzeugung, sondern aus Kalkül, nicht selten mit scheelen Blicken. Doch auch das streitbare Miteinander prägte und veränderte beide Lager, ganz im Gegensatz zu ihren Standesgenossen nördlich der Alpen, die in unfruchtbarer Isolation fern voneinander auf Burgen und hinter städtischen Mauern ihre jeweilige Lebensart kultivierten.
Es war gar nicht so leicht, auf den rund 75 Hektar innerhalb der florentinischen Mauern miteinander auszukommen. Die ritterlichen Vorstellungen von Ehre, Standesbewußtsein und Faustrecht wurden von der bürgerlichen Elite teils belächelt, teils gierig übernommen. Aber mit dem Andauern der blutigen innerstädtischen Fehden in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts waren die magnati, die Großen der etablierten Adelsfamilien, immer verhaßter geworden. Der Primo Popolo, die erste Regierung des Volkes, griff deshalb scharf durch. Es schien ihr nicht genug, die Geschlechtertürme kurz zu halten. Im Rahmen der Verfassung von 1250 erließen die Anzianen Gesetze, die die Willkür des Adels ein für allemal brechen und an der Vorherrschaft der popolani, der Bürger, keinen Zweifel lassen sollten. Wer als Magnat einen Bürger, den die Glocke zum Versammlungsort seines Nachbarschaftsverbandes rief, beschimpfte, mußte diese Beleidigung mit einer hohen Geldstrafe sühnen. Wer von seinem Turm aus einen popolano mit Steinen bewarf, dessen Hand wurde vom Scharfrichter abgehackt. Umgekehrt war den Bürgern streng verboten, sich an den Kämpfen der Magnaten zu beteiligen.
Es erhob niemand Einspruch gegen diese rigorosen Verfügungen. Allerdings hatten die größten Feinde der Republik nach der Niederlage von 1250 das Weite gesucht. Alte Adelsgeschlechter wie die Uberti, deren entschiedene Parteinahme für den Kaiser und gegen eine republikanische Kommune in weitem Umkreis bekannt war, hatten sich gar nicht erst zurück in die Stadt begeben. Sie warteten auf ihren Gütern in der Toskana oder in kaiserlich gesinnten Städten auf den Tag der Rache. Andere, die blieben, beugten sich den Machtverhältnissen: Die Verflechtungen zwischen den bürgerlichen und adligen Eliten waren schon so dicht, daß man zu viele gemeinsame Interessen hatte. Warum sollte man nicht auch unter republikanischen Vorzeichen zusammen Geschäfte machen? Und die ließen sich glänzend an unter der neuen Regierung, wie die Prägung des goldenen Fiorino unübersehbar kundtat.
Mit dem 13. Jahrhundert, dem der Kalabreser Abt Joachim von Fiore an seinem Anfang das Ende aller Zeiten und den Jüngsten Tag prophezeit hatte, begann langsam, aber stetig ein bisher nie gekannter wirtschaftlicher Aufschwung in Europa. Und mit dem sehr irdischen Hunger nach Waren und Konsum, nach Luxusartikeln und Qualitätserzeugnissen wurde der Kaufmann, der meist auch Bankier war, zum wichtigsten Vertreter und Katalysator einer neuen Zeit. Als die Geschicktesten, mit Freude am Risiko und kühlem Unternehmergeist, erwiesen sich die führenden Männer von Florenz. Günstige äußere Umstände kamen ihrem Können und Talent zugute: Norditalien und die Toskana lagen fast im Mittelpunkt eines Kreises, in dem zwischen Kairo und London, zwischen Orient und Skandinavien die Güter zirkulierten. Florenz, das bislang im Schatten berühmter und reicher toskanischer Kommunen – Pisa, Lucca und der Todfeind Siena – der Entwicklung hinterhergehinkt war, zeigte kämpferische Qualitäten und begann, seine geographischen Vorteile zu nutzen. Erfolg und Wohlstand des Newcomers gründeten auf zwei Säulen. Erstens waren es Florentiner Großhändler, die in wenigen Jahren selbst das Monopol der berühmten flandrischen Tuchunternehmer brachen. Zweitens stellten die Handwerker am Arno erstklassige Waren her, spezialisierten sich immer mehr, verlegten sich auf die Methode der Verfeinerung, egal in welchem Bereich. «Aus Florenz» wurde zum Gütezeichen überall in Europa, bei Pelzen und Goldschmiedearbeiten, bei Waffen und Rüstungen jeder Art, von denen die kriegswütige Welt gar nicht genug bekommen konnte.
Ein Geheimnis des Wirtschaftswunders lag in der Mobilität der Beteiligten. Europas führende Unternehmer und Kaufleute machten sich auf lange, gefährliche Wege, um sich mit ihren Waren auf den großen internationalen Messen, vor allem in Frankreich, zu treffen. Was Florenz und seine aufstrebende, dynamische Wirtschaftselite betraf, gab es bald nur noch ein Gesprächsthema: Stoffe und Wolle und alles, was damit zusammenhing. Denn die Florentiner Kaufleute hatten erkannt, daß mit diesen Bedarfsartikeln – in Florenz, der Stadt am Wasser, nach den neuesten Moden verarbeitet – exzellente Geschäfte zu machen waren. Sie kauften auf den Messen der Champagne rauhe graue Wollstoffe ein und ließen sie nach Florenz transportieren. Dort am Arno wurden sie gefärbt und veredelt und anschließend als preisgünstige panni franceschi wieder auf den europäischen Markt geworfen, wo die «französischen Tuche» reißenden Absatz fanden. Und das war nur der Anfang.
Wenn Heizungen und Öfen unbekannt sind und selbst die Häuser der Reichen ohne schützendes Glas in den Fensterluken auskommen müssen, ist nichts so wichtig wie ein warmes Stück Stoff am Leib. Verdient man genug, um sich mit dem Nötigsten zu versorgen, und sind Hunger und Armut keine ständigen Gäste mehr, regen sich neue Empfindungen: der Schönheitssinn, die Freude an Farben und Formen, der Mensch bekommt Lust am Überflüssigen. Mochte auch die Zahl jener, die sich bessere und modische Kleidung leisten konnten, äußerst gering sein im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, so war sie doch um so zahlungskräftiger. Die Bekleidungsindustrie verzeichnete im Laufe des 13. Jahrhunderts gewaltige Wachstumsraten. Nicht mehr karges grobes Tuch sollte es sein, Qualität war gefragt, Samt, Seide und Brokat. Und Florenz verschlief die Trends der Zeit nicht. Die Kaufleute setzten auf die Fähigkeiten, die Florentiner Arbeiter beim Veredeln und Färben der ausländischen Tuche gewonnen hatten, und begannen, statt der Stoffe gleich den Rohstoff – Wolle – an den Arno zu schaffen und die begehrten Stoffe dort herstellen zu lassen.
Um Wolle zu bearbeiten, zu zupfen und zu reinigen, zu walken und zu färben, braucht man viel Wasser und viele Menschen. Florenz hatte beides im Überfluß. An den Ufern des Arno entstanden weiträumige, luftige Holzhallen, unter deren Dächern die gefärbten Tuche zum Trocknen ausgespannt wurden. Ein unerschöpfliches Reservoir an Arbeitskräften aus dem Umland gehörte zu den idealen Voraussetzungen für die Perfektionierung und Vereinheitlichung der Wollproduktion. Ein weiterer Vorteil lag in der Organisation: Die Florentiner Kaufleute behielten das Geschäft vom Einkauf der Rohstoffe bis zum Verkauf der Tuche in der Hand. Sie importierten die Wolle; sie finanzierten die Florentiner Werkstätten, den Bau von Waschanlagen und Trockenhallen, verteilten die Ware nach der ersten Verarbeitungsphase weiter an Spezialisten, übernahmen en gros den Einkauf von Öl und Farbstoffen für die Zunft der Wollkaufleute, die immer mächtiger wurde. Sie exportierten das Endprodukt unverzüglich auf den europäischen Markt, nach Afrika und Kleinasien, wo sie dank ihrer Reisen oder ihrer Agenten überall beste Beziehungen hatten.
Und das war die dritte Säule des Florentiner Aufschwungs: Der finanzielle Einfallsreichtum dieser Unternehmer war ihrem kaufmännischen ebenbürtig. Schon im Jahrzehnt der ersten Volksregierung nach 1250 begann der Aufstieg Florentiner Sozietäten zu den führenden Bankhäusern in Europa. Sie entwickelten, neben ihren Kollegen in Genua und anderen Städten Norditaliens, Methoden des Geldgeschäfts, die bis ins 20. Jahrhundert im weltweiten Handel selbstverständlich blieben. Florentiner Bankiers, die zugleich Kaufleute waren, legten nicht nur das finanzielle Fundament für den internationalen Handel mit Wolle und Stoffen. Ihr Reichtum und ihre Geschäftstüchtigkeit machten die Mozzi und Frescobaldi, die Falconieri und della Scala gegen Ende des 13. Jahrhunderts zu Geldgebern und unentbehrlichen finanziellen Beratern von Königen und Päpsten. Kaufleute und Bankiers aus Florenz erhielten europaweite Privilegien, beeinflußten politische Entscheidungen und verschafften ihrer Heimatstadt ein solches Übermaß an Vorteilen, daß Florenz schließlich allen Konkurrenten – nicht nur in Italien, sondern in ganz Europa – überlegen war.
Schon seit den zwanziger Jahren des 13. Jahrhunderts saßen permanente Agenten von Florentiner Handelshäusern in London, Paris und den flandrischen Städten. Sie kauften und verkauften an Ort und Stelle, ohne daß die geschäftlichen Eigentümer ständig selber auf Reisen gehen mußten. Als der päpstliche Hof in der Mitte des Jahrhunderts begann, seine Steuern im nördlichen Europa durch die Kaufleute aus Florenz eintreiben zu lassen, fiel diese zusätzliche Aufgabe den Florentiner Agenten zu. Sie nutzten sie ohne Skrupel, um den Gewinn ihres Hauses und ihrer Gesellschafter zu mehren. Hatte doch auch der Papst in Rom keinerlei Bedenken, laufend neue Steuern auszuschreiben, um die Unkosten der Kurie oder die Ausgaben für seine teuren politischen Schachzüge zu finanzieren.
Die Abwicklung solcher internationalen Geschäfte auf Gegenseitigkeit war denkbar einfach. Kam der Papst in Geldnöte, belegte er zum Beispiel die englischen Klöster mit einer Sonderabgabe. Als sein Bevollmächtigter spricht wenig später der Londoner Agent einer Florentiner Handelsgesellschaft bei den Äbten vor. Meist kann der geistliche Herr nicht bezahlen oder will es gar nicht. Entweder stellt er dem Mann aus Florenz die exzellente Wolle seiner guten englischen Schafe zur Verfügung, die nun statt nach Flandern nach Florenz auf die Reise geht. Oder er nimmt bei dem Bankagenten einen Kredit auf, für den dieser gerne die Zinsen einbehält.
Die Florentiner Zweigleisigkeit, als Kaufleute und als Bankiers zu arbeiten, wirft andere angesehene Händler und Bankhäuser – vor allem aus der Toskana – aus dem Rennen. Es sind Florentiner, die die weltweiten Handelswege durch bargeldlosen Transfer überbrücken, indem sie das Kreditwesen entschlossen ausbauen. Mit ihrer Finanzkraft und ihren Verbindungen über den ganzen Kontinent können sie als erste in Europa im großen Stil für bargeldlose Wechsel garantieren, ihren Kunden ein Konto einrichten und sich darauf spezialisieren, mit den unterschiedlichen Wechselkursen in Europa Geschäfte zu machen. Die Stärke der Florentiner Sozietäten lag auch darin, daß angeheiratete Verwandte oder Geschäftsfreunde zwar Gesellschafter werden konnten, das Kapital aber immer in der Familie blieb.
Das große Geld, das die Mitglieder der Großhändlerzunft und dann der Wollzunft repräsentierten, machte sie zu den mächtigsten in der Stadt. Dem Geist aber ließ man in Florenz gerne den Vortritt. Die Zunft der Richter und Notare übertraf alle anderen an Ansehen, und auch in der Realität war es mit der Macht und dem Einfluß ihrer Mitglieder nicht schlecht bestellt. Für Juristen gab es in Florenz seit langem viel zu tun, selbst für jene, die kein Vollstudium aufweisen konnten, wie die Notare. Das römische Recht war in Italien mit dem Römischen Reich nicht untergegangen. Und erhalten hatte sich ein Sinn dafür, das Leben von Gemeinschaften – ob Familienverband oder städtische Kommune – auf rationale Weise und nach verbindlichen, schriftlichen Ordnungen zu regeln. Deshalb gab es für unzählige Vorgänge im Leben der Florentiner Dokumente und Verträge. Sie mußten ausgefertigt, beglaubigt, im Streitfall auf ihre Gültigkeit geprüft und ausgelegt werden. (Und die Florentiner stritten sich gerne.) Für wichtige private Briefe, für Kaufabschlüsse und Testamente ließen die Bürger den Notar ins Haus kommen.
Alle Statuten und Aufzeichnungen der städtischen Regierung, die Protokolle von Ratssitzungen und Gerichtsverhandlungen lagen in den Händen der Notare. In den Ausschüssen, Sitzungen und Kommissionen waren diese Experten unentbehrlich. Die Dokumente wurden in lateinischer Sprache abgefaßt, denn eine verbindliche italienische Umgangssprache, volgare genannt, bildete sich und setzte sich, von der Toskana ausgehend, erst gegen Ende dieses Jahrhunderts durch. Das große Latinum hatten die Notare sicher nicht, aber ihre Kenntnisse reichten aus, daß Kommunen und Privatleute sich auf sie verließen und nicht – wie nördlich der Alpen – nach dem Priester riefen, wenn es darum ging, schriftliche Geschäfte abzuwickeln.
Das städtische Bildungsbürgertum südlich der Alpen war erstaunlich wenig auf die Wissensvermittlung durch Kleriker angewiesen. Wer studieren wollte, konnte seine Kenntnisse an den einheimischen städtischen Universitäten erwerben. Während in Paris und Oxford, in Köln oder Cambridge vor allem Theologen ausgebildet wurden, gab es im Land des Papstes berühmte Lehranstalten mit gefragten weltlichen Fächern, die geistlichen Lehrstühle dagegen hatten einen miserablen Ruf. Nach Padua ging man, wollte man ein guter Mediziner werden, und niemand konnte in Italien als Jurist reüssieren, der nicht in Bologna Recht studiert hatte. Dann allerdings war er ein angesehener Mann. Und wenn er in Florenz als Richter in der Zunft eingeschrieben war, hatte er Anspruch auf den Titel Messer, den sonst nur die Ritter führten. Mit Ser wurden die Notare angesprochen. Ser Brunetto Latini zum Beispiel kam aus einer Florentiner Familie, deren männliche Mitglieder den Beruf des Notars seit Generationen ausübten. Er war wohl schon über dreißig Jahre alt, als er einen ehrenvollen Ruf erhielt. Die Anzianen, die seit nunmehr vier Jahren erfolgreich die Politik der ersten Republik bestimmten, hatten stets einen Notar ihres Vertrauens zur Seite, der ihre Sitzungen protokollierte und alle Beschlüsse festhielt. Im Jahre 1254 wurde Brunetto Latini von den Anzianen zum obersten Notar von Florenz bestellt. Wir werden noch von ihm hören.
Wer reich oder gebildet war, erfüllte zwei wesentliche bürgerliche Tugenden. Doch dann erschienen Männer am Arno, die beides in Frage stellten. Als ein Florentiner Kaufmann eines Abends zu später Stunde nach Hause kam, sah er unter den Arkaden neben dem Backofen zwei armselige schlafende Gestalten. Verwundert fragte er seine Frau: «Warum hast du diesen Landstreichern gestattet, sich unter den Arkaden unseres Hauses einzunisten?» Sie antwortete ihm, daß die beiden um Unterkunft gebeten hätten. Die wollte sie ihnen nicht verweigern, und außer dem Holz neben dem Ofen könnten sie nichts entwenden. Sehr erstaunt war die Frau des Hauses, als sie am nächsten Morgen, wie gewohnt, zur Frühmesse ging. Da knieten die unerwünschten Gäste schon, in tiefer Andacht versunken, in der Kirche.
Nein, Diebe und Landstreicher waren die beiden nicht, sondern Gefährten des Franziskus aus Assisi, und auf sie traf zu, was ein zeitgenössischer Chronist an diesen neuen Christen bewunderte: «Erwärmt von der göttlichen Glut und gehüllt in die Decken der Frau Armut.» Il poverello, der kleine Arme, ist vielleicht die beste Charakterisierung für den Kaufmannssohn aus Assisi, der als ein ganz Großer in die Weltgeschichte eingegangen ist, verkitscht, verklärt, vergoldet. Aber Bruder Franz hat davon keinen Schaden genommen, seine Zärtlichkeit für die Menschen und alle anderen Geschöpfe auf dieser Erde war stärker als alle Heiligenscheine, die man ihm verpaßte. Viel schmerzlicher war für ihn, was ihm zu Lebzeiten die römische Kirche, die er stets aus Gehorsam und Überzeugung geliebt hat, und einige seiner Brüder im Herrn zufügten.
Als Franziskus sich im Oktober 1226 in Assisi auf dem kalten Boden seiner geliebten kleinen Portiunkula-Kirche zum Sterben legte, war sein Traum einer armen, fröhlichen Gemeinschaft schon zerstört, sein Lebenswerk eigentlich gescheitert. Eine brüderliche Gemeinschaft hatte Franziskus aufbauen wollen, nur eine Kutte sollte jeder Bruder tragen und als wandernder Prediger über Land ziehen, ohne jeden Besitz – an Geld und an Bildung – und verachtet wie einst Jesus mit seinen Aposteln. Keine Regeln wollte er und keine Klöster gründen und beugte sich am Ende doch der Mutter Kirche. Bruder Franz gab schließlich seine Zustimmung zu einer Ordensregel, die nicht seinen ursprünglichen Zielen entsprach, und mußte zusehen, wie feste Ordenshäuser und klösterliche Strukturen entstanden und aus seinem Kreis ungebundener Männer ein neuer Priesterorden wurde.
Die Zeitgenossen jedoch wußten nicht, daß der Gründer anderes im Sinne hatte. Die Bettelmönche des Franziskus schienen ihnen wie ein Wunder, wie ein Unterpfand für gute, vertrauenswürdige Zeiten. Sie ahnten nicht, daß gerade dieser Ruhm der Welt die Ideale der Bettelmönche schon bald zunichte machen würde. Das 13. Jahrhundert, voller Kriege, geldgierig und geschäftstüchtig, sog die Botschaft der neuen Mönche auf wie ein Verdurstender das Wasser: Friede sollte allenthalten sein, Solidarität mit den Ärmsten und Schwächsten. Keine Herren sollte es mehr geben, sondern nur noch Freunde und Freundinnen in Christus – in der Welt und in der Kirche.
Als Franziskus starb, war Dominikus, der Ordensgründer aus spanischem Landadel, schon fünf Jahre tot. Kompromißlos wie der Mann aus Assisi hatte Dominikus seinen Jüngern Armut gepredigt und einen vorbildlichen Lebenswandel. Der vor allem sollte die Kirche wieder glaubwürdig machen. Im Gegensatz zu Franziskus gründete Dominikus sehr bewußt einen Priesterorden, der durch beste Schulung und überzeugende Argumente die Ketzer, die erstmals den festen Bau der römischen Kirche ins Wanken gebracht hatten, von ihrem Irrglauben abbringen sollte.
Florenz war den Ketzern ein sicherer Hort. Die Katherer, die Reinen, die sich im Süden Frankreichs entwickelt hatten, besaßen hier einen geheimen Bischofssitz und lebten ohne Furcht unter den Bürgern, von denen sie etliche einflußreiche gewonnen hatten. Der Bannstrahl des katholischen Bischofs richtete nicht viel aus, seine Autorität galt den Bürgern nicht allzuviel, und seine Strenge hielt sich auch in Grenzen. Dem machte der Papst 1232 ein Ende. Die Ordensbrüder des Dominikus, der in aller Eile 1234 zur Ehre der Altäre erhoben wurde, jagten nun als Inquisitoren im päpstlichen Auftrag die Ketzer überall in Europa wie die Hunde das Wild.
Florenz war 1244 an der Reihe. Am Arno erscheint der gefürchtete Ketzerverfolger und Dominikanermönch Petrus von Verona. Zusammen mit seinem Florentiner Ordensbruder Ruggero de Calcagni führt er – mitten im Bürgerkrieg zwischen Guelfen und Ghibellinen – einen Prozeß nach dem anderen, werden die Geständigen von den geistlichen Brüdern dem Arm der weltlichen Gerichtsbarkeit ausgeliefert. Die ist in diesen wirren Jahren vor der ersten Florentiner Republik prokaiserlich und damit antipäpstlich. Doch es macht den Dominikanern kein Kopfzerbrechen, am Morgen zum Unheil der Ketzer mit den Kaiserlichen zu paktieren und ihnen am Nachmittag auf den Barrikaden blutige Händel zu liefern. Als Bruder Petrus nach zwei Jahren Florenz verläßt, sind die wenigen überlebenden Ketzer in den Untergrund gedrängt. Sie werden sich nicht mehr erholen, und die Bürger brauchen ihre Energien für andere Kämpfe.
Nach dem Sieg der Volksregierung 1250 sind die Ketzer kein Thema mehr und die Bettelmönche in den einfachen Kutten werden ein vertrauter Anblick in der Stadt, auch wenn Santa Croce und Santa Maria Novella, die beiden kleinen Kirchen der Franziskaner und Dominikaner, außerhalb der damaligen Mauern liegen. In Florenz müssen die öffentlichen Plätze erweitert werden, um die Menge der Menschen zu fassen, die zu den Predigten der Bettelmönche strömen. So beliebt ist das neue Armutsideal, daß es bald ein halbes Dutzend neuer Gemeinschaften von Bettelmönchen gibt, die alle ihren willkommenen Platz in der Bürgergemeinde finden.