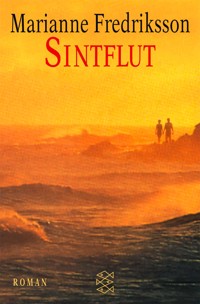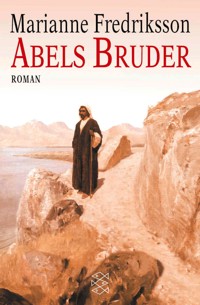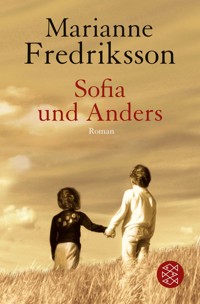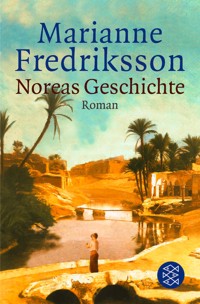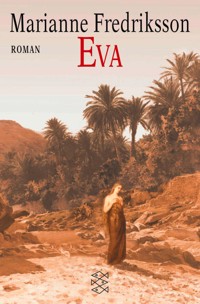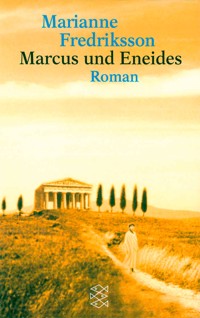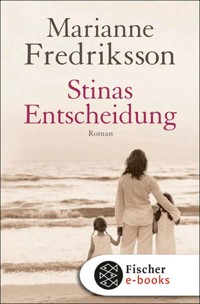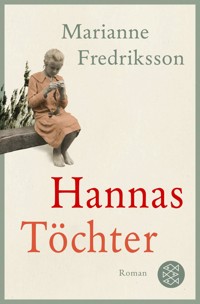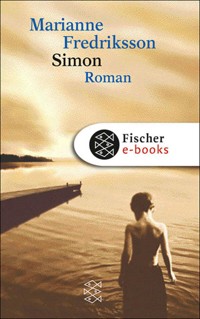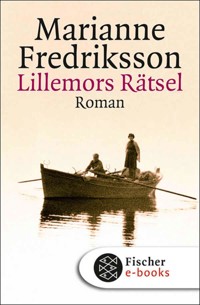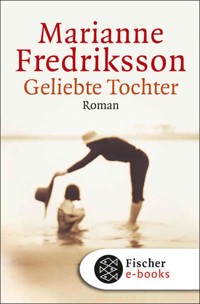8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie glaubt, dass Träume, Gedanken und Gefühle einen Menschen steuern. Er ist sich sicher, dass die Gene einen Menschen bestimmen. Er ist Naturwissenschaftler und glaubt an Fakten. Sie gehört zu den Menschen, die auf der Suche sind. Er hat Angst vor ihrer Intuition, die er nicht greifen, nicht begreifen kann. Beide fürchten sich vor der großen Liebe, und davor, von ihren Gefühlen fortgerissen zu werden. Und doch versuchen Jan und Angelika mit aller Macht, zueinander zu gelangen…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Marianne Fredriksson
Die Jahre mit Jan
Roman
Aus dem Schwedischen von Senta Kapoun
Fischer e-books
Niemand kann dir die Brücke bauen, auf der gerade du über den Fluss des Lebens schreiten musst, niemand außer dir allein … Es gibt in der Welt einen einzigen Weg, auf welchem niemand gehen kann außer dir …
Friedrich Nietzsche, Unzeitgemäße Betrachtungen, Drittes Stück
1.
Später würde er sagen, es sei ein Werk des Zufalls gewesen.
Es war ein Freitagnachmittag im Frühling. Ein düsterer Himmel hatte sich wie ein Dach über die Stadt gesenkt und drückte die Abgase aufs Pflaster.
Das Atmen fiel schwer.
In einer Bar in der Kungsgata spülte er einen Hamburger mit Leichtbier hinunter. In der Hamngata beschloss er dann, durch den Berzeliipark zu gehen, wo er einen Blick auf den Alten warf, der dort als Denkmal stand. Seiner Wirklichkeit und seiner Bedeutung für die Wissenschaft enthoben.
Von dem schönen und geheimnisvollen Bau fasziniert, blieb er kurz vor der Synagoge stehen. In diesem Augenblick öffnete der Himmel seine Schleusen und überflutete die Stadt.
Wie viele andere Schutz suchend, rannte er unter das ausladende Vordach des Tores zur großen Ausstellung. Dort wurde es bald eng, und als der gewaltige Regen die Straße unter Wasser setzte, waren Hosenbeine und Schuhe im Nu durchnässt.
»Das muss die Sintflut sein«, sagte ein älterer Mann im Gedränge.
Niemand lachte.
Da beschloss er, sich die Ausstellung moderner schwedischer Kunst anzusehen.
Er hieß Jan Antonsson und empfand, wie viele andere auch, moderne Kunst, also modern art, eher als Un-art. Unverständlich.
Um sich ein wenig trockenzuwischen, ging er zur Toilette und bediente sich ausgiebig an den Papierhandtüchern. Die größte Mühe bereiteten ihm seine Haare, sein roter Schopf wurde im nassen Zustand zum unmöglichen Krauskopf. Er verabscheute seine Haare, seine Sommersprossen und seine wasserblauen Augen. Das war schon immer so gewesen.
Er schlenderte an den Wänden der Ausstellung entlang und blieb vor einem Gemälde stehen: ein grenzenloses Meer, hohe Klippen und ein Abhang mit leuchtenden Lupinen.
Er war jetzt wieder drei Jahre alt. Es war einmal …
Oder auch nicht.
Das Meer umfasste alles Blau der Erde und des Himmels. Weit hinten, wo der Strand sich verlief, stand ein kleines weißes Haus. Unerschütterlich trotzte es den Stürmen vom offenen Meer. Dort wohnten freundliche Menschen, das sagte ihm sein Bauch. Es waren so viele Jahre vergangen, seit er etwas mit allen Sinnen erfasst hatte, dass er es schon gar nicht mehr wusste. Aber sein Körper erinnerte sich noch daran, dass es in seinem früheren Leben einmal so gewesen sein musste.
Jetzt konnte er sein Blut in den Ohren rauschen, sein Herz in der Brust schlagen hören. Er atmete tief ein, als müsste er seine Lungen mit mehr als der im Saal vorhandenen Luft füllen. Langsam wurde ihm die Unruhe um ihn herum bewusst. Und er merkte, dass andere Menschen auf ihn aufmerksam wurden, weil er wie versteinert sein Meer anstarrte. Er ging weiter, er sah andere Bilder, und sie gefielen ihm, obwohl er sie nicht verstand. Es gab vieles, was ihn in einer unverständlichen Sprache anrührte.
Schön.
Was immer schön bedeuten mochte.
Auf dem Rückweg blieb er noch einmal vor seinem Gemälde stehen. Sah sich das einfache weiße Haus am Meeresstrand an und wusste ohne den geringsten Zweifel, dass dort eine Mutter und ein Vater und mehrere Kinder wohnten, die viel miteinander sprachen und oft lachten.
Es regnete immer noch, als er die Ausstellung verließ, aber jetzt war es nur noch ein sanfter Nieselregen, der den Park nach Frühling duften ließ. Die Knospen an den Bäumen im Kungsträdgården sprossen. Es würde auch in diesem Jahr wieder Frühling werden. Doch das tröstete ihn nicht.
Er dachte an sein Bild und wunderte sich, dass er so betrübt war. Als trauerte er …
Es war ihm nicht anders ergangen als den meisten Menschen. In der Schule musste er alles, was auf Fakten basierte, widerwillig verstehen lernen. Seine Mutter stand natürlich auf der Seite der Schule. Lernen bedeutete für sie, wie sie sagte, dass man im wirklichen Leben festen Boden unter den Füßen hatte. Und diesen Boden konnte er nur durch Wissen erreichen.
Dann fügte sie, jede Silbe betonend, hinzu: Wissend, wahrhaftig und ehrlich zu sein, das ist das Wichtigste im Leben.
Er musste mit dem Lügen aufhören.
Das waren harte Worte für einen Siebenjährigen, der mit der gleichen Selbstverständlichkeit log, mit der ein Pferd trabt. Er war ein Mordskerl im Erfinden. Und er sparte nicht mit Effekten und grellen Farben, wenn er loslegte. So wurde er zum Clown der Schule.
Aber mit den Jahren änderte er sich. Das war vor allem Mutters Augen zuzuschreiben, die genau wussten, wann er log. Aber auch die Schule hatte daran ihren Anteil, denn die Gesetze der Mathematik und die Regeln der Grammatik begannen ihn zunehmend zu faszinieren. Es dauerte seine Zeit, bis er begriff, dass auch die Wahrheit viele Gesichter hat. Dass auch sie missbraucht werden, Vorteile verschaffen, Unsicherheit verschleiern … und die Dinge manipulieren konnte. Dazu bedurfte es nur weniger Worte:
»Gemäß den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft …« Und schon war man obenauf.
Zu Hause angekommen, wollte er gleich den Auktionator anrufen und ein Angebot für das Bild hinterlegen. Aber seine Hand wählte Angelikas Nummer wie von selbst.
»Ich muss mit dir reden«, sagte er.
»Nein, diesmal muss ich mit dir reden.«
»Um was geht's?«
»Um Liebe und Projektionen. Gestern hast du gesagt, dass das, was die Leute Liebe nennen, zum größten Teil Projektionen sind. Ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen und möchte dir klar sagen, dass ich nicht der Spiegel für deine Träume sein will. Ich bin einzig und allein ich, hast du das verstanden?«
»Du weißt doch, dass ich öfters Mist daherrede.«
»Du redest eben überhaupt nicht, für dich sind immer alles gleich Fakten.«
Er schwieg.
Schließlich sagte er:
»Mir ist was passiert.«
»Was Schlimmes?«
»Nein, etwas Eigenartiges. Darf ich rüberkommen?«
»Klar.«
2.
Eine halbe Stunde nach dem überwältigenden Erlebnis der Kunstausstellung stand er in ihrer Diele. Er dachte, mein Gott, wie schön sie doch ist. Guter Gott! Habe ich sie denn noch nie richtig angesehen? Er starrte sie an, ihren großzügigen Mund in dem kleinen dreieckigen Gesicht mit den hohen Backenknochen. Das fast schwarze Haar, das so kurz geschnitten war, dass es die Kopfform betonte. Und dann die Augen, die so dunkelbraun waren, dass man die Pupillen nur ahnen konnte. Der in die Ferne schweifende Blick hatte ihn vom ersten Moment an fasziniert.
Sie lächelte, als sie sagte:
»Du starrst mich an, als hättest du mich noch nie gesehen.«
Er konnte ihr doch nicht sagen, wie es sich tatsächlich verhielt. Er wurde rot, und zu ihrem Schrecken fing er an zu weinen. Sie sagte, sie wolle Kaffee kochen, er solle sich zu ihr in die Küche setzen und erzählen.
Der starke Kaffee beruhigte ihn.
Er erzählte ihr von seinem langen Tag, wie ihm bei der Arbeit alles schief gelaufen war, sodass er um drei Uhr Schluss gemacht hatte. Er berichtete ihr von dem dürftigen Imbiss in dem kleinen Lokal in der Stadt.
»Ich bin durch den Park gegangen und vor der Synagoge stehen geblieben. Und da brach das Unwetter los.«
»Ja, ich habe es in Danderyd vom Fenster aus gesehen«, sagte sie. »Es sah so aus, als ob der Himmel geplatzt wäre.«
»Genau.« Er schüttelte den Kopf.
»Erzähl weiter«, sagte sie.
»Ich bin vor dem Regen in die Bukowski-Ausstellung geflüchtet, bin einfach so herumgegangen und habe mir komische Bilder angesehen.«
Er fand nur schwer die richtigen Worte, wurde aber sicherer, als er zu der Begegnung mit dem gewissen Bild kam. Und entdeckt hatte, dass er sich, wie ein Dreijähriger, mit allen Sinnen erinnern konnte.
»Das ist wirklich wahr«, sagte er. »Es klingt verrückt, aber ich weiß, dass ich die Wirklichkeit wahrgenommen habe. Es war ein großes Meer mit steilen Klippen und einem weißen Haus. Ich wusste, dass dort freundliche Menschen wohnen.«
Sie versuchte, ihn auf die Erde zurückzuholen.
»Vielleicht war es eine Kindheitserinnerung.«
»Das habe ich zunächst auch gedacht. Aber es war mehr als das, es war noch etwas anderes dabei.«
Sie grübelte schweigend vor sich hin und sagte dann:
»Kinder erfahren die Welt nun mal mit allen Sinnen und dem ganzen Körper, solange sie neu und voller Wunder ist. Später wiederholen sich die Bilder einfach, sie werden zur Gewohnheit, zu etwas ganz Alltäglichem. Das ist traurig, und darum stimmt einen der Anblick von etwas Schönem vielleicht manchmal so wehmütig, weil man weiß, dass es schön ist, es einen aber nicht wirklich berührt. Etwas ist verloren gegangen.«
»Es war etwas anderes«, sagte er hartnäckig.
Sie sagte: »Jetzt machen wir uns was zu essen.«
Das hatten sie schon viele Male getan, die gemeinsame Arbeit in der Küche war von schlichter Selbstverständlichkeit, die Körper bewegten sich im sicheren Rhythmus, berührten sich bisweilen, sie tauschten ein Lächeln oder wechselten ein paar Worte, etwa wenn sie die Soße abschmeckten.
Gut.
Sie aßen ihre gebratenen Strömlinge mit Kartoffelbrei und beschlossen, zeitig schlafen zu gehen.
»Ich weiß so wenig von deiner Kindheit«, sagte sie. Es wurde eine lange Nacht.
Er begann mit dem Wal im Öresund.
Er war erst sechs Jahre alt, als er seinen Vater und dessen Kumpel auf dem jährlichen Segeltörn nach Kopenhagen begleiten durfte. Erinnerungen an die Großstadt hatte er nicht. Erinnerte sich nur an das Gefühl, dass sie ihm Angst gemacht hatte. Auf der Heimfahrt wurden sie auf der Höhe von Ven von einem Wal begleitet. Das riesige Tier tauchte plötzlich backbord auf und erschreckte ihn fast zu Tode. Dann sah er, dass sein Vater ganz gelb im Gesicht war und das Ruder so fest gepackt hatte, dass die Knöchel weiß hervortraten.
»Der macht uns mit einem einzigen Schlag der Schwanzflosse zu Kleinholz«, meinte er.
Der Wal begleitete das Boot bis zur Nordspitze von Jütland, wo der Riese dann auf westlichen Kurs Richtung Atlantik abtauchte. Jan lachte auf, bevor er weitersprach:
»Es war ein bemerkenswerter Wal, denn er wurde von Jahr zu Jahr größer. In Järnbott war er noch so groß wie ein vierstöckiges Haus gewesen, aber bald wuchs er mit den Wolkenkratzern von New York um die Wette. Die Begebenheit wurde Jahr für Jahr erzählt. Ich liebte sie, sie gehörte zur Tradition, wenn das Boot im Frühjahr seeklar gemacht wurde. Mutter verabscheute sie, genauso wie Vaters übrige Erzählungen.
Mein Vater stammte aus Värmland und aus einer Familie, in der jeder eine Geschichte auf Lager hat. Eine Sage, eine Geistergeschichte, ein Gedicht. Mutter verabscheute das. Lauter Angeber und Lügner, behauptete sie immer.
Sie stammte aus einem norrländischen Dorf, in dem man frühzeitig lernte, mit Worten sparsam umzugehen. Wer viele Worte machte, wollte sich hervortun. Und das war schäbig.«
Angelika musste laut lachen. Jan rollte sich auf den Rücken, musste mitlachen und sagte, es gibt in unserem Land noch ganz andere kulturelle Probleme als die, mit denen die Einwanderer sich herumschlagen.
Das übermütige Gelächter löste eine Lust in ihm aus, die seine Schläfen pochen und sein schamloses Glied sich unter der Decke wie ein Kanonenrohr aufrichten ließ.
»Ich verliere noch den Verstand!«, japste er.
»Gut«, sagte sie.
Danach überkam ihn die Angst. Vorsicht im Bett war sein eisernes Prinzip. Dieses Mal hatte er sich einfach treiben lassen. Er suchte ihren Blick. Und der erschien ihm erstaunlich zufrieden.
Jetzt bekamen sie Hunger und entschlossen sich für Käse, Brot und Obst. Auf dem Bettrand sitzend tranken sie Rotwein dazu. Aber trotz des Weines konnten sie nicht einschlafen.
»Erzähl weiter«, bat sie, und er kramte in seinen Erinnerungen und landete bei den Großeltern auf dem Bauernhof in Värmland. Den Eltern seines Vaters.
»In meinen ersten Sommerferien wurde ich nach Värmland geschickt. Großmutter und ich streiften durch den Wald. Wir nannten es Kühe hüten. Aber eigentlich kümmerten wir uns kaum um sie, wenn sie am Waldrand weideten.«
Angelika hatte das Gefühl, seine Stimme habe an Klang und Lebhaftigkeit gewonnen.
»Großmutter war besonders darauf aus, mir seltene Vögel und Blumen zu zeigen.«
Er verfiel in nachdenkliches Schweigen.
»Erzähl weiter«, forderte Angelika.
»So nach und nach zeigte Großmutter mir dann aber das kleine Volk, das unter den riesigen Bäumen der Wildmarken lebte. Sie schilderte, wie sie ihre Häuser unter der Erde bauten und die Wurzelfäden der Bäume zu kleinen Grotten flochten.«
Wieder lag er eine Weile schweigend da. Dann aber fand er doch Worte:
»Es dauerte nicht lange, und ich konnte sie auch sehen, ja, ich konnte sogar ihr Geschnatter hören. Schon damals wusste ich, dass ich meiner Mutter davon nie ein Wort erzählen würde. Und auch keinem anderen Menschen.
Mama lag im Krankenhaus. Es hieß, sie werde mir ein Brüderchen schenken. Aber irgendwann klingelte in aller Herrgottsfrühe das Telefon, und ich hörte Großmutter in den Hörer weinen. Als sie zu mir in die Kammer kam, sagte sie, aus dem Brüderchen sei nichts geworden.
Mehr habe ich nie erfahren.
Während meiner Studienjahre habe ich dann den Sommer in Värmland vergessen. Eines Abends aber ließ ich die Bücher Bücher sein und ging ins nächstbeste Kino. Es war reiner Zufall, dass dort ›Ronja Räubertochter‹ gezeigt wurde. Und da waren sie dann, die kleinen Trolle. Sie sahen genauso aus, wie ich sie in den Wäldern von Värmland gesehen hatte.«
Wieder schwieg er, um nach einer Pause fortzufahren:
»Gib zu, es war doch merkwürdig, dass Astrid Lindgren und ihr Regisseur Tage Danielsson die gleichen Trolle gesehen hatten wie Großmutter und ich.«
»Ich glaube, dass kleine Kinder und große Dichter sich in andere Wirklichkeiten versetzen können«, sagte Angelika.
»Wie kannst du so etwas glauben?«, fragte Jan.
»Ich bin selbst einmal ein Kind in einer erfundenen Wirklichkeit gewesen«, meinte sie, und ihre Stimme wurde ganz tief vor Verwunderung.
»Jetzt musst du aber erzählen«, sagte Jan.
»Nicht jetzt«, sagte sie. »Dies ist deine Nacht.«
Jan seufzte, fuhr aber fort:
»Ich war in körperlicher Hinsicht ein erbärmlich kleiner Junge und wuchs nicht wie andere Kinder. Erst als ich ins Gymnasium kam, schoss ich in die Höhe. Zu dieser Zeit hörte ich auch mit dem Lügen auf. Ich, der ich doch immer gelogen, immer Geschichten erfunden hatte. Vielleicht war das ein Erbe von Vater und seiner Familie. Aber viel eher glaube ich, dass ich mich hervortun musste, weil ich ansonsten eine Niete war. Während meiner Schulzeit war ich immer der Kleinste in der Klasse, ich war so klein, dass ich beim Sport nirgends mitmachen durfte. Ich hatte feuerrote Haare und Sommersprossen. Kurz gesagt: Ich war hässlich und ein Außenseiter. Heute würde man sagen, ich wurde gemobbt. In diesem Punkt aber hat Mutter mir den Kopf zurechtgestutzt.
›Habe ich dir nicht beigebracht, dass die einzige Möglichkeit, sich in der Welt zu behaupten, die ist, festen Boden unter die Füße zu bekommen‹, sagte sie. ›Und diesen Boden baut man nicht mit Phantastereien auf.‹
Sie hatte ein längeres Gespräch mit meiner Lehrerin geführt, die meinte, ich sei zwar begabt, aber faul. Aber Mama hatte ihr geantwortet, ich sei nicht faul, sondern ich langweilte mich.«
»Das hat deine Mutter gut gemacht«, sagte Angelika. »Aber ich finde, es hat ihr … ein bisschen an … Einfühlungsvermögen gefehlt. Alle Kinder phantasieren, das ist ein Geschenk der Götter an die Kinder.«
Er dachte eine Weile nach und sagte dann:
»Mag sein, aber du verstehst mich falsch. Ich habe fabuliert, um aufzufallen. Ich spielte eine Rolle, ich war der Klassenclown. Und bei bestimmten Gelegenheiten habe ich ganz bewusst gelogen.«
»Inwiefern?«
»Lass mich die Sache mit dem Fahrrad erzählen«, sagte er, und sie stellte erstaunt fest, dass er rot wurde und zögerte. Doch schließlich kam er zur Sache:
»Ich hatte ein altes, schweres Fahrrad, das eine Kusine mir vermacht hatte, die es ihrerseits von einer Tante geerbt hatte. Die Kette sprang immer wieder ab. Die Bremse war nicht ganz in Ordnung und blieb öfter hängen. Man könnte sagen, damit zu fahren war lebensgefährlich, aber daran habe ich nie gedacht. Das Schlimmste daran war, dass es ein Weiberrad war. Alle Jungen verspotteten mich, mein Gott, welch ein Hohn.«
Er zögerte ein weiteres Mal, holte dann tief Luft und fuhr fort: »Vater hatte kein Geld, um mir ein neues Rad zu kaufen, denn er hatte beim Segelmacher eine neue Fock bestellt. Eine Art Ballon, mit dem er alle Regatten des Sommers gewinnen wollte. An einem dunklen Winterabend hatte ich auf dem Heimweg eine Idee. Hinter der Kurve von Berghem, wo die Straßenbahn langsamer fahren musste, legte ich das Fahrrad auf die Gleise.
Ich versteckte mich hinter einer Fichtenhecke und hörte die Schienen kreischen, als der schwere Triebwagen abbremste. Dann kam ein Knirschen, als er das Fahrrad zu Schrott fuhr.
Ich rannte laut heulend nach Hause und erzählte, dass die Bremse mitten auf dem Gleis versagt hätte und dass ich nur mit dem Leben davongekommen sei, weil ich weggelaufen wäre.
Ich tat so, als wäre ich total von Sinnen, und zitterte am ganzen Leib. Mutter wurde leichenblass und Vater rot vor Scham. Ich selbst schämte mich überhaupt nicht. Es wurde ein großer Sieg. Schon am nächsten Tag bekam ich ein neues Jungenfahrrad, und Vater sagte dem Segelmacher ab, er würde noch eine Saison mit der alten Fock zurechtkommen.«
Zu seiner Verwunderung hörte Jan Angelika laut ins Kissen lachen.
»Was für ein raffinierter kleiner Kerl«, keuchte sie.
Das Merkwürdige war, dass er in ihr Gelächter einstimmen konnte. Es war fast wie beim Anblick des Meeres auf dem Gemälde. Er begegnete einer anderen Wirklichkeit.
Er erwachte aus unruhigen Träumen, als die alte Standuhr fünfmal schlug. Angelika brachte ihm Kaffee ans Bett, süß und stark, wie er ihn mochte.
»Ich muss zur Arbeit«, sagte sie. »Ich habe Frühschicht, aber ich bin um vier Uhr wieder zurück. Da will ich dann etwas über das Mädchen hören, das Katarina hieß.«
Er widerstand dem Impuls, die Decke über den Kopf zu ziehen, sagte aber widerspenstig: »Ich will aber nicht. Und was, zum Teufel, weißt du von Katarina?«
»Nur, dass du den ganzen Morgen von ihr gefaselt hast.«
Jetzt flüsterte er:
»Ich bilde mir ein, dass ich sie getötet habe.«
»Und – hast du?«
»Nein, nicht im buchstäblichen Sinn. Aber … ich habe Lügen verbreitet, dass sie eine schreckliche Krankheit hätte. Dann hat sie diese Krankheit tatsächlich gekriegt und ist daran gestorben.«
Angelikas Augen weiteten sich vor Entsetzen.
Dann musste sie schleunigst zur U-Bahn und zu ihrem Job im Krankenhaus Danderyd.
3.
Jan nahm sich die Wohnung vor. Er begann in der Küche, wo sich noch die schmutzigen Teller, Tassen und Schälchen vom gestrigen Abend stapelten. Die Trinkgläser lagen im Spülbecken im schmutzigen Wasser. Er wusch ab, putzte Herd und Arbeitsflächen. Als Nächstes kam das Schlafzimmer dran, er lüftete, machte die Betten. Abschließend wanderte er mit dem Staubsauger durch die Zweizimmerwohnung. Immer wieder staunte er darüber, wie hell Angelikas Räume waren, weiße Wände, weiße Gardinen überall, und es standen nur wenige Ziergegenstände herum.
Dürftig, hatte er immer gefunden.
Einige Bilder von der Art, für die er kein Verständnis aufbringen konnte, hingen an den Wänden. Und es gab ein paar moderne Möbel, ein schreiend farbiges Sofa, in leuchtendem Orange bezogen, und viele, viele Kissen in Rosa und Grün. Vulgär hatte er das gefunden. Heute hatte er aber das Gefühl, dass das Sofa lachte.
Als er mit der Hausarbeit fertig war, ließ er sich in dem einzigen bequemen Sessel der Wohnung nieder, um die Zeitung zu lesen, merkte aber schnell, dass er nicht mitkriegte, was da stand. Die Augen folgten zwar den Zeilen, aber der Sinn ging ihm verloren. Ihn quälte die Angst vor dem, was ihm gestern passiert war, als Angelika ihm fast fremd erschienen war.
Wie so oft, wenn er Probleme hatte, kehrten seine Gedanken zur Mutter zurück, und ihre Worte ertönten, wie nicht anders zu erwarten:
»Das bildest du dir ein!«
So erinnerte er sich daran, wie er eines Tages zu ihr in die Küche gestürmt war, um ihr jubelnd zu berichten, sein Abiturzeugnis sei so gut, dass er zum Medizinstudium zugelassen worden war.
»Begreifst du, Mama. In ein paar Jahren bin ich Doktor! Ein richtiger Arzt.«
Er hatte erwartet, dass sie sich freute.
Aber sie hatte gesagt:
»Was interessieren dich schon Menschen. Du beachtest sie doch überhaupt nicht!«
»Aber Mama, versteh doch. Heute geht es um Wissenschaften, um Biologie, Chemie oder Technik.«
Und sie hatte in ihrem überheblichsten Ton geantwortet:
»Bei so einem Doktor möchte ich nie landen.«
Jetzt, hier in Angelikas Sessel sitzend, überkam ihn ein großer Zorn. Was, zum Teufel, hatte seine Mutter ihm da angetan! Aber sie hatte ja Recht behalten. Schon nach wenigen Jahren, bei der Visite in der langen Schlange ganz hinten stehend, musste er sich eingestehen, dass Patienten und ihre Krankheiten ihn anödeten. Vor manchen ekelte er sich sogar.
Er schrieb seine Doktorarbeit, denn es war immer gut, auf ein Examen hinweisen zu können. Dann wurde ihm ein Stipendium zugesprochen, sodass er an der Universität in Stockholm Biochemie studieren konnte. Nach wenigen Jahren bekam er schließlich eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter und spezialisierte sich auf Gentechnik.
Er hatte Erfolg. Es gefiel ihm. Er wurde nach Amerika eingeladen, wo er seine Kenntnisse in einem großen Laboratorium vertiefen konnte. Er schrieb an der Columbia University eine weitere Arbeit und erwarb damit noch einen Doktortitel. Aber etwas Wichtiges war ihm verloren gegangen.
Seine Gedanken kehrten zum gestrigen Tag zurück, an dem ihm bewusst geworden war, dass er Angelika nie richtig angesehen hatte. Obwohl er sie seit Monaten kannte und vom ersten Augenblick an geliebt hatte. Mit mir stimmt wirklich etwas nicht, dachte er. Er riss sich zusammen. Er musste etwas unternehmen.
Seine Mutter hatte in einem der Feinkostgeschäfte von Feskekörka in Göteborg Fisch verkauft. Er erinnerte sich, wie es dort nach Meer und Salz, nach Hummer und Krebsen gerochen hatte, die im Beisein der Kunden gekocht wurden. Krabben, Dill. Die Düfte waren durch seine Poren gedrungen, verlockend und sinnlich.
Hier in Stockholm gab es kein Feskekörka.
Er besorgte fangfrischen Heilbutt und große Westküstengarnelen in der Markthalle von Östermalm. Bündelweise Dill.
Vor den EU-Erdbeeren zögerte er, kaufte dann aber doch einen Karton.
Zu Hause beschloss er, Reis zu kochen, während der Heilbutt im Backofen schmorte. Er schälte die Krabben und kochte die Schalen in wenig Wasser auf. Dann versuchte er sich mit fein geschnittenem Dill, Gewürzen und Sahne an der Soße.
»Hier riecht es ja himmlisch!«, rief Angelika, die schnuppernd in der Tür stand.
»Ich bin der Meinung, wir haben allen Grund zum Feiern«, sagte er und nahm sie in die Arme. Merkte, dass er jede Geste wiedererkannte, jede Wandlung in den dunklen Augen. Alles war ihm wohlbekannt, sein Mund auf ihrem hatte heimgefunden, köstlich und geborgen.
4.
Angelika waren an diesem Tag auch viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Nicht während der Arbeit, denn der Job forderte ihre ganze Aufmerksamkeit. Aber schon auf der Fahrt zum Krankenhaus war sie von düsterer Unruhe erfüllt gewesen. Die Bahn raste unter der Stadt dahin, und Angelika hatte sich schließlich eingestehen müssen, dass sie Angst hatte.
Wovor?
Dass sie ihn verlieren könnte?
Ja.
Würde sie so etwas ein zweites Mal überleben?
Das alte, abgeleierte Gebet kam ihr in den Sinn: Lieber Gott, nimm mir meine Mama nicht weg. Aber Gott hörte nicht zu, das wusste sie inzwischen.
Plötzlich fiel ihr wieder ein, was ihre Kollegin Helena über Jan gesagt hatte:
»Hüte dich. Er ist ein eiskalter Klotz.«
Sie hatten gestritten.
»Wer von uns kennt ihn besser, du oder ich?«
»Dann kannst du mir vielleicht mal erklären, warum er immer der Gescheitere sein muss. Und warum es ihm nichts ausmacht, wenn er andere verletzt.«
Helena hatte geseufzt:
»Du bist dermaßen verliebt, dass dir jede Urteilsfähigkeit abhanden gekommen ist.«
Sie trafen sich auch weiterhin, aßen in der Krankenhauskantine zusammen zu Mittag. Aber sie fanden nicht mehr zu der alten Vertrautheit zurück. Sie sprachen nie mehr von Jan.
Heute hätte ich ihr's heimzahlen können, dachte Angelika. Ich hätte ihr sagen können, dass er so ist, wie er ist, weil er als Kind gemobbt wurde. Aber sie hatte es nicht gesagt, weil sie wusste, dass diese Erklärung nicht ausreichte, bei weitem nicht.
Auf der Heimfahrt musste sie in der voll besetzten Bahn stehen. Die Vorortbewohner waren unterwegs in die Großstadt, um Besorgungen zu machen. Sie war müde, es war, wie immer am Wochenende, ein schwerer Tag gewesen. Und dann war da noch die Angst um Jan. Wir sind schrecklich verschieden, dachte sie.
Und im nächsten Moment: Ich weiß eigentlich nicht, wer er ist.
Sie musste an das denken, was Anna einmal gesagt hatte:
»In manchen Fällen hilft keine Therapie der Welt. Psychopathen kann man nicht heilen. Man dringt nicht ins Innere vor, es ist, als wären sie durch und durch verhärtet.«
Verhärtet. Vereist.
Anna war Psychologin und eine Freundin von Angelika. Sie könnte zu ihr gehen und mit ihr über Jan sprechen, aber nein, das würde sie nicht tun. Sie hatte schon frühzeitig gelernt, dass man immer einsam ist, wenn das Leben am schwierigsten ist.
Der Wagen schlingerte in einer Kurve, und plötzlich dachte sie an ihren Vater. Irgendwann würde sie ihn aufsuchen und ihm ihre Frage stellen müssen.
Auf dem Weg von der U-Bahn nach Hause hoffte sie auf einmal, dass Jan gegangen wäre. Auf dem Küchentisch würde ein Zettel mit ein paar hingekritzelten Worten liegen, dass er nach Hause gegangen war, weil er müde war und schlafen wollte.
Er und müde!
Im Fahrstuhl nach oben überkam sie dann der Zorn. Dieser verwünschte feige Kerl hatte sich gedrückt. Gut. Dann würde er eben nie erfahren, dass sie gern mehr über seine Kindheit gehört hätte. Nein. Das wollte sie auf gar keinen Fall. Sie hatte genug von seiner verdammten Mutter. Dieser Norrländerin, die auf jede Frage eine Antwort wusste. Sie würde ihn nicht anrufen. Und nicht ans Telefon gehen.
Schon als sie aus dem Lift stieg und dann ihre Wohnungstür aufschloss, nahm sie den Duft wahr. Feines Essen, Gewürze, Schalentiere, leckere Soße. Im nächsten Augenblick lag sie in seinen Armen, seinen Mund auf ihrem. Und ihr Körper entspannte sich. Auf den Körper ist mehr Verlass als auf die Gedanken, sagte Katta oft. Ich muss sie anrufen, dachte Angelika.
Jan kochte gern, der Heilbutt war erlesen, die Krabbensoße himmlisch und der Wein leicht und gut gekühlt.
O nein, so einfach kommst du mir nicht davon, dachte sie. Trotzdem musste sie zugeben, dass ihr Zorn im Wein untergegangen war. Aber der Schmerz hinterm Zwerchfell nagte weiter an ihr. Sie aßen, sie ließ es sich schmecken und versuchte sich zu erinnern, wann sie zuletzt etwas zu essen bekommen hatte. Das Mittagessen fiel ihr ein, zerkochte Kartoffeln, Fischstäbchen und eine triste Umgebung.
Und dazu Helena.
»Ich soll dich von meiner Kollegin grüßen, du weißt schon, von Helena, deiner Tischdame bei der Weihnachtsfeier im Krankenhaus.«
»Ja«, sagte er vorsichtig. »Sie war mir nicht besonders sympathisch.«
»Warum denn?«
»Sie hatte so ein beunruhigendes Lächeln. Freundlich und nachsichtig. Und es war wie hingekleistert.«
»Ja, sie versteckt sich hinter ihrem Lächeln«, sagte Angelika.
Und dachte, wenn zwei verängstigte Menschen sich begegnen, kann es leicht passieren, dass sie aufeinander losgehen. Denn sie kennen die empfindlichen Stellen ihres Gegenübers ganz genau. Also gelingt es ihnen oft genug, den anderen zu verletzen.
Sie schwiegen eine Weile. Jan brachte frische Teller und die Erdbeeren. Wie erwartet, schmeckten sie nach nichts.
Angelika goss den letzten Wein in ihr eigenes Glas und trank ihn, als wäre es Wasser.
»Ich kann mir gut vorstellen, wie du Helena fertig gemacht hast.«
»Nun, du kennst mich ja.«
Tu ich, dachte sie und versuchte, sich eine boshafte Bemerkung zu verkneifen. Aber es gelang nicht.
»Jedenfalls dem äußeren Erscheinungsbild nach«, sagte sie und schämte sich, als sie sah, wie blass er wurde. Schließlich fragte er:
»Glaubst du, dass mit mir wirklich etwas nicht stimmt?«
»Nein, dieses Bild in der Ausstellung hat dich irgendwie geschockt. Vielleicht war es so etwas wie eine Offenbarung. Es ist ja auch nicht einfach, plötzlich eine neue Wirklichkeitsebene zu erkennen.«
Er dachte daran, wie er heute Morgen beim Aufräumen der Wohnung endlich wahrgenommen hatte, wie schön es hier in aller Schlichtheit war.
»Ich mach Kaffee«, sagte er.
»Dann dusche ich inzwischen.«
Er machte den Kaffee stark, und seine Hände zitterten, als er alles aufs Tablett stellte und es hinaus ins Wohnzimmer trug. Angelika setzte sich aufs Sofa, umgab sich mit einem Stapel aus grellbunten Kissen und legte sich das größte auf die Knie.
Sie baut Mauern, dachte er.
Dann ging sie zum Angriff über:
»Deine Mutter war mir in deiner Erzählung heute Nacht nicht sehr sympathisch.«
»Für mich war sie wie ein Fels. An dem man sich natürlich auch verletzen kann. Aber ohne sie wäre ich ein Schwächling geblieben.«
»Und vielleicht ein Dichter geworden. Oder zumindest ein Mensch, der seinen Gefühlen freien Lauf lassen kann.«
»Aber Angelika, jemand muss einem Kind, das Phantasie und Wirklichkeit nicht unterscheiden kann, doch Grenzen setzen.«
Sie sah an seiner Schläfe eine Ader pochen. Jetzt ärgert er sich, dachte sie.
Aber er war verwundert.
»Man findet sich doch nicht zurecht, ohne die Wirklichkeit zu verstehen. Und dazu braucht es einen gesunden Menschenverstand.«
Angelika lachte ihm frei ins Gesicht:
»Einstein sagt, dass der gesunde Menschenverstand aus nichts anderem als alten Vorurteilen besteht.«
»Was, zum Teufel, hat er damit gemeint?« Jan war verärgert, das Pochen an der Schläfe steigerte sich.
Teufel nochmal, dachte sie.
»Ich würde meinen, er wusste, dass Vorurteile und Vernunft im Leben Sicherheit vermitteln und Zugehörigkeit. Dass sie aber den freien Lauf der Gedanken und die Intuition blockieren. Die Kreativität.«
»Du meinst also, dass Fakten und Wissen von Übel sind?«
»Nein, natürlich nicht«, erwiderte sie. »Aber die so genannten unumstößlichen Tatsachen setzen unserem Weltbild Grenzen, die sich mit dem Zeitgeist verändern. Gegenwärtig dominiert eine naturwissenschaftliche Einstellung zum Leben und der Wirklichkeit. Sie will uns glauben machen, dass wir damit festen Boden unter den Füßen hätten.«
Jans blassblaue Augen blitzten plötzlich auf, und in sarkastischem Ton fragte er:
»Und was gibt es sonst noch? Nenn mir die Alternativen?«
»Intuition, Gefühl, Phantasie, Liebe, Kunst, Musik, Träume. O Jan, es gibt so vieles, was du nicht siehst. Oder womit du nicht rechnest.«
»Solche Gefühlsduselei kenne ich gar nicht an dir.«
Jetzt triefte seine Stimme vor Hohn.
»Aber vielleicht ist das nur deine Art, die Dinge zu sehen«, sagte Angelika. »Okay, vielleicht bin ich sentimental. Außerdem bin ich sehr müde nach einem Tag, an dem ich viel zugehört und getröstet habe und von Mitleid geplagt war. Und einen Menschen habe sterben und sein Kind vor Schmerz weinen sehen.«
»Ich dachte, in deinem Job geht es darum, Spritzen zu geben, Wunden zu verbinden und darauf zu achten, dass die Leute die richtigen Medikamente kriegen.«
»Das auch«, sagte sie. »Ich lege mich jetzt hin.«
Plötzlich sah er sie angstvoll an:
»Aber ich darf doch hier bleiben?«
»Du kannst auf dem Sofa schlafen.«
Sie holte Bettwäsche und die Reservedecke und verschwand dann ins Bad, um sich die Zähne zu putzen.
Als sie auf dem Weg zu ihrem Schlafzimmer durchs Wohnzimmer ging, sagte er:
»Angelika, du hast dich über meine Mutter geäußert, aber … üben nicht alle Mütter große Macht auf ihre Kinder aus?«
»Doch, ich glaube schon. Meine Mutter ist jetzt ein Engel im Himmel, aber sie hat auch heute noch großen Einfluss auf mein Leben. Als ich neun war, ist sie an Krebs erkrankt, und als ich elf Jahre alt war, ist sie daran gestorben.«
Sie sah ihn nicht an und war samt ihrem in die Ferne schweifenden Blick verschwunden. Hatte gute Nacht gesagt und die Tür hinter sich geschlossen.
5.
Sie wusste, dass sie nicht würde einschlafen können. In der Hoffnung, dass die Muskeln sich dennoch entspannten, legte sie sich auf den Rücken und ließ ihren Erinnerungen freien Lauf.
Es begann wie immer bei der Auseinandersetzung ihres Vaters mit seinem Bruder Martin. Die beiden standen in der Küche, ohne zu wissen, dass Angelika nebenan in der Dienstmädchenkammer saß, zu der die Tür sich nie richtig schließen ließ.
Onkel Martin brüllte:
»Wie, zum Teufel, konntest du nur zwei Jahre lang übersehen, dass Margareta alle Symptome aufwies. Alles deutete doch auf Krebs hin. Hast du die Knoten in ihrer Brust denn nie untersucht? Wie konntest du gegen die Schmerzen Pyramidon einsetzen und Hustentropfen, als sie Atembeschwerden bekam? Schließlich bist du ein verdammter Arzt.«
In eisigem Ton fuhr er gemäßigter fort:
»Von Dorf zu Dorf spielst du den Herrgott für Waldarbeiter und Bauern. Du solltest dich in Grund und Boden schämen.«
Sie wollte ihren Papa verteidigen, hielt sich aber zurück bei dem Gedanken, dass sein Wartezimmer schon lange nicht mehr überfüllt war und sie in der Schule gehört hatte, dass man ihn Doktor Pyramidon nannte. Aber das hatte Ebba gesagt, und Ebba war boshaft wie eine Stechmücke, darin waren sich alle einig.
Papa schwieg in der Küche. Aber Onkel Martin betonte jedes Wort, als er schließlich das Schweigen brach.
»Hättest du sie zum Onkologen nach Umeå gebracht, hätten wir sofort operiert und eine wirksame Behandlung eingeleitet. Und ich kann dir garantieren, dass sie ein normales Leben mit ihrem Kind hätte führen können.«
Papa schwieg. Von diesem Tag an hatte sie ihn gehasst.
Das nächste Bild, an das sie sich erinnerte, war der Krankenwagen, in dem sie neben ihrer Mama saß und deren Hand hielt. Ihr gegenüber saß die Frau, die sie Katta nannten und die mit Onkel Martin verheiratet war. Über sie hatte Mama gesagt, sie stehe unter dem Einfluss einer bösen Fee.
In der Stadt hallte das Martinshorn durch Parks und Straßen. Aber nicht einmal die Sirenen konnten sie erschrecken, denn sie war zu einer aufziehbaren Puppe geworden.
Und die blieb sie lange.
Die Mutter brauchte zwei Monate zum Sterben. Tag für Tag saß das Kind an ihrem Bett und hielt ihre Hand. Es redete sich ein, dass das half.
Sie brauchte keine Schmerzen mehr zu erleiden und schrie nicht mehr, wie bisher zu Hause. Hier gab es eine Schwester mit einer Spritze und einen Doktor, der häufig kam und all die unheimlichen Apparate kontrollierte, an die sie angeschlossen war.
Onkel Martin war mit traurigem Gesicht jeden Tag da und versuchte Angelika zu überreden, mit ihm nach Hause zu Tante Katta zu kommen.
Sie weigerte sich. Zum Schluss stellte man ihr ein Bett ins Krankenzimmer, in dem sie sich ausstrecken konnte.
Später hatte sie versucht, sich die Zeit im Sterbezimmer wieder vorzustellen, aber die Erinnerung blieb aus. Ihr Kopf war leer, ohne Gedanken. Und sie hatte auch nichts gefühlt. In der Nacht, in der ihre Mutter starb, empfand sie weder Trauer noch Erleichterung.
Papa kam, aber sie konnte ihn nicht einmal hassen.
Dann kam Katta und sprach aus, wie es stand:
»Es gibt nichts, was du für deine Mama noch tun kannst. Jetzt kommst du mit nach Hause und wirst schlafen und dich erholen.«
Sie bekam ihr eigenes Zimmer in der großen Wohnung mitten in der Stadt, ein richtiges Jungmädchenzimmer mit weißen Gardinen, einem weichen Teppich, geblümtem Bettüberwurf und einer Menge weicher Kissen.
Katta sagte kein Wort, war einfach da.
Brachte Kuchen und Saft. Und vielleicht war eine Tablette im Saft, denn Angelika schlief sofort ein, schlief die ganze Nacht und den halben nächsten Tag durch.
Katta kam mit belegten Broten und heißer Schokolade. Und das Kind aß und trank.
Dann fanden die ersten Worte den Weg vom Kopf zum Mund.
»Du wirst niemals meine Mama werden.«
Katta nickte, als wäre das selbstverständlich.
Es dauerte seine Zeit, bis Angelika begriff, dass Katta sich von ihren Verpflichtungen an der Universität hatte beurlauben lassen, um sich ihr zu Hause ganz widmen zu können.
Sie spazierten durch die Stadt, durch die Parks, am Umefluss entlang.
Katta kaufte ihr neue Kleider, tolle Jeans, Miniröcke und hübsche Blusen. Sie zog nichts davon an.
Katta wollte, dass sie sich die langen ungepflegten Haare schneiden ließ, hinter denen Angelika sich wie hinter einem Vorhang versteckte. Aber sie schrie vor Angst, wenn der Friseur nur erwähnt wurde.
Nach einigen Wochen kehrten in der Nacht die schrecklichen Träume wieder, laute Stimmen riefen nach ihr, und die Worte krallten sich in ihrem Bauch fest. Sie brauchte Hilfe. Papa hatte, wenn es ganz schlimm war, immer eine Tablette zur Hand gehabt. Sie tappte durch das große Zimmer zu Martins und Kattas Bett. Zitternd vor Kälte.
»Ich hab solche Schmerzen«, flüsterte sie. »Papa hat mir immer eine Pille gegeben.«
Aber Katta sagte, sie solle zu ihr ins Bett kriechen.
»Hierher zu mir«, sagte sie und nahm das Kind in die Arme und wärmte es mit ihrem Körper. Und es geschah, dass das Fürchterliche verschwand, als das Kind die Hände fühlte, die ihm Rücken und Brust massierten. Das kleine Mädchen drehte sich um, und nun massierten die Hände ihren Kopf. Um schließlich ihr das Gesicht zu streicheln. Und da, plötzlich, begann sie zu weinen. Und wie sie weinte, die halbe Nacht und den ganzen Vormittag. Schließlich musste sie eingeschlafen sein, denn erst als Onkel Martin mit Kaffee für sie und Katta kam, wachte sie auf.
»Ich muss aufs Klo«, flüsterte sie.
»Ich auch!«, rief Katta lachend.
»Erster im Klo«, sagte Onkel Martin. Sie liefen um die Wette, und Angelika gewann.
Dann tranken sie auf dem Bettrand sitzend Kaffee. Auch das Kind bekam einen Becher voll. Mit viel Milch in dem schwarzen Getränk.
An diesem Morgen setzte die Erholung ein.
Aber es kamen Rückfälle.
Der schlimmste kam, als Katta an einer Volkshochschule, wenige Meilen von Umeå entfernt, einen Sommerkurs halten sollte.
»Ich bleibe doch nur eine Woche weg«, sagte sie. »Aber unsre Oma wird kommen und dir Gesellschaft leisten.«
Zu spät bemerkte sie, dass das Mädchen erstarrte und blass wurde.
Und diesmal gelang ihr der Schrei:
»Nein!«
Dann bekam sie keine Luft mehr und konnte nur noch flüstern:
»Sie will mich erwürgen.«
»Aber sie ist doch so ein lieber Mensch und hat Kinder besonders gern«, sagte Martin erstaunt.
»Ihr kennt sie nicht. Sie ist im Irrenhaus und behauptet, dass ich ein unehelicher Bankert bin. Und sie hat Gott gelobt, dass sie ihm helfen wird, mich zu töten.«
»Jetzt hör mir mal zu.«
Das war Katta, und es klang zornig.
»Wir sprechen von meiner Mama, sie ist die Oma meiner Kinder. Nicht deine. Wir nennen sie Momma.«
Martin bekam es mit der Angst zu tun, zog sich Angelika auf die Knie, schaute ihr in die Augen und sagte:
»Deine Großmutter ist im Kopf sehr krank. Sie kann nicht gesund gemacht werden. Sie muss bis an ihr Lebensende in einer Anstalt gepflegt werden, die du dummerweise als Irrenhaus bezeichnest. Ist das klar?«
»Sie kann nicht herauskommen?«
»Nein, sie kann nicht herauskommen. Die meisten Kinder haben eine Oma, weißt du.«
»Es gibt also viele andere … Omamas?«
»Ja, und wenn du einmal Kinder kriegst, wird Katta ihre Omama.«
Angelika zeigte fast ein Lächeln.
Aber dann fragte Katta:
»Hast du sie etwa in diesem Irrenhaus besucht?«
»Ja«, schluchzte das Kind. »Sie wollte mich erwürgen.«
»Erzähl.«
Die Schreckensbilder tanzten wieder durch ihren Kopf.
»Sie ist aus dem Bett gesprungen und hat mir den Hals zugedrückt. Es hat furchtbar wehgetan. Aber ich habe mich gewehrt, und da musste sie loslassen.«
»Und was hat deine Mama gemacht?«
»Weiß ich nicht, ich bin dann nur noch gerannt und gerannt. Es gab viele lange Gänge und komische Zimmer, in denen andere schreiende Kranke saßen. Dann kam ich zu einer Treppe und bin wieder gerannt und gerannt, bis ich unten war. Im Keller. Dort habe ich mich hinter einem Berg von weißen Mänteln versteckt.
Dann wurde es irgendwie schwarz um mich, und ich erinnere mich an nichts mehr. Papa hat mich dann irgendwann aufgeweckt, um ihn herum standen eine Menge Leute in solchen weißen Mänteln. Ich hab gefroren, und Papa hat seinen Lodenmantel ausgezogen und mich damit zugedeckt. Dann hat er mich ins Auto getragen. Mama lag weinend auf dem Rücksitz. Dann kam ein wütender Doktor, der sagte, es sei verantwortungslos, ein Kind zu einer Patientin mitzunehmen, die jederzeit einen Anfall bekommen könnte. Aber Mama hat mir gesagt, dass Großmutter sie dauernd sehnsüchtig darum gebeten hatte, ihr einziges Enkelkind nur einmal sehen zu dürfen.«
Einige Tage später war Kattas Mutter gekommen. Und sie und Angelika hatten viel Spaß miteinander. Sie gingen jeden Nachmittag ins Kino und schauten sich die Filme von Astrid Lindgren an. Angelika lachte oft darüber und sogar ganz laut. Und als sie schließlich Pippi Langstrumpf kennen lernte, wusste sie, dass sie genau wie Pippi werden wollte.
Vormittags lasen sie sich gegenseitig Bücher von Astrid Lindgren vor. Wenn Mommas Augen müde wurden, musste Angelika lesen, holprig zwar, aber es ging von Tag zu Tag besser.
Ich war elf Jahre alt und bis dahin noch nie im Kino gewesen, hatte nie ein Buch gelesen. Und hatte nie jemanden gehabt, mit dem ich meine Erlebnisse teilen konnte, dachte sie, als sie jetzt so in ihrem Bett lag.
Dann sah sie Momma wieder vor sich.
Angelika entspannte sich, drehte sich auf die Seite und schlief ein.
6.
Auch Jan konnte nicht einschlafen. Er gab dem Sofa die Schuld, das ihm zu kurz war. Aber es war seine Mutter, die ihn wach hielt. Er versuchte sich zu erinnern, wie sie in seiner Kindheit gewesen war. Aber er fand keine Bilder. Für ihn hatte sie damals genauso ausgesehen wie heute. Felsen verändern sich nicht, dachte er.
Auch ihre Küche zu Hause war nach wie vor unverändert, unpraktisch und armselig. Aber seine Nase konnte sich erinnern. Bei Mama roch es immer gut. Nach frisch gebackenem Hefebrot und Fleischbrühe, die auf dem Herd kochte. Ab und zu auch nach Apfelmus oder Johannisbeergelee.
Er nahm den Geruch sauberer Wäsche wahr, die auf dem Küchentisch sortiert wurde. Und die Stärke roch nach Lavendel, wenn Mama die weißen Gardinen bügelte.
Alles, was sie tat, wurde als selbstverständlich hingenommen. Nichts war wichtiger als die Bootsausrüstung oder die Seekarten und Kompasse. Nichts ging auch über die Wichtigkeit der Landesnachrichten, die der Junge, bei Papa auf dem Fernsehsofa sitzend, mit ansehen durfte.
Bei ihm zu Hause ging es still zu. Das war ihm nie aufgefallen, aber im Alter von sieben Jahren begann er ins Nachbarhaus zu gehen. Dort war er gern gesehen, und es gab andere Kinder. Er hing dort in der Küche herum, wo viel geredet wurde, manchmal laut und aufgeregt. Und es wurde geschimpft und gestritten und herumgeschubst und gelacht.
Man trank viel Kaffee und Saft. Zu dieser Zeit begann er darüber nachzudenken, warum seine Eltern nie miteinander sprachen. Sie lachten auch nicht, zankten und stritten sich nicht. Wenn andere Leute kamen, stets Freunde von Papa, gab er immer seine Anekdoten zum Besten. Mama kochte Kaffee, bot Kuchen an. Dann verschwand sie wieder in der Küche.
Langsam dämmerte es dem Jungen, dass seine Eltern unglücklich waren. Warum sprachen sie nie miteinander? Wenn sie dann und wann ein Wort wechseln mussten, geschah das oft über ihn:
»Sag deinem Papa, dass du neue Sachen brauchst, wenn du im Herbst in die Hauptschule kommst.«
»Muss das sein, er wächst doch gar nicht.«
Der Junge musste immer öfter den Vermittler spielen:
»Kannst du deinem Vater vielleicht mitteilen, dass wir uns einen neuen Außenbordmotor im Moment nicht leisten können.«
Papa wandte sich an Jan:
»Alles, was ich verdiene, gebe ich deiner Mutter. Das Geld, für das ich schwer schufte, rinnt ihr durch die Finger.«
Mit der Zeit glaubte Jan, dass er am Unglück seiner Eltern schuld war. Die Schuldgefühle äußerten sich in ständigen Magenschmerzen. Er begriff, dass er aus diesem Grund auch nicht so wuchs wie die anderen Jungen. Das war die Strafe. Die Bauchschmerzen wurden schlimmer. Aber er sagte seiner Mutter nichts davon.
Doch dann wurde er eines Tages in der Schule grün im Gesicht und krümmte sich über der Bank. Die Lehrerin brachte ihn zur Schulschwester, die ihm auf dem Bauch herumdrückte und sagte, er müsse auf die Notfallstation.
»Rufen Sie seine Eltern an.«
Die Lehrerin nickte. Im Krankenhaus drückten sie etwas fester, und ein Arzt fragte, ob er einen Fußball verschluckt habe. Der Junge fand den Doktor albern. Dann wurde geröntgt, und er musste Schläuche schlucken. Es folgten Spülungen. Man nahm Blutproben ab. Schickte ihn nach Hause, sprach ein ernstes Wort mit seiner Mutter, die ihn abholen gekommen war. Und dann geschah das Unglaubliche. Mama fuhr mit ihm im Taxi nach Hause!
Sie brachte ihn ins Bett, wo er sofort einschlief. Am nächsten Morgen rief die Schulschwester an und sagte, die Untersuchungen hätten keine physischen Unregelmäßigkeiten ergeben. Der Arzt hatte sie in einem langen Gespräch gründlich informiert. Aber die Schwester sagte auch, sie wolle am nächsten Tag um drei Uhr mit den Eltern sprechen. Der Junge solle ein paar Tage im Bett bleiben.
Mama musste alleine gehen und, wie immer, war sie auf das Schlimmste gefasst. Aber es kam noch schlimmer, als sie es sich vorgestellt hatte. Die Schwester sagte zunächst einmal, dass es gut gewesen sei, dass eine richtige Untersuchung gemacht worden sei und dass man jetzt wisse, dass keine körperlichen Probleme vorlägen. Aber dann wurde sie ernst.
»Aber wir müssen untersuchen, warum er nicht wächst.«
»Ja?«
»Gibt es in der Familie Kleinwüchsige?«
»Nein«, sagte Mama und dachte an ihre Riesen von Brüdern. Und an den Vater und den Onkel des Jungen, die so lang waren wie die zum Aussamen auf den Kahlschlägen zurückgelassenen Kiefern.
»Es könnte ein Mangel an Wachstumshormonen vorliegen. Wir haben das untersucht, sodass wir nächste Woche mehr wissen«, sagte die Schwester.
Aber dann fuhr sie fort:
»Es kommt auch vor, dass unglückliche Kinder im Wachstum stehen bleiben.«
Es wurde so still in dem sonnigen Raum, dass man die Stäubchen zu Boden fallen hörte.
Schließlich sagte Mama:
»Er ist unser einziges Kind, und wir tun alles für ihn.«
»Sie sind also eine glückliche Familie?«
Mama gab darauf keine Antwort. Sie stand auf und ging.
Als sie nach Hause kam, wiederholte sie dem Jungen das Gespräch Wort für Wort. Sie hatte ein Gedächtnis, so umfassend und zuverlässig wie die Festplatte eines Computers. Aber sie gehörte auch zu der Sorte Menschen, die Beleidigungen über Jahre hinweg horten und sie dann hervorholen konnten, wenn die Verbitterung über sie hereinbrach. Dadurch gab jede Kränkung ihr die Kraft, zu Menschen jedweden Schlages Abstand zu halten.
Er solle bis Ende der Woche im Bett bleiben, hatte die Schwester gesagt. Das gab ihm Zeit zum Nachdenken. Langsam sah er ein, dass er an dem schlechten Verhältnis seiner Eltern unschuldig war. Er hatte keine Schuld. Diese Einsicht führte allmählich zu einer neuen Entdeckung: Er war das Opfer. Er war zu bedauern. Die neuen Gedanken bereiteten ihm einen gewissen Genuss. Aber nach einiger Zeit verging auch das.
Er begann in die Höhe zu schießen und beendete die Hauptschule mit ausgezeichneten Noten. Er bekam eine Prämie und ein großes, schönes Buch. Es war das erste eigene Buch seines Lebens. Verner von Heidenstam hatte es geschrieben. Ihm, der nie ein Märchen gehört hatte, gefiel es nicht, und er las es nicht aus.
Als die Sommerferien näher kamen, machte er endlich den Mund auf. Er wollte dieses Jahr nicht mit zum Segeln gehen. Er wollte nicht segeln, weder nach Oslo noch nach Skagen. Aber vor allem wollte er nicht mit seinen Eltern in der engen Kajüte zusammen sein. Das sagte er aber nicht.
Du liebe Zeit, was wollte er denn den ganzen Sommer lang tun?
Papa stellte diese Frage.
»Ich will zu den Großeltern nach Värmland fahren«, sagte er.
Erstauntes Schweigen.
»Ich habe schon alles mit Großvater ausgemacht. Er hat mir eine Bahnfahrkarte nach Karlstad geschickt.«
Auf dem Bauernhof wurde er mit offenen Armen empfangen. Zu dritt setzten sie sich fast feierlich an den schönen Tisch im großen Zimmer, um sein Zeugnis eingehend und lange zu studieren.
Lachten laut vor Entzücken. Bewunderten seine schöne Prämie. »Heidenstam«, sagte Großmutter. »Das ist vom Feinsten. Er verstand sich auf die Kunst, Geschichten zu erzählen.«
Dann backte die Großmutter eine Torte, denn sie wollten ja richtig feiern. Während der Kuchen im Backofen stand, wurde Jan das erste Glas Wein seines Lebens eingeschenkt. Sie stießen auf seinen Erfolg an. Er kämpfte mit den Tränen.
In diesem Sommer durfte er auf dem Hof helfen. Er packte auf dem Kartoffelacker mit an, mähte die hohen Wiesen mit der Sense und erfuhr, wie wichtig es war, dass alle Blumen liegen blieben, damit sie sich durch die gebildeten Samen vermehren konnten. Er war dabei, als das Heu eingefahren wurde, und lernte, das Pferd zu führen. Dann ging er mit der Großmutter in die Wälder. Aber er konnte die kleinen Trolle zwischen den Wurzeln der großen Bäume nicht mehr sehen. Und er futterte wie ein Pferd, meinte der Großvater.
Der lange Sommer verging viel zu schnell. Das Leben ging wieder seinen gewohnten Gang, als er im Gymnasium anfing. Aber jetzt war er nicht mehr der Kleinste in der Klasse.
Hier hörten seine Erinnerungen auf. Jan konnte endlich schlafen.
7.
Sie schliefen am nächsten Morgen lange. Erst als die alte Standuhr in Angelikas Wohnzimmer zehnmal schlug, wachte Jan auf. Er öffnete die Schlafzimmertür einen Spalt. Angelika schlief fest wie ein Kind. Er liebte sie, aber war er vielleicht nahe daran, sie zu verlieren? Bei diesem Gedanken erschauerte er bis ins Mark.
Er brauchte eine Tasse Kaffee, ging in die Küche und schaltete den Kocher ein. Der Kaffeeduft verbreitete sich bis ins Schlafzimmer und weckte Angelika.
»Du bist heute dran mit Kaffee-ans-Bett-bringen!«, rief sie auf dem Weg zur Toilette.
»Kommt sofort! Käsebrot und Marmelade?«
»Ja, bitte.«
Aber der gute Alltagston hielt nicht, als sie auf ihrem Bett saßen. Sie erkannte es sofort, er hatte Angst. Und sie ebenfalls.
Sie sagte: »Ich habe mich gestern dumm benommen, ich war müde. Und verärgert. Habe eine Menge unnötig dummes Zeug von mir gegeben.«
»Nein, was du gesagt hast, war total in Ordnung. Ich habe mir heute Nacht alles nochmal durch den Kopf gehen lassen.«
»Mit welchem Ergebnis?«
»Dass ich ein Kindskopf bin, der seine Gefühle nie hat zeigen dürfen.«
Sie nickte:
»Das ist ein großer Nachteil.«
»Das weiß ich inzwischen auch. Das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass ich mich dauernd wichtig machen muss. Ich habe so oft kein Verständnis für andere Menschen.«
»Und das darfst du nicht zeigen. Und auch nicht drüber sprechen.«
»Ja. Und jetzt habe ich Angst.«
»Wovor?«
»Dich zu verlieren.«
Sie schwiegen lange. Bis Jan mit einem erneuten Versuch ansetzte:
»Willst du dein Brot denn gar nicht essen?«
»Nein, im Moment nicht. The time has come to talk of many things, wie das Walross zu Alice im Wunderland sagt.«
Er wurde rot, schluckte und bekannte:
»Ich liebe dich.«
Es dauerte einige Zeit, bis er sich traute, sie anzusehen, um dann zu entdecken, dass sie vor Freude strahlte. Aber sie antwortete mit einer Alltagsfloskel:
»Ganz meinerseits …«
Da schwappte seine Kaffeetasse über, und er stammelte, dass er das Bett gleich sauber machen werde. Jetzt mussten sie lachen, und die Liebe überkam sie in dem kaffeenassen Bett. Er konnte sich nicht erinnern, je so glücklich gewesen zu sein.
Sie duschten gemeinsam und merkten erst jetzt, dass sie nichts gegessen hatten und dass der gute Kaffee im Bett versickert war.
»Ich habe Hunger«, sagte Angelika, also gingen sie in die Küche und machten sich neue Brote. »Ich hatte es nie darauf abgesehen, mich in dich zu verlieben«, sagte sie kauend. »Aber dann waren es erst mal deine Augen, so durchsichtig hellblau wie ein Aquarell, das man mit verschwenderisch viel Wasser angelegt hat. Ich dachte, du siehst geradewegs durch mich hindurch.«
»Ach du liebe Güte!«, sagte er. »Und ich dachte, du mit deinem in die Ferne schweifenden Blick wüsstest alles von mir.«
Sie lachten. Aber Jan konnte sich die Bemerkung nicht verkneifen:
»Vielleicht hatte ich doch nicht ganz so Unrecht, als ich von Projektionen sprach.«
»Okay, aber das gilt nur fürs Verliebtsein. Nie im Leben für die Liebe.«
»Das habe ich inzwischen begriffen.«
»Erzähl, was dir heute Nacht durch den Kopf gegangen ist.«
»Nein, jetzt nicht, jetzt bist du dran. Ich weiß bis heute nichts von deiner … toten Mutter.«
»Okay«, sagte Angelika. Und begann bei der elenden Geschichte mit dem Streit zwischen Martin und ihrem Vater.
»Du meine Güte«, sagte Jan. »Das ist ja Mord.«
Er war so erregt, dass er stotterte.
»Ich habe meinen Vater seit dem Begräbnis nicht mehr gesehen. Aber eines Tages werde ich stark genug sein, um in sein Dorf zu fahren und ihm Fragen zu stellen.«
Aber Jan fand, dass ihre Worte nicht entschlossen genug klangen.
Sie sprach weiter:
»Jetzt erzähle ich dir, was los war, als ich meiner Großmutter im Irrenhaus zum ersten Mal begegnete.«
Sie erzählte und schloss mit der Frage:
»Weißt du vielleicht, ob Schizophrenie erblich ist?«
Er ließ sich Zeit mit der Antwort:
»In Psychiatrie weiß ich zu wenig Bescheid.«
»Aber du weißt so einiges vom Gehirn.«
»Ich werde es nachschlagen und dir dann sagen, ob es Erbfaktoren gibt.«
Sie hatte das Gefühl, dass er log, sie wusste, dass die Krankheit in manchen Familien immer wieder auftrat.
Er lächelte, als er sagte:
»Glaub mir, es ist für mich ohne Bedeutung. Ich will dich heiraten und Kinder mit dir haben.«
Sie schwieg, sie hatte ihre Stimme nicht in der Gewalt.
»Du hast nie von deiner Mutter erzählt«, sagte er.
»Ich habe es gestern Abend versucht, als ich sagte, dass ich in einer anderen Wirklichkeit aufgewachsen bin. Sie lebte in einer Welt, die von guten und bösen Feen, von Engeln und Teufeln und Schicksalsgöttinnen beherrscht wurde, mit denen man sich gut stellen musste. Sie war eine gute Märchenerzählerin. Aber sie bestand darauf, dass es keine Märchen waren. Vielleicht kam da ja schon ihre schreckliche Krankheit zum Durchbruch, Krebs kann sich ja auch aufs Gehirn auswirken.«
»Ich habe immer geglaubt, Katta und Martin seien deine Eltern.«