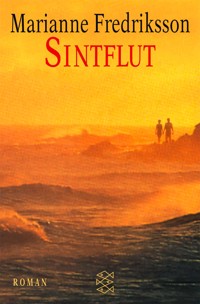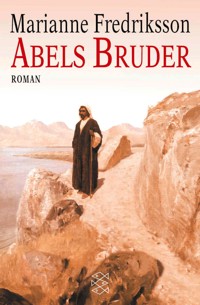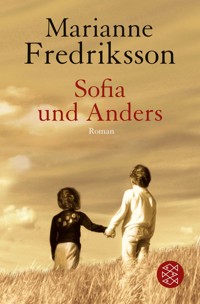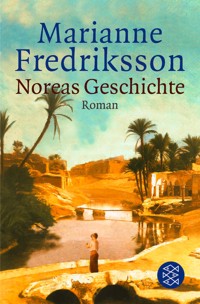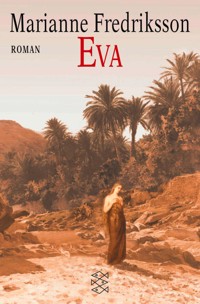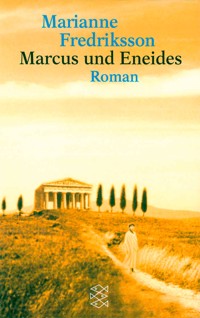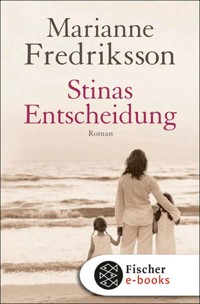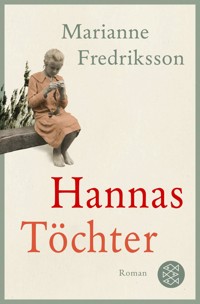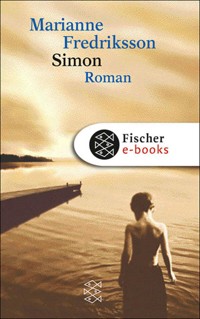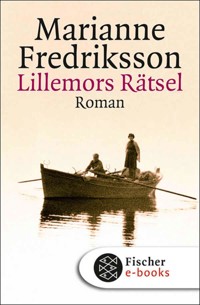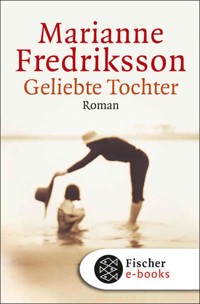
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Katarina ist Architektin, jung, erfolgreich und ungebunden. Die Freiheit, ihr Leben selbst zu bestimmen, ist ihr das Wichtigste. Männer finden sie attraktiv, und sie liebt die Kunst der Verführung. Aber einer festen Bindung weicht sie aus. Zu ihrer Mutter Elisabeth hat sie immer Distanz gewahrt. Nie hat sie verstehen können, warum Elisabeth damals so lange bei ihrem gewalttätigen Mann ausharrte. Katarina ist von ihrem amerikanischen Liebhaber Jack schwanger und will ihr Kind unbedingt zur Welt bringen. Ganz unerwartet reagiert Elisabeth mit großer Freude. Jacks Reaktion dagegen ist ein Schock. Er schlägt sie brutal nieder und kehrt in die USA zurück. Katarina erwacht im Krankenhaus, und plötzlich werden schlimme Kindheitserinnerungen wach. Ist Gewalt vielleicht erblich, nicht nur beim Täter, sondern auch beim Opfer? Katarina spürt, dass sie mit ihrer Mutter sprechen muss. Endlich finden die beiden Frauen einen Weg, einander näher zu kommen. Als der fürsorgliche Kunstmaler Viktor Emanuel Karlsson sich in Katarina verliebt, scheint ihr Leben wieder eine glücklichere Wendung zu nehmen. Da taucht noch einmal der Vater ihres Kindes auf. In ihrem neuen Roman erzählt Marianne Fredriksson eine Geschichte, die Generationen verbindet. Wer bin ich wirklich? Warum bin ich so geworden? Was ist wichtig? Wie finde ich wahre Liebe? Fragen, die jede Frau bewegen. Marianne Fredriksson zeigt den Weg zu den Antworten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Marianne Fredriksson
Geliebte Tochter
Roman
Fischer e-books
Von Herzen danke ich meiner Verlegerin Ann-Marie Skarp für ihr Interesse und ihre Anteilnahme während des langen und einsamen Prozesses, den ein Roman seiner Autorin abverlangt. Ich bedanke mich auch für die sorgfältige Behandlung des Manuskripts und dafür, dass Worte und Handlungsabläufe auf die Goldwaage gelegt wurden.
1.
Sie war nach Norden unterwegs, um ihrer Mutter mitzuteilen, dass sie ein Kind zur Welt bringen werde, aber nicht die Absicht habe, zu heiraten. In der Großstadt war der Spätsommer noch immer mit sattem Grün gegenwärtig, aber schon nördlich von Sala flammte das erste Rot in den Ahornbäumen auf, und als sie sich Bollnäs näherte, schleuderte der Nordwind ganze Hände voll goldener Birkenblätter gegen die Windschutzscheibe.
Sie schaltete die Wagenheizung ein.
Ihre Mutter war ein nüchterner Mensch. Wenn sie hörte, dass der Embryo noch nicht einmal zwölf Wochen in ihr wuchs, würde sie von Abtreibung reden. Und Katarina würde den Vorschlag ohne weitere Erklärung zurückweisen. Sie konnte ja schlecht erzählen, dass sie schon einmal eine Ausschabung hatte vornehmen lassen. Vor drei Jahren. Und dass sie seither die Frage quälte, wer das Kind, das nicht hatte geboren werden dürfen, wohl gewesen sein mochte.
Sie hatte ihrer Mutter von der Abtreibung damals nichts gesagt. Unnötig, sie zu beunruhigen. Unnötig auch, ihrer Mutter Einblick in ihr Leben zu gewähren. Hier in den Dörfern des Ljusnantals hätte man sie als Hure bezeichnet. In Wirklichkeit mochte sie einfach Männer und konnte jedes neue Verliebtsein unglaublich genießen. Und sie gehörte zu den Frauen, die verliebt sein nie mit Liebe verwechselten.
»Nichts mag ich lieber, als im Bett neue Techniken zu lernen«, hatte sie einmal zu einer Freundin gesagt, die in ihrer Rolle als Gattin und Mutter Erfüllung fand. Die Freundin hatte in ihr Lachen nicht eingestimmt, sondern sie für recht bedauernswert gehalten.
Genau wie ich dich bedaure, das hatte Katarina für sich behalten. Und sie hatte dabei an den Mann gedacht, der zu Hause vor dem Fernseher den Babysitter machte, immer wieder auf die Uhr sah und nur auf seine Frau wartete.
Sie hatten sich vor dem Restaurant getrennt. Und die Worte der Freundin waren schmerzlich haften geblieben. Wie ein Stachel.
Ein Verhältnis hatte bei ihr nie lange gehalten, höchstens ein halbes Jahr, länger hielt sie eine Liebelei kaum durch. Ihrer eigenen Erfahrung nach. Nur manchmal, wenn die Trennung allzu sehr schmerzte, hatte sie sich gefragt, ob sie nicht etwa die Flucht ergriff, weil ihr Zärtlichkeitsbedürfnis zu groß geworden war.
Ich fürchte mich vor restloser Hingabe, dachte sie.
Und jetzt will ich ein Kind haben, es lieben, es an meiner Brust nähren, durch Nächte und Tage tragen. Der Gedanke erschreckte sie so sehr, dass sie eine Pause einlegen, aus dem Wagen steigen, tief durchatmen und ihrem Herzen zureden musste, doch etwas langsamer zu schlagen.
Sie stand in der Parknische und blickte über das Flusstal hin. Ohne zu sehen. Die alten Bedenken meldeten sich wieder: Ich werde das nicht schaffen, nicht durchhalten, die Bedürfnisse des Kindes nicht erkennen. Ich werde mich wie verrückt nach dem Zeichentisch im Architekturbüro sehnen.
Ich werde … Die Liste nahm kein Ende, und die Summe ergab: Ich werde das Kind an seinem Lebensnerv schädigen.
Der Wind biss sich durch die Kleider, sie fror und ging zum Wagen zurück. Setzte sich hinein. Sie hatte es nicht mehr besonders weit; wenn sie die Pause ein bisschen hinauszögerte, konnte sie sich auf das bevorstehende Gespräch vorbereiten. Ihre Mutter würde also sagen: Abtreiben. Sie selbst würde sagen: Aber ich will das Kind haben. Ihre Mutter würde einige Zeit verstreichen lassen und es schließlich aussprechen: Mutterschaft liegt dir nicht.
Sie würde das Gesicht in Falten legen wie immer, wenn sie etwas Unangenehmes zu sagen hatte, und ihre Argumente träfen absolut zu. Katarina hatte sich im Kreis kichernder Mädchen nie wohl gefühlt und Babys immer abstoßend gefunden. Genau wie die verdammten Tage, die sie Monat für Monat in Rage brachten.
Und Katarina würde klein beigeben, in die Großstadt zurückkehren und den Embryo absaugen lassen.
Als sie den Blinker drückte, um anzuzeigen, dass sie auf die Fahrbahn hinauswollte, hatte sie Schwierigkeiten, im Rückspiegel etwas zu erkennen. Ihre Augen waren voll Tränen. Als sie aber in die Abzweigung zum Sommerhaus ihrer Mutter einbog, hatte sie sich wieder unter Kontrolle und ein Lächeln bereit.
Sie fuhr auf den Vorplatz und stellte fest, dass er kleiner geworden war. Der Wald wanderte langsam, aber unaufhaltsam auf das Haus zu. Das dornige, undurchdringliche Schlehengestrüpp gewann die Oberhand.
Mein Gott, war es hier öde. Und still. Die Singvögel waren nach Süden gezogen, die heimischen Vögel waren noch nicht auf das Futterhaus angewiesen. Nicht einmal eine Elster schrie.
So einsam.
Noch bevor sie die Handbremse angezogen hatte, war ihre Mutter da. Die beiden Frauen schauten sich eine Weile nur an. Aus reiner Freude. Dann folgte eine lange, feste Umarmung, die Fluten von Wärme hervorrief.
Als sie einander schließlich losließen, sagte Mama: »Ist ja schrecklich, wie blass du bist, Kindchen.« Katarina antwortete wie erwartet, dass sie von der weiten Fahrt müde sei. Und Hunger habe.
Und Mama antwortete wie erwartet: »Ich habe ein sahniges Kartoffelgratin im Ofen. Und frisch gefangene Lachsforellen.«
Eigentlich wollte Katarina jetzt kein warmes Essen, sagte aber mit dem notwendigen Lächeln: »Das wird fein schmecken.«
Sie hätte viel lieber geweint.
»Du frierst, komm, gehen wir ins Haus«, sagte Mama.
Nur nicht von der Norm abweichen, dachte Katarina. Warum werden wir nie wirklich warm miteinander.
Die Antwort war einfach:
Die Gefahr, einander wehzutun, ist zu groß.
»Trag dein Gepäck rauf in die Kammer, ich mache inzwischen das Essen fertig«, sagte Elisabeth.
Katarina nahm den Umweg über die Veranda, blieb dort stehen und beobachtete, wie draußen der breite Strom seine Farbe vom hellsten Blau ins Ultramarin, zu Lila und an den Ufern entlang zu goldenem Grün wechselte. Im Tal hoben sich die roten Häuser wie Schmuckstücke von den blauen Bergen auf der anderen Seite ab. Als Kind war sie überzeugt gewesen, dass die Berge quer übers Wasser miteinander sprachen, Geheimnisse austauschten und sich alter Erzählungen erinnerten. Sie hatte viel darüber nachgedacht, wie das zugehen mochte, hatte ihre Mutter danach gefragt, und die hatte geantwortet, dass die Berge schon seit Jahrtausenden in einer Welt lebten, zu der die Menschen keinen Zugang hatten.
Sie wanderte mit dem Blick zurück, sah die Nachmittagssonne in den kleinen Fensterscheiben der Veranda glitzern und nahm den Zitronenduft wahr, der den Topfpflanzen auf dem Fensterbrett entströmte. Die Doktor-Westerlund-Blume, die für die Lunge gut sein sollte, ließ vor Wassermangel welk die Blätter hängen.
Nach Verlassen der Veranda blieb Katarina auf der Schwelle zum großen Zimmer stehen. Die Flickenteppiche hatten vor Schmutz alle Farbe verloren. Der durchgesessene Lehnstuhl vor dem Kachelofen war auch grau und schäbig, und es fehlte die rote Decke, die Mama für gewöhnlich drüberhängte. Auf dem Tisch standen wie immer Zinnleuchter, doch die Kerzen fehlten. Der gestreifte Tischläufer war faltig, und in der bauchigen Tonvase steckten keine Wiesenblumen.
Alles sah verändert aus und eigenartig traurig.
»Zu Tisch!«
Die Stimme ließ durchblicken, dass Essen eine Gottesgabe war.
Ich halte das nicht aus, dachte Katarina. Aber im Küchenherd brannte Feuer und verbreitete Gemütlichkeit und Wärme, das Essen schmeckte gut, und sie hatte erstaunlich großen Hunger.
Für zwei essen, dachte sie und fand sich albern. Der Embryo war so klein, dass er wohl kaum Bedürfnisse hatte.
Dann hörte sie sich sagen: »Wenn du den ganzen Sommer hier im Wald verbringst, Mama, vereinsamst du viel zu sehr.«
Das Gesicht der Mutter vertiefte sich gleichsam, die Fältchen wurden zu Falten, als sie den Blick nach innen kehrte.
»Die Einsamkeit belastet mich nicht. Aber die Lebenskraft lässt nach.«
Katarina erschrak, fasste sich ans Herz und sagte:
»Mama, du bist hoffentlich nicht krank?«
»Nein, nein, hör zu.«
Sie sprach langsam. Es war ihr wichtig.
»Ich habe von diesem Sommer so viel erwartet. Ich wollte draußen auf dem Vorplatz stehen und die Kraniche nordwärts ziehen sehen. Und ich wollte in hohen Gummistiefeln den Bächen bergauf zu den Quellen folgen, lauschen, den Kuckuck hören, am Wasserfall stehen bleiben und die Lachse springen sehen.«
Sie verstummte, als müsse sie nach Worten suchen.
»Ich wollte jede Frühlingsblume genießen, zuerst die Leberblümchen, dann die Buschwindröschen, Himmelschlüssel, du weißt schon, bis zu den Mittsommerblumen und hinein in den Herbst. Ich habe alles gesehen, immerzu gesehen, aber …«
Sie suchte Katarinas Blick und fuhr dann fort:
»Am schwierigsten war der Tag, an dem die Schwalben zu ihren Nestern unter dem Dach heimkehrten. Du weißt, wie sehr wir uns immer gefreut haben, wie wir auf der Vortreppe standen und den Schwalben ein Begrüßungslied sangen.«
Katarina nickte und versuchte zu lächeln.
»Aber jetzt …«, sagte sie, »nichts. Ich habe wohl mitgekriegt, dass es unter der Dachtraufe schwirrte, und dann habe ich mich mit dem Gefühl in die Küche gesetzt, dass ich gestorben bin.«
Vor dem Fenster fiel die Dämmerung ein, Katarina sagte: »Du bist überarbeitet, Mama.«
»So dachte ich anfangs auch. Aber das stimmt nicht. Es ist das Alter. Langsam und unaufhörlich schleicht es sich an. Zum Schluss versagen die Sinne, Augen, Nase und Ohren, der Kontakt zum Herzen oder der Seele oder was für Worte einem eben dazu einfallen, schwindet.«
Katarinas Blicke wanderten hinaus in das blaue Dunkel, kamen aber nicht weiter als bis zum nachtschwarzen Waldrand. Schließlich nahm sie den Blick zurück, sah ihre Mutter an und sagte zögernd:
»Das habe ich auch schon empfunden. Dass nur wenig von meinem Enthusiasmus und meiner Lust übrig geblieben ist. Die vielen Wiederholungen scheinen das Leben abzunutzen. Man lebt einförmig dahin.«
»Aber du bist noch jung, Katarina!«
»Ich habe ein wildes Leben hinter mir, Mama. Manchmal habe ich das Gefühl, mir bleibt nicht mehr viel zu erleben übrig.«
Im nächsten Moment legte sie sich die Hand auf den Bauch, als hätte sie das neue Leben gespürt. Vielleicht war das der Grund …
Die Begegnung hatte sie beide angestrengt.
Elisabeth ging eine Weile ins Freie, Katarina wusch sich auf dem Spülstein in einer Schüssel und nahm endlich ihre Tasche, um die Treppe hinauf in die Bodenkammer zu gehen.
Sie trafen sich auf dem Vorplatz wieder, als sie barfuß im Gras standen und sich die Zähne putzten.
»Gute Nacht, Mama.«
»Gute Nacht, Katarina.«
2.
Elisabeth konnte nicht einschlafen. Der Rücken tat ihr weh, und sie konnte keine bequeme Ruhestellung finden.
Schon als Katarina anrief, hatte sie gewusst, dass die Tochter ihr etwas sagen wollte, etwas Wichtiges.
Heute war nicht ein Wort gefallen.
Vermutlich wollte sie den Amerikaner heiraten. Und mit ihm in die USA ziehen. Er war ein interessanter Mensch. Schneller Denker, humorvoll. Für Elisabeths Geschmack etwas zu viel Charme. Aber dieser Eindruck war wohl entstanden, als sie spürte, wie die Luft zwischen Katarina und diesem Mann vibrierte.
Ihr Gedanke: Könnte es diesmal Ernst sein?
Katarina würde vermutlich gesetzte Worte wählen, würde sagen, es gibt täglich einen Flug in die USA. Den Winter verbringst du natürlich bei uns. Kalifornien, stell dir das vor, Mama. Keine tiefschwarzen Nächte, keine langen Unterhosen.
Und Elisabeth würde zu lachen versuchen. Und es würde ihr gelingen.
Sie musste …
Aber …
Elisabeth hatte nur wenige glückliche Ehen beobachten können. Es mochte sie geben, vielleicht fehlte ihr nur der entsprechende Einblick. Ihre eigene Ehe war die Hölle gewesen. Abgründe von Angst, als die Liebe am Ende war, ständige Kränkungen, Alkohol, Misshandlungen, wenn es ganz schlimm kam. Und dazu zwei Kinder, die viel zu ertragen hatten.
Zum Schluss das Übliche: die andere Frau. Eine, die jünger und zur Hausfrau und Mutter erzogen war. Sie bekamen noch einmal Kinder, zwei Jungen. Und er war, wenn man den Gerüchten Glauben schenken durfte, glücklich.
Plötzlich fiel ihr ein, dass er an einem Herzinfarkt gestorben war.
Sie bekam Schmerzen zwischen den Schulterblättern und legte sich auf den Rücken. Das verschaffte ihr Erleichterung, aber in dieser Stellung konnte sie nicht einschlafen. Hellwach lag sie im Bett.
Die Probleme hatten angefangen, als sie sich weigerte, ihren Beruf aufzugeben. Natürlich war sie in ihren Mann verliebt gewesen. Aber die Jahre auf der Akademie und die interessante Arbeit an ihrer ersten Schule hatten sie geprägt …
Hinzu kam ihr Selbstwertgefühl. Es wehrte sich gegen die Rolle der Mutter, gegen die Familie, den Traum des Mannes von der tüchtigen Hausfrau und dem leckeren Essen, das pünktlich auf dem Tisch bereitstand.
Sie bekam Kinder und wurde eine »unnatürliche« Mutter, wie ihre Mutter und die Brüder es nannten. Und auch die Verwandten und ihre ganze Umgebung waren dieser Meinung.
Am wenigsten ertrug es der Mann, der doch selbst wirklich Manns genug war, seine Familie zu versorgen.
Also kam es, wie es kommen musste, sagte sie sich, drehte sich auf die Seite und dachte noch, dass Katarina Architektin war und dass man sie in Kalifornien wahrscheinlich gut brauchen konnte.
In diesem Gedanken lag ein wenig Trost, und endlich schlief sie ein.
Katarina hatte den Kopf kaum aufs Kissen gelegt, da war sie schon eingeschlafen. Aber sie wachte morgens zeitig auf, und ihre Gedanken eilten zu Jack, seinem schiefen Lächeln zwischen Freude und Ironie. Kein Sommer kam diesem vergangenen gleich, vom Wind geblähte Segel, Meere von Ewigkeit, Sonne, Felsen und das kleine Haus auf der Schäreninsel, das ihm ein Kollege zur Verfügung gestellt hatte.
Mein Gott, wie sehnte sie sich nach ihm.
Und dann der Gedanke, der wehtat: Ich habe ihn hintergangen.
»Nicht bewusst«, sagte sie laut.
Sie hatte ihre Pillen damals wirklich in der Stadt vergessen. Sie hatte ihre Frauenärztin noch anrufen, sie bitten wollen, ein Rezept nach Norrtälje in die Apotheke zu schicken. Aber sie hatte auch das vergessen.
Falls sie abtreiben ließ, würde Jack es nie erfahren.
In der Morgendämmerung trafen Elisabeth und Katarina sich im Waschhaus und lachten, als sie nackt, jede vor einer großen Wanne voll Wasser, standen. Es war kalt, Katarina fror, als sie sich in das Badetuch wickelte und Elisabeth ihr Rücken und Oberarme trocken rieb. Hier hing, blind und schadhaft von Nässe und Kälte, der einzige große Spiegel des Anwesens. Und plötzlich standen sie beide davor und kicherten bei dem Anblick ihrer selbst.
»Ist ja verrückt, wie ähnlich wir einander sind«, sagte Katarina.
»Na ja, aber du bist viel schöner als ich«, sagte Elisabeth.
»Das bist du immer gewesen.«
»Krieg dich wieder ein, Mama. Sieh nur die langen Nasen, das kräftige Kinn und die großen Münder. Genau gleich, Mama. Sogar die Haare, diese dicke blonde Mähne.«
»Ich färbe meine.«
»Tu ich auch.«
Dann lachten sie. Und Elisabeth spürte, dass das Glück sie für einen Augenblick gestreift hatte.
»Jetzt kochen wir Kaffee.«
Sie rannten durch den Wind, die Luft war wie Glas.
Elisabeth hatte schon Feuer im Herd gemacht, die Küche war warm, und bald verbreitete der Kaffee seinen Duft über dem Küchentisch, auf dem Brot, Butter, Käse und Marmelade bereitstanden.
»Du wirkst irgendwie zornig«, sagte Katarina.
»Du hast Zorn und Entschlossenheit bei mir noch nie auseinanderhalten können.«
»Du bist also entschlossen?«
»Ja. Du willst mir etwas sagen. Und ich will es hören.«
»Okay, Mama.« Und dann sprach sie aus, was sie sich vorgenommen hatte: »Ich bekomme ein Kind, aber ich werde nicht heiraten.«
Das Holz knisterte. Mehr war in der Küche nicht zu hören, und Katarina hätte am liebsten geschrien, verdammt nochmal, nimm dich zusammen und sag irgendetwas. Dann sah sie, dass ihre Mutter weinte, dass ihr die hellen Tränen über die gefurchten Wangen liefen, sich wie die Bäche im Frühling ihren Weg bahnten.
»Weinst du?«
Elisabeth musste ein paar Mal schlucken, um wieder zu Stimme zu kommen:
»Freudentränen«, sagte sie.
Und das war alles, was an diesem Vormittag gesprochen wurde.
Sie gingen hinaus, schweigend und in Eintracht, folgten dem Pfad in den Hochwald. Kamen zurück, den Korb voll Parasolpilze, die sie brieten, und sie waren sich einig, dass es keine wohlschmeckenderen Pilze gab. Ein paar Frikadellen hatte Elisabeth noch aufgetaut, aber die waren eigentlich überflüssig gewesen.
Dann ging jede zu einem Mittagsschläfchen in ihr Zimmer. Sie wussten, dass es abends spät werden würde.
Katarina schlief wie ein Baby. Tief, über alle Zweifel und Ängste erhaben. Der Entschluss war gefasst.
Mit der Dämmerung kam der Sturm. Von Nord. Er rüttelte an den Küchenfenstern, also gingen die beiden Frauen in die große Stube und machten im Kachelofen Feuer.
»Ich habe mit Jack, wie schon vorher mit anderen Männern, ein Abkommen getroffen. Ich habe ihm gesagt, dass ich frei sein und nur die gemeinsame Zeit genießen wolle, die uns geschenkt war.«
Während sie das jetzt sagte, sah sie sein Gesicht vor sich, sein Erstaunen und sein erleichtertes Lächeln, dieses schiefe Lächeln, in das sie sich verliebt hatte. Manchmal konnte es zu einem schallenden Lachen anwachsen.
»Du bist wunderbar«, hatte er gesagt und gleich darauf: »Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder.«
Es hatte geschmerzt, aber sie hatte Worte gefunden:
»Das ist okay. Keiner leidet Schaden, wenn wir einen fröhlichen Sommer miteinander verbringen.«
Und der hatte es werden sollen, dachte sie.
Dann sagte sie zu ihrer Mutter:
»Es war nur so, dass ich die Antibabypillen vergessen hatte, als wir im Hafen von Vaxholm ausliefen.«
»Vergessen«, sagte Elisabeth.
Katarina konnte die Anführungszeichen hören, lauschte ihnen nach und akzeptierte sie.
»Um auf das Wesentliche zurückzukommen – er wird denken, ich habe ihn hereingelegt«, sagte sie.
»Weiß er von … seinem Glück?«
»Nein.«
Nun hielt das Schweigen lange an, Elisabeth legte dicke Holzscheite im Kachelofen nach.
»Normalerweise wäre das kein Problem gewesen, Mama. Ich hätte mir das Kind nehmen lassen. Aber jetzt will etwas in mir dieses Kind haben. Etwas, das so stark ist, dass ich mich nicht widersetzen kann.«
»Was tust du, wenn er sich von seiner Frau scheiden lässt?«
»Dann sage ich nein. Ich will nicht heiraten. Und schon gar nicht einen Mann, der meinetwegen seine Karriere und zwei kleine Kinder opfert. Nein, Mama.«
»Du liebst ihn?«
»Ja. Das macht alles schwieriger.«
In der Stille hörten sie eine Eule schreien, sie zuckten zusammen und lächelten einander an.
»Hier ist also doch nicht alles ausgestorben«, sagte Katarina.
»O nein. Wenn du in der Morgendämmerung aufstehst, kannst du die Elche über den Vorplatz schreiten sehen.«
»Mama, und ich habe geglaubt, du würdest mir zur Abtreibung raten.«
Elisabeths Augen verhärteten sich und flammende Röte überzog ihr Gesicht.
»Ich habe selbst abgetrieben«, sagte sie schließlich. »Es ist das Schändlichste, was ich je getan habe, und ich habe mir nie verziehen.«
Katarina schwieg vor Erstaunen. Elisabeth fuhr fort:
»Es war nach der Scheidung, zu der Zeit, als wir zwei in Göteborg in Untermiete wohnten. Ich habe damals einige Liebesaffären gehabt.«
Sie sah Katarinas Verwunderung und lachte:
»Das hast du nicht geahnt. Aber ich habe es genossen. Erst da durfte ich erleben, was Sex wirklich sein kann. Es war eine wunderbare Zeit voller Heimlichkeiten.«
Katarina fühlte sich merkwürdig gekränkt. Fast beschämt. Ich bin ja verrückt, dachte sie und sagte dann:
»Was war denn an diesem Eingriff so schrecklich?«
»Alles. Die Verachtung des Personals, der grobe Arzt, die Skalpelle, Spiegel, das grelle Licht bis hinein in die intimsten Bereiche. Manchmal glaube ich, dass dies der wahre Sitz der Seele ist. Bei uns Frauen.«
Es dauerte eine Weile, bis sie weiterzusprechen vermochte:
»Der Schmerz, du lieber Gott, es war einfach schrecklich. Keine Narkose, Unmengen von Blut …«
Die Erinnerungen ließen Elisabeths Gesicht immer mehr schrumpfen, sie sah alt aus. Zwang sich aber zum Weitersprechen:
»Dann jahrelang die Frage, wer sie war, dieses Mädchen, das dir so ähnlich gewesen wäre.«
»Wieso weißt du, dass es ein Mädchen war?«
»Der Arzt hat's gesagt. Weißt du, ich hatte zu lange gewartet. Das war wohl auch der Grund, warum es so … blutig zuging.«
Plötzlich stand Elisabeth auf, schüttelte sich wie ein nasser Hund und sagte:
»Jetzt holen wir die Kognakflasche.«
Und der Augenblick war vorüber, Mama würde von Katarinas eigener Abtreibung nie erfahren.
Sie hoben die Gläser und tranken einander zu. Elisabeth trank ex, Katarina dachte an das keimende Leben und nippte nur.
»Wie, zum Henker, konntest du dir einbilden, ich würde dir zur Abtreibung raten? Du bist ein selbständiger Mensch und hast einen guten Job. Und wohnst in einem Land, in dem alleinstehende Mütter nichts Ungewöhnliches sind und respektiert werden.«
Katarina suchte nach Worten:
»Mama, darum ging es gar nicht. Es ging um mich. Ich habe nie mit Puppen gespielt, und ich habe Babys unausstehlich gefunden. Ich kann wahrscheinlich keine Muttergefühle entwickeln, und ich verstehe mich überhaupt nicht auf liebevolle Zuneigung. Das Einzige, worin ich bei einer Beziehung gut bin, ist Sex.«
Die Tränen stiegen in ihr hoch, aber sie zwang sich, weiterzusprechen:
»Ich fürchte, ich werde dem Kind schaden, begreif doch!«
»Dieses Empfinden haben alle Mütter beim ersten Mal.«
»Du meinst, man lernt das?«
»Das Kind wird es dir beibringen. Im Übrigen sind die Gefühle recht ähnlich.«
»Ähnlich, inwiefern?«
»Ein Baby ist schrecklich sinnlich, Katarina. Was es braucht, ist Körperlichkeit, ist ununterbrochene Körpernähe. Und du weißt selbst, dass der Körper nur sehr schwer lügen kann.«
Katarina schmiedete ihren Blick in dem der Mutter fest.
Mitten in der bleiernen Stille begann Elisabeth zu lachen und sagte dann:
»Ich habe wohl zu erwähnen vergessen, dass dieses Kind in deinem Bauch viel anspruchsvoller sein wird als jeder Mann.«
Jetzt verzog auch Katarina ihren Mund zu einem Lächeln.
»Für Worte des Trostes hast du nie Talent gehabt.«
»Nein, Trostworte sind wie Schlagsahne, sie sind etwas zum Drüberschmieren.«
»Ich kann mich erinnern, dass du das früher schon mal gesagt hast.«
»Dir hat Trost sicher gefehlt, als du klein warst.«
»Na ja, es hat seine Zeit gedauert, bis ich gelernt hatte, dass Ehrlichkeit besser ist, selbst wenn sie bitter schmeckt und schwer verdaulich ist.«
Aber Elisabeth schüttelte den Kopf:
»Die Sache mit der Ehrlichkeit ist ein schwieriges Kapitel, Katarina. Wir wissen nur sehr wenig darüber, was sie wirklich ist. Die meisten Menschen, die Trost spenden, versuchen sich über ihre eigene Angst hinwegzutrösten.«
Sie schwieg jetzt lange, als wären ihr die Worte ausgegangen.
»Ich will damit sagen, dass Menschen, die auf Trost verzichten, Respekt vor dem Schmerz des anderen beweisen.«
»Das ist Wortklauberei, Mama. Und jetzt lass uns zur primärsten Art des Trostes kommen, nämlich dem Essen«, sagte Katarina.
Elisabeth lachte:
»Also auf in die Küche, machen wir uns ein paar Brote. Knäckebrot mit Käse.«
Das taten sie auch, der Nordwind rüttelte an den Küchenfenstern, und plötzlich hatten sie einander nichts mehr zu sagen.
»Die praktischen Fragen heben wir uns für morgen auf«, meinte Elisabeth schließlich. »Du weißt, du kannst auf mich zählen.«
»Das weiß ich jetzt, und ich habe einen Plan.«
»Ich habe an der Hochschule nur noch ein Semester hinter mich zu bringen. Verdammtes Glück, dass ich pensionsreif bin.«
3.
Katarina hatte einen klaren Kopf, war voller Energie und Vertrauen. Aber sie konnte nicht schlafen, wollte es vielleicht gar nicht.
Wie würde Jack reagieren …
Sie musste alles noch einmal in Ruhe durchdenken, dieses schwierige Gespräch musste …
Aber die Gedanken ließen sich nicht lenken. Sie schweiften zu Erinnerungen an Jacks Begegnung mit Mama ab. Bilder tauchten auf, klar und deutlich, als hätte sie dieses Wochenende in Gävle damals gefilmt.
Es hatte in Stockhohn in ihrer Wohnung auf Södermalm begonnen, als Jack sagte, er sei neugierig auf ihre Mutter. »Du sprichst so viel von ihr. Wie ist sie eigentlich?«
»Okay, ich rufe Mama an und frage, ob wir sie zum Wochenende besuchen dürfen.«
Es wurde ein langes Telefongespräch voll verständnisinnigen Lachens. Bis Katarina rein zufällig zu Jack hinüberblickte und sah, dass er sich ärgerte. Sie wechselte also ins Englische und sagte, dass sie einen amerikanischen Freund mitbringe.
»So you have to brush up your English, Mummy.«
Wieder lachte sie und sagte abschließend die Worte, die er schon gelernt hatte: »Hej då.«
»Was war denn so lustig?«
»Dass meine Mutter Lehrerin ist. Für Englisch. The Queen's English, verstehst du.«
Frühlinghafte Verzückung lag in der Luft, als sie Jack weckte, die Sonne schien, die unbelaubten Zweige der Bäume und im Hof unter ihrem Fenster waren mit Blüten übersät.
»Auf, auf mein Freund, das Leben ist pure Freude.«
»Hier riecht's nach Honig«, sagte er schläfrig.
»Ja, die Ahornbäume blühen.«
Eine Stunde später waren sie unterwegs.
»Sieh nur die Buschwindröschen, der ganze Waldboden ist ein Blütenteppich. Wir müssen stehen bleiben und einen Strauß für Mama pflücken. Bei ihr ist noch nicht einmal die Leberblümchenzeit angebrochen.«
Jack stöhnte, ging aber brav mit, und bald hatten sie einen dicken Strauß gepflückt, den Katarina in ihre im Bach angefeuchtete Tageszeitung wickelte.
»Wunderbar«, sagte sie.
»Sehr exotisch«, sagte er.
Kurz darauf fragte er:
»Seht ihr euch ähnlich, du und deine Mutter?«
»Ja. Wir haben das gleiche Kinn, die gleiche hohe Stirn, den gleichen entschlossenen Gesichtsausdruck und das dichte blonde Haar. Und wir sind gleich groß.«
Nach einer Weile fügte sie hinzu:
»Aber unsere Augen sind verschieden. Ihre sind hellblau, fast durchsichtig. Wie stark verdünnte Wasserfarben. Als ich klein war, dachte ich, sie kann durch die Leute hindurchsehen, deren Gedanken lesen und ihre Gefühle spüren.«
»Das klingt unbehaglich.«
»War es eine Zeit lang auch. Bis ich begriff, dass sie nach innen schaute, wenn sie diesen fernen Blick hatte.«
»Wie nach innen?«
»Ins eigene Innere.«
»Was meinst du, wird sie … mich mögen?«
»Mögen ist nicht der richtige Ausdruck. Sie nimmt die Menschen, wie sie sind, respektiert sie.«
»Das klingt auch unbehaglich«, sagte er.
»Jack, hör mal zu. Es ist schwierig, die eigene Mutter zu schildern. Aber um dir ein Bild von ihr zu vermitteln, erzähle ich dir, was sie sagte, als ich zum ersten Mal verliebt war. Du kennst das, der tollste Junge der Klasse lud mich ins Kino ein. Ich habe mir eingebildet, dass ich verliebt bin, aber ich war nur geschmeichelt. Und natürlich scharf auf ihn.
Zu jener Zeit bedeutete Kino lange Küsse im Dunkeln und viel Gefummel unter der Wäsche. Während irgendein Cowboy mit gezogener Pistole durch die Prärie ritt. Es war ein phantastisches Doppelerlebnis. Der eigene Körper stand in Flammen, und im Wilden Westen wurde wie verrückt geballert.«
Jack musste lachen. Er kannte das.
»Wir waren so erregt, dass wir zu Hause auf dem Wohnzimmersofa weitermachten. Mama war bei irgendeiner Vorlesung, ich hatte jedes Zeitgefühl verloren, und plötzlich stand sie in der Tür. Als sie sah, was los war, ging sie in die Küche, machte die Tür hinter sich zu und kochte Tee.«
Katarina hielt inne und kicherte rückblickend. »Der Junge sah aus, als würde ihn gleich der Schlag treffen, er raffte seine Klamotten zusammen und rannte die Treppe runter. Meine Beine zitterten, als ich mich neben Mama auf den Küchenstuhl setzte. Sie aber lächelte und meinte, sie habe volles Verständnis. In diesem Alter sei das alles ganz natürlich. Der Körper müsse überschäumen.
Dann sagte sie, wenn ich mich zu gegebener Zeit reif genug fühlte für eine sexuelle Beziehung, solle ich es ihr sagen. Sie würde mir dann die Pille besorgen.«
Katarina war mit ihrem Bericht zufrieden. Aber Jack war schockiert und knallrot im Gesicht.
Den Rest der Fahrt schwiegen sie, und dann standen sie in der Diele der alten Wohnung, und Elisabeth gab Jack die Hand und sagte:
»Sie sind mir ja ein richtiger Cowboy. Nice to meet you.«
Das war keine gute Eröffnung, und sein Lächeln war schiefer denn je. Sie hatte eine fertig gekaufte Pizza im Ofen und legte keine Decke auf den Küchentisch. Es gab etwas Salat dazu und zwei Flaschen Bier.
Katarina sah, was er dachte: Die hat sich keine Arbeit gemacht.
Sie sprachen vom Frühling, Katarina ging die Blumen holen, und beide Frauen strahlten, als sie die Buschwindröschen an der Spüle mit Sorgfalt Blume für Blume in eine Vase steckten. Es war wie ein Ritual.
Bei Tisch sagte Elisabeth:
»Das mit dem Cowboy hat Ihnen nicht gefallen?«
»Nein. Das ist das schwedische Klischee vom Amerikaner.«
»Für mich gilt das nicht, es ist kein Klischee. Für mich ist der Cowboy ein Archetyp. Der Held, stark und schön, mutig und reinen Herzens, glaubwürdig und unkompliziert. Wie der Jüngling in der Legende, der auszog, um den Drachen zu besiegen. In einer Welt, in der Wahrheit noch bedenkenlos einfach war.«
Katarina hörte Jack vor Begeisterung pfeifen.
Der Nachmittag ist gerettet, dachte sie, schob die beiden ins Wohnzimmer ab, erledigte den Abwasch und kochte Kaffee. Dabei hörte sie mit halbem Ohr Jacks Theorien um den alten Mutterkult zu. Sie kannte seinen Vortrag über die Ausgrabungen in El Al, wo man in den Ablagerungen nach der Sintflut die ältesten weiblichen Figuren gefunden hatte.
»Sie waren schlank und elegant und rot und schwarz bemalt«, sagte er und sprach dann über die unterschiedlichen Deutungen der Historiker zur Frage der Macht der Großen Göttin über die Seelen in jener entschwundenen Zeit.
Als Katarina mit den Kaffeetassen, den Plätzchen und der vollen Kanne hereinkam, hörte sie Jack sagen: »Ihre Deutung ist rein feministisch, wahrscheinlich können die Frauen heute nicht anders. So einfach war das aber nicht. Es war ein Fruchtbarkeitsritual, dem Wunder des Gebärens geweiht.«
Elisabeth nickte:
»Für alle Menschen gibt es nur eine einzige Pforte ins Leben …« Sie dachte nach, und das gesuchte Zitat fiel ihr ein: »Im Schoß der Mutter wurde ich zu Fleisch geformt, zu dem das Blut in zehn Monaten gerann durch den Samen des Mannes und die Lust, die im Beischlaf hinzukam. Es sind Worte aus dem Buch der Weisheit im Alten Testament.«
»Das muss ich mir aufschreiben«, sagte Jack.
Als er mit seinem Notizbuch zurückkam, sagte Elisabeth ganz obenhin:
»Eigenartig, dass die Große Mutter heute durch einen wissenschaftlich untermauerten Mythos eine Renaissance erlebt. Ich meine die ›gute Mutter‹ in ihrer enormen Bedeutung für die Kinder. Und dieser Mythos wird dazu verwendet, die Frauen fester an das Heim zu binden.«
Während sie ihren Kaffee tranken, spiegelten sich in Jacks Gesicht widerstreitende Gefühle.
Dann sagte er in seiner direkten Art:
»Sie sind ja eine Pfarrerstochter, also darf ich annehmen, dass Sie eine Menge über Gott wissen.«
»Da irren Sie sich. Ich weiß so einiges aus der Bibel, aber nichts über Gott. Der einzige Gott, für den ich Sympathie hege, ist der alttestamentarische Jahve.«
»Der Stammesgott der Juden …?«
»Ja, der, der hasst und straft, eifersüchtig und machtbesessen ist, der verurteilt und vernichtet. Der Gott Hiobs, der ebenso böse ist wie der Mensch. Aber weniger absichtlich böse.«
Jack wäre die Kaffeetasse fast aus der Hand gefallen, und ausnahmsweise versagten ihm auch die Worte den Dienst. Aber er fasste sich schnell:
»Wenn Sie recht haben, waren die Menschen der Antike mit ihren vielen Göttern besser dran.«
Elisabeth lachte, als sie sagte: »Das können weder Sie noch ich wissen. Aber Vielgötterei bietet vielleicht mehr Möglichkeiten für Projektionen. Der einzige Gott ist ja doch voller Widersprüche.«
Als sie Gävle am nächsten Morgen verließen, waren Jack und Elisabeth Freunde geworden. Beim Frühstück hatte er gesagt:
»In Amerika herrscht der Mythos von der ›guten Mutter‹ recht unangefochten. Zumindest in der immer größer werdenden Mittelschicht. Das bedeutet, dass fast alle Mütter mit einem schlechten Gewissen leben.«
Elisabeth nickte zustimmend, das sei in Schweden nicht anders.
»Aber du scheinst davon unbelastet zu sein?«
»O nein, ich habe vieles nicht getan, und es gibt vieles, was ich nicht hätte tun sollen.«
Er sah einen Schatten über ihr Gesicht huschen und bereute seine Worte. Sie fuhr fort:
»Ich versuche zu glauben, dass Schuldgefühle einfach zum Leben gehören. Man muss sie handhaben lernen, so gut man kann. Manchmal denke ich, es sind trotz allem die Schuldgefühle, die die Moral aufrechterhalten.«
Katarina hörte ihn tief Luft holen.
Plötzlich lächelte Elisabeth:
»Ich habe kürzlich einen Artikel über eine Untersuchung gelesen, natürlich aus Amerika. Es wurde festgestellt, dass die erwachsenen Kinder der wirklich guten Mütter oft die schwersten Schuldgefühle mit sich herumtragen. Die Kinder, die mit Schuldbelastungen am besten zurechtkommen, haben oft gar keine so netten Mütter gehabt. Good enough, wie Winnicott das ausgedrückt hat. Es hat mich getröstet.«
Sie lachte, aber Jack, der nie etwas von Winnicot gehört hatte, war ernst geblieben, als sie sich voneinander verabschiedeten.
4.
Am nächsten Morgen fegte der Wind noch immer kalt ums Haus. Sie schliefen lange, aber Katarina war in der Dämmerung kurz wach gewesen und hatte die Elche, diese urzeitlichen Tiere, feierlich über den Vorplatz schreiten sehen.
Als sie ihre Mutter im Herd Feuer machen hörte, nahm sie eine Grundrisszeichnung und einen Stapel Fotos mit nach unten.
»Sieh mal hier, das ist ein Reihenhaus in einem hübschen Vorort im Norden von Stockholm. Die Bude gehört einem Kollegen von mir, der meine Wohnung in Södermalm schon lange haben will. Jetzt sind wir wegen eines möglichen Tausches im Gespräch.«
»Es ist ein großes Haus«, sagte Elisabeth. »Kannst du dir das leisten?«
»Du ahnst ja nicht, was ein Wohnungseigentum auf Söder wert ist. Wesentlich mehr als das Haus. Mir bliebe genügend Geld übrig, um es ein bisschen zu restaurieren, frisch zu streichen und so.«
»Du lieber Gott.«
»Das Beste an dem Haus ist, dass die obere Etage ausgebaut ist. Küche, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein kleines Bad. Du hättest eine eigene Wohnung, Mama.«
»Du lieber Gott«, sagte Elisabeth noch einmal.
»Lass den lieben Gott aus dem Spiel«, lachte Katarina. »Sprich lieber mit mir.«
Aber Elisabeth schaltete erst einmal die Kaffeemaschine ein und nahm Brot und Butter aus dem Schrank.
»Ein Garten ist auch dabei …«, sagte sie schließlich versonnen.
»Mama …! Können wir nicht ernsthaft reden!«
»Man sagt, dass es nicht gut ist, wenn erwachsene Kinder mit ihren Eltern zusammenwohnen.«
»Du hast dich doch noch nie drum gekümmert, was man sagt …«
»Aber das kann Schwierigkeiten geben, Katarina.«
»Das ist mir klar. Weil wir einander zu nahe stehen.«
»Ich weiß nicht.«
»Wie meinst du das?«
»Wenn man glaubt, sich in allen Wechselfällen des Lebens auf einen anderen Menschen verlassen zu können, braucht man nicht zu zaudern. Wie du das tust«, sagte Elisabeth.
Katarina fühlte, wie der Zorn in ihr hoch kam. Sie erhob sich in voller Länge und sagte:
»Und du tust das nicht? So wie du nie Ansprüche stellst oder Ratschläge erteilst? Deine Meinung nie gerade heraus sagst. Obwohl jeder weiß, dass du verdammt viel Meinung hast.«
Elisabeth wandte den Blick nach innen. Es war der Blick, der Katarina als Kind Angst eingejagt hatte. Jetzt versuchte sie, sich zu beherrschen, aber es gelang nicht. Und ihre Stimme loderte, als sie fortfuhr:
»Du bezeichnest deine Art, dich nicht einzumischen und eher Abstand zu halten, als Respekt. Was glaubst du denn, was für ein Gefühl das war, als du gestern Abend von deinen Liebesabenteuern und deiner Abtreibung erzählt hast?«
Elisabeth war so blass, wie Katarina rot war. Aber ihre Vernunft siegte, und sie sagte mit kühler Stimme:
»Wir erben unsere Lebensmuster. Die unerträglichsten wandeln wir in Antimuster ab. Um überleben zu können. Ich hatte eine Mutter, die immer alles von mir wissen musste.«
»Ich weiß, ich habe Großmutter gekannt, eine Frau, die ihre Kinder aussaugte. Dich und deine Brüder. Außer Olof.«
»Da irrst du dich«, jetzt weinte Elisabeth.
Es war schrecklich, und Katarina hatte Gewissensbisse als sie die Küche durchquerte, um ihrer Mutter den Arm um die Schultern zu legen.
Elisabeth schnäuzte sich in Papier von der Küchenrolle.
Und Katarina setzte sich wieder. Sie schwiegen.
Schließlich sagte Elisabeth: »Wir versuchen's mal. Ich miete deine obere Etage für ein Jahr. Und ich ziehe zu Weihnachten ein, damit ich in der schwierigsten Zeit bei dir bin. Dann sehen wir weiter.«
»Du behältst deine Wohnung in Gävle?«
»Ja, ich suche mir einen Untermieter.«
Elisabeth hatte viele Freunde und war in vielen Vereinen und Vereinigungen aktives Mitglied. Sie hielt Vorträge über ihre Forschungstätigkeit, sie galt in dieser Stadt etwas! Sie hatte eine Menge zu verlieren. Staunend erkannte Katarina, dass ihre Mutter ein eigenes Leben hatte.