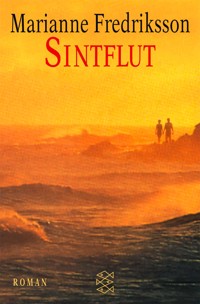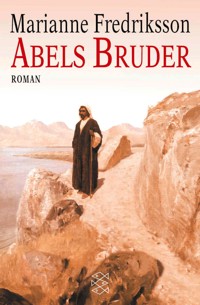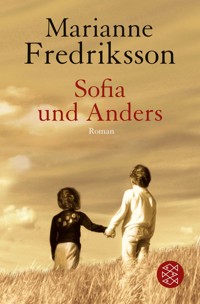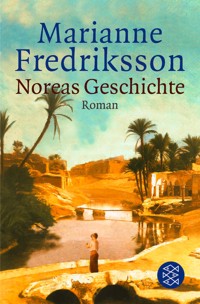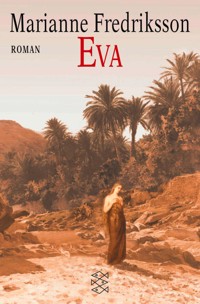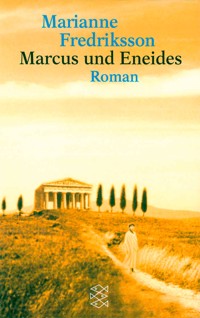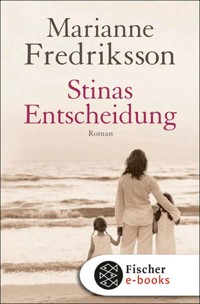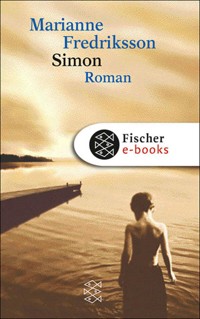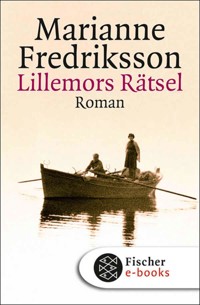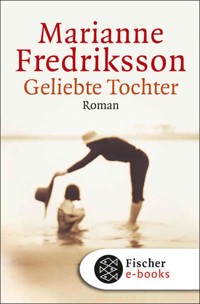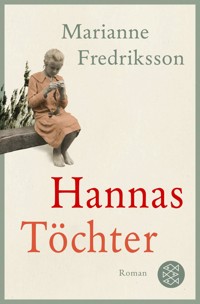
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Hannas Töchter« – drei Generationen in hundert Jahren schwedischer Geschichte Als Anna ihre fast 90-jährige Mutter Johanna besucht, ist diese nicht mehr ansprechbar. Dabei hat Anna noch so viele Fragen über das Leben ihrer Mutter Johanna und ihrer Großmutter Hanna. Wie ist es gewesen vor fast hundert Jahren auf dem Land, als Hanna mit ihrem unehelichen Sohn Ragnar den Müller Broman heiratete? Wie hat sich ihre Mutter gefühlt, als der Vater starb, und warum hat sie niemals rebelliert gegen ihr tristes Hausfrauendasein? Anna begibt sich allein auf die Reise, das Leben ihrer Vorfahren zu entdecken – und findet dabei zu sich selbst. Ein spannendes Buch über die Liebe, in dem Marianne Fredriksson die Lebenslinien dreier Frauen durch hundert Jahre schwedische Geschichte nachzeichnet. "Eine der großen schwedischen Erzählerinnen der Gegenwart." Der Spiegel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Marianne Fredriksson
Hannas Töchter
Roman
Aus dem Schwedischen von Senta Kapoun
FISCHER E-Books
Inhalt
Hannas Töchter
Die Missetaten der Väter suchen die Kinder heim bis ins dritte und vierte Glied. Das lernten wir schon damals in der Schule, als man noch Biblische Geschichte unterrichtete. Ich erinnere mich, daß wir diesen Ausspruch entsetzlich ungerecht, primitiv und albern fanden. Schließlich gehörten wir zu einer der ersten Generationen, die zu »selbständigen« Menschen erzogen wurden, Menschen, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen sollten.
Nach und nach oder auch Hand in Hand mit dem zunehmenden Wissen um die Bedeutung des sozialen und psychischen Erbes gewann das Bibelwort an Gewicht. Wir erben Verhaltensweisen und Reaktionsmuster in einem weit größeren Maß, als wir zugeben wollen.
Es war nicht leicht, dies zu erkennen und zu akzeptieren, so vieles wurde »vergessen«, verschwand im Unterbewußtsein, als die Großeltern Höfe und Landstriche verließen, in denen die Familien seit Generationen gelebt hatten.
Zu den Taten der Mütter gibt es keine Bibelworte, obwohl sie vermutlich von größerer Bedeutung sind als die der Väter. Uralte Muster werden von Müttern an Töchter weitergegeben, die wiederum Töchter bekommen, die wieder …
Vielleicht liegt hierin eine Erklärung dafür, daß Frauen es so schwer gehabt haben, sich zu behaupten und jene Rechte zu nutzen, die ihnen die moderne Gesellschaft mit ihrem Streben nach Gleichberechtigung bietet.
Ich schulde Lisbeth Andréasson, Kustodin des Heimatmuseums auf Bengtsfors Gammelgård, großen Dank. Sie unterzog das Buch über Hanna einer umfassenden kritischen Durchsicht, versah mich mit Literatur über Dalsland und übersetzte nicht zuletzt Dialoge aus der schwedischen Hochsprache in die Mundart des dalsländischen Grenzbereichs.[1] Ferner möchte ich Anders Söderberg vom Verlag Wahlström & Widstrand für seine Kritik, seinen Zuspruch und den großen Enthusiasmus danken. Ein Dank auch an meine Freunde Siv und Johnny Hansson, die jedesmal einsprangen, wenn es mir gelungen war, mich in meinem neuen PC zu verheddern. Und das ist viele Male passiert.
Schließlich möchte ich meinem Mann danken, daß er das alles durchgestanden hat!
Und noch eins. Es gibt keine autobiographischen Anklänge in meinem Buch. Anna, Hanna und Johanna haben keine Ähnlichkeit mit mir, meiner Mutter oder meiner Großmutter. Es sind meiner Phantasie entsprungene Gestalten, die nichts mit der sogenannten Wirklichkeit zu tun haben. Und gerade das macht sie wirklich. Für mich. Und hoffentlich auch für jene, die darüber nachzudenken beginnen, wer ihre Großmutter war und wie vorgegebene Muster ihr Leben beeinflußt haben.
Anna
Prolog
Ihr Empfinden glich einem Wintertag, einem Tag so still und schattenlos, als wäre soeben Neuschnee gefallen. Schrille Geräusche drangen zu ihr durch, das Scheppern fallengelassener Nierenschalen, Schreie.
Das erschreckte sie. Genau wie das Weinen aus dem Nachbarbett, das in dieses Weiß einbrach.
Es gab dort, wo sie war, viele, die weinten.
Vor vier Jahren hatte sie das Gedächtnis verloren. Nur wenige Monate später verschwanden die Wörter. Sie sah und hörte, aber weder Dinge noch Menschen konnten benannt werden und verloren damit ihren Sinn.
Nun also kam sie in das weiße Land, wo es die Zeit nicht gab. Sie wußte nicht, wo ihr Bett stand oder wie alt sie war. Aber sie fand eine neue Art, sich zu verhalten, und bat mit demütigem Lächeln um Nachsicht. Wie ein Kind. Und wie ein Kind war sie weit offen für Gefühle und für alles, was an wortloser Verständigung zwischen Menschen möglich ist.
Ihr war bewußt, daß sie sterben würde. Das war ein sicheres Wissen, nicht nur ein Gedanke.
Es waren die Angehörigen, die sie zurückhielten.
Ihr Mann kam jeden Tag. Mit ihm gab es Begegnungen der Wortlosigkeit. Er war über neunzig, war also auch nahe dieser Grenze. Aber er wollte weder sterben noch wissen. Da er sein und ihr Leben immer unter Kontrolle gehabt hatte, führte er einen harten Kampf gegen das Unausweichliche. Er massierte ihr den Rücken, beugte und streckte ihre Knie und las ihr aus der Tageszeitung vor. Sie konnte dem nichts entgegensetzen. Ihr gemeinsames Leben war lang und kompliziert gewesen.
Am schwierigsten war es, wenn die Tochter kam, sie, die weit weg in einer anderen Stadt wohnte. Die Greisin, die nichts von Zeit und Entfernung wußte, war vor dem Besuch immer unruhig. Es war, als habe sie schon beim Erwachen im Morgengrauen das Auto erahnt, das sich durchs Land bewegte, und mit ihm die Frau am Steuer, die eine törichte Hoffnung nährte.
Anna wußte, daß sie anspruchsvoll war wie ein Kind. Aber trotzdem, kaum ließ sie ihre Gedanken gewähren, gingen sie auch schon mit ihr durch. Nur noch einmal eine Begegnung und vielleicht eine Antwort auf eine der Fragen, die zu stellen ihre Zeit nie ausgereicht hatte. Doch wenn sie dann nach gut fünf Stunden auf dem Parkplatz des Krankenhauses ankam, hatte sie sich damit abgefunden, daß die Mutter sie auch diesmal nicht erkennen würde.
Trotzdem wollte sie die Fragen stellen.
Ich tue es um meinetwillen, dachte sie. Was Mama betrifft, ist es ja egal, worüber ich rede.
Aber sie irrte sich. Johanna verstand zwar die Worte nicht, spürte jedoch den Schmerz der Tochter und ihre eigene Machtlosigkeit. Sie erinnerte sich nicht mehr daran, daß es ihre Aufgabe war, dieses Kind zu trösten, das schon immer unsinnige Fragen gestellt hatte. Doch die Forderung bestand weiter und auch die Schuld an aller Unzulänglichkeit.
Sie wollte in die Stille flüchten, schloß die Augen. Es ging nicht, das Herz schlug, und hinter den Augenlidern war das Dunkel rot und schmerzhaft.
Sie begann zu weinen. Anna versuchte zu trösten, schon gut, schon gut, trocknete die Wangen der Greisin und schämte sich.
Johannas Verzweiflung war nicht aufzuhalten, Anna bekam Angst; klingelte um Hilfe. Es dauerte wie üblich, aber dann stand die blonde Frau in der Tür. Sie hatte junge Augen, ohne Tiefe. Auf der blauen Oberfläche stand Verachtung, und für einen Augenblick konnte Anna sehen, was jene sah: eine Frau mittleren Alters, verängstigt und hilflos, neben der Uralten, lieber Gott!
»Schon gut, schon gut«, sagte auch sie, aber die Stimme war hart, ebenso hart wie die Hände, die der Greisin übers Haar strichen. Trotzdem gelang es. Johanna schlief so plötzlich ein, daß es unwirklich schien.
»Wir dürfen die Patienten nicht aufregen«, sagte die Frau. »Jetzt bleiben Sie eine Weile ruhig sitzen. In zehn Minuten kommen wir Windeln wechseln und Betten machen.«
Anna flüchtete lautlos wie ein gescheuchter Hund durch den Tagesraum hinaus auf die Terrasse, griff nach ihren Zigaretten und machte einen tiefen Lungenzug. Das beruhigte, sie konnte denken. Erste Gedanken der Wut: was für ein verdammtes Weibsstück, hart wie Granit. Hübsch, selbstverständlich, und ekelhaft jung. Hatte Mama ihr aus Furcht gehorcht, gab es hier eine Disziplin, die die hilflosen Alten spürten, der sie sich fügten?
Dann kamen die Selbstvorwürfe, diese junge Frau tat ihre, Annas, Arbeit, tat alles, was laut Naturgesetz sie hätte tun müssen. Aber nicht konnte, sich nicht überwinden konnte, selbst wenn Zeit und Platz vorhanden gewesen wären.
Zu allerletzt kam die staunenswerte Erkenntnis: Der Mutter waren die von ihr gestellten Fragen irgendwie nahegegangen.
Sie drückte die Zigarette in der rostigen Blechdose aus, die jemand auf den entferntesten Tisch gestellt hatte, ein widerwilliges Zugeständnis an die Verlorenen. O Gott, wie müde sie war. Mama, dachte sie, du wunderbare kleine Mama, warum kannst du nicht barmherzig sein und sterben?
Erschrocken warf sie einen Blick auf den Krankenhauspark, in dem die Ahornbäume blühten und nach Honig dufteten. Sie atmete den Duft in tiefen Zügen ein, als suche sie Trost beim Frühling. Aber ihre Sinne blieben taub, ich bin schon selbst fast wie eine Tote, dachte sie, als sie kehrtmachte und mit entschlossenen Schritten zur Tür der Stationsschwester ging, anklopfte, gerade noch denken konnte: Bringen wir's hinter uns, Märta.
Märta war die einzige, die sie hier kannte. Sie begrüßten sich wie alte Freundinnen, die Tochter setzte sich in den Besucherstuhl und wollte gerade zu fragen beginnen, als die Gefühle sie übermannten.
»Ich will nicht heulen«, sagte sie, und dann heulte sie doch.
»Es ist nicht leicht«, die Schwester schob ihr den Karton mit Papiertüchern hin.
»Ich will wissen, wieviel sie mitkriegt«, sagte Anna und sprach von der Hoffnung, erkannt zu werden, sprach von den Fragen, die sie der Mutter gestellt hatte, die nichts begriff und doch verstand.
Märta hörte ohne Erstaunen zu: »Ich glaube, die Alten verstehen in einer Art, die wir nur schwer erfassen. Wie Neugeborene. Sie haben ja selbst zwei Kinder bekommen und wissen, daß schon Säuglinge alles mitkriegen, Aufregung und Freude, bestimmt erinnern Sie sich?«
Nein, sie erinnerte sich nicht, erinnerte sich nur ihres eigenen überwältigenden Gefühls von Zärtlichkeit und Versagen. Aber sie wußte, wovon die Krankenschwester sprach, denn sie hatte ihre Enkelkinder, von denen sie viel gelernt hatte.
Dann sprach Märta in tröstenden Worten vom Allgemeinzustand der alten Frau, man hatte die wundgelegenen Stellen in den Griff bekommen, körperliche Qualen litt sie also nicht.
»Aber sie ist nachts ein bißchen unruhig«, sagte Märta. »Es sieht aus, als hätte sie Alpträume, sie wacht schreiend auf.«
»Träume?«
»Klar träumt sie, das tun alle. Das Traurige ist, daß wir nie erfahren werden, was unsere Patienten so träumen.«
Anna dachte an die Katze, die sie zu Hause gehabt hatten, das schöne Tier, das aus dem Schlaf hochfuhr und mit gespreizten Krallen zu fauchen begann. Dann schämte sie sich auch dieses Gedankens.
Doch Schwester Märta sah ihre Verlegenheit nicht.
»Mit Rücksicht auf Johannas schlechten Allgemeinzustand möchten wir ihr lieber nichts Beruhigendes geben. Außerdem meine ich, sie braucht ihre Träume vielleicht.«
»Braucht …?«
Schwester Märta überhörte das Erstaunen in Annas Stimme und fuhr fort: »Wir haben vor, ihr ein eigenes Zimmer zu geben. In ihrem jetzigen Zustand stört sie die andern im Saal.«
»Ein eigenes Zimmer, ist das möglich?«
»Wir warten Emil in Nummer sieben ab«, sagte die Krankenschwester und senkte den Blick.
Erst als die Tochter in der Parklücke zurücksetzte, begriff sie, was die Krankenschwester Märta mit den Worten über Emil, den alten Sektenprediger, gemeint hatte, dessen Choräle all die Jahre erklungen waren. Ihr war gar nicht aufgefallen, daß es in seinem Zimmer heute still war. Jahrelang hatte sie ihn vom Leben im Tal der Todesschatten singen hören und vom Herrn, dessen furchtbares Gericht uns erwartet.
Johannas geheime Welt richtete sich nach der Uhr. Sie eröffnete sich ihr gegen drei in der Nacht und schloß sich wieder im Morgengrauen um fünf Uhr.
Diese Welt war voller Bilder, erfüllt von Farben, Düften und Stimmen, auch von anderen Geräuschen. Ein Wildbach rauschte, der Wind sang in den Kronen der Ahornbäume, und den Wald erfüllte das Singen der Vögel.
In dieser Nacht beben ihre Bilder vor Spannung. Es ist Sommer und früher Morgen, tiefstehende Sonne und lange Schatten. »Verrückt bist, Teufel noch mal«, schreit die Stimme, die sie am besten kennt, die des Vaters. Er ist rot im Gesicht und erschreckend in seiner Erregung. Sie hat Angst, schlingt die Arme um seine Beine, er hebt sie hoch, streicht ihr übers Haar und sagt:
»Glaub ihm nicht, Kind.«
Aber ihr ältester Bruder steht mitten in der Kammer, er ist prächtig anzusehen, hat blanke Knöpfe und hohe Stiefel, und auch er schreit.
»In die Grotte mit euch allen, und das heute noch. Die können morgen schon da sein.«
Jetzt ist noch eine Stimme zu hören, eine entschlossene.
»Ach, Junge. Glaubst du wirklich, der Axel und der Ole aus Moss und der Sohn von der Astrid, die drüben in Fredrikshald wohnen, kommen daher und schießen uns einfach tot?«
»Ja, Mutter.«
»Ich glaub, du bist übergeschnappt«, sagt die Stimme, doch jetzt ist sie unsicher. Und der Alte sieht den Soldaten an, Blick stößt auf Blick, und der Alte kann dem Ernst in den Augen des Jungen nicht ausweichen.
»Machen wir's halt, wie du meinst.«
Dann wechseln die Bilder. Fußgetrampel, schwere Gegenstände werden weggeschleppt. Sie sieht, wie sich Keller und Vorratsräume leeren. Der große Bottich mit Salzspeck wird hinausgetragen, das Heringsfaß, die Kartoffelkiste, der Multbeerentopf, die Butter im Holzfaß, die harten Fladenbrote, all das kommt hinaus an die Böschung. Hinunter zum Kahn. Säcke voll Decken und Kleider, aller Wollvorrat aus der Hütte wird den Steilhang hinunter zum See geschafft. Sie sieht die rudernden Brüder, angestrengte Ruderschläge hin zur Landzunge, leichte zurück.
»Die Petroleumlampen!« Das ruft die Mutter, unterwegs zur Hütte. Aber der Soldat hält sie auf, auch er ruft laut: »Nein, Mutter, auf Licht müßt Ihr verzichten.«
Die Augen des Kindes sind vor Angst weit aufgerissen. Doch da setzt sich ein Zitronenfalter auf seine Hand.
Nun verändert sich das Bild wieder, die Sonne ist fast untergegangen, sie sitzt auf Vaters Schultern und wird, wie so oft in der Abenddämmerung, den Hang hinauf zu den Bergseen getragen. Diese sind geheimnisvoll und reglos, ganz anders als der große See mit seinem Licht und blauen Geglitzer. Genau über der Mühle bricht der größte der dunklen Seen die Stille, stürzt sich mit all seiner Kraft hinunter in den Wildbach, aber da ist das Wehr und hält ihn zurück.
Der Vater kontrolliert wie immer am Abend die Schleuse. »Norwegerwasser«, sagt er, und seine Stimme klingt gequält. »Vergiß nie, Johanna, das Wasser für unser tägliches Brot kommt aus Norwegen. Wasser«, sagt er, »ist viel klüger als Menschen, es schert sich einen Dreck um alle Grenzen.«
Er ist außer sich. Aber sie fürchtet sich nicht, solange sie auf seinen Schultern sitzen darf.
Jetzt bricht der Abend herein. Mühsam und schwerfällig steigt der Vater steil bergab, geht zur Mühle, prüft die Schlösser. Das kleine Mädchen hört ihn Flüche murmeln, bevor er dem Pfad hinunter zum Boot weiter folgt. In der Höhle ist es still, die Brüder sind eingeschlafen, doch die Mutter bewegt sich unruhig auf dem harten Lager.
Das Kind darf in Vaters Arm schlafen. Es ist kalt.
Später neue Bilder. Sie ist größer, sie sieht es an den Füßen, die zur Höhlenöffnung laufen, in Holzschuhen, denn jetzt sind die Hänge glitschig.
»Vater«, ruft sie, »Vater.«
Aber er antwortet nicht, es ist Herbst, es wird früh dunkel. Dann sieht sie das Licht im Höhleneingang und fürchtet sich, es wird gegrölt in der Höhle, Rudolf ist da, der Schmied, vor dem sie solche Angst hat. Sie sieht beide Männer schwanken, sieht ihn und auch den Vater.
»Heim mit dir, Fratz«, schreit er, und sie rennt und weint, rennt und weint, rennt und fällt, tut sich weh, aber der Schmerz von den aufgeschlagenen Knien ist fast nichts gegen das Weh in der Brust.
»Vater«, schreit sie. »Vater!«
Und dann ist die Nachtschwester da, besorgt: »Schon gut, schon gut, Johanna. Es ist nur ein Traum, schlaf jetzt, schlaf ein.« Sie gehorcht wie immer, schläft kurz ein, bis die Stimmen der Frühschicht in den Körper dringen und wie Eis durch ihre Adern treiben. Sie zittert vor Kälte, doch keiner sieht es, die Fenster werden aufgerissen, sie bekommt eine frische Windel, sie friert nicht mehr und fühlt keine Scham.
Sie ist wieder dort in der weißen Nichtigkeit.
Anna verbrachte eine Nacht mit wirren und klärenden Gedanken. Sie begannen mit den Gefühlen, die in ihr erwacht waren, als Schwester Märta sie nach ihren eigenen Kindern gefragt hatte: Zärtlichkeit und Unzulänglichkeit. So war es bei ihr immer gewesen, wenn ihre Gefühle stark waren, verlor sie selbst an Kraft.
Erst gegen drei Uhr war sie eingeschlafen. Sie hatte geträumt. Von Mama. Und der Mühle und dem Wildbach, der sich hinab in den lichten See stürzte. Im Traum war das große Gewässer still und blank gewesen.
Der Traum hatte sie getröstet.
Herrgott, wie konnte Mama erzählen! Von den Elfen, die im Mondlicht über den See tanzten, und von der Hexe, die mit dem Schmied verheiratet war und Mensch und Tier um den Verstand zaubern konnte. Je älter Anna wurde, um so mehr wuchsen die Märchen zu langen Erzählungen über Leben und Tod der Menschen in diesem magischen Grenzland an. Als sie elf und auch immer kritischer wurde, hatte sie gemeint, alles sei erlogen und es gäbe das seltsame Land nur in der Phantasie ihrer Mutter.
Später, als sie schon erwachsen war und einen Führerschein besaß, hatte sie die Mutter ins Auto gesetzt und sie heim an den Wildbach am langen See gebracht. Es waren dorthin nur 240 Kilometer. Sie konnte sich noch erinnern, wie zornig sie auf Papa gewesen war, als sie die Entfernung auf der Landkarte ermittelt hatte. Er besaß schon viele Jahre ein Auto und hätte wirklich die Strecke in wenigen Stunden mit Johanna und seiner Tochter fahren können, die so viel von diesem Land ihrer Kindheit erzählt bekommen hatte. Wenn er nur den Willen gehabt hätte. Und die Einsicht.
Aber als sie und die Mutter das Ziel an diesem sonnigen Sommertag vor dreißig Jahren erreichten, war der Zorn verraucht. In feierlicher Stimmung und voller Staunen stand sie dort und sah: tatsächlich, hier lag es, das Land der Märchen, das Land mit dem langgestreckten See tief unten, mit dem Wildbach und seinem Gefälle von gut zwanzig Metern und den stillen Norwegerseen oben in den Bergen.
Die Mühle war niedergerissen, ein Kraftwerk erbaut und wieder eingestellt worden, als der Atomstrom kam. Aber das schöne rote Holzhaus stand noch, seit langem der Sommersitz eines Unbekannten.
Der Augenblick war zu groß für Worte, also hatten sie nicht viel gesprochen. Mama hatte geweint und sich dafür entschuldigt: »Ich bin so dumm.« Erst als sie den Eßkorb aus dem Wagen geholt und sich mit Kaffee und belegten Broten auf einem flachen Felsen am See niedergelassen hatten, waren die Worte gekommen und genauso wie damals, als Anna klein gewesen war. Ihre Mutter hatte die Geschichte vom Krieg gewählt, der nie zustandegekommen war:
»Ich war ja erst drei, als die Unionskrise begann und wir in die Höhle übergesiedelt sind. Dort drüben, hinter der Landzunge. Vielleicht glaub ich mich daran zu erinnern, weil ich die Geschichte, während ich heranwuchs, viele Male hab erzählen hören. Aber ich hab die Bilder so deutlich vor mir. Ragnar ist heimgekommen, stand so prächtig dort in seiner blauen Uniform mit den glänzenden Knöpfen und verkündete, daß es Krieg geben werde. Zwischen uns und den Norwegern!«
Das Staunen war ihrer Stimme immer noch anzuhören, das Erstaunen des Kindes vor dem Unbegreiflichen. Die Dreijährige hatte wie alle Grenzbewohner Verwandte jenseits der Norwegerseen, wo Mutters Schwester mit einem Fischhändler in Fredrikshald verheiratet war. Die Kusinen hatten viele Sommer im Müllerhaus verbracht, und selbst war sie einen knappen Monat zuvor mit der Mutter zu Besuch in die Stadt mit der großen Festung gefahren. Sie konnte sich erinnern, wie der Fischhändler roch und was er gesagt hatte, als er die Festungsmauern betrachtete.
»Dort haben wir ihn erschossen, den Sauschwed.«
»Wen?«
»Den Schwedenkönig.«
Das kleine Mädchen hatte Angst bekommen, aber die Tante war von sanfterer Art als die Mutter und hatte sie hochgehoben und getröstet: »Ist schon ganz lang her. Und die Leute früher hatten so wenig Verstand.«
Aber vielleicht gab es etwas in der Stimme des Onkels, das sich im Kopf festgesetzt hatte, denn eine Zeit nach dem Norwegenbesuch befragte das Kind seinen Vater. Er lachte und sagte im wesentlichen wie die Tante, daß das alles lange her war und die Leute sich damals noch von Königen und verrückten Offizieren herumkommandieren ließen.
»Aber es hat ja kein Norweger geschossen. Es war ein Schwede, ein unbekannter Held der Geschichte.«
Sie hatte das nicht verstanden, erinnerte sich aber der Worte. Und weit später, als sie in Göteborg zur Schule ging, hatte sie gedacht, er hat recht gehabt. Es war ein gesegneter Schuß gewesen, der Karl XII. ein Ende bereitet hatte.
Sie waren damals lange auf dem Felsen sitzen geblieben, Mama und Anna. Dann waren sie langsam auf dem Weg um die Bucht durch den Wald zur Schule gewandert, die noch stand, aber viel kleiner war, als Johanna sie in Erinnerung hatte. Mitten im Wald gab es einen Felsblock, den Riesenwurf, dachte Anna. Mama war eine ganze Weile vor dem Stein stehengeblieben, erstaunt: »Wie klein der ist.« Anna, die ihre Kindheitsberge selbst auch mit Magie aufgeladen hatte, mußte nicht darüber lachen.
Während des ganzen langen Samstags gelang es Anna, eine gute Tochter zu sein. Sie bereitete die Lieblingsspeisen ihres Vaters zu, lauschte ohne sichtbare Ungeduld seinen endlosen Geschichten, und fuhr ihn zum Steg, wo das Boot lag, saß fröstelnd dort, während er Fender und Verdecke überprüfte, den Motor zur Kontrolle laufen ließ und Eiderenten mit Brotbrocken fütterte.
»Wie wär's mit einer Runde?«
»Nein, es ist zu kalt. Und ich muß ja noch zu Mama fahren.«
Er schaute spöttisch. Anna hatte nie ein Segel setzen oder einen Außenbordmotor anlassen gelernt. Wohl weil er … aber es war besser, vorsichtig zu sein.
»Du«, sagte er. »Du hast dein Leben lang nichts anderes getan, als die Nase in Bücher gesteckt.«
Er hatte mit voller Absicht verletzen wollen, und es war ihm gelungen.
»Ich habe mich gut damit durchgebracht«, sagte sie.
»Geld«, sagte er, und jetzt troff ihm der Hohn geradezu aus den Mundwinkeln. »Geld ist hier in dieser Welt nicht alles.«
»Das ist wahr. Aber es bedeutet doch eine ganze Menge für dich, der du dich über die Pension beschwerst und jedes Öre zweimal umdrehst.«
Jetzt hat die gute Tochter die Maske fallen lassen, dachte sie, verdammte ihre Verletzlichkeit und sackte vor dem unausweichlichen Streit in sich zusammen. Aber der Vater war unberechenbar wie immer. Das ist es, was ihn so schwierig macht, dachte sie.
»Du wirst nie verstehen können wie es ist, hungrig und arm zu sein«, sagte er. »Ich habe schon früh lernen müssen, jedes einzelne Öre zu schätzen.«
Es gelang ihr, zu lächeln, zu sagen, ich hab ja nur Spaß gemacht, Väterchen. Und die Wolke zog vorüber, und sie half ihm an Land und ins Auto.
Er hat nur zwei Gefühle, Zorn und Sentimentalität, dachte sie. Ist das eine verpufft, ist Zeit für das andere. Da hielt sie sich wieder für ungerecht. Außerdem stimmte es ja, sie hatte nie gehungert.
Im Krankenhaus ging es heute auch besser. Anna tat, was sie mußte. Sie sprach mit der alten Frau wie mit einem Baby, hielt ihre Hand, fütterte sie zu Mittag: ein Löffel für Papa, ein Löffel für Mama. Mitten in dieser Leier hielt sie inne, schämte sich. Es war menschenunwürdig.
Die alte Frau schlief nach dem Essen ein, Anna blieb sitzen und betrachtete das ruhige Gesicht. Wenn sie schlief, sah sie fast aus wie früher, und Anna, hin- und hergerissen zwischen ihrer Zärtlichkeit und ihrem Unvermögen, ging für eine Weile auf die Terrasse, um zu rauchen.
Mit der Zigarette in der Hand versuchte sie über die schwierigen Seiten ihrer Mutter nachzudenken, ihre Selbstaufopferung und ihre Schuldgefühle. Eine Hausfrau mit nur einem Kind und jeder Menge Zeit, es zu verzärteln.
Es war albern, es half ihr nicht. Nichts tut so weh wie Liebe, dachte sie. Mein Fehler ist, daß ich zuviel davon abbekommen habe, darum kriege ich mich nicht in den Griff, weder was Mama noch was Rickard betrifft. Und überhaupt nie, wenn es um die eigenen Kinder geht.
Der Gedanke an ihre beiden Töchter tat ebenfalls weh. Ohne Grund, denn sie hatte keinen Grund, sich ihretwegen Sorgen zu machen. Auch sie hatten eine unzulängliche Mutter gehabt. Und nichts konnte ungeschehen gemacht werden.
Als sie wieder ins Krankenzimmer kam, wachte die Mutter auf, schaute sie an und versuchte zu lächeln. Es war nur ein Augenblick, vielleicht war es gar nicht geschehen. Dennoch war Anna so glücklich, als wäre sie einem Engel begegnet.
»Hallo, kleine Mama«, sagte sie. »Möchtest du wissen, was ich heute nacht geträumt habe? Ich habe vom Norskwasser geträumt, von allem, was du erzählt hast.«
Der Augenblick war schon lange vorbei, aber Anna sprach weiter, ruhig und in langen Sätzen. Wie man zu Erwachsenen spricht.
»Es hat mich daran erinnert, wie wir zum ersten Mal dort waren, du und ich. Du weißt es bestimmt noch, es war ein schöner Sommertag, und ich war ganz erstaunt darüber, daß alles so war, wie du erzählt hattest. Wir saßen auf dem großen Felsen unten am See, weißt du noch? Du hast von der Höhle erzählt, in die ihr geflüchtet wart, weil ihr dachtet, es kommt zum Krieg mit Norwegen, wie ihr dort gehaust habt und wie alle gefroren haben. Außer dir, denn du durftest in Papas Arm schlafen.«
Vielleicht war es ein Wunschdenken, aber Anna meinte zu sehen, daß Leben in das Gesicht der alten Frau kam, es wechselte zwischen Erstaunen und Freude.
Sie lächelte.
Ich war immerzu der Meinung, es ist nicht möglich, aber ich sehe ja, daß es möglich ist, halte es fest, Mama, halte es fest.
Sie sprach weiter vom Wasserfall und dem Wald, der Gesichtsausdruck verlor sich wieder. Aber dann sagte sie: »Ich habe oft darüber nachgedacht, was für ein Gefühl das gewesen sein muß, dort in der Höhle zu schlafen. Wo es so feucht war und ihr kein Feuer machen durftet und nur kalte Sachen essen konntet.«
Jetzt gab es keinen Zweifel mehr, das Gesicht veränderte sich wieder, diesmal zur Heiterkeit hin.
Die alte Frau versuchte Anna anzulächeln, es war eine große Anstrengung, und es gelang ihr nicht, es wurde eine Grimasse. Aber dann geschah das Wunder wieder, die braunen Augen sahen direkt in die Annas, es war ein fester und bedeutungsvoller Blick.
Im nächsten Moment schlief sie. Anna blieb lange sitzen. Nach einer halben Stunde ging die Tür auf, und die Blauäugige sagte: »Die Patienten müssen jetzt frischgemacht werden.«
Anna stand auf, flüsterte der Mutter einen Dank ins Ohr. Als sie den Raum verließ, fing die Greisin im Nebenbett an zu schreien.
Anna wählte den Umweg am Strand entlang, blieb eine Weile im Wagen sitzen und blickte über die Bucht, in der sie schwimmen gelernt hatte. Wo Moschuskraut und rotes Leimkraut, Storchschnäbel und Hornklee sich zwischen den Felsen unter das harte Seegras gemischt hatten, gab es eine Bootswerft, die anspruchslosen Eigenheime waren durch Rauhputz aufgefrischt und so diskret durch Anbauten erweitert worden, daß man sie kaum wiedererkannte. Zu den Hügeln hin, wo die Wiesen der Kindheit sich mit Walderdbeeren, Kornblumen und Kühen ausgedehnt hatten, standen jetzt lange Reihenhaussiedlungen, die wie umgekippte Hochhäuser dalagen.
Nur das Meer dort draußen war sich gleich geblieben und auch die Inseln, deren flache Profile sich am grauen Horizont abzeichneten.
Verlorenes Land, verlorene Kindheit.
Hier gingen wir einst über die Strandwiese, Hand in Hand. Mit Badetüchern und Eßkorb versehen, und darin Brote, Kaffee für dich und Saft für mich. Ich werde langsam erwachsen, dachte Anna und fühlte die Trauer. Und die Wut. Warum muß es sich so häßlich entwickeln, so barbarisch.
Meine Mutter war schön wie einst auch die Landschaft. Jetzt verfällt sie. Und ich versuche zu lernen, all das zu akzeptieren. Es ist an der Zeit, denn auch ich bin alt, bald alt.
Ich muß nach Hause.
Aber sie hätte sich nicht zu beeilen brauchen, denn der Vater schlief.
Leise wie ein Dieb schlich sie sich durch das Haus und fand schließlich, wonach sie suchte. Das Fotoalbum. Aber die Bilder weckten keine Erinnerungen, es waren reine Äußerlichkeiten. Ja, so haben wir ausgesehen.
Vorsichtig zog sie die Schublade heraus, um das alte Album wieder zu verstauen. Es verklemmte sich, und es dauerte eine Weile, bis sie sah, weshalb. Unter dem geblümten Papier, mit dem Mama vor Jahren die Laden ausgelegt hatte, lag noch eine Fotografie. Gerahmt und hinter Glas. Großmutter!
Sie zog das Bild heraus, sah verwundert zur Wand, wo es immer neben Vaters Eltern, den Kindern und Enkeln seinen Platz gehabt hatte. Tatsächlich, das Bild fehlte, und der nicht ausgebleichte Fleck auf der Tapete zeigte an, wo es gehangen hatte.
Merkwürdig, warum hatte er das Bild seiner Schwiegermutter entfernt? Hatte er sie nicht gemocht? Aber das hatte er doch!
Was weiß ich eigentlich? Was kann man von seinen Eltern wissen? Von seinen Kindern?
Und warum ist das so wichtig? Warum wird es als Mangel empfunden, sich nicht zu erinnern und nichts verstanden zu haben? Bei mir ist es wie ein Loch, das aufgefüllt werden muß. Als hätte ich keine Kindheit gehabt, nur eine Erzählung davon, eine Erzählung von dem, was geschehen oder vielleicht nicht geschehen ist.
Es waren gute Erzähler gewesen, vor allem Mama mit ihrer Fähigkeit, alles in Bilder umzusetzen. Vergoldete Bilder?
Daß Papa vervollständigte, daß er einfügte, was Wirkung versprach, und wegnahm, was nur zu Komplikationen führen würde, das hatte ich schon sehr früh begriffen. Und es entschuldigt, weil Dramatik Spannung ergab und Pointen lustig waren.
Bedächtig stahl sie sich die Treppe hinauf in ihr altes Kinderzimmer, legte sich aufs Bett, fühlte, wie müde sie war. Zwischen Wachen und Schlafen kam ihr die Vorstellung, eine wichtige Entdeckung gemacht zu haben. Vielleicht hatte sie darum so wenig Kindheitserinnerungen, weil sie in einer Erzählung gelebt hatte. Einer Geschichte, in der sie sich nie richtig wiedererkennen konnte.
Wurde so das Gefühl des Fremdseins geboren?
Sie erwachte, als der alte Mann in der Küche mit dem Kaffeekessel schepperte, fuhr hoch und wurde vom schlechten Gewissen die Treppe hinuntergejagt.
»Na also, da bist du ja«, sagte er lächelnd. »Mir war doch, als wärst du hier, um mich zu besuchen.«
»Du hattest es vergessen?«
»Ich vergesse heutzutage so leicht.«
Sie nahm ihm den Kaffeekessel aus der Hand, sagte: »Setz dich einstweilen auf die Küchenbank, ich mach das schon mit dem Kaffee.«
Sie nahm Zimtschnecken aus dem Gefrierfach, taute sie im Ofen auf, und sah dann zu, wie das heiße Wasser durch den Papierfilter tropfte, roch den duftenden Kaffee und hörte dem alten Mann kaum zu, der schon mitten in einer Schilderung von seiner Begegnung mit Walen war, als er einmal vom dänischen Skagen losgesegelt war. Es war eine alte, uralte Geschichte, Anna hatte sie viele Male gehört. Mit Vergnügen.
Jetzt hatte er die Fähigkeit verloren, Spannung zu vermitteln und bei der Sache zu bleiben. Seine Erzählung schleppte sich hin, machte Umwege, er verlor den Faden: Wo war ich noch?
»An der schwedischen Küste vor Varberg.«
»Ja, stimmt«, sagte er dankbar, aber der Faden, den er bei Varberg aufnahm, gehörte zu einer anderen Geschichte von einem Mädchen und einem Tanz im Burghof der alten Festung. Mittendrin geriet er ins Stocken, sagte verwirrt, das sei wohl auf der Festung von Kungälv gewesen, wo er in einer hellen Sommernacht getanzt hatte. Und mit dem Bräutigam eines Mädchens in ein Handgemenge geraten war.
Als er seinen einzigartigen Sieg über den Bräutigam schilderte, klang alles klar und deutlich, die Erzählung steigerte sich, erhielt Glanz. Aber schnell verfing er sich in einem Wirrwarr von anderen Erinnerungen, wie er bei einer Prügelei gewonnen, ein scheuendes Pferd aufgehalten und einem Kind, das irgendwo in einem Hafen ins Wasser gefallen war, das Leben gerettet hatte.
Sie nahm die Zimtschnecken aus dem Ofen, und ihre Verzweiflung war fast unerträglich. Dieses schamlose Aufschneiden und das verfallende Gehirn, seine ungeordneten Erinnerungen waren entsetzlich.
Was heißt Erinnerungen? Vielleicht waren es nur Histörchen, die er im Lauf der Jahre immer mehr ausgeschmückt hatte.
Ich will nicht alt werden, dachte sie. Und während sie den Kaffee in die Tassen goß: Wie kann ich jemals wahrhaftig werden? Aber laut sagte sie: »Dein Wachstuch ist aber schon ziemlich verschlissen. Wir werden morgen ein neues kaufen.«
Nach dem Frühstück ging der alte Mann zum Fernseher, diesem gesegneten, abscheulichen Gerät. Dort, im alten durchgesessenen Lehnstuhl, schlief er wie üblich ein. Sie konnte das Mittagessen vorbereiten und hatte sogar noch Zeit für einen kurzen Spaziergang durch das Eichenwäldchen zwischen den Felsen und dem Haus.
Sie brachten die Mahlzeit hinter sich, Hackfleisch mit Rahmsauce und Preiselbeeren.
»Solches Essen kriege ich nur, wenn du hier bist«, sagte er. »Die anderen, die sonst hier rumrennen, die haben keine Zeit, richtiges Essen zu machen.«
Es klang wie ein Vorwurf. Da sie das nicht zu begreifen schien, wurde er deutlicher: »Du kannst doch ebensogut hier bei mir schreiben.«
»Ich habe Mann und Kinder.«
»Die können dich ja hier besuchen kommen«, sagte er, und sie dachte, daß er im Grund gar nicht so unrecht hatte. Ich könnte meinen Bericht sehr wohl oben in meinem alten Zimmer fertig schreiben. Wahrhaftig, dachte sie und lächelte in all ihrem Elend, wie wird man wahrhaftig? Man stelle sich vor, ich spräche aus, wie es sich wirklich verhält, daß ich keinen Augenblick Ruhe in deinem Haus habe, Papa, daß ich mir gerade jetzt nicht vorstellen kann, wie ich es noch zwei weitere Tage aushalten soll, ohne durchzudrehen.
»Ich würde dich nicht stören«, sagte er.
Es lag eine Bitte in den Worten, und sie war den Tränen nahe.
Aber sie begann von den Computern zu sprechen, die sie für ihre Arbeit brauchte, diesen Maschinen, die keinen Ortswechsel zuließen.
Wahrhaftig dachte sie, während sie hier saß und ihrem Vater glatt ins Gesicht log. Als er vom Tisch aufstand und sich für das Essen bedankte, war Kälte in seiner Stimme. Ich mag ihn nicht leiden, dachte sie. Ich habe Angst vor ihm, ich halte ihn nicht aus, ich verabscheue ihn. Das Schwierige ist, daß ich ihn trotzdem liebe.
Sie spülte das Geschirr. Ein Nachbar kam, ein Mann, den sie mochte, ein liebenswerter Mann. Er war fröhlich wie immer, strich ihr über die Wange und sagte: »Es ist nicht leicht, ich weiß.« Sie empfand eine unbegreifliche Angst, als sie seinem Blick begegnete, es war, als ginge ein Schatten durch die Küche.
»Geh du zu Papa rein, ich mache euch einen Grog«, sagte sie und hörte selbst, wie unsicher ihre Stimme war.
Mit fahrigen Bewegungen machte sie das Tablett zurecht, die Flasche Gin, die sie mitgebracht hatte, Tonic, ein Schüsselchen Erdnüsse. Vorahnungen? Nein! Ich bin müde und ein Idiot. Sie sagte es mehrere Male halblaut vor sich hin, müde und idiotisch. Er ist noch jung, gesund und fröhlich, einer von den Menschen, die lange leben.
Als sie die Drinks servierte, sagte sie so ganz nebenbei: »Und wie geht's dir, Birger?«
Er sah sie erstaunt an und sagte, daß es ihm gutgehe wie immer. Sie nickte, wagte aber den ganzen Abend nicht, seinem Blick zu begegnen.
Es war bald Zeit zum Schlafengehen, gegen neun wurde der alte Mann plötzlich müde. Sie half ihm ins Bett, sanft und so nachsichtig wie sie nur konnte. Seine Würde war verletzlich.
Sie nahm sich eine Tasse Tee mit hinauf ins Zimmer, das gehörte dazu. Mama hatte immer darauf bestanden, für jeden gab es eine Tasse Tee mit Honig vor dem Einschlafen. Als sie das süße Getränk zu sich nahm, erwachte die Kindheit zum Leben, die Erinnerungen, die sich ihr eingeprägt hatten. Der Duft von Honig im Tee, eine blaublumige Tasse und vor dem Fenster die Schreie der Sturmmöven, die sich in übermütiger Lebensfreude vom Himmel fallen ließen.
Sie öffnete ihr Fenster und folgte der lärmenden Schar mit den Augen. Sie zogen dem Meer entgegen, hinaus über Asperö und Köpstadsö. Im nächsten Moment hörte sie in den Eichen, die schon die ersten Maiknospen trugen, die Schwarzdrossel singen.
Das war zuviel, solche Wehmut war nicht auszuhalten. Entschlossen nahm sie eine Schlaftablette.
Das goldene Licht weckte sie zeitig. Vielleicht nicht nur das Licht, denn bis hinein in die Träume der Nacht hatte sie das Vogelgezwitscher aus dem Garten gehört, schön und stark wie der Frühling selbst. Eine Weile lag sie still da und versuchte, die einzelnen Stimmen zu erkennen, den Jubel des Buchfinken, die munteren Tonfolgen der Kohlmeisen und das Zirpen der Schwalben während ihres Anflugs auf das Ziegeldach.
Die Schwalben sind gekommen und bauen Nester unter dem Dach, sinnierte sie und konnte für einen Augenblick spüren, daß alles war, wie es sein sollte.
Sie ging auf Zehenspitzen in die Küche hinunter, machte sich lautlos wie ein Geist eine Tasse Kaffee, schnappte sich eine Zimtschnecke und schlich auf leisen Sohlen wieder die Treppe hinauf, erinnerte sich, daß die sechste Stufe knarrte, übersprang sie, und alles ging gut. Der alte Mann im Schlafzimmer schnarchte.
Sie meditierte, der Gesang der Vögel half ihr auf dem Weg in die eigene Stille und in die Gewißheit, daß keine Gefahr drohte, obwohl alles im Fluß war. Vorübergehend glückte ihr sogar der Gedanke, daß ihre Mutter es nicht schwer hatte, daß sie bereits jenseits des Schmerzes angelangt war. Und daß Vaters Gedächtnis so kurz war, daß seine Verbitterung nie von Bestand sein konnte.
Dann holte sie sich Großmutters Fotografie und sah sie sich lange an.
Hanna Broman. Wer warst du? Ich habe dich seltsamerweise fast nur vom Hörensagen gekannt. Du warst eine Legende, großartig und fragwürdig. Ganz einmalig stark, sagte Mama.
Ich muß aber doch auch eigene Bilder haben, du hast ja gelebt, bis ich erwachsen war, heiratete und Kinder bekam. Die Fotografie hat mit meinen Erinnerungen an dich nichts gemein. Das ist verständlich, denn das Bild wurde aufgenommen, als du jung warst, eine Frau im schönsten Alter. Ich habe dich nur als alte Frau erlebt, wie eine Fremde, unglaublich groß und dick, eingehüllt in überweite, faltenreiche schwarze Kleider.
So also sahst du in jenen Tagen aus, als du im Vollbesitz deiner Kräfte warst, damals, als du mit einem Fünfzigkilosack Mehl zehn Kilometer weit, von der Mühle am Wasserfall bis zum Dorf an der Grenze, gingst. Dort hast du Mehl gegen Kaffee, Petroleum, Salz und andere Notwendigkeiten getauscht.
Kann das wahr sein? Du trugst den schweren Sack auf dem Rücken, hat Mama gesagt. Aber nur im Frühling und Herbst. Im Sommer bist du gerudert, im Winter zogst du den Schlitten übers Eis.
Wir wurden in verschiedenen Welten geboren, du und ich. Aber ich kann jetzt sehen, daß wir uns gleichen, die gleiche Stirn und der gleiche Haaransatz mit hohen Ecken. Gleich sind der breite Mund und die kurze Nase. Aber du hast nicht mein Kinn, nein, deines ist kräftig und eigenwillig. Dein Blick ist stetig, deine Augen halten Abstand. Ich erinnere mich, daß sie braun waren.
Lange sehen wir einander an. Zum ersten Mal sehen wir einander an!
Wer bist du? Warum haben wir einander nie kennengelernt? Warum hattest du an mir so gar kein Interesse?
Plötzlich hört Anna eine Frage.
Das Kind, das sagt: »Warum ist sie keine richtige Oma? Bei der man auf dem Schoß sitzen kann und Märchen erzählt bekommt.«
Und die Stimme der Mutter: »Sie ist alt und erschöpft, Anna. Sie hat längst genug von Kindern. Und für Märchen hat es in ihrem Leben nie Zeit gegeben.«
Gibt es so etwas wie Bitterkeit in der Stimme?
Ich muß zu dem zurückgehen, was ich selbst noch weiß.
Großmutter kam, als ich klein und sie noch kräftig genug war, den weiten Weg von der Bushaltestelle bis zum Haus am Meer, wo wir wohnten, zu Fuß zu gehen, manchmal vormittags zu Besuch. Sie saß auf der Küchenbank, es duftete nach Plätzchen und frischgebackenem Hefebrot, und alles war schön, eine Decke auf dem Tisch und die besten Tassen. Sie brachte Wohlbehagen mit, sie war wie eine Katze, die sich in einer Sofaecke zur Ruhe legt und schnurrt. Sie schnurrte auch, daran erinnere ich mich, sie knarrte wie ein Wachtelkönig bei Nacht. Wenn sie nicht sprach.
Auch ihr Reden machte Freude, eine ulkige Sprache, halb Norwegisch, voll Leichtigkeit, manchmal unverständlich.
›Mir sölba‹, sagte sie, ›do in Land‹, oder auch ›akkurat‹. Es gelang ihr immer, sich selbst ebenso zu überraschen wie die andern, denn die Worte flogen ihr aus dem Mund, ehe sie nachgedacht hatte. Dann machte sie ein erstauntes Gesicht, schwieg mit einemmal still, schämte sich oder lachte.
Wovon wurde gesprochen?
Von den Nachbarn im Amtmannhaus. Von Kindern, denen es schlechtging, von versoffenen Männern und kranken Frauen. Aber auch von Hochzeiten und neugeborenen Kindern, von Festen und Essen und wie in aller Welt die Menschen sich das nur leisten konnten, wurde gesprochen.
Für das Kind war das so, wie nach dem Entfernen des Daches vom Puppenhaus ein Durcheinander von Figuren zu sehen. Wie ein Spiel. Aber für die beiden Frauen war es Wirklichkeit und Ernst. Sie hatten lebhaftes Interesse an Höglunds schwächlichen Kindern und Malermeister Johanssons Besäufnissen. Ganz zu schweigen von Frau Niklassons seltsamer Krankheit.
Tratsch. Nicht boshaft, aber auch nicht wohlwollend. Erst jetzt denkt Anna, daß dieses endlose Gerede eine Art Gefühlsorgie war. Sie suhlten sich im Unglück anderer Leute, jammerten herum und lebten ihre persönliche Not aus, ohne je wirklich persönlich zu werden. Über sich selbst zu reden, wäre unmöglich gewesen. Schändlich.
Großmutter errötete leicht.
»Weinst du nie, Oma?«
»Nie. Es hilft nix«, sagte sie und wurde flammend rot.
Auch Mama wurde verlegen und wies das Kind zurecht. Es gab vieles, was man Großmutter nicht fragen durfte, denn wahrscheinlich war sie der Meinung, neugierige Kinder müsse man zurechtweisen, und Johanna könnte ihrem verwöhnten Gör keinen Anstand beibringen.
Du warst so verflixt praktisch, sagte Anna zu der Fotografie.
Vielleicht irre ich mich, dachte sie, als sie den Blick von dem Bildnis zum Meer vor dem Fenster schweifen ließ. Er mußte sich den Weg weit an all den kleinen Häusern vorbei suchen, wo die anonymen neuen Bewohner Zaun an Zaun lebten und einander wohl kaum mit Namen kannten. Vielleicht war es so, daß ihr beide eine traurige Sehnsucht nach dem Dorf hattet, aus dem ihr kamt? Und daß ihr Zusammenhänge und dörfliches Zusammengehörigkeitsgefühl wiederzubeleben versuchtet, als ihr in die Großstadt gezogen seid.
Bei diesem Gedanken konnte Anna ihre Großmutter schnauben hören. Sie mochte die Stadt, das elektrische Licht, das fließende Wasser, die Geschäfte, die im gleichen Häuserblock lagen, und das Recht, die eigene Tür hinter sich zumachen zu können.
Großmutter kam am Sonntag zum Mittagessen, von Vater im Auto geholt. Sie hatte lange schwarze Ketten aus Straß und weiße Rüschen um den Hals, schwieg bei Tisch, bis sie etwas gefragt wurde, und war gegenüber dem Schwiegersohn unterwürfig.
Plötzlich erinnerte sich Anna. Eine völlig klare Erinnerung, dachte sie verwundert. Am Mittagstisch herrschte Ratlosigkeit, die Aussage der Schullehrerin, daß Anna begabt sei, wurde gedreht und gewendet.
Begabt? Das war ein ungewöhnliches Wort. Das Fräulein hatte von höherer Schule gesprochen. Großmutter errötete und kicherte, fand das Gespräch geradezu verwerflich. Sie blickte das Mädchen lange an und sagte: »Zu was soll das gut sein? Bist doch bloß ein Mädchen. Hochmütig wird's, und helfen tut's eh nix.«
Vielleicht waren es diese Worte, die über Annas Zukunft entschieden. ›Bloß ein Mädchen‹ erweckte Vaters Zorn, er, der nie eingestand, wie traurig es ihn machte, daß sein einziges Kind ein Mädchen war.
»Das wird Anna selbst bestimmen«, sagte er. »Will sie studieren, dann wird sie es dürfen.«
Wie habe ich diesen Sonntag vergessen können, dieses Gespräch, dachte Anna. Sie ging zum Bett zurück und sah die Fotografie nochmals an. Du hast dich geirrt, alte Hexe, sagte sie. Ich habe studiert, ich habe die Abschlußprüfung gemacht, ich hatte Erfolg und bewegte mich in Welten, von denen du nicht einmal hast träumen können.
Hochmütig bin ich auch geworden, wie du gesagt hast, und was alle sagen. Und was dich angeht, du wurdest zum Fossil, ein primitiver Überrest aus einer entschwundenen Zeit. Ich habe dich aus meinem Leben ausgeschlossen, du warst nur eine peinliche Erinnerung an eine Herkunft, deren ich mich schämte.
Deshalb habe ich dich nie kennengelernt und habe keine Erinnerungen an dich. Aber es ist auch der Grund dafür, daß deine Fotografie mich so stark anspricht. Denn sie sagt ganz deutlich, daß auch du ein begabtes Mädchen warst.
Du hattest andere Vorurteile als ich, das ist wahr. Aber du hattest manchmal recht, und insbesondere dann, wenn du sagtest, auch ich werde alldem nicht entgehen. Auch auf mich wartete ein Frauenleben.
Ich trug keine Mehlsäcke von der Mühle zur Stadt, Großmutter. Und tat es doch.
Hanna
geboren 1871, gestorben 1964
Hannas Mutter bekam ihre Kinder in zwei Lebensabschnitten. Die vier ersten starben während der Hungersnöte Ende der achtzehnhundertsechziger Jahre an der Seuche. Maja-Lisa selbst wurde immer teilnahmsloser und wagte anzunehmen, daß ihr neue Kinder erspart blieben.
Aber achtzehnhundertsiebzig kam der Frühling mit Regen, die verbrannte Erde lebte auf, und es gab wieder Brot auf dem Tisch. Es war keine Rede von Überfluß, aber im Herbst hatten sie Kohlrüben und Kartoffeln im Keller. Und Kühe, die wenigstens soviel Futter bekamen, daß sie wieder Milch gaben.
Und Maja-Lisa trug ein Kind.
Sie verfluchte ihr Schicksal, aber August, ihr Mann, sagte, daß sie dankbar sein müßten. Die bösen Jahre hatten sie nicht vom Hof vertrieben, sie brauchten nicht im Zigeunerkarren über die Straßen zu ziehen wie viele andere Kleinbauern in Dal.
Hanna wurde als ältestes Kind des neuen Nachwuchses geboren, dann kam ein weiteres Mädchen und schließlich drei Jungen. Was die Mutter aus dem Geschehen gelernt hatte war, die neuen Kinder nicht zu sehr in ihr Herz zu schließen. Aber Schmutz und schlechte Luft zu fürchten.
Letzteres hatte sie in der Kirche gelernt.
In der Zeit vor den Jahren der Not hatten sie einen jungen, samtäugigen Pfarrer gehabt, der, so gut er konnte, in der Nachfolge Christi zu leben versuchte. Er teilte sein Brot mit den Alten, und wo immer er hinkam, brachte er Milch für die Kinder mit, obwohl das Essen auch im Pfarrhaus knapp war. Tagsüber gab er Kindern und Alten das letzte Geleit und schrieb Kirchenpapiere für all jene aus, die Richtung Westen nach Norwegen und Amerika flüchteten. Nachts betete er für die armen Leute.
Da die Gebete keine sichtbare Wirkung zeigten, tauschte er sie immer öfter gegen die Schriften aus, die ihm sein Bruder schickte, der Arzt in Karlstad war. So kam es, daß seine Predigten von der Bedeutung der Reinlichkeit zu handeln begannen. Die Schwindsucht hause im Schmutz und die englische Krankheit im Dunkel, verkündete er. Alle Kinder sollten hinaus ans Tageslicht. Sie starben nicht daran, daß sie froren, sondern an Dunkelheit und Dreck, wetterte er. Und Milch mußten sie bekommen.
Das war eine Botschaft, über die seine Gemeinde die Nase gerümpft hätte, wären die Zeiten so gewesen, wie sie sollten. Jetzt horchten die Mütter ängstlich auf, und Maja-Lisa gehörte zu denen, die die Predigt von der Reinlichkeit ernst nahmen.
Es gab viel Streit in ihrem Haus, ehe sie ihrem Mann beigebracht hatte, daß er nicht auf die Flickenteppiche spucken durfte. Aber sie war unnachgiebig, denn sie fand, der Pfarrer habe recht. Die neuen Kinder waren ungewöhnlich kräftig und gesund.
Aber der samtäugige Pfarrer verschwand und wurde durch einen ersetzt, der sehr auf Branntwein erpicht war. Es war mit dem Pfarrer wie mit den meisten Dingen in dieser Gegend, alles wurde nach den Notjahren schlechter. Die Angst hatte sich endgültig eingenistet, und es gab wenig Freude, dafür aber reichlich Mißgunst. Der Weg zum nächsten Haus wurde auch beschwerlicher, als sich der Wald die Äcker und Wiesen rund um die verlassenen Höfe zurückholte.
Und im Winter zogen die Bettlerscharen durchs Land und erinnerten an das Elend.
Als Hanna zwölf Jahre alt war, kam der neue Pfarrer nach Bråten zur Christenlehre und sagte, sie sollten Gott danken, daß sie an so einem schönen Ort wohnen dürften. Hanna blickte erstaunt über den See und die hohen Berge hin. Sie begriff nicht, wovon er sprach, dieser Pfarrer. Noch weniger verstand sie ihn, als er versicherte, daß Gott für seine Kinder sorge. Gott half nur dem, der harte Fäuste besaß und der gelernt hatte, auch das Geringste zu achten.
Im Alter von zwölf Jahren wurde das Mädchen auf den Hof an der Flußmündung geschickt, um als Magd zu dienen. Da war sie gerade so lange in die Schule gegangen, daß sie zur Not rechnen und schreiben konnte. Das reicht, sagte der Vater.
Auf Lyckan, also ›Glück‹, wie der Hof hieß, herrschte Lovisa, geizig, bekannt für Härte und Hochmut. Der Hof galt hier in der Armeleutegegend als reich, unten in der Ebene wäre es nicht mehr als eine dürftige Bauernwirtschaft gewesen. Lovisa hatte Pech mit ihren Kindern gehabt. Zwei Töchter hatte sie als Säuglinge im Schlaf erdrückt, ein Sohn war immer weniger geworden, schließlich verkrüppelt und an der englischen Krankheit gestorben. Jetzt war nur noch einer übrig, ein schöner Junge, gewöhnt, alle Wünsche erfüllt zu bekommen. Er unterschied sich auch im Aussehen von den anderen, er war dunkelhaarig und schwarzäugig.
Böse Zungen sprachen von einer Schar Zigeuner, die im Sommer vor seiner Geburt durchs Land gezogen war. Aber vernünftige Leute erinnerten sich, daß Lovisas Vater aus Spanien stammte, ein Schiffbrüchiger, dem auf Orust das Leben gerettet worden war.
Die Höfe waren miteinander verwandt, der Hausvater Joel Eriksson auf Lyckan war der Bruder von Hannas Mutter. Der Großvater wohnte noch auf dem Vorderhof, hatte aber seine Außengehöfte unter den Kindern aufgeteilt. Joel, der Sohn, bekam das Besitzrecht für Lyckan. Maja-Lisa und ihr Mann erhielten die Erbpacht auf Bråten, das dürftiger und kleiner war.
Als gäbe es doch noch Gerechtigkeit im Leben, bekam Maja-Lisa einen guten und fleißigen Mann, August Nilsson, geboren und aufgewachsen in Norwegen. Während der Sohn Joel an die schwierige Lovisa aus Bohuslän geriet.
Lovisa war bigott. Wie viele ihrer Wesensart fand sie Freude daran, ihre Mitmenschen in der Zucht und Lehre des Herrn zu halten, und konnte es sich im Alltag leisten, guten Gewissens grausam zu sein.
Nun war Hanna an lange Tage, schwere Arbeit und viele böse Worte gewöhnt. Also klagte sie nicht und bekam nie zu hören, daß die Nachbarn sie bedauerten und sagten, Lovisa behandle sie wie ein Stück Vieh. Das Mädchen durfte sich satt essen und an einem Tag im Monat auch freuen. Das war, wenn sie mit einem Scheffel Mehl zu ihrer Mutter heimgehen konnte.
Als im Oktober die Dunkelheit dichter wurde, bekam sie zum ersten Mal ihre Tage. Es tat weh, und sie blutete stark, Hanna ängstigte sich sehr. Aber sie wagte nicht zu Lovisa zu gehen. Sie nahm ihr verschlissenstes Leinenhemd, riß es in Streifen und kniff die Beine zusammen, um den blutigen Lappen an seinem Platz zu halten. Lovisa sah sie mißtrauisch an und schrie: »Du läufst wie eine x-beinige Kuh, heb die Füße.«
Erst am Samstag, als sie heim zur Mutter kam, konnte sie weinen. Ein paar Tränen nur, denn die Mutter sagte wie immer, daß Heulen gar nichts nützt. Dann gab es Abhilfe durch richtige gehäkelte Binden und ein Band, das man über den Hüften befestigen konnte. Zwei kostbare Sicherheitsnadeln wurden aus Mutters Nähkasten geholt. Es war ein regelrechtes Vermögen. Jetzt sagte Maja-Lisa: »Mußt wissen, daß es gefährlich ist. Laß nie einen Mann näher zu dir als auf zwei Ellen Abstand.«
Dann kam der Abend, an dem sie auf dem Heuboden einschlief. Sie hatte einen Schlafplatz in der Küche, aber dort gab es keine Ruhe, dort wurde abends gestritten. Oft wegen des Sohnes, den die Mutter verwöhnte und aus dem der Vater einen richtigen Kerl machen wollte. Hanna war so müde, daß sie wohl trotz der schlimmen Worte, die über dem Strohsack in der Mägdekiste hin und her flogen, hätte einschlafen können. Aber heute abend prügelten sich die Hausleute in der Kammer, und durch die Küchentür drang das Geräusch von schweren Schlägen und schrecklichen Schreien. Hanna dachte, jetzt macht er sie tot, der Joel. Aber dann hörte sie den schwarzen Rickard brüllen. Es war ein unheimliches und wütendes Aufheulen, wie ein Schrei aus der Unterwelt.
Die haben ihn aufgeweckt, Gott erbarm.
Sie schlich hinaus in den Stall. Vor dem Jungen hatte sie eine Sterbensangst, er hatte angefangen, sie zu zwicken, sobald seine Mutter die Augen anderswo hatte.
Nun schlief sie also auf dem Heuboden wie ein müdes Tier und wachte erst auf, als er ihr den Rock herunterriß. Sie versuchte zu schreien, aber er drückte ihr den Hals zu, und sie wußte, daß sie jetzt sterben würde. Mit dieser Erkenntnis schwieg sie still. Er war schwer wie ein Stier, als er sich auf sie wälzte, und als er in sie eindrang und sie zerriß, konnte sie mitten in diesem ungemeinen Schmerz Gott noch bitten, er möge sie bei sich aufnehmen.
Dann starb sie und war erstaunt, als sie nach vielleicht einer Stunde zu sich kam, blutig und zerfetzt. Sie konnte sich bewegen, zuerst die Hände, dann die Arme und schließlich die Beine. Endlich konnte sie einen Beschluß fassen oder zumindest einen Gedanken formen: Heim zur Mutter.
Sie ging langsam durch den Wald, ließ eine blutige Spur hinter sich. Den letzten Kilometer kroch sie auf allen vieren, aber als sie vor der Hüttentür schrie, war ihre Stimme kräftig genug, die Mutter zu wecken.
Zum ersten und einzigen Mal im Leben sah Hanna ihre Mutter weinen. Das Mädchen wurde auf den Küchentisch gelegt, die Mutter wusch und wusch, konnte aber den Blutfluß nicht stillen.
»Gott im Himmel«, sagte Maja-Lisa, immer und immer wieder sagte sie es, bis sie sich endlich zusammennahm und den ältesten Jungen Anna holen schickte, die die Hebamme in der Gegend war und Maja-Lisa oft genug im Kindbett geholfen hatte. Sie war auch geschickt im Blutstillen.
»Schnell, schnell!« schrie sie dem Jungen nach.
Dann wollte sie dem Mädchen die zerrissenen Kleider ausziehen, besann sich aber. Ihr war selbst in ihrem wilden Zorn doch auch eingefallen, daß Anna nicht nur Hebamme war, sie war auch diejenige, die mit den schlimmsten Geheimnissen des Dorfes von Hütte zu Hütte rannte.
Hanna schlief oder war bewußtlos, Maja-Lisa konnte das nicht genau feststellen. Die Küche sah aus wie ein Schlachthaus, und immer lauter rief sie Gott um Barmherzigkeit an, während die Kinder rundum sich Augen und Ohren zuhielten.
Dann endlich kam Anna, tatkräftig und besonnen. Sie hatte feingeriebene Tormentillwurzel dabei, vermischte sie mit Rindertalg und Schweinefett, und rieb den Unterleib des Mädchens mit der Salbe ein.
Hanna wachte während der Behandlung auf und fing leise an zu wimmern. Die Hebamme beugte sich über das Kind und fragte:
»Wer?«
»Der schwarze Rickard«, flüsterte das Mädchen.
»Hab ich's mir gedacht«, sagte Anna grimmig. Dann gab sie dem Kind zu trinken, einen Sud aus Mistel und weißer Taubnessel. Jetzt müßte das Bluten aufhören und einen Schlaf schenken, tief wie der Tod, sagte sie. Aber Gott weiß, ob sie je wird Kinder kriegen können. Und heiraten wird sie keiner.
Maja-Lisa machte dabei kein trauriges Gesicht und ahnte doch nicht, daß sich beide Weissagungen Annas als falsch herausstellen würden. Jetzt schickte sie die Kinder ins Bett in die Kammer, kochte Kaffee, räumte die Küche auf und entdeckte, daß das Gewehr nicht mehr an der Wand hing und August verschwunden war.
Da fing sie wieder an zu schreien, die Kinder kamen aus der Kammer gerannt, aber Anna, die Maja-Lisas Blick gefolgt war, schnaubte: »Männer! Beruhig dich, Weib, da können wir nix machen.«
»Er endet noch auf der Festung!« schrie Maja-Lisa.
»Glaub kaum, daß es ihm gelingen wird.«
Das bewahrheitete sich. Als August nach Lyckan kam, war der Sohn verschwunden. Die beiden Bauern beruhigten sich mit Branntwein und beschlossen, der Junge müsse zur Heirat gezwungen werden, sobald Hanna heiratsfähig sei, und daß sie bis dahin als Tochter im Haus zu respektieren sei.
Aber aus der Übereinkunft wurde nicht viel. Hanna sagte, lieber ginge sie in den Fluß, bevor sie diesen Rickard heiraten würde, Maja-Lisa verbiß sich ihre Machtlosigkeit, und Lovisa konnte ihrem Sohn auf geheimen Pfaden die Botschaft zukommen lassen, er möge sich um Christi willen vom Hof fernhalten. Die alte Anna sprach vom Bezirksrichter und sagte, daß man von einem gehört hatte, der zum Tod verurteilt worden war, nachdem er einer Dienstmagd Gewalt angetan hatte.
Aber weder August noch Maja-Lisa wollten der Verwandtschaft auf Lyckan solche Schmach antun.
Das Gerede in den Hütten ließ nicht nach, die Leute begannen Lovisa und Lyckan zu meiden. Bis eines Tages offenkundig wurde, daß Hanna schwanger war und man immer mehr zu dem Schluß kam, daß sie wohl doch nicht gar so unwillig gewesen sein mußte, das Mädchen. Und das Getuschel, sie sei grausig zugerichtet, das sei glatt erlogen. Die alte Anna hatte wohl wie üblich den Schnabel mal wieder gehörig gewetzt.
Als die Monatsregel zum zweitenmal hintereinander ausblieb, sagte sich Maja-Lisa wohl hundertmal am Tag, das kommt, weil dem Mädchen der Unterleib zerrissen worden ist. Aber eines Morgens fing das Kind an sich zu übergeben.
Maja-Lisa ging mit dem Mädchen zu Anna. Die Hebamme drückte ihr auf dem Bauch herum, machte große Augen und sagte, auf Gottes Wege verstünde sie sich nun mal nicht. Dann suchte sie die Waldlichtung auf, wo die wilde Petersilie wuchs, kochte einen Sud aus dem Kraut, mußte aber feststellen, daß er dem Balg in Hannas Bauch nichts anhaben konnte.
»Ist schon zu weit«, sagte sie.
Kaum dreizehn Jahre alt, am fünften Juli, gebar Hanna ihr Hurenkind, einen prächtigen Jungen mit schwarzen Augen. Er tat sich schwer mit dem Loslassen, und es wurde eine lang dauernde und schwere Entbindung. Als er endlich auf der Welt war, befiel sie eine seltsame Zärtlichkeit für den Buben.
Obwohl er seinem Vater glich.
Das Gefühl war so erstaunlich, daß sie nicht anders konnte, als sich den Beschlüssen zu beugen, die gefaßt werden mußten. Sie wußte ja, daß der Hof der Eltern nicht zwei weitere Münder sättigen konnte. Sie mußte zurück nach Lyckan. Der Bauer dort versprach ihr hoch und heilig, sie werde wie eine Tochter gehalten werden, und soweit er vermochte, stand er zu seinem Versprechen. Er gewann den Buben lieb, der schnell wuchs und in die Welt hinein lachte. Es war seltsamerweise ein glückliches und kräftiges Kind.
Hanna arbeitete ebenso hart wie zuvor, und Lovisa war nicht freundlicher, obwohl sie viel von Barmherzigkeit redete, seit sie von diesem Sektenbruder bekehrt worden war, der einmal im Monat kam und seine Schäfchen in der Scheune des Nachbargehöfts um sich scharte.
Alle drei warteten sie auf Rickard, aber keiner sprach je ein Wort über den Verschwundenen. Dann ging das Gerücht im Dorf um, er sei in der Gegend irgendwo gesehen worden.
Zu der Zeit beschloß Hanna, flußaufwärts zum Runenmeister im Wald hinter der Teufelskluft zu gehen. Sie hatte lange darüber nachgedacht, hatte sich aber abschrecken lassen durch böses Geraune über den Alten und sein Hexenweib.
Jetzt bat sie den Bauern, sich um das Kind zu kümmern. Es war Sonntag, und sie sagte, sie wolle zur Kirche. Er nickte zustimmend, es sei gut, daß jemand vom Hof Gott dort aufsuchte, wo er zugegen war, sagte er mit einem boshaften Blick auf seine Frau. Lovisa schrie ihr nach, sie dürfe das Hurenbalg nicht vergessen, wenn sie ins Haus Gottes wolle.
Es war eine gute Meile bis zur Kirche am Flußufer, und dann ging es am Wasserfall vorbei steil bergauf. Danach, im ruhigen Gewässer, fand sie die Furt, und dann war es nur noch eine Wanderung von einer halben Stunde durch den Wald zur Berghütte am Ende des Pfades. Sie fand hin, denn sie war als Kind mit der Mutter dort gewesen und hatte schwören müssen, es niemals jemandem zu erzählen. Ihr Herz klopfte laut vor Angst, aber die beiden Alten empfingen sie ohne Erstaunen. Sie wolle einen Runenstab haben, nahmen sie an. Das Mädchen wagte nicht zu sprechen, nickte aber und schaute ängstlich in die Stubenecke, wo das Runenvolk, wie es hieß, das abgeschnittene Glied eines Mörders aufbewahrte, der vor vielen Jahren auf dem Galgenberg gehenkt worden war.
Sie sah sofort, daß es kein männliches Glied war. Nein, es stammte von einem Hengst und konnte sie nicht schrecken. Solche hatte sie schon öfter im letzten Winkel von Hütten gesehen, wo der Kindersegen ausblieb.