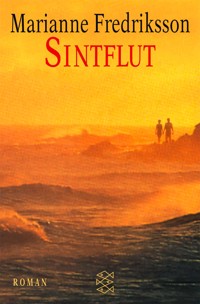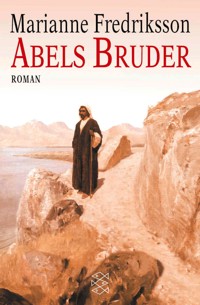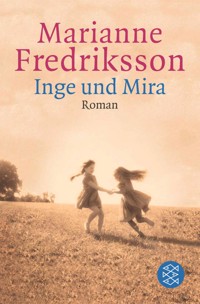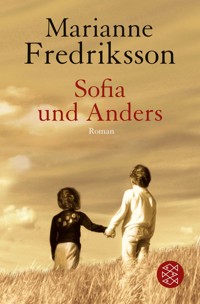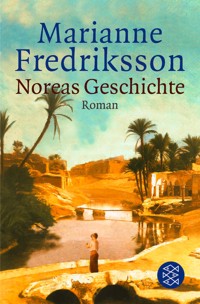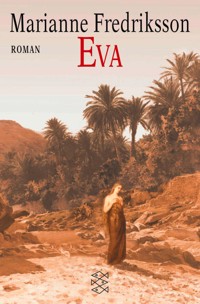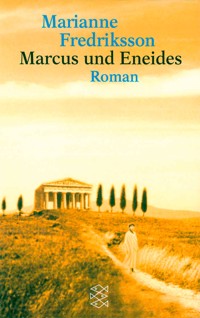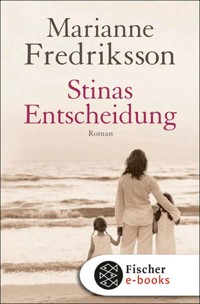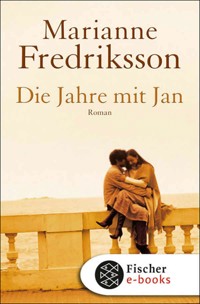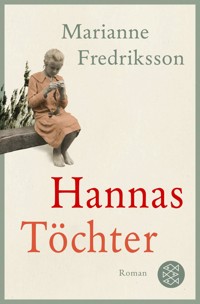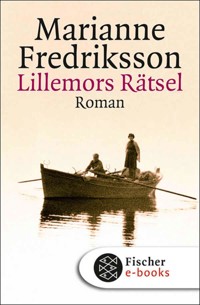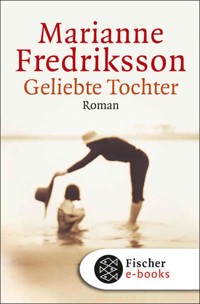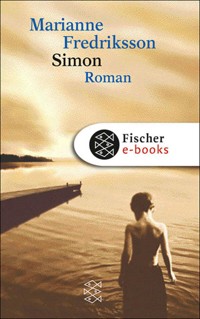
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Marianne Fredriksson erzählt auf wunderbar einfühlsame und sensible Weise die zugleich gewöhnliche und zutiefst außergewöhnliche Lebensgeschichte eines Jungen und seiner Familie in einer schicksalsschweren Zeit. Als der Zweite Weltkrieg seine Schatten auch auf die Küste vor Göteborg wirft, ist Simon noch ein kleiner Junge, und er ist jüdischer Abstammung. Karin und Erik, seine Adoptiveltern, verschweigen ihm seine Herkunft, um ihn zu schützen. So begibt sich der sensible Junge selbst auf die Suche nach seinen Ursprüngen. ›Simon‹ ist in seiner erzählerischen Kraft und Eindringlichkeit ebenso einzigartig dircht und ergreifend wie ›Hannas Töchter‹.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Marianne Fredriksson
Simon
Roman
Aus dem Schwedischen von Senta Kapoun
Fischer e-books
Für Ann
1
Eine von oben bis unten gewöhnliche Eiche«, sagte der Junge zu dem Baum. »Knapp fünfzehn Meter hoch, was zum Angeben nicht gerade viel ist.«
»Und hunderttausend Jahre bist du auch nicht alt. Vielleicht so ungefähr hundert«, schätzte er und dachte an seine Großmutter, die fast neunzig und auch nichts weiter als eine ganz gewöhnliche unzufriedene alte Frau war.
Benannt, vermessen und verglichen verlor der Baum an Großartigkeit für den Jungen.
Aber dennoch konnte er in der mächtigen Krone ein wehmütiges und vorwurfsvolles Rauschen hören. Da blieb ihm nur Gewalt, und er schlug den großen Stein, den er schon lange in seiner Hosentasche mit sich herumtrug, fest in den Stamm.
»Das hast du davon, und jetzt schweig«, brummte er.
In diesem Augenblick wurde der große Baum still und der Junge, der wußte, daß etwas Wesentliches geschehen war, schluckte den Kloß im Hals herunter und achtete nicht auf seine Trauer.
Es war der Tag, an dem er Abschied von seiner Kindheit nahm. Er tat es zu einer bestimmten Stunde und an einem bestimmten Ort, und deshalb würde er sich immer daran erinnern. Und viele Jahre lang würde er darüber nachgrübeln, was es gewesen war, worauf er an diesem Tag in dieser sehr fernen Kindheit verzichtet hatte. Mit zwanzig sollte er eine Ahnung davon bekommen, und von da an würde er sein Leben lang versuchen, das Verlorene wiederzufinden.
Doch jetzt stand der Junge auf dem Felsen hinter Äppelgrens Garten und sah aufs Meer hinaus, wo sich der Nebel zwischen den kleinen Inseln verdichtete, um sich dann langsam auf die Küste zuzuwälzen. Im Land seiner Kindheit hatte der Nebel viele Stimmen, von Vinga bis Älvsborg sangen an einem Tag wie diesem die Nebelhörner.
Hinter sich hatte er den Berg und die Wiese mit dem Land, das es eigentlich nicht gibt. Am Ende der Wiese, wo der Boden tiefer wurde, lag der Eichenwald, dessen Bäume all die Jahre zu ihm gesprochen hatten.
In ihrem Schatten war er dem kleinen Mann mit dem seltsamen runden Hut begegnet. Nein, dachte er, so war es nicht. Er hatte den Mann immer gekannt, aber im Schatten der Laubbäume hatte er ihn auch gesehen.
Das konnte ihm jetzt gleichgültig sein.
»War alles nur Quatsch«, sagte der Junge laut und kroch unter dem Stacheldraht von Äppelgrens Zaun hindurch.
Er entging der Frau, Edit Äppelgren, die an einem Vorfrühlingstag wie diesem aus schnurgeraden Beeten Unkraut zu reißen pflegte. Die Nebelhörner hatten sie ins Haus getrieben, sie vertrug keinen Nebel.
Der Junge verstand das. Der Nebel war die Trauer des Meeres und ebenso unendlich wie das Meer. Eigentlich unerträglich …
»Quatsch«, sagte er dann, denn er wußte es ja besser, hatte er doch soeben beschlossen, die Welt so zu sehen, wie andere Leute sie sahen. Der Nebel war die Wärme des Golfstroms, die in den Himmel stieg, wenn die Luft sich abkühlte.
Das war alles.
Aber so ganz konnte er die Traurigkeit, die im langgezogenen Heulen der Nebelhörner an der Hafeneinfahrt lag, nicht abstreiten, als er Äppelgrens Rasen überquerte und zu Hause in die Küche schlüpfte. Dort bekam er heiße Schokolade.
Er hieß Simon Larsson, war elf Jahre alt, klein von Wuchs, mager und von etwas dunklerer Hautfarbe als andere. Seine Haare waren borstig, braun, fast schwarz, und die Augen so dunkel, daß es manchmal schwierig sein konnte, die Pupillen zu erkennen.
Das Andersartige an seinem Aussehen war ihm bisher nie aufgefallen, denn bis zu diesem Tag waren ihm Vergleiche kein Anliegen gewesen, und er war dadurch vielen Qualen entgangen. Er dachte an Edit Äppelgren und ihre Schwierigkeiten mit dem Nebel. Aber vor allem dachte er an Aron, ihren Mann. Simon hatte Aron immer gern gemocht.
Als Junge war Simon ein kleiner Ausreißer gewesen, eines von diesen Kindern, die wie übermütige junge Hunde den Lockungen der Landstraße erliegen. Es konnte mit einem grellbunten Bonbonpapier im Straßengraben vor dem Zaun beginnen, mit einer leeren Zigarettenpackung weitergehen, und dann lag irgendwo eine Flasche und dann noch eine, und dort blühte eine rote Blume und weiter weg lag ein weißer Stein und dann tauchte vielleicht schattenhaft irgendwo eine Katze auf.
So kam es, daß er sich weiter und weiter von daheim entfernte, und er erinnerte sich sehr deutlich daran, wie ihm bewußt wurde, daß er verloren war. Das war, als er die Straßenbahn erblickte, groß und blau auf rumpelnder Fahrt aus der Stadt heraus. Er war fast von Sinnen vor Schreck, aber genau in dem Augenblick wo er den Mund öffnete um zu schreien, stand Aron vor ihm.
Und Aron beugte sich mit seiner langen Gestalt über den Jungen und seine Stimme kam wie aus dem Himmel als er sagte: »Guter Gott, Junge, willst du schon wieder ausreißen.«
Dann hievte er Simon auf den Gepäckträger seines schwarzen Fahrrads und begann heimwärts zu gehen. Er sprach von den Vögeln, von dem dicken Buchfinken und den geschäftigen Kohlmeisen und von den Spatzen, die im Staub der Landstraße ganz in ihrer Nähe herumhüpften. Für sie hatte er nur Verachtung übrig, fliegende Ratten, sagte er.
Im Frühling gingen sie zusammen über die Weiden und der Junge lernte das Lied der Lerchen erkennen. Danach sang Aron mit dröhnender Stimme ein Lied, das die Hänge bergab rollte und als Echo von den Klippen zurückkam: »Wenn der Früüühling in den Bergen …«
Am schönsten war es, wenn Aron pfiff. Er konnte jeden Vogelruf nachmachen, und der Junge platzte fast vor Spannung, wenn Aron das Amselweibchen zum Antworten brachte, sehnsüchtig und willig. Dann grinste Aron sein breites, gütiges Grinsen.
Nun war es aber so, daß das Vogellied, das alle anderen zwischen den Felsen dort an der Flußmündung übertraf, das Schreien der Möwen war. Aron konnte auch sie nachmachen, und es kam vor, daß er sie bis zum Irrsinn reizte und sie sich wütend auf den Mann und den Jungen herabstürzten.
Da mußte Simon so sehr lachen, daß er fast in die Hose gemacht hätte. Auch die Nachbarn, die auf dem Weg geschäftig vorbei eilten, blieben stehen und verzogen den Mund über den großen Mann, der ebensoviel Spaß hatte wie der kleine Junge. »Aron wird nie erwachsen«, sagten sie.
Aber das hörte Simon nicht. Bis zu diesem Tag war Aron in seiner Welt König gewesen.
Jetzt saß der Junge am Küchentisch vor seinem mehr als süßen Kakao und sah Aron so, wie andere Leute ihn sahen. Begriff vor allem, daß die seltsame Fähigkeit des Mannes, ihn, Simon, zu retten, wenn er sich als kleiner Junge verlaufen hatte, mit Arons Arbeitszeiten zusammenhing. Simon war nach dem Frühstück ausgerissen, Aron hatte zumeist erst in den Morgenstunden Arbeitsschluß und war gerade aus der Straßenbahn gestiegen, als der Junge an der Haltestelle ankam und feststellen mußte, daß er sich verlaufen hatte. Aron hatte dort sein Fahrrad stehen und, wie es eben so war, stand manchmal auch dieses merkwürdige Kind dort, das sich so oft verirrte.
Plötzlich sah Simon die Verachtung, das schiefe Grinsen und die abgehackten Worte, die Aron seit jeher von sich gegeben hatte. Er war Rausschmeißer in einer schlecht beleumundeten Hafenkneipe und hatte einen Spitznamen, den Simon nicht verstand, der aber so gemein war, daß seine Mutter, wenn sie ihn hörte, vor Ärger rot anlief.
Simon mußte wiederum an Tante Äppelgren denken, die dauernd saubermachte und eine so feine Küche hatte, daß er dort nie hineingehen durfte. Er glaubte zu verstehen, daß man Küche und Gartenbeete so adrett halten mußte, wenn man einen Mann mit einem widerwärtigen Spitznamen hatte, der die Frauen erröten ließ.
Als Simon das letzte Stück Hefebrot gekaut und die Kakaotasse mit dem Löffel ausgekratzt hatte, dachte er, daß Aron den Schritt nie getan hatte, den er heute vollzog. Aron Äppelgren hatte nie auf einem Felsen gestanden und Abschied von seiner Kindheit genommen.
Die Küchenbank diente dem Jungen als Bett. Das ließ ihn zum Sozialisten werden.
Es war eine geräumige Küche, sonnig, mit großen Sprossenfenstern nach Westen und Süden, mit weißen Gardinen, Topfpflanzen drinnen und alten Apfelbäumen draußen. Unter dem Südfenster befand sich das eingelassene Zinkbecken mit dem Kaltwasserhahn, in der Ecke gegenüber stand der eiserne Herd und daneben die Holzkiste mit dem zweiflammigen Spirituskocher darauf. An der langen Wand unter dem anderen Fenster nahm die Küchenbank ihren Platz ein, blau gestrichen wie die Stühle, und davor stand der große Küchentisch mit dem Wachstuch am Werktag und einer bestickten Baumwolldecke an den Sonntagen.
Kochfleisch, häufig Suppe. Kaffee. Selbstgebackenes, gute Düfte am Mittwoch, wenn das weiße Hefebrot aus dem Ofen kam. Nachbarschaftsklatsch. Man konnte jedes Wort von der Holzkiste aus in sich aufsaugen, wenn man sich klein und unsichtbar machte, die endlosen Gespräche über all das, was um ein Haar hätte passieren können, oder wer ein Kind erwartete und wer einem leid tun mußte.
Es konnten einem viele leid tun, eigentlich sogar alle. Der Junge lernte Mitleid zu haben anstatt Abneigung zu empfinden. Dadurch kam ihm der Zorn so frühzeitig abhanden, daß er eigentlich nie damit umgehen lernte. Es gab ihn, manchmal versuchte er in seinem Leben einen Aufschrei, aber immer zu spät und immer an der falschen Stelle.
Er wurde ein lieber Junge.
Er selbst hatte es gut, das brachte man ihm früh und so gründlich bei, daß er im Verlauf der Jahre nie auf die Idee gekommen wäre, sich selbst leid zu tun.
Da gab es diesen Hansson, der arbeitslos war und aus diesem Grund seine Frau jeden Samstag schlug, wenn er seine Schnapsration zugeteilt bekommen hatte. Da war Hilma, die zwei Töchter im Sanatorium hatte, und deren Jüngste bereits an der Schwindsucht gestorben war. Und dann war da Anderssons schöne Tochter, die immer neue Kleider trug und in der Stadt auf den Straßen herumging.
Aber als die Nachbarn dahinterkamen, was sie auf den Straßen machte, warfen sie den jungen Mann, der bei ihnen wohnte, hinaus. Die Frauen hatten Angst vor unehelichen Kindern.
Die Männer waren anders. Das war das Schöne am Schlafen auf der Küchenbank. Am Abend saßen die Männer in der Küche, Bier statt Kaffee, Politik statt Gerede über allzu Menschliches, und dann dieses verdammte Auto, das wieder seine Mucken hatte.
Anderssons hatten ein Fuhrunternehmen, aber das hieß nur, daß sie ein Lastauto besaßen. Es beförderte tagsüber Holz zu den Baustellen im Umfeld der wachsenden Stadt. Und Lebensmittel für die Haushalte. Nachts wurde es repariert, denn die Lager holperten, und die Ventile mußten immer wieder nachgeschliffen werden, und das Getriebe war auch schon fast hinüber.
Sachkundig waren sie beide, der Vater und der Onkel. Sie wechselten aus, schmiedeten und fertigten neu. Die Freude war groß, als sie eines Tages einen sechszylindrigen Motor als Ersatz für den alten ausgeleierten vierzylindrigen ergatterten. Aber der Tausch zwang sie dazu, die Kardanwelle zu verlängern, wofür sie ein zusätzliches Kreuzgelenk brauchten. Da sie hartnäckig an der bewährten Zahnradübersetzung festhielten, hatten sie bald ein Auto, das die steilsten aller steilen Straßen der Stadt hinauftuckern konnte. Und das sogar bei Glatteis.
Das Auto war mit der Zeit fast bis ins kleinste Detail von Hand gefertigt. Zwar stand Dodge auf der Kühlerhaube, aber man konnte sich fragen, ob wesentlich mehr als die prächtige rote Karosserie noch aus Detroit stammte.
Sie machten jeden Abend um zehn Uhr mit einer Flasche Bier und den Spätnachrichten im Radio, das auf einem Schemel am Fußende des Küchensofas stand, eine Pause. Am Kopfende lag Simon unter einem rosafarbenen Zelt, einem Stück rotweißkariertem Stoff, das zwischen der Klappe und der Rückwand des Sofas gespannt und an den vorderen Füßen eingehakt wurde, wenn der Junge sich hingelegt hatte und man davon ausging, daß er schlief.
Auf diese Weise erfuhr er von dem Schreckgespenst, das aus dem Herzen Europas herankroch und Hitler hieß. Manchmal hörte man diesen Hitler persönlich im Radio brüllen, und die Deutschen schrien ihr Heil, und danach sagte der Vater, daß früher oder später alles beim Teufel sein werde und bald alles nur noch ein Scherbenhaufen, was die Arbeiter und Per Albin aufgebaut hatten.
Einmal kam ein Mann mit einer Sonderanfertigung handgeschmiedeter Muttern, er habe sie aus reiner Herzensgüte angefertigt, sagte die Mutter, nachdem der Vater ihn hinausgeworfen hatte.
»Herzensgüte!« schrie der Vater. »Ein Judenhasser, ein Nazi in meiner Küche! Bist du nicht gescheit, Frau!«
»Du wirst mit deinem Geschrei noch den Jungen wecken«, mahnte sie.
»Dem können schlimmere Dinge passieren als das«, sagte der Vater, doch da begann die Mutter zu weinen und der Streit verebbte bald in beruhigenden Worten.
Unter dem Zelt auf dem Sofa lag der Junge und fürchtete sich und versuchte zu begreifen. Jude. Das Wort hatte man ihm in der Schule nachgeschrien. Sein Vater war blaß geworden, als Simon es erzählt hatte, und an einem unglaublichen aber wunderbaren Abend hatte er dem Jungen gezeigt, wie man seine Fäuste gebraucht. Stunde um Stunde hatten sie im Keller geübt, gerade Rechte, schneller linker Haken und dann ein Uppercut, wenn die Lage es erforderte.
Am nächsten Tag hatte der Junge sein Können in der Schule ausprobiert, und seither hatte er das Wort nicht mehr gehört.
Erst heute abend wieder.
2
Simon hatte eine gute Mutter.
Das durfte nicht vergessen werden, denn ihre Güte war irgendwie immer vorhanden. Sie gestaltete die Welt, in der der Junge aufwuchs.
Die Mutter war auch schön, war hochgewachsen und blond, hatte einen großen empfindsamen Mund und überraschenderweise braune Augen.
Ihre Güte war nicht von dieser aufdringlichen Art, sie besaß eigene Kräfte und war nicht bedroht von fremden Einflüssen. Karin war vielleicht einer jener seltenen Menschen, die wissen, daß Liebe nicht auf künstlichem Nährboden herangezüchtet werden kann.
Weil Liebe nichts anderes ist als ein Nichtvorhandensein von Angst.
Sie hatte auch begriffen, daß gegen die Angst, die das Leben der Menschen durchzittert, nur selten etwas unternommen werden kann, daß kein Mensch einem anderen innerlich helfen kann. Und daß dies der Grund ist, warum Trost so unendlich notwendig ist.
Also war sie diejenige, bei der alle Schutz suchten. Es gab nicht eine geplagte Frau, nicht einen Mann, die in ihrer Küche nicht Kaffee und Zuspruch bekamen. Ganz zu schweigen von all den Kindern, denen etwas zugestoßen war, und die sich hier ausweinen und Kakao trinken konnten.
Sie trocknete keine Tränen und dachte sich keine Lösungen aus. Aber sie konnte zuhören.
Sie war nicht auf Dank aus, ihre Geduld und ihr großes Herz schenkten ihr wenig Freude. Es war im Gegenteil eher so, daß das ganze Elend des Lebens, dem in ihrer Küche Trost zuteil wurde, ihre Trauer noch vermehrte. Aber sie bekäme dadurch, wie sie sagte, neuen Auftrieb für ihre sozialistische Überzeugung, weil nämlich Menschen einander wie Tiere behandeln, wenn sie selbst wie Tiere behandelt werden. Wie alle guten Menschen glaubte Karin nicht an das Böse. Es war zwar vorhanden, aber nicht als das Böse an sich, es war nur ein Irrtum, der in Ungerechtigkeit und Unglück wurzelte.
Der Junge wurde gerecht behandelt und war glücklich. So konnte er der Flut düsteren Schmerzes und roter Traditionen standhalten. Er wollte es nicht wahrhaben, aber manch alte Schuld gab dem Schmerz Nahrung.
Die Ågrensche hatte acht Kinder und haßte sie alle. Simon war vermutlich der einzige Mensch im Dorf, der sich zu ihr hingezogen fühlte. Das ging sogar so weit, daß er sich mit einem ihrer Söhne anfreundete. Es war keine einfache Freundschaft. Wie alle Ågrenkinder war der Junge hinterhältig und mißtrauisch.
Aber die Freundschaft verschaffte Simon Zutritt zu Ågrens Küche, und da er das Talent hatte, sich unsichtbar zu machen, konnte er den Haß beobachten und belauschen. Dieser Haß war so voller Kraft, daß er dauernd überkochte und jeden erfaßte.
»Verdammte Kuh!« schrie die Ågren ihre älteste Tochter an, die sich vor dem Küchenspiegel kämmte. »Was nützt dir das schon, du siehst aus wie eine elende Kuh und bist so dürr, daß du nicht mal das Geld für den Schlachter wert bist. Glaub bloß nicht, daß einer Lust kriegt, dich zu decken.«
Gegen ihre Töchter war sie besonders gemein, die Söhne bekamen ihr Fett eher beiläufig ab.
»Euch hab ich für meine Sünden gekriegt«, schrie sie. »Raus aus meiner Küche, damit ich euch aus den Augen hab.«
Eines Tages erblickte sie Simon, und plötzlich stand er im Brennpunkt ihres Hasses: »Du Satansbraten«, sagte sie langsam, leise, gedehnt. »Zur Hölle mit dir und nimm deine verdammte scheinheilige Mutter gleich mit. Aber vergiß sie ja nicht vorher zu fragen, wo sie dich her hat.«
Simon holte tief Luft als er merkte, wie sein Zorn sich an ihrem entzündete. Aber er fand keine Worte, sondern stürzte ins Freie und lief zum Strand und den Felsen am Badeplatz. Es war Herbst, die See war grau und böse und half ihm, Worte zu finden. »Du Aas«, sagte er. »Du verdammtes Aas.«
Aber das war nicht genug, er mußte schnell handeln. Er schnitt ihr die Brüste ab, schlug ihr die Augen ein. Dann trampelte er sie tot.
Danach fühlte er sich merkwürdig erleichtert.
Die Ågrensche war nicht alt. Aber sie hatte in dreizehn Jahren vier Fehlgeburten gehabt und acht Kinder geboren, und sie hatte jedes einzelne schon in ihrem Leib gehaßt. Die verdammten Gören fraßen sie auf, verschlangen ihr Leben, zerhackten ihre Nächte und erfüllten ihre Tage mit gallebitterem Verdruß. Sie nahmen ihr jegliche Selbstachtung und jegliche Freude. Nur der Zorn hielt sie aufrecht, ermöglichte gekochtes Essen und saubere Kleider für Mann und Kinder.
»Sie ist wie eine samende, überreife Gurke«, sagte Karin. »Das ist ihr Unglück.«
Selbst schob die Frau alles auf Ågren, den liederlichen Teufel. Aber immerhin brachte er jeden Freitag eine volle Lohntüte nach Hause, und so wagte sie nicht wirklich, sich gegen ihn aufzulehnen.
Sie hatte sich schon sehr jung mit einem netten Mann in geordneten Verhältnissen verheiratet, einem Mann im Dienste der Krone, einem Zöllner. Viele hatten das für ein großes Glück gehalten, und sie selbst hatte irgendwann vielleicht von einem guten Leben in dem neuen Haus am Meer geträumt.
Dann, an einem Frühlingstag ging die älteste Tochter ins Wasser. Sie war sechzehn Jahre alt, doch als die Polizei den Leichnam fand, stellte sich heraus, daß sie schwanger war. Beim Krämer sagte die Ågrensche, sie sei froh, daß das Mädel Verstand genug gehabt hatte, sich umzubringen, sonst hätte sie, die Mutter, die verdammte Hure eigenhändig erwürgen müssen.
Danach ging sie heim und hatte eine Fehlgeburt.
Zum Winter hin wurde ihr Bauch wieder dick, aber dieses Mal war es kein Kind. Die Ågrensche starb im siebenunddreißigsten Lebensjahr an einem Krebs, der ebenso verheerend war wie ihr Haß.
Simon trauerte um sie. Und als Ågren sich ziemlich bald mit einer ganz gewöhnlichen Frau wiederverheiratete, einer Frau, die untertänig war, alles sauber hielt und Plätzchen buk, hörte der Junge mit seinen Besuchen in diesem Haus auf.
Jetzt aber war der Abend des Tages gekommen, an dem Simon sich entschlossen hatte, erwachsen zu werden. Gegen den Nachmittag hin hatte sich der Nebel gelichtet. Der helle Maihimmel vor dem Küchenfenster färbte sich durch den rotweißkarierten Stoff über dem Küchensofa rosa, während er dort lag und an seinen Entschluß dachte.
Er hatte es für seine Mutter getan, soviel war sicher. Aber er hatte die Worte nicht gefunden, die es ihr hätten erklären sollen, und so mußte er auf die Belohnung verzichten, die darin bestanden hätte, daß die Trauer in ihren braunen Augen verschwunden wäre.
Diese Traurigkeit war das einzig wirklich Gefährliche im Leben des Jungen, das einzig Unerträgliche. Er sollte es erst viel später verstehen, dann, wenn er erwachsen und sie bereits tot war, daß ihre Trauer kaum etwas mit ihm zu tun gehabt hatte.
Er konnte sie fröhlich machen. Er hatte sich im Laufe der Jahre viele Tricks ausgedacht, die den Glanz eines Lachens in ihren braunen Augen hervorriefen. Trotzdem glaubte er immer, daß er es war, der sie traurig machte.
Einige Tage zuvor hatten sie erfahren, daß Simon in die Oberschule aufgenommen worden war. Er war der erste in der Familie, der studieren sollte. Obwohl er erst elf war, hatte er selbst die Antragsformulare ausgefüllt und war allein den weiten Weg zur von den Eltern sogenannten Hochmutschule geradelt, als die Zeit für die Aufnahmeprüfung gekommen war.
Der Junge hatte den Freudenschimmer in den Augen der Mutter gesehen, als er mit der Nachricht, daß er aufgenommen worden war, nach Hause kam.
Dieser Schimmer erlosch aber sofort, als der Vater sagte: »So, aus dir soll also etwas werden. Und ich soll’s natürlich bezahlen. Bist du sicher, daß wir uns das leisten können?«
»Das mit dem Geld wird schon in Ordnung gehen«, antwortete die Mutter. »Aber der Rest ist deine Sache. Schließlich war es auch dein Einfall.«
Einige Jahre später, in den Jahren der Reife, sollte Simon sie beide für die Worte hassen, die an diesem Abend in der Küche gefallen waren. Und auch wegen der Einsamkeit, die folgte. Doch später im Leben begann er seine Eltern zu verstehen. Ihre zwiespältige Einstellung zur bürgerlichen Schule, die die begabten Kinder verschlang und damit die Arbeiterklasse von innen heraus aushöhlte. Zu dieser Zeit begann er auch ihre Gefühle zu erahnen, wenn sie zusammen beim Essen saßen und vage begriffen, daß nun ihr Junge sie überholen würde.
Aber man wollte ja, daß die Kinder es besser hätten.
Als Karin damals den Tisch abgeräumt und das Wachstuch saubergewischt hatte, nahm Erik sich das Wirtschaftsbuch vor und setzte sich mit den terminbedingten Ausgaben auseinander. Dann berechnete er die Ausgaben für Schulbücher und Straßenbahn und machte ein bekümmertes Gesicht. Aber das war wie bei vielen Dingen eher ein Ritual, sie hatten eigentlich nicht zu wenig Geld.
Nur diese ewige Angst vor der Armut.
Die Mutter dachte wohl kaum an das Geld. Aber ihr war nicht wohl zumute, und ihre Augen wurden schwarz vom Gewicht ihrer Worte, als sie sagte: »Dann muß eben Schluß sein mit den Träumen.«
Vielleicht galt ihre Sorge etwas ganz anderem als dem, daß Simon die Schule nicht schaffen könnte, vielleicht dachte sie vielmehr daran, daß ihr Junge jetzt einer von der Sorte Mensch werden würde, die weder das eine noch das andere waren, Menschen, die aus eigener Kraft entweder etwas werden oder untergehen mußten.
Doch Simon hörte nur die Worte, und jetzt lag er dort auf der Küchenbank und dachte darüber nach, wie sehr Karin sich freuen würde, wenn er ihr nur in irgendeiner Weise sagen könnte, daß er ein Kind wie alle anderen sein wollte, nur eben noch ein bißchen mehr und ein bißchen besser. Denn er hatte ja gemerkt, daß sie stolz auf die guten Zensuren war und auf die Worte der Lehrerin beim Schulabschluß im vergangenen Jahr.
»Simon ist sehr begabt«, hatte sie gesagt.
Der Vater hatte gegrunzt, er wehrte sich gegen das Wort. Und dann genierte er sich auch für die Lehrerin. So etwas zu sagen, wenn der Junge zuhörte, das war wohl mehr als dumm.
»Der Junge kann doch eitel werden«, sagte er, als sie gemächlich heimgingen. Es war die Zeit, als die Baumblüte gerade begonnen hatte. »Begabt«, sagte er, ließ das Wort über die Zunge gleiten, spuckte es aus.
»Er ist tüchtig«, betonte Karin.
»Klar ist er tüchtig«, sagte Erik. »Schließlich gerät er uns nach.«
»Und du redest von Eitelkeit«, lachte die Mutter, aber ihr Lachen klang glücklich.
Der Junge war immer ein Bücherwurm gewesen, wie man so sagt. Das war eine Eigenart, die so hingenommen wurde wie auch sein kleiner Wuchs und seine schwarzen Haare. Aber sie durfte nicht in Übertreibung ausarten.
Simon hatte schon in den ersten Sommerferien alle Bücher im Haus verschlungen.
Er erinnerte sich an eine Frau, die ihn mit ›Gösta Berling‹ im guten Zimmer auf dem Sofa entdeckt hatte: »Liest der Junge doch Lagerlöf …« Die Stimme hatte vorwurfsvoll geklungen.
»Man kann ihn nicht davon abhalten«, sagte Karin.
»Aber er kann ein solches Buch doch nicht verstehen.«
»Etwas muß er wohl verstehen, sonst würde er ja nicht weiterlesen.«
Mamas Stimme bat nicht etwa um Entschuldigung, aber die andere Frau hatte trotzdem das letzte Wort. »Glaub mir, das kann auf keinen Fall gut für ihn sein.«
War bei Karin ein Anflug von Unruhe zu bemerken gewesen? Vielleicht, denn sie mußte es dem Vater erzählt haben, der zu Simon sagte: »Glaube nur nicht, daß die Welt aus Herrenhoffräuleins und verrückten Pfarrern besteht. Lies lieber Jack London.«
Und Simon las Jack Londons gesammelte Werke, marmorierte braune Bände mit rotem Leinenrücken. Aus dieser Zeit waren ihm noch einige Figuren in Erinnerung geblieben, Wolf-Larsen, ein Geistlicher, der Menschenfleisch aß, ein wahnsinniger Geigenspieler. Und einige Bilder, der lange See von Löven und die Slums in East End.
Der Rest versank im Unterbewußtsein und trug dort reiche Frucht.
Jetzt, mit elf, hatte er den Weg zur Volksbücherei in Majorna gefunden, sein Verlangen war nun weniger brennend, wie das eben so ist bei einem, der weiß, daß er nicht mehr entbehren muß. Er war jetzt auch vorsichtiger geworden, hatte die Angst in Mutters Gesicht auflodern sehen, wenn sie sich fragte, ob ihr Junge allen Ernstes anders als die anderen sein könnte.
»Lauf raus und beweg dich, bevor das Blut in dir fault,« konnte sie sagen. Es war ein Scherz, aber darin verbarg sich auch Besorgnis.
Einmal fand sie ihn auf dem Dachboden, vertieft in Joan Grants Buch über die Königin von Ägypten, seine Augen starrten Karin von pharaonischen Höhen herab an und er hörte nicht, was sie sagte. Erst als sie ihn durch die Jahrhunderte zurück rüttelte, konnte er sehen, daß sie Angst um ihn hatte.
»Du darfst das Leben nicht einfach so aus den Augen verlieren«, sagte sie.
Es tat noch immer weh, obwohl er versuchte, es zu vergessen.
An diesem Abend machte er sich auf der Küchenbank ihre Frage zu seiner: War vielleicht irgend etwas wirklich bei ihm verkehrt?
Er hatte den Schritt hinüber in die Welt der Vergleiche getan.
Aber am nächsten Tag hatte er fast alles wieder völlig vergessen. Er begleitete seinen Cousin im Kanu hinaus zur Flußmündung, lag dort mit dem Paddel in Bereitschaft und wartete auf die Fähre aus Dänemark. Sie kam so pünktlich, daß man die Uhr danach stellen konnte, und war längst nicht das größte Schiff auf dem Weg in den großen Hafen. Aber im Unterschied zu den Amerikadampfern und den weißen Schiffen aus dem Fernen Osten durfte die Fähre die Mündung in voller Fahrt passieren.
Sie pflügte durch die hohe See, und die Jungen waren inzwischen sehr geschickt in der Kunst, das Kanu in die erste Welle zu lenken und auf ihr bis an den Strand zu reiten.
Da kam sie, schnell und schön. Simon hörte den Cousin vor Spannung aufschreien, als sie sich auf den Wellenkamm zubalancierten. Aber sie näherten sich in einem zu schrägen Winkel, so daß das Kanu zu schwanken begann und die Jungen hinausschleuderte, die mit der Welle in die Tiefe glitten.
Für einen Augenblick war Simon von Furcht gepackt, doch er war wie sein Cousin ein guter Schwimmer. Er wußte, was er zu tun hatte, um nicht in den Sog der nächsten Welle zu geraten und ließ sich mittreiben, widerstandslos, auch von der nächsten und übernächsten.
Als die See sich geglättet hatte, schwammen die Jungen zu ihrem Kanu und bugsierten es an Land. Dort stand die Clique, erschrocken zwar, aber höhnisch.
Doch der Cousin tat sich groß mit der riesigen Woge, die höher gewesen war als jede andere jemals zuvor – das wurde anerkannt und die Ehre war gerettet.
Simon hatte anderes im Sinn: das Bild des Mannes, dem er auf seinem Weg in die Tiefe des Meeres begegnet war. Der Kleine war dort gewesen, dem er am Vortag für immer Lebewohl gesagt hatte.
Zu Hause bekam er Schelte und trockene Kleider. Dann kletterte er den Felsen hinauf, lief über die Wiese zum Eichenwald. Er fand seine Bäume, zwischen zehn und fünfzehn Meter hoch, schweigend, genau wie sie es sollten. Die Abmachung wurde eingehalten, das war gut, und nur das hatte er wissen wollen.
Aber in der Nacht, im Schlaf, begegnete ihm sein Mann wieder, saß auf dem Grund des Meeres und führte lange Gespräche mit ihm. Und als er am nächsten Morgen erwachte, fühlte er sich merkwürdig gestärkt.
Erst viel später am Tag, als er in der Schule bereits die Rechenarbeit abgegeben und noch eine Weile Zeit hatte, fiel ihm ein, daß er vergessen hatte den Mann zu fragen, wer er sei, und merkte, daß er sich an kein Wort von dem erinnerte, was gesprochen worden war.
Es war ein ungewöhnlich warmer Sommer, voller Unruhe. In der Küche verfolgten die Erwachsenen jede Nachrichtensendung im Radio.
»Es sieht düster aus«, sagte der Vater.
»Wir brauchen Regen«, sagte die Mutter. »Die Kartoffeln vertrocknen und der Brunnen gibt kaum noch Wasser.«
Aber der Regen kam nicht, und schließlich mußten sie Wasser kaufen und den Brunnen mit dem Tankwagen auffüllen lassen.
3
Im Herbst begann Simon die Schule genau an dem Tag, an dem Ribbentrop nach Moskau fuhr.
Simon war der kleinste in der Klasse und der einzige, der aus einer Arbeiterfamilie kam. Er konnte sich den Manieren schlecht anpassen, stand nicht auf, wenn der Lehrer mit ihm sprach, sagte ja ohne bitte und danke, und ebenso nein.
»Danke-danke, danke-danke«, spotteten die Mitschüler, und Simon fand es albern. Sah aber ein, daß er lernen mußte, es lernen mußte für die Schule und lernen mußte, streng zu trennen. Zu Hause wäre er ausgelacht worden.
Dort war man dankbar, man dankte nicht.
Er war der einzige, der einen Antrag auf Schulgeldermäßigung einreichte. Aber wie alle anderen bekam er ein Deutschlesebuch und eine deutsche Grammatik.
Der Heimweg auf dem Fahrrad war mehr als fünf Kilometer lang. Simon war den Großstadtverkehr, die schweren Lastwagen und großen Straßenbahnen nicht gewöhnt. Er kam nach Hause und brauchte Trost.
Aber Karin war mit Erik beschäftigt, der in der Küche mit einem zerbrochenen Weltbild vor dem Radio saß. Sein politischer Scharfsinn hatte die Sowjetunion immer außen vor gelassen. Der Pakt mit Moskau war ein Verrat an den Arbeitern der Welt.
Simon begriff erst, wie ernst es war, als Karin den Schnaps aus der Speisekammer brachte, obwohl es nur ein ganz gewöhnlicher Wochentag war.
Gegen Abend hatten der Branntwein und Karins tröstende Worte das ihre bewirkt. Erik hatte den Boden unter seinen Füßen notdürftig ausgebessert und war zu dem Schluß gekommen, daß die Russen unterschrieben haben mußten, um Zeit zu gewinnen für die Aufrüstung zur großen und entscheidenden Schlacht gegen die Nazis. Karin konnte aufatmen, ihren Jungen ansehen und fragen: »Na, wie war’s in der neuen Schule?«
»Gut«, sagte der Junge, und mehr wurde während der vielen Jahre Realschule, Gymnasium und Universität eigentlich nie geäußert.
Er zog an diesem Abend die Deutschbücher nicht aus dem Rucksack.
Schon in der ersten Pause am nächsten Tag kam es: »Du kleiner Judendreck«, sagte der Längste und Blondeste in der Klasse, ein Junge mit einem so vornehmen Namen, daß beim ersten Aufrufen ein Raunen durch die Klasse gegangen war.
Simon schlug zu, der Arm schnellte seine rechte Gerade direkt aus der Schulter, rasant und überraschend wie er es gelernt hatte, und der Lange fiel mit heftig blutender Nase um.
Zu mehr kam es nicht, weil es zur nächsten Stunde klingelte. Und es kam auch nie zu Schlimmerem, denn Simon hatte sich Respekt verschafft. Aber er wußte, daß nun die große Einsamkeit für ihn begann, genau wie in der Volksschule.
Doch da irrte er sich.
Als die Jungen die Treppe zum Physiksaal hinaufliefen, legte sich ihm ein Arm um die Schultern und er schaute in zwei braune, traurige Augen.
»Ich heiße Isak«, sagte der Junge. »Und ich bin Jude.«
Sie setzten sich im Physiksaal nebeneinander, so wie sie von da an alle Schuljahre hindurch nebeneinander sitzen würden. Simon hatte einen Freund gefunden.
Aber das sofort zu begreifen war nicht einfach, sein Erstaunen war viel größer als seine Freude. Ein richtiger Jude! Simon schaute Isak während der Schulstunde immer wieder an und konnte es nicht fassen. Der Junge war groß, schlank, hatte braune Haare, sah nett aus.
Wie ein ganz normaler Mensch.
In der Mittagspause nahm Isak Simon mit nach Hause, und sie aßen belegte Brote. Es gab dort ein Dienstmädchen, das ganz wie Tante Äppelgren war, und das dicke Scheiben Leberpastete auf die Brote legte und ihnen dazu Tomaten reichte.
Simon hatte noch nie ein Dienstmädchen gesehen und kaum je Tomaten gegessen, aber das war es nicht, was ihn beeindruckte. Nein, es waren die großen düsteren ineinanderführenden Zimmer, der schwere Samt an den Fenstern, die roten Plüschsofas, die endlosen Reihen von Bücherregalen – und der Geruch, der feine Duft von Bohnerwachs, Parfüm und Reichtum.
Simon sog alles in sich auf und dachte, als er am Nachmittag heimwärts radelte, daß er jetzt erfahren hatte, wie Glück aussah. Er hatte Isaks Cousine kennengelernt, die so elegant war wie eine Prinzessin und lange, lackierte Fingernägel hatte. Simon fragte sich, ob sie überhaupt jemals auf die Toilette gehen mußte.
Dann fiel ihm ein, daß Karin fragen würde, ob er seine Schulbrote aufgegessen hatte, machte also einen Umweg über den Eichenwald, setzte sich dort hin und aß sie auf.
Die Bäume schwiegen.
Als er bergab an Äppelgrens Garten vorbeifuhr, begegnete er einem seiner Cousins. Es war der Zurückgebliebene, und Simon schämte sich für ihn, weil er so dreckig und sein anbiederndes Grinsen absolut unerträglich war.
Ich hasse ihn, dachte Simon. Ich habe ihn immer gehaßt. Und dann schämte er sich noch mehr.
Sie waren gleich alt, waren gleichzeitig in die Schule gekommen. Aber der Cousin war bald in der Hilfsklasse gelandet, und jetzt hatte die Schule ihn ganz aufgegeben. Er war meistens im Stall bei Dahls, die hier in dem wachsenden Vorort zwischen den Eigenheimen noch eine kleine Landwirtschaft betrieben. Sie hatten einen Knecht, der schwachsinnig war, aber gutartig und kräftig genug für die schwere Arbeit auf dem Bauernhof.
Zu Hause hatte Karin ein Gästebett vom Dachboden geholt und zeigte Simon jetzt, wie er es allabendlich im guten Zimmer auseinanderklappen und für sich zum Schlafen zurechtmachen sollte. Für das Bettzeug hatte sie im Eichenbüfett ein Fach ausgeräumt. Dann hatte sie die Decke von dem großen Tisch am Fenster genommen und für seine Bücher eine Schublade freigemacht. Er sollte aus der Küche ins gute Zimmer übersiedeln. Das war eine Anerkennung für seine Ernsthaftigkeit an der neuen Schule.
So neigte sich die lange erste Woche ihrem Ende zu und der Sonntag kam, ein Sonntag, den die Welt nie vergessen sollte. Hitlers Truppen marschierten in Polen ein, Warschau wurde bombardiert. Und England erklärte den Krieg und das alles bewirkte so etwas wie ein Gefühl der Erleichterung.
Am meisten merkte man es Erik an, der sich straffte, wenn er sein ›endlich‹ sagte, und man hörte es auch an den Stimmen der Menschen, wenn sie sich in der Küche um das Radio versammelten. Nur Karin war noch trauriger als gewöhnlich. An diesem Abend half sie Simon das Bett zu machen und sagte: »Wenn ich einen Gott hätte, würde ich ihm auf Knien dafür danken, daß du erst elf Jahre alt bist.«
Simon verstand es nicht. Er hatte nur wie immer, wenn seine Mutter betrübter war als sonst, Schuldgefühle.
Auch in der Schule war am nächsten Tag etwas verändert, die Luft war irgendwie reiner und alles schien einfacher geworden zu sein. Sie lebten hier im größten Hafen an der Westküste ihres Landes, dem Meer und England zugewandt. Nazis gab es nur wenige.
In der ersten Schulstunde hatten sie Geschichte, aber es dauerte, bis sie ihre Bücher aufschlugen. Der Lehrer war jung und verzweifelt und betrachtete es als seine Aufgabe, den Jungen das Geschehene zumindest annähernd zu erklären. Sie kamen fast alle aus Elternhäusern, wo man die Kinder vor der Wirklichkeit zu schützen versuchte.
Für Simon war das meiste eine Wiederholung: Faschismus, Nationalsozialismus, Rassismus, Judenverfolgungen, Spanien, Tschechoslowakei, Österreich, München. Plötzlich zeigte die Küchenbank ihren Nutzen, er war derjenige, der Bescheid wußte, der dem Lehrer entgegenkam, so daß sich bald ein Dialog entspann.
»Es ist gut zu wissen, daß wir hier in der Klasse einen Schüler haben, der weiß, worum es geht«, sagte der Lehrer abschließend. Hinter diesen Worten stand ein Aufruf an die anderen, an die Bürgerkinder, in deren Weltbild sich an diesem Morgen die ersten realistischen Konturen abzeichneten.
Isak äußerte sich kaum, aber die Augen des Lehrers ruhten manchmal auf ihm, als wüßte er, daß dieser Schüler schwieg, weil er ein noch weit größeres Wissen hatte.
Simon saß in seiner Bank und dachte, daß es Brücken zwischen seinen beiden Welten gab und daß vieles von dem, wofür Erik und Karin einstanden, auch hier in der Hochmutsschule von Wert war. Daß nicht alles abzulehnen war, und daß man sich nicht dafür schämen mußte.
Das schlimmste an all dem Neuen war für Simon, daß er sich seiner Familie schämte. An diesem Nachmittag brachte er es fertig, Isak zu fragen, ob er an einem Tag mit ihm nach Hause kommen wollte.
Wie es aber dazu kam, daß Isak zu Karin fand und damit zu zwei Armen und einer Begründung, in ihrer Küche heimisch zu werden, ist eine spätere Geschichte. Denn in diesem Augenblick sagte der Lehrer: »Was auch immer geschieht in der Welt, es muß jeder einzelne das Seine dazu beitragen. Wir schlagen unsere Bücher auf. Wie ihr wißt, begann die Geschichte mit den Sumerern.«
Damit war Simon dort und nicht mehr im Klassenzimmer. Nie hätte er sich etwas so Phantastisches ausdenken können.
Sie lasen Grimberg: »Ein Land des Todes und der großen Stille ist Mesopotamien in unseren Tagen. Schwer ruht die rächende Hand des Herrn seit Jahrtausenden auf dem unglücklichen Land. Die Worte des Propheten Jesaia: ›Ach, du bist vom Himmel gefallen, du Vernichter der Völker‹, klingt wie eine Totenklage zwischen den zerfallenden Mauern …«
Simon verstand nicht alles, ließ sich aber von der Wortgewalt gefangennehmen. Danach ging Grimberg zu den Sumerern über, den Breitschädeligen, Untersetzten, die an Mongolen erinnerten.
»Sie erfanden die Schriftzeichen«, sagte der Lehrer und berichtete von den unzähligen Keilschrifttafeln in den großen Tempeln. Die gewaltigen Zikkuraten entstanden zum ersten Mal vor den Augen des Jungen und er folgte dem Lehrer hinab in die Grabkammern von Ur und zu den Toten.
Erst viele Jahre später glaubte Simon zu erkennen, daß sein Interesse für Frühgeschichte in dieser Stunde geboren wurde und eine immerwährende Kraft aus dem Erfolg schöpfte, den er gleich zu Beginn dieses Unterrichts gehabt hatte.
Oder weil ihn das alles so stark beeindruckt hatte, weil es ein so überaus gewaltiger Tag gewesen war: der erste des großen Krieges.
Schon der Elfjährige erkannte die Bedeutung, die sich hinter den Worten verbarg, daß die Welt, die sich ihm jetzt eröffnete, verwandt war mit der Wiese daheim.
Er wog das schwere Messer in der Hand und die blauen Steine aus Lapislazuli sprachen in ihrer geheimnisvollen Sprache zu ihm, gaben seiner Hand Kraft. Sein Blick haftete an der langen goldenen Klinge.
Das Werkzeug war gut.
Aber es würde ihm nicht helfen, wenn er nicht in dem sich nähernden Augenblick verweilen, ihn zeitlos machen konnte. Er näherte sich dem großen Tempelsaal, sah nicht, sondern ahnte eher die nach oben gewandten Gesichter der vielen tausend Menschen, die im Gebet vereint waren.
Der Stier war gewaltig, im Augenblick der Entscheidung hatte die Zeit ihn eingeholt. Und damit auch die Verbündete der Zeit, die große Angst. Als der Stier auf ihn zurannte, wußte er, daß er sterben würde, und er schrie …
Er schrie so laut, daß er Karin weckte, die sofort bei ihm war, ihn wachrüttelte und sagte: »Du hast schlecht geträumt, steh auf und trink einen Schluck Wasser. Man muß immer zusehen, daß man richtig wach wird, wenn der Alb einen reitet.«
Bevor Isak in Karins Küche landete, hatte Simon schon zusammen mit dessen Eltern und der Cousine mit den lackierten Fingernägeln an Isaks Mittagstisch gesessen. Simon hatte Schwierigkeiten mit dem vielen Besteck, lernte aber durch Beobachtung rasch und wagte zu glauben, daß niemand seine Unsicherheit bemerkte.
Er war zum Essen eingeladen worden. Zu Hause bei Simon wurde nie zum Essen eingeladen, wenn jemand gerade zur richtigen Zeit kam, aß er einfach mit. Wenn eingeladen wurde, dann feierte man ein Fest.
Isaks Vater war einer jener seltenen Menschen, die immer intensiv anwesend sind. Ihm war eine gewisse körperliche Geschmeidigkeit zu eigen, und das fein geschnittene Gesicht war lebhaft, voller Abwechslung. Er hatte ein rasches Lächeln, hell, freundlich. Die Augen waren braun und lebendig. In ihnen lag außer Neugier noch etwas anderes. Angst? Simon erkannte es, wollte es aber nicht sehen und wies den Gedanken als ungehörig zurück.
Dieser Ruben Lentov hatte sich eine Existenz in Schweden geschaffen und auf Bücher gesetzt. Seine Buchhandlung mitten im Zentrum war die größte der Stadt und hatte Filialen in Majorna, Redbergslid und Örgryte. Sie war in der ganzen Welt bekannt, und er hatte Kontakte zu London, Berlin, Paris und New York.
In seiner Jugend war Ruben Lentov ein Suchender gewesen, war von Strindberg und Swedenborg nach Schweden gelockt worden, hatte gefroren und verzichtet, ehe sein Unternehmen sicheres Wachstum versprach.
Sein Aufbruch war auch ein Aufbegehren gewesen gegen allzugroße Mutterliebe und eine allzu starke Vaterbindung. Aber die Familie daheim in Berlin hatte das so nie sehen wollen. Sie hatten ihn zum ersten, der Weitsichtigkeit bewiesen hatte, gemacht, zu einem, der lange vor 1933 begriffen hatte, was geschehen würde. Sie hatten ihn mit Geld und Bankverbindungen versorgt und sich um seine Frau und seinen kleinen Sohn gekümmert.
Mitte der dreißiger Jahre war Rubens Frau nachgekommen, als er schon gut etabliert war. Sie war jedoch völlig verängstigt. In den ersten Jahren erlangte er nie Klarheit darüber, was er von der Neigung seiner Frau zu bösen Vorahnungen halten sollte und davon, daß sie immer alles zum Schlimmsten auslegte.
Aber in den letzten Jahren glaubte er verstanden zu haben.
Die Ärzte, die sie in dem neuen Land aufsuchte, sprachen von Verfolgungswahn. Das war ein Wort, das tagsüber brauchbar war. Aber nie im Dunkeln, denn dort gab es ein Jahrtausende altes Gespenst.
Jetzt saß Simon an Rubens Mittagstisch, er, der schwedische Junge, der der Freund des Sohnes war. Ruben war dankbar für jede Verbindung, die in dem neuen Land geknüpft werden konnte, und er hatte sehr aufmerksam zugehört, als Isak von der Geschichtsstunde und dem Jungen erzählt hatte, der politisch so klarsichtig war und der die Nazis haßte.
Doch er war enttäuscht und schämte sich dafür. Diesen kleinen dunkelhäutigen Jungen hatte er nicht erwartet, mit einem langen blonden Schweden wäre er besser zurechtgekommen.
Die Enttäuschung legte sich im Lauf des Gesprächs als Simon loslegte und Ruben sehr bald erkannte, daß dieser Junge der schwedischen Arbeiterklasse entstammte, daß er die Stimme eines Kindes hatte, die Quelle jedoch die wachsende, mächtige Sozialdemokratie war. Sie stritten sich wegen der Kommunisten und Simon verlor für einen Moment den Boden unter den Füßen, als Ruben sich darüber ereiferte, daß die Sowjetunion ein Sklavenstaat von gleichem Schrot und Korn sei wie Hitler-Deutschland. Dann mäßigte sich Ruben, sah ein, daß er kein Recht hatte herabzusetzen und zu verletzen.
Er schämte sich und bot eine zweite Portion Eis an.
Simon sollte den Abend nie vergessen. Weniger wegen der Dinge, die er gehört hatte, als vielmehr wegen der Unruhe und des Unglücks, das er hier inmitten in all dem Reichtum gesehen hatte. Und weil er sich so sehr vor Isaks Mutter gefürchtet hatte.
Simon war bisher noch nie etwas so Widersprüchlichem begegnet. Ihr Mund und ihr Duft lockten, ihre Augen und ihre Töne erschreckten ihn. Sie klirrte mit Armbändern und scheppernden Halsketten und ihr Blick brannte vor Traurigkeit, sie zog ihn an und stieß ihn ab. Sie umarmte und küßte ihn, schob ihn weg, beobachtete ihn und sagte rätselhaft: »Larsson? Das ist doch unmöglich.«
Dann vergaß sie ihn, sah ihn nicht mehr, sie trank Wein und Simon merkte, daß sie auch Isak aus dem Augenblick und ihrem Bewußtsein verdrängte, und er verstand die Trauer in den Augen des Freundes, die ihm schon am ersten Tag aufgefallen war.
Am Samstag des nächsten Wochenendes wagte er den Versuch eines Brückenschlags zwischen seiner alten Welt und der neuen, und erzählte zu Hause am Küchentisch von der vornehmen Familie, die ihn zum Essen eingeladen hatte.
»Sie waren so … so nervös«, sagte er und suchte nach Worten, die die Besorgnis dort in der großen Stadtwohnung hätten erklären können.
Und Karin fand sie.
»Die leben in Angst«, sagte sie. »Sie sind Juden, und wenn die Deutschen kommen …«
Aber der Herbst verging und die Deutschen kamen nicht. Etwas anderes passierte, etwas, das aus Eriks Sicht fast noch schlimmer war. Am dreißigsten November bombardierten die Sowjets Helsingfors.
Winterkrieg.
Herrgott, wie kalt war doch dieser Winter, in dem die Erde fast an der Bosheit der Menschen zugrunde ging. Es kamen Tage, an denen die Kinder zu Hause bleiben mußten, wenn das Radio meldete, daß die Schulen geschlossen blieben. Simon saß im guten Zimmer, wo Karin im eisernen Ofen Feuer gemacht hatte und die Kohle ihren trockenen Geruch verströmte und Erik mit rotgefrorenen Ohren heimkam und sagte, wenn das so weitergeht, können wir bald mit dem Auto übers Wasser bis hinüber nach Vinga fahren.
Am nächsten Sonntag machten sie es auch, und es war ein Abenteuer, das sich nie mehr wiederholen sollte. Das allzeit lebendige, allzeit gegenwärtige, unbesiegte und gewaltige Meer ließ sich von dem bösen Wind aus Osten in Ketten legen, dem Wind, der mit zwanzig Metern in der Sekunde seine dreißig Minusgrade über den Inseln verbreitete.
Russen und Finnen starben wie die Fliegen an Eis und Feuer. Der Tod holte sich etwa 225 000 Menschenleben, wie man später feststellte, als die Verhältnisse wieder derart waren, daß man auch wieder einen Sinn für Zahlen hatte.
In Simons Heimatstadt machten die großen Werften Überstunden und die Arbeiter schenkten ihren Verdienst den finnischen Nachbarn. In Luleå wurde das Haus der Vereinigung Nordlichtflamme in die Luft gesprengt, und fünf beherzte Kommunisten mußten dafür ihr Leben lassen.
Im Februar war alles vorbei und Karelien hatte sein Heimatrecht im Norden verloren. Etwa zu dieser Zeit sagte Karin, sie müßten zum Frühjahr hin versuchen, einen Acker von Dahls zu pachten und mehr Kartoffeln setzen. Und Gemüse pflanzen.
Lebensmittel begannen knapp zu werden.
4
Viele Jahre danach würde Simon sich mit der Frage beschäftigen, ob er an diesem Morgen etwas Besonderes empfunden hatte. Er war in der Dämmerung aufgewacht und hatte seine Mutter im Schlaf weinen hören.
Karin hatte Vorahnungen.
Er selbst fühlte sich wohl wie immer, als er zur Schule losradelte. Die Stadt war zu einem Tag erwacht, der ein gewöhnlicher zu werden versprach. Von der Bergkuppe an der Stadtgrenze konnte er alle Hebekräne des Hafens sich wie tanzende langbeinige Spinnen bewegen sehen. Wie gewöhnlich überholte er die Straßenbahn, die die bessergestellten Kameraden in die Schule brachte, und wie gewöhnlich empfand er dabei eine gewisse Genugtuung. Majorna lag in der Sonne und ein Hauch von Wärme belebte die Karl-Johansgata.
Wie üblich machte Simon seine Deutschaufgaben während der Morgenandacht in der Aula. Er hatte sich noch immer nicht überwinden können, die Deutschbücher zu Hause aufzuschlagen, und in den Stunden fühlte er sich schlecht.
Wie gewöhnlich hatten sie am Dienstagmorgen Chemie und wie gewöhnlich war Simon kaum daran interessiert.
Aber in der dritten Stunde, mitten im Geschichtsunterricht, ging der Schulwart von Klasse zu Klasse und sagte knapp und mit verschlossenem Gesicht, daß Schüler und Lehrer sich in der Aula einzufinden hätten.
Woran er sich hinterher am besten erinnern konnte, war nicht, was der Direktor gesagt hatte, sondern es war die durch ihn vermittelte Angst, als die Jungen nach Hause geschickt wurden. Alle sollten sofort zu ihren Eltern gehen, die Schule könne an diesem Tag keine Verantwortung für sie übernehmen, sagte er.
Es war der 9. April 1940, Ottos Namenstag, und Simons Beine bewegten sich wie Motorkolben, als er heim zu Karin radelte. Sie stand weinend am Küchenfenster. Als sie den Jungen aber hochhob, ihn auf die Küchenbank stellte und in die Arme nahm, fühlte er mit der Gewißheit eines Kindes, daß nichts Schlimmes geschehen konnte, solange Karin bei ihm war.
Aus dem Radio knatterte eine aufgeregte Stimme, daß die Norweger das deutsche Schlachtschiff Blücher beim Einlaufen in den Hafen von Oslo versenkt hatten. Karin sagte, es wäre besser gewesen, wenn die Norweger es wie die Dänen gemacht und sich gleich ergeben hätten.
Erik kam mit dem Auto nach Hause. Schweden hielt den Atem an. Der Ministerpräsident sprach im Radio, sagte, daß die schwedische Wehrfähigkeit gut sei, und vielen Familien schenkten seine feste Stimme und die skånische Mundart so etwas wie Zuversicht.
Nicht so jedoch in Larssons Küche, denn dort sagte Erik es geradeheraus, wie es tatsächlich war: »Der lügt, der muß ja lügen.«
Wenige Tage später war Erik an einen unbekannten Ort verschwunden, einberufen. Karin und Simon hackten den Ackerboden auf, den sie gepachtet hatten, und setzten Kartoffeln.
In Simons Träumen stürzten sich wilde Bergvölker mit gezückten Säbeln von hohen Bergen hinunter und fielen wie die Heuschrecken in weite, fruchtbare Ebenen ein, brandschatzten, erschlugen die Menschen und warfen ihre toten Körper in Kanäle und Flüsse.
Die nächtlichen Bilder hatten wenig zu tun mit dem Krieg, der rundherum in Simons Welt wütete, denn wie dieser aussah, wußte er aus Zeitungsberichten und Kino-Wochenschauen. Bei Tag bestand das Entsetzen aus Hakenkreuzen, Stiefeln und schwarzen SS-Uniformen, bei Nacht nahm es die Gestalt beleibter, farbenprächtiger Wahnsinniger an, die ihm mit orientalischer Wollust die Kehle durchschnitten und ihn in den Fluß warfen. Dort schwamm er mit tausend anderen Toten herum und das Wasser färbte sich rot, und er sah Karin mit zerschmettertem Kopf neben sich schwimmen. Und sie war es, obwohl sie sich gar nicht ähnlich sah.
Als Erwachsener würde er noch oft darüber nachdenken, was der Krieg mit den Kindern machte, und wie die tiefe Angst sie prägte. Woran er sich am besten erinnerte, das war die Sehnsucht an jedem einzelnen Morgen, daß der Tag enden möge ohne daß etwas passiert war, dieser Tag und der nächste und der übernächste, ein immer gegenwärtiger schmerzlicher Wunsch.
Fünf Jahre sind eine Ewigkeit, wenn man Kind ist.
Seine Generation wurde zu einer Generation der Ungeduldigen, Menschen, die nicht im Heute verweilen konnten, sondern nur für den morgigen Tag lebten.
Trotz allem gab es immer noch einen Alltag. Die Schule war wieder geöffnet. Viele der Jungen hatten wie Simon keinen Vater mehr zu Hause. Nur für Isak war es anders, bei ihm war es die Mutter, die verschwunden war. In der Nacht zum zehnten April hatte sie versucht, die Kinder zu vergiften und in der schönen Wohnung an der Kvartsgata Feuer zu legen. Isak und seine Cousine waren in eine Klinik gebracht worden, wo man ihnen den Magen ausgepumpt hatte. Als sie wieder nach Hause kamen, war die Mutter nicht mehr da, man hatte sie ans andere Flußufer in ein Krankenhaus für Geistesgestörte gebracht.
Dort gab es Spritzen, die ihr Schlaf schenkten, und die sie nach und nach abhängig machten. Isak bekam seine Mutter nie mehr zurück.
Ruben Lentov lief auf dicken echten Teppichen durch die große stille Wohnung, wanderte in den Nächten zwischen den Bücherregalen in der Bibliothek und der Diele umher, immer vor und zurück. Er war sein Leben lang ein Mann der Tat gewesen, jetzt war er ein Mann umgeben von Ohnmacht. Ein Tier im Käfig. Noch gab es eine Tür, durch die man flüchten konnte. Jüdische Freunde hielten den Luftweg nach London und von dort weiter nach Amerika offen, er konnte seine Läden verkaufen, Kind und Geld nehmen und von hier verschwinden.
Er dachte an seinen Bruder in Dänemark, der zu lange gezögert hatte.
Aber am häufigsten dachte er an Olga, die im Psychiatrischen Krankenhaus eingesperrt war, nur noch ein Wrack, vollgepumpt mit Drogen, ohne jeglichen Kontakt, und doch seine Frau und Isaks Mutter.
Die Käfigtür war ins Schloß gefallen und er wußte es.
Dennoch ging er Nacht für Nacht umher, als müsse er einen Entschluß fassen und brauche die langen Stunden, um Klarheit zu finden.
Für Simon hatte die Angst Namen, und so konnte er sie einigermaßen beherrschen: Bomben, Gestapo, Möllergatan 19. Isak kannte die Wörter auch, aber er konnte sie nicht ordnen und auf Abstand halten. Sein Entsetzen war von einer anderen Art, allumfassend und wortlos wie die Angst nun einmal ist, wenn sie uns sehr früh ergriffen hat und wir uns nicht an das Wann erinnern können oder einfach nicht die Kraft dazu haben.
Karin verstand das, erkannte es schon, als sie den Jungen zum ersten Mal sah.
Einmal war es ihr möglich gewesen, mit Isak über Ängste zu sprechen: »Wir können ja nicht mehr als sterben, keiner von uns.«
Es war eine einfache Wahrheit, doch sie half dem Jungen.
Für ihn wurden Karin, ihre Küche und ihre Mahlzeiten, ihr Schmerz und ihr Zorn zu etwas, womit er leben konnte. Karin schuf Ordnung, sie machte das Leben faßbar.
Den ganzen Sommer über hatte Isak in ihrer Küche gehockt, während seine Mutter zu Hause immer verwirrter und erschreckender wurde. An jenem Sonntag im Mai, als die Norweger ihren Widerstand aufgaben und der König samt seiner Regierung Norwegen verließ, kam Isak zu ihnen hinaus und half Karin und Simon beim Unkrautjäten.
Er kam von seiner Mutter, die er im Krankenhaus besucht und die ihn nicht erkannt hatte.
Am Tag darauf zog Karin sich schön an, wählte den hellblauen Mantel, den sie selbst genäht hatte, und den großen weißen mit blauen Rosen verzierten Hut und fuhr mit der Straßenbahn zu Ruben Lentovs Büro.
Sie sahen einander lange schweigend an und Ruben dachte, wenn sie den Blick nicht bald abwendet, besteht die Gefahr, daß ich anfange zu weinen. Da sah sie weg und gab ihm Zeit, übers Wetter zu reden, ehe sie ihr Anliegen vorbrachte: »Ich habe mir gedacht, Isak könnte für eine Weile bei uns wohnen, bei Simon und mir.«
Und Ruben Lentov ließ den Gedanken endlich zu, den er jetzt seit Monaten zurückgewiesen hatte, daß nämlich die Angst in Isaks Augen Olgas Angst glich, und daß es für den Jungen schlecht ausgehen konnte, wenn nichts unternommen wurde. Er sagte: »Ich bin so dankbar.«
Viel mehr wurde kaum gesprochen. Als er sie durch das ganze Büro bis zur Haustür geleitete, hatte er das Gefühl, nie eine schönere Frau gesehen zu haben. Erst am Nachmittag fiel ihm ein, daß er für den Jungen bezahlen mußte, Larssons waren Arbeiter und hatten es wohl nicht allzu üppig.
Aber er hatte an Karin Larsson keine Spur von Proletariat wahrgenommen, und als er sie am Nachmittag anrief, um wegen des Geldes zu fragen, fand er keine Worte.
Später war er froh darüber, als ihm bewußt wurde, daß das, was Karin anbot, unbezahlbar war.
So fand er einen anderen Weg und fuhr einmal in der Woche mit Kaffee und Konserven, Büchern für Simon und Geschenken für Karin hinaus in das kleine Haus an der Flußmündung nahe der ausgehöhlten Felsen, in denen die Streitmacht Öl lagerte. Er wurde wie jeder andere in der großen Küche willkommen geheißen, bekam eine warme Mahlzeit, und wenn er sehr betrübt aussah, auch einen Schnaps.
Ruben mochte zwar keinen Branntwein, mußte Karin aber recht geben, daß er gegen die Schwermut half.
Bald zeigte sich, daß Isak für sich selbst geradestehen konnte. Ihm gefiel die körperliche Arbeit, er war praktisch, geduldig, hatte ein gutes Verhältnis zu Äxten, Spaten, Schraubenschlüsseln und zu schwerer Plackerei und übernahm so in vielen Belangen Eriks Aufgaben. Das war in dieser Familie viel wert, weitaus mehr als Simons Bücherwissen.
»Es ist, als hätten wir unsere Kinder ausgetauscht«, sagte Karin zu Ruben Lentov, als er eines Sonntags kam, um Erik zu besuchen, der Heimaturlaub hatte.
Erik war schlanker als früher, aber ebenso wortreich und bis in die Tiefe seiner schwedischblauen Seele empört über den schlechten Zustand der Streitkräfte.
»Wir haben Autos und kein Benzin«, sagte er. »Aber andererseits haben wir Munition und keine Waffen.«
Dann gebot Karins Blick ihm Einhalt, und er sah auch selbst, wie die Unruhe in Rubens Augen wuchs.
An diesem Abend erzählte Ruben, was er aus geheimen Quellen über das Schicksal der Juden in Deutschland wußte. Simon hatte es nie vergessen. Die Jungen wurden zwar aus der Küche geschickt, aber es war der Ausdruck in Eriks Augen, als er sich einmal in die Küche stahl, um etwas Wasser zu trinken.
Sein Vater hatte Angst.
Und weil Karin so blaß war, als sie den beiden Jungen an diesem Abend die Betten im guten Zimmer machte. Aber vor allem war es, weil er ein. Telefongespräch mit angehört hatte.
Es war Erik, der irgendwo anrief, er war in Eile, weil er mit der Eisenbahn zu seinem Einsatzort fahren mußte. Aber es war nicht die Eile, die seiner Stimme diese Schärfe und den Klang von etwas unerhört Wichtigem verlieh.
»Du mußt den Brief verbrennen …«
…
»Ja, ich weiß, daß ich es versprochen habe. Aber da konnte ich ja nicht ahnen …«
…
»Du mußt doch begreifen, daß sein Leben in Gefahr ist, wenn die Deutschen kommen.«
Simon horchte, saß aufrecht im Bett, um besser hören zu können. Aber eigentlich brauchte er sich nicht anzustrengen, das Telefon hing im Flur an der Wand zum guten Zimmer, jede Silbe drang deutlich zu ihm durch.
Die Fragen schwirrten ihm durch den Kopf. Mit wem sprach Erik, was war das für ein Brief, wessen Leben war in Gefahr?
Dann krampfte sich sein Magen zusammen, denn er wußte, daß er die Antwort auf die letzte Frage bereits kannte.
Es ging um ihn.
Isak schlief in einem eigenen Bett neben ihm, das war gut, denn er durfte nicht beunruhigt werden.
Aber Simon war sehr einsam, als er so dasaß und zu begreifen versuchte, ohne zu irgendeinem Schluß zu kommen.
Er hörte, wie Erik sich von Karin verabschiedete, seinen Rucksack nahm: »Auf Wiedersehen, Karin, gib gut auf dich und die Jungen acht.«
»Auf Wiedersehen Erik, paß auf dich auf.«
Er konnte die beiden vor sich sehen, wie sie sich ein wenig unbeholfen die Hand gaben.
Und kurz bevor die Tür ins Schloß fiel: »Hat sie verstanden?«
»Ich glaube, ja.«
Simon wurde jetzt böse, wie Kinder es werden, wenn sie nicht wissen, worum es geht. Die Wut brachte ihm gespenstische Träume, er begegnete der Ågrenschen, die im Tod noch unheimlicher war als zu Lebzeiten, und die ihm am Strand nachlief und schrie: »Geh heim und frag deine Mutter!«
Aber er hatte die Frage vergessen, hatte sie einfach verloren, konnte sich nicht erinnern, suchte verzweifelt, als hinge sein Leben davon ab.
Er wachte auf, weinte und verharrte im Reich der Dämmerung zwischen Schlafen und Wachen. Er ging auf die Bäume zu, die Eichen, und es gelang ihm schließlich, das Land zu finden, das es eigentlich nicht gibt, und traf seinen Mann, den Kleinen mit dem komischen Hut und dem rätselhaften Lächeln. Sie saßen eine Weile beisammen und sprachen miteinander, wie sie es die Jahre über immer getan hatten, wortlos und jenseits der Zeit.
Am Morgen stand er lange vor dem Spiegel, der über dem Kaltwasserhahn der Spüle an der Wand in der Küche hing, und schaute in die fremden Augen, die wohl die seinen aber doch anders als die aller anderen Menschen waren, dunkler als Karins, dunkler sogar als die von Ruben.
Aber er stellte dem Bild keine Fragen.
Auch Karin fragte er nicht.
Der Alltag um ihn herum behauptete sich. Bei der Hetze vom Haferbrei zu den Broten, die noch geschmiert werden mußten, und den Schulbüchern, die er zusammensuchen mußte, und den Strümpfen, die unauffindbar waren, verblaßte der gestrige Abend, das Telefongespräch verlor seine Konturen, bekam einen Anflug von Unwirklichkeit und Traum.
An diesem Tag bekam Simon ein Ungenügend für seine Deutscharbeit. Isak war bekümmert: »Meinst du, Karin wird traurig sein?«
Simon schaute erstaunt, die Schule lag in seiner Verantwortung, Karin würde nicht einmal fragen.
»Nein«, sagte er. »Die Schule ist ihr egal.«
Isak nickte erleichtert, ihm fiel ein, daß er gehört hatte, wie sie Ruben gegenüber gesagt hatte, als er sich nach Isaks Schulaufgaben erkundigte, man müsse Vertrauen zu seinen Kindern haben.
Dann sagte Isak: »Ich kann ja mit dir Deutsch büffeln, es ist schließlich meine Muttersprache.«
Simon war so verblüfft, daß er sich fast an seinem Rahmbonbon verschluckt hätte, das er sich zum Trost gekauft hatte.
Isak nahm am Deutschunterricht nicht teil, irgendwie hatte Simon es für selbstverständlich erachtet, daß er davon in gleicher Weise befreit war wie vom Religionsunterricht, eben weil er Jude war. Erst jetzt verstand er, daß Isak nicht deutsch zu lernen brauchte, weil er diese erschreckende Sprache mit den vielen harten Kommandowörtern schon beherrschte: Achtung, Heil, halt, verboten …
So kam es, daß die Küche, die jahrelang Hitler hatte brüllen hören, nun einem ganz anderen Deutsch lauschen durfte, einem weichen und runden Berlinerisch.
Das war komisch, selbst Karin war erstaunt darüber, wie angenehm die Sprache der Nazis klingen konnte. Simon lernte schnell, machte sich mit der Sprache vertraut. Er schaffte die nächste Schularbeit gut, und das Halbjahreszeugnis, das sie an dem Tag bekamen, an dem die Deutschen in Paris einmarschierten, war in Ordnung.