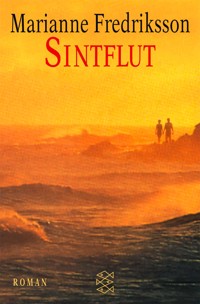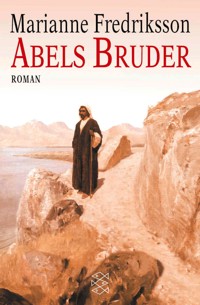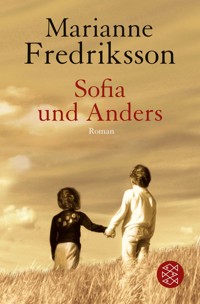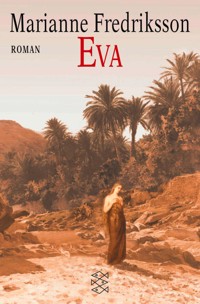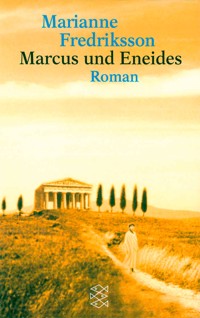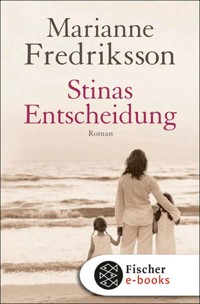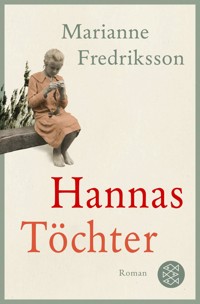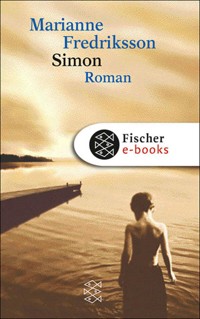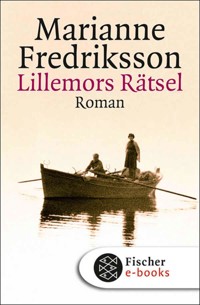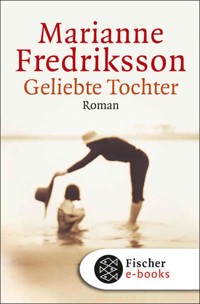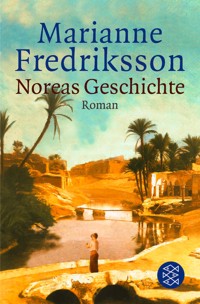
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Norea ist die Tochter von Eva und Adam, Kains Schwester, eine Gestalt aus den alten Menschheitsmythen - und ein Kind mit ganz besonderen Gaben. Denn Norea sieht das "Verborgene" . Sie kann in die Zukunft schauen, in die Herzen der Menschen blicken und über die Grenzen hinaussehen, die wir höchstens im Traum überschreiten. Eva spürt von Anfang an, dass dieses spätgeborene Mädchen von all ihren Kindern das glücklichste ist. Von klein auf fühlt Norea sich eins mit der Natur, mit den Tieren und Pflanzen. Doch dieses sichere Gefühl für die Einheit der Schöpfung schützt sie nicht vor harten Schicksalsschlägen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Marianne Fredriksson
Noreas Geschichte
Roman
Roman
Biografie
Marianne Fredriksson wurde 1927 in Göteborg geboren. Als Journalistin arbeitete sie lange für bekannte schwedische Zeitungen und Zeitschriften. Im Jahre 1980 veröffentlichte sie ihr erstes Buch. Sämtliche Romane der Autorin wurden in Deutschland große Bestsellererfolge. Die Autorin starb am 12. Februar 2007.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
[Widmung]
Was bisher geschah
NOREAS GESCHICHTE
[Motto]
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Nachwort
Für Turid
Was bisher geschah
Manche Ereignisse in Noreas Geschichte sind leichter verständlich, wenn man sich zuvor mit einigen Fakten aus der Rahmenhandlung der Romane von Eva und Abels Bruder vertraut gemacht hat.
Nach Kains Mord an Abel begibt sich Eva, die Mutter der beiden, auf den Weg zurück in das Land ihrer Kindheit, um Antwort auf bestimmte Fragen zu bekommen. In den Wäldern von Eden trifft sie auf ein Volk, das den Unterschied zwischen Gut und Böse nicht kennt. Zudem lebt es außerhalb der Zeit. Hier war Eva aufgewachsen, hatte sich jedoch von der unschuldigen und doch grausamen Horde abgesondert. Sie war zur Einzelgängerin geworden, denn auch ihre Mutter war anders als die Hordenmitglieder gewesen. Die Mutter war eine Frau von großem Wissen, und sie besaß die Fähigkeit zu lieben. Abgesondert lebte sie am Waldrand mit einem Schamanen zusammen, einem seltsamen Mann, der es verstand, Regen zu machen.
Auf dem Rückweg trifft Eva in den Niederungen auf eines der umherziehenden Hirtenvölker. Hier nun verknüpfen sich sämtliche Fäden, und zwar als Eva die Geschichte von der Königstochter erfährt, die gemeinsam mit einem Schamanen aus dem Tempelturm des mächtigen Hofes von Nod geflohen war. In einer Vision hatte sie von Gott den Auftrag erhalten, das wilde Volk von Eden zu erlösen, es eine Sprache zu lehren und ihm beizubringen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.
Eva weiß nun, dass diese Mission fehlgeschlagen ist. Der Schamane und die Mutter wurden nach Evas eigener Flucht von dem Wildvolk ermordet. Gemeinsam mit Eva war damals auch Adam geflohen, den der Schamane daraufhin verbannt hatte.
Eva kehrt auf den Berg zurück, auf dem sie und Adam Ackerbau betreiben. Neben Kain und Abel bekommenen sie noch zwei Kinder – Seth und Norea.
Kain heiratet Letha, ein Mädchen aus dem Hirtenvolk, und Kains Ähnlichkeit mit dem Königsgeschlecht in Nod gibt mittlerweile Anlass zu manchen Gerüchten.
In Abels Bruder wird berichtet, wie Kain seine junge Frau verlässt, nachdem sie ihm ein Kind geboren hat. Aus Eifersucht und Angst, dem Neugeborenen Schaden zuzufügen, flieht er nach Eden, wo er Satan, den Anführer des Wildvolkes, tötet. Inzwischen erreicht die alte, kinderlose Königin von Nod das Gerücht, es existiere ein Nachkomme des Königsgeschlechtes, Kain genannt. Sie schickt ihren Oberbefehlshaber los, um diesen Kain zu finden. Er soll ihn entweder töten oder als Thronfolger nach Nod heimführen.
Einige Zeit danach wird Kain König von Nod. Er heiratet erneut, diesmal Natie, die Tochter des Oberbefehlshabers.
Obwohl Kain scheinbar glücklich ist, verfolgt ihn die Schwermut auch weiterhin. Unterstützung bekommt er von dem offenen und klugen Hohepriester des Hofes. Auch hilft ihm eine Art inneres Gespräch mit seiner Mutter Eva.
Nod gerät in einen Krieg mit dem Nachbarland Sum, und in der entscheidenden Schlacht zeigt Kain großen Heldenmut. Doch die Angst ergreift erneut Besitz von ihm. Er unternimmt einen missglückten Versuch, sich von ihr zu befreien, indem er denen von dem Brudermord berichtet, die ihm am nächsten stehen. Doch sie verstehen ihn nicht, und Kain nimmt sich das Leben.
NOREAS GESCHICHTE
»Gib es auf, dir über Gott und Welt und Ähnliches
das Gehirn zu zermartern.
Suche Ihn bei dir selbst und lerne zu erkennen, wer in dir ist,
der sich alles vollständig zu Eigen macht und spricht:
›Mein Gott, mein Verständnis, mein Denken, meine Seele,
mein Körper!‹
Trachte zu erkennen: Woher kommen Schwermut und
Gelöstheit, Liebe und Hass?
Wenn du dies genau untersucht hast,
dann erst wirst du dich selber finden. In dir.«
Monoimos, gnostischer Lehreram Anfang unserer Zeitrechnung.
Kapitel 1
Mit leichten Schritten flog das Kind über die Wiesen.
Es war wie der Wind, grenzenlos und unberechenbar, erfüllt von der Freude über alles, was auf der Erde wuchs.
Es war fast noch ein Niemand und war deshalb fast schon alles. Zuweilen hielt es bei einer Blume oder einer Hummel inne und war nichts als bloßes Staunen. Oder eine Anemone war verblüht, hatte ihre Kronblätter verloren – und das Kind stand lange davor, völlig in den Anblick versunken.
Ohne Wehmut.
Es sah nichts Vergängliches in der welkenden Blume, sie enthielt keine Botschaft vom schnellen Tod des Frühlings, der hinübergewechselt war in einen heißen Sommer. Das Kind lebte noch außerhalb der Zeit.
In einigem Abstand folgte ihr die Mutter, auch sie mit jenem freien Blick und leichten Gang. Dieses Kind war für sie, die Leidgeprüfte, das Geschenk des Lebens. Spät erst war es geboren, in der Zeit ihrer Reife, als sie vieles schon hinter sich gebracht hatte. Das Kind sollte niemanden ersetzen, sollte nicht benützt werden oder als Trost dienen, brauchte nichts wieder gutzumachen.
Es durfte ganz einfach so sein, wie es war.
Lange bevor das Kind geboren war, hatte die Mutter die mühevolle Wanderung in ihr Inneres gewagt und dort den Nährboden für so manchen Schmerz gefunden. Die noch verbliebenen Rätsel konnten sie nicht mehr schrecken.
Im Großen und Ganzen hatte sie ihr Wachsen hier auf Erden begriffen. Manches hatte sich nicht ganz gerade entwickelt, und sie war traurig darüber. Aber sie hatte sich selbst verziehen – beides, das, was verkümmert war, und das, was sich niemals voll entfalten durfte.
Sie war wenig ängstlich, daher konnte sie das Kind großziehen, ohne es zu maßregeln. Und sie neigte nicht zu Schuldgefühlen, dieses Kind brauchte nicht zu befürchten, es bereite seiner Mutter Kummer.
Die Mutter wusste, dieser Friede, den sie errungen hatte, war von niemandem abhängig. Sie hatte Klarheit über sich selbst und deshalb Vertrauen in das Kind.
Noch dazu war es ein Mädchen, ein Wesen, das sich in der Welt so selbstverständlich bewegte wie sie selbst. Es zeigt sich so, wie es ist, dachte sie und folgte dem tanzenden Kind über die Wiesen.
Und es erstaunte sie auch nicht, dass das Kind seine halb bewussten Gedanken in Worten ausdrücken konnte. Wie jetzt an diesem Frühlingsmorgen, als sie hinauszogen, um die bereits hervorsprießenden Heilpflanzen zu sammeln. Und sie hatten Glück – sie fanden die seltene Aloe, die irgendwann ein einziges Mal hier oben von den Vögeln des Himmels ausgesät worden war. Der zähflüssige Saft der dicken, blaugrünen Blätter heilte Brandwunden, wirksamer als jedes andere Kraut. Und die reifen Samenkerne konnte man mit Enzian, Safran und Rhabarber zu einem Getränk mischen, das einem zu Tode Erschöpften neue Lebenskraft verlieh.
Die Pflanzen fanden sie auf der trockenen Südseite des Berghanges, gleich oberhalb der frisch gerodeten Lichtung, wo sich Myrte, Oleander und die eine oder andere Felsenrose langsam ihren Lebensraum zurückeroberten. Von allem war so reichlich vorhanden, sie könnte einen großen Vorrat anlegen, würde sie sich entschließen, alles zu ernten. Aber in ihrer Sammelfreude zögerte sie doch, empfand es als Plündern.
Sie bückte sich, um hier einige Blattrosetten und dort ein paar schwere Samenstände zu pflücken, und betete dabei im Stillen; es war eine Bitte an die Pflanzen um Vergebung und Verständnis.
Dann hörte sie das Kind rufen: »So schöne Blumen! Wir müssen sie vorsichtig pflücken, nur ein paar. Aber wir dürfen es, sie sind doch für die Kranken.«
Die helle Stimme schwirrte wie Sonnenlicht über die Pflanzen, und der Mutter kam es vor, als gäben sie freiwillig ihre Samen her.
Jetzt wollte das Kind weiter, bis zu den Zedern – und noch weiter, bis hinüber an den Fuß des kahlen Berges; eine unwirtliche Landschaft, steinig, voller Sand, versetzt mit Felsbrocken.
Nur die robustesten Pflanzen konnten auf dem mageren Boden Wurzeln fassen, diejenigen, die zu kriechen gelernt hatten und ohne Wasser und Schatten auskamen. Aber hier duftete es nach Thymian, der im Schutz der großen Felsen Nährboden für ein paar anspruchslose Büschel gefunden hatte.
Die Mutter pflückte einen Bund für den eigenen Gebrauch, dann setzte sie sich und ließ Gedanken und Gefühlen freien Lauf, all diesem Geplapper, das einen Menschen während seiner Wanderung auf Erden begleitet. Wichtiges und Unwichtiges war dabei, Lustiges und Quälendes, Kummer und Freude, alles ließ sie kommen, denn sie hatte endlich gelernt, dass sich der Strom der Gedanken andere, schmerzhaftere Windungen suchte, würde sie ihn aufzuhalten versuchen.
Das Kind hatte keine Gedanken, denen es nachhängen oder die es verbergen musste, nichts, was ihm Freude machte, galt es in Schubladen aufzubewahren, und nichts in seinem Leben musste es in Ordnung bringen. Es liebte diesen Platz. Hier schimmerte der Sand, hier leuchteten die Sterne in tausend Farben, hier tanzte die Welt für das Mädchen. Und hier war auch das Tier.
Sie war ihm eines Morgens begegnet, als die Steine vom Frost noch weiß schimmerten. Das Mädchen und das Tier hatten einander angeblickt und waren dabei vollkommen eins gewesen. Es war ein kleines Tier mit braunem Fell, blitzschnell und scheu. Dennoch war es vor ihm nicht ausgewichen, hatte einfach nur dagesessen mit seinen schwarzen Augen, versunken in die des Kindes.
Eine feierliche Stimmung hatte sie beide umgeben.
Damals hatte sie ihren Bruder bei sich, er war ungeduldig geworden, hatte sie am Arm gezupft und ihr zugerufen, mit ihm heimzugehen.
»Aber siehst du es denn nicht?«, hatte sie geflüstert.
Und der Bruder hatte in die Richtung des Tieres gestarrt und es nicht gesehen.
Da hatte sie begriffen, dass das Tier Gott war. Gott sei unsichtbar, hatte ihr Vater gesagt. Er würde sich nur manchmal einem Auserwählten zeigen.
Heute nun saß sie zwischen den tanzenden Steinen in einer Welt, die vor Licht und Farben sang – und sie wartete. Er würde kommen, das wusste sie. Und die Mutter würde ihn jetzt auch sehen.
Die Mutter war eine Auserwählte, wie Norea selbst.
Gleich darauf tauchte er auf, dort auf dem Felsen nahe am Fuß des Berges, und wieder trafen sich ihre Augen, und sie wurde er, und er wurde sie, beide wurden sie zur selben Zeit eins mit der unendlichen Schöpfung.
Auch die Mutter saß regungslos. Schließlich flüsterte sie:
»Es ist ein Wiesel, Norea.«
Im selben Moment war das Tier verschwunden, und das Kind fühlte eine unbestimmte Trauer. Die Mutter musste es gesehen haben, es war gar nicht anders möglich – aber warum hatte sie Gott ein Wiesel genannt? Und was war das für ein Wort, das die Freude einfing und sie dann wiederum in Stücke schlug?
Wenig später brach die Mutter auf.
»Es wird unerträglich heiß hier. Es ist kein schöner Platz«, sagte sie.
Da blickte sich das Kind um, die Steine hatten aufgehört zu tanzen.
Und das Kind weinte, so unfassbar und untröstlich, wie es nur ganz kleine Kinder tun.
Kapitel 2
Im Frühjahr war Lu-Sin zum Wohnplatz auf Ans Berg gekommen, und sie wusste sofort, dies hier war ein heiliger Ort. Es war gerade die Zeit, in der die Anemonen mit ihren leuchtenden Farben die Hügel überzogen. Und Lu-Sin war bekannt, dass die Götter mit dem Atem des Windes diese Boten an auserwählte Orte schickten – zur Freude der Menschen.
Lu-Sin war kinderlos. Der Same wollte in ihr nie wachsen, trotz einer langen, erfüllten Ehe; auch Opfergaben, Gebete und geheime Rituale in den Tempeln hatten ihr nicht helfen können.
Inannas blinde Priesterin aus dem Tempel in Nod hatte ihr schließlich gesagt: »Du willst nicht, und deshalb wollen auch die Götter nicht.« Damals hatte der Zorn sie wie ein reißender Strom erfasst, dunkelrot im Gesicht hatte sie ihre wütenden Einwände hervorgestammelt. Aber die blinde Seherin ließ den erbitterten Wortschwall über sich ergehen – ohne Sympathie und ohne Mitleid.
Hatte sie ihr überhaupt zugehört?
Lu-Sin wusste es nicht mehr, nur, dass auf die Wut, nachdem sie sich endlich ausgetobt hatte, heftige Trauer gefolgt war und das Gemüt reinigte. Und auf dem Grund der Trauer gab es eine tiefe Einsicht.
Sie war einer jener zahlreichen Menschen auf Erden, die früh erkennen, dass das Leben hier keinen besonderen Sinn hatte und dass es für sie, Lu-Sin, hier keine Aufgabe zu erfüllen gab.
Nicht, dass sie aufgegeben hätte, im Gegenteil – sie kämpfte beharrlicher als die meisten, um den Erwartungen anderer an sie gerecht zu werden. Sie war voller guter Vorsätze, war beliebt und freundlich. Wenige setzten sich für andere so ein wie Lu-Sin, wenige bemühten sich so und gaben ihr Bestes, um sich einen Platz im Dasein zu sichern.
Aber tief in ihrem Körper und in ihrer Seele hatte sie schon immer gewusst, die Anstrengungen würden nie genügen. Hier im Tempel, vor der alten Priesterin, sah sie es ein, hier wagte sie endlich auf die Stimme zu hören, die ihr aus dem Grund ihres Wesens zuflüsterte:
Es hat keinen Sinn.
Dennoch war diesem Augenblick der Einsicht nicht mit Vernunft beizukommen. Lange danach noch versuchte sie es zu verstehen und irrte zwischen Fragen umher, die sich ihr stellten. Sie sehnte sich mit all ihrem Sein nach einem Kind, wollte viele Kinder. Nichts im Leben wäre wunderbarer, als Ast-An nach einer seiner häufigen Reisen mit einem Neugeborenen auf dem Arm entgegenzutreten, es ihm zu reichen und zu sagen: »Sieh mal, das ist dein Sohn.«
Vielleicht mied das Kind sie ja auch, wollte nicht zu einer Mutter, die sich im Grunde ihres Wesens so unsicher war.
Lange Zeit versuchte sie, das Kind zu überreden: Komm, komm trotzdem. Für dich gibt es einen Platz hier im Leben, der dir zusteht.
Aber das Gebet war ohne Kraft, sie spürte es.
Eines Tages begann sie, für Ast-An eine neue Ehe zu planen. Eine neue Gattin sollte das Heim mit ihr teilen und endlich die Söhne gebären, die dem Mann zustanden. Anfangs reagierte Ast-An unwillig darüber; das Band zwischen ihm und seiner Frau war immer stark gewesen, ja, war durch ihre gemeinsamen Sorgen beinahe noch fester geworden. Schließlich gab er ihr zuliebe nach, in der Hoffnung, mit einem Kind im Haus würde Lu-Sin endlich zur Ruhe kommen.
Lu-Sin begann ihre Nachforschungen in den Familien am Hof von Nod. Allzu hohe Ansprüche durfte sie nicht stellen, es handelte sich ja nur um den Platz einer Nebenfrau, und unter jenen Frauen, die von edelstem Geschlecht waren, durfte sie nicht suchen. Bei aller finsteren Entschlossenheit gab ihr das einen gewissen Trost, denn sie selbst gehörte einer der ältesten Familien des Königshauses an.
Auch durfte die Frau nicht allzu hübsch sein. Diesen Gedanken gestand sich Lu-Sin allerdings nicht bewusst ein, hätte ihn auch heftig abgestritten.
Dennoch gab es ihn. Sie war ja auch nur ein Mensch, und Ast-Ans Liebe war für sie das größte Geschenk ihres Lebens, war ihre ganze Erfüllung. Sie beunruhigte und bedrohte aber auch das Grundgefühl:
Diese Liebe war unverdient.
Zuweilen dachte sie: Er wurde getäuscht, ich habe ihn beschwindelt. Zur Strafe bin ich kinderlos.
Die Auswahl unter den möglichen Ehefrauen für Ast-An war größer als sie angenommen hatte, wie sich bald herausstellte. Seine Stellung hatte sich unter dem neuen König gefestigt; Ast-An hatte dessen ganzes Vertrauen. Er selbst war der Verbindungsmann zwischen dem König und seiner Familie auf dem weit entfernten Berg An, und es war ein sehr persönlicher Auftrag, der viel Feingefühl erforderte. Er basierte auf Freundschaft, und eine Freundschaft mit dem König warf Glanz auf einen Mann und sein Haus.
Lu-Sin sah ein, sie müsse schnell einen Entschluss fassen, bevor der Mann seine guten Möglichkeiten selbst erkannte. Sie entschied sich für eine Kaufmannstochter, das vierte Mädchen einer Familie mit sechs Kindern. Sie hieß Bar-Et, und ihre Eltern waren über das Angebot außerordentlich geschmeichelt und freuten sich, solcherart eine weitere Tochter loszuwerden. Das Mädchen war rundlich, beinahe dick, nicht hübsch, aber appetitlich anzusehen, wie es bei sehr jungen Mädchen für gewöhnlich ist.
Nahezu in allem war sie das Gegenteil von Lu-Sin – ein wenig träge, nicht sehr redegewandt und fügsam.
Lu-Sin freute sich über ihre Wahl, und Ast-An erhob keine Einwände, ja er wirkte geradezu erwartungsfroh.
Die Hochzeit war ungewöhnlich aufwendig, wenn man bedachte, dass es sich nur um eine Nebenfrau handelte. Bar-Et und ihre Familie konnten sich somit kaum beklagen, dachte Lu-Sin, nachdem die Gäste das Hochzeitshaus verlassen hatten.
Sie selbst traf, gänzlich unvorbereitet, ein Gefühl bodenloser Verlassenheit, nachdem die Brautleute in dem Gemach verschwunden waren, das Lu-Sin für beide hergerichtet hatte. Und weil es ein verbotenes Gefühl war, gab es auch keinen Ausweg; Tränen standen ihr nicht zu. Lu-Sin würde immer an den Augenblick denken, in dem sie zu Stein verwandelt wurde, da alles Fleisch und alle Wärme in ihr hart, spröde und kalt geworden waren.
In dieser Nacht bewahrheitete sich das, was sie stets in ihrem Inneren gewusst hatte: Alles war sinnlos gewesen.
Am nächsten Morgen bemerkte Ast-An sofort ihre Versteinerung, war doch die Gemeinschaft mit seiner Frau die einzig Leben spendende Kraft in seinem Leben. Er sah es und musste einsehen, all ihre Beteuerungen, die neue Ehe würde sich zum Segen entwickeln, hatten sich als haltlos erwiesen. Die guten Vorsätze waren ein Spiel gewesen, es ließ sich nicht verwirklichen.
In diesem Moment hasste er Lu-Sin, und der Hass wollte ihr entgegenschreien, sie hätte mit ihrer Betriebsamkeit und ihrem verdammten Drängen ihn und sich selbst erniedrigt. Zwar schrie er nicht, das war nicht seine Art, aber er sagte, was er dachte, und hoffte auf einen Streit.
Lu-Sin schien ihn nicht zu hören, die Worte vermochten nicht bis zu ihrer Versteinerung durchzudringen.
Nun war Ast-An aber ein kluger und praktisch veranlagter Mann. Nachdem sich seine Wut gelegt hatte, reifte in ihm ein Entschluss. Lange Zeit schon, bereits seit Kain die Macht in Nod übernommen hatte, lebte Ast-An zwei Leben – eines hier in der Stadt und eines dort oben auf Ans Berg. Lu-Sin sollte Nod verlassen und zur Königsmutter auf den Berg kommen. Seine Frau würde dort gebraucht, und niemanden verlangte es mehr danach, gebraucht zu werden, als Lu-Sin.
Es ist schwer, mit einem Menschen zu reden, der versteinert ist, aber es ist leicht, ihn dorthin zu bringen, wohin man ihn gern haben möchte. Das wurde Ast-An während der nächsten Wochen klar, als er die Reise vorbereitete. Lu-Sin fand sich damit ab, fragte nicht, hörte nur zu. Das erschreckte ihn mehr als alles andere, mehr als die Tatsache, dass sie seine Umarmungen wie eine Statue ertrug.
Die neue Ehefrau vergaß er – und doch nicht ganz. Sie hatte ihm eine angenehme Nacht geschenkt, und als sie sich trennten, legte er in seinen Blick die Botschaft: Später, wenn ich zurückgekommen bin.
Auch war er insgeheim dafür dankbar, dass sie so fügsam war, denn im Grunde war er ständig nur mit der Sorge um die Ehefrau und deren seltsame Versteinerung beschäftigt.
Zwischendurch befürchtete er, der König könnte die Pläne verhindern, aber Kain nahm Ast-Ans Bitte freudig auf. Lu-Sin war eine kraftvolle und kluge Frau, sie würde sicherlich für seine Mutter eine große Freude sein.
Endlich war die Expedition aufgebrochen, und Ast-An dachte oft voller Vertrauen und Zuversicht an Eva. Sie, die kluge Frau, würde ihn verstehen und ein Heilmittel für Lu-Sin wissen.
Sie führten auf Wunsch des Königs Kühe und Ochsen mit sich, die ersten Rinder für die Siedler auf dem Berg. Deshalb war die Reise aufgeschoben worden, der Frühling musste ins Land gezogen und genügend Gras musste vorhanden sein, um die Tiere sicher über die Niederungen zu bringen. Aber die langsamen Tiere verzögerten die Wanderung, für Ast-An zog sich die Reise ganz unnütz unendlich hin. Auch hatte er gehofft, die vielen Eindrücke, das Erlebnis der neuen Landschaft und des Himmels, der hier ganz anders war, würden Lu-Sins Versteinerung aufweichen. Aber weder die Schönheit der Berge noch die weite Ebene konnten ihr Gemüt aufhellen.
Die abendlichen Lagerfeuer brachten ihr keine Wärme, nicht einmal, als sie nachts im Zelt in seinen Armen schlief. Sie fror ja nicht, und das war noch schlimmer. Lebendige Menschen frieren wenigstens, dachte er unendlich verzweifelt.
Als sie Ans Berg erreichten und das mühsame Klettern begann, geschah dennoch etwas mit Lu-Sin. Sie wurde aus ihrer Versteinerung gerissen, jetzt schlug das Herz hart in ihrer Brust und das Blut sang in den Adern. Endlich wurde ihr warm. Und als das Hochplateau erreicht war und sie sich am Sturzbach erfrischte, sah Lu-Sin, wie schön die Welt war mit ihren gewaltigen Ebenen, den weit entfernten Flüssen und riesigen Laubwäldern am Horizont.
Noch hatte ihr das Leben etwas zu bieten.
Und sie schämte sich, als sie Ast-Ans Blick begegnete und seinen Schmerz sah. Wieder kamen ihr die alten, hässlichen Gedanken: Du solltest mich gehen lassen, ich bringe dir nur Unglück.
Dennoch war die Macht der Versteinerung gebrochen, und diese Lu-Sin, die sich jetzt dem Wohnplatz näherte, war ein Mensch aus Fleisch und Blut, aus Verzweiflung und Erwartung.
Und der Wohnplatz nahm sie auf, mit all seinem Frieden und seiner Freude. Die frisch eingesäten Äcker dampften in der Wärme nach dem nächtlichen Regen, der rote Boden schenkte der Saat seine Kraft. Die Tamarisken blühten, spiegelten sich im See und färbten das Wasser am Ufer rosa. Meterhoch umstand der Rosmarin die Häuser und hüllte die Umgebung in seinen frischen Duft.
In Nod sagte man, wo Rosmarin gedieh, herrschte die Frau, ging es Lu-Sin durch den Kopf.
Außerdem blühten hier über und über die Anemonen.
Die Sonne stand noch hoch am Himmel, als sie beim Wohnplatz ankamen, der in der Mittagsruhe döste. Eine Frau mit einem Kind an der Hand kam ihnen entgegen, und wie immer, wenn Lu-Sin ein Kind sah, traf sie ein schmerzhafter Stich.
Dann vergaß sie das Kind und dachte, niemals hatte sie eine schönere Frau gesehen, als diese, die Königsmutter. Sie war nicht mehr jung, war einfach gekleidet, die Haut war von der Sonne gebräunt, und über ihr Gesicht hatte die Trauer ein Netz feiner Falten gelegt. Trotzdem war sie schöner als die Sterne am Nachthimmel.
Sie besaß all die besonderen Züge des Königsgeschlechts – die hohen Wangenknochen, die fein gebogene Nase, eine aufrechte Haltung, die der Frau eine selbstverständliche Würde verlieh. Aber das war nicht der Grund für ihre Schönheit. Es waren die beinahe schwarzen Augen, die Lu-Sin ansahen, weise und voller Wärme, und doch waren es auch sie nicht allein, die ihr diese unbegreifliche Schönheit verliehen.
Erst später, als Ast-An sie mit den Worten vorstellte:
»Das ist meine Frau«, begriff Lu-Sin den wahren Grund. Sie bemerkte das Lächeln der anderen und hörte deren tiefe Stimme: »Herzlich willkommen, wie schön, dass du da bist.«
Dies hier war ein Mensch, der zu großer Liebe fähig war.
Lu-Sin weinte, als Eva ihre Hände festhielt, es war jenes Weinen, das Steine zu sprengen vermag.
Ast-An hatte oft darüber nachgedacht, wie er Eva allein sprechen könnte und welche Worte er wählen sollte, um ihr alles zu erklären und sie um Hilfe zu bitten. Es war überflüssige Mühe gewesen, erkannte er erleichtert, als er Eva zusah, wie sie Lu-Sin in das neue große Wohnhaus hinter der Hecke aus duftendem Rosmarin führte.
Nun machte er sich auf die Suche nach Adam und konnte sich endlich dem widmen, was Männersache war. Konnte sich den lebensnotwendigen Dingen zuwenden wie dem Ackerbau, der Tierhaltung, den Wohnhäusern – allem Praktischen dieser Welt. Und herrlich befreit von Gefühlsregungen, die er nicht verstand.
Mit leichtem Gang machte er sich auf den Weg, sah im Vorbeigehen, dass der neue Stall für die Kühe beinahe fertig war. Diese hatte er samt dem größten Teil des Gepäcks und den Begleitern auf der feuchten Wiese hinter dem Wasserfall zurückgelassen. Die Tiere drängten nach Ruhe, Wasser und frischem Weidegras nach der Kletterei auf den Berg. Er hatte angeordnet, sie sollten erst gegen Abend nachkommen, wenn es kühler geworden war.
Adam empfing ihn herzlich, und bald waren beide Männer tief ins Gespräch verwickelt – über Aussaat und Ackerbau, über die Verteilung der Arbeitskräfte oder das Lammen der Schafe, das soeben begonnen hatte. Adam hatte Probleme mit Beri, dem neuen Hirten, der hartnäckig darauf bestand, die alten Mutterschafe und den ältesten Schafsbock zu schlachten, da dieser die Lust verloren hatte und nicht länger seine Pflicht erfüllte.
Ohne falschen Stolz hatte Adam all die Hilfe angenommen, die ihm der Sohn auf dem Königsthron von Nod im Laufe der Zeit hatte zukommen lassen. Freudig hatte er den Veränderungen auf dem Wohnplatz zugesehen; Häuser waren aus dem Boden gewachsen, neue Anbauarten und Getreidesorten hatte man ausprobiert, und alles hatte sich kräftig und zum Wohle aller entwickelt. Sogar den neuen Töpfer hatte er mit viel Wärme aufgenommen, obwohl er sich noch immer gern mit den alten Tongefäßen abmühte.
Nur in Bezug auf die Schafe reagierte er empfindlich und war skeptisch gegenüber den Neuerungen, ohne es direkt auszusprechen. Ast-An wusste es seit langem, er hatte des Öfteren die Hirten ausgewechselt, bis er Beri fand. Beri war verantwortungsbewusst und feinfühlig. Ast-An wollte, dass die beiden zusammenarbeiteten.
Morgen würde er erneut mit dem Hirten sprechen.
Sie gingen am Seeufer entlang, und stolz wies Adam darauf hin, dass der Schilfgürtel entfernt und die Gräben gereinigt waren, womit Kain seinerzeit schon begonnen hatte. Seth kam angelaufen, der Junge hatte die Nachricht von Ast-Ans Ankunft gehört, und nun flog er in die Arme des Noders, in denen er sich so geborgen fühlte. Ast-An liebte den Jungen und meinte, er sei wieder ein Stück in die Höhe geschossen und ein bisschen klüger geworden, seit sie sich das letzte Mal gesehen hätten. Und Seth bewunderte niemanden mehr als ihn; in den Träumen des Jungen verschmolzen Ast-Ans Gesichtszüge mit denen des Bruders, der weggegangen war, um die schwere Aufgabe als König von Nod zu übernehmen. Wie er wohl aussehen mochte? Er hatte keine Vorstellung mehr von ihm.
Ast-An beantwortete so gut er konnte die Fragen, die aus dem Mund des Sechsjährigen sprudelten. Die meisten betrafen die Kühe, die neuen Tiere – wo waren sie, von denen Seth nun schon seit Monaten gehört hatte?
Dann wollte Seth der Herde entgegenlaufen, aber Adam schüttelte den Kopf, das sei zu weit für den Jungen.
Auf dem Rückweg zum Wohnplatz hätte Ast-An zu gern von seiner Frau gesprochen, von dieser traurigen und auch etwas lächerlichen Geschichte mit der neuen Ehe. Aber er brachte es nicht fertig, sagte nur: »Ich habe meine Frau mitgebracht.«
Adam sah erstaunt aus und schien einen Moment zu zögern.
Woraufhin Ast-An ihn fragte: »Ich hoffe, du hast nichts dagegen?«
»Nein, im Gegenteil, Eva wird sich über ihre Gesellschaft freuen. Ich habe nur ein bisschen Angst, sie wird sich langweilen. Für eine Hofdame aus Nod gibt es nicht viel Abwechslung hier oben.«
»Bei Sin«, sagte Ast-An erleichtert, »meine Frau findet immer etwas, wobei sie sich nützlich machen kann.«
»Genau wie meine Frau«, entgegnete Adam, und beide Männer traten laut lachend durch die Tür des Wohnhauses; hier erwartete sie schon die Begrüßungssuppe.
Wie immer am ersten Abend wurde es später als sonst, diesmal aus dem einfachen Grund, weil die neuen Tiere für so viel Trubel sorgten. Sie mussten, nachdem sie in der Dämmerung endlich eingetroffen waren, erst einmal in dem neuen Schafstall untergebracht werden und zur Ruhe kommen. Stolz, als wären es ihre eigenen Kühe und ihre Idee, sie hierhergebracht zu haben, zeigte Lu-Sin, wie Eva sie melken musste. Und Eva war erstaunt, wie viel Milch aus den großen Eutern der Tiere kam.
Nie hätte sie bessere Milch getrunken, meinte sie.
Dann wurden die Grüße ausgerichtet, und in aller Ausführlichkeit erzählte man von dem Leben in Nod, ebenso von Kains zahlreichen Vorhaben. Eva hörte aufmerksam zu, wie sie es immer tat, und achtete auf das, was möglicherweise zwischen Ast-Ans Worten lag.
Wie gewöhnlich fand sie nicht allzu viel heraus. Soweit sie verstand, ging es ihm gut, ihrem großen Jungen. Er war ein Segen für das Land, und in Ast-Ans Bericht gab es keine Andeutungen über Kains Schwermut. Eva vermied es, danach zu fragen.
Für einen Moment verweilten ihre Gedanken bei der neuen Gattin, jener merkwürdigen Natie, der Tochter des Oberbefehlshabers.
Sie dachte ohne sonderliche Sympathie an sie.
Aber ihr Herz brannte, als sie hörte, Natie habe Kain noch einen Sohn geboren – ein weiteres Enkelkind also, das sie nie sehen würde.
Dann kehrten die Gedanken zu Lu-Sin zurück, die hier neben ihr saß; eigentlich hatte sie während des Tages ununterbrochen an sie gedacht.
Was für eine verzweifelte Geschichte.
In dieser Nacht jagte Lu-Sin einem Gespenst durch Nods enge Gassen nach. Sie wusste, die flüchtende Gestalt vor ihr war ihre eigene Mutter, und sie, Lu-Sin, wollte ihr eine wichtige Frage stellen. Aber das Gespenst entkam, löste sich im Dunkel des Traumes auf, und die Frage wurde nie gestellt.
Dennoch erinnerte sie sich, als sie in dem neuen Zuhause aufwachte. Die Frage lautete:
Weshalb wolltest du mich nicht haben?
Kapitel 3
»Mutter, du siehst doch, dass es ein Vogel ist. Groß ist er, wie ein Adler. Du und ich, wir fliegen mit ihm bis in die Wolken, bis zum Meer, Mutter, wie es Ast-An erzählt hat!«
Die Mutter musste über den Eifer des Kindes lächeln, das auf den Ästen saß, die über Kreuz gelegt von Tonscherben gestützt und mit Blumen verziert waren.
»Mutter …«
Die Stimme klang jetzt auffordernd und so voller Freude, dass die Mutter für einen Moment zu sehen versuchte, was das Kind sah.
»Ja doch, mein Kleines, ich sehe es. Wir fliegen.«
Aber sie log, sie konnte nicht fliegen. Dennoch rührte das Kind etwas in ihr an, ein Gefühl aus ihrer eigenen Kindheit, in der auch für sie noch alles möglich war. Es war eine körperliche Erinnerung, jenseits der Gedanken. Auch sie hatte einst in einer Welt ohne Grenzen gelebt.
Dort gibt es eine andere Sicht der Dinge, dachte sie. Kinder haben sie noch, bevor wir sie lehren zu sehen, wie wir es möchten.
Lu-Sin fand, das Kind habe ungewöhnliche Fähigkeiten. Aber Eva sah es anders. Kinder sind in einer anderen Wirklichkeit zu Hause, dachte sie und erinnerte sich an die Augen von Neugeborenen, die voller Wissen sind. Erwachsene zwingen Kinder in ihre eigene festgelegte Wirklichkeit. Aber weshalb?
Doch sie kannte die Antwort bereits: Wir machen uns zu viele Sorgen. Dieses verdammte Gefühl, bedroht zu sein, macht die Welt zu einem feindlichen Ort. Eva erinnerte sich an ihre ständige Furcht, als ihr erstes Kind klein und so vielen Gefahren ausgesetzt war – da waren der Brunnen und der See, das Feuer und der Wald, die giftigen Pflanzen und die Schlangen im Gras.
Dann fiel ihr Norea ein, als sie mit einer Giftschlange im Korb nach Hause gekommen war. Sie hatte trotz ihrer eigenen Furcht vor Schlangen das Kind überredet, zu dem Steinhaufen zurückzugehen, bei dem es die Schlange eingefangen hatte, und sie dort wieder auszusetzen. Mit einem Blick, starr vor Anstrengung, um ihr Herzklopfen zu verbergen, hatte sie zugesehen, wie das Kind die blitzschnelle Giftschlange in ihre Hände genommen und sie auf den glatten Kopf geküsst hatte, ehe sie sie freiließ.
Die Mutter wurde für ihre Geistesgegenwart belohnt, aber es war unverdient. Bei ihren ersten beiden Kindern war sie ausgesprochen ängstlich gewesen und hatte sie schon oft verloren geglaubt – bei Umständen, auf die eine Mutter nie von allein kommen würde. Wie hätte sie sie auch vor all den Gefahren schützen können! Diesmal hatte sie beschlossen, sich um ihre beiden Jüngsten nicht zu ängstigen.
Sie sollten voll Vertrauen in das Leben und die Natur heranwachsen, wie Eva es ausdrückte.
Adam sprach von Gott, aber beide meinten dasselbe.
Kinder, die jenes Vertrauen haben, wuchsen schnell und ungebrochen heran, waren selbständig und innerlich stark. Um den Jungen machte sich Eva keine Sorgen, er war klug und furchtlos, erfinderisch und umgänglich und wurde von allen auf dem Wohnplatz geliebt. Eva freute sich darüber und beobachtete, wie fürsorglich Seth allen gegenüber war, genau wie sein Vater.
Er war ja auch vor allem Adams Junge, war es von der ersten Stunde an gewesen.
Und Norea?
Eva musste zugeben, dass die Tochter einsamer war. Dafür auf besondere Art frei.
Während das Kind mit seinem Phantasievogel flog, suchte die Mutter nach dem richtigen Wort und fand es:
Unabhängig.
Jetzt regte sich eine Spur von Sorge in Evas Gedanken. Konnte Noreas Einsamkeit daran liegen, dass sie in anderen Welten zu Hause war? Zwischen dem Kind und der Natur bestand eine geheimnisvolle Verbindung. Es konnte mit den Blumen sprechen und lange und ernst erzählen, was die Tiere – die Vögel und Insekten – zu ihr sagten, denen sie rund um den Wohnplatz begegnete.
Das Mädchen konnte keine Grenze ziehen zwischen Phantasie und Wirklichkeit.
War es nicht an der Zeit? Sie war doch schon fünf Jahre alt.
Gleich darauf musste Eva über sich lachen, eben hatte sie noch selbst gesagt, es wären die Ängste der Erwachsenen, die den Kindern Grenzen setzten.
Norea war ganz sie selbst – ein ungewöhnlich selbständiges und begabtes Kind. Früh genug würde sie dazu gezwungen werden, sich einzugrenzen.
Nun senkte sich der große Vogel des Kindes vom Himmel herab auf den Boden, und Norea schloss die Augen wie immer, wenn sie die Schwelle von einer Welt zur anderen überschritt. Gleich darauf lag sie in den Armen der Mutter, als wäre sie nie fort gewesen. Für das Kind gab es nur das Jetzt, sein Platz war stets hier, es verschmolz völlig mit dem, was es tat.
Kinder kennen keinen inneren Zwiespalt, dachte die Mutter, während sie über den Hofplatz dem hüpfenden Kind in das Haus folgte. Es war Zeit, das Abendessen vorzubereiten.
Später am Abend kam Norea kurz vor dem Einschlafen noch einmal auf das Fliegen zu sprechen.
»Ich habe einen Jungen dort am Meer getroffen«, sagte sie. »Einen großen Jungen, fast schon ein Mann.«
»Ach ja? Und wer war er?«
»Das Komische ist, dass ich es nicht weiß, obwohl ich ihn schon lange kenne«, sagte das Mädchen. »Er ist hübsch, hat lange, braune Haare. Und weißt du was, er hat ein Muttermal am Hals unter dem einen Ohr, viereckig und fast schwarz. Kennst du ihn nicht, Mutter?«
Eva war ganz still geworden, natürlich kannte sie ihn. Abel, der seit vielen Jahren tot war, hatte solch ein Mal gehabt.
Kapitel 4
Lu-Sin war mit großem Gepäck zum Wohnplatz gekommen, und wunderbare Dinge zauberte sie nun aus den großen, geflochtenen Körben.
Da leuchteten die Augen des Kindes, und Lu-Sins Herz freute sich über dessen Staunen. Vasen aus Alabaster und Diorit kamen zum Vorschein, kleine Statuen von Göttinnen mit breiten Schultern und üppigen Brüsten und Gesichtern, die, so fand Norea, denen von Fröschen ähnelten. Schalen gab es da, über und über mit phantasievollen Mustern aus Hämatit verziert, oder Tücher in leuchtenden Farben, elegante Kleidung, Schmuck, Armringe aus Gold, Halsbänder aus klirrendem, vulkanischem Glas, Kämme und Schminksachen.
Das Wunderbarste war jedoch die Laute, deren Saiten auf dem feingeschnitzten Holzkörper angebracht waren, mit einem Stierkopf aus getriebenem Gold am Ende des Griffes. Dies aber war nur das Äußere, das eigentliche Wunder war die Musik, die sie hervorbrachte.
Lu-Sin war eine begabte Lautenspielerin und eroberte mit ihrer Kunst schnell das Herz des Kindes. Norea konnte nie genug bekommen. Lu-Sin kannte die Töne der tanzenden Welt, ja, sie konnte mit ihnen den Tanz geradezu hervorlocken, merkte Norea. Wo auch immer und wann auch immer sie spielte, begannen die Steine zu leuchten, dann sangen die Bäume, und die Blumen lachten in neuer Farbenpracht. Lu-Sin gehörte zu den Auserwählten.
Auch hatte sie so mancherlei Interessantes zu erzählen. Das Kind verstand zwar nicht alles, aber manchmal malte Lu-Sin aus Worten Bilder, und dann sah man die Häuser und Straßen von Nod, all die Menschen, den Marktplatz, die Geschäfte und den Hafen mit seinen Schiffen. Nur den hohen Turm konnte sich das Kind nicht vorstellen, er entzog sich seiner Phantasie. Auch der König erschien nicht vor ihrem inneren Auge, er, der ihr Bruder war.
Für Lu-Sin war jedoch nicht die Laute der wichtigste Gegenstand in dem Gepäck, sondern der Spiegel. Es war ein teurer Spiegel, in einen Silberrahmen gefasst und mit Einlegearbeiten aus Perlmutt und Lapislazuli. Der Spiegel selbst war ebenfalls aus Silber, war geschliffen und poliert, sodass er jede kleinste Falte ihres Gesichtes wiedergab.
Lu-Sin betrachtete sich oft im Spiegel.
Für gewöhnlich untersuchte sie ihre Falten, wenn sie ihre Frisur kontrollierte, schob dann das Silberband über die Stirn, verzog den Mund, um zu sehen, wie tief die Falten um die Mundwinkel waren, und legte Rot auf ihre Wangen.
Ihr eigenes Abbild war für Lu-Sin wichtig.
Zum Teil war sie selbst das Bild.
Ohne das Bild hätte sie kaum gewusst, wer sie war.
Jeden Tag nun, den sie hier oben verbrachte, kämmte sie sich weniger streng, legte weniger Farbe auf die Wangen. Schließlich ließ sie auch den grünen Puder auf den Augenlidern weg und fühlte sich eine Zeit lang geradezu unanständig nackt.
Eva unterstützte sie nicht in diesen Entscheidungen, im Gegenteil – sie und das Kind hatten stets bewundert, wie viel Mühe Lu-Sin sich mit ihrem Gesicht gab.
Bereitwillig trat Eva die Arbeit und Verantwortung für den Haushalt an sie ab. Sie hatte genug mit Mann und Kindern zu tun, mit den Heilpflanzen und den Kranken, die weiterhin auf Ans Berg kamen, um hier Trost und Heilung zu suchen. Lu-Sin musste die Arbeiten übernehmen, um die Eva sich nicht riss, unter anderem die Betreuung der zahlreichen Helfer. Eva hatte so ihre Probleme mit ihnen, denn sie war ja während der vielen Jahre gewohnt, alles selbst zu machen. Sie hatte sie oftmals verletzt, weil sie ihnen bei allen möglichen Arbeiten zuvorgekommen war. Dann versuchte sie, alles wieder gutzumachen – und es war jedes Mal genau das Falsche. Einmal machte sie zu viele Worte, dann zu wenig, mal war sie zu nah, mal zu fern – so lief das mit ihren Helfern.
Ein Segen also, endlich davon befreit zu sein. Lu-Sin war es gewohnt, mit Menschen umzugehen, war angemessen freundlich, alles geschah nach ihrem Willen, und die Leute hatten das Gefühl, nützlich zu sein und gebraucht zu werden.