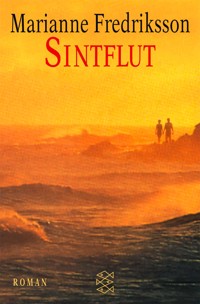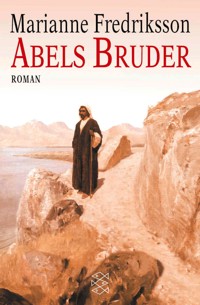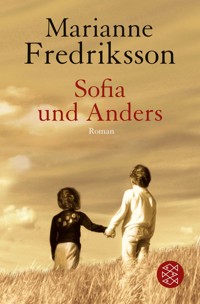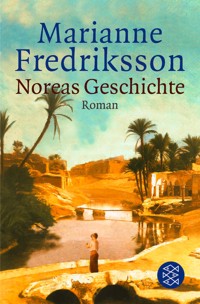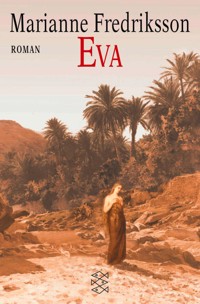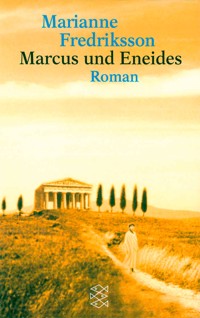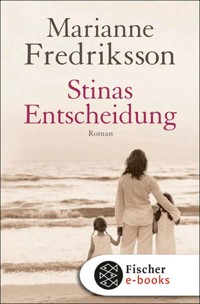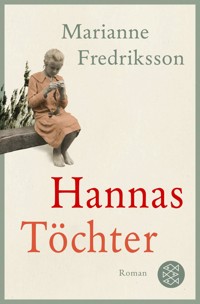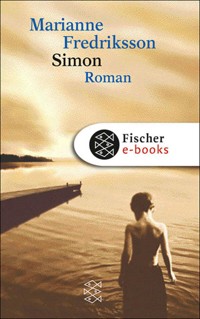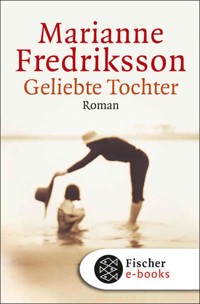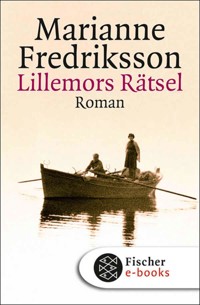
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist Frühling in Östergötland, und Lillemor fährt für ein Paar Tage in das alte Ferienhaus ihrer Familie. Beim ersten Waldspaziergang schlägt ihre Hochstimmung jäh in Entsetzen um, als sie unter einer alten Fichte die Leiche einer jungen Frau findet. Schockiert stellt sie fest, dass die Tote wie ein jüngeres Abbild ihrer Selbst aussieht. Die Suche nach dem Geheimnis der unbekannten Toten wird für Lillemor mehr und mehr zu einer Suche nach ihrer eigenen Geschichte. »Lillemors Rätsel« ist ein spannendes Märchen unserer Zeit über die Last verdrängter Erinnerungen und alter Schuldgefühle, in dem die Jagd nach dem Mörder nur einer von vielen dramatischen Höhepunkten ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Marianne Fredriksson
Lillemors Rätsel
Roman
Aus dem Schwedischen von Senta Kapoun
Fischer e-books
Für Ylva
Es war ein Tag voller Sinnenfreude gewesen – bis sie die Leiche fand.
Sie war langsam gefahren und hatte ihre Freude an der nackten Landschaft gehabt, die sich der Sonne darbot, um zu neuem Leben zu erwachen.
An den Nordhängen des Kolmården war der Boden noch vorjahresgrau, aber in den Tälern zeigten die Birken schon grüne Mauseöhrchen. Während sie bergab der Ebene entgegenfuhr, sah sie Bråviken, die weite Bucht, in der Sonne glitzern und spürte den Wind vom Meer, den Wind, der nach Kindheit roch.
Nach einer Stunde hatte sie die Abzweigung erreicht.
Im Rückspiegel sah sie auf dem Schotterweg, der zum Haus hinaufführte, den Staub wirbeln und wusste, dass alles war, wie es sein sollte. Sie war heimgekehrt.
Es war ein altertümliches Anwesen, das niedrige Zweifamilienhaus lag im Schutz alter Apfelbäume und glatter Felsplatten. Es war jetzt seit fünfzehn Jahren in ihrem Besitz, und obwohl die Familie keine Wurzeln in dieser Gegend hatte, war es zu ihrem Mittelpunkt geworden, hier fühlten sie sich alle mehr zu Hause als irgendwo sonst.
Sie stieg aus dem Auto und räkelte sich in der warmen Sonne wie eine Katze. Im niederen Gras flochten die Buschwindröschen zum Brunnen hin weiße Klöppelspitzen, und noch bevor sie die Tür aufschloss, hatte sie einen Strauß gepflückt und ihre Nase hineingesteckt. Auch die Blumen rochen, wie es sich gehörte, nach Erde und Wasser, Vorjahrestod und neuem Leben.
Und, wie das Meer, nach Kindheit.
Aber der Blumenduft vermittelte auch Schmerz, und einen Augenblick lang sah sie die beiden vor sich, zwei kleine Mädchen am Buschwindröschenhang, dem Meer zugekehrt, in einer anderen, weit zurückliegenden Zeit.
Sie hatte Mühe mit dem Schloss, der Kolben schien dem Schlüssel nicht nachgeben zu wollen. Doch dann glitt die Tür auf, und sie stand auf der Schwelle und hörte die Fliegen summen. Während sie von Raum zu Raum ging, fühlte sie die Wärme, es war hier drinnen viel wärmer als draußen. Sie öffnete die Fenster und sah den Fliegen nach, die dem Wald und dem Abort zustrebten.
Sie hatte einen Kanister Wasser im Auto, konnte sich also Kaffee machen, ohne vorher die Brunnenpumpe in Betrieb nehmen zu müssen. Niklas hatte an das Wasser gedacht und war damit hinter ihr hergelaufen, als sie zu Hause schon aus der Garage gefahren war. Wie immer hatte seine Fürsorge sie irritiert, und wie immer hatte sie sich deswegen geschämt.
Im Schrank des blauen Zimmers stand die Vase aus Pressglas, die gerade so groß war, dass man sie mit der Hand umfassen konnte. Sie gehörte zu den wenigen Dingen, die noch aus ihrer Kindheit stammten, und als sie Wasser einfüllte, konnte sie wieder die beiden kleinen Mädchen sehen, die der Mutter ihre Sträuße überreichten. Sie sah die Küche, die Vase aus dem Küchenschrank, die unter dem Kaltwasserhahn über dem Zinkbecken gefüllt wurde, sah das Lächeln der Mutter.
Eine kleine Vase und zwei Sträuße Buschwindröschen.
Heute kommen die Dinge auf mich zu, dachte sie, drückte es dann aber anders aus: Heute bin ich offen, schrankenlos. Das ist schön, sagte sie sich, und sah die dotterblumengelben Flickenteppiche im Schein der Sonne leuchten.
Voll Vorfreude füllte sie den Kühlschrank. Ein Kilo Krabben, es war der reine Luxus, aber sie konnte Karins Lächeln sehen, das ihr verschlossenes Mädchengesicht aufhellen würde, wenn sie am nächsten Tag den Tisch deckten. Kalbsfilet, nun ja, sie hatte es sich etwas kosten lassen. Erdbeeren, echter Wahnsinn, und alle würden sagen, dass sie längst nicht so gut schmeckten wie die schwedischen. Bei den jungen Kartoffeln von den Kanarischen Inseln hatte sie sich beherrscht, Bintje in den schwarzen Wintertüten taten es auch, und vielleicht würde sie sie im Ofen garen, um das Willkommensessen noch festlicher zu gestalten.
Einstweilen begnügte sie sich mit Filterkaffee und zwei Scheiben Weißbrot mit Käse und Leberwurst. Bei der zweiten Tasse Kaffee schnitt sie sich noch eine Brotscheibe ab, bestrich sie dünn mit Marmelade und dachte, das muss bis heute Abend reichen.
Eigentlich sollte sie jetzt ihre Kleider auspacken, sollte nach oben gehen, lüften, die Betten machen. Und den Arbeitstisch abräumen, um für die Schreibmaschine und alle ihre Aufzeichnungen von der Griechenlandreise Platz zu schaffen. Das war ja der eigentliche Grund, warum sie vorausgefahren war, sie wollte sich für einen Tag hier verschanzen, um auszuwählen und zu planen.
Aber Sofia und ihr Dorf waren so weit weg, und sie selbst hatte hier alles, was sie an Nähe brauchte.
Wie ein Kind, dachte sie, als sie sich auf dem Sofa in der Kammer ausstreckte und einschlief, ohne sich vom Surren der Fliegen stören zu lassen.
Die Sonne weckte sie eine Stunde später auf, ein hartnäckiger Sonnenstrahl kitzelte sie in der Nase und färbte ihre Augenlider innen rosa. Ich sollte mich schämen, dachte sie, stellte aber durchaus zufrieden fest, dass sie sich nicht schämte, ganz im Gegenteil. Sie war zufrieden mit dem Tag, mit der Sonne, dem Fliegengesurr und der Freiheit.
Lieber Himmel, wie selten hatte sie einen Tag ganz für sich alleine.
Sie ging zum Pinkeln hinters Haus, hockte dort im Gras und hörte den Kuckuck im Wald rufen. Und vielleicht war es sein Lockruf, der ihre Sehnsucht nach den weichen Waldpfaden und den dunklen Bäumen weckte. Denn schon wenige Minuten später war sie in ihrem alten Pullover und mit Gummistiefeln an den Füßen unterwegs. Den ganzen langen Einödweg konnte sie sich nicht gönnen, sie musste Maß halten, obwohl sie gerne nachgesehen hätte, was in diesem Frühjahr drüben in der Lichtung auf dem Erbsenfeld angebaut worden war.
Ich mache die kleine Runde, dachte sie, und ganz von selbst fanden ihre Füße den Weg in die Kühle unter den hohen Bäumen. Genau nach Westen ging es, bei den Lärchen, die schon hellgrüne Spießchen zeigten, steil bergauf und dann zur von Unkraut überwucherten Ruine der alten Kate mitten am Hang. Sie lag geschützt an der Südseite, und wie erwartet blühten am Zaun schon die Schlehen.
Schließlich ging der Steig in den Waldweg über, dem sie eine Weile folgte, um dann die Richtung zu den Bergen im Norden einzuschlagen. Unter den Füßen wurde es trockener, es gab immer mehr Krüppelkiefern, das Moos staubte. Aber die Buschwindröschen begleiteten sie auch hier, und ohne viel nachzudenken pflückte sie noch einen Strauß.
Dort wo der Wald aufgab, wo der Boden sogar für den anspruchslosen Wacholder zu karg war, hörte sie den Elch. Sie war ihm schon früher hier begegnet, wusste, dass er nachmittags über den Berg wechselte, sie blieb stehen, versuchte sich unsichtbar zu machen. Aber dieses Mal bekam sie ihn nicht zu sehen, hörte nur das Knacken, als er kehrtmachte und wieder dem dichten Wald zustrebte.
Er hat meine Witterung aufgenommen.
Sie überquerte den Bergkamm und sah rechter Hand unten, wo der Boden den Bäumen wieder Halt gab, das Föhrenwäldchen und an dessen Rand einige hochstämmige Nadelbäume und eine ausladende alte Fichte. Dort hatte sie letzten Sommer Pfifferlinge gefunden.
Jetzt glaubte sie im Laub unter der Fichte eine Hand zu erkennen.
Aber noch lebte sie in der vibrierenden Wirklichkeit dieses Frühlingstages und dachte, es wäre ein früher, ungewöhnlich weißer Mairitterling.
Dann hörte die Welt auf zu vibrieren, ihr Körper hörte auf zu fühlen und zu reagieren. Wie eine Aufziehpuppe ging sie auf die Fichte zu, kniete sich hin, sah die Tote an, war sich bewusst, dass niemand mehr etwas für sie tun konnte und dass die merkwürdige Schmiere am Hinterkopf Gehirnmasse und Blut war.
Das Gesicht.
Sie stand auf, eigenartig kalt und entschlossen. Sie wusste, dass der kürzeste Weg nach Hause geradeaus ging, den Steig hinunter, dann links hinauf zum Haus.
Noch nie waren ihre Schritte so zielbewusst gewesen, sie sah nichts mehr, hörte nichts, dachte nicht. Erst als das Haus zwischen den Bäumen zu sehen war, kam ihr ein Gedanke: Vollbracht, endlich vollbracht.
Und: Ich darf nicht wahnsinnig werden.
Sie hatte den Türschlüssel in der Tasche, die Autoschlüssel waren im Schrank in der Kammer, die Brieftasche mit dem Führerschein ebenso. Als sie durch die Küche zurückging, blieb sie einen Moment in der Waschecke hinter der spanischen Wand stehen, fuhr sich mit einem Kamm durchs schwarze Haar, griff nach einem alten Lippenstift und gab ihrem Mund Kontur. Sie zitterte nicht, sie war ganz ruhig.
Aber sie schaute nicht in den Spiegel, der über der Waschschüssel hing.
Sie schloss das Haus ab, setzte mit dem Wagen zurück, wendete und fuhr los.
Nach Mjölby. Zur Polizeistation? Als die Ampel am Eisenbahnviadukt auf Rot stand, erkundigte sie sich ganz sachlich bei einem Radfahrer nach dem Weg. Er sagte, die Polizei habe neue Räume gegenüber dem Vergnügungslokal Kvarnen bezogen, und im selben Augenblick wusste sie, dass ihr das Staatswappen mit den drei Kronen schon öfter aufgefallen war.
Sie sah, dass die Sonne brannte und dass die Leute Jacken und Mäntel abgelegt hatten, und fand es merkwürdig, dass sie fror, dass ihre Finger abstarben und sie das Lenkrad kaum im Griff hatte.
Ein Tresen, ein junger Mann, und wie jung. Mit diesem Kind konnte sie doch nicht über die Frau sprechen, die da tot im Wald lag.
Also fragte sie ihn nach dem Oberinspektor. Seine schleppende östergötländische Mundart war genauso überlegen wie sein Lächeln, als er antwortete, der Oberinspektor sei beschäftigt und worum es denn gehe.
»Ich habe im Wald die Leiche einer Frau gefunden.«
Jetzt zeigte er zumindest Interesse.
»Vielleicht möchten Sie sich setzen? Ich hole Ihnen ein Glas Wasser.«
Ich halte das nicht aus, ich schreie, dachte sie, wusste aber im selben Augenblick, dass sie damit den Verdacht dieses Jünglings nur bestätigen würde.
»Hören Sie mal«, sagte sie. »Ich bin nicht hysterisch, ich heiße Lillemor Lundgren, ich bin Journalistin, Redakteurin in Stockholm. Wir haben ein Sommerhaus in den Einödwäldern, und dort habe ich soeben eine Frau gefunden. Tot, erschlagen, begreifen Sie?«
Das half, vielleicht war es der Titel, vielleicht kannte er den Namen, denn er nahm Haltung an und ging zu einer Tür und klopfte. Da setzte sie sich auf den ihr zugewiesenen Stuhl und bereute, dass sie das angebotene Glas Wasser abgelehnt hatte. Ihr Mund war quälend trocken.
Der Mann, der jetzt kam, war in ihrem Alter. »Nilsson«, sagte er und reichte ihr eine kräftige, warme Hand.
»Mein Gott, ist Ihnen kalt?«, sagte er. »Sie müssen einen Schock erlitten haben. Bitte erzählen Sie mir alles von Anfang an.«
»Nein«, sagte sie und wunderte sich über ihre Bestimmtheit. »Sie müssen mitkommen, jetzt, sofort.«
»Okay.« Aber der Zweifel in seinen blauen Augen verschwand nicht, als er einen Wagen mit Fahrer anforderte. Lillemor gab dem Jungen hinter dem Tresen ihre Personalien, trank ein Glas Wasser nach dem anderen leer, und als der Wagen kam, sagte Nilsson:
»Wir setzen uns nach hinten, dann können Sie erzählen.«
»Es gibt nichts zu erzählen«, sagte Lillemor. »Ich bin spazieren gegangen und habe sie unterwegs gefunden.«
Aber sie setzte sich auf den Rücksitz und war dankbar für die Menschlichkeit, die er ausstrahlte, als sie dem Fahrer den Weg zu erklären begann. Sie konnten bei Moby Gård abzweigen und von dort durch den Wald bis zum Fuß des Berges fahren.
Das weiße Polizeiauto schlängelte sich die Feldwege entlang, neugierig schienen die Fenster der kleinen roten Häuser ihr nachzustarren. Und zum ersten Mal dachte sie, es wird viel Gerede geben. Sie war schon wieder durstig, trotz der Wassermenge, die sie getrunken hatte, der Mund war so trocken, dass die Zunge klebte, als sie sagte:
»Hier müssen wir halten, weiter kann man nicht fahren.«
Sie ging auf dem ansteigenden Pfad voran und freute sich, dass Nilsson zu schnaufen anfing. Doch auf halbem Weg wollte sie ihn lieber vor sich haben; sie blieb stehen und ließ ihn vorbei. Als sie die weiße Hand sah, sagte sie:
»Ich warte hier.«
Kaum eine Minute danach rannte der Polizeibeamte, der den Wagen gefahren hatte, an ihr vorbei, und sie dachte, gleich wird Alarm geschlagen, endlich glauben sie mir.
Bilder zogen an ihr vorüber, verschwommene Bilder aus Kriminalfilmen – Fotografen, Ärzte, Ermittlungsbeamte. Das geht mich nichts an, dachte sie. Ich habe meinen Teil beigetragen.
Als aber Nilsson mit eigenartigem Gesichtsausdruck auf sie zukam, wusste sie, dass er es auch bemerkt hatte, und beschloss zu schweigen wie ein Grab.
»Sie haben die Tote gekannt«, sagte er, und sie stellte fest, dass sein Ton eine Nuance kühler klang.
»Nein. Ich habe sie noch nie gesehen.«
»Hm«, machte er. »Wir müssen auf die Leute von der Kriminalpolizei in Linköping warten.«
In seinen Worten schien eine geheime Drohung zu liegen, war das Absicht? Trotzdem sagte sie:
»Ich denke, ich kann nach Hause gehen.«
»Nein, Sie müssen noch zu Protokoll geben, was Sie im Wald beobachtet haben.«
Sie sah, dass alle Wärme aus seinem Gesicht gewichen war, und sie hätte am liebsten geschrien, ich habe sie gefunden, ich habe nichts angerührt, ich habe alles so gemacht, wie man es tun soll, bin sofort zu Ihnen gefahren, und warum, zum Henker, sind Sie jetzt so unfreundlich. Stattdessen sagte sie:
»Ich friere.«
Er war etwas freundlicher, als er sie zum Auto brachte, den Motor und die Heizung in Betrieb nahm und ihr eine Decke über die Knie legte.
»Ein Arzt wird bald hier sein«, sagte er. Und sie dachte, der spinnt und dass sie nicht nach Hause gehen wollte.
Zum ersten Mal an diesem Nachmittag konnte sie wieder etwas empfinden. Ich habe Angst, dachte sie. Ich habe entsetzliche Angst.
Ein paar endlose Sekunden lang sah er sie an, wie sie da in eine Decke gehüllt im Auto saß. Sie hatte die Augen geschlossen, aber er wusste, dass sie nicht schlief.
Das ist verrückt, dachte er und versuchte der Unwirklichkeit standzuhalten und die Tatsachen zu registrieren: das dreieckige Gesicht mit den hohen Wangenknochen, den ausdrucksvollen Mund mit dem steilem Venusbogen und einem Anflug von Verbitterung in den Mundwinkeln, wie bei einem Kind, das mehr haben will, als das Leben zu geben bereit ist.
Zartgliedrig, sehr dunkel, sonnengebräunt. Verletzlich? Und älter, bedeutend älter …
Sie musste gefühlt haben, dass sie beobachtet wurde, denn sie schlug langsam die Augen auf, die erstaunlich blau waren.
»Ich hatte eine Schwester«, sagte sie. »Sie ist gestorben.«
Er wusste, dass sie einen Schock erlitten hatte. Nilsson, der immer zu einfachen Schlussfolgerungen neigte, hätte es so ausgedrückt: total geschockt. Und er dachte an den Arzt, der jeden Augenblick hier sein und der Befragung ein Ende setzen konnte.
»Warum denken Sie jetzt an Ihre tote Schwester?«, fragte er und spürte, dass seine Stimme nach so etwas wie Mitgefühl klang, nach Sympathie, die ihm selbst nicht bewusst geworden war.
»Es ist alles so unwirklich«, klagte sie.
»Wir werden das aufklären«, sagte er mit einer Zuversicht, die ihm fremd war. »Ich glaube, es wäre gut, wenn Sie sich ein bisschen bewegten. Kommen Sie mit raus und erzählen Sie mir von Ihrem Spaziergang und wie Sie sie gefunden haben.«
Nilsson hatte ihm gesagt, sie verweigere die Zusammenarbeit, trotzdem nickte sie und stieg mit der Decke über den Schultern aus dem Wagen.
»Ich friere«, sagte sie.
»Ja, das ist so, wenn man einen Schock erlitten hat.« Da lächelte sie, es war ein schwaches, überraschendes Lächeln.
»Sie stammen aus Norrland?«
Und sein Lächeln bestätigte es: Ja, und er heiße Valter Enokson und sei bei der Kriminalpolizei in Linköping. Ihre Hand war eiskalt, der Druck aber kräftig.
»Ich bin von da drüben gekommen und den Waldweg ein Stück entlanggegangen«, sagte sie. »Ich gehe hier öfter mal spazieren. Ich habe an nichts Besonderes gedacht. Das Schöne an Waldspaziergängen ist ja, dass man aufhört zu grübeln.«
»Sie meinen, man hört auf, bestimmte Dinge immer wieder durchzukauen?«
Sie warf ihm einen anerkennenden Blick zu und nickte dann:
»Ich habe Blumen gepflückt. Und weiter oben am Berghang habe ich einen Elch gehört.«
»Gesehen haben Sie ihn nicht?« Er konnte seinen Tatendrang nicht unterdrücken, und sie wunderte sich:
»Nein.«
»Aber wieso wussten Sie …?«
»Hier verläuft ein Elchpfad«, sagte sie. »Ich bin ihm nachmittags schon öfter am Hang begegnet und habe mich jedes Mal darüber gefreut. Also bin ich ruhig stehen geblieben wie immer und hab versucht, mich unsichtbar zu machen. Aber er hatte meine Witterung aufgenommen und hat kehrtgemacht, ich hab gehört, wie weiter unten im Wald die Zweige knackten.«
»Das mit dem Elch müssen wir wohl etwas gründlicher untersuchen«, sagte er und sah, dass sie nicht verstand, was er meinte, aber doch bereitwillig nickte.
Er hatte vier Mann vor Ort, zwei von ihnen gingen mit, als sie ihren Weg rekonstruierte, den Hang hinaufging, stehen blieb, als könnte sie den Elch hören, eine Weile stillstand und dann zum Wald hinunterzeigte, in dem das große Tier verschwunden war …
Erst als sie wieder mit Enokson allein war, schien sie zu begreifen; ihre Augen weiteten sich und suchten seinen Blick:
»Sie meinen, möglicherweise war das …?«
»Möglich«, sagte er. »Sie war ja noch nicht lange tot.«
Wieder befiel sie Schüttelfrost, und sie wiederholte: »Ich friere.« Also zog er sie an sich und massierte ihr Oberarme und Rücken. Es wäre gut, wenn sie weinen könnte, dachte er, aber ihre Augen blieben trocken, und sie war steif wie ein Brett.
»Einfach verrückt«, sagte sie, und er erinnerte sich, dass ihm genau dieser Gedanke gekommen war, als er sie vom Auto aus betrachtet hatte.
»Ich glaube, ich habe eine Flasche Mineralwasser in meinem Wagen«, sagte er. »Kommen Sie, gehen wir sie holen.«
Das Wasser war lauwarm, trotzdem trank sie die Flasche in einem Zug leer, seufzte und fuhr sich mit dem Handrücken über den Mund:
»Danke, das hat gut getan.«
Er hatte ein schlechtes Gewissen, als er fortfuhr:
»Sie haben Buschwindröschen gepflückt?«
Sie nickte.
»Jetzt muss ich Sie um einen Gefallen bitten«, fuhr er fort. »Ich möchte, dass Sie mit mir zu der Fichte hinaufgehen und sich die Tote noch einmal ansehen.«
»Die Tote?«
»Ja.«
»Gott steh mir bei«, sagte sie, und da er ein Christenmensch war, hörte er sofort, dass sie es nicht so meinte und dass Beten nicht zu ihren Gewohnheiten zählte. »Warum denn?«
»Ich möchte, dass Sie nachsehen, ob etwas verändert ist.«
»Gott im Himmel«, sagte sie noch einmal, nickte aber und begann entschlossen, als wolle sie es schnell hinter sich bringen, den Weg bergauf zu gehen. Er folgte ihr. Als sie sich der Fichte näherten, legte er ihr die Hand auf die Schulter:
»Es könnte auch Ihnen helfen. Das Erinnern fällt leichter.«
»Aber ich will mich nicht erinnern.«
»Eben deshalb«, sagte er.
»Ich habe meine tote Schwester nie gesehen.« Sie flüsterte jetzt, und er konnte das, was folgte, nur schwer verstehen.
»Ich war in Amerika, als sie starb.«
Sie fiel wieder neben der Toten auf die Knie und schaute ihr wie vorhin lange in die offenen Augen.
Es waren braune Augen.
Doch im Übrigen war alles so, wie sie befürchtet hatte, das dreieckige Gesicht und der kühne Mund. Enokson schien es, als sähe sie sich selbst in einem Spiegel, aber nicht jetzt, sondern in einer weit zurückliegenden Vergangenheit, ein Bildnis der Jugend, Unsicherheit und Gier.
»Sie ist höchstens zwanzig Jahre alt«, sagte Lillemor, und in ihrer Stimme lagen eine Erschütterung und eine Trauer, als hätte sie endlich begriffen, dass ein Leben ausgelöscht worden war, dass diese junge Frau einen eigenen Blutkreislauf, eine eigene Existenz gehabt hatte. Und dass etwas Unverzeihliches geschehen war.
»Können Sie erkennen, ob etwas verändert worden ist?«
Sie ließ den Blick an dem toten Körper entlangwandern, offensichtlich nicht wissend, dass Enoksons ganze Aufmerksamkeit intensiv auf sie gerichtet war.
Dann schrie sie auf:
»Die Blumen, Gott, die Blumen!«
»Die haben nicht Sie ihr gegeben?«
»Nein, nein.«
»Aber Sie hatten doch einen Strauß gepflückt.«
Verwirrt wie ein kleines Kind sah sie sich um und sagte dann:
»Den muss ich irgendwo verloren haben.«
Dann schrie sie:
»Ich habe nichts angerührt, ich schwöre, ich habe sie nicht berührt. Nie, nie hätte ich es gewagt, ihr meine Blumen in die Hand zu geben.«
»Ich muss Ihnen wohl glauben«, sagte er, und beide sahen auf den sorgsam geformten Strauß in der Hand der Toten:
»Ihnen ist klar, was das bedeutet?«
»Ja, er hat es bereut.«
Enokson war erstaunt und dachte, dass Frauen nun einmal so denken. Trotzdem schüttelte er den Kopf:
»Da bin ich mir nicht sicher. Aber wenn Sie … sich richtig erinnern, muss er hier gewesen sein, nachdem Sie den Ort verlassen hatten.«
Sie schloss die Augen, sie war jetzt so blass, dass es ihn beunruhigte:
»Woran denken Sie?«
»Ich denke dasselbe, was ich dachte, als ich nach Hause ging, um den Wagen zu holen, nämlich dass ich nicht wahnsinnig werden darf, dass ich unter gar keinen Umständen wahnsinnig werden darf.«
»Ist Ihnen dieser Gedanke schon öfter gekommen?«
»Selten. Aber doch einige Male in meiner Jugend und … im Chaos.«
Jetzt hörten sie unten auf dem Waldweg weitere Autos, und endlich kam der Arzt zusammen mit einem beredten und heftig gestikulierenden Nilsson den Steig herauf. Es war ein junger Arzt, so jung, dass er glaubte, seine gewaltige Verblüffung verbergen zu können, als sein Blick von der lebenden Frau zu der Toten wanderte. Genau wie Enokson befürchtet hatte, widmete er sich erst der lebenden, fühlte ihr den Puls und sagte, sie dürfe sich nicht mehr aufregen, sie brauche Wärme und etwas zu trinken.
»Am liebsten würde ich Sie in Linköping in ein Krankenhausbett stecken«, sagte er, und Enokson dachte, die Chance wird sie sich nicht entgehen lassen, und das müsste er wohl akzeptieren. Aber sie lehnte mit fester Stimme ab.
»Ich schaffe das schon. Aber ich möchte nicht gern allein bleiben … in unserem Sommerhaus.«
»Ich werde Sie so bald wie möglich hinbegleiten«, sagte Enokson und wechselte einen Blick mit dem Arzt, der zustimmend nickte.
Er gab seine Anweisungen, was unnötig war, weil alle wussten, was sie zu tun hatten. Und der Arzt, der jetzt neben der Toten kniete, konnte eigentlich nur bestätigen, was er schon wusste, dass die junge Frau noch nicht lange tot war.
»Zwei Stunden?«
»In etwa.«
Als sie den Pfad zum Haus entlanggingen, fragte Enokson, was sie gedacht hatte, als sie vorhin hier gegangen war.
»Aber das sagte ich doch schon, dass ich nicht wahnsinnig werden darf. Und dann …«
»Was dann?«
»Wie dumm es ist, dass wir hier kein Telefon haben.«
Zum ersten Mal log sie, und er fragte sich, warum.
Enokson konnte Sommerhäuser nicht leiden, und dieses hier, das sich am Boden entlangduckte, war von der allerübelsten Sorte. Auf der Steinplatte vor der Haustür lag ein welker kleiner Strauß Anemonen, und Lillemor sagte:
»Ich muss sie in die Tasche gesteckt haben, und als ich den Schlüssel herausnahm, müssen sie mitgerutscht sein.«
»Wir lassen sie liegen«, sagte Enokson, und zum ersten Mal sah sie ihn wachsam an.
»Warum das?«
»Ich will sie fotografieren lassen.«
»Warum, zum Teufel, verdächtigen Sie mich?«
Sie schrie es heraus, und er dachte, sie hat etwas Primitives an sich, angriffslustig, vorwurfsvoll. Und er sagte:
»Lillemor, haben Sie ein Kind geboren, als Sie jung waren? Eine Tochter, die Sie zur Adoption freigegeben haben?«
Ihre Verwunderung war so groß, dass ihr Zorn sich legte. »Ich glaube, Sie sind verrückt. Was für ein idiotischer Gedanke.«
Er lächelte, er fühlte sich plötzlich erleichtert, zuckte mit den Schultern und sagte:
»Polizisten haben nun mal eine seltsame Phantasie. Möchten Sie nicht aufschließen?«
Sie ging sofort auf den Kühlschrank zu, nahm eine Zweiliterpackung Orangensaft heraus und trank, als hätte sie eine lange Wüstenwanderung hinter sich. Er blickte sich im Haus um, ging durch die kleinen Räume und bemerkte unwillkürlich den guten Geschmack, der bis ins kleinste Detail stimmte, sah die feinen Abstufungen, die gefälligen Möbel, die ausgewogene Farbgebung.
»Es ist sehr schön hier«, sagte er trocken, und Lillemor schien erstaunt und ein wenig verletzt.
»Ich glaube, ich durchschaue Sie, Walter Enokson.«
»Da bin ich mir nicht so sicher«, sagte er und verzog den Mund. »Ich bin kein Altachtundsechziger.«
Jetzt lachte sie:
»Was sind Sie denn dann?«
»Ich bin Norrländer, wie Sie selbst festgestellt haben. Und wir hinken immer ein bisschen nach. Das bedeutet, um ein Beispiel zu nennen, dass ich in Katen wie dieser gelebt habe, als es dort noch nach Armut und Vorurteilen roch.«
Sie nickte und sagte, dass sie manchmal an den Schuster denken musste, der mit seinen vielen Kindern hier gewohnt hatte und ein Säufer gewesen war, bevor er zum fanatischen Antialkoholiker wurde. Dass das aber nichts mit dem Gefühl von Frieden und Heimkehr zu tun hatte, das das Haus ihr schenkte.
Plötzlich redete sie ungehemmt drauflos, mit ihrem Wortschwall wollte sie die Wirklichkeit wiederherstellen, in der sie noch vor wenigen Stunden gelebt hatte. Sie erzählte von der großen Schustersfamilie, von den sieben Kindern, die hier aufgewachsen waren, von den Gesellen, die kamen und gingen.
»Man stelle sich schon allein das Essenkochen in dieser armseligen Küche ohne Wasserhahn und Ausguss vor. Es gab nicht einmal Strom, keinen Kühlschrank, nichts …«
»Frauenarbeit«, sagte sie. »Manchmal denke ich mir, die Welt wird nur von der geduldig ertragenen Frauenmühsal zusammengehalten.«
»Ja«, sagte er und erinnerte sich, dass sie eine bekannte Feministin war, kämpferisch und wortgewandt.
»Man sieht das in Griechenland noch heute«, sagte sie, und plötzlich war er mit ihr über die Schwindel erregenden Bergketten unterwegs zu dem Dorf, in dem Sofia lebte. Gegen seinen Willen wurde sein Interesse geweckt, und sie ging die Tasche mit den Notizen, dem Tonbandgerät, den Kassetten und Fotos, ganzen Stößen von Fotografien holen. Er sah die Berge und das Dorf, das sich gegen den blauen Himmel abzeichnete, eine Ansammlung von Häusern klammerte sich an einem Felsvorsprung fest. Und dann war da eine größere Anzahl Nahaufnahmen von einer jungen Frau, die mit intelligenten Augen direkt in die Kamera schaute. Die Frau war schwanger.
»Das vierte Kind in ebenso vielen Jahren«, sagte Lillemor und erzählte von Sofia, dem Einwandererkind aus Rinkeby, hungernd nach Wissen und eigenem Grund und Boden, auf dem es Fuß fassen konnte. Bis sie eines Tages ihren griechischen Verlobten heiratete, der um so vieles dümmer war als sie.
»Um so vieles weniger entwicklungsfähig«, sagte sie und merkte nicht, dass Enokson den Mund verzog.
»Er hat die merkwürdige Fähigkeit abzuschalten, sobald eine Frau spricht. Ein fast urtümlicher Reflex. In einer Zweizimmerwohnung lebt man gleichberechtigt, sollte man meinen, und vielleicht hat er manchmal abgewaschen. Aber er hatte zwei Jobs und einen einfachen Traum, und eines Tages hatte er sein Ziel erreicht, eine Autowerkstatt zu Hause in seinem griechischen Dorf.«
Lillemor seufzte.
Also kehrte Sofia mit einem Kind auf dem Arm und einem im Bauch in ihre Kindheit zurück, diese strahlende junge Frau, die mit Lillemors Hilfe auf der Frauenvolkshochschule einen Kurs nach dem anderen absolviert hatte.
»Sie hat sich entwickelt, dass sich die Balken bogen«, sagte Lillemor.
Und jetzt hatte sie Sofia also besucht, eine Frau, umgeben von Frauen wie einem Haufen schwarzer Krähen, die alle zusammen geduldig die steinigen Felder mit der Hacke bestellten. Es war, als hätte es die Schwedenjahre für Sofia nie gegeben.
»Sie hat sich ihrem Schicksal gebeugt und wird mit vierzig eine alte Frau sein«, sagte Lillemor. »Das Schlimmste ist, dass sie es weiß und sich damit zufrieden gibt. Sie meint, der Mensch hört zu existieren auf, wenn er aus dem ihm zugemessenen Rahmen fällt, dass das einzelne Individuum die Lücken im Leben nie ausfüllen kann.«
»Sie hat also nicht zu denken aufgehört«, sagte Enokson.
»Nein, nein, sie hat immer noch ihren scharfen Verstand. Ich habe die langen Interviews mit ihr hier auf Band, ich muss das alles nur erst auswerten, es könnte ein Buch draus werden.«
»Aber es … es beunruhigt Sie ein bisschen?«
»Ja. Sie war so überzeugend. Aber man kann das Leben schließlich nicht auf eine einzige Rolle in einem klassischen Trauerspiel beschränken.«
Das war unmittelbar an ihn gerichtet, aber sein Gesicht blieb unbewegt, und ihr Blick wandte sich dem Fenster im Westen zu, wo die Sonne unterging. Mit großen Augen sagte sie:
»Ich muss Niklas anrufen. Und ich will die Nacht nicht alleine hier verbringen, ich fahre mit Ihnen nach Mjölby und übernachte im Stadthotel.«
Er war erleichtert, er hatte angenommen, sie werde schwer zu überreden sein. Er half ihr, Aufzeichnungen und Fotos wieder in der Tasche zu verstauen, und sie ging ihr Nachtzeug packen. Dann fiel ihr ein, dass sie ihre Kleider ja noch gar nicht ausgepackt hatte. Sie seufzte und holte Bier und Gläser.
»Leben Ihre Eltern noch?«
»Mein Vater ist tot«, sagte sie. »Meine Mutter …«
Sie vollendete den Satz nicht, ihr Blick flackerte, bis sie Enokson schließlich fixierte:
»Warum wollen Sie das wissen?«
»Ich will einige Auskünfte über Ihre Schwester, über ihren Tod einholen.«
»Die können Sie von meiner Mutter nicht mehr kriegen. Sie lebt in einem Altenpflegeheim in Göteborg und hat noch den Verstand einer Zweijährigen.«
»Verstehe.«
»Nein, das verstehen Sie nicht. Niemand kann verstehen, wie das ist, eine Mutter und trotzdem keine Mutter zu haben.«
»O doch«, sagte Enokson, und die Schatten wanderten durch seinen Kopf, schwarzweiße Bilder von der Mutter, die in dem übel riechenden Saal lag, ohne ihn zu erkennen.
»Meine Mutter ist voriges Jahr im Altenpflegeheim in Luleå gestorben«, sagte er. »Sie litt sieben Jahre lang unter Altersdemenz.«
»Verzeihen Sie mir.«
Sie waren schon an der Tür, als sie fragte:
»Es wird einfacher, wenn sie schließlich tot sind … oder?«
»Irgendwie. Es tut gut, nicht mehr hoffen zu müssen.«
»Darauf, doch wiedererkannt zu werden?«
»Vielleicht. Aber danach wird man verdammt einsam.«
Sie blieb zusammengesunken und mit feuchten Augen mit dem Schlüssel in der Hand auf der Felsplatte vor der Haustür stehen. Enokson nahm ihr den Schlüssel ab und sperrte zu. Als er ihn zurückgab, drehte sie seine Hand um und sah sich den Ehering genau an.
»Sind Sie glücklich verheiratet?«
»Ja«, sagte er. »Wir passen zusammen.«
Bis der Polizeiwagen kam, um sie abzuholen, gingen sie noch kurz ums Haus und sahen, wie die Osterglocken sich auf der Südseite durch die braune Erde schoben.
Eine Stunde später saßen sie auf dem Revier in Mjölby, und Enokson telefonierte mit Lillemors Mann in Stockholm.
»Ein Mord.« Niklas Lundgrens Stimme überschlug sich.
»Und keine Spur vom …?«
»Nein. Ihre Frau übernachtet im Stadthotel, da steht sie gleichsam unter unserem Schutz. Nicht dass ich annehme … aber trotzdem.«
»Lieber Himmel. Und es war Lillemor, die …?«
»Ja«, sagte Enokson und verschwieg das Schwierigste, das Unbegreifliche. »Möchten Sie mit ihr sprechen?«
Er übergab den Hörer und hörte staunend, wie klein und schwach sie wurde, als sie sagte, sie habe einen Schock und er, Niklas, müsse sofort kommen. »Bring die Kinder nicht mit«, sagte sie. »Hörst du, bring die Kinder nicht mit. Sprich mit Oma, bitte sie, dass sie zu den Kindern kommt.«
Als sie den Hörer auflegte, schien sie verlegen.
»Sind Sie glücklich verheiratet?«
»Ja«, sagte sie. »Wir passen zusammen. Vielleicht viel zu gut.«
Niklas Lundgren hatte die Fähigkeit entwickelt, große Gefühle so zu zerlegen, dass er leichter damit fertig wurde.
Natürlich erschrak er, als die Polizei bei ihm anrief, aber als er für die Kinder alles in die Wege leitete, sagte er sich, das Geschehene sei zwar unangenehm, aber mehr auch nicht. Es wurden nun mal Leute umgebracht. Es kam nicht oft vor, aber immerhin, es kam vor. Jemand fand eine Leiche in einer Wohnung oder unter einer Fichte im Wald. Der Rest war Sache der Polizei.
Klar war es für Lillemor kein angenehmes Erlebnis. Sie tat ihm auch Leid, weil er wusste, wie wichtig ihr die Waldspaziergänge in der Umgebung des kleinen Sommersitzes waren. Immer wieder hörte er sie sagen, dass der Wald sie heilte. Aber das war nur so ein typischer Lillemor-Satz, eine dramatische Formulierung, um der Formulierung willen. Seine Frau lebte von Worten. Das war eine der Seiten, die ihn an ihr störten.
Sie war nicht innerlich zerrissen, ganz im Gegenteil. Gewiss, es gab einige Risse in ihrem Selbstvertrauen. Aber Lillemor hatte großes Geschick darin entwickelt, diese zu übertünchen. Sie würde über die ganze Sache hinwegkommen. Wenn die Schockwirkung erst nachließ, würde sie wie er sehen, dass das, was passiert war, sie nichts anging.
Er musste zwar zugeben, dass es nicht angenehm war, wenn in den Wäldern dort unten ein Mörder frei herumlief, und dass die Polizei glaubte, Lillemor beschützen zu müssen. Er las keine Kriminalromane, schaute sich im Fernsehen aber doch ab und zu einen Krimi an und wusste, dass dem, der zu viel gesehen hatte, Gefahr drohte.
Konnte der Kommissar vielleicht gemeint haben, dass sie etwas gesehen hatte, das bedrohlich für sie war?
Aber die Polizei versteht ihre Arbeit, die erwischen den Täter.
Den Kindern erzählte er nur die halbe Wahrheit, dass sich nämlich in den Wäldern beim Sommerhaus ein Mörder herumtrieb. »Und drum dürft ihr jetzt nicht mitkommen.«
»Und Mama?«, sagte Karin, und ihre Augen weiteten sich vor Angst und Entzücken.
»Mama ist bei der Polizei. Die verhören alle, die in der Gegend wohnen.«
»Und dann?«
»Sie übernachtet im Stadthotel in Mjölby und wartet dort auf mich.«
Die Kinder erwiesen sich als sehr kooperativ. Die dreizehnjährige Ingrid rief bei der Oma an und bat sie herzukommen. Er selbst stopfte das Notwendigste in eine Tasche und dachte, ich muss, verdammt nochmal, meine Gedanken zusammenhalten. Da klingelte das Telefon schon wieder. Das Gespräch kam von einem Automaten, er konnte das Klicken von Münzen hören.
»Ich bin aus dem Hotel abgehauen. Ich glaube, die überwachen meinen Telefonanschluss.«
»Wer?«
»Die Polizei.«
»Wo bist du denn?«