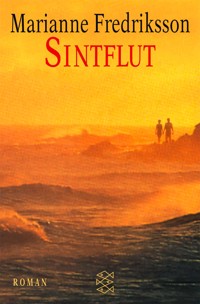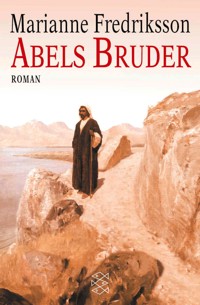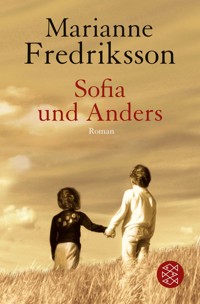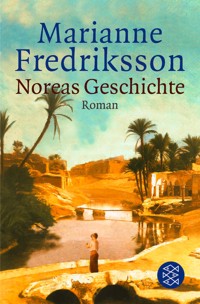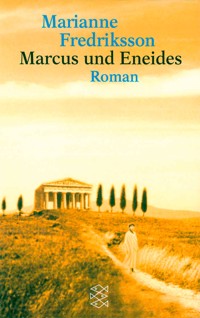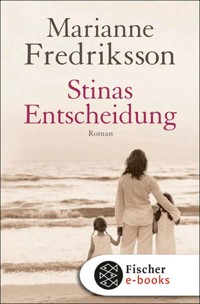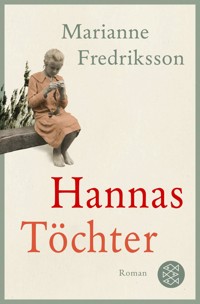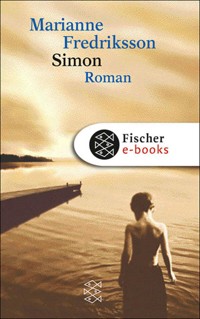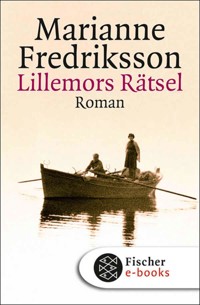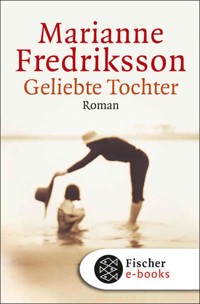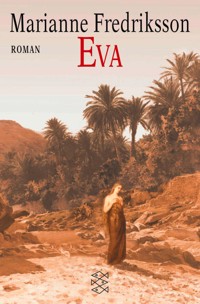
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eva ist erfüllt von Sorge: Ihr ältester Sohn hat den jüngeren getötet. Um begreifen zu können, was eigentlich geschehen ist, muss sie die Spuren ihres eigenen Lebens zurückverfolgen. Eva macht sich auf den Weg zurück in das Land ihrer Herkunft - ins Paradies. In ihrem ersten Roman, der sie in Schweden auf Anhieb bekannt machte, erzählt Marianne Fredriksson nachdenklich und voller Phantasie von Evas Suche nach dem eigenen Ursprung und eröffnet zugleich ganz unpathetisch ein neues Verständnis von Schöpfungsgeschichte und "Sündenfall" aus weiblicher Sicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Marianne Fredriksson
Eva
Roman
Roman
Über dieses Buch
Eva ist erfüllt von Sorge: Ihr ältester Sohn hat den jüngeren getötet. Um begreifen zu können, was eigentlich geschehen ist, muss sie die Spuren ihres eigenen Lebens zurückverfolgen. Eva macht sich auf den Weg zurück in das Land ihrer Herkunft - ins Paradies. In ihrem ersten Roman, der sie in Schweden auf Anhieb bekannt machte, erzählt Marianne Fredriksson nachdenklich und voller Phantasie von Evas Suche nach dem eigenen Ursprung und eröffnet zugleich ganz unpathetisch ein neues Verständnis von Schöpfungsgeschichte und "Sündenfall" aus weiblicher Sicht.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Marianne Fredriksson wurde 1927 in Göteborg geboren. Als Journalistin arbeitete sie lange für bekannte schwedische Zeitungen und Zeitschriften. Im Jahre 1980 veröffentlichte sie ihr erstes Buch. Sämtliche Romane der Autorin wurden in Deutschland große Bestsellererfolge. Die Autorin starb am 12. Februar 2007.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Vorwort
EVA
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Vorwort
Manche modernen Historiker betrachten die Menschheitsgeschichte aus einer anderen als der üblichen Perspektive. Sie gehen bei der Beschreibung der geschichtlichen Epochen von der Entwicklung der menschlichen Psyche aus. Zu den bekanntesten unter ihnen gehört der Schweizer Jean Gebser. Eine Zusammenfassung seiner Theorie findet sich in Ken Wilbers ›Halbzeit der Evolution‹.
Aus Gebsers Sicht hat die Menschheit vier große Phasen durchschritten: das archaische, das magische, das mythische und das mental-rationale Zeitalter.
Der archaische Mensch empfand sich als eins mit der Natur, mit allem, was er sah und erlebte. Er entwickelte kein Ich und hatte daher keinen Gegenpol.
Gegen Ende dieser Epoche begann ein schattenhaftes Ich Form anzunehmen, eine Trennung fand statt (der Sündenfall?). Der Mensch wurde sich seines Körpers bewusst, seiner Psyche und des Todes. Angst wurde geboren, Strategien zum Schutz des Lebens bildeten sich heraus. Die dabei angewandte Verteidigungshaltung war hauptsächlich magischer Natur.
Gebser und andere sind der Ansicht, dass der Mensch jener Epoche eine Art Fähigkeit zur Kommunikation mittels der Parapsychologie besaß. Er stand in telepathischer Verbindung mit den Geistern der Bäume und Flüsse, er konnte ›um die Ecke sehen‹, manchmal auch in die Zukunft.
Im dritten großen Zeitalter begriff der Mensch die Welt und sich selbst durch die Mythen. Im Laufe der mythischen Epoche trat die Menschheit in das Licht der Geschichte, und an den großen Mythen, wie denen der Bibel, können wir ablesen, wie Jahrtausende altes Wissen über all das, was geschehen ist, uminterpretiert wurde. Während der mythischen Epoche besaß der Mensch auch die Fähigkeit, sein eigenes Inneres zu verstehen, denn Mythen und Symbole sprechen den ganzheitlichen Menschen an und nicht nur den Intellekt, der später dominieren sollte.
Schließlich siegte die Ratio, und die Menschheit erreichte das mentale Zeitalter, in dem wir jetzt leben. Es begann mit den Griechen, mit der Geburt des logischen Denkens und der wachsenden Kenntnis, wie man mit Vernunft und Verstand das Leben schützen und die Angst im Zaum halten kann.
Gebser ist der Ansicht, jeder Epochenwechsel sei mit einem Verlust verbunden gewesen. Im Laufe der Entwicklung verloren wir zum Beispiel unsere magischen Fähigkeiten, die Welt intuitiv zu verstehen, und allmählich kam auch unser mythisches Empfinden für Symbole und Ganzheit abhanden.
Ich wusste noch nichts von Gebser, als ich die Trilogie über die erste Familie schrieb. In meiner Legende tritt sie auch gar nicht als erste Familie auf, sondern bei mir sind es Menschen im Grenzland zwischen unterschiedlichen Kulturen. Aber ich war getrieben von einer ungeheuren Neugierde, die kindliche Entwicklung betreffend, neugierig zu ergründen, was geschieht, wenn das Kind von einer Entwicklungsstufe zur nächsten voranschreitet – was es dabei gewinnt und was es verliert.
Deshalb wurde die Begegnung mit dieser anderen historischen Sichtweise so interessant. Es ist ja offensichtlich, dass jedes Kind mit der Geburt die lange Geschichte der Menschheit auf Erden wiederholt. Jeder Einzelne von uns durchlief einmal eine archaische Phase, wo er nicht zwischen sich und der Brust, der Mutter und der Welt unterschied. Dann wechselten wir in die magische Phase und verteidigten unser neu entdecktes Ich (»Kann ich selbst.«) mit den magischen Methoden (»Dummer Stuhl!«). Noch später befanden wir uns in der Welt der Mythen, wo wir lernten, mit Hilfe des Märchens uns selbst und die Welt zu verstehen, um schließlich auf der Schulbank zu landen und uns im Denken von Ursache und Wirkung zu üben, logisch und linear. Für die meisten von uns bedeutete dies, die Fähigkeit des unmittelbaren Erlebens, die magische Kognition und das Ganzheitsgefühl zu verlieren, das die Mythen uns schenkten.
Vor noch nicht allzu langer Zeit war viel die Rede vom Paradies der Kindheit. Jetzt wissen wir es besser, psychologische Forschungen haben klar gezeigt, wie schmerzhaft und voller schicksalsschwerer Missverständnisse die wichtigen Kindheitsjahre sind. Von Freud bis zu Alice Miller hat die Offenlegung der Kindheit gezeigt, dass frühe traumatische Erlebnisse lebenslange psychische Schäden verursachen können. Das sind wesentliche Erkenntnisse, die vielleicht auf lange Sicht Respekt vor Kindern fördern und einen gesünderen Menschen schaffen können.
Trotzdem ist der Mythos von der glücklichen Kindheit schwer auszurotten, denn in jedem von uns steckt die Erinnerung an einen ozeanischen Zustand jenseits der Zeit, in einer Welt, die gut war und selbstverständlich. »Als Unschuld und Frieden unseren Spuren folgten.« Dies ist eine nachträgliche Interpretation, es gibt keine Forschungen über die glückliche Kindheit. Die Wissenschaft ist am Glück ebenso wenig interessiert wie beispielsweise an der Gesundheit.
Meine Romantrilogie über Eva, Kain und Norea spielt in einer Welt, wo sich das Archaische mit dem Magischen verbindet, das Mythische mit dem Logischen, wo die unterschiedlichen Weltanschauungen oder Entwicklungsstadien Seite an Seite leben dürfen. Edens archaische Menschen jenseits von Gut und Böse, ohne einschränkendes Ich und ohne Zeitgefühl, werden Objekte für die Mission von Magiern und Schamanen aus dem mythischen Königreich Nod. Eva selbst bewegt sich zwischen den unterschiedlichen Welten wie eine Repräsentantin der modernen, logischen, vernünftigen und nach Erkenntnissen suchenden Menschheit. Auch Kain ist eine moderne Figur, der sich schuldig fühlende Mensch unserer Zeit ohne Zugang zur Versöhnung. Erst Norea – Evas und Adams jüngste Tochter, wird zur Grenzüberschreitenden, die ihren festen Platz in den unterschiedlichen Welten beibehält und sich deren Erkenntnisse zunutze macht.
EVA
Kapitel 1
Sie ging nach Osten, den Felsgrat entlang, den die Natur in den Südhang des Berges geschnitten hatte. Hier war es nicht mehr so steil, dennoch strengte sie sich bis zum Äußersten an und wusste, ohne dass sie nachzudenken brauchte, die Qualen des Körpers würden sie von den Gedanken befreien.
Es war mitten am Tag. Die Sonne stand hoch, und unaufhörlich musste sie den Schweiß von den Augen wischen, um überhaupt sehen zu können, wohin sie ihre Füße setzte. Klettern, Fuß fassen, die Hitze – es war mehr als genug für den Augenblick.
Bald würde sie den Gipfel erreichen, ausruhen, sich ganz der Aussicht über das Tal, den Fluss und die flimmernde Waldlandschaft am Horizont im Osten hingeben. Von hier aus hatte sie noch zwei Tagesmärsche vor sich.
Sie war auf dem Weg zurück in eine Welt, die sie vor langer Zeit verlassen hatte. Dort hoffte sie, Antwort auf ihre Fragen zu finden.
Dann wollte sie zu dem Mann zurückkehren, der bei der Höhlenbehausung auf sie wartete. Und zu dem Jungen mit dem brennenden Blick.
Der Wind wurde frischer, endlich kam sie dem Gipfel näher. Noch erlaubte sie sich nicht, stehen zu bleiben und den Blick schweifen zu lassen, auszuatmen und den Ledersack mit dem Wasser hervorzuholen, um zu trinken, obwohl Mund und Rachen beinahe ausgetrocknet waren. Vielleicht dachte sie, das Wasser in dem Sack sei warm und eklig geworden, vielleicht setzte sie ihre Hoffnung auf das noch immer eiskalte, wirbelnde Wasser des herabbrausenden Baches, obwohl es bereits weit im Sommer war. Ach, wie deutlich erinnerte sie sich an diesen Wasserfall, unter dem der Mann und sie herumgesprungen waren, nackt, voller Lust; Haut, Haare, Mund und Bauch hatten dieses glitzernde, sprudelnde und lebensspendende Wasser in sich aufgenommen. Es war in jenem Frühjahr gewesen, als alles neu war, wo alles einen Namen bekommen sollte. Nun war es Spätsommer.
Unwillkürlich richtete sie ihr Ohr auf das Brausen des Wasserfalls, doch sie empfing andere Signale. In den Farnsträuchern an der Felswand raschelte es leise, ein trockenes, heimliches Rascheln.
Jetzt war ihr Körper gespannt, wachsam, bereit zu handeln, da – schwach zeichnete sich die ringelnde Gestalt des Todfeindes in dem Grün ab. Der Wanderstock wurde eins mit ihrem Arm, diesmal sollte der Feind nicht entwischen.
Er wartete.
Sie wartete.
Genügend Geduld besaß sie, selten verließ sie die Konzentration. Außerdem brauchte sie Zeit zum Nachdenken. Diesmal sah es böse für ihn aus. Die Farnbüsche bedeckten den Felsen beinahe einen Meter im Umkreis, weiter oberhalb stieg die gelbe Felswand steil empor, bot keinen Schatten. Dort würde es ein Leichtes für ihren Stock sein. Aber er, der Feind, könnte zwischen das Geröll dort vorn schlüpfen, ja, das war seine einzige Möglichkeit, denn darum herum erstreckte sich der Weg leer und öde in der Sonnenhitze.
Sie wartete, sie hatte viel Geduld. Aber die herrliche Wut hatte sich immer nur kurz bei ihr gehalten. Sobald die Gedanken sie bedrängten, atmete sie tief ein, hielt die Luft an und versuchte die weiße Raserei damit am Leben zu erhalten, musste jedoch notgedrungen nachgeben und den Atem loslassen. Und schon kamen die Gedanken zurück und löschten die Wut aus, so, wie sie es bereits im Voraus gewusst hatte.
Du Ärmste, sagten die Gedanken zur Schlange, was hast du mir damals eigentlich angetan? Dein Fehler soll es gewesen sein? Das ist doch nur ein Märchen, das der Mann erfunden hat.
Und was heißt schon Fehler, wurde überhaupt ein Fehler begangen?
Eigentlich müsste ich erst die Antwort auf diese Frage wissen, bevor ich dich töten kann.
Die Schlange, flimmernd in der Mittagshitze, bemerkte ihr Zögern und ergriff die Gelegenheit, schlüpfte zwischen die Steine, genau, wie sie es vermutet hatte.
Dabei war sie gar nicht sicher, ob sie sie getroffen hätte.
Die Wut hatte ihr Kraft gegeben, das spürte sie, als sie die Wanderung zum Gipfel wieder aufnahm. Es war nicht mehr weit, und plötzlich hörte sie den Wasserfall. Ihr Herz hüpfte vor Freude in der Brust. Die letzten dreißig Meter lief sie beinahe, stand auf einmal inmitten der Gischt und ließ sich langsam abkühlen, vom Staub gesäubert jetzt und triefend nass.
Sie löschte ihren Durst, löste das Haar und machte es nass. Langsam zog sie die nassen Kleider aus, wusch sie so gut es ging und hängte sie über einen Felsen. Dann stand sie nackt in der Sonne und ließ ihren Blick endlich über die Welt schweifen.
Alles war in diesem Moment vergessen, sie nahm nur noch die jahrelange Sehnsucht nach eben diesem Jetzt wahr.
Tatsächlich war alles noch so, wie sie es in Erinnerung hatte. In schwindelnder Tiefe grub sich dort unten der Fluss sein schimmerndes Bett durch die Ebene, in weichen Bögen floß er weiter. Nach Nordosten zogen sich die Berge zu immer steileren Höhen hinauf. Der Felsgrat folgte ihnen in diese Richtung, und sie wusste, ohne dort gewesen zu sein, dass er zu den senkrechten Toren des Berges führte, wo der Anklopfende eingelassen wurde, um nie wieder herauszufinden. Irgendwo dort bildete der Fluss schwarze Seen und unbändige Stromschnellen.
Unten im Tal zogen die grasenden Tiere dahin, klein wie Fliegen sahen sie von ihrem Aussichtspunkt hier oben aus. Das Weideland war weniger grün als sie es in Erinnerung hatte, ja, natürlich, es lag an der Trockenheit des Spätsommers. Das gleißende Sonnenlicht schuf flimmernde Luftspiegelungen auf dem Fluss am Horizont, wo man die riesigen Laubwälder erahnen konnte.
Nur der konnte sie erahnen, der wusste, dass es sie gab, dachte sie. Sie wusste um sie, denn sie war dort geboren, aufgewachsen unter den großen Laubkronen voller schimmernder Früchte.
Die Erinnerungen zogen sie mit sich fort. Dort lag das Land der Kindheit, in Reichweite jetzt. Es waren im Übrigen keine Erinnerungen, vielmehr wortloses Gaukelspiel der Gefühle.
Warum erinnerte sie sich an nichts? Warum hatte sie keine Bilder der Eltern in sich, der Freunde, von Geschehnissen, Orten, Begegnungen, Enttäuschungen, Freuden? Vielleicht, weil sie nie einen Namen bekommen hatten?, überlegte sie. Gab es keine Erinnerungen, wenn es keine Worte gab? Was sonst gab es dann, außerhalb der Worte?
Etwas war doch da.
Nicht außerhalb der Worte, hinter ihnen, jenseits davon.
Sie war auf dem Weg zurück, um es herauszufinden.
Hier auf dem Hochplateau gab es wirkliche Erinnerungen – der Mann und sie in lustvollem Spiel unter dem Wasserfall. Sie ging zur Grasböschung hinter der Kaskade, von hier war die Aussicht weniger weit, aber das Gras so weich, wie sie es in Erinnerung hatte. Hier war er hinter ihr hergelaufen, hatte sie sich fallen lassen, er über ihr, hier hatte sie mit aufgestützten Händen gekniet und gespürt, wie sein Glied in sie eindrang, explodierend vor Kraft, hatte es sie mit Lust erfüllt, mehr, mehr.
Hier war es auch, wo sie, getrieben von dem Wunsch, sein Gesicht zu sehen, ihn dazu brachte, das Spiel zu verändern. In der Dämmerung waren sie sich Auge in Auge begegnet, und die Süße in den Lenden hatte sich über den ganzen Körper ausgebreitet, über Augen, Zunge, Mund, Haut, Haare – alles hatte teil daran.
»Du«, hatte er gesagt, und endlich konnte die Stimme das Wort formen, das seine Augen so lange gerufen hatten.
»Du«, hatte er gesagt und ihre Brüste gestreichelt, ihren Hals, ihren Schoß.
Hier hatten sie und er einander angesehen.
Du. Ich.
Er hatte so schöne Augen, dachte sie. Braun, voller Schalk und mit einem Glanz darin, neugierig, forschend und etwas ängstlich.
Er hat so schöne Augen, verbesserte sie sich. Braun sind sie, und der Blick ist noch immer warm. Aber auch ängstlich und jetzt sehr traurig.
»Du wirst doch wiederkommen?«, hatte er gefragt. »Du musst gut auf dich aufpassen. Sie haben uns vertrieben, erinnerst du dich?«
Ja, die Erinnerung war in dem Gefühl aufbewahrt. Sie erwartete kein Willkommen und versprach, wachsam zu sein.
Wer sollte sie dort, wohin sie nun ging, eigentlich willkommen heißen? Wenn sie sich an kein Gesicht erinnerte, an keinen Namen, sie keine Stimme wieder erkannte?
»Vertrau mir«, hatte sie gesagt. »Ich komme zurecht, ich komme zurück. Und dann werden wir es genauer wissen.«
Sie hatte sich umgedreht und an der ersten Biegung zurückgewinkt, er hatte dort gestanden und ihr nachgesehen. Müde sah er aus, einsam, bange.
Sie hatte die Hand gehoben, sie still gehalten, die Handfläche ihm zugewandt. Vertrau mir!
Der Junge war draußen auf dem Feld bei den Tieren, ihm hatte sie nicht Lebwohl gesagt.
»Lass jetzt den Jungen«, sagte sie laut zu sich. »Fort mit ihm aus den Gedanken. Zerstöre nicht diese Stunde, wo du endlich bei dem Wasserfall und der Wiese angekommen bist, wovon du so lange geträumt hast.«
Die Sonne sank jetzt im Westen, sie fror und genoss es auch ein wenig. Ihr Gewand war im Wind getrocknet und duftete sauber, als sie es anzog.
Dann öffnete sie den Beutel mit dem Essen, lachte beinahe über den Lederschlauch mit dem warmem Wasser, goss es über die rosa Malven in einer Felsspalte und füllte den Schlauch mit frischem, eiskaltem Wasser. Das Schafsfleisch war salzig, das Brot bereits trocken, sie musste also stets genügend Wasser bei sich haben. Die Äpfel waren klein, rot und voller herber, bitterer Süße, die sie seit jeher so mochte.
Ihr war klar, sie musste sich entscheiden, ob sie ein Nachtlager aufschlagen oder ihre Wanderung fortsetzen sollte, aber sie schob auch diesen Gedanken beiseite.
Später, sagte sie, später, wenn ich gegessen habe.
Nach dem Essen streckte sie sich aus, lag auf dem Felsvorsprung am Wasserfall und ließ sich wieder von der Sonne wärmen. Sie döste eine Weile – aber mit der Schläfrigkeit kamen auch die Bilder. Die Augen des Jungen, des anderen Jungen, der ihn am Hals packte …
Nein.
Sie setzte sich auf, nun kam das zurück, woran zu denken sie sich verboten hatte. Es konnte am Apfel liegen, dessen bitteren Geschmack sie noch auf der Zunge hatte. Oder am Rosmarin, der zu ihren Füßen duftete; Rosmarin stärkt die Erinnerung …
Sie zwang die Augen zum Horizont, die Gedanken zum Tageslicht hin, zum Jetzt. Es glückte ihr. Wenn sie die Nacht auf dem Felsabsatz bliebe, würde sie ruhig schlafen können, das Risiko nachts umherstreifender Tiere wäre hier oben gering, Sicht nach allen Seiten hatte sie.
Es würde kalt werden, doch sie hatte eine dicke, doppelt gewebte Decke im Ranzen, die Kälte würde erträglich sein.
Aber sie würde wichtige Wanderstunden verlieren. Die Sonne stand noch am Himmel, und mit Sicherheit könnte sie vor Einbruch der Dunkelheit den Berg hinuntersteigen. Unten in der Ebene würde es jedoch schwierig werden, einen Unterschlupf für die Nacht und Schutz vor dem Wind zu finden, Wildkatzen und Schlangen gab es dort sicherlich auch. Bei Tageslicht fürchtete sie sie nicht, nur im Dunkeln waren sie ihr überlegen.
Ihre Nachtsicht war gut, ihre Nase fein und sicher, aber nicht so wie die der Raubtiere. Gegen sie gab es nur eine Waffe – ihre klaren Gedanken und schnelle Entschlusskraft. Und sie wusste aus Erfahrung, dass Raubtiere nachts jagten.
Sie blickte wieder auf den Fluss, berechnete die Entfernung zwischen den Bauminseln in der Felsenlandschaft. Die stummen Bäume waren ihre Verbündeten und würden ihr Schutz geben, das wusste sie. Aber die Abstände zwischen den Baumgruppen waren groß, manchmal bis zu einer Stunde zu wandern.
Nein, sie würde diese Nacht auf dem Felsvorsprung schlafen, bewacht von guten Erinnerungen, gewiegt vom Wind, in den Schlaf gesungen vom sanften Geräusch des herabrauschenden Baches.
Das Gras hinter dem Wasserfall war weich und einladend, dort hatten sie einst vor langer Zeit in ihren Liebesnächten geschlafen. Aber sie waren zu zweit gewesen, jetzt war sie allein und dachte an die Begegnung in den Farnbüschen am Steilhang. Sie entschied sich für den Felsvorsprung, breitete ihre Decke aus und begann, kleine Steine und Geröll um sie zu häufen.
Keine Schlange würde durch den Ringwall schlüpfen, ohne dass die Steine kullerten und sie weckten.
Der Friede des Platzes, die Müdigkeit, das Rauschen des Wassers – alles verhalf ihr schnell über die Grenze zum Schlaf. Die Dunkelheit nahm sie zu sich und löschte sämtliche Gedanken aus.
Sie schlief traumlos.
Kapitel 2
Der Abstieg war beschwerlicher, als sie angenommen, der Berg steiler als sie ihn in Erinnerung hatte. Der Ranzen scheuerte am Rücken, hin und wieder musste sie springen, manchmal sogar auf allen vieren rückwärts hinunterklettern. Unerwartet wurde ihre ganze Aufmerksamkeit beansprucht.
Ein Dornenbusch riss ihr den Handrücken auf. Sie spürte keinen Schmerz, leckte nur einmal über die Wunde und setzte ihren Weg fort. Nach einiger Zeit aber merkte sie, dass sie ziemlich stark blutete, sie musste stehen bleiben, sich nach heilenden Kräutern umsehen und einen Verband über die Wunde legen.
Da stahlen sich die ersten Sonnenstrahlen um den Südhang des Berges, bisher hatte sie die Sonne nur als Licht hinter dem Berg im Osten erahnen können. Früh schon war sie aufgewacht, war entschlossen und eilig aufgebrochen, vom Schlaf und dem Frieden gestärkt, den ihr der Platz auf dem Felsvorsprung geschenkt hatte. Sie wollte sich beeilen, musste sie doch die versäumten Wanderstunden vom Vortag aufholen.
Breitwegerich gab es hier reichlich, sie legte ihn auf die Wunde und umwickelte ihn geschickt mit langen, festen Grashalmen. Dann ließ sie ihren Blick über das Gelände gehen. In einiger Entfernung bemerkte sie einen Wildwechsel, es musste der sein, den sie beide früher schon einmal gegangen waren, und schnell kletterte sie hinüber. Nun kam sie leichter voran.
Auf halbem Weg nach unten zog sich erneut ein Felsabsatz am Berg entlang, dann folgten der Hain, die Graslandschaft, die Quelle – ja, jetzt erkannte sie alles wieder. Hier war es, wo sie scheu und zögernd über die Worte gesprochen hatten.
Wie die Worte zu ihnen gekommen waren.
Mit einer Blume hat es angefangen, fiel ihr ein. In jenem Frühjahr hatten unzählige kleine, weiße Blumen den Boden bedeckt, und ein feiner Duft von zartem Grün, von Erde und Wasser hatte sich über die Landschaft gelegt. Obwohl sie vorher Tausende von ihnen gesehen haben musste, konnte sie sich an keine einzige Blume erinnern. Ob es an der Vielfalt lag, dass sie – und er – nun auf sie aufmerksam wurden?
»Wunderschöne Blumen«, hatte sie gesagt und dann etwas vollkommen Neues getan: Aus reiner Lust pflückte sie einen Strauß, nur um ihn anzuschauen und an ihm zu riechen.
»Woher weißt du, dass es eine Blume ist?«, hatte er gefragt und ihr zugelacht.
Sie weiß nicht mehr, was sie antwortete, nur, dass sich hier ihr erstes Gespräch aus Sätzen entwickelte, an die sich weitere Sätze, Fragen und Antworten reihten.
Es hatte großen Spaß gemacht.
Aber damals hatte sie kaum Worte genug gehabt, um auf seine erste Frage sofort zu antworten, woher sie wusste, dass eine Blume eine Blume sei. Wusste sie damals bereits die Antwort?
Hätte sie denn heute genug Worte, um die Vertrautheit zwischen ihr und all dem, was um sie herum wuchs, zu erklären? Dass eine Freundschaft zwischen ihr und den Pflanzen bestand, die ihr deren Geheimnisse, Namen und Eigenschaften preisgaben? Dass sie dabei von ihnen erfuhr, welche Wurzeln gut und nahrhaft waren, welche Baumknospen stärkend, welche Samen gegen Schmerzen lindernd wirkten oder Krankheiten heilten?
Die Worte rührten von dieser inneren Verbundenheit her, denn einem Vertrauten gibt man nun mal seinen Namen preis. Und mit den Namen wuchs das Wissen, die Kenntnis zu unterscheiden und zu sehen. So viele Kräuter hatte sie kennen gelernt, seitdem sie sich ihrer Fähigkeit als Seherin bewusst geworden war!
So ist es nun einmal mit den Worten, dachte sie, sie bereichern das Leben. Vor den Worten gab es nur Gewächse, nun gibt es Farben, Arten, Unterschiede, Eigenschaften, das Wissen, wie man sie bestimmte, einordnete und anwendete.
Worte geben auch Sicherheit, hatte sie viele Male gedacht. Anstatt vom Schrecken verfolgt zu werden, wenn es am Himmel blitzte, konnte sie jetzt sagen: Es ist ein Gewitter und es geht vorbei, wie im vergangenen Sommer. Ja, sie konnte voraussehen, dass auf diese Hitze ein Gewitter folgen würde, sie also Schutz suchen mussten.
Der Mann sah es auf ganz andere Weise, obwohl ihre Art zu denken sicherlich von Vorteil für ihn war. Nicht der Erde fühlte sich der Mann verbunden, nicht dem Sichtbaren, Greifbaren. Seine Verbundenheit bezog sich vielmehr auf den Himmel und auf eine ihm innewohnende Kraft, die er Gott nannte. Sie hatte es nie verstanden, hatte sich auch nicht besonders dafür interessiert. Hatte keine Zeit gehabt, gestand sie sich ein. Sie musste sich ja um die Kinder kümmern, ums Überleben, um Kleidung und …
In letzter Zeit war ihr zuweilen in den Sinn gekommen, dass das mit Gott und dem Himmel vielleicht ebenso notwendig war. Hier auf der Lichtung überlegte sie noch einmal, dass alles, was sie versprochen, vorausgesehen und geplant hatte, nicht genug gewesen war.
Der Junge ist gestorben …
Der Junge ist getötet worden …
Zurückgeblieben ist der andere, in dessen Augen ein Feuer brannte, das sie nie hatte deuten können, er, der auch ihr Sohn war, aber fremd bereits, als er geboren wurde.
Hierbei spürte sie einen Schmerz, der noch stärker war als die Trauer um den Toten. Sie wagte nicht, bei dem Gedanken an ihn zu verweilen, ihn zu ergründen, nicht einmal versuchsweise zu verstehen. Nicht jetzt. Später einmal, wenn sie über sich selbst Klarheit gefunden hätte.
Sie glaubte, mit dem Schmerz sei es wie mit dem Gewitter, wenn du erst einmal einen Namen für ihn gefunden hast, ist er besiegt.
Auch der Mann hatte sich mit dem Jungen und seinen harten Augen schwer getan, verteidigte sie sich. Sein Gott hatte ihm dabei nicht geholfen. Aber der Mann hatte es versucht, hatte mehr begriffen, mehr gesehen. Sie dachte an seine scheue Freundlichkeit, seinen Versuch, das Recht des Jungen als Erstgeborenem hervorzuheben, erinnerte sich an vorsichtige Gespräche, an die Wanderungen von Vater und Sohn zum See, wo sie gemeinsam ein Holzfloß bauten.
Was hatte der Junge ihm geantwortet? Sie wusste es nicht, hatte sich auch nicht genügend darum gekümmert.
»Du Gott, falls es dich gibt«, sagte sie zum Himmel gewandt, »willst du mir vielleicht sagen, wie eine Mutter einen Sohn gebären kann, vor dem sie sich von der ersten Stunde an fürchtet?«
Sie bekam keine Antwort, hatte auch keine erwartet. Jetzt musste sie weiterwandern, hinunter in die Ebene.
Das Flachland war ein Leichtes, ohne Mühe konnte man darüber hinwegwandern. Auf halbem Weg traf sie auf ein Wäldchen und eine Quelle mit frischem Wasser. Sie löschte den Durst, wusch sich und ließ die Füße ins Wasser hängen, während sie aß. Sie hatte getrocknete Weißwurz dabei, und hier gab es sogar frische. Aber sie konnte sich nicht dazu aufraffen, den langen Wurzelsträngen zu folgen und sie aus der Erde zu graben. Ich bin müde, dachte sie. Ich muss meinen Mittagsschlaf halten.
In der Dämmerung näherte sie sich dem Fluss. Sie durchquerte den Hain dort, wo er am schmalsten war, hatte die Gegend noch im Kopf und fand die richtige Richtung. Es gab ihr ein Gefühl der Zufriedenheit, dass sie sich auf ihr Gedächtnis verlassen konnte, schon immer hatte sie einen klaren Kopf gehabt, und, weiß der Himmel, meistens hilft er einem gut durchs Leben, dachte sie.
Doch sie hatte nicht an das Großwild gedacht, die mächtigen Tiere, die am Abend zum Fluss an die Tränke kamen. Erst als sie den Boden unter sich dröhnen hörte, schoss ihr die Angst durch den Körper. War das vielleicht ein Erdbeben?
Dann tauchten sie auf, ihre riesigen Silhouetten hoben sich gegen den Abendhimmel ab, und sie spürte, wie ihr Herz aussetzte und erneut hart zu schlagen begann. Für ein paar Sekunden beschlich sie die Urangst, doch dann setzten die Gedanken wieder ein.
Ja natürlich, sie kannte sie gut, die Riesentiere, vor denen sich ihr Volk atemlos zitternd auf die Erde warf. Namen für sie hatte sie nicht, aber klare Erinnerungsbilder, und sie wusste: Die großen Tiere tun niemandem etwas.
Daran erinnere ich mich noch, dachte sie.
Dann setzte die Vernunft ein und sagte ihr, die Tiere seien ja vor ihr und versperrten ihr den Weg. Lautlos, ohne einen Halm zu knicken, wollte sie einen Bogen nach Westen einschlagen und sich dem Hain am Fluss von einer anderen Richtung her nähern.
Das Herz schlug wieder im alten Takt, und nun, da es sich beruhigt hatte, merkte sie, wie müde sie war. Sie musste sich in dem Wäldchen ein Nachtquartier suchen, musste sich oben in einer Laubkrone ein Lager herrichten. Es würde unbequem werden, dafür aber ruhig.
Lautlos wie ein Tier, das in der Nacht umherstreift, näherte sie sich dem Hain, fast schon am Ziel änderte sie ihren Schritt – von einem weichen Schleichen zu einem harten Auftrampeln. Sollte es hier Schlangen zwischen Unterholz und Gras geben, sie würde sie auf genügend Abstand halten. Dann suchte sie sich den größten Baum, der dem Flussufer am nächsten stand. Nun war es beinahe ganz dunkel, sie war zufrieden. Die Strecke, die sie durch die lange Nacht auf dem Felsabsatz verloren hatte, war wieder aufgeholt.
Nun befand sie sich wieder im Einklang mit der sich selbst gesetzten Zeit – noch zwei Tagesmärsche am Flussufer entlang, ein weiterer auf der anderen Seite.
Es war ein alter Baum mit starkem Geäst, großer Krone und einem knorrigen Stamm. Sie berührte ihn mit beiden Handflächen, beugte die Stirn gegen die Rinde zwischen den Händen und fragte ihn.
Ja, es war ein guter Baum, sie war willkommen. So gut er konnte, würde er ihr Schutz geben. Sie musste hochspringen, um den untersten Ast zu erreichen. Dann aber war das Klettern ein Kinderspiel, der Körper wusste noch, wie man sich von Ast zu Ast bewegen, wie man schaukeln musste, um in Schwung zu kommen, wollte man ein paar Zweige weiter nach oben gelangen. Sie hatte die Krone beinahe erreicht, als sie eine Astgabel fand, die verzweigt und ausladend genug war für eine Lagerstatt. Sie nahm die Decke aus dem Ranzen, band sie mit dem Seil um sich und befestigte das Ende dort, wo der Ast am dicksten war. Sollte sie wider Erwarten so fest schlafen, dass sie drohte hinunterzufallen, würde das Seil sie abfangen.