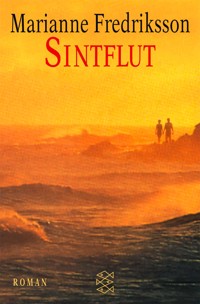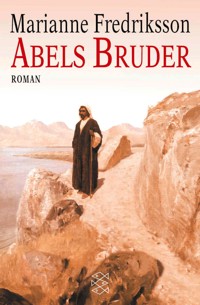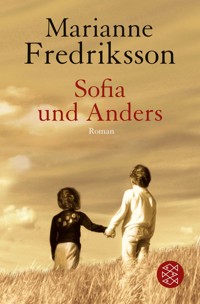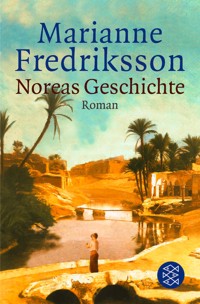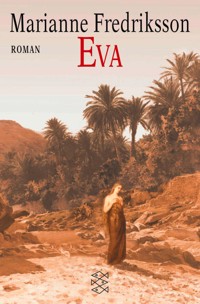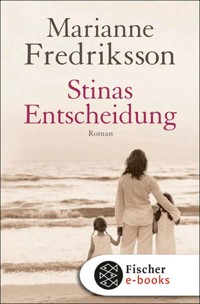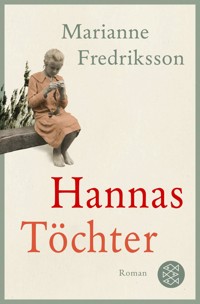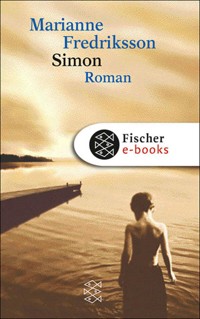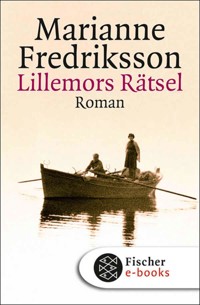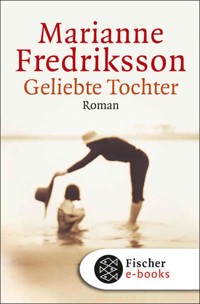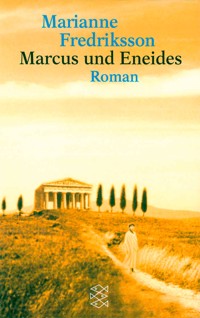
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Ehe zwischen Cornelia und dem Offizier Salvius ist keine glückliche. Salvius fürchtet seine kaltherzige Frau und findet Liebe bei der Sklavin Seleme, die bald von ihm schwanger ist. Doch auch Cornelia erwartet endlich ein Kind von ihm. Seleme wird zur Amme beider Jungen - Marcus und Eneides. Als Cornelia die Sklavin verkauft, keimt in Marcus ein kalter Haß, der ihn sein Leben lang begleitet. Doch als sein eigener Sohn stirbt, begibt er sich auf eine lange Reise, die ihn zu Jesus und endlich zu sich selbst führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Marianne Fredriksson
Marcus und Eneides
Roman
Roman
Über dieses Buch
Die Ehe zwischen Cornelia und dem Offizier Salvius ist keine glückliche. Salvius fürchtet seine kaltherzige Frau und findet Liebe bei der Sklavin Seleme, die bald von ihm schwanger ist. Doch auch Cornelia erwartet endlich ein Kind von ihm. Seleme wird zur Amme beider Jungen - Marcus und Eneides. Als Cornelia die Sklavin verkauft, keimt in Marcus ein kalter Haß, der ihn sein Leben lang begleitet. Doch als sein eigener Sohn stirbt, begibt er sich auf eine lange Reise, die ihn zu Jesus und endlich zu sich selbst führt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Marianne Fredriksson wurde 1927 in Göteborg geboren. Als Journalistin arbeitete sie lange für bekannte schwedische Zeitungen und Zeitschriften. Im Jahre 1980 veröffentlichte sie ihr erstes Buch. Sämtliche Romane der Autorin wurden in Deutschland große Bestsellererfolge. Die Autorin starb am 12. Februar 2007.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
[Widmung]
Prolog
1. Teil
Sie würde einen Sohn [...]
Seleme, das Mädchen aus [...]
Salvius dachte selten an [...]
Lucius Cornelius Scipio war [...]
Nach dem Neuntagefest im [...]
Wie es die Sitte [...]
Cornelia erholte sich erstaunlich [...]
Auf einem Absatz in [...]
Die Jungen waren fünf [...]
»Der Junge erblindete, als [...]
In dieser Nacht weckte [...]
2. Teil
Die Mondpriester verwalteten das [...]
Nur noch sechzehn Jahre [...]
Anjalis hatte nun beinahe [...]
Beim Anblick der chaldäischen [...]
Das Meer.
Die Beamten zeigten deutliches [...]
Im Laufe des Tages [...]
Der Winter in Athen [...]
Er erkannte sie sofort [...]
Das Haus war nicht [...]
3. Teil
Durch die offenen Fensterläden [...]
Anjalis hatte sich vorbereitet, [...]
Die Sonne stand hoch [...]
»Weshalb haben sie gerade [...]
Marcus erwachte davon, dass [...]
Marcus schlief mit dem [...]
In der grauen Stunde [...]
Anjalis fand sich mittlerweile [...]
Eines Tages im zeitigen [...]
Als im Herbst die [...]
»Es gibt einen Ort, [...]
Kalt lag der Frühling [...]
4. Teil
»Nobenius hat eine Säure, [...]
Salvia begleitete sie nach [...]
Die Vorlesungen an der [...]
Sie wollte Marcus.
Ohne dass jemand besonders [...]
Im Morgengrauen wurde das [...]
5. Teil
Falls Marcus noch eine [...]
Pontius Pilatus hatte sich [...]
Marcus lehnte sich an [...]
Noch ehe Marcus am [...]
»Du hörst ganz richtig, [...]
Am nächsten Morgen nahm [...]
Es folgten nun ruhigere [...]
»Das Himmelreich. Will die [...]
In der Dämmerung kam [...]
Quellen
Für Sven mit Dank für all die Hilfe
»Der Tod ist das Ende für den, der sich ein Bild macht«, sagte sie. »Nur dort, wo wir uns kein Bild mehr von dem Schmerz machen können, kann Mitleid geboren werden. Das ist das Geheimnis der Toten, durch sie wird das Leben rätselhaft und das Leiden unausweichlich. Daher lautet die ewige Botschaft: Sterben, um bei sich selbst anzukommen.«
Er konnte ihre Augen nicht erkennen, sie waren hinter dem schwarzen Schleier der dichten Haare verborgen. Dennoch wusste er, dass sie unendlich tief waren, und dass sich die Trauer der ganzen Menschheit in ihnen spiegelte – die Trauer derer, die bereits gelebt hatten, derer, die lebten, und derer, die noch nicht geboren waren.
Doch mit einer Geste voller Entschlossenheit warf sie plötzlich ihr Haar zurück. Er begegnete ihrem Blick und sah, dass allein dort, in dieser Unerschöpflichkeit, alles Sein war.
»Komm«, sagte sie, und ihre Bestimmtheit ließ ihn nicht einen Moment lang zögern. Er folgte ihr auf das Wasser und ließ sich neben ihr nieder, spürte die Kühle und wusste im selben Augenblick, dass der Teich so abgrundtief war wie ihre Augen.
Seine Furcht dauerte nur einen kurzen Augenblick, dann stürzte er durch die Wasseroberfläche. Während er fiel, erinnerte er sich daran, dass die Frau im Teich die Wächterin auf der Schwelle vom Tod zum Leben war, und dass er die goldfarbene Seerose, die sie in ihrer Hand gehalten hatte, früher schon einmal gesehen hatte. Er würde in das Leben eintauchen, das das Vergessen in sich barg.
1. Teil
»Aber die Blinden will ich auf dem Wege leiten,
den sie nicht wissen;
ich will sie führen auf den Steigen,
die sie nicht kennen.
Ich will die Finsternis vor ihnen her
zum Licht machen
und das Höckerige zur Ebene.«
»Hört, ihr Tauben,
und schauet her, ihr Blinden,
dass ihr seht!
Wer ist so blind wie mein Knecht,
und wer ist so taub wie mein Bote,
den ich senden will?«
Jesaja 42,16. 19.
Sie würde einen Sohn gebären und frei sein.
Und dann, gereinigt, ja geradezu körperlos, würde sie in Junos Mysterium eindringen, wie sie es sich all die Jahre erträumt hatte.
Wie sie dort in ihrem Bett saß, die Hände über ihrem Schoß verschränkt, war sie klar und entschlossen. Nach den Jahren der Flucht hatte sich der Feind zu erkennen gegeben. In wahrer, römischer Gesinnung würde sie ihm begegnen.
Cornelia hatte viele Entbindungen gesehen, und alle hatten sie an den Krieg erinnert, an die Schlachten in den Ebenen von Dakien, an die Schreie, an das Blut und den Gestank.
Das Fleischliche an beiden Abgründen des Lebens ekelte sie an. Doch sie war vom Sieg überzeugt, ebenso überzeugt wie ihr Vater, der Feldherr Lucius Cornelius Scipio, damals in Dakien. Dorthin war sie gerufen worden, gerade fünfzehn Jahre alt, und dort war sie Marcus Salvius, einem jungen Offizier von niederer Herkunft, zur Frau gegeben worden.
In seinem Zelt hatten die Vergewaltigungen ihren Anfang genommen – blutig auch sie. Die Schreie der Gefallenen in den Ohren, hatte sie sich unterworfen. Sie hatte nicht geschrien, still und verschlossen war sie gewesen – wie eine Tote.
Bereits da hatte sie auf das Kind gehofft, das ihr die Freiheit geben sollte. Einen Sohn, einen einzigen Sohn, und Salvius würde sich nie mehr zu ihr legen. Doch die Samen, die in ihren verschlossenen Schoß gesät wurden, wollten nicht wachsen. Fünfzehn Jahre waren seit Dakien vergangen, aber der Lauf der Zeit hatte sie nicht entmutigt. In ihren Augen war es nicht sie, die alterte, sondern die Welt.
Ihre Sorge galt dem Sohn, der sich verweigerte. Doch nun war er hier, gefangen in ihrem Schoß, zu heiliger römischer Pflicht verurteilt.
Sie hörte, wie die Stadt aus dem Mittagsschlaf erwachte, in einer Kakophonie aus Lärm, wie ein Mensch, der, nach einem bösen Traum vom Tod, sich hastig vergewissern muss, dass noch Leben in all seinen Gliedern ist.
Hunderttausende Schicksale nahmen dort draußen ihren Lauf, doch Cornelia kümmerten sie nicht. Sie bedachte ihr eigenes.
»Meinen Spiegel«, sagte sie, denn sie wollte den Schwung ihrer Augenbrauen und die Entschlossenheit in ihren düsteren Gesichtszügen prüfen. Doch als sich die griechische Sklavin umwandte, sah Cornelia, dass auch sie ein Kind erwartete. Die weichen Rundungen ihres Körpers zeichneten sich deutlich gegen das Licht des Atriums ab.
Salvius, dieser Bock, hat sich wieder amüsiert, dachte Cornelia, und im ersten Moment spürte sie nur Verwunderung. Sie hatte geglaubt, seine Vorliebe für Knaben habe mittlerweile die Oberhand gewonnen. Das Haus war voll von ihnen, rehscheue Kimbern mit den Geheimnissen des Waldes in ihren Bewegungen, ein feingliedriger Grieche, zwei Kelten mit flammendrotem Haar, und dann die eher Exotischen – ein göttlicher indischer Knabe mit honigfarbener, samtener Haut, und ein aufregend schwarzer Afrikaner, dessen Augen vor Süße überliefen.
Salvius liebte sie alle, so wie er seine Bilder, die griechischen Bronzestatuen und die etruskischen Urnen liebte; Cornelia nahm sie nur mit müder Verachtung wahr.
Jetzt betrachtete sie die Griechin, als sähe sie sie zum ersten Mal.
Das Mädchen war auf eine etwas bäurische Art hübsch, schwer wie die Getreidefelder Siziliens und blond, und sie ruhte in sich – geduldig dem Kind, das in ihr heranwuchs, zugewandt. Eine trächtige Kuh.
Aber da war noch etwas anderes, eine helle Vorfreude auf ihrer Stirn und in den Händen, die Cornelia den Spiegel reichten. Wie ein heimliches Glück, dachte Cornelia und verspürte einen Anflug von Bitterkeit, ehe sie diese Betrachtungen mit ihrem praktischen Verstand zurückwies.
Ich brauche eine Amme. Das Mädchen ist gesund wie die Luft in den attischen Bergen, und ihre Brüste sind groß wie Euter.
Das Sklavenkind würde hingerichtet werden, so hatte es Cornelia auch bisher mit Salvius’ Bastarden gehalten. Nur diesmal nicht sofort, denn wenn man dem Weibchen das Junge wegnähme, würde sein Euter versiegen.
Cornelia nahm den Spiegel, den die Griechin ihr hinhielt, und vertiefte sich in ihren Anblick. Der Ausdruck ihrer Augen war beileibe nicht so ruhig, wie sie angenommen hatte, und ein Zug von Ekel lag um ihren Mund, als hätte etwas Unreines sie berührt und dazu gebracht, sich zu schämen.
Sie legte den Spiegel beiseite und trank die Mandelmilch, die ihr die Sklavin reichte, dann rief sie nach ihrer Sänfte. In Junos Tempel würde ihre Reinheit wiederhergestellt werden. Sie legte die feuerrote Tunika an, und als sie in der Sänfte saß und sich ein parfümiertes Taschentuch vor das Gesicht hielt, dachte sie, sie würde das Mädchen verkaufen, sobald diese mit dem Stillen aufgehört hatte. Die Griechin war kaum siebzehn Jahre alt – noch könnte man einen guten Preis für sie bekommen. Milchweiße Haut und schwere Brüste standen in den Bordellen hoch im Kurs.
Allen entschlossenen Gedanken zum Trotz wütete heftiger Zorn in Cornelia. Richtig bewusst wurde sie sich dessen erst, als sie vor der Göttin im Tempel niedersank.
Nicht Salvius galt ihr Zorn, nein, er galt dem Kind, das das Sklavenmädchen trug.
Dieses noch unsichtbare Wesen kränkte sie.
Zum ersten Mal fragte sich Cornelia jetzt, wer dieser Mensch war, der sich da in ihr Leben drängte und um dessentwillen sie sich morgens schon übergeben musste. Die Frage war jedoch nicht an das Kind in ihrem Leib gerichtet, sondern an die Göttin, die versicherte, der Sohn sei wohlgestaltet und habe gute geistige Fähigkeiten.
Das genügte Cornelia.
Seleme, das Mädchen aus Bithyniens Wäldern, hatte gesehen und verstanden – nicht Cornelias Art zu denken und keine Einzelheiten, aber genug, um zu erschrecken. Sie fühlte ihr Herz wie einen eingeschlossenen Vogel flattern, als sie das Bett in Cornelias Zimmer herrichtete und die Tuniken zusammenfaltete, die die Herrin zurückgewiesen hatte.
Das griechische Mädchen hatte dem heimlichen Klatsch in der Küche und im Gemüsegarten draußen nie Beachtung geschenkt, diesen endlosen Geschichten der Sklaven über Cornelias Grausamkeiten. Seleme glaubte nicht an Schlechtigkeit, sie hatte Mitleid mit denen, die Böses taten.
Sie war nicht unempfindsam, die Kühle um Cornelia hatte sie wohl gespürt und diese wegen ihrer Einsamkeit und Düsternis bedauert. Manches Mal hatte das Mädchen ein unbestimmtes Schuldgefühl geplagt, als ob sie es gewesen sei, die Cornelia Salvius’ Liebe geraubt hatte. Sie hatte es ihm gegenüber erwähnt, er jedoch hatte gelacht und ihr versichert, er habe seine Gattin bereits seit der Hochzeit in Dakien gehasst.
Vieles von dem, was in dem großen Haus in Rom vor sich ging, verstand Seleme nicht; daher vermied sie es, darüber nachzudenken.
Vor Cornelias Zimmer stieß sie auf Esebus, den jungen Schwarzen. Wie immer erschreckte er sie mit seiner Art, lautlos und wie aus dem Nichts aufzutauchen, und das weiße Lächeln in seinem dunklen Gesicht beunruhigte sie bei jeder Begegnung.
»Es heißt, Cornelia pflege den Sklavenkindern von Salvius eigenhändig den Hals durchzuschneiden«, sagte er. Sein Lächeln ging in Lachen über, und die rote Zunge fuhr über seine schwellenden Lippen. Selemes Furcht wuchs. Er ist ein Tier, dachte sie, ein toller Hund.
Da erinnerte sie sich an etwas, das sie als Kind gelernt hatte: Hunde besiegt man mit dem Blick. Sie durchbohrte ihn mit ihren Augen, und obwohl er nicht versuchte, die Schadenfreude in seinem flüchtigen Blick zu verbergen, zwang sie ihn, die Augen niederzuschlagen.
Er verschwand so schnell, wie er aufgetaucht war, und Seleme konnte ihren Weg fortsetzen, durch das Atrium und den Säulengang, wo der Jasmin blühte, weiter zu Salvius’ Gemächern. Sie lief über den kunstvollen Mosaikboden in seine Bibliothek, durch das Schlafgemach und hinaus in den Garten. Hier wuchs eine große Sykomore und überschattete den einzigen Ort des großen Anwesens, der Schutz bot vor fremden Augen und Ohren.
Sie ließ sich auf der Bank unter dem Baum nieder und sah den indischen Drosseln zu, als wollte sie mit Hilfe der Vögel ihre Kraft wiederfinden.
Vogelmädchen hatte man sie genannt, zu Hause, in der kleinen griechischen Stadt an der Mündung des Sakarya. In Scharen kamen dort die Vögel aus den Wäldern und ließen sich in der Nähe des Kindes nieder, sobald es allein hinaus auf den offenen Platz zwischen dem Haus und der Mauer laufen konnte, die die Wohnstätte gegen die Barbaren verteidigen sollte. Die Vögel pickten aus Selemes Hand und setzten sich auf ihre Schultern, als wollten sie ihre Geheimnisse in das Ohr des Kindes flüstern.
Die Erwachsenen hatten sich gewundert und es als ein Zeichen angesehen.
Das Mädchen hatte die hohe Stirn und die hellblauen Augen der Ionier. Auch durch das blonde Haar fiel sie auf – hier, wo das helle griechische Blut eine Spur dunkler geworden war. Die Schwermut des Orients fiel wie ein Schatten über die Menschen in den griechischen Kolonien.
Seleme verstand die Sprache der Vögel – nicht deren Gesang, aber die Botschaft, die sie in der Stille verkündeten. Sie sprach jedoch zu niemandem davon, vielleicht weil sie nicht wusste, dass diese Fähigkeit ungewöhnlich war.
Das Mädchen zog es zu den großen Wäldern, zum hellen Laub der hohen Eichen und zum Ernst der schlanken Föhren. Sie streifte am Fluss entlang und träumte davon, seinem Lauf bis in den Hochwald und weiter hinauf bis zu seiner Quelle in den schneebedeckten Bergen des Südens zu folgen.
Es war ihr jedoch streng verboten, weiter als bis zur Wasserstelle zu gehen.
Die großen Ereignisse in Selemes Leben waren die Feste der Artemis im Frühjahr. Sie liebte die Feuer, die zum Himmel emporloderten, und die ernste Freude, die sie empfand, wenn sie das Fleisch des Opferlamms mit der Göttin teilte, die die Luft mit ihrer Gegenwart und mit ihrer Zärtlichkeit für die Sterblichen erfüllte.
Mit diesen Frühlingsfesten wurde der Grundstein für Selemes Vertrauen gelegt. Artemis wachte über sie, das Vogelmädchen, das in dieser Nacht am Feuer schlafen durfte, umgeben vom Geist der Göttin. Eines Morgens nach dem Fest beschloss sie, endlich ihrer langgehegten Sehnsucht nachzugeben und dem Fluss hinauf in die hohen Berge zu folgen. Die anderen schliefen noch, kein ängstliches Auge überwachte Seleme, als sie über die flachen Felsen bei der Wasserstelle lief und zu klettern begann, hinauf, immer höher hinauf.
Der Schweiß trübte ihren Blick, als sie überrascht auf eine Furt stieß, wo der Fluss sich sammelte, ehe er sich seinen Weg in die Ebene und zum Meer im Norden bahnte.
Hier badete das Mädchen beim ersten Morgenlicht und ruhte sich eine Weile aus, ehe sie in der Schlucht weiterkletterte, die immer steiler wurde. Sie ging auf der Schattenseite und spürte noch immer die Kühle des Bades auf ihrem Körper, als sie ein Tosen vernahm und wusste, dass sie sich dem Wasserfall näherte. Die blauen Berge sind immer noch nicht näher gekommen, dachte sie, aber der Schnee auf den Gipfeln leuchtete jetzt golden in der Morgensonne. Fröstelnd zog sie ihren Mantel enger um die Schultern und setzte ihren Weg in Richtung des Wasserfalles fort.
Niemals hätte sie sich vorstellen können, dass der Wasserfall so überwältigend sein würde, die Wassermassen so ungeheuerlich und die Gischt so weiß und reißend. Beinahe andächtig stand sie dort und glaubte für einen Augenblick, dass sie der erste Mensch sei, der all das sehen durfte. Gleich darauf fiel ihr jedoch ein, dass ja der Vater hier im Frühjahr Lachs zu fangen pflegte. Er hat nie von dem Strom erzählt, dachte sie verwundert, nichts von dem Tosen und den wilden Strudeln, von der ungeheuren Kraft des Wassers.
Doch ihr Vater war ein einfacher Mann, dem die Lust der Griechen an schönen Worten fehlte.
Die Gischt spritzte über sie hinweg, aber sie fror nicht länger, und eine große Ruhe kam über sie. Die Zeit schien stillzustehen, und mit einem Mal wurde ihr bewusst, dass die Welt um sie herum verblasste und im Brausen des Wasserfalles ein großes Schweigen lag.
Gleich darauf erblickte Seleme die Göttin. Sie kam aus den Bergen und in einigem Abstand folgten ihr die tanzenden Bärenmädchen. Die Göttin und das Mädchen wechselten kein einziges Wort – und doch war es eine fruchtbare Begegnung, und Seleme spürte die Gewissheit, daß Artemis sie beschützte. Ehe die Göttin wieder vom grünen Dunkel der Schlucht aufgesogen wurde, wies sie mit einer eindeutigen Geste auf den Weg, den das Mädchen gekommen war. Und Seleme verstand, weiter in das Reich der Artemis durfte sie nicht vordringen.
Zu Hause erwähnte sie nichts von der Begegnung; sie war eine Kostbarkeit, die durch Worte und Neugier nur Schaden nehmen konnte.
Noch zweimal kletterte sie in diesem Sommer, in dem sie fünfzehn geworden war, am Fluss entlang zu dem Wasserfall hinauf. Aber Artemis zeigte sich ihr nicht, und Seleme sah ein, dass sie sich zu viel ersehnte. Dennoch zog es sie zu dem Wasserfall zurück, und bei der dritten Wanderung erwarteten sie die Sklavenjäger der Barbaren am Ort ihrer Zusammenkunft mit Artemis.
Während der schrecklichen Überfahrt mit dem Sklavenschiff nach Rom betete das Mädchen unaufhörlich zur Göttin. Als sie Salvius auf dem Sklavenmarkt sah, wusste sie, daß ihre Gebete erhört worden waren, und mit dem offenen Blick ihrer blauen Augen zwang sie ihn, sie zu kaufen.
Sie war ein Kind; er hatte ihr noch viel über die Genüsse der Liebe beizubringen.
Cornelia nahm sie bloß als einen dunklen Schatten in dem großen Haus wahr, in dem sie besonderen Schutz genoss, keine Schwerarbeit verrichten musste und im Abseits gehalten wurde. Bis zu dem Tag, an dem Cornelias Kammerdienerin in unnötigem Übereifer vom Koch hinausgeworfen wurde, der sich schon lange über das sanfte Wesen des Griechenmädchens geärgert hatte. Ganymedes, Salvius’ Hofmeister, konnte es nicht mehr verhindern, dass nun Seleme zur Herrin geschickt wurde, um sie nach dem Mittagsschlaf zu bedienen.
Seleme erhob sich von der Bank, gestärkt von den Bildern der großen Wälder, des Flusses und der Göttin.
»Nichts ist geschehen«, sagte sie laut zu sich selbst. »Und nichts wird geschehen.«
Sie legte sich auf Salvius’ Bett, um auf ihn zu warten. Er verspätete sich jedoch, und sie schlief ein, schlief tief und lange.
Salvius dachte selten an Cornelia; er war darin geübt, unliebsamen Dingen aus dem Weg zu gehen. Wenn sie jedoch in seinen Gedanken auftauchte, wurde ihm jedesmal bewusst, dass er sich in einer Sackgasse befand, denn die Ehegesetze, die Kaiser Augustus geschaffen hatte, schrieben vor, daß ein Mann nach der Scheidung seiner Frau die Mitgift zurückerstatten musste.
Viele von Salvius’ Freunden ließen sich scheiden, heirateten von neuem und ließen sich wieder scheiden. Es gab Männer, die eine Ehe mit freigelassenen Sklavinnen eingingen, und auch Augustus selbst hatte sich getrennt, sowohl von Clodia als auch von Sempronia, um schließlich Livia zu heiraten, die Frau, die er liebte.
Jedesmal, wenn Salvius wieder an diesem Punkt angekommen war, fühlte er sich machtlos. Im Gegensatz zu ihm hatte der Kaiser die Besitztümer seiner Ehefrau nicht beleihen müssen.
Nun aber erwartete Cornelia ein Kind – Jupiter allein wusste, wie das möglich war. Für eine Weile tröstete sich Salvius mit dem Gedanken, dass er für alle Zukunft von der Verpflichtung befreit war, einmal im Monat das Bett mit ihr zu teilen, eine Pflicht, die ihn während all der Jahre dazu gezwungen hatte, sich mit Alkohol abzustumpfen, sich aber nicht so zu berauschen, dass er keine Erektion mehr bekam.
Es war, als würde man mit einer Toten Liebe machen, deren Körper bereits kalt und starr ist, dachte Salvius schaudernd, als er in seiner Sänfte auf dem Heimweg war.
Die verängstigte Fünfzehnjährige im Zelt damals in Dakien hatte er schon längst vergessen.
»Sie ist verrückt«, entfuhr es ihm, und er dachte dabei auch an ihre Brüder und deren Wahnsinn, an den Fluch, der auf der alten Patrizierfamilie lastete. Cornelius hatte seine Söhne mit eigenen Händen getötet, als die unheilbare Geisteskrankheit sich ihrer bemächtigt hatte. Jetzt lebte er einsam in seiner herrschaftlichen Villa in den Bergen am Lacus Albanus, ohne Nachkommen, doch reich wie der Kaiser selbst und nicht ohne Einfluss.
Vermutlich wusste er aus sicherer Quelle, daß Salvius Cornelias Besitztümer verpfändet hatte – das Gut auf Sizilien und die großen Ländereien in der Ebene südlich vom Rubicon.
Salvius seufzte und trieb seine Träger an. Die Stadt war schwarz, als wäre sie in einen riesigen Sack gesteckt worden, doch im Schein der Fackeln, die die Sklaven trugen, nahm er wahr, wie die Säulen des Saturntempels flackernde Schatten auf das Forum warfen. Lange schaute er zum Tempel hinüber und dachte über die römische Schatzkammer unter dem Podium mit ihren unermesslichen Reichtümern nach.
Wie gewöhnlich hatte er zu viel gegessen und war übersättigt nach der opulenten Mahlzeit bei Setonius. Er müsste seine Schwäche für gebratenen Flamingo mit gegorener Makrelensauce endlich überwinden lernen. Schließlich wußte er seit langem, daß der Magen mit dem zähen Fleisch nicht so recht fertig wurde. Mit dem Wein hatte er sich allerdings zurückgehalten, wohl weil er ahnte, dass er an diesem Abend bei klaren Sinnen sein musste.
Es war spät, doch wie immer herrschte noch lärmende Betriebsamkeit. Bald würde in den Straßen das laute Quietschen der Räder widerhallen, wenn die beladenen Karren zur Nachtstunde durch die Gassen rollten, um die Stadt mit Früchten und Gemüse, Fisch und Fleisch zu versorgen.
Rom schläft nie, dachte er, doch dann verfiel er wieder in seine qualvollen Grübeleien.
Er konnte nicht leugnen, dass die Ehe mit Cornelia ihm Vorteile gebracht hatte: Offizier in Dakien gewesen zu sein, wo er mit einem Mal zu den Nächsten des Feldherren gehört hatte, war nur einer von ihnen. Doch zu Ehren war er nicht gekommen, der Sieger war Cornelius Scipio. Und sehr bald hatte Salvius den Geschmack an all den Unbequemlichkeiten des Lagerlebens verloren. Mit Hilfe des Schwiegervaters hatte er eine Stelle in der städtischen Verwaltung für die Wasserversorgung bekommen. Die Arbeit war weniger beschwerlich, und er wurde bestens von einem seiner griechischen Sklaven umsorgt.
Salvius besaß ein einzigartiges Talent, das sogar in Rom ungewöhnlich war, ihm jedoch nur wenige Vorteile brachte: Er liebte sich selbst mit einer reinen und beinahe kindlichen Liebe. Zu seinen Geheimnissen gehörte auch der leidenschaftliche Wunschtraum, einmal im Leben in den Genuss furchteinflößender Macht zu gelangen.
Dieser Traum hatte ihn zur Knabenliebe getrieben. Lange Zeit hatte er gehofft, die vollendeten Knabenkörper würden sein Blut zum Sieden bringen, und seine Seele würde sich im Mysterium der Auflösung selbst vergessen.
Mit äußerster Sorgfalt hatte er seine Knaben ausgesucht, und der Kauf hatte ihn in die gleiche prickelnde Erregung versetzt wie der Erwerb einer seltenen antiken Vase. Der Rausch war jedoch ausgeblieben: Die Knaben hatten ihm im Bett nicht mehr bedeutet als die Sklavenmädchen, die er im Lauf der Jahre gekauft hatte, um sein alltägliches Vergnügen zu mehren.
Im Gegenteil, eine Frau verkörperte trotz allem das Andersartige, Rätselhafte; ihr Körper war weich, wenn seiner hart war, und ihr Wesen blieb geheimnisvoll. Bald langweilten ihn die Liebesstunden mit den Knaben. Das war vorauszusehen gewesen. Ihre geschmeidigen Körper wurden zu einer schmerzhaften Erinnerung an die Jugend, die sein eigener, in die Jahre gekommener Körper für immer hinter sich gelassen hatte.
Salvius hatte beinahe aufgegeben, auf die Liebe zu hoffen, als das Unerwartete eintrat. Eines Morgens hatte ihn ein Mädchen, ein blutjunges Geschöpf, nicht hübscher als andere, dazu etwas schwer, etwas bäurisch, auf dem Sklavenmarkt mit ihrem Blick festgehalten. Die Luft zwischen ihnen war erfüllt von Sehnsucht, und das Bezwingende daran hatte Salvius betroffen gemacht.
Die folgenden Jahre wurden die reichsten seines Lebens. Der Mittelpunkt seines Universums war nicht länger er selbst, und die Leidenschaft wuchs zur Liebe. Wie immer, wenn das Dasein lebendig wird, werden die Konturen deutlicher, das Licht schärft die Schatten, und Cornelias Macht über sein Gemüt wuchs. Er wollte nicht daran zurückdenken, was mit den Sklavenmädchen, mit denen er im Lauf der Jahre das Bett geteilt hatte, geschehen war.
Doch auch die Angst wuchs.
Er hielt Seleme nun vom Haushalt fern, und zum ersten Mal seit langer Zeit erfreute er sich wieder an den exotischen Knaben. Sie waren so aufreizend, dass sie den Sinn trübten; es war schwer, noch etwas anderes zu sehen als sie.
Cornelia war weder neugierig, noch fiel ihr etwas auf.
Ganymedes, sein getreuer Hofmeister, verstand auch ohne Worte und sorgte dafür, dass die Griechin im Hintergrund blieb; sie ging im geschäftigen Treiben der Sklaven unter.
Aber jetzt? Beide erwarteten sie ein Kind.
Er fürchtete das Pathetische, deshalb rang er in seiner Sänfte nicht die Hände, sondern gestand sich ein, dass er unerbittlich auf einen Entschluss zusteuerte. Dann jedoch klammerte er sich wieder an den Gedanken, Cornelia könnte im Kindbett sterben – eine tröstende Vorstellung, der er sich Monate lang hingegeben hatte. Wie, fragte er sich, sollte dieser tote Körper jemals Leben freigeben? Dieselbe Frage hatte er bei Cornelius Scipio wahrgenommen, dem Alten, der offen heraus gesagt hatte: »Hauptsache, der Junge bleibt am Leben.«
Richtig, dachte Salvius, das Wichtigste ist, dass das Kind überlebt. Egal, ob Sohn oder Tochter, der Erbe von Cornelius’ Reichtümern sollte in seinem Haus heranwachsen – als ein Garant dafür, dass er, Salvius, keinen Mangel an den Genüssen dieses Lebens würde leiden müssen.
Schließlich war er bei der großen Villa am Abhang des Palatins angekommen, der abweisenden Fassade, die Salvius’ Stolz und Augenstern hütete. Als er aus der Sänfte stieg, gelang es ihm zu vergessen, dass auch dieses Haus ein Geschenk von Cornelius war.
Salvius wurde von Ganymedes empfangen, bemerkte sogleich die sorgenvollen Runzeln auf der Stirn des Alten und wusste, daß etwas geschehen war. Salvius nahm sich nicht die Zeit, am Säulengang zu verweilen und den Duft des Jasmins zu genießen, sondern eilte auf seine Gemächer zu. Dort, auf der Liege, erwartete ihn Seleme, und als er sah, wie blass sie war, verschwanden alle tröstenden Gedanken, und er fühlte den Zeitpunkt, einen Entschluss zu fassen, wieder näherrücken.
Bald darauf hatte er ihren Bericht vernommen und entschieden, den Koch auspeitschen zu lassen, der Cornelias Sklavin fortgeschickt hatte. Doch das verriet er Seleme nicht; er tröstete sie, liebte sie, und bald schlief sie ein. Er aber lag wach und kämpfte mit der großen Entscheidung.
Bereits am nächsten Morgen, nach dem Besuch der zahlreichen Bittsteller, wollte er Selemes Freilassung veranlassen. Die Bürokraten hatten es nicht eilig, und es könnte einen oder mehrere Monate dauern, dann aber sollte das Mädchen der unmittelbaren Macht Cornelias entzogen werden.
Cornelias Zorn würde ihn treffen, am schlimmsten sollte es jedoch ihr selbst ergehen. Eine Weile genoss Salvius den Gedanken, wie sich die Schande an Cornelias versteinertem Herzen vorbeischleichen und ihre Klauen in ihren Magen schlagen würde, um die ewige Übelkeit noch zu verschlimmern. Noch kränker würde sie werden, dachte er, und dem Tod bei der Geburt noch einen Schritt näherkommen.
Sie muss sterben, uns allen zuliebe muss sie sterben, dachte er und wünschte, er könnte seine Gebete an einen wohlwollenden Gott richten. Aber ihm fiel keiner ein, und bald erlöste ihn der Schlaf von der Anstrengung.
Am nächsten Morgen erschienen ihm die Gedanken der Nacht unnötig düster. Als er aufwachte, stand Seleme in der Tür zum Garten und kämmte ihr langes Haar – den Kariatyden auf der Akropolis ähnlicher als je zuvor. Sie schien stark genug zu sein, ungeheure Lasten auf ihren Schultern zu tragen, nun, wo ihr der Schlaf ihre Sicherheit zurückgegeben hatte.
Ihm gefiel das nicht.
Wie groß, wie wichtig war ihre Unterwerfung für seine Liebe? Wurde seine Lust dadurch stärker, dass sie voll und ganz sein eigen war, ihr Leben und Denken von ihm abhing? Für diesen einen Menschen war er der absolute Herrscher, der Besitzer ihrer Träume; er befriedigte ihre Wünsche, er war der Gebende, der Zeuger.
Vor einem Jahr noch war sie scheu und ungebildet gewesen. Ihr Griechisch war arm an Worten und von einem breiten Dialekt entstellt; jetzt war ihre Sprache klar und schön.
Und das Lateinische, die Sprache, die er ihr geschenkt hatte, war nicht so dürftig wie das der anderen Sklaven, sondern klangreich und gewandt. Er dachte an Setonius, den Bruder seiner Mutter, bei dem er am Abend zuvor eingeladen war. Er hatte eine Sklavin mit der letztmalig erblühenden Lust eines alten Mannes geliebt – und sie freigegeben. Nun war die Leidenschaft gestorben, und die einstige Sklavin herrschte über die Tage des Alten, das Haus und die Geldtruhe.
Da warf Seleme ihren Kopf zurück, mit einer Geste voller Stolz, und sie lächelte, als sie sagte: »Wie du weißt, bin ich eine Auserwählte.«
Das war ein alter Scherz zwischen ihnen, doch an diesem Morgen fand Salvius keinen Gefallen daran. Als er aus dem Bett stieg, hatte er bereits beschlossen, ihre Freigabe aufzuschieben. Bis auf weiteres.
Sie stritten nie. Trotzdem hatte er eine tödliche Angst vor Cornelia und musste jeden Morgen seinen ganzen Mut zusammennehmen, um an ihre Tür zu klopfen. Der Besuch war kurz, doch die Zeit schien in ihrer Gegenwart stillzustehen, so dass er jedesmal schrecklich zu frieren begann.
»Ich hoffe, du bist bei guter Gesundheit.«
Wie gewöhnlich hatte er zwei Schritte in den Raum gemacht und war dann stehengeblieben.
»Danke, es geht mir gut.«
Sie log, es war offensichtlich, dass sie log, ihre Gesichtsfarbe wirkte gelblich, und ihre Augen brannten wie im Fieber und waren unnatürlich groß.
»Das freut mich.«
Er sah sie an, ohne sie wirklich zu sehen, so als wüsste er, dass etwas Schreckliches passieren würde, wenn er ihr Bild in sich aufnahm. Sie sah seine Furcht nicht, nur seine Verachtung, die wie die ihres Vaters war – ein Blick, der durch sie hindurchging, als würde sie nicht existieren, als hätte es sie nie gegeben.
Als er auf dem Weg zur Tür war, sagte sie: »Du hast wieder einmal einer Sklavin ein Kind gemacht.«
Er drehte sich zu ihr um, wartete mit diesem leeren Blick, der sie wertlos machte. Doch er sagte nichts.
»Ich brauche eine Amme für meinen Sohn«, sagte sie. »Für dieses eine Mal dürfen sie und das Kind am Leben bleiben.«
Er hoffte, sein Gesicht würde ihn nicht verraten; sie sollte weder seine unerhörte Erleichterung noch seinen glühenden Hass bemerken, als er sich verbeugte und auf dem Absatz kehrt machte. Noch einmal blieb er an der Tür stehen:
»Ich hatte geglaubt, es sei unser Sohn«, sagte er. »Aber vielleicht habe ich mich geirrt.«
Mit Genugtuung sah er, wie Cornelia für einem Moment aus ihrer Teilnahmslosigkeit gerissen wurde.
Die Schmähung traf sie wie ein Peitschenhieb. Und sie hatte Angst. Falls Salvius das Kind verleugnete, wäre es um sie geschehen. Sie blieb allein auf dem Bett zurück, und ihr Magen krampfte sich zusammen. Das tat zwar weh, schlimmer waren jedoch die roten Nebel hinter ihren Augenlidern.
Mehr als alles andere fürchtete Cornelia diesen flammenden Nebel. Dahinter nämlich verbarg sich die Vernichtung, der schwarze Wahnsinn. Oft hatte der Bruder, den sie geliebt hatte, von den wallenden roten Nebeln gesprochen, denen man widerstehen musste, um nicht zugrunde zu gehen.
Er hatte es nicht geschafft – eines Tages war er verschwunden.
Doch Cornelia würde standhalten; entschlossen heftete sie den Blick auf Junos Bild. Ihre Augen tränten von der Anstrengung, jedes Blinzeln zu vermeiden.
Lucius Cornelius Scipio war fünfundfünfzig Jahre alt, doch er sah sich so, wie die Welt ihn sah – als alten Mann.
Er gehörte nicht zu dem Zweig des Geschlechts, der Julius Cäsar in Spanien bekämpft hatte; sein Vater hatte sich auf der richtigen Seite befunden, als er in der Schlacht bei Philippi gefallen war, wo Brutus in Übereinstimmung mit seinen Träumen seinem bösen Genius begegnet war.
Cornelius saß also einigermaßen sicher in seiner Villa in den Albaner Bergen und auf seinem Platz im Senat. Nicht ohne Bewunderung sah er zu, wie Augustus die Versammlung, die einst die Welt erobert und beherrscht hatte, entmachtete und zu einer blökenden Schafsherde werden ließ. Er selbst gehörte eher zu den stummen Schafen. Er wollte leben, auch wenn es zuweilen vorkam, dass er sich fragte, wozu.
Wenn er gelegentlich von seiner Kindheit sprach, pflegte er zu erwähnen, er sei dabeigewesen, als Julius Cäsar die Mystiker auf dem Marsfeld mit dem Begrüßungswort ›Quirites, Mitbürger‹ bezwang. Doch bei dieser Art von Erinnerung konnte man sich nie ganz sicher sein. In seiner Kindheit war immer wieder die Geschichte erzählt worden, wie er auf dem Arm seines Vaters gesessen und Cäsar zugehört hatte. Seine Freunde brachten ihn wiederholt dazu, von der Verschwörung zu erzählen, stets mit der Frage, ob er keine Statue in Rom – als Vorzeichen für den Mord – hätte weinen sehen. Doch er hatte keine rechte Erinnerung an das große Entsetzen, das durch die Herzen der Römer ging, als Cäsars Leiche auf dem Forum verbrannte.
Deutlich dagegen erinnerte er sich an das Bild der Giraffe, die Julius Cäsar im Circus Maximus zur Schau gestellt hatte.
Als Feldherr über zwei Legionen hatte er den Frieden in Dakien wiederhergestellt und Roms Grenze bis zur Donau erweitert. Er war einer von Augustus’ großen Generälen, doch nie hatte er einen wirklichen Triumph davongetragen. Die Ehe von Pompeius mit der Tochter des Metellus Scipio stand im Weg. Und überdies hatte der Kaiser den Janustempel geschlossen und den römischen Frieden ausgerufen.
Die Bilder des Krieges verblassten nie in seiner Erinnerung und hatten ihre Schärfe behalten. Das hatte sein Leben leicht gemacht. Als sehr junger Mann hatte er eine Cousine geheiratet. Drei Kinder hatte sie ihm geboren, doch beide Söhne waren einer Geisteskrankheit erlegen.
Die Tochter? Er war bei ihrer Geburt zu Hause, und er erinnerte sich, dass sie ihm von der ersten Stunde an gleichgültig war. Boshaft als Kind, war sie jetzt eine Frau im mittleren Alter, an der Grenze zum Wahnsinn.
Er hatte seine Söhne getötet. Seine Frau hatte Hand an sich gelegt, und das Mädchen wurde von Nadina, einer freigegebenen Sklavin, dem einzigen vernünftigen Menschen an seiner Seite, umsorgt. Krank von seinen düsteren Gedanken, war er zur Donau zurückgekehrt, wo er eines Abends den Mut fand, Coresus, dem alten Arzt, sein Herz zu öffnen. Um seinen eigenen Verstand hatte Cornelius nie gefürchtet, doch er glaubte, dass ein Fluch auf seinem Geschlecht lag.
Der Arzt hatte seine Ansicht jedoch nicht geteilt, sondern die Schuld in der Heirat mit der Cousine gesehen. Cornelius, der sowohl Hunde als auch Pferde züchtete, wusste sehr wohl, dass schlechte Anlagen im Blut ausschlagen und gedeihen konnten, wenn man sich nicht vor Inzucht hütete.
Die Worte des Arztes hatten ihm Trost geschenkt und ein wenig Hoffnung gemacht. Cornelius hatte ja immer noch eine Tochter, und bei entsprechender Heirat …
Damals hatte er Marcus Salvius ins Auge gefasst, einen Offizier, der sich durch nichts anderes auszeichnete als durch ein gutes und unbekümmertes Wesen und durch einen frischen, etwas rundlichen Körper. Sein Vater, ein Kaufmann aus Antium, hatte ein Vermögen von solcher Größe erworben, dass er sich damit für den Rang eines Ritters qualifiziert und für seinen Sohn eine Offiziersstellung in der römischen Armee erhalten hatte. Cornelius Scipio hatte mit leiser Verachtung beobachtet, wie sein Schwiegersohn letztlich der Verlockung des Goldes erlag, als ihm die Ehe mit der Tochter des Feldherren angeboten wurde.
Doch der Zuchthengst entpuppte sich als Enttäuschung; leichtfertig ging er mit Cornelias Geld um, und ein Nachkomme blieb aus – bis jetzt, nach fünfzehn Jahren. Die Nachricht vom jetzt endlich bevorstehenden lang ersehnten Ereignis ließ Cornelius eine nie gekannte Freude empfinden, die ihn selbst verwunderte. Endlich zeigte sich ein Hoffnungsstreifen am Morgenhimmel des alten Feldherrn, und täglich besuchte er seine Tochter, um sich zu vergewissern, dass es ihr den Umständen entsprechend gut ging.
Nun war sie im siebten Monat, das drohende Risiko einer Fehlgeburt war überwunden, und Cornelius beschloss, einen Dankesbesuch in Scipio Africanus’ Villa abzustatten, um den Vorfahren seine Ehrerbietung zu bezeugen. Das schlichte Haus aus Quadersteinen in der überwältigend schönen Natur von Liternum erfüllte Cornelius mit Andacht. Hierher hatte sich der Mann, den man den Schrecken von Karthago nannte, zurückgezogen, als er begriff, dass seine Anwesenheit in Rom den Frieden bedrohte. Hier hatte er wie ein einfacher Bauer die Erde bestellt.
Nach dem Neuntagefest im August setzte in der Stadt am Tiber die Hitze ein. Die Bettler starben auf den Straßen wie Fliegen, und die Reichen flüchteten an die Küsten, wo der Wind Kühle versprach und die alten Bäume Schatten spendeten. Rom stank. Die Jauchegruben, in die die Armen ihre Latrinen entleerten, kochten in der Hitze. Am schlimmsten war der Gestank vor den Häusern der Tuchfärber, wo der Harn in den Bottichen gärte.
Flamen Dialis, Jupiters Oberpriester, der den Gott verkörperte und daher die Stadt nicht verlassen durfte, quälte sich in seinem Palast. Auch Cornelia war in der Stadt geblieben.
Ihre Stimmung war etwas besser geworden, nachdem Salvius mit der griechischen Sklavin verschwunden war. Cornelia hatte eingesehen, dass das Mädchen mehr bedeutete als eine bloße Laune und der alte Hurenbock nun doch einer Leidenschaft erlegen war.
Er machte sich lächerlich, und sie, Cornelia, verletzte das.
Nun waren sie fort – entschlossen strich Cornelia die beiden aus ihrem Gedächtnis. Noch immer suchten sie die roten Nebel heim, doch Flaminica, die in ihrer Ehe mit Flamen Dialis das heilige Leben der Juno lebte, hatte ihr versichert, dass diese roten Nebel ebenso zur Schwangerschaft gehörten wie die sonstigen eigentümlichen Unpässlichkeiten.
Cornelia wollte daran glauben, und es glückte ihr. Die Entbindung würde den Wahnsinn vertreiben – und sie befreien von dem Kind, das in ihr wuchs und ihr mehr und mehr wie ein Ungetüm vorkam, das von ihrem Blut zehrte und ihre Knochen aushöhlte.
Auch Cornelius war in Rom zurückgeblieben, und einmal am Tag besuchte er sie. Er kam, um ihre Mahlzeiten zu überwachen und sie zu zwingen, unter seinem unerbittlichen Blick die stärkende, weiße Grütze zu essen. Manchmal verspürte sie den Wunsch, für ihre Heldentat gelobt zu werden, doch ihr war klar, dass sie keinerlei Anerkennung bekommen würde und dass Cornelius nicht aus Sorge um sie täglich erschien.
Salvius besaß ein kleines Landgut an der Küste südlich von Antium. Er hatte es in etwas verfallenem Zustand von seinem Vater geerbt. Cornelia war noch nie dort gewesen, und in dem Anwesen steckte auch nicht die geringste Summe ihres Geldes. Nun richtete er es für Seleme notdürftig her. Sie liebte die kleinen Gebäude, die Winde, die vom Meer heraufwehten, und den schweren Duft der Pinien in der Abenddämmerung. Hier warteten sie gemeinsam auf ihr Kind, nur von einigen Sklaven umgeben.
Der Junge kam Anfang September, nach einer Nacht voller Schmerzen. Zwischen den Wehen hielt Seleme ihren Blick fest auf die Wand gerichtet. Dort hatte sie für Artemis einen Altar errichtet, auf den Salvius eine antike Statue der Göttin gestellt hatte.
So ging während der langen Nacht die Stärke der Göttin auf sie über, die Kraft, sich zu öffnen und zu pressen. Und als der Junge in der Morgendämmerung den Griff um die Gebärmutter löste, schrie Seleme vor Glück auf.
Gleichzeitig bemerkten sie, dass das Kind seinem Vater ähnelte, mit seiner langen Nase und dem fein gezeichneten, wollüstigen Mund. Nur die Farben waren die seiner Mutter – der honigfarbene Flaum auf dem Kopf, die weiße Haut und die eindringlich blauen Augen. Mit tiefem Ernst nahm Salvius sein Kind auf den Arm und ging beim ersten Schein der Morgensonne mit ihm am Strand entlang. Der Junge schlief, erschöpft vom harten Kampf, und als Salvius die Hilflosigkeit des Kindes sah, durchfuhr ihn ein Schreck.
Noch einmal rief er den Gedanken in sich wach, der nun zu einer magischen Formel geworden war: Cornelia musste sterben.
Seleme blieb auf dem Landgut zurück, und Salvius wendete sich in Rom wieder seinen Pflichten zu. Er stellte fest, dass Cornelia zu einem von grauer Haut überzogenen Skelett abgemagert war und einen grotesken Bauch vor sich hertrug.
Am schlimmsten waren ihre Augen, die aus den Höhlen zu quellen drohten.
Anfang Oktober kehrte Seleme mit ihrem Sohn in das Stadthaus zurück, und in der Mitte desselben Monats, an einem frühen Morgen, setzten Cornelias Wehen ein. Sie stöhnte nicht, doch der Schweiß lief ihr von der Stirn und vermischte sich mit ihren Tränen. Der große Bauch zog sich heftig zusammen, aber Cornelia war verschlossener denn je, und das Kind rührte sich nicht von der Stelle.
An ihrem Bett arbeiteten zwei Ärzte, die Cornelius gerufen hatte, badeten sie und flehten sie an, schrien auf sie ein, sie solle nachgeben – doch vergebens. Sie hatte die Orientierung verloren, kämpfte nicht länger darum, den Fötus aus ihrem Körper zu pressen, sondern führte einen Kampf gegen die Nebel, die sie auszulöschen drohten.
In der zehnten Stunde hielt es der ältere der beiden Ärzte nicht länger aus, und mit aller Kraft schlug er ihr die Faust ins Gesicht und schrie: »Gib endlich nach, Menschenskind!«
Der Schlag rettete dem Kind das Leben – und Cornelia vor dem Wahnsinn. Die ungeheure Wut übertrug sich auf die Presswehen, das Kind rutschte nach unten, und Cornelia kehrte voll glühenden Hasses in die Wirklichkeit zurück.
»Dieser Schlag wird dich das Leben kosten«, sagte sie zu dem Arzt, und ihre Stimme klang merkwürdig ruhig. Ihre Wange blutete, dort, wo sie sein Ring verwundet hatte.
Das Kind wurde vom Großvater entgegengenommen, der in tiefer Dankbarkeit sah, dass der Junge wohlgestaltet und ihm in jeder Hinsicht ähnlich war – ein Spross des uralten Geschlechts der Scipionen.
Der Junge wurde von geübten, unbeteiligten Händen gebadet. Einen Moment lang war er versucht aufzugeben, zurückzukehren und der Einsamkeit zu entfliehen, die ihn erwartete. Doch Minuten später lag er an Selemes Brust und trank sich ins Vergessen.
Salvius, der den ganzen Vormittag auf einer Bank im Atrium gewartet und dieses Kind kaum eines Blickes gewürdigt hatte, bis es der Amme übergeben wurde, bewegte tiefenttäuscht nur ein einziger Gedanke: Cornelia hat trotz allem überlebt.
Als er sich erhob, um sich an der Tür zu ihrem Zimmer zu verbeugen, hörte er die Jubelschreie vom Forum herüberschallen – es war der Fünfzehnte des Monats, und gerade war das Oktoberpferd von Flamen Martialis geopfert worden.
Nur wenige Stunden später an diesem Tag unterschrieb Kaiser Augustus das Gebot, dass die Schätzung aller Welt nun auch in der Provinz Judäa vorgenommen werden sollte.
Wie es die Sitte verlangte, wurde der Sohn nach seinem Vater benannt: Marcus.
Ein hässliches Kind, aber geduldig und tapfer.
So sah ihn Seleme.
Zuweilen empfand sie so etwas wie Zärtlichkeit für das arme Geschöpf, das es gerade noch geschafft hatte, Cornelias Körper lebend zu verlassen, als wollte es trotz allem weiterleben. Sorgsam legte sie Cornelias Sohn immer als ersten an die Brust. Dieser setzte sich in blindem Heißhunger mit einer solchen Beharrlichkeit durch, dass Seleme zuweilen Abscheu für ihn empfand. Sie befürchtete, er würde sich alles nehmen, und das, was übrig blieb, würde für das eigene Kind nicht mehr reichen. Doch Seleme merkte schnell, dass sie sich auf ihren Körper verlassen konnte. Wie hungrig die Jungen auch waren, die Milch reichte immer, und es blieb sogar noch etwas übrig.
Marcus schrie oft vor Bauchgrimmen und Einsamkeit, wenn Seleme ihr eigenes Kind liebkoste. Der Lärm drang bis zu Cornelia hinüber; sie spürte, wie sich ihre Gebärmutter zusammenzog, und rasend vor Wut stürmte sie aus ihrem Gemach.
Selemes Besorgnis steigerte sich zu wildem Schrecken: Marcus musste ruhig gehalten werden, koste es, was es wolle. Solange die Koliken anhielten, wanderte sie nächtelang mit dem Jungen in den Armen auf und ab, bis er schließlich einschlief und sie für ein paar Stunden einnicken konnte.
Bald darauf wurde sie jedoch von ihrem eigenen Sohn geweckt, der voller Lebenskraft nach seiner Mahlzeit schrie.
Salvius floh aus dem Haus, trieb sich in der Stadt herum und war fast immer betrunken, wenn er spät nachts zurückkehrte.
Einzige und unerwartete Unterstützung erhielt Seleme während des harten Winters von dem Mann, vor dem sie sich beinahe ebenso fürchtete wie Cornelia. Jeden Abend erschien Cornelius Scipio, nahm Marcus für ein paar Stunden auf den Schoß und verbreitete Ruhe in Selemes Leben. Er sah ihre Erschöpfung, und eines Tages sprach er mit ihr über Nadina, eine alte Dienerin in seinem Haus in Albanus.
Er sagte, sie habe Erfahrung mit Säuglingen, ob Seleme sie zur Seite haben wollte?
Seleme war erleichtert, doch Salvius wurde wütend. Ihm war klar, dass Nadina kam, um sie zu kontrollieren, und dass Marcus’ Recht gegenüber Eneides behauptet werden sollte.
Salvius wagte jedoch nicht, sich dem Schwiegervater zu widersetzen, und Nadina zog in das Haus auf dem Palatin ein, wo sie sogleich zu einer Wohltäterin wurde.
»Liebes Kind«, sagte sie zu Seleme, »du versiegst, wenn du nicht zum Schlafen kommst.« Also nahm sie sich nach der Morgenmahlzeit der Kinder an, und Seleme fand endlich Ruhe.
In der Umgebung der Griechin und der Kinder wurde Ordnung geschaffen. Nadina besaß die Autorität, die Seleme fehlte, und bewirkte, dass die Sklavinnen gehorchten und Respekt zeigten. Vor allem erkannte sie bald die Ursache für Marcus’ Bauchweh.
»Er bekommt zu viel zu trinken«, sagte sie. »Er darf nicht so lange an der Brust liegen.«
»Aber wenn er schreit?«
»Na und, alle gesunden Kinder schreien.«
»Wenn er schreit, kommt Cornelia gelaufen.«
»Um die kümmere ich mich schon«, sagte Nadina.
Und das tat sie auch. Das nächste Mal, als Cornelia wild schimpfend aus ihrem Zimmer gestürmt kam, stand Nadina vor ihr, groß und kräftig, mit dem schreienden Marcus auf dem Arm: »Schluss mit dem Wahnsinn, Cornelia. Du weißt, was Scipio mit seinen Kindern macht, wenn sie sich im Leben nicht durchsetzen können.«
Zu ihrem größten Erstaunen sah Seleme, wie sich Cornelia schweigend und besiegt zurückzog.
Im März, als die Sonne wärmer wurde, fuhren Seleme, Nadina und die Kinder auf das Gut an der Küste. Dort sah Marcus zum ersten Mal den Himmel und das gewaltige Meer, das weiche Gras und die großen, geheimnisvollen Bäume. Langsam erwachte in ihm ein Gefühl dafür, dass die Erde trotz allem schön sei, und dass das Gras und das Meer auf seiner Seite waren.
Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits erkannt, dass er niemandem Freude bereitete, und dass Seleme, sein Licht, ihr Glück in Eneides fand, dem Bruder, der schöner war als alle Kinder der Welt. Doch er spürte auch seinen eigenen Wert und dass Cornelius’ schützende Macht irgendwie ihm, dem kleinen, hässlichen Marcus galt.
In besonders glücklichen Stunden tanzte Seleme mit ihrem Sohn, ihrem Sonnenschein, am Strand entlang. Sie wollte ihren Bund mit den Vögeln erneuern, und dieser Bund sollte auch Eneides miteinbeziehen. Manchmal glückte es ihr, und eine Drossel oder sogar eine Möwe ließen sich auf ihrer Schulter nieder und blickten auf das Kind in ihren Armen. Doch oft wartete sie vergeblich. Sie erkannte, dass die Vögel der Küste und des Meeres von anderer Natur waren als die Waldvögel in Bithyniern
Die Kinder gediehen wunschgemäß, die düsteren Töne verklangen aus dem Leben der Griechin, und wenn sie an Cornelia dachte, dann in sanfterer Stimmung. Nadina hatte Cornelia einmal besiegt, und wenn es nötig wäre, würde sie es wieder tun.
Als im April die Felder blühten, nannte Seleme Nadina zum ersten Mal Mutter und rührte damit das Herz der alten Frau. Sie sagte zu Cornelius, der einige Male in der Woche den langen Weg bis zu ihnen hinaus machte: »Du musst sehen, daß Salvius Seleme freigibt.«
Und Cornelius versprach, all seine Kräfte einzusetzen, um Salvius dazu zu überreden, den entscheidenden Schritt zu tun.
Salvius tobte. Natürlich wagte er es nicht, dem Schwiegervater offen zu widersprechen, sondern bejahte halbherzig, obwohl es in seinem Inneren rebellierte.
Seleme und das Kind waren die einzigen, die er sich im Kampf gegen Cornelia und deren Geschlecht erobert hatte. Beim Jupiter, wie er diese Scipionen hasste, die ihn als jungen Mann gekauft hatten und seitdem sein ganzes Dasein beherrschten. Wie einen Sklaven hatte man ihn behandelt, und als er spät in seinem Leben endlich die Liebe gefunden hatte, griffen sie wieder mit ihren Befehlen ein.
Selbst den jüngsten Scipionen hasste Salvius, der ständig an Selemes Brust lag.
Nur zuweilen, für einen kurzen Augenblick, machte er sich bewusst, daß Cornelius’ ständige Ermahnungen, er möge Seleme freigeben und Eneides adoptieren, vernünftig waren. Er hatte ja selbst schon daran gedacht und stand kurz vor dem Entschluss.
Doch damit war es nun vorbei.
Wie ein schmollendes Kind war er zu den Weinkrügen zurückgekehrt, zu Bacchus’ Trost, dem einzigen, der ihm noch blieb, jetzt, wo ihn auch Seleme verlassen hatte.
Cornelia erholte sich erstaunlich schnell. Sie aß mit Appetit, nahm wieder zu. Der Körper erholte sich, und ihr Gemüt hellte sich auf. In Junos Tempel begegnete man ihr mit neuem Respekt, den sie ihrem Sohn verdankte.
Flamen Dialis entstammte ebenfalls einem alten Geschlecht, doch im Gegensatz zu den Scipionen war es allen seinen Vorfahren geglückt, sich im Bürgerkrieg auf die richtige Seite zu stellen. Das hatte ihm zu dem hochangesehenen Dienst als Jupiters Oberpriester verholfen.
Gemeinsam mit seiner Gattin verkörperte er nun Jupiters heilige Ehe mit Juno. Flaminica und Cornelia waren seit ihrer Kindheit miteinander befreundet, und dieses Band hatte in all den Jahren gehalten.
Flaminica hatte ein weites Herz. So oft es der Anstand zuließ, besuchte Cornelia das Haus von Flamen Dialis auf dem Capitol. Sie gehörte zu den wenigen in Rom, die das heilige Ehebett gesehen hatten, dessen Füße der Sitte gemäß in frischem Lehm stehen mussten: Der Gott des Tages hatte die Nacht in fruchtbarer Vereinigung mit der Erde zu verbringen.
Cornelia bewunderte Flamen Dialis, doch sie fürchtete seinen Blick.
Sie dachte viel über den Mann nach, der die Hälfte des Universums beherrschte – den Kosmos des Lichts. Schwerer war für sie zu verstehen, dass seine Gattin das weibliche Prinzip und Junos düsteren Himmel verkörpern sollte.
Aber sie glaubte Flaminicas Worten, dass jede Frau, die einmal eine Frucht in sich getragen hatte, mit der dunklen Göttin und der eigenen, ihr innewohnenden Juno einen Bund eingehen könne. Die Vereinigung würde der Frau magische Kräfte verleihen und die Macht der Göttin auf Erden stärken. Oft besuchte Flaminica Junos Grotte in Lanuvium, wo sie mit Hilfe der zahmen Schlange über die verborgenen Seiten der Menschen herrschte.
Bald schon würde Cornelia, deren Körper wieder gesundet war, Flaminica auf die Fahrten begleiten, die im innersten Raum des Tempels begannen.
Mit kindlicher Erwartung bereitete sich Cornelia auf die Reise vor, doch die langen Stunden im Gebet führten sie nicht aus ihrem Körper heraus.
»Du musst Geduld haben«, sagte Flaminica.
Obwohl Cornelia täglich viele Stunden an den Kulthandlungen teilnahm, blieb ihr das Mysterium verschlossen. Flamen Dialis, der durch seine Gattin von Cornelias missglückten Versuchen erfuhr, sah darin ein Zeichen: Cornelia würde Junos Kräfte missbrauchen, falls sie Zugang zu ihnen fände.
Eines Tages sprach er mit Cornelia selbst darüber. Sie schlug die Augen nieder und verriet mit keiner Miene, wie tief er sie verletzt hatte. Doch als sie an jenem Tag nach Hause fuhr, drohte der Wahnsinn sie einzuholen.
Es war im zeitigen Frühjahr; Seleme und die Kinder hatten die Stadt verlassen, und Cornelia legte sich ins Bett. Die roten Nebel hinter ihren geschlossenen Lidern flammten wieder auf und machten ihr Angst. Alles Leiden war umsonst gewesen. Selbst die Göttin der Dunkelheit hatte sie abgewiesen.
Wahrscheinlich hätte sie dieses Mal nicht die Kraft gehabt, gegen den Wahnsinn anzukämpfen, wenn ihr nicht eine Hand gereicht worden wäre. Sie gehörte Esebus, dem schwarzen Knaben, der nach dem Verkauf aller anderen im Haus zurückgeblieben war. Salvius hatte ihn zurückbehalten, in Erwartung eines Käufers mit dem richtigen Geschmack für das Exotische, der für den Knaben einen guten Preis zahlen würde.
Schon lange Zeit gab es ein stilles Einvernehmen zwischen Cornelia und dem Knaben; ihre Blicke waren einander begegnet und hatten verstanden. Doch erst am heutigen Tag war sie so tief gesunken, die Freundschaft eines Sklaven anzunehmen.
Nun saß er an ihrer Seite und tröstete sie mit böswilligem Klatsch über Salvius und Seleme. Beinahe körperlich konnte Cornelia spüren, wie sich ihre große Enttäuschung in Hass verwandelte, und ihre Wut richtete sich gegen die Griechin, die ihr Mann und Kind genommen hatte.
Die roten Nebel verschwanden, als ihr Blick unverwandt auf dem Gesicht des Knaben an ihrem Bett ruhte und sich an der Süße seiner Augen festsog.
Sie ergriff seine Hand – eine unerhörte Geste von ihr.
»Glaube nicht, dass ich aufgegeben habe«, sagte sie. »Ich warte nur auf die richtige Gelegenheit.«
Er lächelte sie an.
Rasch und hart wurde das Band geknüpft. Schamlos zeigte sich Cornelia in der ganzen Stadt mit dem schwarzen Sklaven an ihrer Seite. Er begleitete sie zur Rennbahn und zu Empfängen, und der Klatsch erhielt reichlich Nahrung: Scipios stolze Tochter und ein schwarzer Sklave, schön wie ein Gott aus dem dunklen Afrika.
Alle Welt lachte über sie.
Oft suchten sie Zuflucht bei den großen Gladiatorenspielen, wo man sie gemeinsam jubeln sah, wenn die Spannung am größten war.
Zu Junos Tempel auf dem Capitol kehrte Cornelia niemals zurück.
Auf einem Absatz in den Albaner Bergen, in einiger Entfernung von Ciceros Tusculum, hatte Cornelius Scipio seine Villa erbaut. Er hatte den Platz sorgfältig ausgewählt: Im Hintergrund erstreckten sich die blauen Berge, und vor sich hatte er die kühlen Wälder mit immergrünen Steineichen, einem großen Bestand an Hainbuchen und Korkeichen, Ahorn und Linden in zartestem Grün.
Die Gebäude waren streng und schön. An das große Haupthaus schlossen sich, verbunden über eine Terrasse, die Gebäude für die Gäste an, dann die Festsäle und die großen Bibliotheken, eine griechische und eine lateinische.
Von der Terrasse aus konnte Cornelius auf den Lacus Albanus, den tiefen Kratersee, blicken, der in den heißen Sommermonaten der Landschaft Kühle gab.
Zwischen dem Haus und den Stallungen, den Hundezwingern und den Wohnstätten der Sklaven, die allmählich ein eigenes kleines Dorf bildeten, hatte Cornelius einen großen Garten angelegt. In seiner Artenvielfalt konnte er sich durchaus mit Cäsars berühmten Gärten auf der anderen Seite des Tiber messen. Jetzt im Frühjahr blühten schneeweiße Azaleen, rote Päonien, blaue Hortensien und die ersten zartroten Rosen. Auf der Terrasse plätscherte der Springbrunnen, und entlang der Mauer überwucherte wilder Wein die spitze Stechpalme, das goldgelbe Habichtskraut und die rosa Wildrosen.
Doch der Frühling war auch die Zeit des weißen Mondes und des Nebels. Und mit den Nebeln erhielt Cornelius Besuch von den Toten. Sie entstiegen dem See und näherten sich zögernden Schrittes der Terrasse, auf der er saß.
So viele Tote, so viele Heimatlose.
Abertausende waren es – Gefallene, die nach den Schlachten in den Wäldern Germaniens und auf der Steppe jenseits der Donau zurückgelassen worden waren. Aber auch jene, die bei der Seeschlacht vor der griechischen Küste ertranken.
Ohne Gesichter und Namen kehrten sie zu ihrem alten Feldherrn zurück. Cornelius sah von seiner Terrasse aus, wie sie sich ihm näherten und wieder zum Lacus Albanus zurückgingen, in dem sie erneut umkamen. Anfangs versuchte er den Toten noch Namen und Gesichter zu geben, er glaubte ihnen das schuldig zu sein.
Doch sie waren zu zahlreich.
Der Tod hatte sein ganzes Leben beherrscht. Dennoch wusste er nichts über ihn, wusste nicht, wie er ihm in der Stunde des Überganges begegnen würde.
Die Toten erschreckten ihn nicht. Aber sie erfüllten ihn mit Trauer – nicht weil sie einst ihr Leben geopfert hatten, sondern weil er nun nichts mehr für sie tun konnte.
Der Tod kennt keine Heimat, hatte jener griechische Philosoph gesagt, dessen Vortrag Cornelius in Rom gehört hatte. Diese Wahrheit fand er in der Schlacht bei Philippi bestätigt, als sich die Römer im Namen von Antonius und Oktavian gegenseitig umbrachten. Darüber hinaus hatte er mit der langen Rede über den Tod nicht viel anfangen können, obwohl sie von einem berühmten Philosophen gehalten worden war. Der hatte gesagt, der Tod sei ein ständiger Begleiter des Lebens, und in jedem Augenblick würde die Vergangenheit in uns sterben.
Er hatte das Leben als ein Abschiednehmen und den Tod als die einzige Gewissheit bezeichnet. Doch Cornelius hatte sich in dieser Schilderung nicht wiedergefunden. Das Leben war zu reich, um ein Abschied zu sein: Es bestand aus Freude und Schmerz, Siegen und Verlusten. Das Leben war das einzig Gewisse, und man konnte ihm Gaben abverlangen: Schönheit, die man sich erträumen und verwirklichen konnte; ebenso Freundschaft, die zwar mehr von einem forderte, doch auch größere Freude bescherte, wenn man sie gewann. Und Treue.
Dann waren da noch die großen Gefühle, größer als man selbst: der Siegesrausch, die Macht und die Ehre. Bereits im Wüstenkrieg am Euphrat hatte er erlebt, wie sich diese Gefühle bis zur Ekstase gesteigert und ihm den Verstand geraubt hatten. Dort hatten die Toten den Ernst dieses großen Spiels bestätigt. Und Cornelius Scipio erinnerte sich, dass sogar der Tod selbst ein Rausch war – blutrot und überwältigend in seiner gewaltigen Schönheit.
Ein weiteres Gefühl, größer als der Mensch, war die Trauer. Er dachte an seine unglückselige Ehe zurück, an die wahnsinnige Gattin und an die Söhne, die er ermordet hatte. Und an die Verzweiflung, die die Grenzen seines Körpers gesprengt hatte und in einem Schrei zum Himmel gestiegen war.
Dieser Ruf hätte die Herzen der Götter erweichen müssen, dachte er, er hätte die kalten Sterne zum Erzittern bringen müssen. Doch das Universum blieb vom Schmerz der Menschen unberührt.
Nun durchbrachen einige der Toten die Kette, rückten näher, kamen sogar bis zum Rand der Terrasse. Diese Toten hatten ein Gesicht – es war Lucius, der älteste Sohn, und Gaius, der jüngere, der auf das Leben so neugierig gewesen war, ehe ihn der Wahnsinn eingeholt hatte.
»Ich habe das einzig Mögliche getan.«
Cornelius sagte es mit brüchiger Stimme, und am liebsten hätte er die Augen mit den Händen verdeckt, damit er die toten Söhne nicht sah.
Doch sie hörten ihn nicht, lächelten ihn an. Sie waren nicht gekommen, um ihn zu richten, sie suchten ihre Erinnerungen in dem alten Haus – vielleicht das dreibeinige Holzpferd oder eine Puppe ohne Augen.
Da berührte Mythekos, der Sklave, den Alten und sagte sanft: »Sie haben geschlafen, Herr, Sie hatten einen bösen Traum.«
Cornelius erhob sich mit steifen Gliedern, blickte über die Wälder und den See, der im Mondschein glitzerte. Er war wieder ins Leben zurückgekehrt.
Behutsam half Mythekos seinem Herrn ins Bett. Doch der Schlaf wollte nicht kommen. Hellwach, den Blick zur Decke gerichtet, versuchte er an die toten Söhne zu denken.
Noch einmal wollte er sich an ihre Gesichter erinnern, Zug um Zug. Möglicherweise ist es das einzige, was wir für die Toten tun können, uns an sie erinnern, dachte er. Doch es gab wenig, an dem er seine Erinnerung festmachen konnte – er war so selten zu Hause gewesen, als die Kinder klein waren.
Erst beim Morgengrauen stellte sich der Schlaf ein, und mit ihm die Träume. Und da vermochte er sie zu sehen, die Söhne: Lucius, der ein ernstes Kind war, und Gaius, den Eifrigen. Er konnte die beiden hören, ihre hellen Vogelstimmen. Aber er verstand nicht, was sie sagten.
Er hatte ihnen nie zugehört.
Im Traum sah er, dass Lucius Marcus glich, dem Kind, das Cornelius endlich zu lieben wagte.
Er erwachte mit der üblichen nagenden Sorge um Marcus.
Heute werde ich noch einmal die Frage nach Selemes Freilassung stellen, dachte er.
Eneides blieb weiterhin ein ausgesprochen hübsches Kind. Sein römisches Gesicht mit der geraden Nase, dem festen Kinn und dem weichen, ausdrucksvollen Mund stand in überraschendem Gegensatz zu dem blonden Haar, der beinahe goldfarbenen Haut und den blauen Augen.
Er war quicklebendig und es fiel ihm leicht, seine Gefühle zu zeigen, denn er konnte sicher sein, dass sie gutgeheißen würden. Sowohl die Wut, die zuweilen in seinen Augen aufblitzte, als auch die Enttäuschung, die seine Augen mit riesigen Tränen füllte, denen kein menschliches Wesen widerstehen konnte. Auch fühlte er sich schnell verletzt, wurde dann aber in die Arme genommen und mit Küssen bedeckt.
Und sein Lachen steckte die ganze Welt an.
Selbstverständlich entwickelte er sich schnell, lief schon, bevor er ein Jahr alt war, sprang wie der Wind über die Wiesen, ehe er zwei war, und plapperte unablässig in einer so niedlichen Kindersprache, dass jeder dahinschmolz.
Es fällt leicht, Eneides zu lieben, zu leicht, dachte Nadina, die alte Dienerin, und bemerkte, dass Seleme die gleichen Gedanken hegte und deshalb versuchte, ihren Stolz und ihre Freude zu verbergen.
Salvius ließ seinen Gefühlen freien Lauf, er betete seinen Sohn an – den Sklavenjungen, der seinen Besitzer um den kleinen Finger wickelte. Es kam sogar vor, dass er im Licht des Jungen eine Zeitlang nüchtern blieb und sich dann seiner Verantwortung bewusst wurde: Er mußte Eneides adoptieren und Seleme freigeben.
Doch das böswillige Spiel mit Cornelia hatte einen neuen Reiz erhalten, denn ein weiterer Stein war ins Spiel gekommen: Sie konnte ihre Abhängigkeit von dem schwarzen Sklaven nicht verbergen. Bei ihren täglichen kurzen Begegnungen erprobten Salvius und Cornelia ihre Macht übereinander. Ohne dass es offen ausgesprochen worden wäre, war beiden bewusst, dass die geringste Drohung gegen Seleme Esebus’ unmittelbaren Verkauf zur Folge gehabt hätte.