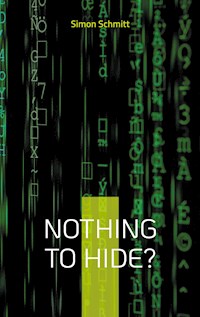Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Morgens nicht aufstehen, abends nicht einschlafen können. Zu kaputt um weiterzumachen, zu gesund um aufzugeben. Sich lieber nicht suchen, um nicht ganz verloren zu gehen. Die Umarmung brauchen, aber die Nähe kaum ertragen. Morgen hassen, was man gestern noch geliebt hat. Hinter der buntesten Maske farblos sein. Appetitlos in sich hineinstopfen. Am Galgen Humor haben. Und manchmal am Leben zugrunde gehen. Jeder hat sein eigenes Labyrinth. Allein deshalb wird es nie den einen Ausweg geben. Dennoch lassen sich oft ähnliche Bausteine erkennen, die bei der Orientierung helfen können. Ein Erfahrungsbericht mit Abgründen, mehr und weniger klugen Lösungsansätzen und anderthalb Klinikaufenthalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinen Eltern, Freya und Frau Scharl
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Abwärts
The way we survive…
Omegatier
Musterschüler
Menschliches Versagen I
Menschliches Versagen II
Menschliches Versagen III
Abgrund
Im Kreis
Wut der Verzweiflung
Hochzeit
Stuck in somebody else’s dream
Someone who brings you home…
Honigwaffeln
Freundschaft I
Neither burn out, nor fade away
Psych-?
Prodepressiva
Disko
Win-Win
Desperate times call for desperate measures
Eiszeit
Platz für Schweres I
Once I stayed alive for you…
…now I would even die for you
Freundschaft II
Aufwärts
Klinisch lebendig
Gruppentherapie
Gemeinsamkeiten
Gegensätze
The hardest ones to love…
Kraftausdruck
Platz für Schweres II
Wunden
Pflaster
Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser
Update I
Update II
Update III
Virus
Grenzüberschreitung
Leidensgenossen
Rückzug
Wer fliegen will, muss springen
Stadt, Land, Fluss
Freundschaft III
Platz für Schweres III
Schlusswort
Melancholia
Vorwort
Wenn ich nur das Wort „Vorwort“ sah, hatte ich schon keine Lust mehr weiterzulesen. Doch das half nichts. Ich brauchte eine Antwort auf die Depression und so bin ich in aussichtslosen Phasen oft durch Buchhandlungen geirrt und habe nach Werken gesucht, die mir irgendwie hätten weiterhelfen können. Wenn es auch nur einer Person genauso geht, ihr dieses Buch in die Hände fällt und sie etwas daraus ziehen kann, bin ich schon froh, dass ich mir die Arbeit gemacht habe. Außerdem ist es für mich selbst wichtig, meine eigenen Gedanken und Schlussfolgerungen so ernst zu nehmen, dass ich sie nach außen vertreten kann. Wenn man gesund werden will, muss man das lernen.
Für einige Überschriften hatte ich Liedtexte zitiert, da deren Aussagen es auf den Punkt bringen und mir eine simple Übersetzung davon zu schwammig klang. Allerdings sind die Richtlinien zu Kleinzitaten etwas ungenau, man darf nur seit 70 Jahren verstorbene Personen frei von Einschränkungen wiedergeben und es gibt Abmahnanwälte, die sich auf derartige Verstöße spezialisiert haben. Weil ich nicht warten wollte, bis alle tot sind (die Künstler, nicht die Anwälte) und die 70 Jahre vergangen, habe ich die jeweiligen Sätze abgewandelt und nur die Kernaussagen übernommen, damit keine Rechte verletzt werden.
Lange habe ich überlegt, wie detailliert oder trocken ich bestimmte Erlebnisse beschreibe, ohne dass sie zu Lasten des Zusammenhangs zu schnell abgehandelt sind, bzw. Mitleid-Gedöns entsteht. Letztendlich entschied ich mich für einen Mittelweg, der dem gerecht werden sollte. Beim Lesen darf jedoch keinesfalls der Eindruck entstehen, dass es erst einen drastischen Auslöser braucht, bis Handlungsbedarf besteht. Generell muss in diesem Punkt natürlich jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Hätte man mir in manchen Angelegenheiten aber bereits auf halber Strecke gesagt, dass ich geradewegs in eine Sackgasse renne, wäre ich vorher umgekehrt.
Einleitung
Seit ich mich erinnern kann, frage ich mich, was die Leute anders machen, die ihr Leben augenscheinlich annehmen können, obwohl ihre Situation aussichtslos zu sein scheint. Mir stand die Welt offen, aber ich habe die Hälfte meiner Zeit kraftlos im Bett liegend, oder auf der Toilette verbracht. Meine Schwester weiß von klein auf, dass sie eine lebensbedrohliche Krankheit hat, ihr Körper ist von Natur aus schwächer als meiner und dennoch steht sie jeden Morgen ohne Murren auf und geht ihres Weges.
Als ich bereits eine Weile außer Gefecht war, fing ich an, mich in Büchern und Foren selbst schlau zu machen. Die Aussage, dass man in der Depression stets mit einem negativ verzerrten Blick durch die Welt gehe, fing an mich zu beschäftigen. Mir gefiel der Gedanke, dass ich alles nur etwas zu verdunkelt sehe und lediglich einen Weg finden muss, diese Brille abzusetzen. Wirklich daran glauben konnte ich nicht. Mein Körper rebellierte mit jedem Tag mehr, ich konnte kaum noch richtig schlafen oder essen und es gab offensichtlich nichts, wofür es sich noch gelohnt hätte aufzustehen. Obwohl das alles unveränderlich zu sein schien, ließ ich den Gedanken an ein besseres Leben zum Glück nicht los. Inzwischen habe ich verstanden, wie es zu all dem kam und wie ich den Prozess wieder umkehren konnte. Um zu erkennen, wo anzusetzen ist, musste mir allerdings erst einmal bewusst werden, wie ich in diesem Loch gelandet war.
Abwärts
The way we survive makes us who we are
Sommer 2003 - Ich bin mit meiner Mutter, meiner Tante und meiner Schwester an der Ostküste der USA. Während wir in unserem Mietwagen unterwegs sind, holt mich zum ersten Mal ein Chaos aus Gedanken und Gefühlen ein, das mir in Zukunft noch öfter begegnen sollte. Ohne ersichtlichen Grund kann ich die Situation kaum ertragen und fange an, mich an allem zu stören, bis ich letztendlich nur noch um mich wüte. Mit aller Gewalt versuche ich klare Gedanken zu fassen, doch es klappt einfach nicht. Da ich bald 15 werde, denke ich, dass das etwas mit der Pubertät zu tun hat, aber es scheint noch mehr dahinter zu stecken.
Wir kommen gerade von einem Familientreffen der amerikanischen Selbsthilfegruppe von FA-Betroffenen. FA ist Fanconi-Anämie, meine Schwester hat diese Krankheit. Aufgrund eines Gen-Defekts kann es dabei schon im Kindesalter zu einer Rückbildung des Knochenmarks, Leukämie, Schleimhautkrebs oder Hirnblutungen kommen. Man schätzt, dass auf eine Million Geburten fünf bis zehn Neuerkrankungen kommen. Die Lebenserwartung soll 15 bis 20 Jahre betragen, höre ich immer. Meine Schwester ist zwei Jahre jünger als ich. Seit ich klein bin, läuft im Hintergrund der Gedanke mit, dass sie vielleicht nicht lange da sein wird. Doch ich kenne es nicht anders, mir ist die Tragweite nicht bewusst. Dennoch lasse ich sie kaum an mich heran und verhalte mich ihr gegenüber alles andere als brüderlich. Vor anderen beschütze ich sie zwar, selbst behandle ich sie aber auch nicht besonders gut. Wenn sie etwas falsch macht, wofür sie geärgert werden könnte, werde ich meist aggressiv und will sie dazu zwingen, es richtig umzusetzen. Es ist eine seltsame Mischung aus Belehren, Behüten und Abstand halten.
Die Anzahl der verstorbenen FA-Kinder, mit denen ich auf Treffen der deutschen Selbsthilfegruppe gespielt habe, kann ich bereits zu diesem Zeitpunkt kaum mehr zählen. Und will ich auch nicht. Und vor allem nicht darüber nachdenken, wie viele davon noch gehen werden. Das hat schon immer dazu gehört. Genauso, dass ich auf meine Schwester etwas mehr Acht geben muss, weil sie sehr schnell blaue Flecken bekommt. Doch ich weiß, dass es ihr im Vergleich zu anderen Betroffenen gut geht.
Nach dem FA-Treffen besuchen wir Anne, die seit drei Monaten ein Auslandsjahr in Ohio verbringt. Sie ist nicht meine Freundin, aber die Freundin.
Was Freundschaften angeht, habe ich ein eigenartiges System entwickelt. Anne steht über allem. Meine Mutter und meine Schwester sind mir nicht egal, aber ich pflege seit geraumer Zeit ein solches Verhältnis zu ihnen, dass ich mit ihrem Verlust irgendwie zurechtkommen könnte. Auch wenn es merkwürdig ist, wie intensiv ich mich mit diesem Gedanken auseinandersetze, kann ich nur vermuten, dass es etwas mit dem Tod meines Vaters, ein halbes Jahr nach der Geburt meiner Schwester, zu tun hat. Eigentlich scheine ich mich damit aber abgefunden zu haben, denn ich kann mit seiner Person kaum Gefühle in Verbindung bringen und habe auch keine einzige klare Erinnerung an ihn. Außerdem kenne ich viele andere Kinder, die ebenfalls ohne Vater aufgewachsen sind und von denen zeigt auch keines ein besonders auffälliges Verhalten. Es ist zwar schade, wenn man sieht, wie andere mit ihren Vätern zusammen Zeit verbringen, doch man arrangiert sich früher oder später damit. Nur diese ständigen Überlegungen, wie ich mich schützen kann, falls dem Rest meiner Familie auch etwas zustoßen sollte, können nicht ganz normal sein.
Obwohl ich Anne noch nicht einmal ein Jahr kenne, nimmt sie so die Rolle einer Schwester, einer Partnerin und irgendwie auch die, jeder anderen Bezugsperson ein. Bis dahin hatte ich mit Mädchen relativ wenig am Hut. Vorher waren PC-Spiele mein größtes Hobby, doch das hat sich über Nacht geändert. Die Möglichkeit, die Sorgen um alle anderen einfach mal vergessen und sich nur auf eine Person konzentrieren zu können, ist unbezahlbar. Oft werde ich gefragt, ob ich mich nicht in sie verliebt hätte, aber darum geht es mir nicht, obwohl sie überdurchschnittlich attraktiv ist. Es ist lediglich diese feste Instanz, die ich will, und auf eine bestimmte Weise braucht sie mich auch. Ich habe keine großen Ansprüche, bin jederzeit verfügbar, sage so gut wie nie „nein“, dafür immer öfter „ja“.
Als meine Familie und ich wieder in Deutschland sind, muss ich mich langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass Anne nun noch neun Monate fort sein wird.
Für mich ist das der GAU. Das Prinzip, das hinter dieser Freundschaft steckte, hatte mir schließlich so etwas wie Leichtigkeit gegeben. Endlich konnte ich damit aufhören, mir bei jedem Krankenwagen, den ich in der Ferne hörte, sofort Horrorszenarien auszumalen oder einen Plan Z zu überlegen, falls ich tatsächlich von einem auf den anderen Moment alleine weiterleben müsste. Auch der Zwang, jederzeit auf alles so gut wie möglich vorbereitet zu sein, hatte etwas nachgelassen. Diese Freundschaft war extra nicht auf „unsicheren“ Faktoren wie Liebe aufgebaut, sondern stand auf handfesten Argumenten, auch wenn das bedeutete, dass ich meine Bedürfnisse konsequent hinten anstellen musste. Doch dafür bekam ich eben Leichtigkeit und auf die wollte ich nicht mehr verzichten müssen.
Nun war Anne aber 6.000 Kilometer entfernt, wo ich keinerlei Einfluss darauf hatte, was mit ihr geschieht und was aus unserer Freundschaft wird. Bald darauf kann ich zum ersten Mal beobachten, wie sich meine Sorgen auf meinen Körper auswirken. Neben einer leichten Antriebsschwäche vernehme ich auch Magenbeschwerden, die in immer regelmäßiger werdenden Abständen kommen und gehen.
Omegatier
Winter 2005 - In den Weihnachtsferien holt mich meine Mutter nach einer Feier bei Bianca1 ab. Anne wurde in ihrer Abwesenheit durch sie ersetzt. Wie das so schnell passieren konnte, verstehe ich selbst nicht ganz, doch ich habe das gleiche Programm und Gefühl kurzerhand auf eine andere Person übertragen. Diesmal ist das Verhältnis aber etwas lockerer, da ich inzwischen auch einen besten Freund habe, mit dem ich durch dick und dünn gehe. Bianca ist ebenfalls ziemlich hübsch und so gut wie jeder in meinem Freundeskreis würde ihr näher kommen wollen. Manchmal denke ich auch darüber nach, aber der Sicherheitsfaktor hat Priorität, das Verlangen nach Nähe muss sich hinten anstellen.
Auf der Heimfahrt erzählt mir meine Mutter, dass in dieser Nacht eine Freundin von uns an den Folgen einer Knochenmarktransplantation starb, der sie sich aufgrund ihrer Fanconi-Anämie unterziehen musste. Bisher hatte ich einen gewissen Abstand zu den meisten Verstorbenen, doch mit ihr habe ich in den letzten Jahren einige heitere Spieleabende verbracht. Trotzdem lässt es mich fast kalt, als ich davon erfahre, was mir auch nach einigen Tagen noch äußerst seltsam vorkommt.
Wir haben derweil Besuch von der Schwester eines anderen FA-Kindes. Sie ist in meinem Alter und wir sind uns während des letzten Familientreffens schon etwas näher gekommen. Es tut gut, jemandem um sich zu haben, der in einer ähnlichen Situation steckt. Sie kennt das, wenn einem ständig Gedanken über die Krankheit, Leben und Sterben durch den Kopf gehen. Und darüber, was eigentlich wichtig sein soll, in Anbetracht dessen, dass so viele, die wir kennen, vielleicht nie das Erwachsenenalter erreichen werden. Die meisten unserer Freunde mussten sich mit so etwas nie auseinandersetzen. Durch diesen gemeinsamen Nenner, haben wir bald ein anderes Verhältnis, als ich es bisher mit Anne oder Bianca kenne. Da sie aber 200 Kilometer entfernt wohnt und wir beide noch kein Auto fahren dürfen, bleiben wir vorerst nur telefonisch in Kontakt.
Meine Bauchschmerzen treten nun immer häufiger auf. Es liegt die Vermutung nahe, dass es sich dabei um Unverträglichkeiten gegenüber bestimmten Lebensmitteln handelt, noch kann ich aber nicht ausmachen, durch was genau sie hervorgerufen werden.
Sommer 2006 - Ich fahre mit meiner Familie nach Griechenland. Nach einigen Tagen macht mir wieder die „Sinnlosigkeit“ von Urlauben zu schaffen. Wie immer habe ich dieses bedrückende, teilweise unerträgliche Chaos in meinem Kopf, wenn ich einfach nur wo bin, um dort zu sein. Sogar auf der Abschlussfahrt im Vorjahr hatte ich damit zu kämpfen. Ich kann nicht begreifen, wieso ich es nicht schaffe, lediglich zu entspannen. Es mangelt mir doch eigentlich an nichts. In diesen Phasen scheint aber alles völlig sinnlos zu sein und wenn man mir nur den kleinsten Grund dafür liefert, platzt der Zorn aus mir heraus. Diesmal endet es in einem so heftigen Streit, dass sich meine Mutter das Datum markiert.
Einen Monat später werde ich 18. Langsam aber sicher entfernen sich die Themen, die mich beschäftigen, weitestgehend von denen, die meine Freunde interessieren. Noch kann ich mich unter sie mischen, doch die Momente, in denen ich mich aus dem Geschehen ausklinke und in meinen Gedanken verliere, nehmen mit jeder Woche zu. Dabei verfalle ich stets in die selben wiederkehrenden Überlegungen über Leben und Tod, bis ich zwangsläufig zu dem Ergebnis komme, dass tatsächlich alles ziemlich sinnlos ist. Allmählich finde ich es aber äußerst seltsam, dass sich um mich herum wohl niemand die gleichen Sorgen macht. Es muss doch jemanden geben, der diese übertriebene Erwartung von Unglück und den ständigen Drang, sich gegen jede vorstellbare Gefahr so gut wie möglich wappnen zu müssen, kennt. Zwar stolpere ich inzwischen immer häufiger über das Wort „Verlustangst“, es begegnet mir jedoch hauptsächlich in Fernsehsendungen, in denen jedes Schicksal bis zum verstorbenen Goldfisch breitgetreten wird und diese Schublade ist die letzte, in die ich mich stecken will.
Doch es ist nicht nur die Angst vor dem Verlassenwerden, die mich beschäftigt. Während meine Freunde relativ locker nach vorne schauen, plagen mich Existenzängste, obwohl absolut nichts dafür spricht, dass ich je auf der Straße landen könnte. Wir sind nicht arm, haben ein eigenes Haus und unser Ort besteht gefühlt zur Hälfte aus Verwandten, so dass man jederzeit bei jemandem unterkommen könnte. Dennoch verzweifle ich zunehmend an der Vorstellung, später nicht gut genug auf ein Leben vorbereitet zu sein, an dem ich kaum noch richtig teilnehme.
Mit der Zeit machen mich diese Entwicklungen immer unsicherer, in Gesprächen mit Freunden merke ich aber, dass es ihnen mit ihren Problemen ähnlich geht und vermutlich jeder eine Seite an sich hat, mit der man sich etwas verloren vorkommt. Viele meiner Gedanken entdecke ich auch in den Liedtexten einiger Bands. Sie behandeln ähnliche Themen und ihre Videos haben im Internet Unmengen an Aufrufen. So ungewöhnlich kann das, was in mir vorgeht, also nicht sein.
Abgesehen von all dem bin ich seit jeher sehr übereifrig, was Regeln angeht. Wenn meine Freunde mal wieder irgendwo etwas anstellen, versuche ich sie entweder davon abzubringen oder überlege mir bereits eine wasserdichte Ausrede anstatt mitzumischen. Dieses Verhalten nutzte aber nicht immer. Einmal bekam ich sogar Sozialstunden auferlegt, inklusive der unschlüssigen Argumentation „mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen“. Oder andersherum. Jedenfalls wurde mir angelastet, dass ich nichts unternommen hätte, als ein Mädchen aus unserem Ort den Feuerlöscher einer Tankstelle klaute, damit die Straße besprühte und laut „Ghostbusters“ rief.
1 Um den Überblick zu wahren, habe ich allen Freundinnen, zu denen ich ein ähnliches Verhältnis wie zu Anne pflegte, fiktive Namen mit den Anfangsbuchstaben A bis E gegeben, in der Reihenfolge, in der ich sie kennengelernt habe. Sonstige Namen sind unabhängig davon gewählt.
Musterschüler
Meine größte Stärke, gleichzeitig wohl aber auch Schwäche, ist der Drang zur Perfektion, der sich aus dem Zwang, stets auf jeden Umstand vorbereitet sein zu müssen, ergibt. Er verleitet mich dazu, immer an mir arbeiten zu wollen, lässt mich jedoch schnell alles hinschmeißen, wenn einmal etwas nicht nach Strich und Faden verläuft. Doch nicht nur darunter leiden meine Noten.
Vom Ende der Grundschule bis hin zur Abschlussprüfung verbinde ich mit Lernen extreme Konzentrationsprobleme. Es war mir all die Jahre schleierhaft, wieso ich mir plötzlich so schwer tat, obwohl mein Erfolg von klein auf vorprogrammiert zu sein schien. Schon zum Ende der Kindergartenzeit hatte ich mir das Lesen mehr oder weniger selbst beigebracht, wurde kurz darauf noch vor meinem sechsten Geburtstag eingeschult und war dennoch bei allen Tests ganz vorne mit dabei. Aus so einem aufgeweckten Kind hätte doch etwas werden müssen.
In der Zwischenzeit ging es hingegen bergab. Auf der Realschule durfte ich sogar eine Ehrenrunde drehen, obwohl ich erst im Jahr zuvor vom Gymnasium gekommen war. Und das auch noch wegen zu schlechter Leistungen in Englisch und Französisch, den beiden Hauptfächern meiner jetzigen Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten. Das schrie geradezu nach „Du kannst doch, wenn du willst!“ Aber ich wollte wohl nie. Ich hatte es damals geradezu provoziert, das Schuljahr wiederholen zu müssen, um danach mit Anne in eine Klasse zu kommen. Als sie in die USA ging und mein Körper zu schwächeln anfing, hatte ich darauf gepokert, dass es wieder laufen würde, sobald sie zurück ist und wir erneut vereint sind. Sie kam allerdings in eine andere Klasse und ich hatte bereits Bianca kennengelernt, wodurch der Plan später hinfällig wurde. Da ich mir vor lauter Vorbereitung auf den Weltuntergang nie ernsthaft Gedanken darüber gemacht hatte, was ich später einmal werden will, meine Englischkenntnisse dank der Teilnahme an den amerikanischen Fanconi-Anämie- Familientreffen aber auf ein überdurchschnittliches Niveau gestiegen waren, entschied ich mich dafür, auf die Fremdsprachenschule zu gehen.
Wenige Wochen nachdem dort das neue Schuljahr begonnen hat, bemerke ich bereits, dass mich meine alten Lernprobleme erneut einholen. Sobald ich versuche den Stoff zu verinnerlichen, drifte ich immer wieder in die gewohnten Gedankenspiralen ab, bis ich es ernüchtert aufgebe. Mit der Zeit erkenne ich das als „Faulheit“ an und gebe mich mit dieser Definition zufrieden. Einige Lehrer merken das und weisen mich ebenfalls auf diese Faulheit hin, ihnen jedoch zu erklären, dass bei meinen Lernversuchen absolut nichts hängen bleibt, sondern sich nur Gedanken bezüglich der Sinnlosigkeit des Daseins breit machen, wäre wahrscheinlich genauso sinnlos.
Unter Druck funktioniert es hingegen fast immer. Wenn es aufgrund wichtiger Noten indirekt um meine Existenz geht, bleiben die ständigen unangenehmen Bilder aus und ich kann mir mit komplizierten Eselsbrücken und Mustern innerhalb kürzester Zeit den Stoff der letzten Wochen einprägen. So hatte ich es damals auch irgendwie bis zur mittleren Reife geschafft. Der Anspruch meiner neuen Schule wird aber selbst für das beste Kurzzeitgedächtnis bald zu viel. Mit aller Gewalt versuche ich dem Unterrichtsgeschehen zu folgen, doch es will mir kaum noch gelingen.
Während ich immer weiter abschweife, wächst langsam Wut in mir heran. Es zerrt an meinen Nerven, den Schulalltag, die ständigen Bauchkrämpfe und diese elende Sinnhinterfragung unter einen Hut zu bringen. In Anbetracht der Probleme, die in meinem unmittelbaren Umfeld herrschen, will ich meine Zeit nicht mit dem „unwichtigen“ Zeug verschwenden, das ich hier lernen muss. Gleichzeitig schäme ich mich aber für diese Einstellung, weil sich andere aufgrund ihres Gesundheitszustands eben nicht einmal fragen dürfen, was sie mit ihrer Zeit anfangen wollen.
Einige Wochen später ist der Schulstoff davon gerannt und ich bin stehen geblieben. Als der Berg an Problemen immer größer wird, leiste ich mir zunehmend freie Tage und hoffe, dass mich meine Crash-Lernmethoden im Notfall wieder retten werden. Aufgrund des ansteigenden Drucks beginnt nun aber auch noch das Einschlafen schwieriger zu werden.
Inzwischen habe ich eine eigene Wohnung im Mietshaus meiner Großmutter. Niemand bekommt mehr mit, was ich den ganzen Tag über treibe und ich verbringe die Zeit inzwischen gerne alleine. Gerede über belanglose Themen interessiert mich überhaupt nicht mehr. Da ich bei den meisten Leuten das Gefühl habe, sowieso nur an die Grenzen ihres Horizontes zu stoßen, gehe ich abgesehen von der Schule bald kaum noch außer Haus.
Manchmal muss ich aber. Weil Bianca und ich im Jahr zuvor ständig „wichtige“ Dinge am Handy zu klären hatten und sich die Minutenpreise damals noch um die 50 Cent ansiedelten, darf ich meine halbe Jugend Zeitungen austragen, um die dreistelligen Beträge der Handyrechnung zurückzuzahlen.
Menschliches Versagen I
Herbst 2006 - Wie jeden Mittwoch mache ich mich auf den Weg, um die Blätter zu verteilen. Da ich in der Nacht zuvor nur zwei Stunden schlafen konnte, bin ich ziemlich erschöpft, aber da stimmt noch etwas anderes nicht. Anfangs fühle ich mich nur ein bisschen komisch, doch nach einigen Schritten schießen mir ständig die gleichen schlimmen Bilder durch den Kopf. Andauernd muss ich an die Freundin denken, die an Weihnachten verstarb. Und dann an meine Schwester, wie sie im Krankenhaus liegt, mit Schläuchen im Gesicht. Gedanken an den Moment, vor dem ich mich schon immer fürchte, bisher aber nie an mich herangelassen hatte. Mit einem Mal kann ich mich nicht mehr dagegen wehren.
Den ganzen Tag über treibt es mir beim Laufen Tränen in die Augen. Auch die Vorstellung selbst zu sterben, irgendwann nicht mehr da zu sein, und dass sich die Welt dann einfach weiterdrehen wird, ist plötzlich unerträglich und lähmt meinen ganzen Körper. Krampfhaft versuche ich an etwas anderes zu denken, doch nichts kann mich mehr davon ablenken. Und ganz tief in dieser Angst liegt auch etwas Vertrautes, das ich mit einem Zeitpunkt verbinde, an dem meine Schwester und ich noch ganz klein waren. Als wolle mir gerade etwas bewusst werden, was ich seit Ewigkeiten hinten angestellt habe. Das ist in diesem Augenblick gleichermaßen beruhigend und erschreckend.
Auch am nächsten Tag geht mir alles so nahe, dass selbst, wenn ich nur im TV oder in der Zeitung etwas Schlimmes sehe, ich augenblicklich mitleide. Anfangs hoffe ich, dass es nur am Schlafmangel gelegen hat und die Angst wieder verschwindet, sobald ich mich einmal richtig ausgeschlafen habe, doch sie bleibt. Selbst beim Fußball- und Videospielen holt sie mich ein. Dass die Gedanken im Unterricht und beim Zeitungaustragen leichtes Spiel hatten, war nicht so verwunderlich, aber dass sie mich nun sogar in Aktivitäten, die Spaß machen sollten, nicht mehr in Ruhe ließen, ist zu viel.
Irgendein Fass muss übergelaufen sein. Alle Präferenzen haben sich auf einen Schlag verändert und bei jeder Ungerechtigkeit und jedem Leid, das ich aufschnappe, bin ich sofort berührt. Als wäre alles Kindliche in mir, wenn man davon überhaupt noch sprechen konnte, von ein auf den anderen Tag verflogen und damit auch mein Antrieb.
Um etwas Abstand zu gewinnen, flüchte ich mich in der Woche darauf zu der Freundin, die uns in den Weihnachtsferien besucht hatte. Aufgrund der ähnlichen Situation mit ihrer Schwester hoffe ich darauf, dass sie noch am ehesten nachvollziehen kann, was in mir los ist.
Nach ein paar gemeinsamen Tagen geht es mir tatsächlich besser. Zwar nicht so, wie vor dem seltsamen Einbruch, dennoch schaffe ich es, wieder klarere Gedanken zu fassen. Bald darauf wird das Verhältnis zu meiner neuen Freundin immer inniger, bis daraus sogar meine erste richtige Beziehung entsteht.
Depressionen waren schon immer ein Thema zuhause, unter anderem weil mein Vater damit Probleme hatte, aber bedeutete das zwangsläufig, dass es auch mich erwischt? Mit diesem Anliegen besuchen meine Mutter und ich unseren Hausarzt, der schon meinen Vater behandelt hatte. Er erklärt, dass ich erst zu einem Neurologen muss, bevor er mich zum Psychotherapeuten schicken kann. Wir bemühen uns daraufhin, so bald wie möglich einen Termin beim nächsten Nervenarzt zu bekommen, doch scheinbar spinnt die halbe Stadt, wenn es auf den Winter zugeht. Obwohl dort vier Ärzte angestellt sind, ist die Praxis für mehrere Monate ausgebucht.
Als ich meiner Klassenleiterin den Sachverhalt erkläre, empfiehlt sie mir einen Psychotherapeuten, mit dem eine ihrer Bekannten gute Erfahrungen gemacht hat. Bei ihm bekomme ich auch zügiger einen Termin. Nachdem ich dort erzählt habe, was in mir vorgeht, lässt er mich einen Persönlichkeitstest bearbeiten. Dieser ergibt, dass mein Mitgefühl und meine Empathiefähigkeit überdurchschnittlich ausgeprägt sind, eine Depression schließt der Therapeut aufgrund meines Verhaltens während der Sitzungen aber aus. Auch der Neurologe ist einige Wochen und ein paar Tests später nicht der Meinung, dass ein akutes Problem vorliegt, erklärt aber, dass man in Zukunft mit aufputschenden und stimmungshebenden Medikamenten, sogenannten „Uppers“, nachhelfen könnte, falls die Antriebsschwäche anhält.
Da aus fachmännischer Sicht alles in Ordnung zu sein scheint, gehe ich davon aus, dass es an meiner Einstellung liegt und nehme mir vor, mich in Zukunft zusammenzureißen. Das endet damit, dass ich einige Tage später nicht einmal mehr die Kraft finde, morgens aufzustehen und zwei Wochen lang auf der Couch vor mich hinvegetiere.
Bei meiner Freundin kommt es währenddessen häufiger zu ausufernden Streitereien zwischen ihren Eltern. Als die Situation eskaliert, ruft sie mich verzweifelt an und erklärt, dass sie es dort nicht mehr aushalten könne. Daraufhin mache ich etwas, was ich früher nie getan hätte. Obwohl ich die Konsequenzen kaum einschätzen kann, treffe ich eine nachhaltige Entscheidung und stelle dabei die Gefühle einer Person über die rationale Einschätzung der Situation.
In einer Nacht-und-Nebel-Aktion beschließen wir, dass sie ihr Zeug packt, ich sie abhole, und wir fortan zusammen bei mir wohnen. Uns ist zwar nicht ganz klar, was wir da tun, aber es fühlt sich auch nicht falsch an. Da meine Partnerin zu diesem Zeitpunkt noch 17 ist, befürchten wir, dass ihre Mutter die Polizei ruft oder uns sogar selbst verfolgt, doch wir versuchen uns nicht verrückt zu machen.
Das erledigen andere für uns. Als wir unterwegs etwas zu Essen besorgen wollen, dauert es einige Minuten, bis die Angestellte hinter der Theke auftaucht und sich entschuldigt: „Sorry, bin gleich da, ihr seid ja nicht auf der Flucht, oder?“ – Künstlich lachend schütteln wir unsere Köpfe. Doch wir kommen davon. Keine Polizei, keine Mutter.
In den Tagen darauf planen wir, wie es von nun an weitergehen soll. Für den ein oder anderen hat es von außen sicher nach einer jugendlichen Dummheit ausgesehen, doch aufgrund der ähnlichen Situation, dem Chaos, das uns noch erwarten würde, der damit einhergehenden Aussichtslosigkeit und dem Mangel an Alternativen, steht für uns außer Frage, dass wir dazu verdammt sind, den Rest unseres Lebens gemeinsam zu verbringen.