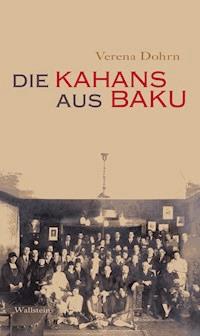
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer jüdischen Unternehmerfamilie in turbulenten Zeiten: zwischen Zwangsmigration und erfolgreichem Unternehmergeist. Die Geschicke der Kahans spiegeln ein dramatisches Jahrhundert europäischer Geschichte aus dem Blickwinkel einer jüdischen Unternehmerfamilie. In Konkurrenz zu Nobel und in Kooperation mit Rothschild machte Chaim Kahan (1850 -1916), der aus einem polnisch-litauischen Stetl stammte, sein Vermögen auf den Ölfeldern von Baku. Doch der Erste Weltkrieg zerriss die Familie, und die Herrschaft der Bolschewiki zerstörte das Milieu, das ihm zu Wohlstand verholfen hatte. In diesen unbeständigen Zeiten erbten die sieben Kinder seine Unternehmen. Sie flohen nach Berlin, gründeten erneut Firmen, wurden global player im Ölgeschäft und konterkarierten damit das Stereotyp vom armen Ostjuden. Sie betrieben Tankstellennetze und bewiesen Unternehmergeist in einer innovativen Branche von strategischer Bedeutung. Dazu waren sie philanthropisch tätig, halfen Flüchtlingen, retteten Verlage und engagierten sich für die jüdische Heimstatt in Palästina. Als die Nazis an die Macht kamen, floh die Familie, die transnational gut vernetzt war, noch einmal - von Berlin nach Paris, von dort nach Tel Aviv und New York. Abermals bewährten sich in der Not Traditionsbewusstsein und Familiensinn. Verena Dohrn erzählt die Geschichte der Kahans basierend auf Quellen aus privaten und staatlichen Archiven aus 14 Ländern, insbesondere aber anhand des Familienarchivs, das aus einigen Tausend Dokumenten besteht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 796
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Verena Dohrn
Die Kahans aus Baku
Eine Familienbiographie
Für meine Enkel –
Luis, Eric, Noa, Kolja und Kim
INHALT
KAPITEL 1In Haft. Jacob Kahan
KAPITEL 2Chaim Kahan. Von Orlja nach Brest-Litowsk
KAPITEL 3Leben unter den Bedingungen des Krieges – Berlin
KAPITEL 4Unterwegs. Wilna, Warschau, Charkow, Saratow …
KAPITEL 5Staatsbürgerschaften und Bildungswelten.Berlin, Bonn, Frankfurt, Marburg, Antwerpen
KAPITEL 6Nach Baku
KAPITEL 7Sina und die Ölfelder. Baku
KAPITEL 8Aron und das schwarze Gold. Baku
KAPITEL 9Sommerfrischen im Krieg. Bad Harzburg, Bad Neuenahr, Bad Polzin
KAPITEL 10Wirtschaften in Krieg und Revolution. Petrograd
KAPITEL 11Über die Front. Berlin, Warschau, Baku, Moskau, Wilna, Charkow, Kiew
KAPITEL 12Vertreibungen aus Russland. Baku, Charkow, Ekaterinoslav, Moskau
KAPITEL 13Neubeginn im Westen. Caucasian Oil Company. Kopenhagen, Berlin, London, Hamburg, Wilhelmshaven
KAPITEL 14Familie im Exil. Berlin
KAPITEL 15Die Nitag. Berlin
KAPITEL 16Bücherliebe. Petrograd, Wilno, Berlin
KAPITEL 17Schlüterstraße 36. Vertreibung aus dem ›Paradies‹. Berlin
KAPITEL 18Außenseiter in der Zwischenkriegszeit.Europäische Firmennetze. Berlin, Hamburg, Kopenhagen, London, Riga, Paris, Amsterdam
KAPITEL 19Die dritte Vertreibung. Paris, Lissabon
KAPITEL 20Erez Israel. Tel Aviv
KAPITEL 21Zufluchten. Die Familie lebt. New York, Tel Aviv, Ma’agen Michael
NACHBEMERKUNGEN ZU DEN QUELLEN
DANK
ANHANG
KAPITEL 1
In Haft. Jacob Kahan
September 1914. Seit anderthalb Monaten herrschte Krieg in Europa. Für Jacob war vermutlich schwer zu fassen, was seitdem geschehen war. Im Juni waren sie in die Sommerfrischen gefahren. Die Eltern, seine beiden Brüder und er, die Großeltern, Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen, waren von Petersburg, Charkow, Baku, Ekaterinoslav, Berlin gekommen, um, wie die Jahre zuvor und wie es in bürgerlichen jüdischen Familien üblich war, die über größere Entfernungen, ja mehrere Landesgrenzen hinweg, zerstreut lebten, den Sommer zusammen oder zumindest nahe beieinander zu verbringen. Die Mehrzahl von ihnen hatte sich im hessisch-fränkisch-rheinländischen Dreieck versammelt. Dieses Jahr kurten die Eltern in Wiesbaden, die Rosenbergs in Bad Kissingen, die Großeltern in Bad Neuenahr. In Wiesbaden hatte Jacob Radfahren gelernt, kurz bevor sie den Urlaub abbrachen, weil der Krieg begann. Das letzte halbe Jahr war turbulent und etwas unwirklich gewesen mit dem unerwarteten Umzug der Cousine Rosa von Warschau nach Berlin Ende Dezember, der Reise nach Ägypten und Palästina mit Eltern und Großeltern im April, dem Wiedersehen mit dem Bruder in Jaffa und dem Ausbruch des Krieges während der Sommerfrische, und nun die erzwungene Reise nach Berlin. Dabei hatte er in München gerade das zweite Semester erfolgreich hinter sich gebracht. Jetzt saß er hier fest. Die Einzelzellen im Stadtvogteigefängnis Berlin Mitte in der Dirksenstraße waren alles andere als komfortabel. Student Jacob aus begütertem, bürgerlichem Haus war von einem auf den anderen Tag zum Häftling geworden. Man hatte ihn als ›feindlichen Ausländer‹ festgenommen. Aus dieser Situation konnte ihm nur einer helfen – der Großvater, aber der war inzwischen weit fort, irgendwo im Russischen Reich, in Petersburg, Charkow, Saratow, Kislovodsk oder Baku.
Die Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien am 28. Juli hatte die Stimmung der jüdischen Feriengäste in den Kurorten gedrückt, die Hiobsnachrichten über die politischen Wirren die idyllische Ruhe des Badelebens zerstört. Wegen der schlechten Bahn- und Postverbindungen trafen Nachrichten, Telegramme und Zeitungen, die von den kurenden Kaufleuten, Fabrikanten und Bankiers gerade in dieser Situation besonders ungeduldig erwartet wurden, nur schleppend ein. Angesichts der lähmenden Ungewissheit machte sich Unruhe an den Quellwasserbrunnen, in den Wandelhallen, Lesesälen, an den Mittagstafeln, in den dürftige Depeschen umlagernden nervös gestikulierenden Menschengruppen breit. Dazu kam der Temperatursturz. Nach den heißen Tagen setzte plötzlich Regen ein, und es wurde kühl.
Am Tag nach der Kriegserklärung hatte Rosa in ihrem Brief aus Bad Kissingen an Jacob in Wiesbaden über das schlechte Wetter und die beängstigende politische Situation geklagt: »Der Krieg verdirbt allen gründlich die Stimmung und man hört über nichts anderes, man spricht nur über ihn.« Jacob, ebenso verstimmt, hatte sie in seinem Brief am Tag darauf ermutigt, sie solle sich nicht beunruhigen lassen und sich ihn zum Vorbild nehmen. Er nutze die Zeit in Wiesbaden zum Radfahrenlernen.
Als sich Deutschland an die Seite Österreich-Ungarns stellte, und beide am 1. August dem Russischen Reich den Krieg erklärten, kam in der Familie Kahan-Rosenberg eine fast freudig erregte Stimmung auf. Man sehnte den Zusammenbruch des alten zaristischen Regimes herbei und sorgte sich zugleich um die wirtschaftliche Existenz, die ein europäischer Krieg gefährden konnte. Zu jenem Zeitpunkt logierten die Großeltern in der Pension Villa Daheim im rheinländischen Bad Neuenahr, Jacob mit Eltern und Brüdern im Hotel Ritter, einem der beiden jüdischen, »gut geleiteten, rituell geführten Hotels« im alten hessischen Kurbad Wiesbaden, und Rosenbergs in der Villa Esplanade im Bayerischen Staatsbad Kissingen. In Erinnerungen heißt es, man sei wegen des Kriegsbeginns in jenem Sommer in Deutschland »stecken geblieben«. Um Internierungen an ungemütlicheren Orten zu entgehen, habe der Großvater für die Familie ein ganzes Hotel angemietet. Dies sei von der örtlichen Polizei akzeptiert worden. Kahan-Rosenbergs saßen in Bad Nauheim fest.
Tausende russischer Juden wurden durch den plötzlichen Kriegsausbruch in Deutschland zurückgehalten, österreichische aus Frankreich und Belgien nach Deutschland vertrieben, palästinische von ihrer Heimat abgeschnitten. Einige Hundert osteuropäische Juden, die den Sommer in deutschen Kurorten verbrachten, wurden in Bad Nauheim konzentriert, erinnerte sich Nachum Goldmann, der als staatenloser Student und Jude osteuropäischer Herkunft wegen Aufsässigkeit gegenüber der Staatsgewalt aus Frankfurt am Main verbannt worden war und sich ebenfalls dort einquartierte. Es wurde ihnen gestattet, in Hotels zu wohnen. Da es sich meist um vermögende Leute handelte, ging es ihnen recht gut. Aron Kahan, Jacobs Onkel, war zu der Zeit schon auf dem Heimweg. Die Nachricht vom Brand der Kahan’schen Raffinerie in Riga, die er zufällig in einer Berliner Zeitung gesehen hatte, trieb ihn zurück ins Russische Reich. Darüber schrieb er in seinen Erinnerungen, schon am Bahnhof habe er angesichts der vielen Soldaten und Krankenschwestern, der Präsenz des Roten Kreuzes verstanden, dass die Lage ernster war als gedacht: »Während unserer ganzen Reise kamen uns Militärzüge auf ihrem Weg zur Grenze entgegen, und in Gatschina erzählten uns Soldaten, dass die Deutschen gerade die Grenze zu Russland überschritten hätten. Der Weltkrieg hatte begonnen.« – Den meisten, vor allem den vermögenden Russländern, die der Kriegsbeginn in Deutschland überrascht hatte, wurde im Laufe der nächsten Wochen die Heimreise ermöglicht – so auch den Kahans. Jacobs Vater Baruch, sein Bruder Nachum und Großvater Chaim kehrten zusammen mit den Verwandten aus Baku und Ekaterinoslav via Schweden und Finnland ins Russische Reich zurück. Doch seine Mutter Rosalia und sein jüngster Bruder Arusja blieben in Deutschland zusammen mit Rosenbergs und Bendet Kahan mit Frau und Kindern. Diese beiden Familien waren vor kurzem nach Deutschland gezogen und hatten es leichter, nach Hause zu kommen. Sie reisten aus den Sommerfrischen nach Berlin.
Als wehrdiensttauglicher junger Mann und Staatsbürger des Kriegsgegners Russland bekam Jacob offenbar die größten Probleme. Er wurde nicht nur von der Universität verwiesen, sondern kurz vor den Hohen Feiertagen auch verhaftet. Wie er von Wiesbaden ins Stadtvogteigefängnis Berlin-Mitte in der Dirksen-Straße gelangte, bleibt ungewiss. Jedenfalls war er dort inhaftiert. Aus dieser Zeit sind in den Hinterlassenschaften Postkarten, Briefe und Zettel erhalten. Sobald es möglich war, nahm Jacob vom Gefängnis aus Kontakt mit der Familie auf und die Familie mit ihm, nach den geltenden preußischen Bestimmungen: in offenen Briefen, in der Amtssprache Deutsch und ohne ein kritisches Wort über die Haftbedingungen.
Von einem Tag auf den anderen zog sich Deutschland für den Neunzehnjährigen zu einer preußischen Gefängniszelle zusammen, die er sich mit drei jungen Juden aus Polen teilte. Auch viele mittellose Juden aus dem Russischen Reich, die keine Möglichkeit sahen, nach Hause zu fahren, wurden dort festgehalten. Darüber hinaus bestand die Gefahr, ins Internierungslager für zivile Gefangene und Geiseln aus den Gegnerländern in Holzminden verlegt zu werden, wo während der Kriegsjahre unter unmenschlichen Bedingungen mehrere Tausend Menschen aus Frankreich und dem Russischen Reich gefangen gehalten wurden.
Die Tatsache, dass Rosch ha-Schana, das Neujahrsfest, unmittelbar bevorstand, verschärfte die missliche Lage für Jacob, der ein traditionsbewusster und religiöser Jude war. Die jüdische Gemeinde linderte die Not. Vertreten durch einen gewissen Rabbiner Dr. Levy, sorgte sie über die Festtage für das spirituelle und leibliche Wohl der Gefangenen. Außerdem übermittelte der Rabbiner, der in Charlottenburg in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Kahan-Rosenbergs wohnte, persönlich Nachrichten an die Familie. Hilfe versprach sich Jacob auch von Dr. Ludwig A. Rosenthal, der damals als orthodoxer Rabbiner und Gelehrter in Berlin ein hohes Ansehen genoss. Rosenthal, aus dem deutsch regierten Putzig, polnisch Puck, bei Danzig gebürtig, war ein Alters-, Glaubens- und Gesinnungsgenosse und in gewisser Weise auch ein Landsmann seines Großvaters. Der Großvater Chaim Kahan hatte gute Verbindungen zur Orthodoxie in Deutschland, die wiederum enge Kontakte zu den Juden in Osteuropa unterhielt. Durch Vermittlung des Großvaters hatte Jacob vor dem Krieg bei den Rosenthals in Berlin, Chausseestraße 108, Unterkunft gefunden und sich mit der Familie angefreundet.
»Ich fühle mich heute so einsam und verlassen. Ich habe eine grosse Sehnsucht nach Ihnen. Wann werden wir uns wiedersehen? (…) Warum haben Sie mir heute nichts zum Essen geschickt? Sie sollen jeden Tag schicken und je mehr. Auch Wäsche und Geld möchte ich haben. Segne Sie alle Gott, meine Lieben! Möge er Ihnen alles Glück schicken und vor solchen schweren Zeiten bewahren. Ihr Jacob Kahan« – Angesichts der bevorstehenden Hohen Feiertage, Rosch ha-Schana und Jom Kippur, an denen man sich vom allgemeinen Getriebe noch stärker als sonst absonderte, sich zu Gottesdiensten in die Synagoge und danach in die Familie zurückzog und dort gemeinsam betend und singend bei rituellen Mahlzeiten verbrachte, war der Druck auf den Häftling Jacob und sein Elend in der Gefängniszelle so groß, dass er ein Zugeständnis an die deutschen Behörden und einen konkreten Vorschlag für seine Befreiung machte. Er versprach, während des Krieges in Berlin zu bleiben und weder nach München noch zu den Eltern nach Charkow zurückzukehren, und schlug vor, die Autorität und den Einfluss Rabbiner Ludwig A. Rosenthals dafür zu nutzen. Dennoch gelang es der Familie nicht, Jacob zu Rosch ha-Schana zu befreien. Abgesehen von einer kurzen Notiz auf der Rückseite eines Gefängnisformulars, die Jacob nach einem vergeblichen Befreiungsversuch vom Onkel Bendet erhielt, war eine Karte von der Cousine Rosa die erste schriftliche Nachricht vonseiten der Familie. »Wir wenden alles an, um dich zu befreien und hoffentlich kommst du recht bald wieder zurück«, schrieb sie. »Deine letzte Karte machte mich ganz kaputt: du bist zu sehr aufgeregt … Musst aber, Jacobchen, dich bemühen nicht so zu sein!« Cousin und Cousine, Jacob und Rahel, genannt Jascha und Rosa oder auch Roska, standen sich besonders nah. Schon drei Jahre zuvor, als er sechzehn und sie dreizehn Jahre alt war, heißt es in der Familie, hätten sie sich am Beschneidungsfest für den Vetter Moshe Ettinger in Warschau die Ehe versprochen.
Nach Rosch ha-Schana meldete sich Jacob erneut mit einem langen Brief aus der Zelle Nr. 584 des Stadtvogteigefängnisses: »Meine Lieben! Die Feiertage sind zu Ende! Wir haben alles getan, um sie würdig abzuhalten.« Er berichtete davon, wie fünfzehn Männer die Neujahrsfesttage unter Anleitung eines Kantors mit Gebeten, Schofarblasen, Essen und Schlafen in einer Gefängniszelle zusammen verbrachten. Die Gemeinde hatte nicht nur einen Kantor, sondern an beiden Feiertagen jeweils zweimal koschere Fleischmahlzeiten geschickt. Dem Brief nach war Jacob immer noch aufgebracht und, was die Befreiung anbetraf, kaum zuversichtlicher, zugleich aber schien er sich in der Haft einzurichten. Erstmals erfuhr die Familie Genaueres über die Gefängnisordnung – Besuche mussten beim Kommandanten beantragt, Besuchszeiten eingehalten werden – und über die Mithäftlinge: Ein promovierter Herr war dabei, der offenbar auf der Durchreise aufgehalten und von seinem Koffer getrennt worden war, aber auch jemand, dem es am Elementarsten fehlte.
Zugleich werden die Verbindungen sichtbar, auf die Jacob und die Familie Hoffnungen setzten. »Einige Rabbiner haben uns besucht«, schrieb er, »gestern war hier Dr. Rabbi Munk. Er war erstaunt, mich hier zu sehen, weil er dachte, dass ich schon frei bin. Er sagte, dass Dr. Nathan und Hermann Struck sprechen für mich beim Kommandanten, und dass ich frei kommen werde, weil mein Grossvater für Tachkemoni-Schule gestiftet hat, die ja unter deutschem Schutze steht. Ist es alles wahr? Und wann wird endlich die Freiheit kommen?« Rabbiner Esra Esriel Munk, geboren 1867 in Altona und 1940 in Jerusalem gestorben, einer der herausragenden Kämpfer für das orthodoxe Judentum in Deutschland mit Einfluss auf die Landesregierung und Staats- wie Stadtverwaltung in Berlin, hatte die Häftlinge besucht. Seit 1900 fungierte er als Rabbiner und Vorsitzender des Rabbinatsgerichts der orthodoxen Gemeinde Adass Jisroel, als Sachverständiger für jüdische Angelegenheiten im preußischen Kultusministerium und führendes Mitglied in zahlreichen jüdisch-orthodoxen Vereinigungen. Die Familie Kahan-Rosenberg war in Berlin eng mit der Adass Jisroel verbunden und Rabbiner Munk deshalb bekannt. Jacob sollte auf Fürsprache von Dr. Paul Nathan und Hermann Struck freikommen. Paul Nathan kannte man als Gründer und engagierten Leiter des Hilfsvereins der deutschen Juden. Von 1900 bis 1919 vertrat er obendrein als Stadtverordneter in Berlin die Fortschrittliche Volkspartei. In jenen Tagen, zu Kriegsbeginn, gründete er nicht nur das Interkonfessionelle Hilfskomitee für die Juden in den besetzten Ostgebieten, sondern auch ein Komitee, um mittellose russländische Juden in ihre Heimat zurückzuführen. In siebzehn Sonderzügen wurden etwa sechzehntausend Personen transportiert. Der Künstler und Graphiker Hermann Struck, der in Deutschland vor allem durch seine Porträts osteuropäischer Juden und Kriegsgefangener bekannt wurde, gehörte zum Kreis der aktiven religiösen Zionisten im Misrachi und war der Familie Kahan zeitlebens verbunden. Wenige Monate vor Kriegsbeginn hatten Hermann Struck, Chaim Kahan, Jonas Rosenberg und der ebenfalls im Misrachi aktive und an der Preußischen Staatsbibliothek beschäftigte Bibliothekar Hermann Pick in der Charlottenburger Wohnung zusammengesessen, hatten Pläne geschmiedet und die Umwandlung der Tachkemoni-Schule in ein Gymnasium beschlossen, das Ganze auf der Basis einer großzügigen Spende von Chaim Kahan in der Höhe von 55.000 Goldfranken (44.550 Goldmark, wobei eine Goldmark etwa die fünffache Kaufkraft eines Euro von heute hatte), eine stattliche Summe. Die Tachkemoni-Schule in Jaffa stand seit Jahren unter der Oberaufsicht des westlichen Misrachi-Zentrums in Frankfurt am Main und galt als Modell für das religiös-zionistische Bildungssystem in Palästina. Zum Dank hatte Struck Chaim Kahan in Öl porträtiert – das Bild gehört zu den markantesten Hinterlassenschaften der Familie –, und zwar in doppelter Ausführung, eins für den Spender ohne und eine Kopie für die Tachkemoni-Schule mit Kipa. Kurz danach war Jacob mit den Großeltern in einer Gruppe zionistischer Politiker nach Palästina gereist. Der Großvater wollte sich einen Eindruck von der Schule verschaffen.
Für Jacob war es schon die zweite Reise nach Palästina gewesen. Zum ersten Mal hatte er das Land bereits im Sommer 1911 kennengelernt, sich dort mit den Eltern getroffen. Vielleicht hatten sie ihn, kurz nachdem er seinen ersten Berlinaufenthalt abgebrochen hatte, auf die Reise geschickt, damit er lerne, mit der Fremde und dem Heimweh umzugehen. Dieses Mal aber war Jacob in offizieller Mission, in »zionistischer Kommission«, wie Kurt Blumenfeld es später nannte, unterwegs gewesen. Er sollte Großvater und Großmutter begleiten. Die Eltern waren bereits vorausgefahren. Die Kommission wurde von Nachum Sokolow, Generalsekretär und Mitglied des Exekutivkomitees der Zionistischen Organisation, persönlich geleitet. Auch Kurt Blumenfeld, damals Generalsekretär des Zionistischen Weltverbandes, hatte zur Reisegruppe gehört. Die erste Station war, wie damals üblich, Ägypten gewesen. In Ägypten hatten sie sich die Pyramiden angesehen, in Kairo das Museum besucht, ehe sie mit dem Zug nach Port Said und von dort mit einem Schiff des Österreichischen Lloyd nach Jaffa fuhren. Von der Reise ist ein Fotoalbum erhalten, mit kleinen, schon etwas verblichenen Bildchen in dunkelgraue, schwarz geränderte Passepartouts geschoben. Sie geben uns eine Vorstellung davon, wie Jacob sich, auf seine Entlassung wartend, Angst und Langeweile vertrieben haben mag. Auf den Fotos sind die touristischen Highlights zu sehen – Pyramiden, Kamele, eine verschleierte Frau, Palmenhaine, die Küste des Toten Meeres vor Wüstenbergen, die Mittelmeerküste vor Jaffa mit Fischerbooten, die Altstadt, der Tempelberg von Jerusalem, Tel Aviv im Aufbau, Beduinenzelte, die Eisenbahnlinie von Jaffa nach Jerusalem, aber auch einige persönliche Aufnahmen – die Mutter auf einem Kamel, der Großvater in einer Pferdedroschke, die Eltern auf der Galerie eines Hauses, ein Selbstporträt. Dazu repräsentative Bilder: Großvater inmitten der zionistischen Kommission, zu Besuch in der Tachkemoni-Schule unter zahlreichen, ehrwürdig dreinblickenden Menschen, zumeist Männern. Einmal ist auch Jacob, in der hinteren Reihe, mit auf dem Bild. Jacob hatte offenbar an allen wichtigen Treffen seines Großvaters teilgenommen. Besonders spannend seien für ihn, schrieb er an die Mutter, die Besuche beim Chacham Baschi Chaim Nachum Effendi, dem Oberrabbiner des Osmanischen Reiches, auf der Rückreise in Konstantinopel gewesen. Der Großvater war ja nicht nur ein Förderer der Tachkemoni-Schule, sondern auch am Erwerb von Grund und Boden in Palästina beteiligt. Die einwöchige Rückreise hatte Jacob ebenfalls allein mit den Großeltern zurückgelegt, über Port Said, Alexandria, Saloniki, Konstantinopel, Sofia und Wien. Chaim und Malka Kahan waren von dort nach Berlin weitergereist, er aber war nach München gefahren, während die Eltern zwei weitere Wochen, bis in die zweite Maihälfte hinein, in Palästina blieben und zusammen mit Bruder Arusja nachkamen. Im April 1914 hatte Hermann Struck Chaim Kahan eine Ansichtskarte mit einer eigenen Radierung hinterhergeschickt: »Verehrter Herr Kahan, ich freue mich sehr von Ihrer Familie hier zu erfahren, dass Sie gut gereist sind. Hoffentlich sind Sie bei bester Gesundheit und können unser grosses Werk dort in Angriff nehmen. Mit besten Wünschen und herzlichen Grüssen Ihr ergebener Hermann Struck.« Jetzt, zu Beginn des Krieges, war Struck, während Jacob in Haft saß, Mitglied im Hilfskomitee für jüdische Vertriebene der Zionistischen Vereinigung für Deutschland.
Cousine Rosa reagierte unverzüglich mit einer Postkarte auf Jacobs ausführlichen Brief: »Ich glaube, du bist jetzt ruhiger, und ich freue mich sehr darüber. Bei uns gibt’s nichts Neues«, schrieb sie, nochmals ihre Liebe zu Jacob beschwörend und die engen familiären Beziehungen und Freundschaften ins Feld führend, die sie beide mit Berlin verbanden: zu den Brüdern und Cousins, den gemeinsamen Freundinnen Trude und Rosa, den Töchtern von Rabbiner Rosenthal, die für die guten Verbindungen der Kahan-Rosenbergs in die deutsch-jüdische Gesellschaft bürgten. Erstmals trat auch Rosas Bruder Noma durch einen kurzen, in gotischer Schrift verfassten Zusatz und Gruß in Erscheinung. Berlin war für Jacob bisher vor allem mit den Erinnerungen an Rosa Rosenthal verbunden gewesen. Sie hatte ihm während seines ersten Aufenthalts in der Stadt die Familie ersetzt, die er so schmerzlich vermisst hatte. Beinahe vier Jahre war es her, er war fünfzehn Jahre alt, als seine Eltern ihn aus Charkow fort, nach Berlin geschickt hatten, damit er, wie einst der Vater in Frankfurt am Main, seine in Antwerpen begonnene deutsche Schulbildung fortsetze. In Berlin hatte er im Haus von Rabbiner Rosenthal gewohnt und sich auf die Aufnahmeprüfung am Dorotheenstädtischen Realgymnasium vorbereitet. Er hatte die Prüfung wohl auch bestanden, aber kaum ins Gymnasium eingetreten, war er nach Charkow zurückgefahren. Anders als in der Antwerpener Fremde, wo er im Kreis der Familie gelebt hatte, war er in Berlin allein. Ein Foto aus dem Jahr 1910, das vermutlich in der Berliner Schule entstanden ist, zeigt einen leicht verstört blickenden, hoch aufgeschossenen Halbwüchsigen in zweireihig geknöpfter Tuchjacke. Stehkragen und Binder sitzen ihm eng am Hals.
Jacob erinnerte sich an Rosa Rosenthals strahlende Augen, an ihre Güte und Zärtlichkeit. Erst vor kurzem hatte sie ihm in einem Brief ihre Zuneigung gestanden, ihn »liebes Jakob-Brüderlein« genannt und vom »großen schwarzen Jascha mit den schwarzen Träumeraugen« geschwärmt. Rosa war mittlerweile mit dem Kaufmann Josel Langer verheiratet und lebte in einer eigenen Wohnung in Schöneberg. Erst nach ihrer Ermutigung hatte Jacob seine Schüchternheit überwunden und sich in einem mühsam auf Deutsch formulierten, sorgfältig vorgeschriebenen und deshalb vermutlich erhalten gebliebenen Antwortbrief zu ihr bekannt. Seine Seele fühle sich von ihr angezogen, schrieb er, wie eine Blume von der Sonne. Daraufhin hatte sie ihn auf ein Wiedersehen in Palästina, im Land ihrer Sehnsucht, vertröstet, wo sie Jascha als Minister und sich selbst einst als Besucherin sah. Rosa Rosenthal war offenbar Jacobs mütterlich-erotische Liebe. Die Verbindung blieb, auch nachdem er sich seiner Cousine Rosa Rosenberg versprochen hatte, bestehen.
Endlich meldete sich die Mutter mit einem Brief, den sie – vielleicht ganz bewusst – auf einem Mitteilungsbogen und unter dem geschäftlichen Briefkopf von Max Lew, »Generalvertreter der Russisch-Baltischen Mineralölwerke A.-G. (vormals Ch. N. Kahan) St. Petersburg« in Berlin-Charlottenburg verfasst hatte und der Jacobs Status als Mitglied einer russländischen Unternehmerfamilie mit ausgewiesenen Geschäftskontakten in Deutschland sichtbar machte. Max Lew fungierte als Hauptagent für das Familienunternehmen in Berlin und war einer der wichtigsten Akteure im Geschäftsverbund. Die Mutter schrieb: »Mein Theuerer Sohn! Deine Postkarten habe ich gelesen. Es war so unerwartet! Ich weiss ja so gut deine Unschuldigkeit. Ich versichere dich, dass hat man erwartet deine Befreiung, und deswegen hab ich dir weder Wäsche und Essen zugeschickt.« An einigen Stellen des Briefes sind die Schriftzüge der Mutter von Tränen verwischt.
Jacob schickte sieben Karten und Briefe als Hilferufe aus dem Gefängnis an seine Familie, alle mit Bleistift geschrieben (die Tinte war ihm schon in der Mitte der ersten Karte ausgegangen), sodass die Schrift verblich. Mutter, Cousine und Onkel sandten ihm genauso viele Postkarten, Briefe und Zettel zurück. Die Korrespondenz wurde in zwei Bündeln an verschiedenen Stellen aufbewahrt. Welche Freude, als ich sie zusammenfügen konnte. Alle Karten und Briefe sind, da sie von preußischen Beamten zensiert wurden, auf Deutsch, also in einer für die Kahans fremden Sprache, verfasst. Jacobs Briefe schildern aber nicht nur Angst und Pein, sondern berichten auch von Erleichterungen in Form von Essenslieferungen und anderen Annehmlichkeiten. »Meine liebe teure Mutter! Erst eben habe ich Dein Schreiben erhalten und auch den Koffer mit den Wäschen und Esswaren, die du mir geschickt hast. – Einen unsäglichen Dank dir dafür! Ich war heute so betrübt, weil ich keine Nachrichten von Ihnen gehabt habe. Jetzt bin ich getröstet und [werde] mit Geduld die Befreiung erwarten, die wohl, wie ich hoffe, die[se] Woche erfolgen wird. Meine Stimmung und die meiner Kameraden in der Zelle ist sehr gehoben, dank der fröhlichen Botschaft.«
Noch als Gefangener war Jacob anscheinend privilegiert. Er setzte alles daran, ein guter Jude, ein Fürsprecher für seine Mitgefangenen, zu sein. Zugleich sprachen die Sehnsucht nach aus Friedenszeiten Vertrautem aus seinen Worten und der Wunsch, wenigstens von Ferne an den Familienereignissen teilzuhaben, was die Liebesgaben von Cousine und Mutter, die sie ihren Briefe beilegten, zumindest symbolisch ermöglichten: eine weitere Postkarte und ein Briefchen im hellblauen Miniaturumschlag von Rosa und wieder auf Max Lews Briefpapier die Zeilen der Mutter. Als sich der nächste Hohe Feiertag, Jom Kippur, das Sühnefest, näherte, wuchsen die Ungeduld und die Unruhe darüber, ob und wann Jacob freikommen würde, erneut. »Lieber Jacob! Viele Grüsse und Küsse! Schicke dir Essen, Schachspiel und die Wäsche, die du gebeten hast. Lass es dir gut schmecken. Guten Appetit! Schreibe paar Worte und schicke sie mit, falls es geht. Rosa« – »Mein Theuerer geliebter Sohn, Jascha! Ich bringe dir mit Butter eine Flasche Milch und etwas Früchte, auch die Tfilin. Wie geht es dir mit deinem Schnupfen? Da hastu eine warme Jacke. Es wird für dich sehr gesorgt und wir hoffen alle dich schon im Erev Jom Kippur zu umarmen. Gebe Gott! – Den Machsor den ich dir geschickt habe, bitte mir zurückzugeben. Denn du wirst ihn nicht brauchen. Ich warte auf ihn.« Für alle Fälle brachte die Mutter die obligatorischen Wünsche zum Fest – chatima tova, einen guten Abschluss im Buch des Lebens, das heißt Entlastung von jeglicher Schuld gegenüber Anderen, und ein leichtes Fasten, ta’anit – schon einmal schriftlich auf den Weg.
Nachdem Jacob als Externer das Gymnasium in Charkow abgeschlossen hatte, war er im September 1913 wieder nach Berlin gekommen, um dort zu studieren, etwa zur selben Zeit wie Onkel Bendet Kahan, der im Auftrag des Großvaters eine Zehnzimmerwohnung in Berlin-Charlottenburg, Schlüterstraße 36, mietete. Aber Jacob hatte es damals vorgezogen, wieder bei Rosenthals in der Chausseestraße zu wohnen. Als seine Bewerbung an der Friedrich-Wilhelms-Universität abgelehnt wurde, riet der Vater aus der Meraner Sommerfrische ihm zum Studium in England, Frankreich oder Italien, doch Jacob entschied sich für München. Es war für ihn nicht eben leicht, mit den Erwartungen der Eltern und Großeltern an ihn als dem ältesten Sohn und Enkel umzugehen. Dazu kamen die politisch schwierige Lage und die Restriktionen gegen ihn als russländischen Staatsbürger und Juden.
Ungeachtet dessen genoss Jacob, so lange und so gut es ging, den Schutz und die Privilegien der Familie. Auch im Gefängnis pflegte er einen großbürgerlichen Lebensstil. Er sorgte für sein leibliches, seelisches und geistiges Wohl und nahm sich darüber hinaus seiner Mitgefangenen an. Daraus schöpfte er Energie und Selbstbewusstsein. Zugleich behielt er einen Überblick über die Lage. Er besorgte sich Geld von der Familie, um Lebensmittel und Dienstleistungen für sich und seine Leidensgenossen zu kaufen. Mittagessen erhielten Jacob und auch ein anderer Häftling aus einem Lokal in der nahe gelegenen Burgstraße, einer idyllisch an der Spree gelegenen Geschäftsstraße in Altberlin, dem Schloss gegenüber, wo sich die Börse und einige bekannte Lokalitäten wie Cassels Hotel, König von Portugal, das Börsen-Hotel befanden. Dort lebten viele Kaufleute, Agenten und Kursmakler, noch mehr gingen aus und ein. Im Jahr 1914 gab es das unter Aufsicht der Adass Jisroel koscher geführte Cassels Hotel & Restaurant unter Leitung von Leopold Pelteson schon lange nicht mehr, in dem der Student Sammy Gronemann und seine Kommilitonen vom Rabbinerseminar einst zu speisen pflegten. Das Hotel König von Portugal hatte es übernommen. Doch auch der König von Portugal wurde unter der Leitung des Weinhändlers Richter mit »streng ritueller Küche« und hauseigener Synagoge im Sinne der jüdischen Traditionen und Vorschriften geführt. Außerdem gab es in der Burgstraße Nr. 20 noch das Burg-Hotel, Inhaber S. Lewin. Jacob bezog sein Mittagessen aus einem der beiden Häuser.
»27. IX. 1914 Stadtvogtei-Gefängnis. Meine liebe Mutter! Obgleich ich vor einer halben Stunde mein[en] Brief von gestern abend dem Aufseher abgegeben habe, nicht destoweniger schreibe ich wieder, weil mir was eingefallen ist. Die Weste, die ich bestellt habe, soll von meinem schwarzen Anzug sein, den ich in Charkow machte. Er liegt in dem grossen Koffer. Einen Spiegel brauche ich nicht, weil ein solcher in meinem Seifenkästchen sich befindet. Ausser dem ich möchte eine kleine Spiritus-Maschine mit einer kleinen leichten Casserolle haben. Dazu einen doppel Löffel für Tee. Ich trinke nur heissen Caffee morgens und ich möchte mich manchmal erwärmen. Wenn ich sogar frei werde, wird das für meine Cameraden von grossem Nutzen sein. Ich möchte auch Bücher zum Lesen haben, was Ernstes, Nietzsche oder Wedekind’s FrühlingsErwachen! Sie haben eine Menge russischer Universal-Bibliothek-Bücher. Ich könnte es meinen Kameraden geben. Es wird dir wohl komisch erscheinen, dass ich mich versorge, als wäre in meiner Absicht, noch einen Monat hier zu sitzen. Aber wer kann wissen? Vor einer Woche war hier mein Onkel, um mich abzuholen und schrieb, dass nächsten Tag bin ich frei und ich bin noch immer hier. Falls ich bis Jom-Kipur nicht frei werde, sollst du mich am Dienstag 10-11 unbedingt besuchen. Die gewünschten Sachen kannst du mir teils morgen teils dann bringen. Es wäre gut, hättest du mir Esswaren und Obst geschickt. Ich grüsse alle herzlich und bin dein Jascha.«
Abgesehen von Spirituskocher mit Kochtopf und Teesieb, Schachbrett, frischer Wäsche und warmer Kleidung wünschte sich Jacob, dass man ihm Bücher ins Gefängnis schicke. Er hatte ein besonderes Interesse an Literatur. Deshalb studierte er Philologie. Seine Bücherwünsche verrieten, dass er den Geschmack seiner Generation in Deutschland teilte, dass ihm zugleich aber die klassische russische Literatur zur Verfügung stand. Jiddisch war seine Muttersprache und Hebräisch ein Muss für einen zionistischen Litwaken. Jacob war zwar in Warschau geboren, aber seine Familie kam aus dem nordwestlichen Grenzland des Russischen Reiches, polnisch kresy genannt, einem Raum, in dem die Petersburger Regierung sich nur schwer behaupten konnte. Die wechselvolle Geschichte des russländisch-belorussisch-polnisch-litauischen Grenzlands zeugt davon. Dort wurden die Staatsgrenzen stets willkürlich gezogen. Sie durchschneiden in den kresy Kulturlandschaften mit ethnokonfessionellen Gemengelagen, in denen die jüdische Diaspora über sechshundert Jahre, seit dem 14. Jahrhundert und bis zu ihrer Zerstörung und der Ermordung der Juden im Holocaust, bedeutsam und vielfältig war. Die nach rabbinischer Tradition lebenden Juden in Litauen wurden Litwaken genannt. Kahans waren Litwaken.
Die Fähigkeit, mehrere Sprachen zu sprechen und in verschiedenen Kulturkreisen zu leben, war Jacobs Vermögen, das mindestens so viel wert war wie der finanzielle Reichtum seiner Familie. Halt gab ihm dabei sein religiöser Lebenswandel. Aber wie vereinbarte er Nietzsche- und Wedekind-Lektüren, deren Revolten, Gesellschaftskritik, Individualismus und Skeptizismus, mit einem Leben nach der jüdischen Religion und Tradition? – »29. IX. 1914 (Erev Jom Kippur) Meine Lieben! Heute war ich und paar Cameraden vor dem Leutnant vorgelassen, welcher uns sagte, dass wir gleich frei gelassen werden. Er bedauerte sehr, dass er uns nicht gleich den Entlassungsschein geben kann, versprach jedoch alles anzuwenden, sogar telegraphieren, damit wir heute vor Anbruch der Dunkelheit freikommen. Ich warte mit Ungeduld, es ist aber noch eine Stunden zu Feiertag und die Depesche kam noch nicht. Wenn sie heute nachts kommt oder morgen früh, werde ich um Erlaubnis bitten, hier den Feiertag zu verbleiben. Onkel Bendet soll auf mich unten warten. Ich habe ihm ein Zettelchen geschickt. Auf jeden Fall ich wünsche Ihnen zu [Jom Kippur] jegliches Glück und [chatima tova] mit Gruss an alle Ihr Jascha«
Jacob stellte die religiöse Pflicht sogar über den Wunsch nach Freiheit. Schon vor Rosch ha-Schana hatte er die Verpflichtung, vor den Feiertagen ein rituelles Bad zu nehmen – die Mutter deutete es in einem ihrer Briefe an –, nicht erfüllen können. Sollte nun die Freilassung nach Einbruch der Dunkelheit erfolgen, also nach Beginn von Jom Kippur, würde er freiwillig im Gefängnis bleiben, um die Vorschrift einzuhalten, am jom tov, dem Feiertag, zu ruhen. Wie bedeutsam das für einen nach den traditionellen religiösen Vorschriften lebenden Juden war, bezeugen Nachum Goldmanns Erinnerungen an die internierten Russländer in Bad Nauheim zu Kriegsbeginn. Als man ihnen das rituelle Bad vor den Hohen Feiertagen in der einzigen erreichbaren Mikwe im nahegelegenen Friedberg verweigerte, mit dem Argument, es gebe in Bad Nauheim doch genügend Bäder, setzte sich Nachum Goldmann beim Stadtkommandanten von Frankfurt erfolgreich für sie ein. Mit den eilig und in fahriger Schrift, unmittelbar am Vorabend des Hohen Feiertags, vor Beginn des erev Jom Kippur, hingeworfenen Zeilen endete Jacobs Korrespondenz mit der Familie im September 1914 aus dem Stadtvogteigefängnis in der Dirksenstraße.
KAPITEL 2
Chaim Kahan. Von Orlja nach Brest-Litowsk
»Chaim Kahn war ein ungewöhnlicher Mensch, ein seltener Typus. Ein rastloser Geist mit unerschöpflicher Energie. Er hatte den Kopf immer voller Pläne und Ideen. Er war ein begabter Mensch mit einer wilden Fantasie und erstaunlichen Charakterzügen.«
Jacobs Großvater Chaim-Mosche ben Nachman, genannt Chaim Kahan, war der Sohn des Melamed Mosche Nachman haCohen im Stetl Orlja. Er wurde um 1850 geboren, hatte drei ältere Brüder und wuchs als Halbwaise auf. Die Mutter starb nach seiner Geburt. Es war die Zeit der panischen Angst vor der Willkürherrschaft des Zaren Nikolaus I. Der Vater gab den vier Söhnen vorsichtshalber zwei verschiedene Nachnamen, um sie vor dem Militärdienst zu schützen, der damals besonders grausam war. Die beiden älteren nannte er Ahron und Aba Kameneckij und die beiden jüngeren Schaul-Falk und Chaim Cohen. Je weniger Söhne mit demselben Familiennamen man meldete, desto sicherer waren sie vor der Rekrutierung. Als zweite Vorsichtsmaßnahme diente die Frühehe. Deshalb, und weil die Familie arm war, wurde Chaim bereits mit dreizehn Jahren, kaum dass er Bar Mizwa war, verheiratet.
Obgleich es heißt, er stamme aus einer Familie von Gelehrten, und obwohl sein Enkel Arusja ehrerbietig und wie üblich die Genealogie der Kahans bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgte, zählte Chaims Vater zu den einfachen Leuten. Er war weder Gelehrter, noch Land- oder Steuerpächter, Unternehmer oder Großkaufmann, gehörte auch nicht zu den Beamten oder Angestellten der Gemeinde, sondern war einer von den vielen Lehrern, die Kindern unter sechs Tora und Gebete beibrachten und, um genug zu verdienen, meist nebenher noch ein Gewerbe betrieben. In den Hinterlassenschaften gibt es nur spärliche Hinweise auf Chaims Kindheit. Das Stetl, in dem er groß wurde, lag in der Provinz Grodno, bei Bjelsk, heute polnisch Orla bei Bielsk podlaski an der Grenze zu Belarus. Demnach war die historische Landschaft Podlachien im Osten Polens zwischen westlichem Bug und Memel, Łomża und Brest mit Bielsk als Zentrum Chaim Kahans Heimat. Orlja liegt an der Orljanka. »Meine Geburtsstadt […] lag und liegt vielleicht immer noch an den Ufern eines kleinen Flusses in einem großen Sumpfgebiet, das weite Teile der Provinz […] und der umliegenden Provinzen in Weißrussland einnahm; ein flaches, offenes Land, schwermütig und monoton, doch mit seinen Flüssen, Wäldern und Seen nicht gänzlich ohne Charme. Zwischen den Flüssen war der Boden sandig, mit Kiefern und Ginster bestanden, in Ufernähe war die Erde schwarz und die Bäume trugen Blätter. Im Frühling und im Herbst war die Gegend ein Meer aus Schlamm; im Winter eine Welt von Schnee und Eis; im Sommer war sie von einem Dunstschleier überzogen. Rundum in hunderten von Stetln und Dörfern lebten Juden, wie sie schon seit vielen Generationen gelebt hatten, verstreute Inseln in einem nichtjüdischen Ozean.« So ähnlich wie Chaim Weizmann sein Geburtsstetl Motol’ im Gouvernement Grodno schilderte, hätte auch Chaim Kahan Orlja beschreiben können.
Orlja/Orla, etwa eine Autostunde südlich von Białystok, ist heute ein Dorf mit zwei Namen auf den Ortsschildern, einem polnischen in lateinischer und einem belorussischen in kyrillischer Schrift, wie andere im Grenzgebiet auch. Der Ort besteht aus drei, vier asphaltierten Straßen in der Breite, mit Kieswegen als Zwischen- und Querverbindungen. Heute stehen da kleine, eingeschossige braune und bunte Holzhäuser mit Veranden und Bänken davor, umgeben von Gemüse- und Blumengärten. Hat irgendetwas die Zeiten überlebt, sodass sich Erinnerungen daran heften lassen? Es gibt zwei orthodoxe Kirchen, St. Michael seit 1797 und Kyrill und Method seit 1870 – und eine Synagoge, die wie ein Fremdkörper alle anderen Gebäude überragt.
Die Große Synagoge von Orlja steht zwar mitten im Ort, aber dennoch einsam am Rand einer kahlen Rasenfläche, hinter einem großen, leeren Asphaltplatz, als sei das Gelände geräumt, abgetragen worden, als warte man vergeblich auf Besucher. Stolz schwingt sich der helle Renaissancegiebel in den Himmel. Das hohe Haus wird rechts und links von niedrigen Seitengebäuden flankiert. Große Bogenfenster, die vom Boden der einstigen Galerie bis unters Dach reichen, lassen das Sonnenlicht hinein. Die steinernen Außenwände sind verputzt, hier und da liegt das Mauerwerk frei, weil Feuchtigkeit an ihm nagt. Die Fenster in den Anbauten sind mit Brettern vernagelt. Doch der mächtige Portikus steht für Beständigkeit und Größe und lädt die Besucher zum Betreten des Hauses ein. Chaim hat dessen Schwelle sicherlich regelmäßig überschritten.
Anders als Motol’ hat Orlja eine bemerkenswerte Geschichte, die auf einer Informationstafel am Straßenrand kurz erzählt wird. Seit Beginn des 16. Jahrhunderts ist sie durch Quellen verbürgt. Im Jahr 1500 schenkte der polnische König Aleksander Jagiellonczyk das Land dem Schreiber des Statthalters im litauischen Trakai, damit dieser eine Stadt darauf errichte. Das Privileg wurde von König Zygmunt dem Alten 1507 bestätigt. Dieses Datum gilt als Gründungsjahr der Stadt. Einer der tatsächlichen Gründungsväter von Stadt und Orljansker Gutsherrschaft war jedoch ein litauischer Schatzmeister, dem es gelang, das Land zwischen 1512 und 1522 unter seine Herrschaft zu bringen. Mitte des 16. Jahrhunderts gehörten neun Dörfer zur Orljansker Gutsherrschaft. Durch Heirat ging das Gut an eine polnische Adelsfamilie aus Sluck und wurde wahrscheinlich im Jahre 1585 Teil des Eigentums der Familie Radziwiłł.
Das Goldene Zeitalter in der Geschichte des Ortes begann mit der Herrschaft von Christopher Radziwiłł (1585-1640), der sich für den podlachischen Besitz einsetzte, denn Orlja verfügte dank der Orljanka über fruchtbaren Boden und lag im strategisch bedeutsamen Grenzgebiet zwischen Litauen und Polen. Im Jahre 1634, unter der Herrschaft von Janusz Radziwiłł, der ein bekennender Calvinist war, erhielt Orlja Stadtrecht, Stadtwappen und etwa um diese Zeit auch eine calvinistische Kirche und eine Synagoge. Das Schicksal des Stetls stand und fiel mit den polnisch-litauischen Adligen, die Grundbesitzer, Herren über die leibeigenen belorussischen und ukrainischen Bauern und für die jüdischen Anwohner Patrone, Repräsentanten der Staatsmacht, Arbeitgeber und Kunden waren. Die Jüdische Gemeinde spielte eine wichtige Rolle in Orlja. Auch nachdem die Befreiungskriege der Kosaken von der polnisch-litauischen Adelsherrschaft (1655-1660) die Entwicklung der Stadt insgesamt zurückgeworfen hatten, blieb sie ein jüdisches Zentrum, das vor allem im 19. Jahrhundert, in dessen Mitte Chaim Kahan geboren wurde, eine Blütezeit erlebte. Für das Jahr 1765 hatten die Kahals-Protokolle bereits 1.358 Kopfsteuerzahler angegeben. In Chaim Kahans Kindheit zählte die Jüdische Gemeinde von Orlja mehr als dreimal so viele, 4.436 Seelen. Ende des Jahrhunderts machten sie nach der offiziellen Volkszählung zwar immer noch zwei Drittel der Gesamtbevölkerung aus, waren aber nur noch halb so viele wie fünfzig Jahre zuvor, 2.310 von insgesamt 3.003 Einwohnern. Die Landflucht hatte begonnen.
Die Große Synagoge war über mehr als drei Jahrhunderte mit Leben erfüllt. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg brannte der Dachstuhl ab. Während des Krieges wurde die Ruine von den Nationalsozialisten als Lager missbraucht, aber nicht weiter zerstört, sodass die Synagoge in den 1980ern restauriert werden konnte. Seit 2008 beherbergt sie eine kleine Ausstellung. Sie ist Museum und Gedenkstätte zugleich, die von der »Stiftung zur Bewahrung des jüdischen Erbes in Polen« in Warschau betreut wird. Der Renaissancebau ist das einzige Zeugnis für die einstige Größe des Stetls. Im Innern überraschen Fragmente farbiger Wandmalereien, florale Muster und figürliche Darstellungen – Weinreben, die an Säulen emporranken; Phantasievögel, die unter den Kapitellen in hängenden Blumenkörben und Reifen schaukeln, während eine lebendige Schwalbe unterm Dach entlangsegelt und aufgeregt schreit; prächtige, fast lebensgroße Löwen und Tiger rechts und links vom Toraschrein; ein Schmuckband auf der Höhe der einstigen Galerie mit Bildern aus dem Garten Eden: wo sich inmitten von Blumen, Büschen und Bäumen Hirsche und Hasen friedlich neben Adlern und Löwen ergehen.
Die Ausstellung auf dem nackten Mauerwerk der Synagoge ist dem Vorkriegsstetl gewidmet. Fotos zeigen den alten schulhoif, wo mehrere Betstuben – geduckte, dunkle ein- bis zweigeschossige Holzhäuschen – vor dem prächtigen hellen Steinbau eng beieinanderstehen. Vielleicht ist Chaim hier einst in den Cheder und danach ins Lehrhaus gegangen. Auf zwei Fotos, in Großformat auf Leinwand gezogen, ist der noch unversehrte Innenraum der Synagoge zu sehen, das eine blickt auf den Toraschrein, das andere auf den Haupteingang gegenüber. Die Legende »Fot. Hermann Struck 1916« legt eine Spur vom heutigen Orlja zu Chaim Kahans Heimatort. Beide Fotos stammen vom politischen Weggefährten Hermann Struck. Er war als Soldat hier gewesen und hatte den Innenraum der Synagoge für die Nachwelt festgehalten. Der Graphiker fertigte gern Fotos als Vorlage für seine Zeichnungen an und Synagogen im östlichen Europa gehörten zu seinen Lieblingsobjekten. Zu welchem Anlass aber war er in Orlja und in welcher Eigenschaft? Hatten Chaim Kahans Erzählungen vom Heimatstetl ihn neugierig gemacht? War er privat dort, aus persönlichem Interesse, oder im amtlichen Auftrag, vom Presseamt des Oberbefehlshabers Ost geschickt (Orlja gehörte damals zum Gouvernement »Ober Ost«), für das er zwischen März und November 1916 als Zensor und Übersetzer arbeitete, oder aber erst danach, als Soldat im Fronteinsatz?
Der jüdische Friedhof von Orlja ist heute nur noch ein Wiesenhügel, aus dem hier und da Grabsteinspitzen ragen. Nur wenige sind zu erkennen. Chaims Eltern, auch andere Vorfahren, liegen hier vielleicht begraben. Immerhin wird die Wiese gemäht. Unterm schattenspendenden Holunder hält der Mäher Mittagsschlaf. In der Kneipe des Ortes trinken zwei Bauern ihr Mittagsbier. Es gibt Kuttelsuppe. Der Synagogenbau, die Fotos, der Friedhofshügel, die Kirchen, die Kuttelsuppe und Erinnerungen sind wohl das Einzige, was vom alten Orlja übrig blieb.
»Ich bin ein wenig aus Orla«, erinnert sich der polnische Schriftsteller Roman Śliwonik, Sohn des Postvorstehers von Orla in den dreißiger Jahren. »(Die ursprünglichen Bewohner waren hier Juden, Weißrussen. Es stellt sich heraus, dass auch ich aus Orla komme.) – Es passierte – und es passiert in mir immer noch – auf dem Hintergrund der riesigen untergehenden Sonne, oder vielleicht in der Dämmerung unmittelbar nach dem Untergang. Von der Brücke aus schaute ich auf dunkle betende Gestalten über den silbrig glänzenden Wellen des Flusses. Auf der linken Seite zitterte, vibrierte die riesige Mühle, weiter hinter der Biegung des Flusses dauerten die von Gänseblümchen weißen Wiesen. Noch weiter wuchs aus den Wiesen ein Hügel heraus mit dem alten Friedhof und noch weiter war, und ist vielleicht noch, das Unaussprechliche. – Die ersten acht Jahre meines Lebens wohnte ich in diesem Städtchen, dessen ursprüngliche Bewohner Juden und Weißrussen waren. Es lebten hier auch einige polnische Beamte mit ihren Familien. […] Die Weißrussen, jene großen, sympathischen, schnauzbärtigen Riesen, vornübergebeugt, etwas schrill, laut und gut zu den Kindern. – Die ersten Illustrationen in großen Folianten zeigte mir ein ebensolch großer Weißrusse, einer der Briefträger, die bei meinem Vater gearbeitet haben. Er zeigte, erklärte weise, mit Herzensgüte und bereitwillig. Kinder, kleine Jungs, können Lügen spüren. Später verlieren sie diese Fähigkeit und Weisheit. – Juden, das ist meine ganze Kindheit, großwüchsig, fremdartig, sich am Fluss wiegend, die Straßen füllend, die Läden, mein Leben. Gesprächig, immer weise, ehrlich Entrüstung heuchelnd. – Und nun soll ich all das aus meinem Gedächtnis verbannen, verwerfen, verändern, umarbeiten, nur weil die Dummheit von irgendwem in mir Ärger heraufbeschwört? – Im Alter von sieben Jahren hatte ich mehr Frieden in mir als jetzt. Ich schaute den Juden nach, die aus der Synagoge zum Fluss gingen, sie gingen an unserer Veranda vorbei und nichts wird mir das Bild ersetzen, lange, schwarze Schatten, langsam am Himmel vorbeiziehend, an dem weltweit am schönsten die Sonne unterging.«
Als Roman Śliwonik in Orla/Orlja lebte, war Chaim Kahan schon lange fort. Doch der Ort war sich gleich geblieben. Nur dass es statt der russischen nun polnische Beamte gab. Im Mai 1864 wurde Chaim in Orlja mit der um drei Jahre älteren Malka Basch verheiratet, der Tochter von Eliezer Mosche und Debora Basch aus Brest. Er war damals nicht nur jünger, sondern auch kleiner als seine Braut und beide waren fast noch Kinder. Vielleicht fand die Hochzeit in der Großen Synagoge statt. Die Strophe aus den Psalmen Raz ke-zevi, »Renne wie ein Hirsch!«, im Freskenumlauf könnte Chaims Wahlspruch fürs Leben geworden sein. Die Familie erzählt, er habe geweint, als er Elternhaus und Stetl verlassen musste, um zu den Schwiegereltern in die Fremde, nach Brest, zu ziehen. Brest war nach Białystok im Norden die nächstgrößere Stadt im Süden und etwa achtzig Kilometer von Orlja entfernt. – »Liebe Malke!«, schrieb er viele Jahre später scheinbar hastig, auf Russisch, fast ohne Punkt und Komma, von Petrograd nach Berlin. »Ich bezweifele, dass du dich an jene Jahre erinnerst als wir Kostgänger waren wie damals bei den Juden üblich und wie wir lebten? Ich kann mit einiger Sicherheit sagen dass in jedem Fall meine Lebenslage viel mieser war als meine Fantasien aus meinem Heimatstetl Orlja Ich war wirklich glücklich mit dir und meine Fantasien verwandelten sich vollends in den Wunsch dich glücklich zu machen!«
Heute ist die Bevölkerung von Orlja/Orla ganz überwiegend belorussischer und ukrainischer Herkunft und orthodox. Die Leute sprechen, so erzählte es mir ein dort lebender Bauer, ihre eigene Sprache, eine Mischung aus Polnisch, Ukrainisch, Belorussisch und Russisch. Die Sprachengrenze verläuft, wie vielerorts, nicht entlang der Staatsgrenze. Chaim Kahan wuchs mit jenem Sprachgemisch als Umgebungssprache auf. Orlja hatte, sagt der Bauer, vor dem Holocaust 5.000 Einwohner, davon waren 3.000 Juden. Heute beträgt die Bevölkerung 800 Seelen. Früher hatte Orlja Stadtrechte, heute ist es ein Dorf. Es gibt keine Arbeit und die Leute gehen fort.
Den direkten Weg von Orlja nach Brest versperrt heutzutage die polnisch-belorussische Staatsgrenze, einen Grenzübergang gibt es nur bei Brest. Brest-Litowsk, in der jüdischen Literatur Brisk genannt, hat 330.000 Einwohner und ist durch den Friedensvertrag zwischen Sowjetrussland und den Mittelmächten im März 1918 weltbekannt. Es ist seit jeher eine Grenzstadt, zwischen dem Großfürstentum Litauen und der Polnischen Adelsrepublik, seit der Dritten Polnischen Teilung zwischen dem Königreich Polen und dem Gouvernement Grodno im nordwestlichen Grenzland des Russischen Reiches, polnisch kresy genannt. Nach dem Zusammenbruch der Imperien gehörte es zur Ersten Polnischen Republik, aber nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt wieder eine Grenzstation von der Volksrepublik Polen nach der Sowjetunion und heute von Polen nach Belarus, der Europäischen in die Eurasische Union. Darüber hinaus ist Brest für seine Festung berühmt, die Zar Nikolaus I. nach dem Ersten Polnischen Aufstand im Jahre 1831 dort, wo die Stadt stand, errichten ließ. Der Bau begann Ende der 1830er Jahre und zog sich bis in die 1850er Jahre hin. Die Festung hatte noch im Zweiten Weltkrieg eine strategische Bedeutung. Mussolini und Hitler trafen sich dort. Brest ist seit alters ein Verkehrsknotenpunkt. Hier fließen Westlicher Bug und Muchavec zusammen und bilden seit der Fertigstellung des Dnjepr-Bug-Kanals (1841), der Pina und Muchavec verband, einen Wasserweg vom Dnjepr bis zur Weichsel. Im Jahr 1896 passierten in Brest elf Dampfer, einige Hundert Frachtkähne und mehr als fünfzehntausend Flöße die Wasserstraße. Die Chaussee von Warschau über Minsk nach Moskau läuft durch die Stadt. Zuletzt wurde Brest Eisenbahnknotenpunkt. Seit 1869 verkehren Züge zwischen Warschau und Brest, wenige Jahre später kamen die Linien Brest–Moskau, Königsberg–Brest–Kiew dazu. Die günstige geographische Lage am Grenzübergang, am Zusammenfluss von Bug und Muchavec, prädestinierte Brest zur Handelsstadt zwischen Polen und Litauen, aber auch darüber hinaus, zwischen Russland und Westeuropa. Ursprünglich war Brest eine der größten Städte im Großfürstentum, zugleich seit Mitte des 14. Jahrhunderts und bis Wilna ihm dreihundert Jahre später diesen Rang streitig machte, Zentrum des litwakischen Judentums. Die Unternehmertochter Pauline Wengeroff, geborene Epstein, berichtet in ihren Erinnerungen vom jüdischen Leben im Brest der 1830/40er Jahre, von der Idylle vor dem Festungsbau, den Zerstörungen durch ihn, vom beengten Wohnen in der Neustadt, ehe sie die »große Übergangszeit« der 1860/70er Jahre beschreibt, als Chaim Kahan nach Brest kam. »Es war schon die Zeit, da die Lilienthalsche Bewegung in breitere und tiefere Schichten drang. Jetzt durfte man es wenigstens wagen, die ›fremden‹ Bücher zu studieren; und die jungen Leute in Brest nutzten diese Möglichkeit in jeder Hinsicht aus. Sie veranstalteten Versammlungen, in denen man deutsche Klassiker, wissenschaftliche Werke, besonders aber die alte griechische Literatur las. Allmählich wurden auch die Frauen zu diesen Zusammenkünften zugelassen.« Pauline Wengeroffs Bruder Ephraim Epstein und ihr Schwager Abram Sak’, später ein bekannter Bankier in Petersburg, führten in jugendlichem Alter die jüdische Aufklärungsbewegung in Brest an, die mit der Mission des deutsch-jüdischen Reformers Max Lilienthal in zarischem Auftrag während der 1840er Jahre begonnen hatte. Der junge Chaim Kahan könnte von ihnen beeinflusst worden sein. Einmal sorgten Schwager und Schwester, so Pauline Wengeroff, für einen Familienskandal, als sie am Schabbesnachmittag zusammen über die große Chausseestraße spazierten, wo die meisten Brester Juden, die Dämmerung genießend, flanierten, denn Männer und Frauen hatten streng getrennt voneinander zu gehen. Ob Chaim und Malka sich wohl an die alten Anstandsregeln hielten, oder ob auch sie schon zusammen auf der Chausseestraße flanierten?
In Brest lebte Chaim Kahan die ersten beiden Ehejahre bei den Schwiegereltern auf kest und lernte vermutlich wie andere junge Männer, die bei den Gemeindemitgliedern reihum verköstigt wurden, im Lehrhaus oder in der Jeschiwa. Als zwei Jahre später der erste Sohn, Baruch-Tanchum, geboren wurde, Chaim war gerade sechzehn, begann er den Lebensunterhalt für die Familie selbst zu verdienen. Rund drei Jahrzehnte, seit der Heirat mit Malka und bis die älteste Tochter Miriam verheiratet wurde, lebte die Familie Kahan in Brest. Nirgends war sie so sesshaft wie dort. Der letzte der wenigen Hinweise auf ihre Brester Existenz in den Hinterlassenschaften ist Eliezer Mosche Baschs Gratulation an die Enkeltochter Miriam in Warschau zur Geburt der Tochter, seiner Urenkelin Rosa, im Sommer 1898 unter dem Briefkopf der Kaspischen-Schwarzmeer Ölindustrie- und Handelsgesellschaft, Vertretung Brest, als Chaim Kahan selbst schon in Charkow lebte und von dort aus wirtschaftete.
Drei Kilometer östlich von der Festung entstand Mitte des 19. Jahrhunderts das neue Brest aus zwei Vorstädten mit ein- bis zweistöckigen Steinhäusern, breiten, gerade angelegten Straßen, stattlichen Kaufläden. Dennoch dominierten niedrige Holzhäuser die Stadt. Nicht alle Straßen waren gepflastert. Der Muchavec war nicht nur wirtschaftlicher Wasserweg, sondern auch eine Quelle von Infektionskrankheiten. Immerhin ermöglichte ein großer Stadtpark Erholung und Freizeitvergnügen. Die hygienischen Bedingungen waren, wie damals überall in den Städten und Stetln, nicht gut, Abfälle wurden einfach auf die Straße geworfen. Ein Jahr nach Chaims und Malkas Heirat wurde Brest von einer Choleraepidemie heimgesucht. Es gab nur fünf Brunnen mit Trinkwasserqualität, zwei Bäder, beide in jüdischem Besitz, auf der Langen und auf der Muchavec-Straße, dazu zwei Mikwen.
Als Chaim nach Brest kam, stand die nikolaitische Festung bereits, war schon eine Generation über die gewaltsame Versetzung der Stadt hingegangen. Die Festung erstreckte sich über eine Fläche von vier Quadratkilometern. Allein die Zitadelle, ihr Zentrum, war von einer fast zwei Kilometer langen Mauer umgeben. Die Festung war so groß, dass ich das Areal nach zwei Stunden im Eilschritt immer noch nicht durchmessen hatte. Sie ist das Schicksal der Stadt, zerstörte das alte Brest, ihr Bau vertrieb und ruinierte die Bewohner, sie brachte den Tod, zog im Krieg Gewalt und Kämpfer an. In Friedenszeiten aber gab sie Arbeit und erhielt die Stadt so am Leben. Chaim Kahan kam in Friedenszeiten, als Brest erneut prosperierte und sich zum Verkehrsknotenpunkt, Handels- und Industriestandort entwickelte. Die Große Synagoge auf der Millionaja (heute Sovetskaja) war gerade errichtet worden.
Brest war nach Grodno die zweitgrößte Stadt im Gouvernement und die vorwiegend jüdische Bevölkerung Modernisierungen gegenüber aufgeschlossen. Brest ging mit der Zeit, besaß in den 1860er Jahren eine litwakisch dominierte Gemeinde mit einer differenzierten Infrastruktur. Schon vor der Großen Synagoge besaß sie ein Krankenhaus, größer als das Stadthospital, eine unentgeltliche Gemeindeschule, die Talmud-Tora für fünfhundert Jungen. Die Maskilim setzten sich für die Modernisierung der Bildung ein und eröffneten eine Bibliothek. Es gab eine kleine staatliche jüdische Schule neben den traditionellen Chadarim und vielfältige Institutionen der Sozial- und Gesundheitsfürsorge, insbesondere für Witwen, Arme, Waisen und werdende Mütter. 1889 zählte man in Brest zweitausend Häuser und mehr als vierzigtausend Einwohner, davon zwei Drittel Juden. Dieses Verhältnis blieb bei einem gewissen Wachstum auch im nächsten Jahrzehnt stabil. Fast alle Handwerker in Brest – Eisen- und Blechschmiede, Tischler und Stellmacher, Schuster, Schächter, Buchbinder, Seiler, Schneider, Bäcker, Goldschmiede, Frisöre, Uhrmacher, Pelzhutmacher, Glaser, Seifensieder, Zuschneider – waren Juden. Die Militärgarnison war Großkunde für diverse Waren wie Uniformen, Zubehör, Baumaterialien, Gebrauchsgegenstände und Lebensmittel. Der Festungsbau verbot hohe Fabrikanlagen, dennoch gab es in Brest Industrie, die vor allem von Juden betrieben wurde: Fabriken zur Herstellung von Terpentin, Leder, Tuch, Seife und Nahrungsmitteln, mehrere Ziegeleien, Druckereien, Dampfmühlen.
Damals begann eine neue Zeit. Industrialisierung und Eisenbahnbau veränderten die Berufe. Seit Aufhebung der Leibeigenschaft verdrängten die Bauern die Juden aus den Gutspächterposten. Die Eisenbahn machte Fuhrleute, Kneipenwirte, Schmuggler und Handwerker arbeitslos. Der beschleunigte Waren- und Menschentransport erhöhte die auswärtige Konkurrenz. Reformen nach dem physiokratischen Konzept der ›Produktivisierung‹ führten in Brest zur Gründung landwirtschaftlicher Kolonien (1881). Juden begannen moderne Landwirtschaft zu betreiben. Allerdings war dies nur eine Randerscheinung: Die Restriktionen nach den Mai-Gesetzen im Jahre 1882, das Verbot von Landkauf und weitere Einschränkungen forcierten eher deren Urbanisierung. Den größten Teil der Gewerbe, in denen Juden beschäftigt waren, machte mit vierzig Prozent das Manufaktur- und Verlagswesen aus, dicht gefolgt vom Handel. In Brest wurden Alkohol, Lebensmittel, Haushaltswaren, landwirtschaftliches Gerät und Werkzeug, Baumaterialien, Petroleum, Holz, Papierwaren und Druckerzeugnisse verkauft. Seit Ende des 19. Jahrhunderts hatte die Stadt fünf Bibliotheken und acht Druckereien, nahezu alle in jüdischem Besitz. Juden haben in Belarus den Buchdruck eingeführt. Damals gab es sieben große Apotheken, dreiundzwanzig Drogerien, mehrere Hundert Läden an der Chausseestraße, viele davon mit jüdischen Inhabern, und eine Handelspassage an der Millionaja. Es gab zwei Synagogen und um die dreißig jüdische Bethäuser in Brest, so die Historikerin Ol’ga Sobolevskaja.
Chaim Kahan hätte damals durchaus die Möglichkeit gehabt, wie einige seiner Vorfahren Gelehrter zu werden. Zu seiner Zeit amtierten in Brest Rabbiner, deren Namen in der weiteren Familiengeschichte eine Rolle spielen sollten und die damals vermutlich seine Lehrer und Ratgeber waren: Zwi Hersch Ornstein aus Galizien (1865-1874), Mosche Jehoschua Leib Diskin (bis 1877) aus Łomża, der am Ende seines Lebens ein prominenter Rabbiner in Jerusalem war, Joseph Dow Bär Soloweitschik (1878-1892) und dessen Sohn Chajim Halevi Soloweitschik (1892-1914). Doch Chaim Kahan entschied sich für das Handelsgewerbe. Er begann damit, Salzheringe, die auf keinem Tisch fehlen durften, in Fässern aus Holland zu importieren. Malka verkaufte sie weiter, en gros. Darüber kursiert ein Witz in der Familie: Als die Heringe einmal knapp wurden, verkauften Chaim und Malka das Fass, erworben für zehn, zunächst für fünfzehn Rubel. Doch je knapper die Ware, desto höher der Preis. Als der auf einhundert Rubel pro Fass stieg, wurden die Fässer als lukrative Handelsobjekte mehrfach weiterverkauft, sodass der Hering stank, als er beim Verbraucher ankam, und dieser sich beschwerte. Chaim Kahan antwortete ihm: »Warum hast du das Fass geöffnet? Es war doch für den Verkauf bestimmt.«
Malka hatte noch Kontakte, tätigte auch noch weiter Handelsgeschäfte in Brest, als sie längst von dort fortgezogen war, denn ihre Schwester Riva, verheiratete Dubinbaum, lebte mit Familie dort, und Malka verkaufte den Verwandten und Bekannten in und um Brest Seife und Soda aus Warschau. In der geschäftigen Stadt mit ihren schnellen Verbindungen in die Welt boten sich Chaim Kahan viele Gewerbe und Gewerke zum Broterwerb an, doch er gab den Fischhandel nach kurzer Zeit auf und, statt in der Region Holz oder Getreide, Leder, Tabak oder Stoffe zu kaufen und zu verkaufen, entschied er sich für das Geschäft mit einem Produkt, das ganz neu war und auf dem Markt boomte – Petroleum, Lichtöl. Sieben Jahre lang, seit seinem achtzehnten Lebensjahr, verdingte er sich als Arbeiter an verschiedenen Orten – in Kiew, Königsberg, Caricyn an der Wolga (seit 1925 Stalingrad, seit 1961 Wolgograd) und anderen Städten, bis er sich 1876/77 in Wilna als Ölgroßhändler selbstständig machte. Chaim Kahan war von Beginn an ein Selfmademan, nicht zuletzt weil er beweglich war und – wie er es später selbst formulierte – geschickt »kombinierte«. Der Großvater sei viel unterwegs gewesen und habe später an vielen Orten Wohnungen gehabt, erinnerte sich Arusja, außer in Brest in Charkow, Warschau, Wilna, Baku, Antwerpen, zuletzt in Berlin. Sehr oft war er von zu Hause fort, was ihm nicht selten Konflikte mit Malka einbrachte, die daheim auf ihn wartete und die Kinder großzog. Oft stritt man im Hause Kahan über Chaims Geschäftsideen und den Sinn der vielen Wohnorte. Dennoch kehrte er bis Mitte der 1890er Jahre stets nach Brest zurück. Hier lebte die Familie, hatte er all die Jahre ein Kontor und bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs auch Öllager, anfangs nur unter seinem eigenen Namen, später auch unter dem der Kaspischen-Schwarzmeer Ölindustrie- und Handelsgesellschaft. Hier in Brest wurden auch die Ehen seiner beiden ältesten Kinder Baruch und Miriam geschlossen.
In Brisk habe der Großvater ein großes Haus mit einem Obstgarten besessen. Nach dem Ersten Weltkrieg sei das Haus an die polnische Kommandantur verpachtet gewesen, bis Hitler kam, so Arusja in seinen Erinnerungen. Efim Basin, Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde und Regionalhistoriker in Brest, fand das Grundstück. Es war mit allen Bauten bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im Besitz der Familie Kahan, das Haupthaus wurde in der Zwischenkriegszeit an die Kommandantur der Wojewodschaftspolizei vermietet. Die Wojewodschaftspolizei war die höchste zivile Polizeibehörde der Stadt und für die ganze Region zuständig. Es muss also eine respektable Adresse gewesen sein. Die Kahans besaßen ein geräumiges, ein dreiviertel Hektar großes Eckgrundstück, da, wo die Medovaja, die Honigstraße, auf die Chausseestraße stieß. Die Medovaja hieß im Brześć nad Bugiem der Zwischenkriegszeit Zygmuntowska, im sowjetischen und belorussischen Brest Karla Marksa und die Chausseestraße, heute Praspekt Generala Mašerava, Jagiellonska. Es heißt, die Kriege hätten Brest fast gänzlich zerstört. Tatsächlich steht auf Kahans ehemaligem Grundstück kein altes Bauwerk mehr, an seiner Stelle ragt ein achtstöckiges Mietshaus aus der Sowjetzeit empor, doch es gibt noch zahlreiche Vorkriegsbauten und im Vergleich mit Häusern in der Nachbarschaft, die aus der Zarenzeit stammen, formt sich ein Bild.
Gleich nebenan, nur durch die Karla Marksa von Kahans einstigem Grundstück getrennt, steht ein prächtiges Verwaltungsgebäude, heute beherbergt es eine Touristikagentur, unter russischer Herrschaft war es die Steuerbehörde, in der Zwischenkriegszeit Sitz der Wojwodschaft, der Region. Darauf folgt das alte Postgebäude, heute eine Filiale der Brester Post. Zur anderen Seite hin, Praspekt Mašerava 2, Ecke Leninstraße, stand das Slawische Hotel in unmittelbarer Nachbarschaft, das nach dem Ersten Weltkrieg in ein vom Joint unterhaltenes Jüdisches Waisenhaus umgewandelt wurde. In der Karla Marksa, aber auch in anderen Nebenstraßen stehen noch Wohnhäuser aus der Zarenzeit. Fest geerdet, breit gestreckt, niedrig, mit dicken Mauern, Schmuckbändern unter dem Gesims, Säulenreliefs rechts und links der Fenster und Eingangsportale, darüber Balkons mit schmiedeeisernem Gittergeländer. Alte, solide Stadtbürgerhäuser in zentraler Lage. Denn die Chaussee kam von der Festung und war die Durchgangsstraße von Warschau nach Moskau. Schräg gegenüber lag der Stadtpark und zum Ufer des Muchavec waren es vielleicht hundert Schritte. Zur anderen Seite, auch noch fußläufig, lag der Bahnhof und dazwischen das Stadtzentrum mit der Millionnaja, wo die Große Synagoge stand, ein stattliches, achteckiges, oben spitz zulaufendes Gebäude über zwei Stockwerke für achthundert Besucher, das seit Beginn der 1970er Jahre, modernistisch und bis zur Unkenntlichkeit verformt, wie mancherorts Synagogen in der einstigen Sowjetunion, als Kino fungiert. Nur im Keller, bei den Toiletten, zeugen mächtige Natursteine vom Synagogenfundament, das aus demselben unverwüstlichen Material und in derselben soliden Weise wie die Festung errichtet wurde, sodass es der sowjetischen Stadtregierung nicht gelang, das Gebäude zu sprengen. Vor kurzem weihte die Chabad-Gemeinde eine Torarolle im Kino Belarus, veranstaltete von dort einen Umzug, einen sijum, durch die Stadt, gab dem Bau für den Moment etwas von seiner einstigen Aura zurück.
Sicher war die Chausseestraße in Brest bereits gepflastert und besaß auch einen Bürgersteig, als Chaim und Malka dort lebten. Sie war damals schon breit, hatte einen Mittelstreifen mit Bäumen, abgezäunten Arealen, vielleicht für Pferde oder andere Haustiere, auch mit Stellplätzen für Droschken, und war sehr belebt. Dort reihte sich Geschäft an Geschäft. Gefährte aller Art fuhren da, auch die ersten Radfahrer. Man sah Flaneure, Durchreisende, Soldaten von der Festung, Handwerker und Händler, die in der Garnison zu tun hatten. Leute, die zur Behörde oder in die Post gingen, kamen vorbei. Hinter dem Haus erstreckte sich ein Garten, denn das Grundstück war groß, sodass die Kinder, auch wenn sie nicht in den Stadtpark oder ans Muchavec-Ufer konnten, frische Luft bekamen und Auslauf hatten. Dazu gibt es in der Familie einen weiteren Witz aus der Brester Zeit: Einmal ging Chaim Kahan mit einem Bekannten spazieren, einem älteren Mann, der von Zeit zu Zeit einen fahren ließ. Jede explosive Entlastung begleitete er mit dem Ausruf »Oj a churben!« Als Chaim sich umsah, bemerkte er, dass ihnen ein Pärchen folgte. Er fragte die beiden, seit wann. Sie antworteten, seit dem churben rischn, dem ersten churben! Hier lacht, wer in der jüdischen Geschichte zu Haus ist und weiß, dass churben die Zerstörung des Tempels und seitdem eine Zäsur in der Zeitrechnung bedeutet.
Bauplänen, Baugenehmigungen und Steuererhebungen zufolge gab es um die Jahrhundertwende drei zweistöckige Steinhäuser, einen Pferdestall und Wirtschaftsgebäude auf dem Grundstück, das Chaim Kahan von seinem Schwiegervater erbte. In welchem davon sie lebten und seit wann, ob schon seit der Heirat oder erst seit Chaims Geschäfte erfolgreich liefen, bleibt ungewiss – im stattlichen Vorderhaus, direkt an der Chaussee, mit eingeschossigem Flügel nach hinten hinaus, im Haus auf dem Hof oder dem an der Querstraße, der Medovaja. Das größte war ein Doppelhaus, mehr als dreißig Meter lang, vierzehn Fenster, außer dem Haupteingang noch mit drei Türen auf jeder Seite zur Chausseestraße hin. Dahinter befanden sich die Kontore oder Ladengeschäfte. Angenommen, die Familie, drei Generationen, der alte Basch (seine Frau lebte nicht mehr), Chaim und Malka, die Kinder, vermutlich auch Dienstboten und Angestellte lebten in dem Doppelhaus, dann wohnten sie im ersten Stockwerk, das mit zwölf Zimmern immer noch geräumig war. Vielleicht hatte Schwiegervater Basch auch eine eigene Wohnung im Flügel oder in einem der anderen Wohnhäuser. Da war sicher viel Leben, wegen des Geschäfts und wegen der vielen kleinen Kinder, denn Malka Kahan brachte im Lauf von zwanzig Jahren elf zur Welt – zuerst in engem Abstand Baruch, Miriam und Pinchas, nach einer siebenjährigen Pause Bendet, Aron, David und Rahel; von vieren fehlen die Namen, vermutlich weil sie früh starben. Großvater Basch habe das unaufhörliche Klappern der Löffel, mit denen die Kinder gefüttert wurden, noch vernommen, als diese längst erwachsen waren, erzählt man sich in der Familie.
Nachdem Kahans Brest verlassen hatten, kümmerten sie sich weiterhin um ihr Anwesen in der Stadt, erneuerten es, bauten es aus. All die Jahre hindurch, die schwere Zeit des Ersten Weltkriegs inbegriffen, hielten sie Kontakt nach Brest – zum Verwalter Tanchum-Michal Orchow, zur Familie von Malkas Schwester Riva. »Nochmals erinnere ich hinsichtlich des Schwagers Osip Abramovič [Dubinbaum] ihm zu zahlen 200 Mark allen Verwandten einiges hinzuzugeben erinnere E.[uch] hinsichtlich Jakob Orchow wahrscheinlich ist er arm helft ihm ebenfalls«, schrieb Chaim Kahan am 3. März 1916 aus Petrograd an seine Lieben in Berlin. Nach den Adressbüchern lebten in der Zwischenkriegszeit noch einige namens Basch und Kahan in Brest, unter anderem der Molkereibesitzer Szmul Kahan, der neben Orchow als Verwalter eingesetzt war, und eine gewisse Wichna Kahan, Białystoker Straße 66, wo die Nachfolger von Chaim N. Kahan amtlich gemeldet waren.
Was ist vom alten jüdischen Brest, abgesehen von den Mauern des Kinos Belarus,





























