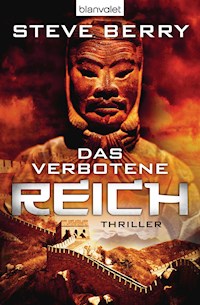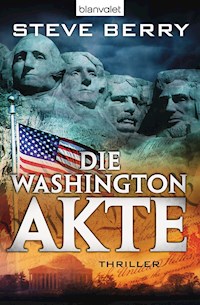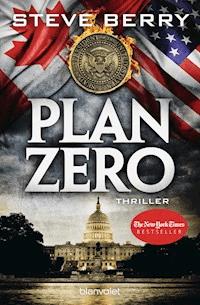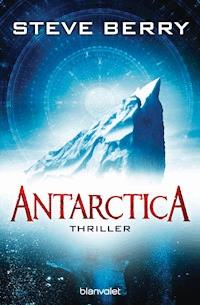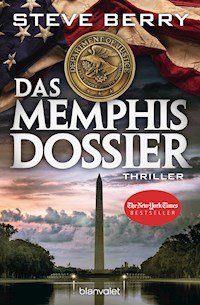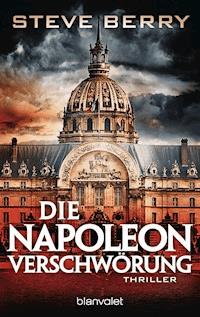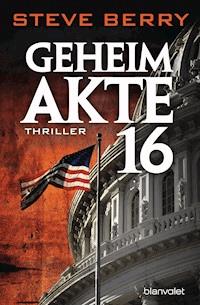9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Die Wahrheit über die Entdeckung Amerikas wird die Welt verändern …
Der preisgekrönte Journalist Tom Sagan deckt in seinen Artikeln unbequeme Wahrheiten aus Brennpunktregionen der Welt auf. Doch als seine Reportage aus dem Nahen Osten als Fälschung angeprangert wird, verliert er über Nacht alles. Was er nicht beweisen kann: Er wurde gezielt sabotiert. Gerade als Sagan dem Ganzen ein Ende setzen will, wird der amerikanische Nachrichtendienst auf ihn aufmerksam. Und plötzlich ist Sagan in eine hoch brisante verdeckte Ermittlung verstrickt, die alles verändern könnte, was die moderne Welt über die Entdeckung Amerikas zu wissen glaubt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 660
Ähnliche
Buch
Der ehemalige Nahost-Reporter Tom Sagan muss seine Tochter retten. Sie ist Entführern in die Hände gefallen, und wenn Tom ihnen nicht das gibt, wonach sie suchen, wird ihr Schlimmes zustoßen. Doch die Entführer wollen Tom zwingen, ihnen das Geheimnis auszuhändigen, das sein Vater mit ins Grab nahm. Es handelt sich um ein wertvolles Dokument, dessen Inhalt auch Tom unbekannt ist. Doch eines weiß er bestimmt: Sollte es in die falschen Hände fallen, könnte es unermessliche Auswirkungen auf die Weltgeschichte haben. Tom bleibt keine Wahl: Er muss sich auf ein gefährliches Spiel einlassen – und selbst die Wahrheit als Erster herausfinden …
Autor
Steve Berry war viele Jahre erfolgreich als Anwalt tätig, bevor er seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte. Mit jedem seiner spannenden Thriller stürmt er in den USA die Spitzenplätze der Bestsellerliste. Steve Berry lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in Camden County, Georgia.
Bei Blanvalet von Steve Berry lieferbar:
Die Washington-Akte
Das verbotene Reich
Der Korse
Antarctica
Steve Berry
Die
KOLUMBUS-
VERSCHWÖRUNG
Thriller
Aus dem Amerikanischen
von Barbara Ostrop
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel
»The Columbus Affair« bei Ballantine Books, New York.
Copyright © der Originalausgabe 2012 by Steve Berry
Published by arrangement with Magellan Billet Inc.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014 by Blanvalet, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: Johannes Frick
Umschlagmotive: Johannes Frick, Neusäß/Augsburg,
unter Verwendung von Motiven von Getty Images und Shutterstock
Redaktion: Werner Bauer
ES · Herstellung: sam
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-12342-0V002
www.blanvalet.de
Für Simon Lipskar, Literaturagent
Danke.
Seit rund fünfhundert Jahren grübeln Historiker über die Frage nach: Wer war Christoph Kolumbus?
Die Wahrheit ist einfach nur eine andere Frage:
Wer soll er Ihrer Vorstellung nach gewesen sein?
Anonym
JAMAIKA, 1504 n. Chr.
Prolog
Christoph Kolumbus spürte, dass der entscheidende Augenblick bald kommen würde. Sein Trupp wanderte schon den ganzen Tag durch den üppigen Wald dieses tropischen Landes nach Süden und war dabei stetig aufwärtsgestiegen. Von allen Inseln, die er seit der ersten Landung im Oktober 1492 entdeckt hatte, war dies die schönste. Eine schmale Ebene säumte die felsige Küste. In Nebel gehüllte Bergketten zogen sich wie ein Rückgrat über die Insel. Sie stiegen von Westen her allmählich an und gipfelten hier, im Osten, in einem Gewirr von Bergkämmen. Der Untergrund bestand überwiegend aus durchlässigem Kalkstein, der von fruchtbarer, roter Erde bedeckt war. Unter dichten, alten Baumbeständen wucherte eine unglaubliche Vielfalt von Pflanzen, die im feuchten Klima der vom Meer kommenden Winde prächtig gediehen. Die Eingeborenen, die hier lebten, nannten ihr Zuhause Xaymaca, was, wie er erfahren hatte, »Insel der Quellen« bedeutete. Ein passender Name, denn überall gab es Wasser. Da im Kastilischen statt des X ein J geschrieben wurde, hieß die Insel bei ihm Jamaica – beziehungsweise Jamaika.
»Admiral.«
Er blieb stehen und drehte sich nach dem Mann um.
»Es ist nicht mehr weit«, sagte de Torres und zeigte nach vorn. »Den Hang hinunter zu der ebenen Stelle und dann hinter einer Lichtung.«
Luis hatte ihn auf allen drei vorangegangenen Reisen begleitet, auch bei der von 1492, als sie zum ersten Mal Land betreten hatten. Sie verstanden sich gut und vertrauten einander.
Dasselbe konnte er über die sechs Eingeborenen, die die Kisten trugen, nicht sagen. Sie waren Heiden. Er zeigte auf zwei, die einen der kleineren Behälter transportierten, und bedeutete ihnen mit einer Geste, vorsichtig zu sein – überrascht, dass das Holz nach zwei Jahren noch immer heil war, also nicht von Wurmlöchern durchsiebt wie letztes Jahr sein Schiffsrumpf. Ein ganzes Jahr lag er nun schon auf dieser Insel fest.
Doch seine Gefangenschaft war jetzt vorbei.
»Du hast den Ort gut gewählt«, sagte er auf Spanisch zu de Torres.
Keiner der Eingeborenen beherrschte ihre Sprache. Drei weitere Spanier begleiteten ihn und Torres, alle sorgfältig ausgewählt. Die Eingeborenen hingegen waren zwangsverpflichtet worden. Er hatte sie mit dem Versprechen weiterer Falkenglöckchen bestochen – billiger Tand, doch der Klang schien sie zu faszinieren. Sie mussten nur drei Kisten in die Berge schleppen.
Bei Tagesanbruch waren sie in einer Waldlichtung am Rande der Nordküste aufgebrochen. In der Nähe hatte ein kalter, schimmernder Fluss sich über Felsstufen hinuntergestürzt und ein Becken nach dem anderen gebildet, bis er sich schließlich in einem letzten, silbernen Wasserfall ins Meer ergoss. Das ununterbrochene Zirpen der Insekten und Flöten der Vögel war immer lauter geworden und hatte nun ein wildes Crescendo erreicht. Der Marsch den bewaldeten Hang hinauf war anstrengend gewesen, und alle waren außer Atem, ihre Kleider schweißnass, die Gesichter schmutzig. Jetzt ging es endlich wieder abwärts, in ein üppig grünes Tal.
Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte er sich wie verjüngt.
Er liebte dieses Land.
Die erste Reise 1492 hatte gegen den Rat sogenannter Gelehrter stattgefunden, ihm höchstselbst war die Leitung übertragen worden. Siebenundachtzig Mann waren, von der Kraft seines Traums getragen, ins Unbekannte aufgebrochen. Jahrzehntelang hatte er darum gekämpft, das nötige Geld dafür zu bekommen. Erst hatte er es bei den Portugiesen versucht, dann bei den Spaniern. Die Kapitulation von Santa Fé, ein Vertrag zwischen ihm und der spanischen Krone, hatte ihm die Aufnahme in den Adelsstand zugesagt, zehn Prozent der zu erwartenden Gewinne und die Kontrolle über die Meere, die er entdeckte. Auf dem Papier war das ein ausgezeichneter Handel, aber Ferdinand und Isabella hatten ihren Teil des Vertrags gebrochen. Nachdem er vor zwölf Jahren den Nachweis für die Existenz der Neuen Welt erbracht hatte, wie sie inzwischen von allen genannt wurde, war ein spanisches Schiff nach dem anderen westwärts gesegelt, ohne seine Genehmigung als Admiral des Ozeans einzuholen.
Huren. Lügner.
Sie alle.
»Dort«, rief de Torres.
Kolumbus blieb stehen und spähte durch die Bäume, an Tausenden von roten Blüten vorbei, die die Eingeborenen »Flammen des Waldes« nannten. Er erblickte einen klaren Tümpel, flach und glatt wie eine Glasscheibe. Und er hörte das Tosen von Wasser, das hineinstürzte und wieder herausströmte.
Jamaika hatte er zum ersten Mal im Mai 1494 besucht, während seiner zweiten Reise, und festgestellt, dass die Nordküste von den gleichen Eingeborenen bewohnt war, die er auch auf den Nachbarinseln angetroffen hatte. Nur waren diese Menschen feindseliger. Vielleicht erklärte ihre Nähe zu den Kariben, die auf Puerto Rico im Osten lebten, warum sie so aggressiv waren. Kariben waren finstere Kannibalen, für sie war Gewalt oberstes Gesetz. Da Kolumbus aus früheren Erfahrungen gelernt hatte, hatte er für die ersten Begegnungen mit den Jamaikanern Bluthunde und Bogenschützen losgeschickt. Er hatte einige von ihnen getötet und andere misshandelt, bis die Überlebenden ihm nur zu gerne zu Diensten sein wollten.
Er ließ den Trupp beim Tümpel Halt machen.
De Torres trat zu ihm und flüsterte: »Hier ist er. Der Ort.«
Kolumbus wusste, dass dies sein letzter Aufenthalt in seiner Neuen Welt war. Er war einundfünfzig und hatte es geschafft, sich eine eindrucksvolle Zahl von Feinden zu machen. Beweis dafür war das vergangene Jahr, denn über dieser vierten Reise hatte von Anfang an ein schlechter Stern gestanden. Als Erstes hatte er die Küste jener Gegend erkundet, die er inzwischen für einen Kontinent hielt. Sie schien sich endlos von Norden nach Süden zu erstrecken, so weit er gesegelt war. Nach dieser Erkundungsfahrt hatte er gehofft, auf Kuba oder Hispaniola an Land gehen zu können, aber seine wurmzerfressenen Schiffe hatten es nur bis Jamaika geschafft. Dort hatte er beide auf den Strand gelegt und auf Rettung gewartet.
Doch es war keine gekommen.
Der Gouverneur Hispaniolas, sein eingeschworener Feind, beschloss, ihn und seine 113 Mann sterben zu lassen.
Doch das war nicht geschehen.
Stattdessen waren ein paar tapfere Leute mit dem Kanu nach Hispaniola gepaddelt und hatten ein Schiff zurückgebracht.
Ja, er hatte sich wahrlich viele Feinde geschaffen.
Es war ihnen gelungen, es so hinzubiegen, dass alle Rechte, die die Kapitulation ihm zusagte, aufgehoben wurden. Seinen Adel und den Titel des Admirals hatte er verteidigen können, aber das bedeutete nichts. Die Kolonisten in Santo Domingo hatten sogar rebelliert und ihn gezwungen, die Auseinandersetzung mit einem demütigenden Abkommen beizulegen. Vor vier Jahren war er in Ketten nach Spanien zurückgebracht worden. Dort hatten ihm ein Prozess und der Kerker gedroht. Doch der König und die Königin hatten ihn überraschenderweise begnadigt und dann eine vierte Überfahrt finanziert und genehmigt.
Es stellte sich die Frage, was sie dazu bewegt haben mochte.
Isabella hatte aufrichtig gewirkt, sie liebte das Abenteuer. Aber mit dem König sah es anders aus. Ferdinand hatte ihn nie gemocht und offen gesagt, er halte eine Fahrt über den westlichen Ozean für verrückt.
Das war natürlich vor Kolumbus’ Erfolg gewesen.
Jetzt wollte Ferdinand nichts als Gold und Silber.
Huren. Lügner.
Sie alle.
Er bedeutete den Eingeborenen mit einer Geste, die Kisten abzusetzen. Seine drei Männer halfen ihnen, da die Last schwer war.
»Wir sind da«, rief er auf Spanisch.
Seine Männer wussten, was sie zu tun hatten.
Sie zogen die Schwerter und hieben die Eingeborenen mit raschen Hieben nieder. Zwei krümmten sich stöhnend auf dem Boden, wurden aber mit Schwertstößen in die Brust zum Schweigen gebracht. Das Gemetzel war ihm gleichgültig; die Eingeborenen waren es nicht wert, dieselbe Luft zu atmen wie Europäer. Die kleinen, kupferbraunen Menschen gingen nackt wie am Tag ihrer Geburt. Sie besaßen keine Schriftsprache und kannten keinen glühenden Glauben. Sie lebten in Dörfern am Meer und, soweit er es beobachtet hatte, bestand ihre einzige Leistung darin, ein wenig Ackerbau zu treiben. Ihr Anführer war ein Mann, der Kazike genannt wurde. Während des Jahres, in dem Kolumbus schon hier festsaß, hatte er sich mit ihm angefreundet. Es war der Kazike, der ihm gestern, als er zum letzten Mal an der Nordküste vor Anker gegangen war, sechs Männer zur Verfügung gestellt hatte.
»Ein einfacher Ausflug in die Berge«, hatte er dem Häuptling erklärt. »Nur für ein paar Tage.«
Er beherrschte ihre Sprache, das Arawak, gut genug, um seine Bitte auszudrücken. Der Kazike hatte zu erkennen gegeben, dass er ihn verstand, und auf sechs Männer gezeigt, die die Kisten tragen würden. Kolumbus hatte sich dankbar verneigt und mehrere Falkenglöckchen als Geschenk überreicht. Gott sei Dank hatte er eine größere Menge davon mitgenommen. In Europa banden Falkner sie an die Beine ihrer Vögel. Sie waren praktisch wertlos. Hier aber galten sie als harte Währung.
Der Kazike hatte die Bezahlung angenommen und sich seinerseits verneigt.
Kolumbus hatte schon zweimal ein Geschäft mit diesem Häuptling gemacht. Sie hatten Freundschaft geschlossen. Verstanden sich. Und er nutzte das aus.
Bei seinem ersten Besuch auf der Insel 1494 hatte er für einen Tag Halt gemacht, um lecke Stellen in seinem Schiff abzudichten und die Wasservorräte aufzufüllen. Dabei waren den Männern in den klaren Bächen feine Goldsplitter aufgefallen. Als er den Kaziken danach befragte, erfuhr er von einem Ort, wo die Goldkörnchen größer waren, teilweise so groß wie Bohnen.
Das war der Ort, an dem er jetzt stand.
Aber anders als die ränkevolle spanische Monarchie interessierte Gold ihn nicht.
Seine Ziele lagen höher.
Sein Blick heftete sich auf de Torres, und sein alter Freund wusste, was nun anstand. De Torres richtete sein Schwert gegen einen der drei Spanier, einen untersetzten Mann mit grauem Bart.
»Auf die Knie«, befahl de Torres, während er dem Mann die Waffe abnahm.
Die beiden anderen Mitglieder des Trupps verliehen seiner Forderung mit erhobenen Schwertern Nachdruck.
Der Gefangene kniete sich nieder.
Kolumbus fasste ihn ins Auge. »Hast du mich für so dumm gehalten?«
»Admiral …«
Er gebot ihm mit erhobener Hand zu schweigen. »Vor vier Jahren hat man mich in Ketten nach Spanien zurückgebracht und mir alles genommen, was von Rechts wegen mir gehört. Dann jedoch wurde es mir genauso unvermittelt zurückgegeben.« Er hielt inne. »Mit nichts als ein paar Worten vergaben der König und die Königin mir alles, was ich angeblich getan hatte. Hielten sie mich für so unwissend?« Er stockte erneut. »Ja, allerdings. Und das ist die schlimmste Beleidigung von allen. Jahrelang hatte ich um die nötigen Mittel gebeten, ja geradezu gefleht, um über den Ozean zu segeln. Jahrelang hatte man sie mir verweigert. Doch nun musste ich nur einen einzigen Brief an die Krone schreiben und erhielt umgehend das Geld für die vierte Reise. Eine einzige Bitte, und alles wurde gewährt. Da wusste ich, dass etwas faul war.«
Der Gefangene wurde noch immer von den Schwertern in Schach gehalten; er konnte unmöglich fliehen.
»Du bist ein Spion«, sagte Kolumbus. »Du wurdest hierhergeschickt, um der Krone Bericht zu erstatten, was ich tue.«
Der Anblick dieses Dummkopfs war ihm zuwider. Der Mann verkörperte den Verrat all dieser spanischen Lügner und das Elend, das er ihretwegen durchlitten hatte.
»Stell die Fragen, deren Antwort deine Gönner wissen wollen«, forderte Kolumbus ihn auf.
Der Mann schwieg.
»Frage, habe ich gesagt.« Kolumbus’ Stimme wurde lauter. »Ich befehle es dir.«
»Wer seid Ihr, um mir etwas zu befehlen?«, erwiderte der Spion. »Ihr seid kein Mann Christi.«
Kolumbus steckte die Beleidigung mit der Geduld ein, die ein hartes Leben ihn gelehrt hatte. Aber er sah, dass seine Gefolgsleute nicht so versöhnlich waren.
Er zeigte auf sie. »Diese Männer gehören ebenfalls nicht Christus an.«
Der Gefangene spie auf den Boden.
»Lautete dein Auftrag, über alles zu berichten, was auf der Reise geschah? Ging es um diese Kisten, die wir heute hier haben? Oder waren deine Auftraggeber einfach nur hinter Gold her?«
»Ihr wart nicht aufrichtig.«
Kolumbus lachte. »Ich soll nicht aufrichtig gewesen sein?«
»Die Heilige Mutter Kirche wird Eure ewige Verdammnis in den Feuern der Hölle sehen.«
Da begriff er. Dies war ein Spion der Inquisition.
Der schlimmsten aller Feinde.
Schierer Selbsterhaltungstrieb loderte in ihm auf. Er bemerkte die Sorge in de Torres’ Blick. Das Problem war ihm seit seinem Aufbruch vor zwei Jahren aus Spanien bewusst. Aber gab es noch mehr Augen und Ohren? Die Inquisitoren hatten bereits Tausende von Menschen verbrennen lassen. Er hasste alles, wofür sie standen.
Was er heute hier zu Ende brachte, hatte allein das Ziel, diesem Übel entgegenzuwirken.
De Torres hatte ihm bereits mitgeteilt, dass er nicht das Risiko eingehen würde, sich von irgendwelchen spanischen Inquisitoren aufspüren zu lassen. Nein, er würde nicht nach Europa zurückkehren. Er beabsichtigte, sich auf Kuba niederzulassen, einer bedeutend größeren Insel im Norden. Die beiden Männer, die an seiner Seite ihr Schwert gezückt hielten, waren jünger und ehrgeiziger. Sie hatten ebenfalls die Entscheidung getroffen hierzubleiben. Auch Kolumbus würde es am besten so halten, aber hier war nicht sein Platz, was auch immer er sich wünschen mochte.
Er starrte wütend auf den Knienden nieder.
»Die Engländer und Niederländer nennen mich Columbus. Die Franzosen Colomb. Die Portugiesen Colombo. Die Spanier kennen mich als Colón. Aber keines davon ist der Name, mit dem ich zur Welt kam. Leider wirst du meinen wahren Namen niemals erfahren, und du wirst deinen Gönnern, die dich in Spanien erwarten, nie Bericht erstatten.«
Er winkte, und de Torres stieß dem Mann das Schwert in die Brust.
Der Gefangene hatte keine Zeit zu reagieren.
Die Klinge wurde mit einem widerlichen Geräusch aus dem Fleisch gerissen, und die Leiche kippte auf den Knien nach vorn und fiel mit dem Gesicht auf die Erde.
Eine Blutlache breitete sich um sie aus.
Kolumbus spuckte auf die Leiche, die anderen taten es ihm nach.
Er hoffte, dass dies der letzte Mann sein würde, den er sterben sah. Er war des Tötens müde. Da er in Kürze auf sein Schiff zurückkehren und dieses Land für immer verlassen würde, hatte er die Reaktion des Kaziken auf den Mord an den sechs Eingeborenen nicht zu fürchten. Andere würden den Preis bezahlen, aber das war nicht seine Sorge. Sie waren alle Feinde, und er wünschte ihnen nur Schlechtes.
Er drehte sich um und betrachtete nun endlich seine Umgebung. Jedes Detail war wie beschrieben.
»Siehst du, Admiral«, sagte de Torres. »Es ist, als hätte Gott selbst uns hierhergeführt.«
Sein alter Freund hatte recht.
Es wirkte wirklich so.
Sei mutig wie ein Leopard, leicht wie ein Adler, schnell wie ein Reh und stark wie ein Löwe bei der Erfüllung des Willens deines Vaters im Himmel.
Weise Worte.
»Kommt«, sagte er zu den anderen. »Lasst uns beten, dass das Geheimnis dieses Tages lange verborgen bleibt.«
GEGENWART
1
Tom Sagan packte die Waffe fester. Er hatte seit einem Jahr über diesen Augenblick nachgedacht und Für und Wider abgewägt, nun aber entschieden, dass ein Punkt gewichtiger war als alle anderen.
Er wollte einfach nicht mehr länger leben.
Früher hatte er einmal als investigativer Journalist für die LOS ANGELES TIMES gearbeitet und ein sechsstelliges Gehalt bezogen. Artikel mit seinem weithin bekannten Verfassernamen hatten regelmäßig auf der ersten Seite gestanden. Er hatte in allen Teilen der Welt recherchiert – in Sarajewo, Peking, Johannesburg, Belgrad und Moskau. Zu seinem Spezialgebiet entwickelte sich aber Nahost, eine Gegend, mit der er irgendwann eng vertraut war. Hier hatte er seinen Ruf begründet. Seine vertraulichen Akten waren einmal mit den Aussagen Hunderter williger Informanten gefüllt gewesen, Menschen, die wussten, dass er sie um jeden Preis schützen würde. Das hatte er bewiesen, als er elf Tage in einem Washingtoner Knast absitzen musste, weil er den Informanten einer Story über einen korrupten pennsylvanischen Kongressabgeordneten nicht nennen wollte.
Der Abgeordnete war ins Gefängnis gewandert.
Und Tom hatte seine dritte Nominierung für den Pulitzer-Preis erhalten.
Einundzwanzig Kategorien wurden ausgezeichnet. Eine davon war »eine herausragende Arbeit des investigativen Journalismus. Der Preis geht an einen einzelnen Autor oder eine Autorengruppe für einen einzelnen Artikel oder eine Artikelserie.« Die Gewinner erhielten eine Urkunde sowie zehntausend Dollar und durften fortan die Worte Träger des Pulitzer-Preises hinter ihren Namen stellen.
Er hatte ihn erhalten.
Aber dann war er ihm wieder aberkannt worden.
Das schien die Geschichte seines Lebens zu sein.
Alles war ihm wieder weggenommen worden.
Seine Karriere, sein Ruf, seine Glaubwürdigkeit und sogar seine Selbstachtung. Am Ende war er als Sohn, Vater, Ehemann, Reporter und Freund gescheitert. Vor ein paar Wochen hatte er diese Abwärtsspirale auf einem Blatt Papier festgehalten und festgestellt, dass alles begonnen hatte, als er fünfundzwanzig war. Damals hatte er gerade als Drittbester seines Jahrgangs die Fachrichtung Journalismus an der University of Florida abgeschlossen.
Dann hatte ihn sein Vater verstoßen.
Abiram Sagan war unerbittlich gewesen.
»Wir alle treffen Entscheidungen. Gute. Schlechte. Neutrale. Du bist erwachsen, Tom, und hast deine getroffen. Und jetzt bin ich mit Entscheiden an der Reihe.«
Und er hatte entschieden.
Auf demselben Blatt hatte Tom Höhe- und Tiefpunkte seines Lebens notiert. Manche lagen vor diesem Zeitpunkt. Er war Redakteur seiner Highschool-Zeitung gewesen und im College Campus-Reporter. Doch die meisten Entwicklungen kamen erst danach. Sein Aufstieg vom Volontär zum fest angestellten Reporter und dann zum bedeutenden internationalen Korrespondenten. Die Preise und Auszeichnungen. Die Hochachtung seiner Kollegen. Wie hatte ein Beobachter seinen Stil beschrieben? »Umfassende, weitblickende Berichterstattung unter großem persönlichem Risiko.«
Dann kam seine Scheidung.
Die Entfremdung von seinem einzigen Kind. Falsche Investitionsentscheidungen. Und sogar noch falschere Lebensentscheidungen.
Schließlich war er entlassen worden.
Vor acht Jahren.
Und seitdem war sein Leben kein Leben mehr.
Die meisten seiner Freunde hatte er verloren, aber das konnte ebenso sehr seine Schuld sein wie die ihre. Er war in eine immer tiefere Depression abgeglitten und hatte sich in sich selbst zurückgezogen. Erstaunlich, dass er nicht zu Alkohol oder Drogen gegriffen hatte, aber beides hatte nie einen Reiz für ihn gehabt.
Er berauschte sich lieber an Selbstmitleid.
Er blickte sich im Inneren des Hauses um.
Er hatte beschlossen, hier zu sterben, im Haus seiner Eltern. Auf eine makabre Weise war das passend. Dicke Staubschichten und ein modriger Geruch riefen ihm in Erinnerung, dass die Räumlichkeiten seit drei Jahren unbewohnt waren. Er hatte Strom, Gas und Wasser angemeldet gelassen, die geringe Grundsteuer bezahlt und den Rasen gerade oft genug mähen lassen, dass die Nachbarn nicht meckerten. Vorhin war ihm aufgefallen, dass der ausladende Maulbeerbaum vor dem Haus gestutzt und der Zaun gestrichen werden musste.
Er fand es grässlich hier. Zu viele Geister der Vergangenheit.
Er ging durch die Räume und erinnerte sich an glücklichere Tage. In der Küche fiel sein Blick auf leere Marmeladengläser. Früher hatten sie gefüllt in einer Reihe auf dem Fensterbrett gestanden. Bei dem Gedanken an seine Mutter stieg eine Welle ungewöhnlicher Freude in ihm auf, die allerdings rasch wieder verebbte.
Er sollte einen Abschiedsbrief mit einer Erklärung schreiben, jemandem oder etwas die Schuld geben. Aber wem? Oder was? Keiner würde ihm glauben, wenn er die Wahrheit berichtete. Leider konnte er genau wie vor acht Jahren niemandem die Schuld geben außer sich selbst.
Würde er irgendjemandem fehlen?
Gewiss nicht seiner Tochter. Mit der hatte er seit zwei Jahren kein Wort mehr gesprochen. Seiner Literaturagentin? Vielleicht. Sie hatte mit ihm als Ghostwriter eine Menge Geld verdient. Zu seiner Bestürzung hatte er festgestellt, dass viele sogenannte Bestsellerautoren kein Wort schreiben konnten. Was hatte ein Kritiker zur Zeit seines Niedergangs einmal geäußert? »Dem Journalisten Sagan scheint eine vielversprechende Karriere als Romanautor beschieden.«
Das Arschloch.
Aber er hatte den Rat tatsächlich angenommen.
Wie man es wohl erklärte, wenn man sich das Leben nahm? Selbstmord ist definitionsgemäß ein irrationaler Akt. Und für so etwas gibt es definitionsgemäß keine Erklärung. Hoffentlich würde man ihn begraben. Er hatte viel Geld auf der Bank liegen, mehr als genug für eine anständige Bestattung.
Wie es wohl wäre, tot zu sein?
War einem dann noch etwas bewusst? Konnte man hören? Sehen? Riechen? Oder war es einfach nur ein Meer aus Schwärze? Keine Gedanken. Keine Gefühle.
Gar nichts.
Er kehrte in den vorderen Bereich des Hauses zurück.
Draußen war ein wunderschöner Märztag, die Sonne strahlte hell. Florida hatte wirklich tolles Wetter. Genau wie Kalifornien, wo er vor seiner Entlassung gelebt hatte – und hier gab es außerdem keine Erdbeben. Das Gefühl der warmen Sonne an einem schönen Sommertag würde ihm fehlen.
Er blieb im offenen Türbogen stehen und schaute in den Salon. Diesen Raum hatte seine Mutter immer das Zimmer genannt. Hier waren seine Eltern am Sabbat zusammengekommen. Abiram hatte aus der Thora vorgelesen. Hier hatten sie Jom Kippur und andere Feiertage begangen. Er erinnerte sich an den Anblick der zinnenen Menora, die hinten auf dem Tisch gebrannt hatte. Seine Eltern waren fromme Juden gewesen. Nach seiner Bar-Mizwa hatte auch er zuerst die Thora studiert. Er hatte vor den Sprossenfenstern mit den zwölf Feldern gestanden. Damastvorhänge, die seine Mutter in monatelanger Arbeit genäht hatte, hatten sie eingefasst. Sie war sehr geschickt gewesen, eine wunderbare Frau, von allen geliebt. Er vermisste sie. Sie war sechs Jahre vor Abiram gestorben, der nun seit drei Jahren tot war.
Es wurde Zeit, dem hier ein Ende zu setzen.
Er betrachtete die Waffe, eine Pistole, die er vor ein paar Monaten auf einer Waffenmesse in Orlando gekauft hatte, und setzte sich aufs Sofa. Staubwolken stiegen auf und sanken wieder nieder. Er erinnerte sich an Abirams Lektion über die Vögel und die Bienen, die er einmal hier an diesem Platz erhalten hatte. Wie alt war er damals gewesen? Zwölf vielleicht?
Also vor achtunddreißig Jahren?
Es kam ihm vor wie letzte Woche.
Wie üblich war es eine wenig präzise und knappe Erläuterung gewesen.
»Verstehst du?«, hatte Abiram ihn gefragt. »Das ist nämlich wichtig.«
»Ich mag Mädchen nicht.«
»Das wirst du aber einmal. Vergiss also nicht, was ich dir gesagt habe.«
Frauen. Noch so etwas, wo er versagt hatte. Als junger Mann hatte er nur wenige Beziehungen gehabt und dann Michele geheiratet, die erste Frau, die sich ernstlich für ihn interessiert hatte. Aber die Ehe war nach seiner Entlassung gescheitert, und seit damals hatte er nichts mehr mit einer Frau gehabt. Michele hatte ihren Tribut gefordert.
»Vielleicht werde ich auch sie bald wiedersehen«, brummte er.
Seine Exfrau war vor zwei Jahren bei einem Autounfall gestorben.
Das war die letzte Gelegenheit, bei der er mit seiner Tochter gesprochen hatte. Ihre Worte waren laut und deutlich gewesen.»Verschwinde. Sie würde nicht wollen, dass du dabei bist.«
Da hatte er die Trauerfeier auf dem Friedhof verlassen.
Den Finger am Abzug, schaute er wieder auf die Waffe. Er nahm seinen Mut zusammen, holte tief Luft und führte die Mündung an die Schläfe. Wie fast alle Sagans, so war auch er Linkshänder. Sein Onkel, früher einmal Baseball-Profi, hatte ihm als Kind gesagt, wenn es ihm gelänge, einen Ball mit Drall zu werfen, könne er in der Ersten Liga ein Vermögen verdienen. Talentierte Linkshänder seien selten.
Aber auch im Sport war er ein Versager gewesen.
Das Metall berührte seine Haut.
Die Mündung drückte gegen seine Schläfe.
Er schloss die Augen, legte den Finger fest auf den Abzug und stellte sich vor, wie sein Nachruf beginnen würde: Dienstag, den 5. März, hat der ehemalige investigative Journalist Tom Sagan sich im Haus seiner Eltern in Mount Dora, Florida, das Leben genommen.
Wenn er nur ein wenig fester drückte, würde …
Es klopfte.
Er schlug die Augen auf.
Ein Mann stand vor dem Fenster, so dicht bei der Scheibe, dass Tom sein Gesicht erkennen konnte – es war älter als sein eigenes, klar gezeichnet und wirkte distinguiert. Außerdem sah er die rechte Hand des Mannes.
Diese drückte ein Foto gegen die Scheibe.
Er erkannte das Bild einer jungen Frau, die mit ausgestreckten Armen und Beinen auf dem Rücken lag.
Als wäre sie gefesselt.
Er kannte das Gesicht.
Es war das seiner Tochter Ali.
2
Ali Becket lag auf dem Bett, mit Armen und Beinen ans Geländer gefesselt. Ihr Mund war mit einem Stück Isolierband zugeklebt, so dass sie gezwungen war, hastig durch die Nase zu atmen. Der kleine Raum war dunkel und entmutigte sie zusätzlich.
Beruhige dich, ermahnte sie sich.
Ihre Gedanken wanderten zu ihrem Vater.
Thomas Peter Sagan.
Sie hatten unterschiedliche Nachnamen. Das hatte sie einer Ehe zu verdanken, mit der sie es vor drei Jahren unmittelbar nach dem Tod ihres Großvaters Abiram versucht hatte. Eine miserable Idee, insbesondere da ihr frischgebackener Ehemann der Meinung war, der Ring an seinem Finger gebe ihm freie Verfügung über ihre Kreditkarten. Die Ehe hatte neunzig Tage gehalten. Die Scheidung dauerte dann noch mal dreißig Tage. Die Schulden hatte sie erst nach zwei Jahren abbezahlt.
Aber sie hatte sie bezahlt.
Ihre Mutter hatte sie gelehrt, dass Zahlungsrückstände nicht gut waren. Sie gab sich gerne dem Gedanken hin, dass ihre Mutter ihr eine gewisse Persönlichkeit mitgegeben hatte. Falls sie Charakter hatte, kam der gewiss nicht von ihrem Vater. Sie hatte nur schreckliche Erinnerungen an ihn. Fünfundzwanzig war sie jetzt und konnte sich nicht erinnern, dass er ihr auch nur ein einziges Mal gesagt hatte, dass er sie liebhatte.
»Warum hast du ihn überhaupt geheiratet?«
»Wir waren jung, Ali, und verliebt. Wir hatten gemeinsam viele gute Jahre, bevor die schlechten kamen. Es war eine sichere Existenz.«
Erst seit ihrer eigenen Ehe begriff sie den Wert der Sicherheit. Absolutes Chaos war eine bessere Beschreibung dieser kurzen Verbindung. Das Einzige, was sie mitnahm, war ihr neuer Nachname, denn alles war besser als Sagan. Sagan war ihr wirklich zuwider. Wenn sie sich schon an ein Scheitern erinnern lassen musste, dann lieber durch den Exmann, der gelegentlich – insbesondere während der sechs Tage auf den Turks- und Caicoinseln – doch auch bleibende Eindrücke hinterlassen hatte.
Sie prüfte die Fesseln um ihre Arme. Ihre Muskeln taten weh. Sie entspannte sie und suchte eine bequemere Haltung. Das offene Fenster ließ kühle Luft ein, aber der Schweiß stand ihr auf der Stirn, und ihr T-Shirt klebte feucht auf der nackten Matratze. Die wenigen Gerüche, die sie wahrnehmen konnte, waren nicht angenehm, und sie fragte sich, wer vor ihr auf dem Bett gelegen haben mochte.
Sie verabscheute das Gefühl der Hilflosigkeit, das ihre missliche Lage in ihr weckte. Daher zwang sie sich, erneut an ihre Mutter zu denken, eine warmherzige Frau, die ihre Tochter innig geliebt hatte. Sie hatte dafür gesorgt, dass Alis Noten gut genug für die Aufnahme in die Brown University gewesen waren, wo sie auch den Master gemacht hatte. Historische Studien waren immer ihre Leidenschaft gewesen, insbesondere das Amerika nach Kolumbus, und zwar die Zeit zwischen 1492 und 1800, in der Europa sich der Neuen Welt aufgepfropft hatte.
Auch beziehungsmäßig hatte ihre Mutter hervorragend die Kurve gekriegt, sich von den Verletzungen ihrer Scheidung erholt und einen neuen Mann gefunden. Der war orthopädischer Chirurg gewesen, ein warmherziger Mensch, der sie beide geliebt hatte, ganz anders als ihr Vater.
Diese Ehe war ein Erfolg gewesen.
Doch vor zwei Jahren hatte ein verantwortungsloser Kerl, dem sie längst den Führerschein abgenommen hatten, ein Stoppschild überfahren und das Leben ihrer Mutter beendet.
Ali vermisste sie schrecklich.
Die Beerdigung blieb ihr lebhaft in Erinnerung, da ihr Vater damals unerwartet aufgetaucht war.
»Verschwinde. Sie würde nicht wollen, dass du dabei bist«, hatte sie so laut gesagt, dass alle Trauergäste es hören konnten.
»Ich wollte mich verabschieden.«
»Das hast du schon vor langer Zeit getan, als du uns beide abgeschrieben hast.«
»Du hast doch gar keine Ahnung, was ich getan habe.«
»Man hat nur eine Gelegenheit, sein Kind großzuziehen. Ehemann zu sein. Und Vater. Du hast deine vermasselt. Hau ab.«
Sie dachte an sein Gesicht. Die ausdruckslose Miene, die praktisch nicht erkennen ließ, was dahinter vorging. Als Jugendliche hatte sie sich immer gefragt, was er dachte.
Das war vorbei. Was spielte es schon für eine Rolle?
Sie zerrte an ihren Fesseln.
Wie auch immer, es mochte sich jetzt in der Tat als sehr wichtig erweisen.
3
Béne Rowe lauschte auf das Anschlagen seiner Hunde, preisgekrönte Bluthunde aus teurer Zucht. Vor dreihundert Jahren wurde die Rasse zum ersten Mal aus Kuba nach Jamaika importiert, und ursprünglich war sie von Kolumbus über den Atlantik gebracht worden. Eine berühmte Geschichte wusste zu berichten, dass die riesigen Tiere während Ferdinands und Isabellas Rückeroberung Grenadas von den Mauren arabische Kinder zerrissen hatten, die vor den Türen von Moscheen ausgesetzt worden waren. Das war angeblich kaum einen Monat vor der Abreise des verdammten Kolumbus nach Amerika geschehen.
Durch die sich alles verändert hatte.
»De Hunde sind nah dran«, sagte er zu seinen Begleitern, beide vertrauenswürdige Unterchefs. »Verdammt nah. Achtet auf das Bellen. Es wird schneller.« Er ließ ein Lächeln aufblitzen, mit blendend weißen Zähnen, für die er eine Menge Geld ausgegeben hatte. »Se mögen es, wenn es aufs Ende zugeht.«
Er vermischte sein Englisch mit Patois, da er wusste, dass seine Männer sich mit dem hier gebräuchlichen Dialekt wohler fühlten – einem Kauderwelsch aus Englisch, afrikanischen Sprachen und Arawak. Er zog richtiges Englisch vor, eine Gewohnheit, die ihm während seiner Schulzeit in Fleisch und Blut übergegangen war. Zudem hatte seine Mutter darauf bestanden. Das war ein bisschen ungewöhnlich für sie beide, da sie im Allgemeinen an Traditionen festhielten.
Seine beiden Leute waren mit Gewehren bewaffnet. Sie marschierten mit ihm ins jamaikanische Hochland hinauf, zu den Sierras de Bastidas – den befestigten Bergen, wie die Spanier sie genannt hatten. Seine Vorfahren, entlaufene Sklaven, hatten sich in den Bergen wie in einer Festung vor ihren ehemaligen Herren verschanzt. Sie hatten sich Katawud, Yenkunkun oder Chankofi genannt. Angeblich hatten die Spanier diese Flüchtlinge als cimarrons – Ungezähmte, Wilde – oder marrans bezeichnet, was Schweinejäger bedeutet. Andere hielten das französische Wort marron für den Ursprung, das »entlaufener Sklave« heißt. Wo auch immer das Wort nun aber herkam, die Engländer machten schließlich Maroons daraus.
Und das blieb hängen.
Diese fleißigen Menschen errichteten Städte, die nach ihren Gründern benannt wurden – Trelawny, Accompong, Scott’s Hall, Moore und Charles. Sie heirateten eingeborene Taino-Frauen und bahnten Pfade durch die jungfräuliche Wildnis. Sie kämpften gegen Piraten, die Jamaika regelmäßig überfielen.
Die Berge wurden ihr Zuhause und die Wälder ihre Verbündeten.
»Ich höre Big Nanny«, sagte er. »Dieses helle Jaulen. Das ist sie. Sie is’ eine Anführerin. Seit je.«
Er hatte sie nach Grandy Nanny benannt, einem weiblichen Oberhaupt der Maroons im 18. Jahrhundert. Sie war eine bedeutende spirituelle und militärische Führerpersönlichkeit gewesen. Ihr Porträt zierte inzwischen den jamaikanischen Fünfhundert-Dollar-Schein. Allerdings war das Bild reine Fantasie. Es gab keine exakte Beschreibung von ihr und kein Gemälde – nur Legenden.
Er stellte sich die Szene vor, die sich jetzt in einem halben Kilometer Entfernung abspielen musste. Die roten und lohfarbenen Hunde – riesig wie Mastiffs, flink wie Bluthunde und mutig wie Bulldoggen – liefen gewiss mit gesträubtem Fell zu viert hinter Big Nanny her. Sie ließ niemals zu, dass einer der Rüden sie überholte, und genau wie einstmals ihre Namensgeberin forderte keiner sie heraus. Einem Hund, der es einmal versucht hatte, hatte sie mit ihren mächtigen Kiefern das Genick gebrochen.
Er blieb am Rand eines hohen Grats stehen und blickte auf die fernen, baumbewachsenen Berge hinaus. Der häufigste Baum war der Blue Mahoe, dazu kamen der Wasserapfel, Mahagoni, Teak, Schraubenbäume und dichte Bambusdickichte. Er erblickte einen Feigenbaum, ein zähes, eigensinniges Gewächs, und erinnerte sich an das, was seine Mutter ihn gelehrt hatte. »Die Feige herrscht. Sie sagt denen, die sie herausfordern: ›Mein Wille zur Macht beruht auf eurem Willen, euch zu unterwerfen.‹«
Er bewunderte eine solche Stärke.
An einem der Berghänge entdeckte er eine Gruppe von Arbeitern. Sie standen in einer Reihe und schwangen Hacken, die in der Sonne blitzten. Er stellte sich vor, er wäre dreihundert Jahre früher hier gewesen, als einer der von Kolumbus fälschlich Indianer genannten Eingeborenen, und hätte hier als Sklave für die Spanier geschuftet. Oder hundert Jahre später der afrikanische Ersatz, der sein ganzes Leben lang einem englischen Plantagenbesitzer gehörte.
Von daher stammten die Maroons – sie waren Mischlinge aus den eingeborenen Taino und den eingeführten Afrikanern.
Leute wie er selbst.
»Du will zu ihnen gehen?«, fragte ihn seine Rechte Hand.
Er wusste, dass seine Leute die Hunde fürchteten. Aber sie hassten auch die Drogen-Dons. Jamaika war von kriminellen Banden ausgepowert. Der Don, der gerade in einem halben Kilometer Entfernung von einer Meute kubanischer Bluthunde gehetzt wurde, meinte, über den Gesetzen zu stehen. Seine bewaffneten Gefolgsleute hatten Kingston in ein Kriegsgebiet verwandelt. Mehrere Unschuldige waren in Kreuzfeuern ums Leben gekommen. Es war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, als ein öffentliches Krankenhaus und eine Schule unter Beschuss gerieten. Patienten waren gezwungen gewesen, sich unter ihre Betten zu flüchten, und Schüler hatten Prüfungen abgelegt, während draußen die Kugeln pfiffen. Daher hatte er den Don mit einem Treffen geködert – keiner entzog sich, wenn Béne Rowe rief – und ihn dann in die Berge gebracht.
»A wa yu a say?«, was sagst du, fragte der unverschämte Don auf Patois.
»Sprich Englisch.«
»Schämst du dich deiner selbst, Béne?«
»Ich schäme mich für dich.«
»Was hast du vor? Willst du mich zu Tode hetzen?«
»A no mi.« Nicht ich.
Er wechselte absichtlich ins Patois, um diesem Mann zu zeigen, dass er seine eigene Herkunft nicht verleugnete. Er deutete auf die Hunde, die oben in den Pick-ups in ihren Käfigen bellten. »Se werden des für mich machen.«
»Und was wirst du tun? Mich töten?«
Er schüttelte den Kopf. »Des werden auch de Hunde machen.«
Lächelnd dachte er daran, wie sich die Augen des Drecksacks geweitet hatten. Schön, dass jemand, der aus dem kleinsten Anlass, wenn nicht sogar ganz ohne Grund, mordete, tatsächlich Angst kannte.
»Du bist keiner von uns«, spie der Don hervor. »Du hast vergessen, wer du bist, Béne.«
Rowe trat näher und blieb nur Zentimeter vor dem Mann stehen. Der trug ein offenes Seidenhemd, maßgeschneiderte Hosen und teure Slipper. Diese Kleidung sollte wohl Eindruck schinden, aber an diesem Dummkopf war nur wenig eindrucksvoll. Er war dünn wie ein Zuckerrohrhalm, das eine Auge war trübe, und er hatte einen Mund voll schlechter Zähne.
»Du bist ein Nichts«, sagte Rowe.
»Immerhin hältst du mich für so wichtig, dass du mich sterben sehen willst.«
Rowe lachte. »Stimmt. Und wenn ich Achtung vor dir hätte, würde ich dich erschießen. Aber du bist wie ein Tier, und die Hunde werden dich mit Freuden hetzen.«
»Hat die Regierung dich dafür bezahlt, Béne? Die schafft es nicht, also überredet sie dich dazu?«
»Ich tue es um meiner selbst willen.«
Die Polizei hatte schon zweimal versucht, den üblen Kerl festzunehmen, aber beide Male war in Kingston eine Rebellion ausgebrochen. Traurig, dass Verbrecher zu Helden geworden waren, aber die Dons waren klug. Die jamaikanische Regierung kümmerte sich nicht um ihre Bürger, und die Dons waren in die Bresche gesprungen, hatten Essen verteilt, Gemeindezentren gebaut und Ärzte bezuschusst. So hatten sie sich eingeschmeichelt.
Und es hatte funktioniert.
Die Leute waren zum Aufstand bereit, damit ihre Wohltäter nicht ins Gefängnis kamen.
»Du hast dreißig Minuten, bevor ich die Käfige aufmache.«
Der Mann hatte noch einen Augenblick verharrt, dann aber begriffen, dass Rowe es ernst meinte, und war geflohen.
Wie ein Sklave, der seinem Herrn entläuft.
Rowe sog die klare Morgenluft in seine Lunge. Ringe blauen Nebels, dick wie Milch, hatten sich in der Ferne um die Gipfel gesammelt. Drei waren zweitausend Meter hoch, einer annähernd zweitausendfünfhundert. Die Bergkette zog sich von Osten nach Westen und riegelte Kingston von der Nordküste ab. So auffällig waren die blauen Nebelkränze, dass die Engländer das Gebirge die Blue Mountains genannt hatten.
Seine beiden Leute standen neben ihm, das Gewehr über die Schulter gelegt.
»Da ist noch dieses andere Problem«, sagte er, den Blick nach vorn gerichtet. »Wird er kommen?«
»Er ist auf’m Weg. Sie warten bei’n Pick-ups, bis wir so weit sind.«
Über viele Kilometer gehörte das Land in allen Himmelsrichtungen ihm. Die meisten Maroons bestellten nur eine kleine Fläche, die eigentlich jemand anderem gehörte, und bezahlten dafür eine jährliche Pacht. Er aber hatte Tausende von Hektar in seinem Besitz und überließ ihnen die Nutzung umsonst.
In der Ferne bellten die Hunde noch immer.
Er schaute auf seine Armbanduhr.
»Big Nanny nähert sich ihrer Beute. Sie lässt die Gejagten selten länger als eine Stunde davonlaufen.«
Seine gut ausgebildeten Hunde waren grimmig, langbeinig und verfügten über eine verblüffende Ausdauer und Kraft. Außerdem konnten sie Bäume erklimmen. Das würde das heutige Opfer bald feststellen, sollte es dummerweise glauben, ein Ast hoch oben in einem Baum würde ihm Sicherheit bieten.
Die kubanischen Bluthunde waren schon vor langer Zeit nur zu einem einzigen Zweck gezüchtet worden: um entflohene Schwarze zu jagen.
Die seinen waren fortschrittlicher und hetzten sowohl Schwarze als auch Weiße. Aber wie ihre Vorfahren töteten sie nur, wenn ihre Beute sich wehrte. Ansonsten stellten sie das Opfer und hielten es mit Bellen und gefletschten Zähnen in Schach, bis ihr Herr eintraf.
»Wir gehen jetzt zu ihnen«, sagte er.
Er führte seine Leute in den Wald. Es gab keinen Pfad, nur dichte, üppige Vegetation. Einer seiner Männer holte eine Machet hervor und hackte den Weg frei. Bei diesem Wort kehrte er immer zum Patois zurück und ließ hinten das e weg. Merkwürdig, wie ihm manche Dinge einfach unwillkürlich unterliefen.
Ein Windstoß fuhr fauchend durch die Zweige.
Wie leicht es wäre, sich zwischen Farn und Orchideen zu verstecken. Kein Mensch würde einen jemals finden. Und deshalb hatten die Briten schließlich die Hunde importiert, um die Entflohenen zu jagen.
Eine wirklich gute Nase spürte letztlich alles auf.
Sie drangen weiter in Richtung der Hunde vor. Sein Mann mit der Machet ging voran und hackte auf das Blätterdickicht ein. Schmale Splitter gleißenden Sonnenlichts fielen auf die Erde nieder.
»Béne«, rief sein anderer Mann.
Ein dicker Blätterteppich federte jeden Schritt ab, und so konnte man auch die Singvögel hören. Felsen und Steine unter dem Mulch gruben sich in seine Sohlen, doch er hatte feste Stiefel angezogen. Er kämpfte sich unter den tief hängenden Ästen hindurch und kam zu seinen Männern, die auf einer kleinen Lichtung standen. Ein rosenfarbener Ibis schwang sich mit klatschenden Flügelschlägen aus einem der Bäume gegenüber in die Luft. Unter einem Schutzdach hoher Äste war der Boden mit Orchideen bewachsen.
Er entdeckte zwischen den Farnen Trümmerstücke auf der Erde.
Seine Hunde begannen zu heulen.
Zum Zeichen ihres Erfolgs.
Sie hatten ihre Beute gestellt.
Er trat näher und bückte sich, um die Steine zu untersuchen. Manche waren größer und in den Boden eingelassen, andere waren nur Bruchstücke. Alles war mit Flechten und Moos bewachsen, aber trotzdem sah man darunter noch die schwachen Umrisse von Buchstaben.
Er erkannte die Schrift.
Hebräisch.
»Hier sind noch mehr davon«, sagten seine Männer, die suchend herumgingen.
Er blieb stehen, denn er wusste, was sie gefunden hatten.
Grabsteine.
Ein Friedhof, von dessen Existenz sie gewusst hatten.
Er lächelte. »Ach, was für ein guter Tag, meine Freunde. Ein guter Tag. Wir sind auf einen Schatz gestoßen.«
Er dachte an Zachariah Simon und wusste, dass der sich freuen würde.
4
Zachariah Simon trat ins Haus. Tom Sagan wartete ab, noch immer die Pistole in der Hand. Zachariah erinnerte sich aus dem Hintergrundbericht, den er in Auftrag gegeben hatte, dass dieser Mann Linkshänder war.
»Wer sind Sie?«, fragte Tom.
Simon stellte sich vor und streckte die Hand aus, aber Tom ergriff sie nicht. Vielmehr fragte er: »Was wollen Sie hier?«
»Ich beobachte Sie schon seit mehreren Tagen.« Zachariah zeigte auf die Pistole. »Vielleicht ist es gut, dass ich gekommen bin.«
»Dieses Foto. Das ist meine Tochter.«
Simon hielt das Foto so, dass sie beide es sehen konnten. »Sie ist meine Gefangene.« Er wartete auf eine Reaktion. Als keine kam, fragte er: »Ist Ihnen das egal?«
»Natürlich nicht. Und ich bin bewaffnet.«
Tom schwenkte drohend die Pistole, und Zachariah maß seinen Gegner mit einem prüfenden Blick. Tom war hochgewachsen und hatte ein jungenhaftes, unrasiertes Gesicht. Seine dunklen Augen, die flink und wachsam wirkten, machten es hart. Um das kurze, schwarze Haar beneidete Zachariah ihn, denn seine eigene Haarpracht war längst verschwunden. Arme und Brust ließen keine Fitnessbemühungen erkennen, und auch das hatte der Bericht knapp angemerkt: »joggt nicht und macht keine Bauchübungen«. Trotzdem wirkte Tom Sagan für einen Fünfzigjährigen, der viel saß, bemerkenswert gut in Form.
»Mr. Sagan, es gibt etwas, das Sie unbedingt verstehen müssen. Es ist ganz entscheidend, dass Sie mir glauben, was ich nun sage.« Er hielt inne. »Es ist mir egal, ob Sie Selbstmord begehen. Sie können mit Ihrem Leben machen, was Sie wollen. Aber ich verlange etwas von Ihnen, bevor Sie sich die Kugel geben.«
Tom richtete die Waffe auf ihn. »Wir gehen jetzt zur Polizei.«
Zachariah zuckte mit den Schultern. »Sie entscheiden selbst. Aber ich muss Ihnen sagen, dass das zu nichts führt, außer dass Ihre Tochter dann unvorstellbare Schmerzen erdulden muss.« Er hielt das Foto von Ali Becket höher, damit Tom es gut sehen konnte. »Sie müssen mir glauben. Wenn Sie nicht tun, was ich von Ihnen verlange, wird Ihre Tochter leiden.«
Tom rührte sich nicht.
»Sie bezweifeln, was ich sage. Das sehe ich Ihren Augen an. So haben Sie vielleicht einmal an Informanten gezweifelt, wenn die Ihnen etwas erzählt haben, was auf eine sagenhafte Story hindeutete. Da mussten Sie sich ständig fragen: Stimmte das? War es geschönt? Oder schlicht und ergreifend gelogen? Wenn man bedenkt, wie es Ihnen schlussendlich ergangen ist, ist es verständlich, wenn Sie jetzt Zweifel an mir haben. Hier bin ich, ein vollkommen Fremder, tauche in einem äußerst ungelegenen Moment auf und behaupte merkwürdige Dinge.«
Er ließ die schwarze Tumi-Reisetasche von seiner Schulter gleiten. Tom zielte weiter auf ihn. Zachariah öffnete die Schließen und holte sein iPad heraus.
»Ich muss Ihnen etwas zeigen. Wenn Sie es gesehen haben und dann immer noch die Polizei informieren wollen, werde ich Sie nicht daran hindern.«
Er legte die Tasche auf den Boden und schaltete das iPad ein.
Licht blendete Alis Augen. Grell. Ein Lichtstrahl, der auf die ans Bett Gefesselte gerichtet war. Sie blinzelte und wartete, bis ihre brennenden Augen sich an das Licht gewöhnt hatten. Dann betrachtete sie den nun erleuchteten Raum.
Eine Kamera, unmittelbar rechts neben dem Scheinwerfer. Sie stand auf einem Stativ, und die Linse war auf sie gerichtet. Ein winziges rotes Lämpchen zeigte an, dass sie lief. Man hatte ihr gesagt, dass ihr Vater sie sehen würde, wenn das der Fall war. Sie zerrte mit Armen und Beinen an ihren Fesseln, hob den Kopf und wendete ihn zur Linse.
Sie hasste es, gefangen zu sein. Der Verlust der Freiheit. Vollständiges Ausgeliefertsein an jemand anderen. Falls ihre Nase juckte, könnte sie sich nicht kratzen. Falls ihre Bluse verrutschte, könnte sie sie nicht geradeziehen. Falls böse Menschen versuchten, ihr etwas Schlimmes anzutun, könnte sie sie nicht daran hindern.
Zwei Männer kamen hinter dem Scheinwerfer hervor und näherten sich dem Bett.
Der eine war hochgewachsen und hatte einen dicken Bauch, eine schmale Nase und gleichfalls schmale Lippen. Er könnte ein Italiener oder Spanier sein, sein geöltes Haar war dunkel und lockig. Sie hatte mitgekriegt, dass er Rócha hieß. Der andere Kerl war der schwärzeste Mensch, den sie je gesehen hatte. Er hatte eine Knollennase, gelbe Zähne und Augen wie zwei Tropfen Rohöl. Er sagte nie etwas, und sie kannte ihn nur unter dem Spitznamen, den Rócha verwendete.
Midnight. Mitternacht.
Beide Männer näherten sich dem Bett, einer auf jeder Seite mit der Kamera und Ali zwischen sich. Rócha beugte sich über sie, bis ganz dicht über ihr Gesicht, und streichelte sanft ihre Wange. Seine Finger rochen nach Zitrusfrüchten. Sie schüttelte protestierend den Kopf, doch er lächelte nur und streichelte sie weiter. Auch Midnight kam zum Bett und begrapschte ihre rechte Brust unter der Bluse.
Ihre Augen glühten vor Angst und Wut.
Rócha drückte ihren Kopf auf die Matratze hinunter.
Ein Messer tauchte in seiner Hand auf, es glänzte im Scheinwerferlicht.
Die Kamera übertrug weiter jeden Augenblick des Übergriffs, das rote Lämpchen zeigte an, dass ihr Vater sie sehen konnte. Seit zwei Jahren hatten sie kein Wort mehr miteinander gewechselt. Wie sie es sah, hatte sie keinen Vater. Ihr Stiefvater war immer für sie da gewesen. Sie nannte ihn Dad, und er nannte sie seine Tochter.
Eine Illusion?
Gewiss.
Aber sie funktionierte.
Rócha trat zum Fußende des Bettes und ergriff ihren linken Schuh. Dann schob er das Messer ins Hosenbein und schnitt den Stoff bis zur Taille auf.
Midnight kicherte.
Sie hob den Kopf und blickte an sich hinunter.
Der Schnitt endete bei ihrer Taille.
Ihre Haut war entblößt.
Rócha steckte die Hand unter den aufgeschnittenen Stoff und schob sie in ihren Schritt. Sie versuchte Widerstand zu leisten, zerrte an ihren Fesseln und schüttelte den Kopf. Er warf Midnight das Messer zu, der die Klinge an ihre Kehle führte und ihr befahl, still zu liegen.
Sie beschloss, der Aufforderung Folge zu leisten.
Doch bevor sie das tat, heftete sie die Augen auf die Kamera, und ihr wilder Blick war nicht zu missdeuten.
Wenigstens ein einziges Mal in deinem jämmerlichen Leben hilf deiner Tochter!
5
Tom starrte auf das iPad, die Panik im Blick seiner Tochter durchbohrte seine Seele.
Er zielte mit der Pistole auf Zachariah Simon.
»Dann wird Ihre Tochter nur umso schneller vergewaltigt«, sagte der Besucher. »Die beiden werden sie fertigmachen, und Sie tragen dann die Schuld daran.«
Tom beobachtete auf dem Bildschirm, wie der Schwarze Alis anderes Hosenbein bis zur Taille aufschlitzte.
»Sie sind arm dran«, sagte Simon zu ihm. »Früher waren Sie einmal ein geachteter Journalist, ein erstklassiger internationaler Reporter. Dann aber haben Sie sich unmöglich gemacht. Sie haben eine Story erfunden. Es gab keine Quellen, und die Dokumentation war rein fiktiv. Kein einziges Wort ließ sich nachweisen, und Sie wurden als Fälscher entlarvt.«
Toms Halsmuskeln spannten sich an. »Jeder kann im Internet surfen.«
Simon gluckste. »Das also denken Sie von mir? Dass ich so oberflächlich bin? Ich versichere Ihnen, Mr. Sagan, ich habe viel Energie darauf verwendet, Sie genau unter die Lupe zu nehmen. Inzwischen sind Sie in die fiktive Branche eingestiegen. Sie arbeiten als Ghostwriter für Romanautoren. Mehrere Ihrer Romane sind Bestseller geworden. Wie fühlt es sich an, wenn jemand anders Ihren Erfolg als seinen eigenen einheimst?«
Auf dem Bildschirm verhöhnten die beiden Männer Ali. Er sah, wie sich ihre Lippen bewegten, auch wenn der Lautsprecher stumm blieb.
Er richtete die Waffe auf Simon, doch der zeigte auf das iPad.
»Sie können mich erschießen. Aber was wird dann aus ihr?«
»Was wollen Sie?«
»Zunächst einmal will ich, dass Sie es ernst nehmen, wenn ich Ihnen sage, dass ich Ihrer Tochter Leid zufügen werde. Glauben Sie mir das?«
Tom hielt mit der Linken weiter die Waffe erhoben, doch sein Blick zuckte zum Bildschirm zurück. Beide Männer erforschten Regionen, die durch die Schlitze in Alis Hose zugänglich geworden waren.
Das musste aufhören.
»Zweitens«, sagte Simon, »verlange ich, dass Sie etwas für mich tun. Danach lasse ich Ihre Tochter frei, und Sie können von mir aus das zu Ende bringen, wobei ich Sie heute Nachmittag hier gestört habe.«
»Was soll ich tun?«, fragte er.
»Ich will, dass die Leiche Ihres Vaters exhumiert wird.«
Der Scheinwerfer erlosch und ebenso das rote Lämpchen an der Kamera. Von dem grellen Lichtstrahl befreit, sank Ali zurück auf die Matratze.
Eine andere Lampe ging an. Sie war weniger hell, ließ aber doch den Raum erkennen.
Rócha saß neben ihr.
Der Schweiß stand ihr auf der Stirn.
Seit zwei Jahren hatte sie zum ersten Mal mit ihrem Vater zu tun gehabt, und nun war es zu Ende.
Rócha schaute auf sie hinunter, er hatte inzwischen wieder das Messer in der Hand. Midnight stand neben der Kamera. Alis Beine waren durch die aufgeschlitzte Hose zu sehen, aber wenigstens befummelten die beiden sie nicht mehr.
»Sollen wir weitermachen?«, fragte Rócha mit einem leichten portugiesischen Akzent.
Sie durchbohrte ihn mit ihrem Blick und verbot es sich, vor Angst zu zittern.
»Wohl besser nicht«, meinte er und lächelte.
Er schnitt die Fesseln an ihren Armen und Beinen auf. Sie setzte sich hoch und riss sich das Klebeband vom Mund, ermahnte sich aber gleichzeitig, vorsichtig mit diesen Männern umzugehen. »War das alles wirklich nötig?«
»Na, dir hat gefallen?«, fragte Rócha, eindeutig stolz auf sich.
Sie hatte die beiden aufgefordert, überzeugend zu agieren, und ihnen sogar vorgeschlagen, ein Messer zu verwenden. Aber sie hatte nie gesagt, dass sie ihre Klamotten aufschneiden und sie betatschen sollten.
Aber was hatte sie erwartet?
Diese Männer waren undiszipliniert und nutzten jede Gelegenheit. Und sie hatte ihnen eine gute Gelegenheit geboten.
Sie stand auf und streifte sich die Fesseln von Handgelenken und Fußknöcheln. Sie wollte einfach nur hier weg. »Ihr habt ihn überzeugt. Wir sind fertig.«
Midnight sagte nichts und wirkte auch nicht sonderlich interessiert. Das tat er nie. Er war ein ruhiger Vertreter und schien nur zu tun, was man ihm auftrug.
Rócha hatte das Sagen.
Zumindest, solang Zachariah weg war.
Sie fragte sich, was wohl in Florida im Haus ihres Großvaters in Mount Dora vor sich ging. Vor weniger als einer Stunde hatte sie einen Anruf Zachariahs erhalten und erfahren, dass ihr Vater von Orlando aus dorthin gefahren war. Es war eine halbstündige Fahrt auf der Interstate 4, und sie hatte sie selbst schon oft gemacht.
Dann hatte Zachariah erneut angerufen.
Ihr Vater habe eine Pistole in der Hand und scheine Selbstmord begehen zu wollen. Einen Augenblick lang hatte sie das bedrückt. Was auch immer zwischen ihnen vorgefallen war, er war immer noch ihr Vater. Aber sobald sie diesem Mann ihr Mitgefühl gezeigt hatte, hatte er ihr nur immer wieder das Herz gebrochen.
Besser, die Mauer zwischen ihnen blieb, wo sie war.
Sie rieb sich die wunden Handgelenke.
Ihre Nerven waren angegriffen.
Sie ertappte beide Männer dabei, wie sie bewundernd auf ihre nackten Beine starrten, die von der aufgeschlitzten Hose nicht mehr richtig bedeckt wurden.
»Lassen Sie uns doch hierbleiben«, sagte Rócha. »Wir können mit der Vorstellung weitermachen. Ohne Kamera.«
»Keine gute Idee«, erwiderte sie. »Für einen Tag war das genug Schauspielerei.«
6
Tom war verblüfft. »Hä? Warum wollen Sie denn die Leiche exhumieren lassen?«
Die Videoübertragung auf dem iPad hatte geendet, der Bildschirm war wieder schwarz.
»Meine Mitarbeiter erwarten einen Anruf von mir. Wenn sie den nicht in den nächsten Minuten erhalten, geht es los, und Ihre Tochter wird richtig leiden. Die Videoübertragung hat dazu gedient, Ihnen die Lage klarzumachen.« Simon zeigte auf die Pistole. »Dürfte ich die haben?«
Tom fragte sich, was wohl passieren würde, wenn er die Sache einfach der Polizei überließe.
Wahrscheinlich so viel wie vor acht Jahren, als er darauf angewiesen gewesen war, dass die Cops ihre Arbeit machten.
Gar nichts würde geschehen, verdammt noch mal.
Er reichte Simon die Waffe.
Interessant, wie eine Niederlage die andere nach sich zog. Damals, als er noch auf der Suche nach der nächsten großen Story durch die Welt zog, hätte er sich von so jemandem niemals einschüchtern lassen. Selbstbewusstsein und Kühnheit waren sein Markenzeichen gewesen.
Aber sie waren auch für seinen Sturz verantwortlich.
Er hatte ganz kurz davorgestanden, seinem Leben ein Ende zu setzen. Dann läge er jetzt mit einem Loch im Schädel auf dem Boden. Stattdessen betrachtete er nun einen äußerst gepflegten Herrn, der wie etwa fünfzig wirkte und silbrig meliertes schwarzes Haar hatte. Sein Gesicht ließ an einen Osteuropäer denken, die hohen Wangenknochen, der rötliche Teint, der Vollbart und die tief liegenden Augen wiesen in diese Richtung. Er kannte den Typ, hatte ihn in jenem Teil der Welt oft genug gesehen. Eine Fähigkeit, die er als Reporter erworben hatte, war das schnelle Einschätzen von Menschen gewesen. Wie sie aussahen. Ihre Gewohnheiten. Ihre Ticks.
Dieser hier lächelte viel.
Nicht, um Belustigung auszudrücken, sondern um seiner Argumentation Nachdruck zu verleihen.
Tom freute sich, dass einige der Fähigkeiten, die er sich in seinem früheren Beruf angeeignet hatte, nun doch wieder zum Vorschein kamen.
Lange Zeit waren sie vollkommen verschüttet gewesen.
»Ihr Vater ist vor drei Jahren gestorben«, sagte Simon. »Bis dahin hat er hier in diesem Haus gelebt. Wussten Sie, dass er ein bedeutender Mann war?«
»Er war Musiklehrer.«
»Und das ist nicht bedeutend?«
»Sie wissen, was ich meine.«
»Ihr Vater war den größten Teil seines Erwachsenenlebens Lehrer. Ihr Großvater mütterlicherseits war allerdings wirklich eine äußerst interessante Persönlichkeit. Er war Archäologe und Anfang des 20. Jahrhunderts an einigen der großen Ausgrabungen in Palästina beteiligt. Ich habe über ihn gelesen.«
Tom ebenfalls. Marc Eden Cross, den er Saki genannt hatte, hatte viele Ausgrabungen geleitet. Tom erinnerte sich, wie Saki ihm als Kind davon erzählt hatte. Besonders aufregend waren die Geschichten eigentlich nicht gewesen. Die Arbeit als Archäologe war bei Weitem nicht so spannend, wie es bei George Lucas und Steven Spielberg den Anschein hatte. Tatsächlich war es ähnlich wie beim Journalismus, wo ein großer Teil der Aufgaben einsam an einem Schreibtisch erledigt wurde.
Simon nahm den Salon in Augenschein, ging herum und bewunderte die staubbedeckten Möbel. »Warum haben Sie das Haus hier instand gehalten?«
»Wer sagt denn, dass ich das getan habe?«
Simon suchte seinen Blick. »Kommen Sie schon, Mr. Sagan. Ist jetzt nicht die Zeit gekommen, ehrlich zu sein? Ihr Vater hat Ihnen diese Immobilie übertragen. Tatsächlich hat er Ihnen nichts anderes hinterlassen. Sein gesamter anderer Besitz ging an Ihre Tochter. Viel war es ja nicht gerade. Hunderttausend Dollar, ein Auto, ein paar Aktien und eine Lebensversicherung.«
»Wie ich sehe, haben Sie das Nachlassgericht aufgesucht.«
Simon lächelte erneut. »Das Gesetz verlangt die Erstellung einer Liste der Vermögensgegenstände. Ihre Tochter wurde zur Testamentsvollstreckerin ernannt.«
Als ob er sich an diese Kränkung erinnern lassen wollte. Er war ausdrücklich vom Testament ausgeschlossen worden, die rechtliche Verantwortung hatte eine Generation übersprungen.
Er war bei der Beerdigung gewesen, hatte sich aber ansonsten ferngehalten und nichts von dem getan, was von einem jüdischen Sohn erwartet wurde. Er und Ali hatten nicht miteinander gesprochen.
»Ihr Vater hat Ihnen fünf Wochen vor seinem Tod das Besitzrecht an diesem Haus übertragen«, fuhr Simon fort. »Sie und er hatten lange Zeit nicht mehr miteinander gesprochen. Warum hat er das wohl getan?«
»Vielleicht wollte er einfach, dass ich das Haus bekomme.«
»Das bezweifle ich.«
Er fragte sich, wie viel dieser Fremde eigentlich tatsächlich wusste.
»Ihr Vater war ein frommer Jude. Seine Religion und sein Erbe waren ihm wichtig.«
»Woher wollen Sie das wissen?«
»Ich habe mit Menschen gesprochen, die ihn kannten. Er befolgte die Worte der Thora, war ein Wohltäter seiner Synagoge und unterstützte Israel, obwohl er selbst das Heilige Land nie besucht hat. Sie dagegen kennen sich in dieser Region recht gut aus.«
Ja, das stimmte. Er hatte die letzten drei Berufsjahre dort verbracht. Hunderte von Storys hatte er dort recherchiert. In einer der letzten hatte er eine Vergewaltigung angeprangert, die ein ehemaliger israelischer Staatspräsident begangen hatte. Sie hatte in der ganzen Welt für Schlagzeilen gesorgt und schließlich dazu geführt, dass der Mann ins Gefängnis kam. Er erinnerte sich, wie die selbst ernannten Kritiker sich später, nachdem all das Schlimme passiert war, gefragt hatten, wie viel von jener Story frei erfunden gewesen war.
Kritiker. Menschen, die ihren Lebensunterhalt damit verdienten, andere runterzumachen. Egal was, sie hatten immer eine Meinung dazu, und die war niemals gut. Die Kritiker hatten sich an seinem Niedergang geweidet und ihn als einen Journalisten verurteilt, der beschlossen hatte, dass die Nachricht an sich nicht gut genug war.
Besser, man erfindet sie selbst.
Er wünschte, es wäre so einfach gewesen.
»Warum interessiert meine Familie Sie so sehr?«
Simon stieß den Finger in seine Richtung. Tom bemerkte die perfekt gepflegte Haut und die manikürten Nägel. »Sie spielen wieder den neugierigen Journalisten? Hoffen Sie, etwas zu erfahren? Heute nicht. Alles, was Sie wissen müssen, Mr. Sagan, ist, dass Ihre Tochter sich in großer Gefahr befindet.«
»Und was, wenn mir das egal ist?« Etwas zur Schau gestellte Kaltschnäuzigkeit würde vielleicht sowohl ihm als auch Ali nützen.
»Oh, es ist Ihnen aber nicht egal. Sonst hätten Sie doch längst abgedrückt, solange Sie die Waffe noch hatten. Sehen Sie, so geht es einem mit seinen Kindern. Egal, wie sehr wir sie enttäuschen oder sie uns, sie bleiben immer unsere Kinder. Wir können nicht anders, sie sind uns nicht egal. Wie Sie und Ihr Vater. Sie beide haben in zwanzig Jahren kaum ein Wort miteinander gewechselt, und doch hat er Ihnen dieses Haus hinterlassen. Das fasziniert mich.«
Der Mann, der sich Simon nannte, ging zur zinnenen Menora auf dem Tisch an der Wand und strich leicht über das stumpfe Metall. »Ihr Vater war Jude, Ihre Mutter Jüdin. Beide waren stolz auf das, was sie waren. Anders als Sie, Mr. Sagan. Ihnen liegt nichts an Ihrer Herkunft.«
Tom missfiel der herablassende Tonfall. »Sie ist eine ziemliche Bürde.«
»Nein, sie ist ein Grund zum Stolz. Wir haben als Volk schreckliche Leiden erduldet. Das bedeutet etwas. Mir zumindest.«
Hatte Tom richtig gehört?
Der Besucher wandte sich ihm zu.
»Ja, Mr. Sagan. Mein Judentum, genau das ist der Grund, warum ich hier bin.«
7
Béne stand dort, wo einmal ein jüdischer Friedhof gewesen war. Wie lange war das her? Schwer zu sagen. Er hatte fünfzehn Grabsteine gezählt, die zerfallen waren, und andere, die in die Erde eingesunken dalagen. Das Sonnenlicht fiel zitternd durch das dichte Schutzdach der Bäume, die tanzende Schatten warfen. Einer seiner Männer war bei ihm geblieben, und der andere, der sich auf die Suche nach den Hunden gemacht hatte, kehrte nun durch das Blätterdickicht zurück.
»Big Nanny und die Meute haben die Sache erledigt«, rief er. »Sie haben ihn an einem Felsabsturz in die Enge getrieben, aber er hat sich nicht gewehrt.«
»Du hast ihn also erschossen?«, fragte er seinen Untergebenen.
Ein Nicken bestätigte, was der Schuss, der vor ein paar Minuten gefallen war, schon angekündigt hatte.
»Den sind wir los«, sagte Béne. »Die Insel ist von einem weiteren stinkenden Parasiten befreit.«
Er hatte voll Abscheu Zeitungsartikel über Drogen-Dons gelesen, die sich für Robin Hood hielten. Angeblich beraubten sie die Reichen und beschenkten die Armen. Aber diese Bandenbosse waren keine Wohltäter. Vielmehr pressten sie den um ihre Existenz kämpfenden Unternehmern Geld ab, um Marihuana anzupflanzen und Kokain zu importieren. Ihre Soldaten waren die willfährigsten und unwissendsten Menschen, die sich auftreiben ließen. Sie forderten wenig und taten, was man ihnen auftrug. In den Slums von West Kingston und in den Tiefen von Spanish Town herrschten die Dons wie Götter, aber hier, in den Blue Mountains, waren sie ein Nichts.
»Lassen wir se wissen, wie er gestorben is’?«, fragte einer seiner Männer.
»Natürlich. Wir schicken Ihnen eine Botschaft.«
Sein erster Unterchef verstand und winkte den anderen Mann herbei. »Hol de Kopf«, sagte er.
»In der Tat«, bemerkte Béne lachend. »Hol de Kopf. Wenn das kein Argument ist. Wir wollen die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen.«
Der tote Drogen-Don interessierte ihn nicht mehr. Seine Aufmerksamkeit galt vielmehr dem, was er gerade durch Zufall entdeckt hatte.
Er wusste einiges darüber.
Anfangs durften nur Christen in die Neue Welt auswandern, aber da die spanischen Katholiken sich als unfähige Kolonisatoren erwiesen, wandte die Krone sich schließlich an die Gruppe, die für ihren Erfolg bekannt war.
Die Juden.