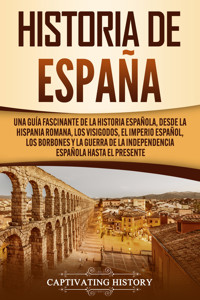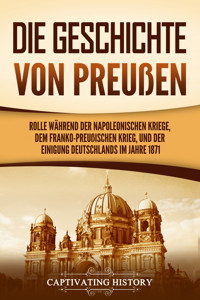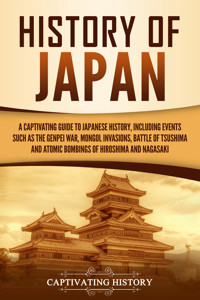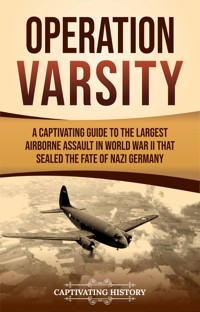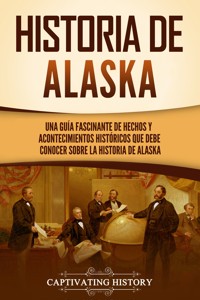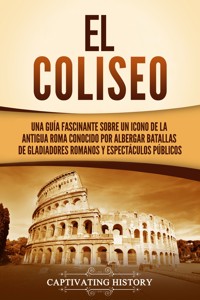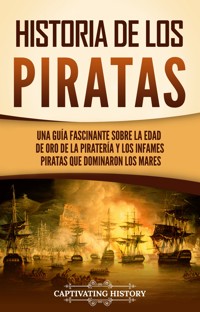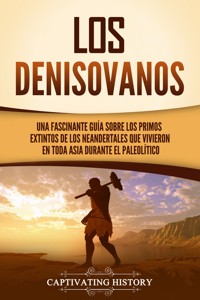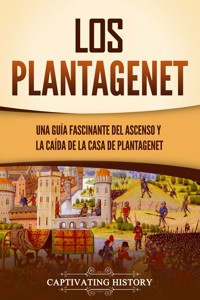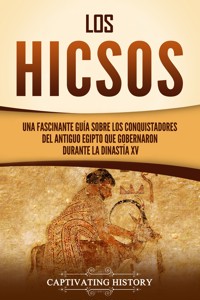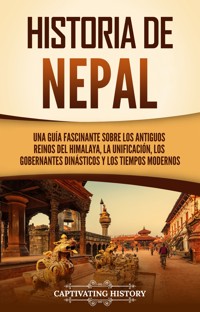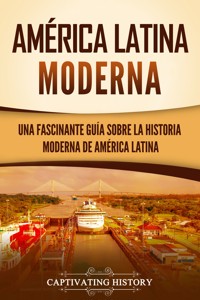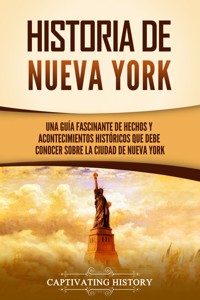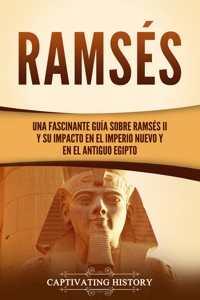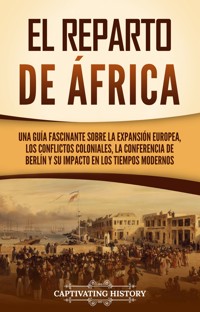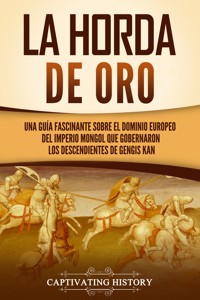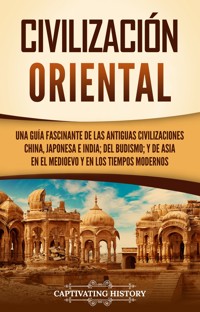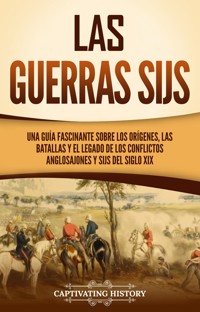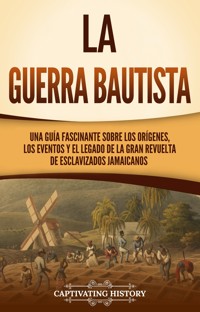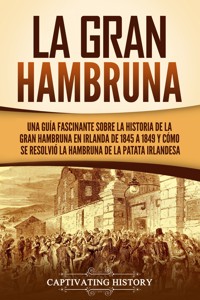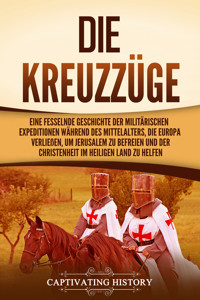
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Captivating History
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wenn Sie mehr über die fesselnde Geschichte der Kreuzzüge erfahren wollen, dann lesen Sie weiter... Man könnte fast sagen, dass die europäischen Könige und Adligen des Mittelalters kreuzzugswütig waren. Die enorme Anzahl von Kämpfern, die regelmäßig in den Nahen Osten segelten, um dort gegen die Muslime zu kämpfen, zeugt von der weit verbreiteten Popularität des Abenteuertums in Übersee zu dieser Zeit. Die Vorstellung von einem glorreichen Kreuzzug, bei dem sich große Heere aus verschiedenen Regionen Europas zum Kampf gegen türkische und arabische Muslime versammelten, war so fest in den Köpfen der Menschen verankert, dass die Kreuzzüge auf Kämpfe auch gegen häretische europäische christliche Sekten ausgeweitet wurden. In "Die Kreuzzüge: Eine fesselnde Geschichte der militärischen Expeditionen während des Mittelalters, die Europa verließen, um Jerusalem zu befreien und der Christenheit im Heiligen Land zu helfen", erfahren Sie mehr zu den folgenden Themen: - Der Erste Kreuzzug (1095-1099) - Der Papst fordert die Gläubigen zum Kampfe auf - Die Armeen des Ersten Kreuzzugs treffen auf den Feind - Die Folgen des Ersten Kreuzzugs - Der Zweite Kreuzzug (1147-1149) Die Entstehung des Königreiches von Jerusalem - Der Dritte Kreuzzug (1189-1192) - Der Königskreuzzug - Der Vierte Kreuzzug (1202-1204) - Das Lateinische Reich von Konstantinopel und der Kinderkreuzzug - Der Fünfte Kreuzzug (1217-1221) - Der Sechste Kreuzzug (1228) – Friedrich II., der Herrscher des Heiligen Römischen Reiches trägt das Kreuz - Der Siebte Kreuzzug (1248-1254) - Der Achte Kreuzzug (1270) - Und vieles, vieles mehr! Wenn Sie also mehr über die Geschichte der Kreuzzüge erfahren möchten, scrollen Sie nach oben und klicken Sie auf "In den Einkaufswagen"!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Kreuzzüge
Eine fesselnde Geschichte der militärischen Expeditionen während des Mittelalters, die Europa verließen, um Jerusalem zu befreien und der Christenheit im Heiligen Land zu helfen
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Die Kreuzzüge: Eine fesselnde Geschichte der militärischen Expeditionen während des Mittelalters, die Europa verließen, um Jerusalem zu befreien und der Christenheit im Heiligen Land zu helfen
Einleitung
Kapitel 1 - Der Erste Kreuzzug (1095-1099) - Der Papst fordert die Gläubigen zum Kampfe auf
Kapitel 2 - Die Armeen des Ersten Kreuzzuges treffen auf den Feind
Kapitel 3 - Die Folgen des Ersten Kreuzzuges
Kapitel 4 - Der Zweite Kreuzzug (1147-1149) Die Entstehung des Königreichs von Jerusalem
Kapitel 5 - Der Dritte Kreuzzug (1189-1192) - Der Königskreuzzug
Kapitel 6 - Der Vierte Kreuzzug (1202-1204) - Das Lateinische Reich von Konstantinopel und der Kinderkreuzzug (1212)
Kapitel 7 - Der Fünfte Kreuzzug (1217-1221)
Kapitel 8 - Der Sechste Kreuzzug (1228-1229) - Friedrich II, der Herrscher des Heiligen Römischen Reiches trägt das Kreuz
Kapitel 9 - Der Siebte Kreuzzug (1248-1254)
Kapitel 10 - Der Achte Kreuzzug (1270)
Der Neunte Kreuzzug (1271-1272)
Fazit
Weitere Literatur
© Copyright 2022
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert werden. Rezensenten dürfen in Besprechungen kurze Textpassagen zitieren.
Haftungsausschluss: Kein Teil dieser Publikation darf ohne die schriftliche Erlaubnis des Verlags reproduziert oder in irgendeiner Form übertragen werden, sei es auf mechanischem oder elektronischem Wege, einschließlich Fotokopie oder Tonaufnahme oder in einem Informationsspeicher oder Datenspeicher oder durch E-Mail.
Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, die in diesem Werk enthaltenen Informationen zu verifizieren, übernehmen weder der Autor noch der Verlag Verantwortung für etwaige Fehler, Auslassungen oder gegenteilige Auslegungen des Themas.
Dieses Buch dient der Unterhaltung. Die geäußerte Meinung ist ausschließlich die des Autors und sollte nicht als Ausdruck von fachlicher Anweisung oder Anordnung verstanden werden. Der Leser / die Leserin ist selbst für seine / ihre Handlungen verantwortlich.
Die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze und Regelungen, einschließlich internationaler, Bundes-, Staats- und lokaler Rechtsprechung, die Geschäftspraktiken, Werbung und alle übrigen Aspekte des Geschäftsbetriebs in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich regeln oder jeglicher anderer Jurisdiktion obliegt ausschließlich dem Käufer oder Leser.
Weder der Autor noch der Verlag übernimmt Verantwortung oder Haftung oder sonst etwas im Namen des Käufers
Einleitung
Man könnte fast sagen, dass die europäischen Könige und Adligen des Mittelalters kreuzzugswütig waren. Die enorme Anzahl von Kämpfern, die regelmäßig in den Nahen Osten segelten, um dort gegen die Muslime zu kämpfen, zeugt von der weit verbreiteten Popularität des Abenteuertums in Übersee zu dieser Zeit. Die Vorstellung von einem glorreichen Kreuzzug, bei dem sich große Heere aus verschiedenen Regionen Europas zum Kampf gegen türkische und arabische Muslime versammelten, war so fest in den Köpfen der Menschen verankert, dass die Kreuzzüge auf Kämpfe auch gegen häretische europäische christliche Sekten ausgeweitet wurden.
Es gibt viele dafür Gründe, warum so viele europäische Adlige dem Ruf zum Kreuzzug folgten, und alle diese Gründe sind in der komplexen Organisation der mittelalterlichen Feudalgesellschaft zu suchen, die sich in den verschiedenen Kulturen Europas unterschiedlich schnell entwickelte.
Als im frühen Mittelalter die zentralisierte weltliche Ordnung in Westeuropa mit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches zerfiel, entstanden eine Vielzahl von kleineren Quasi-Staaten. Diese Staaten wurden von Bevölkerungsgruppen gegründet, die gemeinsame ethnische Wurzeln in den Stämmen der Barbaren hatten, die einst in kleineren Stammesgesellschaften über den Kontinent gezogen waren. Da es keine festgelegten nationalen oder kulturellen Grenzen gab, kämpften die Staaten ständig um die Vorherrschaft und die Ländereien in ihrer Region - das Land war zu dieser Zeit die wichtigste Quelle des Reichtums. Es entstand eine Kultur der Kriegsführung, die sich in die Gesellschaftsordnung all der unterschiedlichen kulturellen Gruppen einfügte.
Das Chaos aus multiethnischen und mehrsprachigen Staaten, die in einem ständigen Zustand des Kampfes mit mächtigen und schwachen Nachbarn standen, wurde durch eine einzige einigende Kraft ausgeglichen: die Macht der katholischen Kirche. Zuweilen geriet aber sogar die Autorität der Kirche, die vom Papst geleitet wurde und durch eine Hierarchie kirchlicher Amtsträger organisiert war, unter Beschuss. Es kam zu Streitigkeiten über die Befugnis der Kirche, wenn es darum ging, weltliche Beamte und Führer zu ernennen. Auch die unmittelbare Autorität des Papsttums über die Staaten und deren Fähigkeit, die Einkünfte erwirtschafteten, die die weltlichen Herren begehrten, war ein ständiger Streitpunkt.
In den nicht seltenen Fällen, in denen die Diplomatie versagte, zogen die Staatsoberhäupter von ihren befestigten Häusern oder Burgen aus in den Kampf gegen ihre Nachbarn. Dabei machte es keinen Unterschied, ob es sich um andere weltliche Herrscher oder um kirchliche Beamte wie beispielsweise Erzbischöfe, Bischöfe oder sogar den Papst höchstpersönlich handelte. All diese Würdenträger verfügten über ihre eigenen Heere. Da der Reichtum durch die territoriale Macht bestimmt wurde, kam es im Grunde genommen ständig zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Der Krieg galt als der entscheidende Faktor für die erfolgreiche Organisation der Gesellschaft.
Das Kämpfen wurden durch die Begriffe Ehre, Loyalität und Mut gekennzeichnet. Hinzu kamen die christlichen Vorstellungen von einem gerechten Krieg, von Barmherzigkeit und Moral. So verrichteten die kämpfenden Männer der Oberschicht und ihre Gefolgsleute, bevor sie in die Schlacht zogen, christliche Gebetsrituale, in denen sie im Voraus um die Vergebung aller Sünden baten, die sie auf dem Schlachtfeld begehen könnten.
Da Kriege mit dem Ziel geführt wurden, Land zu erwerben und die Zahl der Arbeitskräfte für die Armeen zu erhöhen, entwickelte sich ein komplexes System des Landbesitzes. Wie allgemein bekannt, geht die Beute an den Sieger. Im Mittelalter bedeutete dies im Allgemeinen nicht die vollständige Vernichtung der Ländereien der besiegten Adligen. Vielmehr behielt der besiegte Herrscher seine Pachtbauern und überließ dem Sieger einen Teil ihrer Einkünfte. Der besiegte Anführer und seine kämpfenden Männer mussten dem Sieger durch das Ritual der Huldigung die Treue schwören. Die Lehnstreue der Besiegten bedeutete, dass der siegreiche Herrscher von einem erweiterten Heer von Rittern und Fußsoldaten der unteren Klassen Militärdienst verlangen konnte. Die Macht eines Herrschers hing unmittelbar von der Qualität und Quantität seiner eigenen Kämpfer ab, aber auch von denen, die ihm durch Eroberungen als Vasallen dienten.
Die Kriegsführung war nicht das einzige Mittel, mit dem mittelalterliche Adlige ihre Macht ausbauten. Durch ein ausgeklügeltes System von Mischehen zwischen den mächtigen Familien wurde ein gewisser Anschein von Ordnung geschaffen, in dem gleich starke Könige und Adlige von Zeit zu Zeit ihre Wachsamkeit gegenüber geldgierigen Nachbarn aufgeben konnten, was gleichzeitig den Weg für Angriffe auf weniger mächtige Herrscher ebnete. Mischehen waren deshalb wichtig, um im Bedarfsfall Bündnisse mit Nicht-Vasallenstaaten zu schließen. Und schließlich konnte eine Heirat zwischen den oberen Klassen den Anspruch eines Adligen oder eines Königs auf die von seinen Nachkommen geerbten Ländereien untermauern.
Die Kirche war ein wesentlicher stabilisierender Bestandteil dieser Mischung aus miteinander verbundenen Bündnissen und Vasallenstaaten. Das Papsttum war zeitweise mit den adligen Grundbesitzern gleichgestellt. Seine Ländereien oder Staaten wurden aus demselben Gefüge von Vasallenstaaten gebildet, aus denen bei Bedarf Heere gebildet werden konnten. Die Erzbischöfe, Bischöfe und Äbte der Klöster waren dem Papst verpflichtet, als eine Art religiöse Huldigung. Diese Beamten waren selbst Grundbesitzer und konnten daher ihre Vasallen dazu auffordern, im Bedarfsfall Soldaten zu stellen.
Da der Adel im mittelalterlichen Europa eine ausgeprägte Kultur der Kriegsführung pflegte, ist die Anziehungskraft von Kriegen in weit entfernten Ländern leicht zu verstehen. Als der Papst die mächtigen Führer der Christenheit aufforderte, gegen die Muslime im Osten zu den Waffen zu greifen, was als „Kreuznahme Christi“ bezeichnet wurde, stieß er auf offene Ohren. Die Adligen sahen in der Teilnahme an den Kreuzzügen nicht nur eine ehrenvolle Möglichkeit, ihre religiöse Inbrunst zu demonstrieren, sondern auch ein Mittel, um ihre Kampffähigkeit und - für die Vasallen - ihre Loyalität gegenüber ihrem Oberherrn unter Beweis zu stellen. Der Anreiz zur Teilnahme an den Kreuzzügen, der für einige Könige und Adlige wohl am stärksten war, bestand in der Möglichkeit, Ländereien, Schätze und Kämpfer in einer Region zu erwerben, die vom europäischen Feudalsystem bis dahin noch nicht erschlossen worden war.
Die Hauptaufgabe eines Ritters war der Kampf. Selbst in den Pausen zwischen den ernsthaften Kriegshandlungen verfeinerten die Ritter ihre Fähigkeiten und gewannen durch rituelle Turniere an Ehre. In gewissem Sinne füllten die Kreuzzüge ein Machtvakuum für Ritter, ähnlich wie es auch die Turniere taten. Dies erklärt, warum ein König oder Adliger, der zu Hause in Europa in den Krieg zog, keine Notwendigkeit dazu verspürte, dem Ruf des Papstes zu folgen und im Ausland zu dienen. Der Wunsch die Forderungen der Kirche zu ignorieren, sogar bis hin zur Exkommunikation, war für einen weltlichen Herrscher ein angemessenes Mittel, um seine Unabhängigkeit zu demonstrieren.
Im Nachhinein ist schwer zu verstehen, warum der Aufruf zum Kampf im Sinne der Kreuzzüge immer wieder dazu führte, dass riesige Heerscharen von Kämpfern aufgestellt werden konnten. Die Verheißung von Abenteuern und Reichtum waren starke Motivatoren, das steht fest. Die fast völlige Unkenntnis der Gefahren, die mit einer so weiten Reise verbunden waren, an deren Ende der Kampf gegen einen geheimnisvollen Feind stand, erklärt zum Teil auch den Eifer, mit dem die Europäer dazu bereit waren ihre Heimat zu verlassen und zu Lande und zu Wasser ins Heilige Land zu ziehen. Dabei ist sicher, dass die Kreuzfahrer nicht wussten, dass sie auf dem Landweg nach Jerusalem auf starken Widerstand stoßen würden. Sie waren auf die Einheimischen entlang des Weges angewiesen, um ihre Männer und ihre Pferde mit Lebensmitteln zu versorgen, und hatten auf ihrem Weg durch praktisch unwegsames Gelände mit Krankheiten zu kämpfen. Wenn sich die Kreuzfahrer zur Reise auf dem Seeweg ins Heilige Land entschieden, sahen sie sich unweigerlich Schiffbrüchen und Angriffen durch feindliche Mächte und Piraten ausgesetzt.
Wenn schon die Könige und Ritter, die das Kreuz auf sich nahmen, nicht wussten, was ihnen auf ihren Expeditionen in den Nahen Osten bevorstand, so war die große Mehrheit der Kreuzfahrer noch unwissender. Bei diesen Männern handelte es sich um Fußsoldaten, Diener und Bauern, die die wohlhabenden Ritter begleiteten. Zu den Fußsoldaten gehörten ausgebildete Armbrustschützen und speertragende Infanteristen. Sie wurden aus den unteren Schichten der adligen Ländereien und der Ländereien ihrer Vasallen rekrutiert. Auch die zahlreichen Diener, die für alle möglichen Aufgaben benötigt wurden, vom Füttern der Pferde über die Pflege der Rüstungen und Schwerter bis hin zum Aufbau des Lagers und der Versorgung von Pferden und Karren mit Vorräten, wussten zweifellos nichts von den Strapazen, die sie im Ausland erwarten sollten. Unter den Kreuzfahrern wurde die Zahl der Todesopfer aus der Unterschicht nicht aufgezeichnet, insbesondere unter den Nichtkämpfern, da die Chronisten jener Zeit deren Bedeutung für den Erfolg der Kreuzzüge als sehr gering einschätzten.
Es gab zwei Kreuzzüge, die nicht zu den üblichen Expeditionen wohlhabender, aggressiver und abenteuerlustiger Ritter gehörten. Der Volkskreuzzug von 1096 nach Chr. und der Kinderkreuzzug von 1212 nach Chr. wurden von der Unterschicht organisiert, die von charismatischen Anführern dazu überzeugt wurde, ins Heilige Land aufzubrechen und den Muslimen entweder mit Gewalt oder durch Bekehrung zum Christentum beizukommen. Die Kreuzfahrer aus der Unterschicht waren für beides nicht gerüstet, geschweige denn dazu in der Lage, die lange Reise nach Osten mit ihren begrenzten Mitteln zu bewältigen.
Unabhängig davon, ob sie durch das Versprechen von Abenteuern oder Reichtum motiviert worden waren, lebten viele Kreuzfahrer nach ihrer Ankunft im Heiligen Land ein Leben, das dem in ihrer Heimat ähnelte. Auf ihren Reisen in den Osten griffen sie in Ermangelung muslimischer Gegner Juden, byzantinische Christen sowie Könige und Adlige an, die sie nicht unterstützen wollten. Auf ihren Märschen in den Osten und nachdem sie sich im Heiligen Land niedergelassen hatten, stritten und kämpften die Kreuzfahrer in den Pausen zwischen den Auseinandersetzungen gegeneinander, sei es gegen echte Feinde in ihren Rängen oder gegen Feinde die ihrer Einbildung entsprangen. Da sie für den Kampf lebten, verhielten sich viele Kreuzfahrer ihren christlichen Mitbürgern gegenüber ganz abscheulich. Bei Streitigkeiten über die Aufteilung der Beute oder die Kriegstaktik ihres Vorgesetzten gingen die Ritter des einen Adligen gegen die des anderen vor. Diese Männer lebten für den Kampf, und wenn der Feind nicht in Sicht war, zogen sie wegen jeder noch so kleinen Meinungsverschiedenheit das Schwert. Die ständigen Auseinandersetzungen der Kreuzfahrer untereinander und die unmögliche Aufgabe, die Kämpfer zu kontrollieren, wurde in mehreren Expeditionen deutlich.
Da die Kreuzfahrer in erster Linie Kämpfer waren, waren ihre Ausrüstung und militärische Taktik für das Verständnis ihrer Erfolge und Misserfolge in Konfrontationen mit ihren Gegnern von großer Bedeutung. Die Waffen und Rüstungen, die von den mittelalterlichen Rittern während der Kreuzzüge verwendet wurden, entwickelten sich im Laufe der Zeit weiter und wurden immer ausgefeilter. Beim ersten Kreuzzug trugen die berittenen Krieger ein Kettenhemd, dass die von Kopf bis Fuß bedeckte. Dazu trugen sie Schilde oder Buckler (Faustschilde) und einfache Breitschwerter. Im Laufe der Zeit wurden Platten aus gehärtetem oder aufgekohltem Eisen hinzugefügt, um empfindliche Körperteile zu schützen. Die bekannteste Rüstung, der sogenannte „Vollplattenanzug“, gehörte erst lange nach dem Ende der Kreuzzüge zur üblichen Ausstattung.
Das Rüstungsschwert oder „Ritterschwert“ war ein einhändiges, zweischneidiges, kreuzförmiges Schwert, das im Kampf zum Stoßen oder Schneiden verwendet wurde. Im späten 12. Jahrhundert nach Chr. gab es zwei Formen dieses Rüstungsschwerts. Als die Rüstung zunehmend von der Verwendung von Platten dominiert wurde, wurde eine stumpfe, kurze, schwere Version des Rüstungsschwerts eingesetzt, um stumpfe Verletzungen durch die Rüstung hindurch zu verursachen. Außerdem wurde eine schmalspitzige Version dazu verwendet, die Rüstung des Gegners direkt zu durchbohren. Schließlich wurden beide Typen durch das Breitschwert oder Langschwert ersetzt, das mit einer oder beiden Händen geführt werden konnte. Ein dritter Schwerttyp, ein einschneidiges Schwert, das einem persischen Krummsäbel ähnelte, könnte eine weitere bevorzugte Waffe einiger Ritter gewesen sein. Diese Schwerter waren zur Hand hin beschwert, so dass die Klinge blitzschnell geführt werden konnte. Die Ritter trugen auch Dolche, im Wesentlichen kurze, zweischneidige Schwerter, die am Rücken oder am Gürtel befestigt werden konnten.
Fußsoldaten trugen Streitkolben oder Keulen mit einem Schaft aus Holz oder Metall und einem Kopf aus Stein, Eisen oder Stahl. Keulen mit längeren Stielen wurden auch von Reitern verwendet. Da Streitkolben leicht herzustellen waren, wurden sie zur bevorzugten Waffe der bäuerlichen Bevölkerung.
Neben Streitkolben und Äxten führten die Fußsoldaten einen Speer oder eine Lanze mit einem hölzernen Schaft, an dessen Ende sich ein geschärfter Kopf befand, der entweder aus dem Holz selbst oder aus einem geschmiedeten Metallaufsatz gefertigt war. Zur Zeit der Kreuzzüge wurden die Speere von den Soldaten gehalten und nicht auf den Feind geschleudert. Je nach Herkunftsland verfügten die Kreuzfahrer über spezielle Waffen. Die Dänen trugen beispielsweise Breitäxte, und die 3 bis 6 Meter langen Stichwaffen, die sogenannten „Piken“, wurden von der Infanterie in Flandern und Schottland verwendet.
Während der Kreuzzüge stellte der Befehlshaber in Feldschlachten oder geplanten militärischen Begegnungen auf einem vorher abgesteckten Schlachtfeld Infanteristen auf, die sich gegen die gegnerische Infanterie stellten. Jede Lücke in ihren Reihen wurde durch einen Angriff der Ritter ausgenutzt. Wenn dieser Angriff erfolgreich war, wendeten die Ritter ihre Pferde und griffen die gegnerische Infanterie von hinten an, oder sie griffen die berittenen Soldaten des Gegners frontal an. In der ersten Phase einer offenen Feldschlacht bestand das Ziel darin, einzelne Mitglieder der gegnerischen Streitkräfte außer Gefecht zu setzen und so einen Rückzug zu erzwingen. Bei einem Rückzug waren sowohl die muslimischen Kämpfer als auch die Kreuzfahrerheere der größten Gefahr ausgesetzt. Fußsoldaten und Reiter waren besonders verwundbar, wenn sie von hinten angegriffen wurden, und so wurden viele von ihnen beim Rückzug getötet. Zur Zeit der Kreuzzüge war die Verwundung eines Soldaten ein wirksames Mittel, um ihn von weiteren Kämpfen auszuschließen, da die meisten Verwundeten starben.
Die Araber und Türken, die gegen die Kreuzfahrer kämpften, setzten Fußsoldaten mit Speeren als erste Linie ein, ähnlich wie die Kreuzfahrer es auch taten. Dahinter folgten berittene Krieger, die in Kettenhemden gekleidet waren und Schwerter, Schilde und Lanzen trugen. Die muslimische Kavallerie war auf Schnelligkeit ausgelegt, und ihre berittenen Krieger waren weniger durch schwere Rüstungen und Schwerter belastet. Die berittenen Bogenschützen der Sarazenen waren im Kampfe gegen die Truppen der Kreuzfahrer besonders effektiv. Die Armbrustschützen der Kreuzfahrer waren auf dem Schlachtfeld und beim Beschuss der Feinde von Belagerungstürmen oder Burgmauern ebenfalls sehr effektiv.
Die Waliser und Engländer waren besonders geübt im Umgang mit dem einteiligen Langbogen (einige Bögen wurden später als Kompositbögen entwickelt), und es gelang ihnen, Pfeile zu schießen, die Kettenhemden durchdringen konnten. Französische und deutsche Langbogenschützen waren etwas weniger begabt im Umgang mit dieser unhandlichen Waffe. Es bedurfte jahrelanger Übung, um den Langbogen perfekt zu beherrschen, der in den Händen der geschicktesten Schützen etwa sechs Pfeile pro Minute schießen konnte. Diese Feuerrate war weit höher als bei ähnlichen, konkurrierenden Waffen wie etwa der Armbrust. Der Vorteil der Armbrust bestand darin, dass sie eine größere Durchschlagskraft hatte und keine jahrelange Ausbildung erforderte.
Die Geschichte der Kreuzzüge ist kompliziert. Die Ereignisse in Europa wirkten sich auf die Zusammensetzung der Kreuzfahrerheere aus, und die Ereignisse im Osten beeinflussten die Zusammensetzung der muslimischen Streitkräfte. Für die Christen waren in erster Linie die Führungskraft und Treue der Adligen untereinander ausschlaggebend dafür, ob eine Schlacht gewonnen oder verloren wurde. Ehre und Habgier spielten bei ihren Erfolgen und Misserfolgen eine gleichermaßen große Rolle. Hinter dem gesamten Unternehmen, das sich über drei Jahrhunderte hinzog, stand die Kirche, die sich kaum von weltlichen Mächten unterschied, wenn es darum ging, Loyalitäten zu wechseln, um Autorität auszuüben und den Wert ihrer Schatzkammer zu erhöhen.
Mit dem Aufstieg der christlichen Kirche in der Zeit des Niedergangs des Römischen Reiches wurden die Gläubigen zu Pilgerreisen ins Heilige Land ermuntert, um die Stätten zu besichtigen, die das Leben Christi und seiner Mutter Maria sowie seiner Jünger und der frühchristlichen Heiligen prägten. Im 12. Jahrhundert nach Chr. hatte sich die den Pilgern empfohlene Route bereits so weit etabliert, dass ein deutscher Geistlicher einen Pilgerführer durch das Heilige Land (1172) schrieb. Er beschrieb für sein begrenztes Publikum von gebildeten Christen, was sie in Jerusalem zu sehen bekommen konnten, wie etwa die Säule der Geißelung von Christi und die Grotte, in der das Kreuz gefunden wurde. Er beschrieb die christlichen Stätten in Bethlehem, Nazareth und Damaskus. Die Zahl der gläubigen Pilger, die aus Europa und den Städten des byzantinischen Reiches herbeiströmten, war sicherlich beträchtlich. Die Sicherheit dieser Pilger und der Schutz dieser verehrten Stätten waren die offiziellen Beweggründe für die Entsendung der Heere von europäischen Königen und Adligen in den Kampf im Osten. Es gab jedoch auch andere Motive. Dazu gehörten unter anderem regionale Konflikte um territoriale Ausdehnung, kirchliche Differenzen mit der weltlichen Obrigkeit, Lehrkonflikte innerhalb der Kirche sowie Habgier und Aggression.