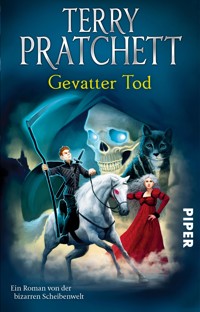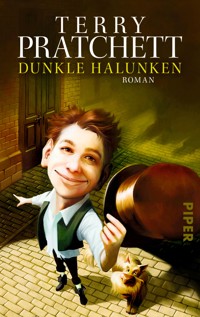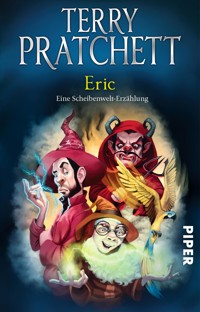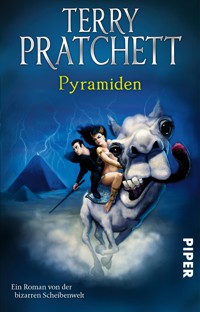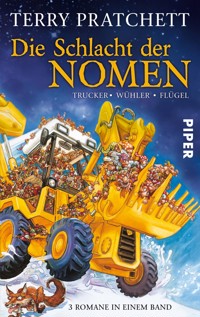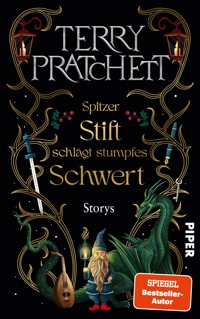2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manhattan
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Noch einmal tut sich Großes auf der Scheibenwelt …
Tiffany Weh, die junge Hexe aus dem Kreideland, musste einige beeindruckende Gegner bezwingen und viele Prüfungen bestehen, bevor die anderen, erwachsenen Hexen der Scheibe sie als eine der Ihren akzeptierten. Nun ist die sie die offizielle Hexe ihrer Heimat, stolz und glücklich – und steht doch vor ihrer bisher größten Herausforderung. Denn tief im Kreideland rührt sich etwas: Ein alter Feind sammelt neue Kraft. Und nicht nur hier, auf der ganzen Scheibenwelt hat eine Zeit der Umbrüche begonnen. Grenzen verschwimmen, Allianzen verschieben sich, neue Mächte entstehen. Tiffany muss wählen zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Gut und Böse. Als sich eine gewaltige Invasion ankündigt, ruft Tiffany die Hexengemeinde auf, ihr beizustehen. Denn der Tag der Abrechnung rückt näher ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2015
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Im abgeschiedenen Kreideland läuft das Leben in ruhigen Bahnen, und auch wenn die junge Tiffany Weh als offizielle Hexe ihrer Heimat durchaus alle Hände voll zu tun hat, so sind das doch meist Routineangelegenheiten: den Kranken und Schwachen zu Hilfe eilen, Haushaltsangelegenheiten klären, Sterbenden den Abschied so leicht wie möglich machen. Nichts, was große Magie erfordern würde. Bis sich tief im Kreideland etwas Unerklärliches rührt und ein alter Feind zu neuem Leben erwacht. Mithilfe alter Freunde und neuer, unerwarteter Verbündeter nimmt Tiffany den Kampf auf – und stellt sich der größten Herausforderung ihres Lebens. Denn nicht nur das kleine Kreideland, die ganze Scheibenwelt ist im Umbruch, und nichts wird mehr sein, wie es einmal war …
Autor
Terry Pratchett, geboren 1948, gilt als einer der erfolgreichsten Autoren der Gegenwart. Von seinen mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Romanen wurden weltweit bisher über 80 Millionen Exemplare verkauft, seine Werke sind in 38 Sprachen übersetzt. Für seine Verdienste um die englische Literatur wurde ihm sogar die Ritterwürde verliehen. »Die Krone des Schäfers« ist der letzte Roman von der einzigartigen Scheibenwelt. Terry Pratchett starb im März 2015.
Weitere Informationen zu Terry Pratchett und seinen Werken unter www.pratchett-buecher.de sowie unter www.pratchett-fanclub.de.
Terry Pratchett
Die Krone des Schäfers
Ein Märchen von der Scheibenwelt
Aus dem Englischen übersetztvon Regina Rawlinson
MANHATTAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2015
unter dem Titel »The Shepherd’s Crown« bei Doubleday, an imprint of Random House Children’s Publishers UK, A Penguin Random House Company, London.Manhattan Bücher erscheinen im
Wilhelm Goldmann Verlag, München, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2015
by Terry & Lyn Pratchett
Discworld® and Unseen University® are trademarks registered by Terry Pratchett
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Die Nutzung des Labels Manhattan erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Hans-im-Glück-Verlags, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Umschlaggestaltung: buxdesign, München, unter Verwendung von Illustrationen von © Sebastian Wunnicke
Redaktion: Uta Rupprecht
ISBN: 978-3-641-18311-0
www.manhattan-verlag.de
Für Esmeralda WetterwachsPass auf dich auf
PrologEine Krone in der Kreide
Es wurde im Dunkel des Runden Meeres geboren, winzig und weich, ein Spielzeug der Gezeiten. Zwar bekam es später eine harte Schale, doch die gewaltigen Untiere in seiner brodelnden, wogenden Welt hätten es im Nu zerknacken können. Trotzdem überlebte es. Sein kleines Leben hätte so weitergehen können, bis ihm die gefährliche Brandung und im Wasser treibende Trümmer über kurz oder lang ein Ende bereitet hätten, wäre der Tümpel nicht gewesen.
In dem warmen Tümpel oben am Strand, der gelegentlich von nabenwärtigen Regenfällen gespeist wurde, ernährte sich das Geschöpf von Wesen, die noch kleiner waren als es selbst, und wuchs zum König heran. Und es hätte sogar noch größer werden können, wäre das Wasser nicht eines Sommers in der Sonnenglut verdunstet.
Doch so starb das kleine Ding. Zurück blieb nur sein Panzer, der einen harten, scharfen Kern in sich trug. Bei der nächsten Sturmflut wurde er in die Gezeitenzone geschwemmt, wo er liegen blieb und zwischen Kieselsteinen und dem, was die Stürme sonst noch an den Strand warfen, herumrollte.
Das Meer wälzte sich durch die Weltalter, bis es irgendwann austrocknete. Bei seinem allmählichen Rückzug wurde der stachelige Panzer Schicht um Schicht von den Schalen anderer toter Geschöpfe zugedeckt, und der scharfe, harte Kern in seinem Inneren wurde größer und größer. Doch eines Tages fiel der Panzer einem Schäfer auf, der in den Hügeln, die nun Kreideland genannt wurden, seine Herde hütete.
Er hob das seltsame Ding auf und drehte und wendete es. Kugelig, ohne eine Kugel zu sein, schmiegte es sich in seine Hand. Für einen Feuerstein war es zu regelmäßig geformt, und doch hatte es ein Herz aus Feuerstein. Die Oberfläche war grau wie Stein, darunter aber lag ein zarter goldener Schimmer. Von der abgeplatteten Unterseite aus zogen sich im gleichen Abstand fünf deutlich erkennbare Wulste nach oben, die an Strahlen erinnerten. Der Schäfer sah ein solches Gebilde nicht zum ersten Mal. Dieses allerdings kam ihm anders vor – es war ihm wie von selbst in die Hand gesprungen.
Das kleine Ding rollte in seiner Hand herum, und ihm war fast so, als wollte es ihm etwas sagen. Was für ein verrückter Gedanke, dabei hatte er noch gar kein Bier getrunken. Doch mit einem Mal schien seine ganze Welt wie erfüllt von dem merkwürdigen Fund. Sei kein Trottel, dachte er, aber er steckte ihn trotzdem ein und nahm ihn mit ins Wirtshaus, um ihn seinen Stammtischbrüdern zu zeigen.
»Guckt euch das mal an«, sagte er. »Sieht das nicht wie eine Krone aus?«
Und natürlich lachte einer der Männer. »Eine Krone? Was willst du denn mit ’ner Krone? Du bist doch kein König, Daniel Weh.«
Gleichwohl trug der Schäfer das kleine Ding nach Hause und legte es vorsichtig auf das Wandbord in der Küche zu den anderen Sachen, die er besonders mochte.
Dort geriet es schließlich in Vergessenheit und verschwand aus dem Lauf der Geschichte.
Die Wehs aber vergaßen es nicht, sondern gaben es von einer Generation an die andere weiter.
1Wo der Wind weht
Es war ein Tag, an dem man sich wünschte, dass er nie vergeht. Als Tiffany Weh hoch oben in den Hügeln auf den elterlichen Hof hinunterblickte, war ihr, als könnte sie bis ans Ende der Welt sehen. Die Luft war kristallklar, und eine frische Brise wirbelte das tote Herbstlaub um die Stämme der Eschen, die mit den Ästen klapperten, um die letzten Blätter loszuwerden und für das Frühlingsgrün Platz zu schaffen.
Tiffany hatte sich immer gewundert, dass so weit oben überhaupt noch Bäume wuchsen. Oma Weh hatte ihr erklärt, es gebe hier Wege, die noch aus der Zeit stammten, als das Tal unten ein Sumpf gewesen war. Die Menschen von damals hätten sich in der Höhe angesiedelt – weit weg vom Sumpf und von Menschen, die ihnen die Schafe stehlen wollten.
Vielleicht fühlten sie sich in der Nähe der alten Steinkreise einfach sicher und geborgen. Vielleicht aber waren sie von ihnen erst aufgestellt worden? Obwohl niemand genau wusste, woher die Kreise stammten, war jedem klar, dass man sie besser in Ruhe ließ, Aberglaube hin oder her. Auch wenn sie Geheimnisse oder Schätze bergen mochten, was nützte einem so etwas schon bei den Schafen? Und wenn mal wieder ein Stein umstürzte und einen Menschen unter sich begrub, ließ sich nie ganz ausschließen, dass der Betreffende – beziehungsweise der Getroffene – gar nicht wieder ausgebuddelt werden wollte. Nur weil einer tot war, hieß das noch lange nicht, dass er nicht wütend werden konnte, o nein.
Tiffany hingegen hatte einmal sogar eine bestimmte Steinformation als Tor ins Märchenland benutzt – ein Märchenland, das keinerlei Ähnlichkeit mit dem besaß, das sie aus ihrem Märchenbuch für brave Kinder kannte. Und deshalb wusste sie, was für Gefahren dort lauerten.
Aus irgendeinem Grund hatte sie heute heraufkommen müssen. Obwohl sie wie jede vernünftige Hexe feste Stiefel trug, robust und zweckmäßig, die für jedes Gelände taugten, konnte sie durch die dicken Sohlen ihr Land spüren und wusste, was es ihr zu sagen hatte. Mit einem Kitzeln hatte es angefangen, einem Kribbeln, das ihr in die Füße kroch, um sich Gehör zu verschaffen, und das sie hügelauf trieb zum Steinkreis, obwohl sie gerade bis zum Ellenbogen in einem Schaf mit einer bösen Darmkolik steckte. Warum sie zu den Steinen gehen sollte, wusste Tiffany nicht, aber als Hexe wäre es ihr nie in den Sinn gekommen, einen solchen Ruf zu missachten. Schließlich waren die Steinkreise für ihr Land Schutz und Schirm gegen die Gefahren von der anderen Seite …
Einigermaßen besorgt hatte sie sich unverzüglich auf den Weg gemacht. Aber oben auf der Kreide war alles in schönster Ordnung. Wie immer. So auch heute.
Oder doch nicht? Zu Tiffanys Überraschung war sie nicht die Einzige, die es an diesem Tag zu den alten Steinen gezogen hatte. Während sie sich in der frischen, reinen Luft im Kreis drehte und dem Wind lauschte, der ihr das Laub über die Füße wehte, sprangen ihr flammend rote Haare und blau leuchtende Tätowierungen ins Auge, und als sich eine Handvoll besonders lustig umherwirbelnder Blätter auf die Hörner eines Kaninchenschädelhelms spießten, erklang auch schon ein unwirsches »Potzblitz!«.
»Die Kelda selber hat mich hergeschickt, damit ich auf die Steine achtgebe«, sagte Rob Irgendwer. Er saß auf einem Felsvorsprung und hielt nach allen Seiten hin Ausschau, als könnte jeden Moment eine Räuberbande auftauchen. Woher auch immer. Aber vor allem aus einem Steinkreis.
»Wenn die sich noch mal rübertraun, sollnse ruhig kommen, die Lumpenhunde. Wir sind bereit«, fügte er hoffnungsfroh hinzu. »Dann könnse unsre Gastfreundschaft am eignen Leib erleben.« Er richtete sich zu seiner vollen Größe von sechs Zoll auf und schwang sein Breitschwert gegen einen unsichtbaren Feind, wie immer ein sehr beeindruckendes Schauspiel.
»Die alten Räuber sind doch längst alle tot«, sagte Tiffany, obwohl sich sofort ihre Zweiten Gedanken zu Wort meldeten, sie solle gefälligst besser zuhören. Wenn Jeannie – Robs Frau und die Kelda des Clans der Wir-sind-die-Größten! – dunkle Wolken aufziehen sah, waren sie höchstwahrscheinlich schon im Anrollen.
»Na und? Tot sind wir auch«, sagte Rob.1
»Leider.« Tiffany seufzte. »Früher sind die Sterblichen einfach gestorben. Heute dagegen kommen sie gern auch mal wieder.«
»Die würden schön wegbleiben, wennse drüben ’ne tüchtige Portion von unserm Brose kriegen täten.«
»Brose? Was ist das denn?«, fragte Tiffany.
»So was wie Haferbrei, bloß mit allem möglichen Drum und Dran drin. Am liebsten auch noch mit ’nem Gläschen Branntwein oder ’nem Schuss von deiner Oma ihrem Schafeinreibemittel.«
Tiffany lachte, aber ihre Unruhe ließ sich nicht vertreiben. Sie musste unbedingt mit Jeannie sprechen. Um zu erfahren, warum ihren Stiefeln und der Kelda Übles schwante.
Bis zu dem großen grasigen Hügel mit der labyrinthischen Wohnhöhle der Wir-sind-die-Größten war es nicht weit. Vor dem Brombeerdickicht, das den Haupteingang verbarg, stießen Tiffany und Rob auf Jeannie, die an der frischen Luft ein belegtes Brot aß.
Hammelbraten, dachte Tiffany. Aber natürlich kannte sie das Abkommen, das den Kleinen Freien Männern als Gegenleistung dafür, dass sie die Lämmer vor den Sturzflugattacken der Krähen beschützten, hin und wieder ein altes Schaf zugestand. Wie für alle Jungtiere gab es nämlich auch für die Lämmer nichts Spannenderes, als sich in Gefahr zu begeben – und darin umzukommen. So beherrschten die Lämmer, die sich auf der Kreide verirrten, seit Kurzem ein ganz neues Kunststück: Sie sausten – manchmal sogar rückwärts – wie ein geölter Blitz über die Hügel, unter allen vier Klauen Größte, die sie zur Herde zurückverfrachteten.
Weil es in jedem Clan der Wir-sind-die-Größten nur eine Kelda gab, musste diese mit einem kräftigen Appetit ausgestattet sein, denn sie setzte ununterbrochen2 Kinder in die Welt, fast ausschließlich Söhne. War doch einmal eine Tochter darunter, galt das als großes Glück. Die Kelda war jedes Mal, wenn Tiffany ihr begegnete, wieder ein Stückchen breiter und runder geworden. Solche Hüften bekam man nicht von allein, daran musste man arbeiten. Und Jeannie war fleißig. Wovon auch das belegte Brot zeugte, das sie gerade verzehrte. Zwischen den beiden Scheiben klemmte nämlich – konnte das wahr sein? – eine halbe Hammelkeule. Eine reife Leistung für eine lediglich sechs Zoll messende Größtenfrau. Je älter und weiser Jeannie wurde, desto weniger beschrieb das Wort »Gürtel« eine Vorrichtung zum Festhalten ihres karierten Kilts, sondern bezog sich vielmehr auf ihren Äquator.
Soweit die jungen Größten keine Schnecken hüteten, übten sie sich im Ringkampf. Sie prallten gegeneinander, gegen die Wände und manchmal sogar gegen ihre eigenen Stiefel. Weil sie in Tiffany eine Art Kelda sahen und einen Heidenrespekt vor ihr hatten, hörten sie, als sie näher kam, sofort mit dem Raufen auf und wechselten bange Blicke.
»In einer Reihe aufstellen, Jungs, und dann zeigt ihr unserer kleinen großen Hexe, was ihr alles gelernt habt«, sagte ihre Mutter stolz und wischte sich das Hammelfett von den Lippen.
O nein, dachte Tiffany. Was sie mir wohl vorführen wollen? Hoffentlich nichts mit Schnecken …
Aber Jeannie befahl: »Sagt unserer Hexe das ABC auf. Du fängst an, Klein-bisschen-Kleinerer-als-der-kleine-Jock-Jock.«
Der erste kleine Größte in der Reihe kratzte sich verlegen an seiner Gürteltasche und schnipste einen Käfer daraus hervor. Dass die Gürteltaschen der Kleinen Freien Männer immer zu jucken schienen, lag wohl auch daran, dass ihr Inhalt des Öfteren noch lebendig war. Klein-bisschen-Kleinerer-als-der-kleine-Jock-Jock schluckte. »A steht für … Axt«, posaunte er los. »Für zum Rübeabschlagen«, fügte er großspurig hinzu.
»B steht für Breitschwert!«, krähte der Nächste, während er sich etwas vom Kilt wischte, was stark nach Schneckenschleim aussah. »Zum Knochenknacken.«
»Und C steht für Keule … Und wennste mir noch mal das Schwert reinbohrst, kriegste ’n Tritt in’n Hintern!«, schrie der Dritte, wirbelte herum und stürzte sich auf einen seiner Brüder.
Als sich das wilde Handgemenge ins Brombeerdickicht verlagerte, fiel ein sichelförmiges gelbes Etwas auf den Boden. Rob hob es blitzschnell auf und versteckte es hinter seinem Rücken.
Tiffany kniff die Augen zusammen. Das sah ihr doch verdächtig nach … ja, nach einem Zehennagel aus!
»Je nun.« Rob trat von einem Bein aufs andere. »Wennste den alten Männern die Zehennägel schneidst, fliegen die Dinger immer aussem Fenster und warten bloß drauf, dasse einer aufklaubt. Und weißte was? Die sind hart wie Nägel.«
»Ja, und wieso? Weil es Nägel sind«, gab Tiffany zurück. Dann hielt sie inne. Womöglich wäre jemand wie zum Beispiel der alte Herr Nimlet, der ohne fremde Hilfe nicht mal mehr aus dem Sessel hochkam, sogar froh darüber, dass er – zumindest teilweise – noch für etwas zu gebrauchen war.
Die Kelda nahm sie beiseite. »Dein Name ist in der Erde, Kind. Das Land spricht mit dir, Tir-far-thóinn, Land unter der Welle. Sprichst du auch mit ihm?«
»Zu selten«, sagte Tiffany. »Aber ich höre ihm zu, Jeannie.«
»Nicht jeden Tag?«, fragte die Kelda.
»Nein, nicht jeden Tag. Ich habe keine Zeit. Viel zu viel Arbeit.«
»Das sehe ich. Du weißt ja, dass ich über dich wache. In meinen Gedanken habe ich dich immer vor mir. Doch leider habe ich dich viel zu oft auch über mir. Wenn du nämlich auf dem Besen hin und her saust. Denk daran, du bist schon lange tot.«
Tiffany seufzte, sie war zum Umfallen müde. So viele Hausbesuche … Eine mitfühlende Hexe tat, was getan werden musste: einem alten Mütterlein das Feuerholz ins Haus tragen oder einen Eintopf kochen, bei einem kranken Bein oder hartnäckigen Schmerzen eine Kräutermedizin vorbeibringen, bei knurrendem Magen mit einem Korb »überschüssiger« Eier aushelfen, einem Säugling, dessen Eltern es an Geld fehlte, etwas Gebrauchtes zum Anziehen besorgen – und zuhören, ja, immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen haben. Nicht zu vergessen die Zehennägel, die hart wie Feuerstein sein konnten. Bei manchen alten Männern, die keine Familie oder Freunde mehr hatten, waren sie oft so lang und krumm, dass sie die Füße kaum noch in die Stiefel bekamen.
Das alles war Aufgabe der Hexen. So stopften sie die Löcher in den Maschen der Welt. Und der Lohn für die viele Mühe war … noch mehr Arbeit. Immer mehr. Wer das größte Loch grub, bekam einfach eine größere Schaufel in die Hand gedrückt.
»Aber heute habe ich auf das Land gehört, Jeannie«, sagte sie. »Es wollte, dass ich zum Steinkreis gehe …« Wie eine Frage hing der letzte Satz in der Luft.
Die Kelda seufzte. »Noch kann ich’s nich deutlich erkennen, aber irgendwas … stimmt nich, Tiffan. Der Schleier zwischen den Welten ist dünn und kann leicht reißen. Die Steine stehen zwar, der Durchgang ist versperrt – und nachdem du die Elfenkönigin ins Märchenland zurückbefördert hast, dürfte sie wohl immer noch geschwächt sein. Sie hat es bestimmt nich eilig, noch mal deinen Weg zu kreuzen. Trotzdem hab ich Angst. Es ist, wie wenn sich ein Nebel auf uns zuwälzt.«
Tiffany biss sich auf die Lippen. Wenn die Kelda besorgt war, musste auch sie auf das Schlimmste gefasst sein.
»Mach dich nicht verrückt«, sagte Jeannie beruhigend und musterte Tiffany forschend. »Wenn du uns brauchst, kannst du auf uns zählen. Und bis dahin halten wir für dich die Augen offen.« Damit vertilgte sie den Rest ihres Hammelbrots und wechselte das Thema. »Du hast doch einen Freund, ja? Preston heißt er, stimmt’s? Seht ihr euch eigentlich öfter?« Plötzlich war ihr Blick so scharf wie eine Axt.
»Nun ja«, sagte Tiffany, »er muss viel arbeiten, genau wie ich. Er im Krankenhaus, ich im Kreideland.« Zu ihrem Entsetzen wurde sie doch tatsächlich rot. Es fing in den Zehen an und kroch immer höher, bis sie aussah wie eine Tomate. Sie und rot werden? Wie ein Bauernmädchen, das einen Verehrer hatte? Ausgeschlossen! Schließlich war sie eine Hexe. »Aber wir schreiben uns«, fügte sie kläglich hinzu.
»Und reicht dir das? Briefe?«
Tiffany schluckte. Früher hatte sie – und nicht nur sie – geglaubt, Preston und sie wären so gut wie verlobt. Immerhin war er ein gebildeter junger Mann, der die neue Schule in der Scheune der Wehs leitete, bis er genug zusammengespart hatte, um in die große Stadt zu ziehen und Medizin zu studieren. Heute erwarteten noch immer alle – auch Tiffany und Preston –, dass sie eines Tages heiraten würden. Es fragte sich bloß, ob sie diese Erwartungen wirklich erfüllen musste. »Er ist furchtbar nett und witzig und kann wunderbar mit Worten umgehen«, erklärte sie. »Aber … unsere Arbeit ist uns beiden sehr wichtig. Man könnte sogar sagen, sie macht uns aus. Preston muss sich in Lady Sybils Gratishospital tüchtig ins Zeug legen. Und ich? Denke immer an Oma Weh, wie gern sie hier oben in den Hügeln gewohnt hat, ganz für sich allein, nur mit Donner und Blitz, ihren Hunden, und …« Sie brach ab. Jeannie legte ihr die kleine haselnussbraune Hand auf den Arm.
»Das ist doch kein Leben, Kind.«
»Ach, ich mag meine Arbeit, sie hilft den Menschen.«
»Aber wer hilft dir? So viel, wie du mit dem Besen unterwegs bist, denke ich manchmal, er müsste doch heißlaufen. Du kümmerst dich um alle – aber wer kümmert sich um dich? Wenn du schon ohne deinen Preston auskommen musst, wie wäre es dann mit dem Baron und seiner jungen Frau? Denen liegt das Wohlergehen ihrer Untertanen auch am Herzen. Zumindest so sehr, dass sie dir helfen würden.«
»Es liegt ihnen sehr am Herzen«, sagte Tiffany. Mit Schaudern erinnerte sie sich daran, dass alle auch einmal geglaubt hatten, sie und Roland, der heutige Baron, wären ein Paar. Warum war bloß alle Welt so versessen darauf, sie unter die Haube zu bringen? Wenn sie unbedingt heiraten wollte, würde sie schon selbst einen Ehemann finden. Das konnte doch wohl nicht so schwer sein. »Roland ist ein anständiger Kerl, auch wenn er noch nicht so ein guter Mensch ist wie sein Vater, bevor er starb. Und Lätitia …«
Obwohl Rolands Frau zaubern konnte, gefiel sie sich zurzeit in der Rolle der jungen Baronin. Und die spielte sie so gut, dass Tiffany sich gelegentlich fragte, ob die Baronin nicht vielleicht doch eines Tages über die Hexe in ihr triumphieren würde. Das Leben einer Adligen war mit Sicherheit um einiges keimfreier.
»Was du alles schon gemacht hast … Das hätte sonst keine hingekriegt«, fuhr Jeannie fort.
»Es gibt einfach zu viel Arbeit und nicht genügend Leute, die mit anpacken können.«
Mit einem seltsamen Lächeln fragte die Kelda: »Würdest du dir denn helfen lassen? Du darfst dich nicht davor scheuen, um Hilfe zu bitten. Stolz ist was Feines, Kind, aber früher oder später bringt er dich um.«
Tiffany lachte. »Jeannie, du hast immer recht. Aber ich bin eine Hexe, und uns steckt der Stolz in den Knochen.« Dabei musste sie an Oma Wetterwachs denken – die Hexe, die bei allen anderen Hexen als die weiseste und mächtigste unter ihnen galt. Oma Wetterwachs klang nie stolz, wenn sie etwas sagte, aber das hatte sie auch gar nicht nötig. Der Stolz gehörte einfach zu ihrem Wesen. Was es auch war, was eine Hexe in den Knochen haben musste, Oma Wetterwachs besaß es in rauen Mengen. Tiffany hoffte, dass sie als Hexe irgendwann auch einmal so stark sein würde.
»So ist’s recht«, sagte die Kelda. »Du bist unsere Hexe der Hügel, und wir brauchen eine Hexe mit Stolz im Leib. Aber wir wollen auch, dass du ein bisschen mehr an dich selbst denkst.« Sie musterte Tiffany mit ernstem Blick. »Also finde raus, wohin der Wind dich weht.«
Unten in den Grafschaften wehte der Wind heftig. Wütend heulte er um die Häuser – und um die Schornsteine des Schlosses von Lord Schwenk, das inmitten einer riesigen Parklandschaft am Ende einer langen Auffahrt thronte. Womit jeder, der nicht im Besitz eines zumindest halbwegs tauglichen Pferdes war, als Besucher von vornherein nicht infrage kam.
Das galt für die Mehrheit der ansässigen Landbevölkerung, hauptsächlich Bauern, die sich solche Anwandlungen aber vor lauter Arbeit sowieso nicht leisten konnten. Wenn sie überhaupt ein Pferd besaßen, dann einen großen, schweren Gaul mit haarigen Beinen, der in der Regel vor ein Fuhrwerk geschirrt wurde. Die dürren, überspannten Pferde, die die Auffahrt hinauftrabten oder eine Kutsche zum Schloss zogen, beförderten normalerweise Menschen von einem etwas anderen Schlag: Männer mit Grundbesitz und Vermögen, aber ohne viel Kinn, deren Frauen häufig dem Pferd ähnlich sahen.
Lord Schwenks Vater hatte Wohlstand und Titel von seinem Vater, einem berühmten Baumeister, geerbt, aber alles vertrunken.3 Doch mit List und Tücke, Schwindelei und, ja, auch mit diversen Schwenks war es seinem Sohn Harold gelungen, das Familienvermögen zurückzugewinnen, worauf er das Schloss um zwei Flügel erweiterte und sie mit hässlichen Möbeln vollstellte.
Er hatte drei Söhne und war sehr froh, dass seine Frau ihm, über den üblichen Erben und den Ersatzerben hinaus, einen zusätzlichen Stammhalter beschert hatte. Lord Schwenk legte nämlich Wert darauf, seinen Zeitgenossen immer etwas vorauszuhaben, und sei es, dass dieses Etwas nur ein Sohn war, für den er nicht einmal sonderlich viel übrig hatte.
Harry, der älteste der Söhne, verzichtete weitgehend auf die Schule, weil er seinem Vater bei der Verwaltung der Güter zur Hand ging und dabei vor allem lernte, wen man eines Wortes würdigte und wen nicht, wen man sich warmhalten musste und wem man die kalte Schulter zeigte.
An zweiter Stelle kam Hugo, der den Wunsch geäußert hatte, ein Mann der Kirche zu werden. Worauf sein Vater sagte: »Aber nur, wenn du dich der Omnianische Kirche anschließt! Alle anderen kommen nicht infrage. Ausgeschlossen, dass mein Sohn irgendeiner windigen Sekte beitritt!«4 Da Om zum Glück ein stummer Gott war, konnten die Priester seine Wünsche nach eigenem Gutdünken auslegen. Sonderbarerweise ließen diese sich kaum einmal mit »Gebt den Armen zu essen« oder »Helft den Alten« übersetzen, sondern eher mit »Bau dir eine prunkvolle Residenz« oder »Gönn dir ein siebengängiges Abendessen«. Deshalb war Lord Schwenk der Ansicht, dass es durchaus nicht schaden konnte, einen Geistlichen in der Familie zu haben.
Sein jüngster Spross war Gottfried. Und was aus ihm mal werden sollte, wusste niemand. Am allerwenigsten Gottfried selbst.
Der Hauslehrer, den Lord Schwenk für seine Söhne beschäftigte, hieß Herr Scharwanz. Die beiden älteren Jungen nannten ihn »Schwänzler« – und zwar nicht nur hinter seinem Rücken oder hinter vorgehaltener Hand. Aber für Gottfried war Herr Scharwanz ein Geschenk des Himmels. Der Lehrer war mit einer riesigen Büchertruhe eingezogen, weil er aus Erfahrung wusste, dass in manchen Schlössern kaum ein Buch zu finden war, es sei denn, es handelte von irgendeiner Schlacht, in der ein Mitglied der Familie eine ebenso spektakuläre wie schwachsinnige Heldentat vollbracht hatte. Herr Scharwanz und seine wunderbaren Bücher eröffneten Gottfried die Welt der großen Philosophen Ly Schwatzmaul, Orinjkrates, Xeno und Ibid sowie der berühmten Erfinder Goldauge Silberhand Daktylos und Leonardo von Quirm. Und allmählich wurde ihm klar, was er werden wollte.
Wenn Gottfried genug gelesen und gelernt hatte, unternahm Herr Scharwanz mit ihm Exkursionen, auf denen sie alte Knochen und versunkene Orte ausgruben, und erklärte ihm das Universum, über das sich der Junge bis dahin keinerlei Gedanken gemacht hatte. Je mehr Gottfried lernte, desto größer wurde sein Wissensdurst. Er wollte alles über die Große Schildkröte A’Tuin erfahren und über die Länder, die jenseits der Grafschaften lagen.
»Dürfte ich Sie etwas fragen?«, sagte er eines Tages. »Wie sind Sie eigentlich Lehrer geworden?«
Herr Scharwanz lachte. »Wie so oft – durch meinen eigenen Lehrer. Er hat mir ein Buch geschenkt, und danach habe ich alles gelesen, was ich finden konnte. Genau wie Ihr, junger Herr. Ihr steckt doch auch immer mit der Nase in einem Buch, und das nicht nur während des Unterrichts.«
Als Lord Schwenk sich wieder einmal über den Hauslehrer lustig machte, widersprach ihm seine Frau: Herr Scharwanz sei ein Juwel.
Gottfrieds Vater schnaubte verächtlich. »Ein Juwel? Der Mann ist ein Eierkopf, der im Dreck nach Knochen und vertrockneten Leichen buddelt! Und überhaupt: Wen interessiert schon, wo Vierecks liegt? Da will doch sowieso keiner hin!«5
Ausgelaugt und kraftlos erhob die Mutter noch ein letztes Mal Einspruch: »Aber Gottfried kann ausgezeichnet lesen, und Herr Scharwanz hat ihm drei Sprachen beigebracht. Er beherrscht sogar ein paar Brocken Offleranisch!«
Wieder erntete sie ein Schnauben. »Womit er höchstens dann etwas anfangen kann, wenn er Zahnarzt wird! Ha, Fremdsprachen sind die reine Zeitverschwendung. Heutzutage spricht doch sowieso jeder Ankh-Morporkisch.«
Aber zu Gottfried sagte die Mutter: »Lies du nur, mein Junge. Die Bücher ebnen dir den Weg. Wissen ist der Schlüssel zu allem.«
Schon bald darauf entließ Lord Schwenk den Lehrer mit den Worten: »Sie setzen ihm bloß Flausen in den Kopf. Wozu? Aus dem Jungen wird sowieso nichts. Im Gegensatz zu seinen Brüdern.«
Die Sätze hallten als Echo durch die langen Gänge des Schlosses, und als Gottfried sie aufschnappte, dachte er: Ganz egal, was ich mal werde: Ich will auf keinen Fall so werden wie mein Vater!
Seines Hauslehrers beraubt, streifte er im Schloss umher und brachte sich dabei selbst allerhand Neues bei. Er hielt sich oft beim Stallburschen Jennerwein auf, der trotz seiner jugendlichen Berufsbezeichnung schon steinalt war und die Gesänge aller Vögel auf der Welt erkennen und sogar nachpfeifen konnte.
Jennerwein war auch dabei, als Gottfried Mephisto fand. Eine Geiß hatte Junge geworfen, zwei gesunde und ein kleines, schwächliches Zicklein, das von seiner Mutter verstoßen worden war.
»Ich will versuchen, das Böcklein zu retten«, verkündete Gottfried, nachdem er es im Stroh gefunden hatte. Er blieb die ganze Nacht wach, um das Junge am Leben zu erhalten, und ließ es die Milch der Mutter von seinen Fingern schlecken, bis es schließlich neben ihm in einem auseinandergerupften Heuballen einschlief, der sie beide schön warm hielt.
Was für ein Winzling!, dachte Gottfried, während er dem Zicklein in die geschlitzten Augen sah. Ich muss ihm eine Chance geben.
Und das Zicklein dankte ihm seine Fürsorge. Es entwickelte sich zu einem kräftigen jungen Bock, der teuflisch fest ausschlagen konnte und Gottfried auf Schritt und Tritt nachlief. Sobald er seinen Herrn in Gefahr wähnte, ging er mit gesenktem Kopf zum Angriff über. Da er fast jeden für eine Gefahr hielt, der in Gottfrieds Nähe kam, musste manch ein Diener oder Gast schnell zur Seite springen, weil er sich den gesenkten Hörnern der Ziege gegenübersah.
»Warum habt Ihr dem Teufelsbock den Namen Mephisto gegeben, junger Herr?«, fragte Jennerwein eines Tages.
»Den hab ich in einem Buch6 gelesen. Ich wusste gleich, das ist ein sehr guter Name für eine Ziege«, antwortete Gottfried.
Gottfried wuchs heran, vom Knaben zum Burschen, vom Burschen zum jungen Mann, und weil er klug war, achtete er in all den Jahren darauf, seinem Vater so selten wie möglich unter die Augen zu treten.
Einmal sattelte Jennerwein ihm ein Pferd, und sie ritten zu dem Fuchsbau an der Grenze von Lord Schwenks Ländereien, den sie schon von früheren Besuchen her kannten. Sie pirschten sich an und beobachteten, wie die Füchsin mit ihren Welpen spielte.
»Da lacht einem das Herz im Leibe«, flüsterte Jennerwein. »Eine Füchsin muss fressen und ihre Jungen füttern. Wenn die Biester bloß nicht so eine Vorliebe für meine Hühner hätten! Weil sie Tiere töten, die für uns wichtig sind, töten wir sie. Das ist der Lauf der Welt.«
»Aber warum muss das so sein?«, fragte Gottfried, von Mitleid für die Füchsin gepackt.
»Wir brauchen die Hühner, wir müssen sie schützen. Und darum jagen wir die Füchse«, sagte Jennerwein. »Wisst Ihr, warum ich Euch heute hergebracht habe, Master Gottfried? Euer Vater will Euch sicher schon bald auf die Jagd mitnehmen. Und womöglich geht es dann sogar gegen diese Füchsin hier.«
»Ich verstehe, ja.« Die Fuchsjagd war nichts Neues für Gottfried. Schon als er noch in den Windeln lag, musste er beim Aufbruch der Jagdgesellschaft dabei sein. »Wir müssen unsere Hühner beschützen, und die Welt kann grausam und gnadenlos sein. Aber zum reinen Vergnügen zu töten, das ist nicht richtig. Es ist furchtbar! Eine Hinrichtung, sonst nichts. Müssen wir alles töten? Sogar eine Fuchsmutter, die für ihre Jungen sorgt? Wir nehmen und nehmen, ohne zu geben.« Gottfried stand auf und ging zurück zu seinem Pferd. »Ich will nicht jagen, Jennerwein. Glaube mir, Hass ist meinem Wesen fremd. Ich hasse nicht einmal meinen Vater, aber die Jagd würde ich gern ein für alle Mal aus der Welt schaffen.«
Der alte Stallbursche machte eine besorgte Miene. »Seid besser auf der Hut, junger Herr. Ihr kennt Euren Herrn Vater. Er hat einen eisernen Willen.«
»Er hat auch ein Herz aus Eisen!«, sagte Gottfried bitter.
»Aber wenn Ihr es ihm erklärt – oder Eurer Frau Mutter … Vielleicht versteht er ja doch, dass Ihr für die Jagd noch nicht bereit seid.«
»Das wäre zwecklos. Wenn er einmal einen Entschluss gefasst hat, lässt er sich nicht mehr davon abbringen. Manchmal bekomme ich mit, wie Mutter weint. Sie will nicht, dass es jemand merkt. Aber ich weiß es.«
Da sah er einen Habicht am Himmel, und plötzlich dachte er: Frei sein! Ja, das wünsche ich mir: Freiheit.
»Ich würde gern fliegen können, Jennerwein«, sagte er. »Wie ein Vogel. Wie Langas.«7
Wie aufs Stichwort sauste eine Hexe auf ihrem Besen über sie hinweg, dem Weg des Habichts folgend. Gottfried zeigte zum Himmel und sagte: »Ich will auch einen Besen. Ich will Hexe werden.«
Und der Alte antwortete: »Das geht nicht, mein Junge. Männer können keine Hexen sein, das weiß doch jeder.«
»Aber warum nicht?«
Der Alte zuckte mit den Schultern. »Das weiß keiner.«
»Dann finde ich es heraus«, sagte Gottfried.
Mit kreidebleicher, aber entschlossener Miene ritt er zum ersten Mal auf die Jagd. Heute kam es darauf an: Er musste versuchen, seinen Mann zu stehen.
Im gestreckten Galopp ging es über Stock und Stein, man hielt sich nicht auf mit Traben, da fiel man schon lieber in den Graben. Kühn übersprangen die Reiter Hecken und Gatter – manchmal sogar ohne Pferd. Gottfried hielt sich am Ende der Jagdgesellschaft, bis er sich unbemerkt davonstehlen konnte, und umritt den Wald in entgegengesetzter Richtung. Das Herz war ihm schwer, vor allem, wenn das Bellen der Hunde in freudiges Kläffen umschlug, weil sie eine Beute aufgestöbert hatten.
Irgendwann wurde es Zeit, ins Schloss zurückzukehren. Dort befand sich bereits alles in dem seligen Zustand, in dem es noch ein Morgen gibt. Mit einem heißen Getränk, tüchtig angereichert mit Schnaps, der große Ähnlichkeit mit dem Speziellen Schafeinreibemittel von Tiffanys Großmutter hatte, beging man das Ende der Jagd. Die Belohnung für die heimgekehrten Helden! Sie hatten die Jagd überlebt! Hussa! Die Jäger kippten den Fusel in sich hinein, dass er ihnen über die nicht vorhandenen Kinne lief.
Aber Lord Schwenk musterte Gottfrieds Pferd – das einzige, das nicht von Schweiß troff und dessen Beine nicht mit Lehm bespritzt waren –, und sein Zorn kannte keine Grenzen.
Die flehenden Blicke der Mutter waren vergeblich. Als die Brüder Gottfried packten und festhielten, musste sie sich abwenden.
Während Lord Schwenk seinem jüngsten Sohn das Blut einer Füchsin ins Gesicht schmierte, brüllte er ihn wutschnaubend an: »Wo warst du? Warum warst du nicht dabei, als wir die Fähe zur Strecke gebracht haben? Du wirst auf die Jagd gehen, junger Mann – und zwar mit Freude! Genau wie ich, als ich jung war, und wie mein Vater vor mir. Das gehört in unserem Haus zur Tradition. Hast du verstanden? Jedes männliche Mitglied unserer Familie erlegt in deinem Alter sein erstes Wild. Wie kannst du es wagen, den Stab darüber zu brechen? Ich schäme mich für dich!«
Er zog ihm die Reitgerte über den Rücken.
Gottfried, dem das Blut der Füchsin noch vom Gesicht rann, sah seine Mutter an. »So ein wunderschönes Tier! Warum musste es auf diese Weise sterben? Zum bloßen Vergnügen?«
»Bitte, reize deinen Vater nicht!«, flehte die Mutter.
»Ich beobachte die Füchse im Wald, aber ihr? Ihr jagt sie. Und wozu? Um sie zu essen? Nein. Wir – die Unsäglichen – hetzen und töten, um unseren Blutdurst zu stillen. Nur zu unserem Vergnügen.«
Wusch.
Das tat weh. Aber plötzlich überkam Gottfried … ja, was? Die Gewissheit, dass es möglich war, etwas Gutes zu bewirken. Und er wusste, er war der Richtige dafür. Er richtete sich zu seiner vollen Größe auf und riss sich von seinen Brüdern los.
»Ich muss dir danken, Vater«, sagte er energisch, »denn ich habe heute eine wichtige Lektion gelernt. Aber ich lasse mich nie wieder von dir schlagen. Und wiedersehen wirst du mich erst, wenn du ein anderer geworden bist. Hast du das begriffen?« Sein Ton war jetzt seltsam feierlich, dem Anlass angemessen.
Harry und Hugo sahen ihn fast ehrfürchtig an und machten sich auf eine Explosion gefasst. Die Jagdgäste, die sich taktvoll abgewandt hatten, damit Lord Schwenk seinen Sohn ungestört zur Rede stellen konnte, gaben sich nicht einmal mehr den Anschein, als wären sie an der Auseinandersetzung nicht interessiert. Die Welt der Jagd war aus dem Lot geraten. Eine eisige, atemlose Stille senkte sich herab.
Während Lord Schwenk noch wie versteinert dastand, führte Gottfried sein Pferd in den Stall.
ENDE DER LESEPROBE