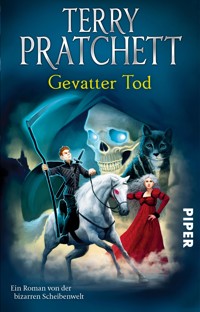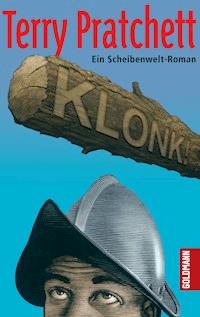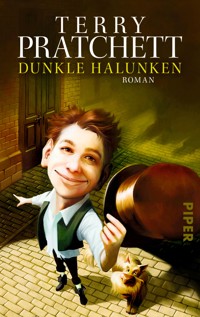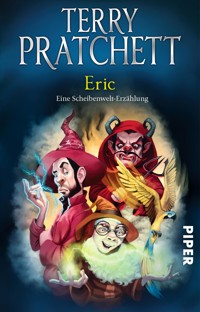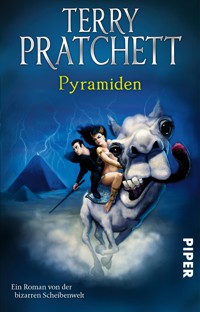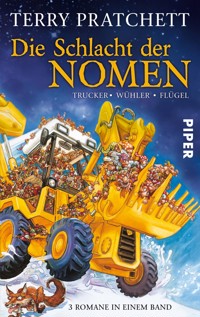9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manhattan
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Lange Erde
- Sprache: Deutsch
Ein Aufbruch zu neuen Welten: Die große neue Serie!
Ein kleiner angekokelter Plastikkasten, ein paar angelötete Drähte, ein Schalter, eine Kartoffel … Als die Polizistin Monica Jansson im Jahr 2015 in den verkohlten Ruinen eines Hauses auf diese eher zweifelhafte Apparatur stößt, ahnt sie nicht, dass der Prototyp einer bahnbrechenden Erfindung vor ihr steht. Einer Erfindung, die die Geschichte der Menschheit für immer verändern wird. Denn der kleine Kasten ist ein Wechsler, mit dem es von nun an jedem möglich sein wird, mit einem kleinen Schritt in die »Lange Erde« hinauszutreten: eine unendliche Abfolge von parallelen Welten, der unseren mehr oder weniger ähnlich und von Menschen unbewohnt. Schon bald setzt auf der alten Erde ein wilder Goldrausch ein. Denn die Lange Erde birgt unendliche Möglichkeiten – und unendliche Gefahren …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2013
Sammlungen
Ähnliche
2015: Madison, Wisconsin. Polizeibeamtin Monica Jansson untersucht die verkohlten Ruinen des Hauses und stößt auf eine merkwürdige Vorrichtung: ein altes Plastikkästchen mit ein paar verlöteten Drähten, einem Dreiwegschalter und – einer Kartoffel …
Was so harmlos aussieht, ist der Prototyp einer Erfindung, die unsere Welt für immer verändern wird. Denn unsere bisher so einzigartige Erde ist nur eine von unendlich vielen Parallelwelten im Gefüge der »Langen Erde«, und dieser Kasten ist ein »Wechsler«: mit ihm ist es von nun an jedem Menschen möglich, mit einem kleinen Schritt in die »Lange Erde« hinauszuschreiten. Die fundamentalen physikalischen Gesetzmäßigkeiten sind dabei überall gleich – doch all die Glücks- und Unglücksfälle, die das Gesicht unserer Welt geformt haben, von Sintfluten zu Meteoriteneinschlägen, unterscheiden sich. Und je weiter man reist, desto abenteuerlicher werden dabei die Parallelwelten.
Auf der guten alten Erde bricht das Chaos aus: Bedeuten unendliche Welten nicht auch unendlichen Reichtum? Unendliche Macht? Wem gehört die »Lange Erde« – zumal alle anderen Welten von Menschen unbewohnt sind? Neue, mächtige Kooperationen schicken wagemutige Pioniere aus, die in langen, gefährlichen Expeditionen nie gesehene, neue Welten erforschen. Einer von ihnen ist Joshua Valienté, der schon immer Freiheit und Weite der »Langen Erde« suchte. Nun macht er sich mit dem fast allwissenden Computer Lobsang auf eine faszinierende Reise ins Ungewisse …
Weitere Informationen zu Terry Pratchett und Stephen Baxter finden Sie am Ende des Buches.
Terry Pratchett und Stephen Baxter
Die Lange Erde
Roman
Ins Deutsche übertragen von
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel »The Long Earth« bei Doubleday, an imprint of Transworld Publishers, London. Die Bauanleitung des Wechslers stammt von Rich Shailer. Die Übersetzungen der Zitate von Keats und von Wordsworth stammen beide von Werner von Koppenfels und sind folgendem Werk entnommen: Friedhelm Kemp, Englische und amerikanische Dichtung, Bd. 2 – Von Dryden bis Tennyson, Hrg. von Werner von Koppenfels und Manfred Pfister, München, 2000. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Übersetzers.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2012
by Terry and Lyn Pratchett and Stephen Baxter
This edition is published by arrangement with Transworld Publishers, a division of Random House Group Ltd.
All rights reserved.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2013
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Die Nutzung des Labels Manhattan erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Hans-im-Glück-Verlags, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Umschlaggestaltung: buxdesign, München, unter Verwendung eines Entwurfs von R. Shailer/TW
Umschlagmotiv: © Getty Images
Redaktion: Uta Rupprecht
Für Lyn und Rhianna, wie immer
T. P.
Für Sandra
S. B.
1
Auf einer Waldlichtung:
Als Schütze Percy erwachte, zwitscherten Vögel. Vogelgezwitscher hatte er lange nicht mehr gehört, dafür sorgten schon die Kanonen. Eine Zeit lang blieb er einfach liegen und genoss die köstliche Ruhe.
Andererseits wunderte er sich ein wenig benommen darüber, warum er in feuchtem, aber würzig duftendem Gras und nicht auf seinem Bettzeug lag. Ah, wie herrlich – duftendes Gras! Dort, wo er eben noch gewesen war, hatte es nicht besonders gut geduftet. Er war eher an den Geruch von Kordit, heißem Öl, verbranntem Fleisch und den Gestank ungewaschener Männer gewöhnt.
Er fragte sich, ob er tot war. Schließlich war es ein mörderisches Bombardement gewesen.
Falls er wirklich tot war, dann ging das hier nach der Hölle aus Lärm und Schreien und Schlamm, die er verlassen hatte, durchaus als Himmel durch. Und wenn es nicht der Himmel war, würde ihm sein Sergeant ohnehin gleich die Hölle heißmachen. Er würde Percy hochreißen, kurz inspizieren und dann sofort zur Verpflegungsstelle schicken, damit er sich einen Tee und ein belegtes Brot geben ließ. Aber weit und breit war kein Sergeant zu sehen, und bis auf das Zwitschern der Vögel in den Bäumen war auch nichts zu hören.
Als die Morgendämmerung den Himmel langsam heller werden ließ, fragte er sich: »Was für Bäume?«
Da Schütze Percy ein praktisch veranlagter und vernünftiger junger Mann war, beschloss er, sich in diesem Traum keine Sorgen wegen irgendwelcher Bäume zu machen. Bäume hatten noch nie versucht, ihn umzubringen. Er legte sich wieder auf den Rücken und musste wohl ein wenig eingenickt sein, denn als er die Augen wieder aufschlug, war es helllichter Tag. Er hatte Durst.
Tageslicht – aber wo? Na ja, wahrscheinlich in Frankreich. Es musste Frankreich sein. Percy konnte von der Granate, die ihn ausgeknipst hatte, nicht sehr weit weggeschleudert worden sein. Es musste sich immer noch um Frankreich handeln, aber er lag mitten im Wald, wo überhaupt kein Wald sein durfte. Außerdem fehlten die üblichen Frankreichgeräusche, also das Donnern der Geschütze und das Schreien der Männer.
Die ganze Sache war ihm schlichtweg ein Rätsel. Außerdem war er halb am Verdursten.
Also packte er inmitten dieser ätherischen, von Vögeln heimgesuchten Stille alle seine Sorgen in das, was von seinem alten Tornister noch übrig war, und dachte sich, dass in dem Lied vom Tornister und den Sorgen wohl ein wahrer Kern steckte: Warum sollte man sich groß Sorgen machen? Es war tatsächlich alles sinnlos, jedenfalls spätestens dann, wenn man mit ansehen musste, wie sich links und rechts von einem Männer in nichts auflösten wie Tau am Morgen.
Aber als er sich erhob, spürte er das vertraute Ziehen im linken Bein bis in den Knochen hinein. Es war das Überbleibsel einer Wunde, die nicht ausgereicht hatte, um ihn nach Hause zu schicken, ihm aber wenigstens zu einer Versetzung zu den Jungs von der Tarnung und zu einem verbeulten Farbenkasten im Tornister verholfen hatte. Wenn sein Bein immer noch wehtat, dann war das hier kein Traum! Aber er befand sich nicht mehr dort, wo er zuvor gewesen war, so viel war sicher.
Als er so zwischen den Bäumen hindurchging, dorthin, wo weniger Bäume zu stehen schienen als überall sonst, schoss ihm ein flirrender, eiskalter Gedanke durch den Kopf: Warum haben wir gesungen? Sind wir verrückt gewesen? Was zum Teufel haben wir uns eigentlich dabei gedacht? Überall lagen Arme und Beine herum, verwandelten sich Männer in einen Nebel aus Fleisch und Knochen! Und wir haben gesungen!
Was sind wir doch für elende, hirnverbrannte Idioten gewesen!
Eine halbe Stunde später ging Schütze Percy einen Hügel hinab zu einem Bach in einer flachen Senke. Das Wasser schmeckte ein bisschen brackig, aber in seinem Zustand hätte er auch aus einem Pferdetrog getrunken, und zwar direkt neben dem Pferd.
Er folgte dem Bach, bis er in einen Fluss mündete, keinen sehr breiten Fluss, aber Schütze Percy war ein Junge vom Lande und wusste, dass es am Flussufer Krebse gab. Eine halbe Stunde später kochten besagte Flusskrebse fröhlich vor sich hin. Die Viecher waren größer als alle Flusskrebse, die er je gesehen hatte! Und es gab unglaublich viele davon! Und wie saftig sie waren! Er schlemmte, bis ihm der Bauch wehtat, drehte seinen Fang an einem grünen Stock über einem eilig entfachten Feuer und riss die Krebse mit bloßen Händen auseinander. Vielleicht bin ich wirklich tot, dachte er jetzt, und längst im Himmel. Eigentlich hätte ich überhaupt nichts dagegen, denn von der Hölle habe ich, weiß Gott, schon mehr als genug gesehen.
Am Abend lag er auf einer Lichtung am Fluss, den Kopf auf seinen Tornister gebettet. Als die Sterne aufgingen und heller als je zuvor am Himmel glänzten, fing Percy zu singen an, das Lied vom Tornister und den Sorgen: »Pack Up Your Troubles In Your Old Kit Bag.« Noch ehe er zu Ende gesungen hatte, verstummte er und schlief den Schlaf der Gerechten.
Als ihm die Sonne wieder übers Gesicht strich, erwachte Percy erholt, setzte sich auf – und erstarrte vor Schreck. Angesichts der Blicke, mit denen er ruhig und gelassen gemustert wurde, blieb er stocksteif wie eine Statue sitzen. Vor ihm aufgereiht hockte ein ganzes Dutzend dieser Kerle und betrachtete ihn.
Wer waren sie? Was waren sie? Sie sahen ein bisschen wie Bären aus, aber sie hatten keine Bärengesichter, oder auch ein bisschen wie Affen, nur dicker. Und sie betrachteten ihn in aller Seelenruhe. Das waren doch bestimmt keine Franzosen?
Trotzdem probierte er es mit seinem Französisch: »Parlee wulle wuu?«
Sie sahen ihn verständnislos an.
In die Stille hinein räusperte sich Percy, weil er das Gefühl hatte, dass etwas mehr von ihm erwartet wurde, und stimmte abermals sein »Pack Up Your Troubles« an.
Die Kerle lauschten verzückt, bis das Lied zu Ende war. Dann sahen sie einander an. Schließlich, als hätten sie sich darüber verständigt, trat einer von ihnen vor und sang Percy das Lied seinerseits formvollendet und fehlerlos vor.
Schütze Percy hörte ihm mit vor Staunen offenem Mund zu.
*
Ein Jahrhundert später:
Die Prärie war flach und üppig grün, hier und da stand ein Eichenwäldchen. Der Himmel darüber war geradezu sprichwörtlich blau. Am Horizont bewegte sich etwas, wie ein Wolkenschatten: eine gewaltige, dahinziehende Tierherde.
Eine Art Seufzen war zu hören, ein Ausatmen. Ein Beobachter, der nahe genug gewesen wäre, hätte womöglich einen Windhauch auf der Haut gespürt.
Im Gras lag eine Frau.
Sie hieß Maria Valienté. Sie trug ihren rosa Angoralieblingspullover. Sie war erst fünfzehn, aber sie war schwanger, und das Kind konnte jeden Moment kommen. Die Wehen hatten ihren mageren Körper fest im Griff. Noch vor einem Augenblick hatte sie nicht gewusst, ob sie mehr Angst vor der Geburt oder vor dem Zorn Schwester Stephanies haben sollte, die ihr das Affenarmband weggenommen hatte – das einzige Andenken, das Maria von ihrer Mutter besaß –, weil es angeblich ein Zeichen der Sünde war.
Und jetzt das. Freier Himmel, wo eigentlich eine nikotinfleckige Stuckdecke hätte sein müssen. Gras und Bäume, wo gerade noch ein abgetretener Teppich gewesen war. Alles war falsch. Wo war dieses Hier? War sie überhaupt noch in Madison? Wie war es überhaupt möglich, dass sie hier war?
Aber diese Fragen spielten momentan keine Rolle. Die Schmerzen hatten sie wieder gepackt, und sie spürte, dass das Baby kam. Hier war niemand, der ihr helfen konnte, nicht einmal Schwester Stephanie. Sie schloss die Augen und schrie. Und presste.
Das Baby purzelte ins Gras. Maria wusste, dass sie noch auf die Nachgeburt warten musste. Als das erledigt war, spürte sie eine klebrige Wärme zwischen den Beinen, und da lag ein Baby, das mit einem schleimigen, blutigen Film überzogen war. Es – er – machte den Mund auf und stieß ein leises Wimmern aus.
Aus der Ferne ertönte etwas wie grollender Donner. Ein tiefes Brüllen, wie man es sonst nur im Zoo hörte. Wie von einem Löwen.
Einem Löwen? Maria schrie wieder, diesmal vor Angst …
Der Schrei brach abrupt ab, wie ausgeschaltet. Maria war verschwunden. Der Neugeborene war allein.
Ganz allein – bis auf das Universum. Das auf ihn einströmte und mit unendlich vielen Stimmen auf ihn einredete. Und dahinter eine unermessliche Stille.
Sein ängstliches Geschrei wurde zu einem sanften Gurgeln. Die Stille war beruhigend.
Eine Art Seufzen war zu vernehmen, wie ein Ausatmen. Maria befand sich wieder im Grünen, unter dem blauen Himmel. Sie setzte sich auf und schaute sich ängstlich um. Ihr Gesicht war grau; sie verlor viel Blut. Aber ihr Baby war hier.
Sie sammelte das Baby und die Nachgeburt ein – sie hatte noch nicht einmal die Nabelschnur durchtrennt –, wickelte den Kleinen in ihren Angorapullover und wiegte ihn in den Armen. Sein Gesichtchen sah eigenartig friedlich aus. Sie hatte gedacht, sie hätte ihn verloren. »Joshua«, sagte sie. »Dein Name ist Joshua Valienté.«
Ein leises Plopp, und weg waren sie.
Auf der grasbewachsenen Ebene blieb lediglich ein schleimiger Fleck aus halb getrocknetem Blut und anderen Körperflüssigkeiten zurück, und natürlich das Gras und der Himmel. Aber der Blutgeruch würde schon bald Aufmerksamkeit auf sich lenken.
*
Und vor langer, langer Zeit auf einer Welt, so nah wie ein Schatten:
Eine ganz andere Version von Nordamerika umfing ein riesiges salziges Binnenmeer. In diesem Meer wimmelte es vor mikrobiellem Leben. All dieses Leben diente einem einzigen kolossalen Organismus.
Und auf dieser Welt, unter einem wolkenverhangenen Himmel, knisterte die Gesamtheit des trüben Meeres mit einem einzigen Gedanken.
Ich …
Diesem Gedanken folgte ein weiterer.
Zu welchem Zweck?
2
Die Bank neben dem modern aussehenden Getränkeautomaten war überaus bequem. Schon seit Längerem hatte Jo-shua Valienté nicht mehr so etwas Weiches gespürt; auch dieses wattige Gefühl nicht, das ihn immer befiel, wenn er sich in einem Gebäude aufhielt, in dem der Welt durch das Mobiliar und die Teppiche eine ganz bestimmte Geräuschlosigkeit auferlegt wurde.
Neben der luxuriösen Sitzbank lag ein Stapel Hochglanzmagazine, aber Joshua wusste auch mit glänzendem Papier nicht besonders viel anzufangen. Bücher? Bücher waren in Ordnung. Joshua mochte Bücher, besonders Taschenbücher: leicht und einfach zu tragen, und wenn man sie nicht noch mal lesen wollte, tja, dann gab es für einigermaßen weiches Papier immer eine gute Verwendung.
Normalerweise lauschte er, wenn er nichts zu tun hatte, einfach der Stille.
Die Stille hier war jedoch sehr stumpf und undeutlich, sie wurde von den Geräuschen der profanen Welt beinahe erstickt. Merkten die Menschen in diesem geschleckten Gebäude überhaupt, wie laut es hier war?
Das Brüllen der Klimaanlagen und Computerventilatoren, das gedämpfte Murmeln aus den Telefonen, gefolgt von den Lauten der Leute, die erklärten, dass sie eigentlich nicht anwesend seien, man aber seinen Namen nach dem Piepton hinterlassen könne, und das wiederum gefolgt von dem Piep. Joshua befand sich im Firmensitz des transEarth-Instituts, einem Zweig der Black Corporation. Das gesichtslose Büro aus Rigips und Chrom wurde von einem riesigen Logo beherrscht. Es stellte eine Schachfigur dar – den Springer. Das hier war nicht Joshuas Welt. Nichts davon war seine Welt. Genau genommen hatte er überhaupt keine Welt. Er hatte sie alle.
Die gesamte Lange Erde.
*
Viele Welten, eine Erde nach der anderen, mannigfach. Mehr Welten, als man zählen konnte, wie von einigen behauptet wurde. Um von einer zur anderen zu gelangen, musste man lediglich einen Schritt zur Seite machen und immer so weiter, eine endlose Kette.
Für Experten wie Professor Wotan Ulm von der Universität Oxford war das alles eine Quelle gewaltiger Irritation. »Diese vielen Parallel-Erden«, erläuterte er der BBC, »sind in jeder Hinsicht identisch – bis auf die Details. Ach ja, und sie sind alle leer. Genauer gesagt sind sie natürlich voll, hauptsächlich mit Wäldern und Sümpfen. Große, dunkle, schweigende Wälder und tiefe, alles verschlingende, tödliche Sümpfe. Aber es gibt keine Menschen. Unsere Erde ist überfüllt, aber die Lange Erde ist leer. Pech für Adolf Hitler, dass er seinen Krieg auch anderswo nicht gewinnen durfte! – Wissenschaftlern fällt es schwer, über die Lange Erde zu reden, ohne von Mannigfaltigkeiten der M-Branen oder Quanten-Multiversen zu brabbeln. Was, wenn sich das Universum jedes Mal verzweigt, sobald ein Blatt vom Baum fällt, wenn es in jedem Augenblick Milliarden neuer Ableger bildet? Genau das scheint uns die Quantenphysik zu sagen. Dabei geht es nicht darum, dass eine Milliarde Wirklichkeiten erfahren werden müssten; die Quantenzustände überlagern sich wie die Obertöne einer einzelnen Violinensaite. Womöglich entstehen aber unter bestimmten Voraussetzungen – zum Beispiel, wenn ein Vulkan in Aufruhr gerät, ein Komet die Atmosphäre streift, wenn reine Liebe schnöde hintergangen wird –, tatsächlich andere empirische Wirklichkeiten, sozusagen ein Zopf aus lauter Quantensträngen. Vielleicht werden diese Zöpfe dann aufgrund ihrer Ähnlichkeit durch irgendeine höhere Dimension zusammengezogen und eine ganze Weltenkette fädelt sich hintereinander auf. Oder irgendwie so! Aber vielleicht ist das alles auch nur ein Traum, eine kollektive Fantasie der Menschheit.
Letztendlich stehen wir diesem Phänomen genauso ratlos gegenüber, als wäre damals Dante ein kurzer Blick auf Hubbles expandierenden Kosmos gewährt worden. Sogar die Sprache, mit der wir es zu beschreiben versuchen, ist womöglich nicht zutreffender als die Kartenspiel-Analogie, die den meisten Menschen am verständlichsten erscheint: die Lange Erde als großer Stapel dreidimensionaler Spielkarten, übereinandergelagert in einem höherdimensionalen Raum, wobei jede Karte eine völlig eigene Erde darstellt. Bezeichnenderweise steht die Lange Erde den meisten Menschen offen. So gut wie jeder kann in diesem Spielkartenstapel auf und ab reisen, sich gewissermaßen durch die Karten hindurchbohren. Die Leute nehmen diesen neuen Raum für sich in Anspruch. Und warum auch nicht? Es ist ein Urinstinkt! Im Grund fürchten wir Savannenaffen uns im Dunkeln immer noch vor dem Leoparden. Wenn wir uns möglichst großflächig verteilen, kann er uns nicht alle erwischen. – Das alles ist zutiefst verstörend. Es will einfach nicht passen! Und warum ist der Menschheit dieses gigantische Kartenspiel ausgerechnet jetzt angeboten worden, wo wir so dringend wie nie zuvor mehr Platz brauchen? Andererseits ist die Wissenschaft letztendlich nicht mehr als eine Abfolge von Fragen, die zu neuen Fragen führen, was ja auch gut so ist, sonst wäre sie ja keine besonders attraktive Karriereoption, oder? Aber ganz egal wie die Antworten auf derlei Fragen auch lauten mögen – glauben Sie mir, ab jetzt dürfte sich für die Menschheit alles ändern … Reicht das, Jokaste? Irgendein Idiot hat mit seinem Kugelschreiber geklickt, als ich den Vergleich mit Dante gebracht habe.«
Joshua hatte natürlich begriffen, dass es transEarth allein deshalb gab, um aus diesen Veränderungen Profit zu schlagen. Vermutlich war er genau deshalb hierhergebracht worden – mehr oder weniger gegen seinen Willen und aus einer sehr weit entfernten Welt.
Endlich ging die Tür auf. Eine junge Frau, die einen Laptop so dünn wie Blattgold vor der Brust hielt, kam herein. Im Heim hatte Joshua auch so ein Gerät, allerdings ein klobigeres, altmodischeres Modell, mit dem er hauptsächlich nach Rezepten für Nahrung aus der Natur suchte. »Mr Valienté? Freut mich, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich heiße Selena Jones. Herzlich willkommen im transEarth-Institut.«
Sie ist zweifellos sehr attraktiv, dachte er. Joshua mochte Frauen und hatte angenehme Erinnerungen an seine wenigen, kurzen Beziehungen. Aber er hatte noch nie viel Zeit mit Frauen verbracht und fühlte sich in ihrer Gegenwart immer ein wenig unsicher. »Willkommen? Sie haben mir keine Wahl gelassen. Sie haben meine Mailbox ausfindig gemacht. Das bedeutet, dass Sie von der Regierung sind.«
»Nein, da liegen Sie falsch. Gelegentlich arbeiten wir für die Regierung, aber wir gehören mit Sicherheit nicht dazu.«
»Legal?«
Sie lächelte missbilligend. »Lobsang hat Ihren Mailbox-Code ausfindig gemacht.«
»Und wer ist Lobsang?«
»Ich«, sagte der Getränkeautomat.
»Du bist ein Getränkeautomat«, sagte Joshua.
»Mit dieser Annahme liegen Sie völlig daneben, obwohl ich Ihnen innerhalb weniger Sekunden das Getränk Ihrer Wahl produzieren könnte.«
»Aber auf dir steht Coca-Cola drauf!«
»Verzeihen Sie mir meinen gewöhnungsbedürftigen Humor. Übrigens, wenn Sie in der Hoffnung auf eine kleine Erfrischung einen Dollar eingeworfen hätten, hätte ich Ihnen das Geld selbstverständlich zurückerstattet. Oder die gewünschte Erfrischung geliefert.«
Joshua gab sich redlich Mühe, aus diesem Dialog schlau zu werden. »Lobsang wer?«
»Ich habe keinen Nachnamen. Im alten Tibet hatten nur Aristokraten und Lebende Buddhas Nachnamen, Joshua. Derlei Ambitionen hege ich nicht.«
»Bist du ein Computer?«
»Warum fragen Sie das?«
»Weil ich verdammt sicher bin, dass da drin kein Mensch steckt. Außerdem redest du komisch.«
»Mr Valienté, ich bin redegewandter und wortgewaltiger als jeder andere, den Sie kennen, aber Sie haben recht, ich stecke nicht in diesem Getränkeautomaten. Jedenfalls nicht voll und ganz.«
»Quälen Sie unseren Besucher nicht länger, Lobsang«, sagte Selena und wandte sich wieder an Joshua. »Mr Valienté, ich weiß, dass Sie … woanders gewesen sind, als die Welt zum ersten Mal von Lobsang erfahren hat. Er ist einzigartig. Er ist ein Computer, rein technisch gesehen, aber er war einmal ein – wie soll ich es ausdrücken – ein tibetischer Motorradmechaniker.«
»Und wie ist er aus Tibet ins Innere eines Getränkeautomaten gekommen?«
»Das ist nun wirklich eine lange Geschichte, Mr Valienté …«
Wäre Joshua nicht so lange weg gewesen, hätte er alles über Lobsang gewusst. Lobsang war die erste Maschine, der es gelungen war, ein Gericht davon zu überzeugen, dass sie ein menschliches Wesen ist.
»Natürlich haben das andere Maschinen der sechsten Generation auch schon versucht«, erklärte ihm Selena. »Solange Sie im Raum nebenan bleiben und sich mit einer von ihnen über Lautsprecher unterhalten, klingen sie mindestens so menschlich wie die meisten Schwachköpfe, die einem tagtäglich über den Weg laufen, aber das beweist in den Augen des Gesetzes noch gar nichts. Lobsang hingegen behauptet nicht, eine denkende Maschine zu sein. Auf dieser Basis wollte er überhaupt keine Rechte für sich einklagen. Er hat nur gesagt, er sei ein toter Tibeter. – Und damit, Joshua, hatte er sie am Wickel. Reinkarnation ist nach wie vor ein Eckpfeiler des Glaubens auf dieser Welt, und Lobsang hat einfach gesagt, er sei als Computerprogramm wiedergeboren. So wie vor Gericht als Beweis vorgelegt – wenn Sie möchten, zeige ich Ihnen die Kopien –, lief die entsprechende Software exakt in der Mikrosekunde an, in der in Lhasa ein Motorradmechaniker mit einem offen gestanden unaussprechlichen Namen verstarb. Für eine suchende Seele sehen zwanzigtausend Teraflops technologischer Hexerei auf einem Gel-Substrat allem Anschein nach nicht viel anders aus als ein paar Pfund matschiges Gehirngewebe. Mehrere Gerichtssachverständige haben die erstaunliche Genauigkeit von Lobsangs Erinnerungsfetzen an sein vorheriges Leben bestätigt. Ich selbst habe einen kleinen, drahtigen alten Mann mit einem Gesicht wie ein verschrumpelter Pfirsich kennengelernt, einen entfernten Cousin des Mechanikers, der sich sehr vergnügt mehrere Stunden mit Lobsang über die gute alte Zeit in Lhasa unterhalten hat. Ein überaus anregender Nachmittag!«
»Aber warum?«, wollte Joshua wissen. »Was hat er davon?«
»Ich bin immer noch hier«, meldete sich Lobsang zu Wort. »Er ist nicht aus Holz, nicht vergessen.«
»Entschuldigung.«
»Was ich davon habe? Die allgemeinen Bürgerrechte. Sicherheit. Das Recht auf Privatbesitz.«
»Und wenn man dich abschaltet, wäre es Mord?«
»Allerdings. Obwohl das physisch unmöglich wäre, aber das Thema wollen wir an dieser Stelle nicht vertiefen.«
»Dann hat das Gericht also anerkannt, dass du ein Mensch bist?«
»Na ja, es hat ja nie eine juristische Definition des Begriffes ›menschlich‹ gegeben.«
»Und jetzt arbeitest du für transEarth.«
»Ich bin anteiliger Besitzer der Firma. Douglas Black, der Gründer, hatte mir, ohne zu zögern, eine Partnerschaft angeboten. Und das nicht nur meiner Berühmtheit wegen, obwohl er ein Faible für derlei Geschichten hat. Sondern wegen meines transhumanen Intellekts.«
»Ach.«
»Zurück zum Geschäftlichen«, sagte Selena. »Sie waren nicht leicht zu finden, Mr Valienté.«
Joshua sah sie an und nahm sich vor, beim nächsten Mal noch schwerer zu finden zu sein.
»Ihre Besuche auf der Erde sind in letzter Zeit immer seltener geworden.«
»Ich befinde mich immer auf der Erde.«
»Sie wissen, was ich meine«, erwiderte Selena. »Auf dieser Erde. Der Datum-Erde. Oder auch nur einer der Nahen Erden.«
»Ich lasse mich nicht anheuern«, sagte Joshua rasch und versuchte, einen Anflug von Angst aus seiner Stimme zu verbannen. »Ich arbeite lieber allein.«
»Das dürfte eine ziemliche Untertreibung sein.«
Joshua lebte sein Leben lieber in einem von ihm selbst abgesteckten Rahmen, auf Welten, die weit von der Datum-Erde entfernt waren, so weit, dass kaum jemand bis dorthin reiste. Und sogar dort hütete er sich vor Gesellschaft. Angeblich hatte Daniel Boone immer dann seine Zelte abgebrochen, wenn er den Rauch vom Kaminfeuer eines Nachbarn sehen konnte. Verglichen mit Joshua war Boone geradezu krankhaft gesellig.
»Genau deshalb sind Sie so interessant für uns. Wir wissen, dass Sie nicht auf andere Menschen angewiesen sind.« Selena hielt abwehrend eine Hand in die Höhe. »Ja, ich weiß, Sie sind nicht asozial. Aber bedenken Sie doch bitte: Bevor es die Lange Erde gab, ist in der langen Geschichte der Menschheit noch nie jemand allein gewesen. So richtig allein, meine ich. Selbst der raubeinigste Seemann wusste stets, dass es irgendwo dort draußen jemanden gab. Sogar die alten Mondfahrer, die Astronauten, die auf dem Mond herumspaziert sind, konnten die Erde sehen. Jeder Mensch wusste, dass andere Menschen nie allzu weit entfernt waren.«
»Stimmt. Und mit den Wechslern sind sie immer nur einen Rösselsprung weit weg.«
»Aber das begreifen unsere Sinne nicht. Wissen Sie, wie viele Leute sich auf eigene Faust auf den Weg machen?«
»Nein.«
»Niemand. Na ja, so gut wie niemand. Zu wissen, dass man völlig allein auf einem ganzen Planeten ist, womöglich die einzige Seele im ganzen Universum? Neunundneunzig von hundert Menschen halten das nicht aus.«
Joshua kam sich nie allein vor. Immer war die Stille bei ihm, gleich jenseits des Himmels.
»Wie Selena bereits gesagt hat«, meldete sich Lobsang wieder zu Wort, »macht Sie genau das für uns interessant. Das und gewisse andere Eigenschaften, über die wir uns später noch unterhalten können. Ach ja, und die Tatsache, dass wir ein Druckmittel gegen Sie in der Hand haben.«
Joshua ging ein Licht auf. »Sie wollen, dass ich eine Reise antrete. In die Lange Erde.«
»Ja. Also genau das, was Sie so einzigartig gut beherrschen«, erwiderte Selena zuckersüß. »Wir möchten, dass Sie bis in die Megas vorstoßen, Joshua.«
Die Megas: So bezeichneten einige Pioniere die Welten, die mehr als eine Million Schritte von der Erde entfernt waren und die die meisten höchstens vom Hörensagen kannten.
»Warum?«
»Aus einem völlig unschuldigen Grund«, antwortete Lobsang. »Um zu sehen, was es da draußen so alles gibt.«
Selena lächelte. »Informationen die Lange Erde betreffend bilden sozusagen die Geschäftsgrundlage von transEarth, Mr Valienté.«
Lobsang war etwas mitteilsamer: »Überlegen Sie doch mal, Joshua. Bis vor fünfzehn Jahren stand der Menschheit nur eine Erde zur Verfügung. Ihre Träume reichten nicht weit, nur bis zu den Welten innerhalb des Sonnensystems, die alle öde und nutzlos und nur mit entsetzlich hohem finanziellem Aufwand zu erreichen waren. Nun besitzen wir den Schlüssel zu unzähligen Welten! Und wir haben noch nicht mal diejenigen gleich nebenan erforscht. Jetzt bietet sich uns die Gelegenheit, genau das zu tun.«
»Uns?«, fragte Joshua. »Soll ich dich etwa mitnehmen? Läuft es darauf hinaus? Ein Computer bezahlt mich dafür, dass ich den Chauffeur für ihn spiele?«
»Ja, so etwa in der Preisklasse«, antwortete Selena.
Joshua runzelte die Stirn. »Aus welchem Grund sollte ich das tun? Sie haben ein Druckmittel erwähnt?«
»Dazu kommen wir noch«, erwiderte Selena gelassen. »Wir haben Sie beobachtet, Joshua. Zum ersten Mal aktenkundig wurden Sie in einem Bericht, den Monica Jansson von der Polizei in Madison abgefasst hat, und zwar direkt nach dem Wechseltag. Darin geht es um einen geheimnisvollen Jungen, der zurückgekommen ist und dabei andere Kinder mitgebracht hat. Ein richtiger kleiner Rattenfänger von Hameln. Damals, als das Wünschen noch geholfen hat, wären Sie garantiert weltberühmt gewesen.«
»Und als das Wünschen dann nicht mehr geholfen hat«, warf Lobsang ein, »hätte man Sie garantiert einen Hexer genannt.«
Joshua seufzte. Ob wohl jemals Gras über diesen Tag wachsen würde? Er hatte nie ein Held sein wollen; er konnte es nicht leiden, wenn die Leute ihn so merkwürdig ansahen. Wenn sie ihn überhaupt ansahen. »Damals herrschte ein Riesendurcheinander, das war alles«, sagte er. »Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen?«
»Aus Polizeiakten, wie der von Jansson«, antwortete der Getränkeautomat. »Das Gute an der Polizei ist, dass sie alles archiviert. Und ich liebe Datensammlungen aller Art. Sie verraten mir alles Mögliche. Sie verraten mir zum Beispiel, wer Ihre Mutter war, Joshua. Sie hieß Maria, hab ich recht?«
»Meine Mutter geht niemanden etwas an.«
»Joshua, jeder geht mich etwas an, und jeder ist aktenkundig. Und die Akten haben mir alles über Sie erzählt. Dass Sie wahrscheinlich etwas ganz Besonderes sind. Dass Sie am Wechseltag dort gewesen sind.«
»Am Wechseltag sind alle dort gewesen.«
»Schon. Aber für Sie war es nichts Neues, stimmt’s, Joshua? Sie haben sich dort zu Hause gefühlt. Zum ersten Mal in Ihrem Leben wussten Sie, dass Sie am richtigen Ort waren …«
3
Wechseltag. Vor fünfzehn Jahren. Joshua war gerade dreizehn geworden.
Später wussten alle, wo sie am Wechseltag gewesen waren. Die meisten hatten tief in der Scheiße gesessen.
Damals wusste niemand, wer den Schaltplan für den Wechsler ins Netz gestellt hatte. Aber als der Abend wie eine Sense über die Welt strich, bauten überall Kinder und Jugendliche Wechsler zusammen, allein Dutzende in der direkten Umgebung des Heims in Madison. Überall hatten die Elektronikläden einen regelrechten Ansturm erlebt. Es handelte sich um geradezu lächerlich simple elektronische Bauteile, auch die Kartoffel, die man in der Mitte einsetzen sollte, kam einem irgendwie albern vor, aber sie war wichtig, denn sie sicherte die Energieversorgung. Es gab auch einen Schalter. Der Schalter war unverzichtbar. Manche Jugendliche dachten, man bräuchte keinen Schalter. Dass es genüge, einfach nur die Drähte zusammenzuzwirbeln. Das waren diejenigen, die kurz darauf Rotz und Wasser heulten.
Joshua hatte seinen ersten Wechsler sehr sorgfältig zusammengebaut. Er machte immer alles sehr gewissenhaft. Er war einer von den Jungen, die sämtliche Teile immer, ausnahmslos immer, vor dem Zusammenkleben bemalten und sie dann in der richtigen Reihenfolge zusammenklebten, die jedes Bauteil griffbereit hatten, ehe sie sich an die Arbeit machten. Joshua machte sich immer an die Arbeit. Es hörte sich überlegter, absichtlicher an als anfangen. Wenn er im Heim eines der alten, abgegriffenen und unvollständigen Puzzlespiele zusammensetzte, sortierte er zuallererst sämtliche Teile, trennte Himmel und Meer und den Rand, ehe er die ersten beiden Einzelteile zusammenfügte. Wenn sich das Puzzle als unvollständig herausstellte, ging er manchmal in seine kleine Werkstatt, sägte die fehlenden Stücke sorgfältig aus gesammelten Holzabfällen aus und malte sie dann passend an. Wenn man es nicht wusste, wäre man nie auf die Idee gekommen, dass dem Puzzle jemals Teile gefehlt hatten. Manchmal kochte er auch, unter der Aufsicht von Schwester Serendipity. Dann sorgte er dafür, dass rechtzeitig sämtliche Zutaten da waren, reihte sie akribisch vor sich auf und ging dann Schritt für Schritt nach dem Rezept vor. Nebenbei spülte er sogar die Sachen, die er nicht mehr brauchte, gleich ab. Er kochte gern, und die Anerkennung, die ihm dadurch im Heim entgegengebracht wurde, mochte er ebenfalls.
So war Joshua. So erledigte er seine Sachen. Und deshalb war er auch nicht der erste Jugendliche, der einen Schritt aus der Welt machte, denn er lackierte seine Wechsel-Box nicht nur, sondern wartete auch, bis der Lack getrocknet war. Und das war gewiss auch der Grund dafür, weshalb er der Erste war, der zurückkam, ohne sich in die Hose gemacht zu haben, oder Schlimmeres.
Wechseltag. Überall verschwanden Kinder und Jugendliche. Eltern suchten die Wohnviertel ab. Eben noch waren die Kinder da, spielten mit diesem neuen verrückten Spielzeug, und im nächsten Augenblick waren sie weg. Als sich immer mehr aufgeregte Eltern auf den Straßen begegneten, verwandelte sich die Aufregung in schiere Panik. Die Polizei wurde verständigt, aber was sollte die Polizei groß tun? Wen sollte sie festnehmen? Wo suchen?
Dann wechselte Joshua selbst, zum ersten Mal.
Einen Herzschlag zuvor war er noch in seiner Werkstatt im Heim gewesen. Jetzt stand er im Wald, einem dichten, endlosen Wald, durch den das Mondlicht kaum bis auf den Boden fand. Überall hörte er andere junge Leute, die sich übergaben oder nach ihren Eltern riefen, einige schrien auch so, als wären sie verletzt. Er wunderte sich über die allgemeine Verzweiflung. Er musste sich nicht übergeben. Es war irgendwie unheimlich, das schon. Aber es war eine warme Nacht – bloß wo?
Das Geschrei ringsum lenkte ihn ab. Ein kleines Mädchen ganz in seiner Nähe schrie nach seiner Mutter. Die Kleine hörte sich wie Sarah an, die auch im Heim wohnte. Er rief ihren Namen.
Sie hörte auf zu weinen, und er vernahm ihre Stimme dicht neben sich: »Joshua?«
Er überlegte. Es war spät am Abend. Sarah musste sich im Mädchenschlaftrakt befunden haben, ungefähr zwanzig Meter von seiner Werkstatt entfernt. Er hatte sich nicht bewegt, aber er befand sich eindeutig an einem anderen Ort. Und zwar nicht in Madison. In Madison gab es Lärm, Autos, Flugzeuge, Lichter, wohingegen er jetzt in einem Wald stand, einem dichten Wald wie in einem Märchenbuch, und nirgendwo eine Straßenlaterne, egal in welche Richtung er schaute. Aber Sarah war auch hier, wo auch immer sie sein mochten. Der Gedanke setzte sich nach und nach zusammen, wie ein unvollständiges Puzzle. Keine Panik! Denk nach! Sie müsste ungefähr dort sein, wo sie vorher auch war, bloß eben hier. Du musst also nur den Gang zu ihrem Zimmer entlanggehen, obwohl es hier weder einen Gang noch einen Schlaftrakt gab. Problem gelöst.
Bis auf die Tatsache, dass er auf dem Weg zu ihr mitten durch den Baum direkt vor ihm gehen musste. Einen extrem dicken Baum.
Er arbeitete sich um den Baum herum, kämpfte sich durch das dichte Unterholz, das Gestrüpp, die abgefallenen Äste dieses sehr verwilderten Waldes. »Rede immer weiter«, sagte er. »Aber rühr dich nicht von der Stelle. Ich komme.«
»Joshua?«
»Ich sag dir was. Du singst einfach. Irgendwas. So kann ich dich im Dunkeln leicht finden.« Joshua schaltete seine Taschenlampe an. Es war nur eine ganz winzige, die in eine Hosentasche passte. Er hatte nachts immer eine Taschenlampe dabei. Selbstverständlich. Er war Joshua.
Sie sang nicht. Sie fing an zu beten. »Vater unser, der du bist im Himmel …«
Wenn die Leute einfach nur das machen würden, was man ihnen sagte. Nur ein einziges Mal.
Ringsumher aus dem Wald kamen andere Stimmen aus der Dunkelheit und beteten mit. »Geheiligt werde dein Name …«
Er klatschte in die Hände und rief: »Haltet mal alle die Klappe! Ich bringe euch hier raus. Vertraut mir.« Er wusste nicht, warum sie ihm vertrauen sollten, aber sein autoritärer Ton wirkte Wunder. Die anderen Stimmen erstarben. Er holte tief Luft und rief: »Sarah. Du zuerst. Alles klar? Alle anderen gehen auf das Gebet zu. Nichts sagen, einfach nur in Richtung des Gebets gehen.«
»Vater unser, der du bist im Himmel …«, fing Sarah wieder an.
Während er sich mit ausgestreckten, tastenden Händen vorwärtsbewegte, sich einen Weg durch das Gestrüpp bahnte, über Wurzeln kletterte und vor jedem Schritt vorsichtig den Boden prüfte, hörte er ringsumher, wie sich andere ebenfalls in Bewegung setzten, und er hörte weitere Stimmen rufen. Einige beschwerten sich darüber, dass sie sich verlaufen hätten. Andere meckerten, weil sie keinen Handy-Empfang hatten. Manchmal sah er ein Display aufleuchten, kleine Bildschirme, die wie Glühwürmchen leuchteten. Und es gab verzweifeltes Weinen, sogar schmerzvolles Stöhnen.
Das Gebet endete mit einem Amen, das ringsum im Wald nachhallte, und Sarah sagte: »Joshua? Ich bin fertig.«
Und ich hab sie immer für ein intelligentes Kind gehalten, dachte Joshua. »Dann fang wieder von vorne an.«
Es dauerte mehrere Minuten, bis er sie erreicht hatte, obwohl sie nur die halbe Länge des Heims von ihm entfernt war. Jetzt erkannte er auch, dass dieses Waldstück eigentlich gar nicht so groß war. Hinter den Bäumen sah er im Mondlicht etwas, das wie Prärieblumen aussah, wie im Arboretum. Aber keine Spur vom Heim oder von der Straße, an der es stand.
Schließlich kam Sarah auf ihn zugetorkelt und klammerte sich an ihn. »Wo sind wir?«
»Irgendwo anders, vermute ich. Du weißt schon. So wie Narnia.«
Im Mondlicht sah er die Tränen, die ihr übers Gesicht liefen, und den Rotz unter ihrer Nase, und er roch das Erbrochene auf ihrem Nachthemd. »Ich bin aber in keinen Kleiderschrank reingegangen.«
Er musste laut lachen. Sie sah ihn verdutzt an. Aber weil er lachte, lachte sie auch. Kurz darauf war die kleine Lichtung von Gelächter erfüllt, denn andere Kinder kamen auf ihn zu, auf das Licht der Taschenlampe, und einen Augenblick lang waren Angst und Schrecken vertrieben. Es war nicht lustig, wenn man einsam und verlassen irgendwo herumstand, aber wenn man sich gemeinsam mit anderen verlaufen hatte und mit ihnen lachte, sah die Sache schon ganz anders aus.
Jemand packte ihn am Arm. »Josh?«
»Freddie?«
»Es war schrecklich. Ich bin im Dunkeln irgendwo runtergefallen, bis auf den Waldboden.«
Freddie hatte eine Magen-Darm-Infektion, erinnerte sich Joshua. Er war auf der Krankenstation gewesen, im ersten Stock des Heims. Er musste durch das verschwundene Gebäude gefallen sein. »Bist du verletzt?«
»Nein … Josh? Wie kommen wir wieder nach Hause?«
Joshua nahm Sarah an die Hand. »Hast du dir einen Wechsler gebastelt, Sarah?«
»Ja.«
Er warf einen kurzen Blick auf das Häufchen zerbrochener Bauteile in ihrer Hand. Es war nicht einmal eine richtige Schachtel, nicht einmal ein Schuhkarton oder so was, ganz zu schweigen von einer Kiste, die jemand eigens zu diesem Zweck sorgfältig zusammengebaut hatte – so wie seine. »Was hast du als Schalter benutzt?«
»Welchen Schalter? Ich habe einfach die Drähte zusammengedreht.«
»Nicht zu fassen. Da stand doch ausdrücklich, dass man einen Mitte-Null-Schalter dranbauen soll.« Er nahm ihren Wechsler sehr vorsichtig in die Hände. Man musste bei Sarah immer sehr vorsichtig sein. Sie war zwar selbst kein Problem, aber ihr war schon einiges an Problemen zugestoßen.
Wenigstens gab es drei Drähte. Er verfolgte den Schaltkreis mit den Fingerkuppen. Er hatte Stunden damit zugebracht, sich den Schaltplan anzusehen; er kannte ihn auswendig. Er trennte die Drähte und drückte ihr das stümperhafte Gewirr wieder in die Hand. »Also. Wenn ich sage ›Los‹, drückst du diese beiden Drähte gegeneinander. Sobald du wieder in deinem Zimmer bist, lass das ganze Ding auf den Boden fallen und leg dich ins Bett. Alles klar?«
Sarah schniefte. »Und wenn es nicht funktioniert?«
»Dann bist du ja immer noch hier, und ich auch. Und das ist ja schon mal nicht schlecht, oder? Bist du bereit? Wir zählen von zehn rückwärts. Neun, acht …«
Bei null verschwand sie. Ein leises Plopp war zu hören, als wäre eine Seifenblase zerplatzt.
Die anderen Kinder starrten auf die Stelle, wo sie eben noch gewesen war, dann sahen sie Joshua an. Einige von ihnen kannte er nicht. Soweit er überhaupt Gesichter ausmachen konnte, waren etliche darunter, die er nicht kannte. Er hatte keine Ahnung, wie weit sie in der Dunkelheit gelaufen waren.
Momentan war er der König der Welt. Diese hilflosen Kinder würden alles machen, was er sagte. Das Gefühl behagte ihm nicht besonders. Es bedeutete eine lästige Pflicht.
Er wandte sich an Freddie. »Jetzt du, Freddie. Du kennst Sarah. Sag ihr, dass sie keine Angst haben muss. Sag ihr, dass gleich viele Kinder durch ihren Schlafraum zurückkommen. Sag ihr, Joshua hat gesagt, dass es keine andere Möglichkeit gibt, sie alle wieder nach Hause zu bringen. Und reg dich bloß nicht auf. Jetzt zeig mir deinen Wechsler.«
Einer nach dem anderen, Plopp für Plopp, verschwanden die Jungen und Mädchen.
Als die letzten Kinder in seiner unmittelbaren Nähe weg waren, blieben immer noch die Stimmen weiter drinnen im Wald, vielleicht sogar von außerhalb. Für sie konnte Joshua nichts tun. Er war sich nicht einmal sicher, ob er gerade eben das Richtige getan hatte. Er stand allein in der Stille und lauschte. Abgesehen von den fernen Stimmen war nichts zu hören, nur das leise Sirren von Stechmücken. Angeblich konnten Stechmücken ein Pferd töten. Es war nur eine Frage der Zeit.
Er hielt seinen eigenen, sorgfältig zusammengebauten Wechsler in der Hand und bewegte den Schalter zur Seite.
Im nächsten Augenblick stand er wieder im Heim, gleich neben Sarahs Bett, in ihrem winzigen, unordentlichen Zimmer. Er sah gerade noch, wie das letzte, immer noch ziemlich hysterische Mädchen, dem er den Weg nach Hause gezeigt hatte, hinaus in den Korridor ging. Und er hörte die Schwestern mit schrillen Stimmen seinen Namen rufen.
Eilig bewegte er erneut den Schalter und stand wieder allein in der Einsamkeit des Waldes. Seines Waldes.
Jetzt vernahm er noch mehr Stimmen, ganz in der Nähe. Schluchzen. Schreien. Ein Kind sagte sehr höflich: »Entschuldigung. Kann mir vielleicht jemand helfen?« Dann war ein Würgen zu hören. Jemand übergab sich.
Noch mehr Ankömmlinge. Warum ist ihnen allen schlecht?, fragte er sich. Das war der Geruch des Wechseltags, an den er sich später immer sofort erinnerte. Alle hatten gekotzt. Er nicht.
Er machte sich auf den Weg in die Dunkelheit, suchte nach dem letzten Kind, das gerufen hatte.
Nach diesem kam das nächste. Und das nächste, ein Mädchen, das sich allem Anschein nach den Arm gebrochen hatte, als es aus einem höheren Stockwerk gefallen war. Und dann wieder jemand. Es gab immer noch einen, um den er sich kümmern musste.
Der erste Hauch der Morgendämmerung brachte den Gesang von Vögeln und graues Licht in das Waldstück. Ob es zu Hause auch dämmerte?
Inzwischen waren, bis auf das leise Schluchzen des letzten verlorenen Jungen, der sich das Bein mit einem spitzen Holzstück durchbohrt hatte, absolut keine menschlichen Laute mehr zu vernehmen. Er konnte seinen eigenen Wechsler auf keinen Fall mehr selbst bedienen, was sehr schade war, denn im Zwielicht bewunderte Joshua die Kunstfertigkeit, mit der das Gerät gebaut war. Der Junge hatte offensichtlich einige Zeit im Elektronikladen zugebracht. Ein vernünftiger Kerl, aber so vernünftig, dass er eine Taschenlampe oder ein Mittel gegen die Mücken mitgebracht hätte, war er auch wieder nicht.
Joshua bückte sich vorsichtig, nahm den Jungen auf den Arm und richtete sich wieder auf. Der Kleine stöhnte. Mit einer Hand ertastete Joshua den Schalter seines eigenen Wechslers und war abermals froh darüber, dass er die Anweisungen so genau befolgt hatte.
Als sie diesmal hinüberwechselten, strahlte ihm grelles Licht ins Gesicht, und innerhalb weniger Sekunden kam vor ihm ein Streifenwagen der Polizei von Madison mit quietschenden Reifen zum Stehen. Joshua rührte sich nicht von der Stelle.
Zwei Polizisten stiegen aus. Einer, ein jüngerer Mann in einer leuchtenden Warnweste, nahm Joshua den verletzten Jungen vorsichtig ab und legte ihn ins Gras. Der andere war eine Frau, die ihn mit offenen, nach oben gedrehten Handflächen anlächelte. Das machte ihn nervös. So lächelten die Schwestern immer, wenn es ein Problem gab. Zur herzlichen Begrüßung ausgestreckte Arme konnten sich allzu rasch in eine Umklammerung verwandeln. Hinter den Polizisten blinkten überall blaue und rote Lichter, wie in einem Hollywoodfilm.
»Hallo, Joshua«, sagte die Polizistin. »Ich bin Monica Jansson.«
4
Für Monica Jansson von der Stadtpolizei Madison hatte alles noch früher angefangen, nämlich am Tag zuvor: als sie zum dritten Mal in ein paar Monaten zu dem ausgebrannten Haus der Linsays nicht weit von der Mifflin Street hinausgefahren war.
Sie wusste selbst nicht genau, warum sie noch einmal hergekommen war. Diesmal hatte sie die Zentrale nicht geschickt. Trotzdem stocherte sie schon wieder in den Asche- und Holzkohlehäufchen herum, die einmal Möbel gewesen waren, ging vor den zerstörten Überresten eines älteren Flachbildfernsehers in die Hocke, trat sachte über einen versengten, vom Löschschaum aufgeweichten und mit Flecken übersäten Teppich, auf dem überall die Spuren der schweren Stiefel von Feuerwehrleuten und Polizisten zu sehen waren, blätterte wieder durch die verkohlten Reste dessen, was einmal ein umfangreicher Stapel Notizen gewesen sein musste: handschriftlich niedergeschriebene mathematische Gleichungen, ein unentzifferbares Gekritzel.
Sie dachte an ihren Partner Clancy, der draußen im Streifenwagen seinen fünften Starbucks des Tages schlürfte und sie für eine ausgemachte Idiotin hielt. Was sollte es jetzt noch zu finden geben, nachdem die Kollegen von der Kripo überall drübergelatscht waren und die Spurensicherung ihre Arbeit erledigt hatte? Sogar die Tochter, diese spinnerte College-Studentin, hatte die ganze Angelegenheit ohne Erstaunen oder Besorgnis aufgenommen und nur ruhig genickt, als sie erfuhr, dass ihr Vater wegen mutmaßlicher Brandstiftung, Anstiftung zum Terrorismus und Tierquälerei – nicht unbedingt in dieser Reihenfolge – gesucht wurde. Sie hatte einfach nur genickt, als gehörte so etwas im Hause Linsay zum Alltag.
Sonst scherte sich niemand darum. Bald würde das Haus kein offizieller Tatort mehr sein, dann konnte der Eigentümer damit anfangen, aufzuräumen und sich mit seiner Versicherung zu streiten. Dabei war niemand verletzt worden, nicht einmal Willis Linsay selbst, denn es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass er bei dem ziemlich dürftigen Brand umgekommen war. Die ganze Geschichte war wohl einfach ein Rätsel, das wahrscheinlich nie gelöst wurde, einer der geheimnisvollen Fälle, mit denen es erfahrene Polizisten immer wieder zu tun bekamen. So lautete jedenfalls Clancys Meinung, derzufolge man wissen sollte, wann es besser war, eine Sache auf sich beruhen zu lassen. Vielleicht war Jansson mit ihren neunundzwanzig Jahren noch zu grün hinter den Ohren.
Vielleicht lag es aber auch daran, was sie gesehen hatte, als sie einige Monate zuvor zum ersten Mal zum Haus der Linsays gefahren waren. Denn der erste Anruf war von einer Nachbarin gekommen, die gesehen haben wollte, wie ein Mann eine Ziege in dieses eingeschossige Haus getragen hatte, und das mitten in Madison.
Eine Ziege? Natürlich folgten die vorhersehbaren Witzchen zwischen Clancy und der Zentrale. Vielleicht kriegte dieser Typ ja bei Ziegen ein Horn – und so weiter, und so fort. Die gleiche Nachbarin, eine sehr reizbare Frau, sagte aus, dass sie ebenjenen Mann bei anderen Gelegenheiten dabei beobachtet habe, wie er Kälber durch die Haustür geschoben habe, einmal sogar ein Fohlen. Ganz zu schweigen von einem Käfig voller Hühner. Trotzdem hatte es nie Anzeigen wegen Lärmbelästigung oder Stallgerüchen gegeben. Keinerlei Hinweise darauf, dass hier Tiere hausten. Was machte der Kerl mit ihnen – vögelte er sie, oder legte er sie auf den Grill?
Es stellte sich heraus, dass Willis Linsay allein lebte, nachdem seine Frau vor mehreren Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Es gab eine Tochter namens Sally, achtzehn Jahre alt, die an der Universität Wisconsin-Madison, der UW, studierte und bei einer Tante wohnte. Linsay war Wissenschaftler oder so etwas Ähnliches gewesen, hatte sogar einmal als Dozent für theoretische Physik in Princeton gearbeitet. Jetzt unterrichtete er hin und wieder an der UW, und in seiner restlichen Zeit – tja, was er in seiner restlichen Zeit anstellte, wusste niemand so genau. Obwohl Jansson in den Akten ein paar Hinweise gefunden hatte, dass er gelegentlich unter anderem Namen für Douglas Black, den Industriellen, arbeitete. Das war keine große Überraschung. In letzter Zeit arbeitete irgendwann jeder auf die eine oder andere Weise für Black.
Was Linsay auch treiben mochte, er hielt sich keine Ziegen im Wohnzimmer. Vielleicht beruhte das Ganze auf reiner Boshaftigkeit: Eine naseweise Nachbarin wollte dem schrulligen Nachbarn nebenan eins auswischen. So etwas gab es durchaus.
Beim nächsten Anruf war es jedoch um etwas ganz anderes gegangen.
Jemand hatte den Entwurf für ein Gerät ins Netz gestellt, das er oder sie den »Wechsler« nannte. Das Design konnte variiert werden, aber im Grunde handelte es sich um ein tragbares Kästchen mit einem großen Schalter obendrauf, den man in drei Stellungen bringen konnte. In dem Kistchen befanden sich allerlei elektronische Bauteile sowie ein Stromkabel, das in … einer Kartoffel steckte.
Als die Behörden Wind davon bekamen, schlugen sie Alarm. Das Ding sah aus wie etwas, was sich ein Selbstmordattentäter um die Brust schnallte, ehe er zu einem Bummel über die belebte Hauptstraße aufbrach. Außerdem sah es aus, als könnte es sich jedes Kind im Handumdrehen aus ein paar Ersatzteilen in seinem Zimmer zusammenbasteln. Alle vermuteten, dass das Wort »Kartoffel« ein Codewort für irgendetwas anderes sein musste, zum Beispiel ein Scheibchen Semtex.
Aber bis ein Streifenwagen zu einem Stelldichein mit Agenten vom Heimatschutz zum Haus der Linsays geschickt wurde, war bereits ein dritter, davon völlig unabhängiger Anruf eingegangen: Das Haus stand in Flammen. Jansson war bei diesem Einsatz dabei gewesen. Sie hatten Willis Linsay nirgendwo finden können.
Es handelte sich um einen klaren Fall von Brandstiftung. Die Spurensicherung hatte den ölgetränkten Lappen, das billige Feuerzeug, den Stapel Papier und die zerlegten Möbel gefunden, mit denen der Brand entfacht worden war. Der Zweck des Feuers schien die Vernichtung von Linsays umfänglichen Notizen und anderen Materials gewesen zu sein. Als Täter kam sowohl Linsay selbst als auch irgendjemand anders, der ihm übel mitspielen wollte, infrage.
Jansson vermutete, dass Linsay es selbst getan hatte. Sie hatte den Mann nie kennengelernt, nicht einmal ein Foto von ihm gesehen. Aber ihre flüchtige Beschäftigung mit ihm hatte einen bestimmten Eindruck bei ihr hinterlassen. Er war zweifellos extrem intelligent. Man lehrte nicht ganz zufällig Physik in Princeton. Aber irgendetwas fehlte in dieser Gleichung. Seine Wohnung war ein einziger Sauhaufen gewesen. Auch das Weder-Fisch-noch-Fleisch-Feuer passte dazu.
Wozu das alles gut sein sollte, wusste sie jedoch nicht. Was hatte der Mann im Schilde geführt?
Jetzt fand Jansson Linsays eigenen Wechsler, vermutlich den Prototyp. Er stand im Wohnzimmer auf dem Kaminsims, über einer Feuerstelle, wo schon seit Jahrzehnten nichts mehr gebrannt hatte. Vielleicht hatte er ihn absichtlich zurückgelassen, damit man ihn fand. Die Spurensicherung hatte ihn entdeckt, kräftig auf Fingerabdrücke eingepudert und stehen gelassen. Wahrscheinlich würde er eingelagert werden, sobald das Haus nicht mehr als Tatort galt.
Jansson betrachtete das Gerät genauer. Es war nicht mehr als ein Plastikkästchen, ein Würfel von ungefähr zehn Zentimetern Kantenlänge. Die Kriminaltechniker glaubten, das Kästchen habe womöglich einmal antike dreieinhalb Zoll Floppy-Disketten enthalten. Linsay war allem Anschein nach ein Typ, der solchen Krempel aufhob. Hinter den durchsichtigen Seitenteilen sah man elektronische Bauteile, Kondensatoren, Widerstände und Spulen, die mit gezwirbelten und verlöteten Drähten miteinander verbunden waren. Aus dem Deckel ragte ein großer Dreiwegeschalter, die Positionen mit einem schwarzen Marker beschriftet:
WEST – AUS – OST
Momentan stand der Schalter auf AUS.
Den übrigen Platz in dem Kästchen beanspruchte … eine Kartoffel. Eine normale Kartoffel. Kein Semtex und keine Säureampulle, keine Nägel und auch kein anderes Utensil des modernen Terrorarsenals. Einer der Kriminaltechniker hatte vermutet, dass es sich womöglich um eine Energiequelle handelte, wie bei der klassischen Kartoffeluhr. Die meisten Leute hielten es einfach nur für ein Zeichen von Wahnsinn oder vielleicht für einen besonders schrägen Sinn für Humor. Was es auch sein mochte, überall auf der Welt waren junge Menschen fieberhaft dabei, sich so ein Gerät zu basteln.
Unter dem Wechsler in Linsays Haus hatte ein Stück Papier gelegen, auf dem, mit demselben Marker und in derselben Handschrift, gekritzelt stand: PROBIER MICH AUS. Das klang sehr nach Alice im Wunderland. Linsays Abschiedsgruß. Jansson fiel auf, dass keiner ihrer Kollegen die Anweisung auf dem Papierfetzen befolgt hatte: PROBIER MICH AUS.
Sie nahm das Kästchen in die Hand. Es wog fast nichts. Sie machte den Deckel auf. Noch ein Stück Papier. Unter der Überschrift BAU MICH FERTIG folgten einfache Anweisungen, die wie der Entwurf des Schaltplans aussah, der letztendlich im Netz gelandet war. Man solle keine Eisenteile verwenden, stand da dick unterstrichen. Sie musste mehrere Spulen aus Kupferdraht fertigwickeln und dann die Kontakte anbringen, um die Spulen aufeinander abzustimmen.
Sie machte sich an die Arbeit. Das Aufwickeln der Spulen war eine verblüffend angenehme Tätigkeit, auch wenn sie nicht hätte sagen können, warum. Nur sie und diese Bauteile, wie ein Schulkind, das sich sein erstes Radio zusammenbastelt. Die richtige Abstimmung war auch ganz einfach; sie spürte es sofort, als der Schleifkontakt an der richtigen Stelle saß – obwohl sie das ebenfalls nicht genauer erklären konnte und sich auch nicht darauf freute, es in ihrem Bericht beschreiben zu müssen.
Als sie damit fertig war, machte sie den Deckel wieder zu, nahm den Schalter zwischen Daumen und Zeigefinger, warf in Gedanken eine Münze und stellte den Schalter auf WEST.
Das Haus löste sich in einen Hauch frische Luft auf.
Prärieblumen ringsumher, hüfthoch, wie in einem Naturschutzgebiet.
Ihr war, als hätte ihr jemand in den Magen geboxt. Sie krümmte sich stöhnend und ließ das Kästchen fallen. Sie hatte festen Boden unter den Füßen, ihre blank geputzten Schuhe standen auf Gras. Die Luft in ihrer Nase roch frisch und würzig, der Gestank nach Asche und Schaum war verschwunden.
Hatte irgendein Verbrecher sie attackiert? Ihre Hand ging zur Pistole. Sie steckte in ihrem Holster, fühlte sich aber merkwürdig an; der Kunststoffrahmen und das Magazin sahen soweit in Ordnung aus, aber das Ding klapperte.
Vorsichtig richtete sie sich wieder auf. Ihrem Magen ging es immer noch nicht gut, aber sie hatte keine Schmerzen, ihr war eher schlecht. Sie sah sich um. Niemand zu sehen, der sie bedrohte, und auch sonst niemand.
Sie war auch nicht mehr von vier Wänden umgeben, das Haus nahe der Mifflin Street war verschwunden. Es gab nur noch Prärieblumen und einen kleinen Wald aus dreißig Meter hohen Bäumen, darüber einen blauen Himmel, frei von Kondensstreifen und Smog. Es war wie im Arboretum, der gewaltigen Prärie-Rekonstruktion mitten in Madison. Dieses Arboretum hier schien allerdings die ganze Stadt geschluckt zu haben. Und sie stand ganz plötzlich mittendrin.
»Ach«, machte sie. Diese Reaktion kam ihr selbst unangemessen vor. Nach kurzer Überlegung fügte sie ein »du« hinzu und schloss, obwohl sie damit das zeit ihres Lebens gepflegte Glaubenssystem des Agnostizismus mit Tendenz zu unverblümtem Atheismus verleugnete, mit einem »großer Gott«.
Sie schob die Pistole wieder ins Holster und versuchte, wie eine Polizistin zu denken. Wie eine Polizistin zu sehen. Auf dem Boden, direkt neben ihren Füßen und dem Wechsler, den sie fallen gelassen hatte, erblickte sie jetzt Abfall. Zigarettenstummel. Und etwas, was wie ein Kuhfladen aussah. Also war Willis Linsay hierher verschwunden? Falls ja, war nirgendwo etwas von ihm zu sehen. Auch von seinen Tieren nicht …
ENDE DER LESEPROBE