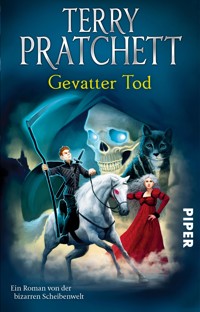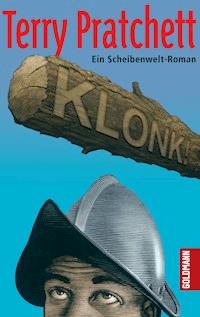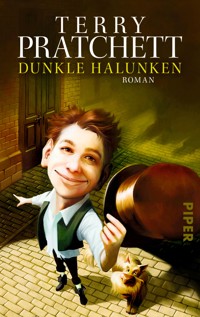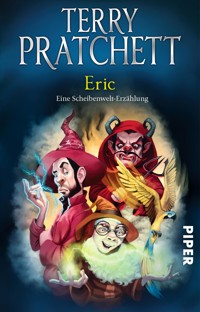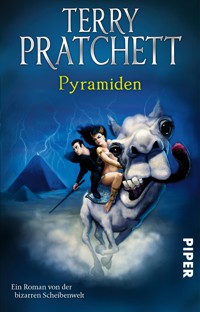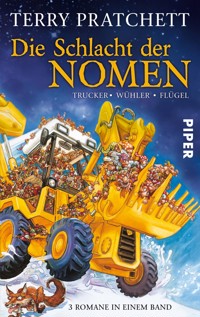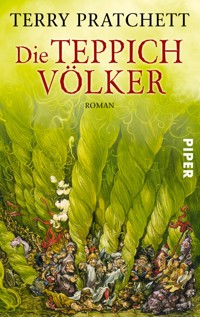9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nachdem er den König erdolcht hat, besteigt der finstere Herzog Felmet gemeinsam mit seiner unausstehlichen Gattin den Thron. Der wahre Thronerbe, ein zweijähriger Junge, wurde indes von fahrenden Schauspielern adoptiert. Nur ein unschlagbares Team kann jetzt noch helfen: der Geist des Königs, Gevatter Tod und Oma Wetterwachs mit ihren hexenden Freundinnen. Gemeinsam ersinnen sie einen unglaublichen Plan, der selbst Shakespeares Macbeth das Fürchten und Lachen zugleich lehren würde …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2015
Sammlungen
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy:
Übersetzung aus dem Englischen von Andreas Brandhorst
ISBN 978-3-492-97226-0
Mai 2015
© 1988 Terry und Lyn Pratchett
Titel der englischen Originalausgabe:
»Wyrd Sisters«, Victor Gollancz Limited, London
Deutschsprachige Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2004
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Covermotiv: Anke Koopmann, Guter Punkt unter der Verwendung eines Motivs von Katarzyna Oleska
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Es treten auf: drei Hexen, Könige,Dolche, Kronen, Stürme, Zwerge,Katzen, Geister, Phantome, Affen,Räuber, Dämonen, Wälder, Erben,Narren, Folterer, Trolle, Drehschei-ben, Jubel und Trubel sowie diverseAlarme.
Wind heulte. Blitze stachen ziellos herab, wie ein ungeschickter Mörder. Donner rollte über das dunkle, regengepeitschte Land.
Die Nacht war so dunkel wie das Innere einer Katze. Man konnte sie für eine jener Nächte halten, die Götter nutzen, um Menschen wie Figuren auf dem Schachbrett des Schicksals zu bewegen. Mitten im elementaren Stürmen, neben tropfnassen Stechginsterbüschen, glühte Feuerschein wie Tollheit im Auge eines Wiesels. Das flackernde Licht fiel auf drei Gestalten. Es blubberte im nahen Kessel, und eine unheimliche Stimme kreischte: »Wann soll’n wir drei uns wiedersehen?«
Eine kurze Pause folgte.
Schließlich erwiderte eine andere und weitaus normaler klingende Stimme: »Tja, ich hätte nächsten Dienstag Zeit.«
Die Sternenschildkröte Groß-A’Tuin schwimmt durchs unergründlich tiefe Meer des Alls, und auf ihrem Rücken stehen vier riesige Elefanten, deren Schultern die Scheibenwelt tragen. Eine kleine Sonne und ein winziger Mond umkreisen sie in einer komplizierten Umlaufbahn, um verschiedene Jahreszeiten zu schaffen – nirgends sonst im Multiversum mag es notwendig werden, dass ein Elefant das Bein hebt, um die Sonne vorbeiziehen zu lassen.
Der Grund dafür bleibt vielleicht immer ein Rätsel. Vielleicht hatte der Schöpfer des Universums die Nase voll von langweiligen Achsenneigungen, Albedos und Rotationsgeschwindigkeiten; möglicherweise beschloss er, sich ein wenig Spaß zu gönnen.
Wer vermutet, dass die Götter einer solchen Welt wahrscheinlich nicht Schach spielen, hat zweifellos recht. Es gibt überhaupt keine Götter, die an Schachpartien Gefallen finden. Dazu fehlt ihnen einfach die Fantasie. Götter bevorzugen einfache, gemeine Spiele, deren Regeln zum Beispiel Du sollst keine Transzendenz erreichen und Fall sofort der Vergessenheit anheim lauten. Wenn man Religion verstehen will, sollte man daran denken, dass es in der göttlichen Vorstellung vom Vergnügen in erster Linie um Schlangen und Leitern mit eingefetteten Sprossen geht.
Magie hält die Scheibenwelt zusammen – ein Zauber, der durch ihre Drehung entsteht, wie Seide, gesponnen aus den tiefen Schichten der Existenz, um die Wunden der Realität zu nähen.
Ein großer Teil davon erreicht die Spitzhornberge, die sich von den frosterstarrten kalten Ländern der Mitte durch einen langen Archipel bis zum warmen Ozean erstrecken, der endlos über den Rand fließt.
Pure Magie knistert unsichtbar von Gipfel zu Gipfel und entlädt sich im Gebirge. Die meisten Hexen und Zauberer stammen aus den Spitzhornbergen. Dort bewegen sich die Blätter der Bäume selbst dann, wenn kein Wind weht. Dort machen Felsen abends Spaziergänge.
Manchmal scheint sogar das Land lebendig zu sein …
Gelegentlich auch der Himmel.
Der Sturm gab sich wirklich Mühe. Dies war seine große Chance. Er hatte einige Jahre damit verbracht, die Provinzen zu durchstreifen, hier und dort nützliche Arbeit in Form von Böen zu leisten, Beziehungen zu knüpfen, ahnungslose Schafhirten zu überraschen und kleine Eichen zu entwurzeln. Jetzt bekam er durch einen Wetterwechsel die Möglichkeit, sich richtig ins Zeug zu legen. Er strengte sich deshalb so sehr an, weil er hoffte, von einem wichtigen Klima entdeckt zu werden.
Es war ein guter Sturm. Er zeichnete sich durch eine gehörige Portion Talent und recht beeindruckende Leidenschaft aus. Die Kritiker gelangten zu folgendem Schluss: Wenn er lernte, Blitz und Donner zu kontrollieren, so stand diesem Sturm eine steile Karriere bevor.
Die Wälder applaudierten mit lautem Rauschen, wogenden Dunstschwaden und umherfliegenden Blättern. Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass die Götter in solchen Nächten nicht über Schachbrettern brüten, sondern sich mit anderen Spielen die Zeit vertreiben. Auch dabei geht es um das Schicksal der Sterblichen und die Throne von Königen. Man sollte nicht vergessen, dass sie vom Anfang bis zum Ende mogeln …
Eine Kutsche rollte über den Weg, der durch den Wald führte. Immer wieder neigte sie sich mit einem Ruck von einer Seite zur anderen, als die Räder an Baumwurzeln stießen. Der Kutscher holte mit der Peitsche aus, und ihr verzweifelt klingendes Knallen bildete einen guten Kontrapunkt zum Grollen des Gewitters.
Weiter hinten, der Abstand war nicht besonders groß und verringerte sich, folgten drei in Kapuzenmäntel gehüllte Reiter.
In solchen Nächten finden böse Taten statt. Und natürlich auch gute. Aber die bösen überwiegen.
In solchen Nächten gehen Hexen auf Reisen.
Natürlich reisen sie nicht ins Ausland. Das Essen bereitet ihnen Magenbeschwerden; das Wetter ist unzuverlässig, und die Schamanen schnappen sich alle Liegestühle. Nein, sie bleiben im ihnen vertrauten Wald. Faserige Wolken umschmiegten einen vollen Mond, und die Luft flüsterte und enthielt deutliche Anzeichen von Magie.
Auf der Lichtung sprachen die Hexen solche Worte:
»Am Dienstag muss ich babysitten«, sagte die eine.
Sie trug keinen Hut, aber ihr weißes, lockiges Haar war so dicht, dass es einem Helm gleichkam. »Für unseren Jason, der wieder Vater geworden ist. Ich hätte Freitag Zeit. Beeil dich mit dem Tee, Liebe! Ich verdurste schier.«
Die jüngste Hexe seufzte, schöpfte kochendes Wasser aus dem Kessel und goss es in die Teekanne.
Die dritte Hexe klopfte ihr gutmütig auf die Hand.
»Der Ton war schon recht gut«, meinte sie. »Nur das Kreischen könnte noch etwas besser sein. Stimmt’s, Nanny Ogg?«
»Richtiges Kreischen kann nie schaden«, erwiderte Nanny Ogg schnell. »Und beim Schielen hat dir Gütchen Wemper, mögesieinfriedenruhen, sicher sehr geholfen.«
»Du hast gut geschielt«, fügte Oma Wetterwachs hinzu. Die jüngste Hexe, sie hieß Magrat Knoblauch, entspannte sich erleichtert. Sie begegnete Oma Wetterwachs mit großem Respekt. Überall in den Spitzhornbergen wusste man, dass Frau beziehungsweise Fräulein Wetterwachs nur selten jemanden lobte. Wenn sie das Schielen für gut hielt, so hatte Magrat wahrscheinlich in die eigenen Nasenlöcher gestarrt.
Im Gegensatz zu Zauberern, die auf eine komplizierte Hierarchie Wert legen, können sich Hexen kaum mit einer strukturierten Organisation der beruflichen Laufbahn anfreunden.Jede einzelne Hexe entscheidet, welches Mädchen sie als Nachfolgerin wählt. Hexen sind von Natur aus nicht besonders gesellig, soweit es die Kolleginnen betrifft, und sie haben keine Anführerin.
Unter den Anführerinnen, die es bei Hexen gar nicht gab, genoss Oma Wetterwachs die höchste Hochachtung.
Magrats Hände zitterten ein wenig, als sie den Tee vorbereitete. Sie war natürlich zufrieden, aber gleichzeitig empfand sie es als nervenaufreibend, das Arbeitsleben als Dorfhexe zwischen Oma Wetterwachs auf der einen und Nanny Ogg auf der anderen Seite des Waldes zu beginnen. Die Idee, einen Hexenzirkel zu schaffen, stammte von ihr. Es überraschte sie, dass Oma und Nanny einverstanden waren – zumindest erhoben sie keine Einwände.
Sie erinnerte sich an das Gespräch …
»Ein Zirkel?«, fragte Nanny Ogg. »Was hat denn Geometrie damit zu tun?«
»Sie meint einen Hexenzirkel, Gytha«, erklärte Oma Wetterwachs. »Du weißt schon, wie in der guten alten Zeit. Eine Versammlung.«
»Die Knie hoch?«, fragte Nanny Ogg hoffnungsvoll.
»Kein Tanz«, warnte Oma. »Ich bin gegen das Tanzen. Und ich halte auch nichts davon, zu singen, sich übermäßig aufzuregen und mit Salben und so weiter herumzualbern.«
»Die frische Luft tut dir bestimmt gut«, verkündete Nanny fröhlich.
Magrat versuchte, sich ihre Enttäuschung in Hinsicht auf das Tanzen nicht anmerken zu lassen. Glücklicherweise hatte sie darauf verzichtet, einige andere Ideen in Worte zu kleiden. Sie griff nun in die mitgebrachte Tüte – dies war ihr erster Sabbat, und sie wollte ihn voll auskosten.
»Möchte jemand Teekuchen?«, fragte sie.
Oma Wetterwachs betrachtete ihn eine Zeit lang, bevor sie hineinbiss. Magrat hatte ihn mit einer Kruste gebacken, die kleine Fledermäuse nachbildete, und deren Augen bestanden aus Rosinen.
Die Kutsche erreichte den Waldrand. Sie rumpelte über einen Stein hinweg, raste einige Sekunden lang auf zwei Rädern weiter und richtete sich dann wieder auf, ungeachtet aller Gesetze des Gleichgewichts. Doch die Steigung vor ihr sorgte dafür, dass sie langsamer wurde.
Der Kutscher – er stand nun aufrecht wie ein Wagenlenker – strich sich das Haar aus den Augen und spähte durch die Düsternis. Niemand lebte hier oben im Schoß der Spitzhornberge, aber trotzdem sah er Licht. Bei allen Barmherzigen – dort vorn schimmerte Licht!
Hinter ihm bohrte sich ein Pfeil ins Kutschendach.
Unterdessen stellte sich König Verence, Monarch von Lancre, einer verblüffenden Erkenntnis.
Wie die meisten Menschen – damit sind insbesondere Leute unter sechzig gemeint – hatte er nie sehr gründlich darüber nachgedacht, was geschehen würde, wenn man starb. Wie die meisten Menschen seit dem Anbeginn der Zeit ging er rein instinktiv von der Annahme aus, dass irgendwie alles in Ordnung käme.
Und wie die meisten Menschen seit dem Anbeginn der Zeit war er nun tot.
Genauer gesagt: Er lag am unteren Ende der Treppe in Schloss Lancre, und ein Dolch steckte in seinem Rücken. König Verence richtete sich auf, und dabei erwartete ihn eine weitere Überraschung. Jemand, den er für sich selbst hielt, stand auf, aber etwas, das seinem Körper ähnelte, blieb liegen.
Es war ein recht guter Körper, fand er, als er ihn jetzt zum ersten Mal von außen sah. Er hatte immer an ihm gehangen, doch das schien jetzt nicht mehr der Fall zu sein, wie er sich eingestehen musste.
Es handelte sich um einen großen, muskulösen Leib. Verence hatte sich gut um ihn gekümmert, ihm einen Schnurrbart und lange Locken erlaubt, ihm gesunde Bewegung im Freien verschafft, den Magen mit rotem Fleisch gefüllt. Aber jetzt, als ein Körper nützlich gewesen wäre, ließ er ihn im Stich. Beziehungsweise raus.
Kurz darauf merkte Verence, dass eine dürre, hochgewachsene Gestalt neben ihm stand. Der größte Teil von ihr verbarg sich unter einem schwarzen Kapuzenmantel, aber darunter ragte ein knöcherner Arm hervor, dessen Hand eine große Sense hielt.
Wenn man tot ist, wird man sich sofort über die Bedeutung gewisser Dinge klar.
HALLO.
Verence richtete sich zu seiner vollen Größe auf, oder was normalerweise seine volle Größe gewesen wäre. Doch der Teil seiner Existenz, für den das Wort ›Größe‹ einen Sinn hatte, lag steif auf dem Boden und sah einer Zukunft entgegen, die den Ausdruck ›Tiefe‹ angebracht erscheinen ließ.
»Ich bin ein König, wohlgemerkt«, sagte er.
DU WARST EIN KÖNIG, EUER MAJESTÄT.
»Was?«, fragte Verence scharf.
WARST. MAN NENNT SO ETWAS VERGANGENHEITSFORM. DU WIRST DICH BALD DARAN GEWÖHNEN.
Die hochgewachsene Gestalt trommelte mit knochigen Fingern auf den Griff der Sense. Sie schien über etwas verärgert zu sein.
Mir ergeht es ähnlich, dachte Verence. Aber die verschiedenen deutlichen Hinweise der speziellen Umstände arbeiteten sich allmählich durch die naiv-tapfere Dummheit, die fast den gesamten Charakter bestimmte. Ganz gleich, in welchem Königreich er sich befand, so dämmerte ihm langsam, er war gewiss nicht sein König.
»Bist du der Tod, Bursche?«, fragte er.
ICH HABE VIELE NAMEN.
»Und welchen benutzt du derzeit?« Diesmal erklang etwas mehr Respekt in Verences Stimme. Leute wanderten umher; sie wanderten durch den König und seinen Begleiter, wie Geister.
»Oh, es war also Felmet«, murmelte Verence und beobachtete den Mann, der mit einem heimtückischen Lächeln am oberen Ende der Treppe lauerte. »Mein Vater riet mir immer, vor ihm auf der Hut zu sein. Warum bin ich nicht zornig?«
ES LIEGT AN DEN DRÜSEN, entgegnete Tod. AM ADRENALIN UND SO WEITER. DU HAST JETZT KEINE GEFÜHLE MEHR, NUR NOCH GEDANKEN.
Die hochgewachsene Gestalt rang sich zu einer Entscheidung durch.
DIES IST HÖCHST UNGEWÖHNLICH, fügte Tod wie im Selbstgespräch hinzu. ABER WER BIN ICH SCHON, UM DAGEGEN ZU PROTESTIEREN?
»Ja, wer?«
WAS?
»Ich sagte: Ja, wer?«
SEI STILL.
Tod neigte den Kopf zur Seite und erweckte den Eindruck, einer inneren Stimme zu lauschen. Als die Kapuze nach hinten rutschte, sah Verence, dass Tod tatsächlich ganz und gar wie ein Skelett aussah. Mit einer Ausnahme: Die Augenhöhlen glühten himmelblau. Doch der König empfand keine Furcht. Einerseits war es schwer, erschrocken zu sein, wenn die dazu notwendigen Dinge einige Meter entfernt gerannen; andererseits hatte er sich zeit seines Lebens nie vor etwas gefürchtet, und er wollte auch jetzt nicht damit beginnen. Der Grund dafür? Es mangelte ihm an Fantasie, und außerdem gehörte er zu den wenigen Menschen, die völlig im Hier und Heute leben.
Bei den meisten Leuten ist das nicht der Fall. Sie führen ihr Leben als eine Art temporaler Fleck im Aufenthaltsbereich des Körpers: Sie erwarten die Zukunft oder klammern sich an der Vergangenheit fest. Für gewöhnlich denken sie so konzentriert daran, was als Nächstes geschehen wird, dass sie es erst merken, wenn sie darauf zurückblicken. Viele Menschen sind so. Sie lernen die Furcht, weil sie tief in ihrem Innern, auf einer unterbewussten Ebene, genau wissen, was geschehen wird – es geschieht bereits.
Aber Verence hatte immer nur in der Gegenwart gelebt. Zumindest bis jetzt.
Tod seufzte.
ICH NEHME AN, NIEMAND HAT DIR ETWAS GESAGT, ODER?, fragte er vorsichtig.
»Wie bitte?«
KEINE VORAHNUNGEN? VIELLEICHT SELTSAME TRÄUME? IRGENDWELCHE VERRÜCKTEN WAHRSAGER, DIE DIR IN DEN STRASSEN ETWAS ZUGERUFEN HABEN?
»Sollten sie mich etwa darauf hinweisen, dass ich bald sterbe?«
NEIN, WAHRSCHEINLICH NICHT, erwiderte Tod. DAS WÄRE ZU VIEL ERHOFFT. SIE ÜBERLASSEN ES IMMER MIR.
»Wer?«, fragte Verence verwirrt.
DAS SCHICKSAL, DIE VORSEHUNG UND ALLE ANDEREN. Tod legte dem König die Hand auf die Schulter. WIE DEM AUCH SEI: ICH FÜRCHTE, DU MUSST EIN GEIST WERDEN.
»Oh.« Verence blickte an seinem … Körper hinab, der recht fest wirkte, bis jemand hindurchmarschierte.
REG DICH NICHT AUF DESHALB.
Verence sah, wie man seine steife Leiche ehrerbietig aus dem Saal trug.
»Ich werd’s versuchen«, sagte er.
DAS IST ANERKENNENSWERT.
»Ich bezweifle, ob ich der Sache mit den weißen Laken und Ketten gewachsen bin«, fuhr der König fort. »Verlangt man von mir, dass ich dauernd stöhne und schreie?«
Tod zuckte mit den Schultern. MÖCHTEST DU?, fragte er.
»Nein.«
DANN WÜRDE ICH MIR DARÜBER KEINE GEDANKEN MACHEN. Tod holte eine Sanduhr unter dem schwarzen Umhang hervor und betrachtete sie aufmerksam.
JETZT MUSS ICH MICH SPUTEN, sagte er, drehte sich abrupt um, hob die Sense und verließ den Saal, indem er durch die Wand ging.
»He, warte!« Verence lief ihm nach.
Tod blickte nicht zurück. Der König folgte ihm durch die Mauer und spürte dabei keinen Widerstand – er schien durch Nebel zu schreiten.
»Ist das alles?«, entfuhr es ihm. »Ich meine, wie lange muss ich ein Geist sein? Warum soll ich ein Geist sein? Du kannst mich doch nicht einfach so zurücklassen.« Verence verharrte und hob einen gebieterischen, halb durchsichtigen Zeigefinger. »Bleib stehen! Ich befehle es dir!«
Tod schüttelte kummervoll den Kopf und trat durch die nächste Wand. Der verstorbene König eilte ihm so würdevoll wie möglich nach und erreichte die große schwarze Gestalt, als sie den Sattelgurt eines weißen Rosses festzurrte. Das Pferd stand auf dem Wehrgang des Schlosses und trug einen Futtersack.
»Du kannst mich nicht einfach so zurücklassen!«, wiederholte er, obwohl es ihm an Überzeugung mangelte.
Tod wandte sich ihm zu.
DOCH, ICH KANN, antwortete er. DU BIST UNTOT, WEISST DU. GEISTER BEFINDEN SICH IN DER WELT ZWISCHEN LEBEN UND TOD. DAFÜR BIN ICH NICHT ZUSTÄNDIG. Er klopfte Verence auf die Schulter. SEI UNBESORGT. ES DAUERT KEINE EWIGKEIT.
»Gut.«
ES KÖNNTE DIR ALLERDINGS WIE EINE EWIGKEITERSCHEINEN.
»Wie lange wird mein, äh, Leben als Geist dauern?«
BIS DU DEIN SCHICKSAL ERFÜLLT HAST, NEHME ICH AN.
»Und woher soll ich wissen, worin mein Schicksal besteht?«, fragte der König mit wachsender Verzweiflung.
KEINE AHNUNG, TUT MIR LEID.
»Wie kann ich es herausfinden?«
SOLCHE DINGE OFFENBAREN SICH IRGENDWIE, HABE ICH GEHÖRT, sagte Tod und schwang sich in den Sattel.
»Und bis dahin muss ich hier spuken.« Der König sah sich auf dem Wehrgang um. »Vermutlich ganz allein. Kann mich jemand sehen?«
OH, DIE ÜBERSINNLICH BEGABTEN. NAHE VERWANDTE. UND NATÜRLICH KATZEN.
»Ich hasse Katzen.«
Tods Gesichtsausdruck verhärtete sich etwas – wenn das möglich war. Für einen Moment zeigte sich im blauen Leuchten der leeren Augenhöhlen ein rötliches Strahlen.
ICH VERSTEHE. Der Ton wies darauf hin, dass Tod sogar Katzenhasser tolerierte. SICHER GEFALLEN DIR GROSSE HUNDE.
»Ja, das stimmt.« Verence starrte missmutig ins Morgengrauen. Seine Hunde würde er wirklich vermissen. Und es sah nach einem guten Jagdtag aus.
Er fragte sich, ob Geister auf die Jagd gingen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht, dachte er. Ähnliches galt für Essen und Trinken, und das fand Verence noch deprimierender. Er mochte große, laute Bankette und hatte so manches gutes Bier geschlabbert1. Auch einige schlechte, wenn er darüber nachdachte. Meistens war er erst am nächsten Morgen imstande gewesen, den Unterschied festzustellen.
Niedergeschlagen trat er nach einem Stein und beobachtete trübsinnig, wie der Fuß hindurchstrich. Keine Jagd mehr, weder mit Hunden noch mit Falken, keine Feste, keine Zechereien … Verence begriff langsam, dass die Freuden des Fleisches ohne das Fleisch kaum der Rede wert waren. Die Tatsache, dass er nicht mehr lebte, munterte ihn keineswegs auf.
EINIGE LEUTE MÖGEN ES, GEISTER ZU SEIN, sagte Tod.
»Hmm?«, erwiderte der König schwermütig.
EIGENTLICH IST ES GAR NICHT SO SCHLIMM. UNTOTE KÖNNEN BEOBACHTEN, WIE ES IHREN NACHKOMMEN ERGEHT. BITTE? STIMMT WAS NICHT?
Aber Verence war bereits in einer Wand verschwunden.
OH, LASS DICH DURCH MICH NICHT STÖREN, brummte Tod gereizt. Er sah sich mit einem Blick um, der Raum, Zeit und die Seelen der Menschen durchdrang, und er sah: einen Erdrutsch im fernen Klatsch, einen Orkan in Wiewunderland, eine Seuche in Hergen.
VIEL ARBEIT, murmelte er und lenkte sein Pferd gen Himmel.
Verence stürmte durch die Mauern des Schlosses. Seine Füße berührten kaum den Boden – tatsächlich wiesen die Steinplatten an manchen Stellen solche Mulden auf, dass er dort gar keine Gelegenheit bekam, den Boden zu berühren.
Als König hatte er sich daran gewöhnt, die Diener so zu behandeln, als existierten sie überhaupt nicht, und es war fast das Gleiche, durch sie zu laufen. Der einzige Unterschied bestand darin, dass sie nicht zur Seite wichen.
Verence erreichte das Kinderzimmer, sah die aufgebrochene Tür, die herumliegenden Laken …
Hufschläge. Er eilte zum Fenster, starrte nach draußen und beobachtete, wie seine Pferde, an die Deichsel der Kutsche gespannt, durchs Tor galoppierten. Einige Sekunden später folgten drei Reiter. Eine Zeit lang pochten die Hufe auf dem Kopfsteinpflaster, bevor Stille zurückkehrte.
Der König schlug auf die Fensterbank, und seine Faust drang einige Zentimeter tief darin ein.
Dann glitt er nach draußen und lehnte es ab, die Höhe zur Kenntnis zu nehmen. Mit einer Mischung aus Fliegen und Rennen überquerte er den Hof und näherte sich den Ställen.
Dort brauchte er etwa zwanzig Sekunden, um folgende Erfahrung zu machen: Zu den vielen Dingen, die einem Geist verwehrt blieben, gehörte auch das Reiten. Es gelang ihm, in den Sattel zu springen – das heißt, er schwebte direkt darüber –, aber als das Pferd davonstob, hockte Verence auf gut anderthalb Metern leerer Luft.
Er versuchte zu laufen und kam bis zum Tor, bevor die Luft so dick wurde, dass sie die Konsistenz von Teer gewann.
»Das geht nicht«, ertönte eine alte, traurige Stimme hinter ihm. »Du bist an den Ort gebunden, wo man dich getötet hat. So ist das eben mit dem Spuken. Glaub mir, ich weiß darüber Bescheid.«
Oma Wetterwachs hob den zweiten Teekuchen zum Mund und zögerte.
»Jemand kommt«, sagte sie.
»Weißt du das, weil es in deinen Daumen prickelt?«, fragte Magrat interessiert. Sie hatte viel aus Büchern über Hexenkunst gelernt.
»Weil mir die Ohren klingen«, erwiderte Oma, sah Nanny Ogg an und hob die Brauen. Die alte Gütchen Wemper war auf ihre eigene Art und Weise eine ausgezeichnete Hexe gewesen, aber zu verspielt. Zu viele Blumen, romantische Vorstellungen und dergleichen.
Gelegentlich zuckten Blitze, und ihr kurzlebiger Schein fiel auf eine Moorlandschaft, die sich bis zum Wald erstreckte. Der Regen auf dem warmen Sommerboden schuf geisterhafte Dunstschwaden.
»Hufschläge?«, brummte Nanny Ogg. »Um diese Zeit in der Nacht käme niemand hierher.«
Magrat sah sich scheu um. Hier und dort im Moor ragten große Steinblöcke auf, ihr Ursprung in der Zeit verloren. Es hieß, sie führten ein recht mobiles Eigenleben. Magrat schauderte.
»Vor wem sollte man sich hier fürchten?«, brachte sie hervor.
»Vor uns«, antwortete Oma Wetterwachs selbstgefällig.
Die Hufschläge wurden lauter und langsamer. Dann rumpelte die Kutsche an den Stechginsterbüschen vorbei; die Pferde hingen in den Geschirren. Der Kutscher sprang vom Bock, lief zur Tür, holte ein großes Bündel hervor und hastete den drei Frauen entgegen.
Er war halb über den Torf, als er plötzlich verharrte und Oma Wetterwachs entsetzt anstarrte.
»Es ist alles in Ordnung«, raunte Oma, und ihr Flüstern klang glockenklar durch das Heulen des Sturms.
Sie trat einige Schritte vor, und ein geeigneter Blitz erlaubte es ihr, direkt in die Augen des Mannes zu sehen. Ihr trüber Glanz wies Kenner darauf hin, dass der Blick nicht mehr dem Diesseits galt.
Mit einer letzten ruckartigen Bewegung drückte der Mann Oma Wetterwachs das Bündel in die Hände und fiel zu Boden. Die Federn eines Armbrustbolzens ragten aus seinem Rücken.
Drei Gestalten näherten sich dem flackernden Feuer. Oma sah in zwei andere Augen, die so kalt wirkten wie die Hänge der Hölle.
Ihr Eigentümer warf die Armbrust beiseite. Ein Kettenhemd glänzte unter dem durchnässten Mantel, als er sein Schwert zog.
Er fuchtelte nicht damit herum. Die Augen, deren Blick an Oma Wetterwachs’ Zügen festklebte, gehörten einem Mann, der nie mit irgendwelchen Dingen herumfuchtelt. Es waren die Augen eines Mannes, der ganz genau weiß, wozu ein Schwert dient. Er streckte die Hand aus.
»Gib es mir!«, verlangte er.
Oma zupfte an der Decke des Bündels und betrachtete das von Schlaf umhüllte Gesicht eines Kindes.
Sie hob den Kopf.
»Nein«, entgegnete sie schlicht.
Der Soldat musterte Magrat und Nanny Ogg, die ebenso reglos standen wie die Monolithen des Moors.
»Seid ihr Hexen?«, fragte er.
Oma Wetterwachs nickte. Ein Blitz stach aus dem dunklen Firmament herab, und hundert Meter entfernt ging ein Strauch in Flammen auf. Die beiden anderen Soldaten murmelten etwas, doch der erste Mann lächelte nur und ballte eine gepanzerte Faust.
»Gleitet Stahl an Hexenhaut ab?«, fragte er.
»Nicht dass ich wüsste«, erwiderte Oma Wetterwachs gelassen. »Möchtest du es herausfinden?«
Einer der anderen Soldaten trat auf den ersten zu und berührte ihn vorsichtig am Arm.
»Herr, mit allem Respekt, Herr, aber ich halte das für keine gute Idee …«
»Sei still.«
»Aber du beschwörst schreckliches Unheil herauf, wenn du …«
»Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt?«
»Herr«, sagte der Soldat. Er begegnete Omas Blick, und in seinen Pupillen glühte hoffnungsloses Grauen.
Der Anführer wandte sich wieder Oma Wetterwachs zu, die völlig ruhig blieb.
»Deine Bauernmagie eignet sich nur dafür, Narren zu beeindrucken, Mutter der Nacht. Ich kann dich auf der Stelle töten.«
»Dann schlag ruhig zu«, sagte Oma und sah ihm über die Schulter. »Wenn dein Herz von dir verlangt, dass du mich tötest, so stoß mir das Schwert in den Leib.«
Der Mann hob die Klinge. Erneut gleißte ein Blitz und traf einen wenige Meter entfernt liegenden Stein. Rauch wallte, und es roch nach verbranntem Silizium.
»Daneben«, sagte der erste Soldat spöttisch. Oma Wetterwachs beobachtete, wie er die Muskeln spannte, als er mit dem Schwert ausholte.
Plötzlich zeigte sich Verwirrung in seiner Miene. Er neigte den Kopf zur Seite, öffnete den Mund und schien zu versuchen, sich mit einer neuen Idee anzufreunden. Das Schwert fiel ihm aus der Hand und bohrte sich in den Torf. Dann seufzte der Mann, faltete sich langsam zusammen und sank vor Oma Wetterwachs zu Boden.
Sie stieß ihn sanft mit dem Fuß an. »Vielleicht wusstest du gar nicht, worauf ich gezielt habe«, hauchte sie. »Mutter der Nacht, hm?«
Einer der beiden anderen Soldaten – gemeint ist jener Mann, der versucht hatte, seinen Vorgesetzten zur Vernunft zu bringen – starrte entsetzt auf den blutigen Dolch in seiner Hand und wich zurück.
»Ichichich konnte es nicht zulassen«, stammelte er. »Er hätte nicht, ich meine, er durfte nicht …«
»Bist du aus dieser Gegend, junger Mann?«, fragte Oma Wetterwachs.
Der Soldat fiel auf die Knie. »Ich komme aus Verrückter Wolf, gnä’ Frau«, sagte er, und sein Blick galt der Leiche des Anführers. »Dafür wird man mich hinrichten!«, jammerte er.
»Du hast nur das getan, was du für richtig hieltest«, sagte Oma Wetterwachs.
»Deshalb bin ich nicht Soldat geworden. Es war nie mein Wunsch, jemanden zu töten.«
»Lobenswert.« Nachdenklich fügte Oma hinzu: »Was hältst du davon, Seemann zu werden? Ja, eine nautische Karriere. An deiner Stelle würde ich so schnell wie möglich damit beginnen. Besser noch: jetzt sofort. Lauf, junger Mann! Lauf zum Meer! Im Wasser kann man keine Spuren hinterlassen. Bestimmt erwartet dich ein langes und erfolgreiches Leben.« Sie überlegte einen Moment. »Zumindest sind deine Aussichten, hier ein langes und erfolgreiches Leben zu führen, wesentlich geringer.«
Der Soldat stand auf und sah Oma Wetterwachs mit einer Mischung aus Dankbarkeit und Ehrfurcht an. Eine Sekunde später lief er durch die Nebelschwaden.
»Jetzt erklärt uns vielleicht jemand, was dies alles zu bedeuten hat«, sagte Oma und drehte sich zum dritten Mann um.
Beziehungsweise dorthin, wo er gestanden hatte.
Hufschläge pochten in der Ferne, und Stille folgte.
Nanny Ogg humpelte einige Schritte.
»Ich könnte ihn einholen«, sagte sie. »Was meinst du?«
Oma Wetterwachs schüttelte den Kopf, nahm Platz und richtete ihre Aufmerksamkeit auf das Kind. Es war ein Junge, knapp zwei Jahre alt, und seine einzige Bekleidung bestand aus der Decke. Oma wiegte ihn ein wenig und starrte ins Leere.
Nanny Ogg untersuchte die beiden Leichen wie jemand, der sich nicht vor Aufbahrungen fürchtete.
»Vielleicht waren es Räuber«, sagte Magrat zaghaft.
Nanny schüttelte den Kopf.
»Sonderbar«, sagte sie. »Sie tragen beide das gleiche Abzeichen. Zwei Bären auf einem schwarzen und goldenen Schild. Weiß jemand von euch, was es damit auf sich hat?«
»Das Wappen von König Verence«, antwortete Magrat.
»Wer ist König Verence?«, fragte Oma Wetterwachs.
»Er regiert über dieses Land«, sagte Magrat.
»Oh, der König«, brummte Oma Wetterwachs, als sei die Sache kaum der Rede wert.
»Soldaten, die gegeneinander kämpfen«, sagte Nanny Ogg. »Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Magrat, sieh in der Kutsche nach.«
Die jüngste Hexe kam der Aufforderung nach und kehrte mit einem Sack zurück. Als sie ihn öffnete und umdrehte, fiel etwas auf den Torf.
Der Sturm heulte nun auf der anderen Seite des Berges, und von einem blassen Mond tropfte wässeriges Licht auf das Moorland. Es floss auch über einen Gegenstand, bei dem es sich zweifellos um eine außerordentlich wichtige Krone handelte.
»Eine Krone«, sagte Magrat. »Mit vielen spitzen Dingen dran.«
»Lieber Himmel«, kommentierte Oma.
Das Kind gluckste im Schlaf. Oma Wetterwachs mochte es nicht, in die Zukunft zu sehen, aber jetzt fühlte sie den Blick der Zukunft auf sich gerichtet.
Er gefiel ihr nicht sehr.
König Verence stand der Vergangenheit gegenüber, und er teilte Oma Wetterwachs’ Mangel an Begeisterung.
»Du kannst mich sehen?«, fragte er.
»O ja, ziemlich deutlich sogar«, bestätigte der Neuankömmling.
Verence zog die Brauen zusammen. Geister schienen weitaus größeren mentalen Anstrengungen ausgesetzt zu sein als lebende Menschen. Vierzig Jahre lang hatte er es geschafft, höchstens ein- oder zweimal am Tag zu denken, und jetzt war er die ganze Zeit über damit beschäftigt.
»Ah«, sagte er, »du bist ebenfalls ein Geist.«
»Gut beobachtet.«
»Der Kopf unter deinem Arm gab mir einen Hinweis«, sagte Verence, zufrieden mit sich selbst.
»Stört er dich? Ich kann ihn wieder aufsetzen, wenn er dich stört.« Das Phantom streckte freundlich die freie Hand aus. »Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Champot, König von Lancre.«
»Verence, ebenso.« Er musterte das Gesicht des alten Königs. »Ich erinnere mich nicht daran, dein Bild in der Langen Galerie gesehen zu haben …«
»Oh, die ersten Porträts entstanden nach meiner Zeit«, sagte Champot und winkte ab.
»Seit wann bist du schon hier?«
Der alte König ließ die Hand sinken und rieb sich die Nase. »Seit etwa tausend Jahren«, verkündete er stolz. »Als Mensch und Geist.«
»Tausend Jahre!«
»Ich habe dieses Schloss gebaut und wollte gerade einige hübsche Dekorationen hinzufügen, als mir mein Neffe im Schlaf den Kopf abhackte. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr mich das geärgert hat.«
»Aber … tausend Jahre …«, wiederholte der andere König benommen.
Champot griff nach seinem Arm. »Eigentlich ist es gar nicht so schlimm«, sagte er und führte einen bestürzten Verence über den Hof. »Als Geist hat man sogar gewisse Vorteile.«
»Das müssen verdammt seltsame Vorteile sein!«, entfuhr es Verence. »Mir hat das Leben gefallen!«
Champot lächelte aufmunternd. »Du wirst dich daran gewöhnen«, versprach er.
»Ich will mich gar nicht daran gewöhnen!«
»Du hast ein starkes morphogenes Feld«, sagte Champot. »Ja, ich bin sicher. Weißt du, ich halte nach solchen Dingen Ausschau. Ja. Ein sehr starkes Feld. Kein Zweifel.«
»Morpho-was?«
»Ich konnte nie besonders gut mit Worten umgehen«, erklärte Champot. »Ich fand es immer leichter, mit Gegenständen nach Leuten zu werfen. Aber ich schätze, es läuft alles darauf hinaus, wie man gelebt hat. Als man noch gelebt hat, meine ich. Man nennt so etwas …« Er zögerte kurz. »… animalische Vitalität. Ja, so lautet der richtige Ausdruck. Animalische Vitalität. Je mehr man davon hatte, desto leichter fällt es einem, sich als Geist das eigene Selbst zu erhalten. Ich glaube, du bist hundertprozentig lebendig gewesen. Als Mensch, meine ich.«
Fast gegen seinen Willen fühlte sich Verence geschmeichelt. »Ich habe immer versucht, aktiv zu sein.« Sie schritten durch eine Mauer und erreichten den leeren Großen Saal. Der Anblick langer Banketttische löste eine automatische Reaktion im König aus.
»Wie besorgen wir uns das Frühstück?«, fragte er.
Champots Kopf sah überrascht auf.
»Wir frühstücken nicht«, erwiderte er. »Wir sind Geister.«
»Aber ich bin hungrig!«
»Das bist du nicht. Du bildest es dir nur ein.«
Teller, Tassen und Krüge klapperten in der Küche. Die Köche waren bereits auf, und da sie keine anderen Anweisungen bekommen hatten, trafen sie Vorbereitungen für das normale Frühstücksmenü des Schlosses. Vertraute Düfte wehten durch den dunklen Zugang, der zur Küche führte.
Verence schnupperte.
»Würstchen«, sagte er verträumt. »Schinken. Eier. Geräucherter Fisch.« Er starrte Champot an. »Blutwurst«, flüsterte er.
»Du hast keinen Magen mehr«, stellte der alte Geist fest. »Es ist nur deine Fantasie. Reine Angewohnheit. Du glaubst, Hunger zu haben.«
»Ich glaube, ich bin bereits halb verhungert.«
»Mag sein, aber du kannst überhaupt nichts essen«, sagte Champot. »Nicht einen einzigen Bissen.«
Verence nahm auf einer Sitzbank Platz, ganz vorsichtig, um nicht hindurchzusinken. Entmutigt senkte er den Kopf und schlug die Hände vors Gesicht. Er hatte gehört, dass der Tod schlimm war, aber so schlimm …
Er sehnte sich nach Rache. Er wollte das plötzlich so düster wirkende Schloss verlassen, um seinen Sohn zu suchen. Und er erschrak, als er merkte, dass er noch einen dritten, größeren Wunsch verspürte: Derzeit hätte er alles für einen Teller mit gebackenen Nieren gegeben.
Eine feuchte Morgendämmerung strömte übers Land, erkletterte die Mauer des Schlosses Lancre, stürmte die Feste und kroch schließlich durch die Flügelfenster der Türme.
Herzog Felmet starrte verdrießlich auf den tropfnassen Wald. Er schien endlos zu sein. Felmet hatte nichts gegen Bäume, aber wenn so viele davon beisammenstanden, boten sie seiner Ansicht nach einen äußerst deprimierenden Anblick. Immer wieder ertappte er sich dabei, dass er sie zu zählen begann.
»In der Tat, Liebste«, sagte er.
Viele Leute, die dem Herzog begegneten, verglichen ihn mit einer jener Eidechsen, die auf vulkanischen Inseln leben, sich nur einmal am Tag bewegen, ein drittes rudimentäres Auge haben und auf monatlicher Basis blinzeln. Er glaubte, ein zivilisierter Mann zu sein, der sich mehr für die trockene Luft und den hellen Sonnenschein eines gut organisierten Klimas eignete.
Andererseits ist das Leben als Baum vielleicht gar nicht so schlecht, dachte Felmet. Bäume hatten keine Ohren, da war er ziemlich sicher. Und sie schienen auch ohne den heiligen Stand der Ehe gut zurechtzukommen. Eine männliche Eiche – er beschloss, in einem Lexikon nachzusehen –, eine männliche Eiche vertraute ihre Pollen einfach nur dem Wind an, und die Sache mit den Eicheln – es sei denn, es ging dabei um Eichenäpfel; nein, es waren Eicheln, der Herzog zweifelte kaum daran – fand woanders statt …
»Ja, Teuerste«, sagte er.
Bäume sind wirklich gut dran, dachte Felmet und starrte auf die zahllosen Wipfel. Egoistische Mistkerle.
»Gewiss, Schatz«, murmelte er.
»Was?«, fragte die Herzogin.
Der Herzog zögerte und versuchte verzweifelt, sich an die letzten fünf Minuten des Monologs zu erinnern. Die endlosen Worte warfen ihm vor, nur ein halber Mann und … willensschwach zu sein? Vage entsann er sich an die Klage darüber, das Schloss sei zu kalt. Ja, das war’s. Na ja, zumindest in dieser Hinsicht konnten sich die verdammten Bäume nützlich machen.
»Ich lasse einige fällen und sofort hierherbringen, Gepriesene.«
Lady Felmet war einige Sekunden lang sprachlos, was nur höchst selten geschah. Wer die große und imposante Frau zum ersten Mal sah, dachte an eine Galeone mit gesetzten Segeln. Dieser Eindruck wurde noch von ihrem Irrglauben verstärkt, roter Samt stehe ihr. Immerhin passte er zu der Hautfarbe.
Der Herzog hielt es oft für einen Glücksfall, dass er diese Frau geheiratet hatte. Ohne ihren Motor des Ehrgeizes hätte er seine Zeit vermutlich damit verschwendet, auf die Jagd zu gehen, zu trinken und seinen droit de seigneur2 zu ertüchtigen. Doch jetzt trennte ihn nur noch ein Schritt vom Thron; vielleicht herrschte er bald über alles, was er nun beobachtete.
Zum Beispiel über den Wald, dachte er niedergeschlagen.
Felmet seufzte.
»Du willst was fällen lassen?«, fragte die Herzogin eisig.
»Oh, die Bäume«, antwortete der Herzog.
»Was haben denn Bäume damit zu tun?«
»Nun … es sind so viele«, betonte Felmet.
»Wechsle nicht das Thema!«
»Entschuldige bitte, Liebling.«
»Ich sagte: Wie konntest du so dumm sein, sie entkommen zu lassen? Ich habe dich darauf hingewiesen, dass der Diener zu treu ist. Einer solchen Person darf man nicht vertrauen.«
»Nein, Schatz.«
»Hast du zufällig daran gedacht, sie verfolgen zu lassen?«
»Von Bentzen, Teuerste. Und zwei Wächtern.«
»Oh.« Die Herzogin zögerte. Bentzen war Hauptmann der herzoglichen Leibwache und als Mörder so fähig wie ein psychotischer Mungo. Sie hätte sich ebenfalls für ihn entschieden. Lady Felmet bedauerte es, vorübergehend um die Chance gebracht worden zu sein, ihren Gemahl zu tadeln, aber sie fand schnell zu ihrem üblichen vorwurfsvollen Selbst zurück.
»Er hätte im Schloss bleiben können, wenn du bereit gewesen wärst, auf mich zu hören. Aber du bist mit deinen Gedanken immer woanders.«
»Wie bitte, Herzallerliebste?«
Der Herzog seufzte erneut. Eine lange Nacht lag hinter ihm. Erst war es zu einem Sturm gekommen, der viel zu dramatisch geheult hatte, und dann zu der blutigen Angelegenheit mit den Messern …
Es ist bereits erwähnt worden, dass den Herzog nur noch ein Schritt vom Thron trennte. Der fragliche Schritt begann am oberen Ende der Treppe, die zum Großen Saal führte: König Verence war im Dunkeln die Stufen hinuntergefallen und unten, entgegen allen Gesetzen der Wahrscheinlichkeit, in den eigenen Dolch gestürzt.
Der Schlossarzt hatte erklärt, Verence sei durch natürliche Ursachen gestorben. Bentzen war zu ihm gegangen, um ihn auf Folgendes hinzuweisen: Wenn man des Nachts mit einem Dolch im Rücken die Treppe hinunterfiel, so war das eine Krankheit, die auf unkluges Öffnen des Mundes zurückging.
Einige andere Angehörige der herzoglichen Leibwache, die nicht vorsichtig genug gewesen waren, hatten sich bereits angesteckt. Es war zu einer kleinen Epidemie gekommen.
Der Herzog schauderte. Die vergangene Nacht enthielt verschwommene, aber auch schreckliche Details.
Er erinnerte sich daran, dass jetzt alles Unangenehme zu Ende ging und ihm ein Königreich zu Füßen lag. Es mochte kein besonders großes Reich sein, und außerdem bestand es überwiegend aus Bäumen, aber es hatte eine Krone.
Die verschwunden blieb.
Schloss Lancre stand auf einem Felsvorsprung und war von einem Architekten erbaut worden, der von Gormenghast gehört hatte, ohne dass ihm ein ausreichendes Budget zur Verfügung stand. Er hatte sich große Mühe mit einem Vorrat an Ausverkauf-Türmen und diversen Sonderangebot-Artikeln gegeben, zum Beispiel gebrauchten Kellergeschossen, Strebepfeilern, Zinnen, Steinfiguren, Höfen, Kerkern und Verliesen. Es fehlte nichts, was ein ordentliches Schloss brauchte, abgesehen von einem stabilen Fundament und Mörtel, der nicht schon bei einem leichten Nieselregen bröckelte.
Das Schloss neigte sich schwindelerregend hoch über dem weißen Wasser des Flusses Lancre, der dreihundert Meter weiter unten rauschte. Ab und zu fielen kleine Teile des Gebäudes hinein.
Es war kein besonders großes Schloss, aber es enthielt mindestens tausend Stellen, wo man eine Krone verstecken konnte.
Die Herzogin verließ das Zimmer, um jemand anderen zu schelten. Lord Felmet blieb allein zurück und starrte mürrisch über die Landschaft. Es begann zu regnen.
Jemand nahm dies zum Anlass, laut ans Schlosstor zu klopfen. Damit störte er den Pförtner, der zusammen mit Koch und Hofnarr in der warmen Küche saß und Karten spielte.
Er verzog das Gesicht und stand auf. »Es klopft auswärts«, sagte er.
»Auswärts?«, wiederholte der Narr.
»Drinwärts wohl kaum, Idiot.«
Der Narr sah verwirrt auf. »Es klopft auswärts?«, fragte er argwöhnisch. »Klingt seltsam. Hat das was mit Zen zu tun?«
Als der Pförtner in Richtung Wachhaus davonschlurfte, schob der Koch eine weitere Münze in die Tischmitte und bedachte den Narren mit einem scharfen Blick.
»Was ist ein Zen?«, fragte er.
Die Glocken des Narren klirrten und läuteten leise, als er seine Karten sortierte. »Oh, eine Subsekte des klatschianischen philosophischen Systems namens Sumtin«, erwiderte er, ohne vorher nachzudenken. »Sie ist für ihre einfache Strenge bekannt und bietet inneren Frieden sowie seelische Ganzheit, zu erreichen durch Meditation und eine besondere Atemtechnik. Ein interessanter Aspekt besteht darin, unsinnig erscheinende Fragen zu stellen, um die Türen der Wahrnehmung weiter aufzustoßen.«
»Wie bitte?«, entfuhr es dem Koch misstrauisch. Er war ziemlich nervös. Als er das Frühstück in den Großen Saal gebracht hatte, schien jemand versucht zu haben, ihm das Tablett aus den Händen zu ziehen. Schlimmer noch: Der neue Herzog hatte ihn mit dem Auftrag zurückgeschickt, Haferschleim zu holen. Er schauderte. Haferschleim und ein drei Minuten gekochtes Ei! Für so etwas fühlte sich der Koch zu alt. Er hatte sich an eine gewisse Routine gewöhnt und glaubte sich der wahren feudalen Tradition verpflichtet. Er wollte nur Dinge servieren, die man braten und denen man einen Apfel ins Maul stecken konnte.
Der Narr zögerte mit einer Karte in der Hand, unterdrückte die Panik und überlegte rasch.
»Meiner Treu!«, quiekte er. »Du habest mehr Fragen als ein Schoner Besansegel.«
Der Koch entspannte sich.
»Na schön«, murmelte er, noch immer nicht ganz zufriedengestellt. Der Narr verlor die nächsten drei Spiele, um ganz sicher zu sein.
Unterdessen öffnete der Pförtner die Klappe im Tor und blickte nach draußen.
»Wer klopft auswärts?«, knurrte er.
Der Soldat zögerte, obwohl er völlig durchnässt und entsetzt war.
»Auswärts?«, wiederholte er. »Auswärts wo?«
»Wenn du mich auf den Arm nehmen willst, lasse ich dich den ganzen Tag draußen stehen«, erwiderte der Pförtner ruhig.
»Nein!«, rief der Soldat. »Ich muss sofort zum Herzog. Hexen sind auf Reisen!«
Mehrere mögliche Kommentare gingen dem Pförtner durch den Kopf, unter anderem ›Vielleicht machen sie Urlaub‹ und ›Ich könnte ebenfalls ein paar freie Tage brauchen‹. Aber er schwieg, als er das Gesicht des Soldaten bemerkte. Er wirkte wie jemand, der Dinge gesehen hatte, die niemand sehen möchte …
»Hexen?«, fragte Lord Felmet.
»Hexen!«, sagte die Herzogin.
In den zugigen Fluren flüsterte eine Stimme, so leise wie der Wind in Schlüssellöchern. »Hexen!«, raunte es hoffnungsvoll.
Die übersinnlich Begabten …
»Es ist Einmischerei, jawohl«, verkündete Oma Wetterwachs. »Und daraus ergeben sich nur Scherereien.«
»Es könnte so romantisch sein.« Magrat seufzte tief.
»Dutschidutschi-du«, sagte Nanny Ogg.
»Wie dem auch sei«, erwiderte Magrat, »du hast den schrecklichen Mann umgebracht!«
»Nein, ich habe die Dinge nur dazu … ermutigt, sich auf eine bestimmte Weise zu entwickeln.« Oma Wetterwachs runzelte die Stirn. »Er hatte keinen Respekt. Wer keinen Respekt hat, muss mit Problemen rechnen.«
»Itziwitzi dididi.«
»Der andere Mann hat das Kind hierher gebracht, um es zu retten!«, platzte es aus Magrat heraus. »Er wollte, dass wir den Jungen schützen! Das ist doch offensichtlich! Die Vorsehung hat ihn zu uns geführt!«
»Oh, offensichtlich«, entgegnete Oma. »Ja, es scheint offensichtlich zu sein. Doch wenn etwas offensichtlich ist, braucht es deshalb noch nicht wahr zu sein.«
Sie wog die Krone in den Händen. Das Objekt fühlte sich recht schwer an, doch es war ein Gewicht, das über Pfunde und Unzen hinausging.
»Ja, aber ich meine …«, begann Magrat.
»Ich meine, dass bald Leute kommen werden«, sagte Oma Wetterwachs. »Ernste Leute. Finster dreinblickende Leute. Leute, die nicht zögern, Mauern einzureißen und Hütten niederzubrennen. Und …«
»Utzidutzi dadada.«
»Und wir wären alle viel glücklicher, wenn du endlich damit aufhören würdest, so zu glucksen, Gytha!«, zischte Oma scharf. Sie spürte, wie Ärger in ihr aufstieg. Es entstand immer Ärger in ihr, wenn sie sich unsicher fühlte. Außerdem befanden sie sich nun in Magrats Hütte, und die Einrichtung ging ihr allmählich auf die Nerven. Magrat glaubte an die Weisheit der Natur, Elfen, die Heilkraft von Farben, den Kreis der Jahreszeiten und viele andere Dinge, von denen Oma Wetterwachs nichts hielt.
»Du willst mir hoffentlich nicht erklären, wie man sich um ein Kind kümmert«, erwiderte Nanny Ogg mit sanftem Nachdruck. »Immerhin habe ich fünfzehn eigene.«
»Ich schlage nur vor, dass wir gründlich darüber nachdenken«, brummte Oma.
Die anderen Hexen beobachteten sie eine Zeit lang.
»Nun?«, fragte Magrat.
Oma Wetterwachs’ Finger trommelten auf den Rand der Krone. Sie runzelte die Stirn.
»Zuerst einmal: Wir müssen den Jungen von hier fortbringen.« Sie hob die Hand. »Nein, Gytha, deine Hütte ist zweifellos geeignet, aber sie bietet keine Sicherheit. Er muss in ein anderes Land, wo ihn niemand kennt. Und dann dies hier.« Oma hob die Krone.
»Oh, ganz einfach«, sagte Magrat. »Wir verstecken sie unter einem Stein oder so. Mit kleinen Kindern ist alles viel schwieriger als mit Kronen.«
»Da irrst du dich«, widersprach Oma. »Und der Grund dafür: Es wimmelt überall von kleinen Kindern, und sie sehen alle gleich aus. Aber wahrscheinlich gibt’s nicht viele Kronen. Außerdem neigen sie dazu, gefunden zu werden. Irgendwie rufen sie Menschen zu sich. Selbst wenn wir sie irgendwo unter einen Stein legen würden, innerhalb einer Woche fände sie Gelegenheit, sich durch Zufall entdecken zu lassen. Ganz bestimmt.«
»Ja, du hast recht.« Nanny Ogg nickte würdevoll. »Wie oft ist es euch passiert, dass ihr einen magischen Ring in die tiefsten Tiefen des Meers werft, anschließend nach Hause zurückkehrt, um ein Häppchen Steinbutt zum Tee zu essen … und dann liegt der Ring plötzlich auf dem Tisch?«
Die Hexen überlegten.
»Nie«, sagte Oma Wetterwachs. »Und das gilt auch für euch. Hinzu kommt: Vielleicht will der Junge die Krone irgendwann zurück. Sie gehört ihm, das dürfen wir nicht vergessen. Könige messen Kronen große Bedeutung bei. Wirklich, Gytha, manchmal sind deine Bemerkungen …«
»Ich koche uns Tee«, bot sich Magrat fröhlich an und verschwand in der Spülküche.
Die beiden älteren Hexen saßen am Tisch und wahrten ein höfliches, angespanntes Schweigen. »Sie hat es hier recht hübsch, nicht wahr?«, meinte Nanny Ogg nach einer Weile. »Blumen und so. Was sind das für Dinge an den Wänden?«
»Siegel und Amulette«, antwortete Oma Wetterwachs. »Oder so.«
»Schick«, sagte Nanny vorsichtig. »Und dann die Umhänge und Ruten und so.«
»Modern«, brummte Oma Wetterwachs und rümpfte die Nase. »Als ich ein Mädchen war, haben wir uns mit einem Klumpen Wachs und einigen Nadeln begnügt. Damals mussten wir unseren eigenen Zauber entwickeln.«
»O ja, seitdem haben wir alle viel Wasser gelassen«, sagte Nanny Ogg weise und wiegte den kleinen Jungen.
Oma Wetterwachs schniefte. Nanny Ogg hatte drei Ehen hinter sich und regierte über einen ganzen Clan aus Kindern und Enkeln überall im Königreich. Für Hexen war es nicht direkt verboten zu heiraten, das gab Oma widerstrebend zu. Aber nur sehr widerstrebend. Erneut schniefte sie missbilligend. Ein Fehler, wie sich herausstellte.
»Was ist das für ein Geruch?«, fragte sie scharf.
»Oh.« Nanny Ogg rückte das kleine Kind zurecht. »Ich sehe mal nach, ob Magrat ein paar saubere Tücher hat.«
Daraufhin war Oma Wetterwachs allein. Eine seltsame Verlegenheit erfasste sie, typisch für jemanden, der allein im Zimmer einer anderen Person ist. Sie widerstand der Versuchung, sich die Bücher im Regal anzusehen oder am Kaminsims nach Staub zu suchen. Langsam drehte sie die Krone hin und her, und das Objekt schien größer und schwerer zu werden.
Sie bemerkte einen Spiegel über dem Kamin und blickte auf die Krone hinab. Der funkelnde Gegenstand war verlockend, schien geradezu darum zu flehen, aufgesetzt zu werden. Warum nicht? Oma vergewisserte sich, dass niemand zusah, nahm rasch den Hut ab und ersetzte ihn durch die Krone.
Sie schien gut zu passen. Oma Wetterwachs richtete sich stolz auf, trat vor den Herd und winkte gebieterisch.
»Gar nicht schlecht«, murmelte sie und winkte arrogant in Richtung der Standuhr. »Runter mit der Rübe, ha!«, befahl sie und lächelte grimmig.
Und dann erstarrte sie plötzlich, als sie Schreie hörte, das Donnern von Hufen, das Zischen von Pfeilen und dumpfes Pochen, mit dem sich Speere in menschliches Fleisch bohrten. Angriffswelle auf Angriffswelle flutete durch Omas Kopf. Erbarmungslose Schwerter schlugen auf Schilde, gegnerische Klingen oder Knochen. Die Gewalt vieler Jahre kondensierte in einer Zeitspanne von wenigen Sekunden. Manchmal glaubte die Hexe, bei den Toten zu liegen oder an einem Ast zu baumeln. Es gab Hände, die nach der Krone griffen, sie auf ein Samtkissen legten …
Oma Wetterwachs nahm sie behutsam ab – es fiel ihr sehr schwer, denn die Krone wollte auf ihrem Kopf bleiben – und legte sie auf den Tisch.
»Das bedeutet es also, König zu sein«, murmelte sie. »Warum halten das so viele für erstrebenswert?«
»Möchtest du Zucker?«, erklang Magrats Stimme hinter ihr.
»Man muss als Narr zur Welt kommen, um König zu werden«, befand Oma.
»Bitte?«
Sie drehte sich um. »Hab dich gar nicht hereinkommen sehen. Was hast du gesagt?«
»Möchtest du Zucker in den Tee?«
»Drei Löffel«, erwiderte Oma Wetterwachs sofort. Eins der wenigen Betrübnisse ihres Lebens bestand darin, dass sie trotz aller Anstrengungen den Gipfel ihrer Karriere mit allen Zähnen und einer rosaroten, pfirsichweichen Haut erreicht hatte. Selbst die mächtigsten Zaubersprüche konnten keine Warzen in ihrem attraktiven, wenn auch ein wenig pferdeartigen Gesicht wachsen lassen, und ein hoher Zuckerkonsum verlieh ihr nur unerschöpfliche Energie. Vor vielen Jahren war sie einmal so verzweifelt gewesen, dass sie einen Magier um Rat fragte, und der erklärte ihr, es liege daran, dass sie einen Stoffwechsel besaß. Dieser Hinweis erlaubte es ihr wenigstens, sich Nanny Ogg überlegen zu fühlen, die bestimmt nie einen gesehen hatte.
Magrat gab pflichtbewusst drei gehäufte Löffel Zucker in die Tasse. Es wäre wirklich nett, gelegentlich mal ein ›Danke‹ zu hören, dachte sie wehmütig.
Dann spürte sie den Blick der Krone.
»Du fühlst es, nicht wahr?«, fragte Oma Wetterwachs. »Wie ich schon sagte: Kronen rufen Menschen zu sich.«
»Es ist schrecklich!«
»Nein, nein, die Krone versucht nur, eine richtige Krone zu sein. Es liegt in ihrer Natur.«
»Sicher steckt Magie in ihr!«
»Sie ist nur das, was sie ist«, betonte Oma Wetterwachs noch einmal.
»Sie möchte, dass ich sie aufsetze«, sagte Magrat. Ihre ausgestreckte Hand zitterte.
»Ja, da hast du recht.«
»Aber ich werde stark sein«, sagte Magrat.
»Das habe ich nicht anders erwartet«, erwiderte Oma, und ihr Gesicht wirkte plötzlich seltsam hölzern. »Was macht Gytha?«
»Sie wäscht das Kind im Spülbecken«, antwortete Magrat geistesabwesend. »Wie sollen wir so etwas verstecken? Was geschieht, wenn wir die Krone irgendwo tief vergraben?«
»Ein Dachs würde sie nach oben holen«, murmelte Oma. »Oder jemand sucht an der betreffenden Stelle nach Gold. Oder ein Baum schlingt die Wurzeln darum und fällt beim nächsten Sturm. Dann kommt jemand vorbei, sieht das Ding, setzt es auf …«
»Es sei denn, die entsprechende Person ist ebenso willensstark wie wir«, warf Magrat ein.
»Ja, in der Tat«, bestätigte Oma Wetterwachs und starrte auf ihre Fingernägel. »Es ist nicht schwer, eine Krone aufzusetzen. Das Problem besteht darin, sie wieder vom Kopf zu nehmen.«
Magrat griff danach und drehte sie.
»Eigentlich sieht sie gar nicht wie eine richtige Krone aus«, sagte die junge Hexe.
»Du hast bestimmt schon viele gesehen«, erwiderte Oma Wetterwachs. »Wahrscheinlich bist du eine Expertin für Kronen.«
»Ich kenne tatsächlich einige.« Ein gewisser Trotz lag in Magrats Stimme. »Normalerweise sind sie mit mehr Edelsteinen besetzt und haben Stoff in der Mitte. Diese ist eher unscheinbar …«
»Magrat Knoblauch!«
»Ich übertreibe nicht. Als ich bei Gütchen Wemper in die Lehre ging …«
»… mögesieinfriedenruhen …«
»Mögesieinfriedenruhen, ja. Sie nahm mich mit nach Scharfschneide oder Lancre, wenn die wandernden Schauspieler im Ort waren. Sie fand großen Gefallen am Theater. Du würdest staunen, wie viele Kronen es dort gibt. Obgleich …« Magrat legte eine kurze Pause ein. »Gütchen meinte, sie bestünden nur aus Blech und Papier und so. Und Glas anstelle von echten Edelsteinen. Trotzdem sehen sie echter aus als diese hier. Ist das nicht seltsam?«
»Dinge, die wie Dinge aussehen wollen, sehen manchmal mehr wie Dinge aus als Dinge«, stellte Oma Wetterwachs fest. »Eine allgemein bekannte Tatsache. Aber ich rate davon ab, einer solchen Entwicklung Vorschub zu leisten. Warum wandern die Schauspieler mit Kronen umher? Und was spielen sie?«
»Weißt du nicht übers Theater Bescheid?«, fragte Magrat.
Oma Wetterwachs, die aus Prinzip niemals irgendeine Art von Unwissenheit zugab, zögerte nicht eine Sekunde lang. »Oh, doch. Es gehört zu solchen Sachen, stimmt’s?«
»Gütchen Wemper meinte, es halte dem Leben einen Spiegel vor«, sagte Magrat. »Sie meinte auch, das Theater muntere sie immer auf.«
»Kann ich mir denken«, erwiderte Oma und ging in die Offensive. »Wenn man’s richtig spielt. Die Schauspieler sind sicher gute Leute, wie?«
»Ich denke schon.«