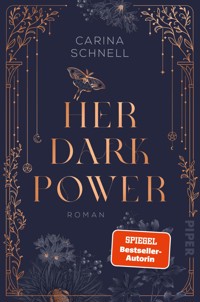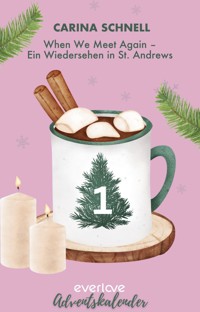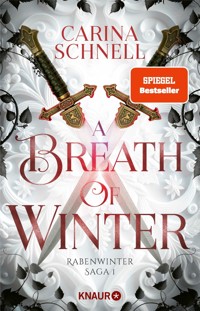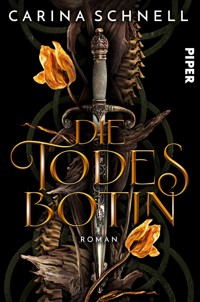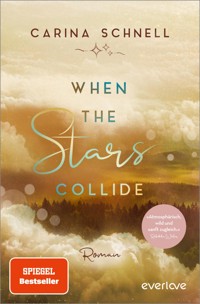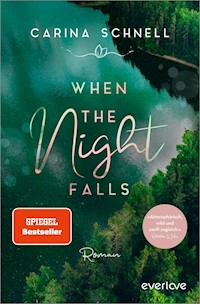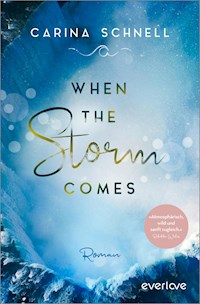3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Magische Leidenschaft
- Sprache: Deutsch
Zwischen Magie und Menschlichkeit, zwischen Leidenschaft und Schmerz Als Namenlose lebt sie als Kurtisane des Königs bei Hofe und wird Zeugin eines brutalen Angriffs auf den Palast und ihre Heimat. Nur knapp kann sich die Namenlose in den Wald retten, vor dem sich die Menschen seit Jahren fürchten. Den Kreaturen dort werden magische Kräfte nachgesagt. Doch die Namenlose hat keine Wahl. Sie trifft den Waldläufer Érion. Was zunächst als Mittel zum Zweck dient, wird bald Freundschaft und Liebe. Érion gibt ihr endlich einen Namen: Méah heißt sie von nun an. Érion glaubt, dass sie zu Höherem berufen ist und begleitet sie auf ihrer Flucht gen Norden. Aber die Schergen, die den Palast überfielen, sind ihnen auf den Fersen. Und Méah ahnt noch nicht, welches Schicksal ihr bestimmt ist… Von Carina Schnell sind bei Forever erschienen: Die Kurtisane - Erwachen der Leidenschaft Die Magierin - Entscheidung aus Leidenschaft
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Die AutorinNach ihrem Abitur verbrachte Carina Schnell viel Zeit im Ausland. Da sie sich schon immer für fremde Länder, Kulturen und Sprachen interessierte, absolvierte sie ihr Bachelorstudium an der Universität Heidelberg und einen Master an der Uni Genf im Übersetzen. In den vielen Jahren, in denen sie als Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache tätig war, ist ihre Liebe zur deutschen Sprache wieder bewusst geworden. Zurzeit lebt und arbeitet sie als Übersetzerin in der Schweiz. Seit November 2016 ist sie Fernstudentin der Autorenschule der Textmanufaktur.
Das Buch
Zwischen Magie und Menschlichkeit, zwischen Leidenschaft und Schmerz
Als Namenlose lebt sie als Kurtisane des Königs bei Hofe und wird Zeugin eines brutalen Angriffs auf den Palast und ihre Heimat. Nur knapp kann sich die Namenlose in den Wald retten, vor dem sich die Menschen seit Jahren fürchten. Den Kreaturen dort werden magische Kräfte nachgesagt. Doch die Namenlose hat keine Wahl. Sie trifft den Waldläufer Érion. Was zunächst als Mittel zum Zweck dient, wird bald Freundschaft und Liebe. Érion gibt ihr endlich einen Namen: Méah heißt sie von nun an. Érion glaubt, dass sie zu Höherem berufen ist und begleitet sie auf ihrer Flucht gen Norden. Aber die Schergen, die den Palast überfielen, sind ihnen auf den Fersen. Und Méah ahnt noch nicht, welches Schicksal ihr bestimmt ist…
Von Carina Schnell sind bei Forever erschienen:Die Kurtisane - Erwachen der LeidenschaftDie Magierin - Entscheidung aus Leidenschaft (Juli 2017)
Carina Schnell
Die Kurtisane
Erwachen der Leidenschaft
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Originalausgabe bei Forever Forever ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Juni 2017 (1) © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2017 Umschlaggestaltung: zero-media.net, München Titelabbildung: © FinePic® Autorenfoto: © privat ISBN 978-3-95818-192-2 Hinweis zu Urheberrechten Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Stimmen in der Nacht
Lautlos wie ein Schatten huschte ich den düsteren Gang entlang. Das eilige Tapsen meiner nackten Füße wurde von den Teppichen verschluckt. Auch zu dieser späten Stunde brannten hier und dort noch Fackeln in ihren Halterungen. Ihr flackerndes Licht ließ sonderbare Gestalten über die Wände tanzen. Fröstelnd zog ich mir meinen dünnen Überwurf enger um die Schultern. Darunter war ich nackt.
Obwohl der Frühling vor der Tür stand, war es nachts noch empfindlich kalt im Palast. Doch trotz der Kälte wärmte mich die Wut, die in meinem Bauch brodelte und bald jede Faser meines Körpers durchströmte. Ich beschleunigte meine Schritte.
Als ich um die Ecke bog, erkannten mich die Wachen am Ende des Gangs und nahmen Haltung an. Sie versuchten vergebens, ihre Abneigung vor mir hinter einer tiefen Verbeugung zu verbergen. Doch sie hing wie eine giftige Wolke zwischen uns, die die Luft im Gang verpestete, während ich mich ihnen erhobenen Hauptes und mit herausforderndem Blick näherte.
Als ich vor der riesigen Eichenholztür zum Stehen kam, wagte es eine der Wachen, mir in den Weg zu treten.
»Was tut Ihr hier zu so später Stunde?«, fragte er nervös. »Soweit wir informiert sind, hat Seine Majestät heute nicht nach Euch verlangt.«
Er brachte nicht den Mut auf, mir in die Augen zu sehen, und auch sein Kumpan starrte betreten zu Boden.
»Seit einer Woche hat Seine Majestät mich nicht sehen wollen, und ich habe ein Recht darauf, zu erfahren, warum«, gab ich ungeduldig zurück.
Der Wachmann wollte etwas erwidern, doch ich trat entschlossen auf die Tür zu, die er noch immer versperrte. Als er den Kopf hob und die Wut rot in meinen Augen aufblitzen sah, wich er wortlos zurück.
Ich hielt mich nicht mit Klopfen auf. Schwungvoll öffnete ich die Tür und trat ein.
König Béoras, ein breitschultriger Mann, der sein bestes Alter bereits hinter sich hatte, stand am Fenster und schaute in die Nacht hinaus. Als ich eintrat, drehte er den Kopf langsam zur Tür. Für einen kurzen Moment stand Überraschung in seinem Blick. »Ihr seid es nur«, seufzte er dann leise.
Er warf noch einen letzten Blick hinaus, dann wandte er sich vom Fenster ab. Geräuschlos wie eine Katze war ich ihm da schon entgegengehuscht.
Mit geschickten Fingern öffnete ich seinen reich verzierten Morgenmantel und fiel vor ihm auf die Knie. Er lächelte über meine Ungeduld und strich mir eine schwarze Locke aus dem Gesicht.
»Ich bin nicht in der Stimmung. Es war ein langer Tag«, murmelte er mit leisem Tadel in der Stimme.
»Euer Körper verrät mir etwas anderes«, schnurrte ich und machte mich sogleich daran, ein wenig nachzuhelfen.
Nachsichtig lächelnd legte er zwei Finger unter mein Kinn, um mich zu sich hochzuziehen. Ich erhob mich nur widerwillig. So schnell würde ich mich nicht geschlagen geben. Wenn er mich jetzt fortschickte, wusste ich nicht, wann ich ihn das nächste Mal sehen würde. Ich musste ihn daran erinnern, dass er es fünf Jahre lang nicht müde geworden war, mich jede Nacht zu sich zu rufen. Bis jetzt.
»Habt Ihr wieder die Träume gehabt?«, versuchte ich ihn abzulenken. »Was ist es nur, das Euch Nacht für Nacht wach hält? Seit mehr als hundert Jahren herrscht Friede im Reich, die Handelsbeziehungen zu den Südlichen Inseln verbessern sich mit jedem Jahr, und alle adligen Damen Panterras warten nur darauf, dass Ihr Euch endlich mit einer von ihnen vermählt.«
»Es ist der Wald«, flüsterte Béoras, und seine Stimme klang entrückt, während sein Blick erneut zum Fenster wanderte. »Jede Nacht sehe ich den Walhallad in meinen Träumen in Flammen stehen. Die Bäume ragen schwarz verkohlt und kahl in den Nachthimmel. Und zwischen ihnen steht eine Gestalt.«
»Was für eine Gestalt?«, hakte ich nach.
Er zögerte und schien ganz in seiner Erinnerung an den Traum gefangen. »Letzte Nacht sah ich ihn zum ersten Mal zwischen den Flammen hervortreten. Es ist ein Mann in einem roten Umhang.«
»Was glaubt Ihr, was dieser Traum bedeutet?«, fragte ich und bemühte mich vergeblich, die Sorge aus meiner Stimme zu verbannen. Der König war kein junger Mann mehr, und wenn nun auch noch sein Geist langsam von diesen Wahnvorstellungen zerrüttet wurde, würde ich mir bald einen neuen Gönner suchen müssen.
»Vielleicht muss ich den gesamten Wald endgültig zerstören, so wie es Urgroßvater immer geplant hat«, sagte er wie zu sich selbst. »Vielleicht ist es das, was der Traum mir sagen will. Der Walhallad muss brennen.«
Sein Gemurmel wurde immer unverständlicher. Ich legte beruhigend eine Hand auf seine nackte Brust, und er sah auf, als würde er aus einer Trance erwachen.
»Verzeiht mir. Es ist wohl das Los eines Königs, auch nachts noch von seinen Sorgen geplagt zu werden.«
»Und es ist meine Aufgabe, Euch von Euren Sorgen abzulenken, oder habt Ihr das etwa vergessen?«, unterbrach ich ihn ungeduldig.
Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, bis er mir tief in die Augen sehen konnte. »Grün«, lächelte er. »So grün wie eine Frühlingswiese.«
Ich wusste, dass er meine Augen liebte. Er war einer der wenigen, die sie nicht fürchteten, sondern ihre Andersartigkeit zu schätzen wussten. Oft sagte er mir, ich würde mit meinen Augen lächeln, als hielte das Leben einen Zauber bereit, dessen Geheimnis ich allein kenne. Früher hatte er sich stundenlang in dem Anblick meiner Augen verlieren und immer wieder etwas Neues in ihnen entdecken können. Das war vor den Träumen und den schlaflosen Nächten gewesen. Als er mich noch jeden Abend zu sich gerufen hatte und dann erschöpft und leise schnarchend in meinen Armen in einen tiefen Schlaf gefallen war.
Ich liebte ihn wiederum auf eine Art, die nichts mit diesem wahrhaftigen, tiefen Gefühl zu tun hatte, das das Leben und die Sicht auf alle Dinge für immer veränderte. Ich liebte seine Abhängigkeit von mir und die Macht, die ich über seinen Körper besaß.
Langsam wanderte meine Hand tiefer, fuhr über die starke Brust und den festen Bauch, die noch an den einst gefürchteten Turnierkämpfer erinnerten.
Wohlig seufzend schloss er die Augen. Plötzlich packte er mich ungestüm und hob mich hoch. Triumphierend schlang ich meine Beine fest um seinen Körper, und er trug mich zum Bett.
»Wie konnte ich dir nur so lange widerstehen?«, flüsterte er mir ins Ohr, und ich spürte, wie seine Lust zwischen meinen Beinen erwachte.
Er warf mich auf die weichen Laken und streifte mir das silberdurchwirkte Gewand vom Körper. Schon war er über mir. Sein heißer Atem streifte meine Wange. Seine Hände waren überall. Genüsslich wand ich mich unter seinen Berührungen. Endlich bebte mein ganzer Körper wieder vor Lust, und ich verzehrte mich nach Befriedigung. Fordernd hob ich ihm mein Becken entgegen, stöhnte und flehte ihn mit Küssen an, das Feuer in meinem Inneren zum Erlöschen zu bringen.
Er drehte sich, zog mich auf sich, und wir verschmolzen miteinander durch die rhythmischen Bewegungen meines Beckens.
Als ich schwitzend und schwer atmend in seinen Armen liegend zur Ruhe kam, konnte Béoras seine Augen kaum noch offen halten. Ich war froh darüber, ihm endlich den Schlaf beschert zu haben, der ihm seit über einer Woche verwehrt geblieben war, und kuschelte mich in seine Umarmung. Sein Atem wurde schwerer.
Da öffnete er seine Augen mit einem Ruck.
»Er hat zu mir gesprochen«, murmelte er zerstreut, als wäre ihm das gerade erst eingefallen. »Der Mann im roten Umhang.«
»Und was hat er zu Euch gesagt?«
»Tötet die Frau, die Euch Nacht für Nacht besucht«, murmelte er und war auch schon eingeschlafen.
Feuer und Eisen
Es war noch dunkel, als ich das Bett des Königs in den frühen Morgenstunden verließ. Er schlief friedlich und bemerkte nicht, wie ich mich vorsichtig aus seiner Umarmung löste. Ich warf einen raschen Blick in den Spiegel an der Wand und bemerkte zufrieden, dass meine Augen die Farbe von satter, flüssiger Bronze angenommen hatten.
Die beiden Wachen vor der Tür schliefen fest, als ich an ihnen vorbeihuschte, um mich auf den Weg in meine eigene Kammer zu machen.
Die Erinnerung an die Nacht voll Sinnlichkeit und lauten Schreien der Lust zauberte ein Lächeln auf mein Gesicht. Vielleicht hatte ich in dieser Nacht endlich die Macht gebrochen, die diese Albträume nun schon seit Wochen über Béoras hatten. Sein Gerede darüber, den Walhallad niederzubrennen, beunruhigte mich nicht. Der uralte Wald bedeckte seit Jahrhunderten den gesamten Osten Panterras und würde nicht so leicht zu vernichten sein. Doch würde Béoras mir wirklich etwas antun wollen, der Frau, die ihn jede Nacht besuchte? Ich bog um eine Ecke und schüttelte den Kopf.
»Sei keine Närrin«, schalt ich mich selbst. Ich durfte mich nicht von Béoras’ geistiger Verwirrung anstecken lassen. Ich atmete tief durch, und meine Schritte wurden langsamer. Zufrieden lauschte ich und hörte nur die absolute Stille, die mich in dem leeren, nur von wenigen Fackeln erhellten Gang umgab.
Ich genoss die frühen Morgenstunden, in denen ich auf leisen Sohlen des Königs Gemach verließ. Die meisten Palastbewohner würden erst in einigen Stunden erwachen, und noch herrschte diese angenehme, vertraute Stille. Ich konnte mich nur in diesen Stunden, in denen die Kälte der Nacht langsam vom ersten Licht des Tages verdrängt wurde, frei bewegen. Im grellen Tageslicht erwachte der Palast jeden Tag aufs Neue zum
Leben – ein Leben, an dem ich keinen Anteil hatte.
Tagsüber war es mir verboten, mich dem König auch nur zu nähern. Nur seine Leibwache wusste, was beinahe jede Nacht hinter verschlossenen Türen zwischen ihm und mir geschah.
Im Alter von nur fünfzehn Jahren war mir mein Ruf als Kurtisane bereits vorausgeeilt, und König Béoras hatte mich an seinen Hof geholt. Seit fünf Jahren hatte er keine andere Frau außer mir gehabt. Er verzehrte sich nach mir, und ich nahm meine Aufgabe sehr ernst, ihm jeden Wunsch von den Augen abzulesen.
Wenn er mit mir zusammen war, wollte er die Sorgen des Tages vergessen, sich ganz meinen geübten Händen überlassen und sich fühlen wie ein Mann, der geliebt wird und nicht wie ein einsamer König ohne Frau und Erben. Ich kannte all seine Geheimnisse, Sorgen und Ängste. Er wusste wiederum nichts über meine geheimsten Wünsche, die ich immer sorgfältig für mich behielt.
Gedankenverloren huschte ich die Stufen der breiten Haupttreppe hinauf, darauf bedacht, kein Geräusch zu verursachen. Ich verabscheute den Lärm und die Hektik, die jeden Tag aufs Neue, mit dem Tageslicht in den Palast einzogen.
Meine ereignislosen Tage schleppten sich endlos dahin. Der König versuchte, mir die Zeit mit extravaganten Geschenken zu versüßen. Er schenkte mir prachtvolle Kleider aus weit entfernten Ländern, Schmuck und Leckereien. Damit meine Haut samtweich blieb, badete ich in wertvollen Essenzen, und mein Haar wurde täglich mit den teuersten Duftölen eingerieben und frisiert. Doch all diese Annehmlichkeiten konnten nicht die endlosen, einsamen Stunden des Wartens ausfüllen.
Als ich am Treppenabsatz ankam und um die Ecke biegen wollte, wäre ich beinahe in Ernia, die Kammerfrau des Königs, hineingelaufen. Sie wich vor mir zurück, als hätte ich die Drachenpocken.
»Hexe«, zischte sie hasserfüllt. »Mach, dass du fortkommst!«
Ich warf ihr einen bösen Blick zu und huschte eilig weiter. Ich ärgerte mich, dass ich zu lange in den Armen des Königs geblieben und ihr deshalb über den Weg gelaufen war. Gewöhnlich war ich immer auf der Hut vor den anderen Palastbewohnern. Sie warfen Kartoffelschalen und Brotrinden nach mir und beschimpften mich, wann immer sie mich sahen.
Man erzählte sich, ich betreibe schwarze Magie und behexe mit meinen seltsamen Augen den König. Bei dem Gedanken daran lachte ich leise auf. An Magie hatte ich noch nie geglaubt.
Dennoch hatte ich, seit ich alt genug war, um zu verstehen, dass ich anders als die anderen Kinder war, versucht, mich anzupassen und keine Aufmerksamkeit zu erregen. Vergebens.
So hatte ich in all meinen Jahren im Palast lernen müssen, im Verborgenen zu leben. Ich kannte mich besser aus als alle Diener, Leibwächter und Speichellecker. Jede verborgene Tür war bereits von mir entdeckt und jeder Geheimgang erkundet worden.
Als ich, aus meinen Gedanken gerissen, die unscheinbare Tür meiner Kammer erreichte, schlüpfte ich erleichtert hinein. Ein weiterer langer Tag lag vor mir. Ich sollte noch etwas schlafen.
Während ich mich auszog, wanderten meine Gedanken zu Felfan, meinem einzigen Freund im Palast. Ich hatte ihn vor zwei Jahren auf einem meiner Streifzüge kennengelernt. Felfan, der Stallbursche mit den vielen Sommersprossen und dem schüchternen Lächeln. Der junge Mann, der mich aufmunterte, wenn mich das Leben im Palast zu erdrücken schien. Der treue Freund, der mir Tag für Tag heimlich Schwertkampfunterricht hinter dem Pferdestall gab. Meinetwegen hatte er schon oft Prügel bezogen.
Lächelnd erinnerte ich mich an seine Worte von gestern, nachdem er mich einmal mehr besiegt hatte.
»Du bist die schönste aller Frauen, das ist deine stärkste Waffe. Setze sie im Kampf ein, und du wirst unbesiegbar sein.« Immer, wenn er mir Komplimente machte, färbten sich seine Wangen zartrosa, und er sah peinlich berührt zu Boden. Ich beschloss, ihm am Nachmittag einen Besuch abzustatten.
Erschöpft streifte ich mir mein Gewand über den Kopf und wollte gerade ins Bett schlüpfen, als mich laute Rufe aufschreckten. Ich eilte zum offenen Fenster.
Der sich im Osten langsam erhellende Himmel war getränkt vom roten Schein eines Feuers, das sich, so weit das Auge reichte, über das Palastgelände fraß.
Ich sah Soldaten, die halb angezogen alarmiert über den Hof rannten, sich im Laufen ihre Brustharnische überstreiften und sich den Schlaf aus den Augen rieben. Frauen eilten klagend davon, andere versuchten, das sich schnell ausbreitende Feuer mit Wassereimern zu löschen. Der Wind drehte und wehte verzerrte Kampfgeräusche zu mir herüber. Ich hörte alarmierte Schreie und das Klirren von Eisen auf Eisen.
Für einen Moment war ich wie betäubt, gefesselt von dem Bild der Verheerung, das sich unter mir ausbreitete. Das Knistern der Flammen drang zu mir herauf, während sie sich ihren tödlichen Weg durch die Holzgebäude der Bediensteten auf dem Hof bahnten. Der aufsteigende Rauch ließ meine Augen tränen.
Erschrocken fuhr ich herum, als ich plötzlich dumpfe Schläge vernahm. Jemand schlug gegen das mächtige Eingangstor des Palastes. Wir wurden angegriffen!
Aus meinem anfänglichen Schockzustand gerissen, begannen meine Gedanken nun zu rasen. Wer waren die Angreifer? Seit Jahren herrschte Frieden in Panterra, und der König hatte keine Feinde. Hatte er mir womöglich etwas verschwiegen?
Doch ich hatte keine Zeit, mich mit diesen Fragen zu befassen. Feindliche Soldaten vergriffen sich immer an den Frauen des Königs, das war allgemein bekannt. Ich musste es unbemerkt aus dem Palast herausschaffen, sonst würde mich ein grausames Schicksal erwarten.
Ohne zu zögern, eilte ich zu meiner Kleidertruhe und zerrte ein schlichtes graues Gewand hervor, das ich benutzte, um mich tagsüber unbemerkt im Palast zu bewegen. Sittsam bedeckte es meinen ganzen Körper. Ich wusste, dass ich um keinen Preis auffallen durfte, wenn ich unversehrt entkommen wollte. Die Kleider meiner feinen Garderobe würden mich sofort als das entlarven, was ich war.
Während ich mit zitternden Fingern in das Kleid schlüpfte, schlug mir das Herz bis zum Hals und übertönte sogar die Schreie und den Kampfeslärm, die durch das Fenster zu mir heraufdrangen.
Plötzlich ertönte ein lautes Krachen, das selbst die dicken Schlossmauern erzittern ließ. Erschrocken hielt ich in meinen Fluchtvorbereitungen inne. Die Angreifer mussten das Eingangsportal zerstört haben und ins Innere des Palastes vorgedrungen sein. Nun galt es, keine Zeit zu verlieren.
Vorsichtig öffnete ich die Tür meiner Kammer und spähte durch den schmalen Spalt hinaus. Niemand war zu sehen.
Leise huschte ich den dunklen Gang entlang und tastete mich zur Treppe vor. Einen kurzen Moment lang fragte ich mich, ob ich den König warnen sollte. Ich verwarf diesen Gedanken jedoch schnell wieder, als sich laute Stimmen näherten. Hastig sandte ich ein Stoßgebet zum allmächtigen Pan.
»Bitte, gnädiger Schöpfer, schütze den König und hilf mir, lebend hier herauszukommen! In deiner Weisheit zeige mir den besten Weg!«
Dann huschte ich die Treppe hinunter. Am Treppenabsatz angekommen, wandte ich mich nach links und ertastete die Umrisse einer in die Wand eingelassenen Tür, die zu einem Dienstbotengang führte. Mit zitternden Fingern öffnete ich sie und achtete darauf, sie hinter mir sorgfältig wieder zu verschließen.
Der Boden war mit Teppichen ausgelegt, und Öllampen erleuchteten in regelmäßigen Abständen den leicht abwärts verlaufenden Gang. Meine Aufregung wuchs. Dieser Gang würde mich mitten ins Herz des Palastes führen und womöglich in die Arme der Angreifer. Gleichzeitig war er der einzige Weg, wenn ich unbemerkt entkommen wollte.
Als ich die Tür am anderen Ende des Gangs erreichte, waren meine Hände bereits schweißfeucht. Ich lauschte, hörte jedoch nichts außer meinem eigenen schweren Atem. Mit größter Vorsicht öffnete ich die Tür einen Spalt. Der breite Korridor, der sich vor mir auftat, schien leer zu sein, bis auf die pompösen Porträts aller vergangenen Herrscher Panterras, die die Wände säumten. Ich öffnete die Tür etwas weiter und fuhr erschrocken zurück, als ich gegen einen Widerstand stieß. Ich schloss die Augen und schluckte. Dann nahm ich all meinen Mut zusammen und spähte vorsichtig an der Tür vorbei, um zu sehen, was sie blockierte.
Direkt vor der Tür lag eine blutüberströmte Dienerin auf dem Boden. Ihr Kopf befand sich wenige Meter von ihrem Körper entfernt auf dem blutgetränkten Teppich, das Blond ihrer Haare war rot gesprenkelt.
Ich erstarrte und musste für einen Moment gegen den aufkommenden Brechreiz ankämpfen. »Milea«, flüsterte ich traurig. Sie war neu im Palast gewesen und hatte mir manchmal schüchtern zugelächelt, wenn wir uns auf dem Gang begegnet waren.
Jetzt nicht den Mut verlieren, ermahnte ich mich. Ich presste mir eine Hand vor Mund und Nase, während ich mit einem großen Schritt über den Körper der Toten stieg, sorgfältig darauf bedacht, sie nicht zu berühren. So schnell ich es, ohne ein Geräusch zu verursachen, vermochte, schlich ich dicht an der Wand entlang. Die Augen aller Monarchen schienen mir unangenehm von ihrem Platz zwischen den Bilderrahmen aus zu folgen.
Als ich das Poltern von schweren Stiefeln auf der Treppe vor mir vernahm, schien mein Herzschlag auszusetzen, und mein Körper gefror mitten in der Bewegung. Hektisch blickte ich mich auf dem langen Flur um. Es gab kein Versteck, keine einzige Fluchtmöglichkeit. Die Schritte kamen rasch näher. Panisch fuhr ich herum. Zwischen zwei Gemälden hing ein reich verzierter Wandteppich, der die religiöse Szene zeigte, in der Pan dem siegreichen König Dunragh den weißen Mantel der Gerechtigkeit überreichte.
Ich zerrte an dem schweren, staubigen Wandteppich und zwängte mich zwischen Teppich und Wand. Als meine Haut die eiskalten Steine berührte, kroch mir eine Gänsehaut den Rücken herauf. Das Versteck war nur eine Notlösung, denn der Wandteppich bedeckte zwar meinen Körper, verbarg aber nicht meine Füße. Ich zitterte am ganzen Leib, während ich versuchte, geräuschlos zu atmen.
Die Sekunden schienen sich endlos in die Länge zu ziehen. Nun war der Soldatentrupp die Treppe heruntergekommen und lief im Laufschritt den Flur entlang, direkt an meinem Versteck vorbei. Meine Sinne waren aufs Äußerste geschärft, während ich mich an die Steinwand presste und das Klirren der Rüstungen, das Klappern der Schwerter und den schweren Atem der Männer hören konnte.
Sie waren jetzt so dicht vor mir, dass mir der Geruch von Eisen in die Nase stieg. Ich hatte das Gefühl, mein wild pochendes Herz müsste mich jeden Moment verraten.
»Lasst keinen Mann am Leben« rief einer der Soldaten mit einem merkwürdigen Akzent. »Ihr wisst, was mit den Frauen zu tun ist. Der Herr will alle Schwarzhaarigen lebend.«
Die anderen lachten. Ich war mir meiner eigenen schwarzen Locken, die mir schweißnass im Nacken klebten, auf einmal nur allzu bewusst. Erneut fragte ich mich, woher diese Angreifer kamen und was der Zweck ihres Angriffs war. Was hatten sie mit schwarzhaarigen Frauen wie mir vor? Und wer war ihr Anführer?
Als sich die Schritte wieder entfernten, atmete ich erleichtert auf. Sobald ich sicher war, allein auf dem Gang zu sein, lief ich in Windeseile zur nächsten verborgenen Tür. Verschmolzen mit dem Gestein der Wand, war sie mit ungeschultem Auge niemals zu entdecken.
Den Geheimgang, der sich dahinter auftat, benutzte ich fast täglich. Er führte zu den abseits vom Palast gelegenen Ställen und damit zu Felfan.
Einen kurzen Moment lang überschattete die Sorge um ihn meine eigene Todesangst. Ich versuchte, mich zu beruhigen. Felfan war ein ausgezeichneter Schwertkämpfer, er würde sich zu verteidigen wissen. Ich beschwor sein vertrautes Gesicht vor meinem inneren Auge herauf und stellte mir vor, wie er mit konzentrierter Miene wie ein Berserker unter den feindlichen Soldaten wütete. Er war meine einzige Hoffnung, es hier lebend herauszuschaffen.
Nachdem ich die Tür zum Geheimgang hinter mir zugezogen hatte, lehnte ich mich eine Weile erleichtert gegen die kühle Wand und gönnte mir eine Pause. Als ich die Augen schloss, sah ich allerdings wieder den abgetrennten Kopf der Dienerin vor mir. Tränen traten mir in die Augen, und ich bemerkte, dass ich schon wieder am ganzen Körper zitterte. Ich gönnte mir nur wenige Augenblicke, um mich zu fangen, dann blinzelte ich die Tränen fort und stieß mich von der Wand ab.
Es gab kein Licht in diesem Gang, doch ich kannte den Weg. Ich gab mir einen Ruck und tastete mich an der Wand entlang durch die Dunkelheit.
Als ich den feuchten Gang hinter mir ließ und auf den Hof hinaustrat, bereitete ich mich innerlich auf das Schlimmste vor. Trotzdem stiegen mir Tränen der Verzweiflung in die Augen, als ich sah, dass die Ställe lichterloh brannten.
Die Hitze des Feuers schlug mir ins Gesicht, der dicke schwarze Qualm raubte mir den Atem. Ich sah alles wie durch einen Schleier hindurch.
Die Pferde waren freigelassen worden und stoben mit weit aufgerissenen Augen und laut wiehernd in Panik umher. Der Hof war mit Leichen bedeckt. Ich ermahnte mich, dass ich einen klaren Kopf bewahren musste, um hier herauszukommen.
Durch die brennenden Ställe war ich von meinem Fluchtweg über die nördliche Hauptstraße, die mich zur nächsten Stadt führen würde, abgeschnitten. Das metallene Klirren marschierender Stiefel riss mich abermals aus meinen Gedanken. Ohne zu zögern, rannte ich los.
Dicke Rauchschwaden trieben über den Hof und ließen mich nur wenige Meter weit sehen. Die Schritte wurden lauter. Jetzt konnte ich auch Rufe hören. Feindliche Soldaten! Ich rannte schneller. Da stolperte ich plötzlich über etwas und fiel der Länge nach zu Boden. Ich schürfte mir Hände und Knie auf und zerriss mein Kleid. Die Stimmen waren nun ganz nah.
Ich versuchte, so regungslos wie möglich liegen zu bleiben. Zwischen den zahlreichen Leichen, die den Hof bedeckten, würde ich vielleicht nicht auffallen. Ich presste mich flach auf den mit feuchtem Stroh bedeckten Boden, drehte mein Gesicht zur Seite und blickte in die leblosen Augen Felfans.
Ich presste mir die Hand auf den Mund, um nicht laut aufzuschreien. Fassungslos starrte ich in das vor Entsetzen verzerrte Gesicht meines Freundes. Der Anblick seines vor Grauen grimassenhaft entstellten Gesichts grub sich in mein Herz wie tausend Dolchstöße, und dennoch konnte ich meinen Blick nicht abwenden. Seine Augen waren weit aufgerissen und blickten starr, sein Mund war geöffnet, und Blut rann ihm aus dem Mundwinkel. Die einst roten Haare schienen stumpf und farblos und umgaben sein Gesicht wie ein Kranz aus kaltem Feuer. Seine Sommersprossen waren unter dem Ruß, der sein Gesicht bedeckte, kaum noch zu erkennen. Tränen rannen lautlos meine Wangen hinab.
Von Trauer überwältigt zwang ich mich, mich von dem schrecklichen Anblick zu lösen.
Ein Flackern in meinem Augenwinkel zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Zuerst dachte ich, die Flammen hätten mich umzingelt, doch dann sah ich, wie sich der Feuerschein in der Nähe von Felfan auf dem Boden spiegelte. Neben ihm lag ein Schwert. Er hatte seine Hand noch schützend darübergelegt. Ich biss die Zähne zusammen und lächelte grimmig. Er war nicht kampflos gestorben.
In der Zwischenzeit hatten sich die Schritte entfernt. Es war unheimlich still geworden. Außer dem Fauchen der Flammen, dem Krachen zusammenstürzender Holzbalken und dem Prasseln und Knistern des Feuers war nichts mehr zu hören. Keine Schreie, kein Pferdewiehern, kein Kampfeslärm.
Ich schaute auf und erkannte durch meine tränenverschleierten Augen sofort den Grund dafür. Alle Lebewesen waren geflohen vor dem, was sich da näherte. Eine Flammenwand donnerte unaufhaltsam auf mich zu. Der beißende Rauch schlug mir ins Gesicht und nahm mir den Atem. Ich hielt schützend eine Hand vor meinen Mund. Ohne nachzudenken, griff ich mit der anderen Hand nach Felfans Schwert.
Ich schrie auf, als ich mir die Finger an dem erhitzten Eisen verbrannte, und ließ die Waffe fallen. Mit der anderen Hand versuchte ich, Felfans steifen Körper mit mir von der Flammenhölle fortzuziehen. Wie eine Wahnsinnige zog und zerrte ich an ihm und brach schließlich in verzweifelte Schluchzer aus. Ich konnte ihn doch nicht einfach hier liegen lassen.
Doch als ich die Hitze des Feuers wie einen Schlag in meinem Gesicht spürte und die Flammen schon so nahe waren, dass sie die Spitzen meiner Haare versengten, entfesselte ich meine ganze Wut in einem Schrei der Verzweiflung und rannte los.
Meine letzte Chance, dem Feuer und den feindlichen Soldaten zu entkommen, war der an den Palast grenzende Wald.
Es hieß, dass sich niemals ein Mensch, der bei vollem Verstand war, in den Walhallad hineinwagte. Doch jetzt war ich dem Wahnsinn nahe. Todesangst und Trauer gruben sich in mein Herz, und ich spürte nur noch nackten Überlebenswillen. Ich rannte um mein Leben. Die Angst verlieh mir übermenschliche Kraft, die durch meine Adern schoss und alles andere aus meinen Gedanken verbannte. Innerhalb weniger Minuten hatte ich die östliche Palastmauer erklommen.
Als ich so auf der hohen Mauer stand, schaute ich noch einmal zurück zu dem Ort, den ich fast fünf Jahre lang mein Zuhause genannt hatte. Der Palast war hinter den Rauchsäulen und hochschlagenden Flammen kaum noch auszumachen. Ich wusste nicht, wer die feindlichen Truppen waren oder woher sie kamen, aber in diesem Moment schwor ich mir, es herauszufinden und Rache zu üben.
Schließlich drehte ich mich um, sprang von der Mauer und kehrte meinem alten Leben den Rücken zu.
Der Aufprall auf der anderen Seite war hart, und ich verdrehte mir den linken Knöchel. Am Ende meiner Kräfte humpelte ich auf den Waldrand zu.
Dunkel und bedrohlich wuchs der Walhallad vor mir in die Höhe. Die Bäume waren riesig und alt. Ihr Anblick jagte mir kalte Schauer über den Rücken, als ich zwischen sie trat. Trotzdem fühlte ich mich unter dem undurchdringlichen Blätterdach sicher. Das Feuer würde nicht bis hierher gelangen. Der Wind wehte die Flammen in die entgegengesetzte Richtung, und die Steinmauer trennte den Wald von dem Flammeninferno. Ich schleppte mich tiefer zwischen die Bäume und wollte nur noch vergessen. Vergessen, wer ich war. Vergessen, was ich erlebt hatte. Vergessen, dass ich meinen besten Freund nie wieder würde lächeln sehen.
Augen in der Dunkelheit
Ich wusste nicht mehr, wie viele Tage ich schon durch den Wald irrte. Meine aufgesprungenen Lippen und das bohrende Hungergefühl sagten mir aber, dass ich nicht mehr lange so weitermachen konnte. Ich wusste weder, welche Pilze oder Kräuter genießbar waren, noch, welche Bäume Früchte trugen oder wie man ein Tier erlegt. Daher hatte ich mich in den letzten Tagen nicht getraut, etwas anderes zu mir zu nehmen als eine Handvoll Nüsse, die ich gestern am Waldboden gefunden hatte.
Meine Beine schleppten meinen müden Körper nur noch vorwärts, weil es kein Zurück mehr gab. Mein Zustand war von Wut über den feindlichen Angriff und den Tod meines besten Freundes über Angst vor diesem wilden Wald zu purer Verzweiflung gewechselt, als mir schließlich klar wurde, dass ich mich heillos verirrt hatte.
Mein altes Leben schien bereits zu verblassen wie die Erinnerung an einen Traum. Das Einzige, was mich noch auf den Beinen hielt, waren die Fragen, die in meinem Kopf wie Blätter im Herbstwind ohne Unterlass umherwirbelten. Wer waren die feindlichen Angreifer? Wer hatte sie geschickt, und warum hatten sie es auf schwarzhaarige Frauen wie mich abgesehen? Und viel wichtiger: Was hatte ihr Befehlshaber als Nächstes vor?
Der Angriff auf den Königspalast, das Herz Panterras, war sicher nur der Anfang einer möglichen Invasion des gesamten Reiches gewesen. Was, wenn ich als Einzige entkommen war? Alles in mir schrie danach, mich einfach in Sicherheit zu bringen und das Reich sich selbst zu überlassen. Vielleicht könnte ich es bis zur Küste schaffen und mich auf ein Handelsschiff zu den Südlichen Inseln schmuggeln.
Die Verantwortung lastete jedoch schwer auf meinen Schultern. Wenn ich die einzige Überlebende war, musste ich es wenigstens bis zur nächsten Stadt schaffen und das Volk warnen. Ich wusste, dass Gahírimh, eine der größten Handelsstädte des Reiches, nur etwa eine Woche strammen Fußmarsches entfernt lag. Sicherlich würde man von dort aus einen Gegenangriff organisieren können, um den Palast zurückzuerobern und das Reich vor Schlimmerem zu bewahren. Und Felfan zu rächen.
Doch wie viel Zeit blieb mir? War das feindliche Heer womöglich bereits auf dem Vormarsch, um ganz Panterra zu unterwerfen?
Um Antworten auf alle meine Fragen zu finden, musste ich es so schnell wie möglich aus dem Walhallad herausschaffen. Doch je länger ich mich zwischen den dicht stehenden Stämmen und Sträuchern hindurchschleppte, desto auswegloser schien mir meine Situation.
In meiner ersten Nacht im Wald hatte ich bereits kein Auge zugetan. Die Dunkelheit war unter dem dichten Blätterdach undurchdringlich, und ich konnte mir allzu lebhaft ausmalen, was dort alles in den Schatten lauerte. Ein gefährlich funkelndes gelbes Augenpaar hatte mich so erschreckt, dass ich blindlings losgerannt war und erst anhielt, als meine Lungen zu bersten schienen. So war ich zu tief in den Wald vorgedrungen und hatte mich verlaufen.
Nun war ich am Ende meiner Kräfte. Meine einst angenehm duftende Haut, das seidige Haar und die gepflegten Fingernägel gehörten einem früheren Leben an.
Mein Kleid hing in Fetzen an meinem Körper herab. Gesicht, Arme und Beine waren von Dornen und Zweigen zerkratzt und mit blauen Flecken übersät. Mein Haar war verfilzt, und Blätter und Dornen hatten sich darin verfangen. Mein verdrehter Knöchel pochte unaufhörlich, und die Verbrennung an meiner rechten Hand, mit der ich Felfans Schwert hatte aufheben wollen, schmerzte und hatte zu nässen begonnen. Sie roch nach verbranntem Fleisch und sonderte ein gelbliches Sekret ab, obwohl ich sie notdürftig mit einem Fetzen meines Kleides verbunden hatte.
Am schlimmsten waren aber das stetig wachsende Hungergefühl und die damit verbundene Schwäche, die langsam, aber stetig durch meinen Körper kroch und ihn lähmte.
Trotzdem schleppte ich mich vorwärts, setzte einen Fuß vor den anderen. Es war Hoffnung, die mich vorantrieb. Hoffnung auf eine Quelle mit frischem Wasser hinter dem nächsten Baum oder darauf, dass sich der Wald wie durch Zauberhand vor mir lichtete und mich endlich freigab.
Ich hatte erfolglos versucht, all die Gefahren, die angeblich in diesem Wald lauerten, zu verdrängen. Jeden Abend, wenn es dämmerte, wenn die Kälte wie ein ungebetener Gast in meine Glieder kroch und die Dunkelheit alles um mich herum zu verschlucken drohte, drangen all die unheimlichen Geschichten über die Gefahren des Waldes wieder in mein Bewusstsein vor.
Mein Leben lang hatte man mir erzählt, der Walhallad sei böse. Schenkte man den alten Sagen glauben, lauerten hier, von wilden Tieren abgesehen, zahlreiche mystische Ungeheuer. Neben harmlosen Erzählungen von Kobolden, die ihren Schabernack mit Reisenden trieben, erzählte man sich nachts am Lagerfeuer auch unzählige Gruselgeschichten über menschenfressende Düsteralben, blutrünstige Knochenwölfe und die in schwarzer Magie erprobten Dunklen Meister, die hier ihr Unwesen trieben.
Die Erzählungen, die aus Zeiten stammten, in denen die Menschen sich noch vor Magie gefürchtet hatten, sollten kleinen Kindern Angst einjagen und die Menschen vom verbotenen Walhallad fernhalten, denn auf das Betreten stand die Todesstrafe.
Früher, hinter den sicheren Mauern des Palastes, hatte ich diese Geschichten als Ammenmärchen abgetan. Doch allein unter einem stetig dunkler werdenden Himmel, umgeben von zahlreichen fremden Geräuschen und mit Dutzenden verborgenen Augenpaaren im Rücken, war es plötzlich weniger abwegig, an diese Spukerzählungen zu glauben.
Wenn ich hier nachts wach lag und den Geräuschen des Waldes lauschte, spielten mir meine Sinne wundersame Streiche. Doch sagte ich mir jedes Mal, dass es nur die Bäume waren, die unter der Liebkosung des Windes seufzten.
Das gelbe Augenpaar, das mich in meiner ersten Nacht so erschreckt hatte, war auch in der zweiten Nacht erschienen, hatte sich mir aber nicht genähert. Geschlafen hatte ich deshalb nur wenig, seit ich diesen verfluchten Ort betreten hatte.
Neben meiner Angst vor allem Übernatürlichen machte ich mir Sorgen wegen der Soldaten, die den Palast angegriffen hatten. Ich wusste nicht, ob sie womöglich im Wald nach Überlebenden suchen oder, vom Aberglauben geleitet, keinen Fuß hier reinsetzen würden. Wieder und wieder stellte ich mir diese Fragen, und es schien, als hielten sie allein mich davon ab, den Verstand zu verlieren.
Die Sonne stand tief, als ich mir so in Gedanken versunken einen Weg durch das Dickicht bahnte. Es drangen nur noch wenige Sonnenstrahlen durch das dichte Blätterwerk bis zum Waldboden vor. In diesem Licht sah der Wald wahrlich verzaubert aus und verlor einiges von seiner Bedrohlichkeit. Doch bald würde die Dämmerung einsetzen, und ich würde mir einen sicheren Platz für die Nacht suchen müssen, an dem mich niemand hinterrücks angreifen könnte.
»Vermaledeiter Wald«, fluchte ich, weil ich im zunehmenden Dämmerlicht über eine Wurzel gestolpert war, hielt aber augenblicklich in der Bewegung inne, als ich ein rotes Glühen im rechten Augenwinkel wahrnahm. Mein Herz begann schneller zu klopfen, meine Hände wurden feucht. Ich fuhr herum.
Ein verwunderter Laut entwich meinem vor Staunen weit offen stehenden Mund, als ich die Quelle des Feuerscheins ausmachte.
An einen knorrigen Baum gelehnt saß dort ein Mann. Ein Strahl des sterbenden Sonnenlichts schien ihm direkt in das von wirrem braunem Haar eingerahmte Gesicht. Er hatte die Augen geschlossen, und sein Kopf war im Schlaf auf seine Brust gesackt. Ein wohliger Ausdruck lag auf seinen Zügen, und er atmete tief und gleichmäßig.
Ich stand nur wenige Schritte von ihm entfernt. Meine Aufmerksamkeit war von einer kleinen Feuerstelle zu seinen Füßen erregt worden, auf der einzelne Funken zwischen den schwarzen Kohlen glommen. Darüber hing, auf einen Stock gespießt, ein halb aufgegessenes und gut durchgebratenes Kaninchen.
Beim Gedanken daran, wie sich der würzige Geschmack des Fleisches langsam in meinem Mund ausbreitete, zog sich mein Magen schmerzhaft zusammen. Ich starrte wie gebannt auf den saftigen Leckerbissen und überlegte fieberhaft, ob ich es wagen könnte, den Mann zu beklauen. Er sah friedlich aus im Schlaf und schien nicht bewaffnet zu sein. Seine Arme hatte er vor der Brust verschränkt.
Ich würde mich lautlos heranschleichen, den Stock mitsamt Kaninchen vom Feuer nehmen und wäre längst fort, wenn er erwachte.
Andererseits, dachte ich, war er der erste Mensch, den ich seit Tagen gesehen hatte. Vielleicht sollte ich ihn um Hilfe bitten. Was hatte er im Wald zu suchen? Ich wusste, dass sich einige mutige Jäger in den Walhallad wagten, um Wild zu erlegen und es dann zu besonders hohen Preisen auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Darauf stand allerdings die Todesstrafe. Ich sollte mich lieber nicht mit einem Gesetzlosen einlassen. Das halbe Kaninchen würde er nicht vermissen. Der Mann würde sicherlich besser ohne Nahrung zurechtkommen als ich, und angesichts seiner robusten Lederkleidung schien er auf einen längeren Aufenthalt im Wald vorbereitet zu sein.
Schließlich konnte ich nicht länger warten. Lautlos begann ich mich an mein Opfer heranzupirschen. Als ich dicht vor der Feuerstelle stand, nahm ich all meinen Mut zusammen und griff vorsichtig nach dem Stock.
Ein schriller Schrei ertönte, und etwas stürzte sich von oben auf mich herab. Der Fremde erwachte sofort, war innerhalb weniger Sekunden auf den Beinen und hatte mich überwältigt, ehe ich mich versah.
Er drehte mir mit einer einzigen fließenden Bewegung meinen linken Arm auf den Rücken, bog ihn schmerzhaft nach oben und setzte mir gleichzeitig ein Messer an die Kehle.
Durch den Klammergriff fest an mich gepresst, stand er hinter mir, und sein Atem ging noch nicht einmal schneller. Ich wollte mich nicht so leicht geschlagen geben und versuchte verbissen, mich aus seinem Griff zu befreien.
Doch schon erfolgte ein weiterer Angriff aus der Luft. Ich schlug wild um mich, kratzte, spuckte und biss, um das Etwas, das sich in meinen Haaren verkrallt hatte, loszuwerden. Der Fremde packte mich fester, und das Messer schnitt leicht in meine Kehle. Der Schmerz brachte mich dazu stillzuhalten. Tränen der Wut liefen mir über das Gesicht.
»Haben wir uns wieder beruhigt?«, fragte eine angenehm tiefe Stimme ganz nah an meinem Ohr.
»Lasst mich los!«, gab ich zähneknirschend zurück und betonte dabei jedes einzelne Wort.
Sein Griff lockerte sich, und als ich nicht erneut wild um mich zu schlagen begann, gab er mich schließlich frei.
Ich hätte nichts lieber getan, als ihn erneut anzugreifen. Nicht nur war mein Plan fehlgeschlagen, ich befand mich nun sogar in noch größeren Schwierigkeiten als zuvor. Doch ich schluckte die Tränen hinunter und bändigte meine Wut.
Es gab nur noch einen Weg, heil aus dieser Situation herauszukommen. Ich musste ihn dazu bringen, nach meinen Regeln zu spielen.
Ich nahm Haltung an und strich mein hoffnungslos zerrissenes Kleid glatt. Doch bevor ich meinen verführerischsten Blick aufsetzte, blinzelte ich unauffällig zu den Wipfeln der Bäume hinauf, um einem weiteren Angriff aus der Luft vorzubeugen.
Auf einem Ast saß dort ein Falke und spähte misstrauisch zu mir herunter. Als ich ihn böse anfunkelte, legte er den Kopf schief und starrte mich unschuldig aus seinen dunklen Falkenaugen an. Ich schnaubte erbost. Ich hatte mich von einem Vogel überwältigen lassen!
Graziös drehte ich mich zu dem Fremden um und schenkte ihm einen meiner unwiderstehlichen Blicke. Prompt verfinsterte sich jedoch mein Gesichtsausdruck, als ich bemerkte, dass er mir den Rücken zugewandt hatte und gerade dabei war, sein Messer wieder in eine Lederscheide an seinem Stiefel zu stecken. Dabei pfiff er leise vor sich hin.
Wutentbrannt stellte ich fest, dass er es noch nicht einmal für nötig zu halten schien, mich im Auge zu behalten. In meinem Zustand war ich wohl kein ernst zu nehmender Gegner.
Ich überlegte, ob ich ihn eines Besseren belehren und mich auf ihn stürzen sollte, doch da krächzte der Falke warnend, als hätte er meine Gedanken gelesen. Ich seufzte resigniert. Was hatte der Mann jetzt wohl mit mir vor?
Der Fremde beachtete mich nicht im Geringsten. Fröhlich pfeifend trat er die Flammen aus und wickelte die Überreste des Kaninchens in ein Tuch. Er warf sich eine Ledertasche über die Schulter und zog ein Kurzschwert, einen Köcher mit Pfeilen und einen Bogen hinter dem Baumstamm hervor, an dem er noch vor wenigen Augenblicken gelehnt hatte.
Beschämt schlug ich die Augen nieder. Wie hatte ich auch nur eine Sekunde lang annehmen können, dass er unbewaffnet in diesen Wald gekommen war?
Als er das Kurzschwert am Waffengurt um seine Hüfte und Köcher und Bogen an seinem Rücken befestigt hatte, hob er wortlos seinen rechten Arm, an dessen Elle eine abgenutzte Lederstulpe befestigt war. Daraufhin stieß der Falke elegant vom Baum herab und ließ sich darauf nieder.
Der Fremde sagte etwas in einer mir fremden Sprache zu dem Vogel und streichelte ihm liebevoll über das graue Gefieder. Dann drehte er sich um und begann sich auf den Weg tiefer in den Wald hinein zu machen.
Er drehte sich nicht mehr nach mir um, warf mir aber das in das Tuch eingewickelte Kaninchenfleisch über seine Schulter hinweg zu. »Lass es dir schmecken«, rief er. Dann war er zwischen den Bäumen verschwunden.
Ich fing das Bündel auf und starrte ihm sprachlos hinterher. Ich brauchte einen kurzen Moment, um zu verarbeiten, was soeben geschehen war, ehe ich mich stolpernd in Bewegung setzte und, mehr fallend als rennend, hinter ihm herlief.
Als ich ihn nicht mehr ausfindig machen konnte, geriet ich in Panik. »Wartet! Wartet auf mich!«
Alles, was ich hörte, war das Säuseln des Windes in den Blättern der Bäume und der Schrei einer Eule. Ich hatte nicht bemerkt, dass die Dämmerung während meines peinlichen Diebstahlversuchs endgültig heraufgezogen war. Es war kaum noch etwas im sterbenden Licht zu erkennen.
Plötzlich stand er vor mir.
»Und ich dachte, du warst nur auf mein Kaninchen aus«, bemerkte er amüsiert.
Mit einem fragenden Lächeln auf dem Gesicht schaute er mich an und legte dabei den Kopf genauso schief wie sein Falke zuvor. Ich bemerkte, dass das Tier nicht mehr auf seinem Arm saß. Das machte mir Mut.
»Es tut mir leid«, stieß ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Es fiel mir nicht leicht, mich bei ihm zu entschuldigen, während er mich mit diesem überheblichen Grinsen musterte.
Zum ersten Mal wanderte sein Blick zu meinen Augen, und unsere Blicke trafen sich. Seine Augen weiteten sich mit einem Mal, und es war, als hielte er mich mit seinem eindringlichen Blick fest. Er starrte mich geradezu an, und seine Stirn zog sich nachdenklich in Falten. Nach einigen Augenblicken schien er sich wieder zu fangen und blinzelte kurz.
»Und was genau tut dir leid?«, fragte er eine Spur zu unbeschwert. »Dass du mich aufgeweckt hast, dass du meinen Falken erschreckt hast oder dass du uns beklauen wolltest?«
Schon wollte ich ihm eine patzige Antwort geben, besann mich aber eines Besseren. Ich hatte diesen Mann zu meinem Retter auserkoren. Er würde mich aus diesem Wald herausbringen, nur wusste er es noch nicht.
Mein Retter musterte mich noch immer nichtsahnend, eine Augenbraue ungeduldig hochgezogen.
»Ich möchte mich für alle drei Vergehen aufrichtig bei Euch entschuldigen und würde Euch gerne erklären, warum ich mich dazu gezwungen sah, Euch zu beklauen. Ich habe mich verlaufen, und ich brauche Eure Hilfe. Könnt Ihr mich aus diesem Wald herausführen?«
Er sah mich weiterhin mit diesem seltsamen Blick an, als würde er angestrengt über etwas nachdenken.
»Ich kann Euch nicht bezahlen, aber mir würde da eine Wiedergutmachung einfallen, die Euch sicher besser gefallen würde«, fügte ich hastig hinzu und lächelte vielsagend.
Seine Mundwinkel zuckten.
»Dann sollten wir dir vielleicht erst einmal etwas zum Anziehen besorgen. Du frierst sicher, und die Nächte sind für diese Jahreszeit noch kühl«, bemerkte er trocken. Ich starrte ihn verblüfft an, und sein Grinsen wurde noch breiter.
»Hier mitten im Wald? Ich glaube kaum«, knurrte ich, verärgert darüber, dass er mein Angebot einfach übergangen hatte und es ihn anscheinend amüsierte. So eine Reaktion hatte ich noch nie von einem Mann bekommen.
»Du wirst schon sehen. Schaffst du es, mit mir Schritt zu halten?«
»Natürlich.«
»Ich würde dir nicht empfehlen, mich noch einmal anzugreifen. Wir wollen ja nicht, dass du noch mehr blaue Flecken bekommst.«
Der Schalk blitzte in seinen Augen auf und weckte meinen Zorn.
»Die meisten davon habe ich mir beim Kampf mit Euch und Eurem Vieh zugezogen«, gab ich wütend zurück.
»Mein Vieh?«
»Dieses Vieh war es auch, was Euch mit seinem Geschrei aus dem Schlaf gerissen hat, nicht ich!«
Er lachte. »Folge mir!«
Die dunkle Gestalt schritt den Wehrgang des besetzten Wachturms entlang. Unter ihr breitete sich ein schreckliches Bild der Verwüstung aus. Große Teile des Königspalastes standen in Flammen, und der Hof war übersät mit den Leichen der Getreuen des Königs. Nur vereinzelt drangen noch Schreie letzter Überlebender oder gefolterter Palastbewohner herauf. Die Luft war geschwängert von Rauch und dem Geruch frischen Blutes. Berauscht sog der Rote den Duft der Vernichtung in sich auf. Es war der Duft des Sieges, der Genugtuung und des Verrats. Der Verrat roch köstlich, er könnte sich leicht an diese besonders verführerische Note, die auch dem Duft der Macht innewohnte, gewöhnen.
Dumpfe Schritte ließen ihn sich von seinen Gedanken losreißen. Er ermahnte sich, dass er sein Ziel mit diesem ersten Sieg noch lange nicht erreicht hatte.
»Mein Herr.«
Der Söldnerhauptmann schlug sich mit der rechten Faust auf die Brust und verneigte sich tief.
»Die Gesuchte wurde noch nicht gefunden. Wir haben das gesamte Palastgelände durchkämmt, jede schwarzhaarige Frau aufgespürt und König Béoras gefoltert. Er redet nicht.«
Ein bedrohliches Knurren drang unter der tief ins Gesicht gezogenen Kapuze seines Herrn hervor. Der Soldat wich ängstlich zurück. Er hatte noch nie das Gesicht seines Meisters gesehen. Stets trug dieser eine pechschwarze Rüstung und einen dunkelroten Umhang. Die Kapuze war immer so tief ins Gesicht gezogen, dass man darunter nur eine unendlich tiefe Schwärze erkennen konnte.
Einige Söldner seiner Truppe erzählten sich, der Rote sei kein Mensch. Andere munkelten, er sei körperlos und lediglich seine dunkle Seele hause in der Rüstung. Wieder andere scherzten, er sei einfach nur so hässlich, dass er sich verstecken müsse. Diese Mutmaßungen wurden aber nur des Nachts hinter vorgehaltener Hand geflüstert. Der Respekt und die alles übersteigende Angst, die der Rote seinen Anhängern einflößte, sorgten für uneingeschränkten Gehorsam.
Während er weiter das Bild der Zerstörung unter sich betrachtete und seinem Hauptmann noch immer den Rücken zuwandte, antwortete der Rote mit einer Stimme, die den Söldner wie ein Peitschenhieb traf.
»Habe ich dir nicht oft genug erklärt, wie wichtig diese Frau für meine Ziele ist? Habe ich dich nicht immer wieder ermahnt, dass sie auch für deine Existenz von größter Bedeutung ist?«
Die Worte klangen aus diesem schwarzen Schlund nicht wie Fragen, auch wenn sie so formuliert waren. Leise und bedrohlich zischelte die Stimme, und der Soldat ahnte Schreckliches. Seine Hände zitterten. Hastig wischte er sich den Angstschweiß aus dem Gesicht.
»Wenn ihr sie nicht findet und zu mir bringt«, fuhr der Rote fort, »werde ich dich und deine Männer als mir unwürdige Diener erkennen und euch für euer Versagen bestrafen müssen.«
Langsam drehte er sich zu dem Soldaten um. Dieser zitterte bereits am ganzen Leib und wich noch weiter zurück.
»Es wäre zu schade, wenn ich bemerken sollte, dass ihr euch nicht ausreichend angestrengt habt, um euren Meister zufriedenzustellen, findest du nicht auch, Hauptmann?«
Die Stimme klang immer noch kalt und gefühllos, hatte jetzt aber auch noch einen bedrohlichen Unterton angenommen.
»Wi-wir … werden euch nicht enttäuschen, H-Herr. Wir sind uns der Dringlichkeit des Auftrags d-durchaus bewusst.«
Während der Soldat sprach, bemerkte er, wie etwas Warmes, Feuchtes an der Innenseite seines Schenkels hinablief. Er schluckte schwer.
»Ich werde mich sofort auf den Weg machen, um unseren Fehler zu korrigieren.« Er wollte schon herumfahren und von den Zinnen flüchten.
»Nein.«
Jetzt lächelte der Rote unter seiner Kapuze. Er konnte die Angst des Menschen riechen, als dieser mitten im Schritt erstarrte. Er konnte sein Herz flattern hören wie einen kleinen, aufgebrachten Vogel, eingesperrt in einem Käfig.
Der Rote weidete sich an dem Angstgestank aus Schweiß und Urin und sog ihn tief in sich auf. Grinsend leckte er sich über die Lippen. Er ließ seine nächsten Worte wie eine gefährliche Säure genüsslich über seine Zunge gleiten und beobachtete voll perverser Freude, wie sie den Verstand des Soldaten zu verätzen begannen.
»Du hast versagt, Hauptmann.«
»Nein …« Die Stimme des Soldaten war nur noch ein zitterndes Flüstern.
»Die Frau ist entkommen.«
»Nein, mein Herr, ich …«
Die Angst fraß sich langsam in seinen Verstand, grub sich tiefer und tiefer hinein und ließ ihn verzweifelt werden. Unachtsam. Respektlos.
»Die Kurtisane ist entkommen, und durch dein Versagen bin ich mit diesem Sieg meinem Ziel keinen Schritt näher gekommen. Du weißt, wie sehr ich es hasse, enttäuscht zu werden.«
»Neeeiiinn! Ich bitte Euch, Herr!« Er warf sich seinem Herrn schluchzend vor die Füße. »Habt Erbarmen!«
»Du vergisst dich, Welkan.« Der Rote lachte leise in sich hinein. »Vergiss nicht, vor wem du hier um Gnade flehst. Und vor allem vergiss nicht, dass ich es hasse, enttäuscht zu werden!«
Die letzten Worte schleuderte er dem sich am Boden windenden Soldaten in einem Schrei der Wut entgegen. Er riss die Arme in die Höhe, und Welkan wurde von einer unsichtbaren Macht emporgeschleudert. Er hing kopfüber in der Luft, und der Rote ließ ihn mit einer raschen Bewegung ganz nah vor sein Gesicht schweben.
Die Augen des Soldaten zuckten wild und unkontrolliert hinter den geschlossenen Lidern. Seine Lippen bebten und schienen lautlos flehende Worte zu formen. Aus seinem Mundwinkel rann Blut, er hatte sich vor Angst auf die Zunge gebissen. Der rote König betrachtete für einen Moment das vor Angst verzerrte Gesicht dieses schwachen Geschöpfes. Dann hielt er seinen Mund dicht an Welkans Ohr.
»Ich werde sie finden. Dazu brauche ich dich nicht.«
Und mit einer einzigen Bewegung seiner Augen schleuderte er den Soldaten über den Rand der Zinnen in den feurigen Abgrund.
Die Namenlosen
Meine Überheblichkeit schien mich schon bald eingeholt zu haben. Es war tatsächlich nicht leicht, mit meinem Begleiter Schritt zu halten. Er bewegte sich so flink und geschickt zwischen den tief hängenden Ästen und den Wurzeln am Boden hindurch, dass er keinerlei Geräusch verursachte.
Ich hatte ihn kein einziges Mal stolpern oder straucheln sehen, und nicht selten verschwand er plötzlich aus meinem Blickfeld, nur um dann hinter dem nächsten Strauch belustigt auf mich zu warten.
Die meiste Zeit über hatte ich meinen Blick fest auf seinen Rücken geheftet. Ich knabberte an dem gebratenen Hasenfleisch und wartete darauf, dass er irgendwann unachtsam einen Ast streifen oder an einem Dornenbusch hängen bleiben würde, doch er bewegte sich so geschmeidig durch den Wald, als wäre er ein Teil von ihm. Meine Stimmung wurde stetig grimmiger.
Die meisten der gemurmelten Verwünschungen, die ich von Zeit zu Zeit zwischen zusammengebissenen Zähnen hervorstieß, galten seinem Federvieh. Der Falke zog, versteckt vor unseren Blicken, ununterbrochen seine Kreise über den Baumwipfeln und stieß dann und wann einen warnenden Ruf aus.
Ich wusste nicht, wie lange ich schon hinter dem Fremden hergestolpert war, als er plötzlich das Wort an mich richtete, ohne sich zu mir umzudrehen. Ich war erschöpft, die Verbrennung an meiner Hand hatte zu pochen begonnen, und so erschrak ich im ersten Moment über seine leise Stimme.
»Was hat dich in diesen Wald geführt?«
Mein Herz begann sofort schneller zu schlagen. Konnte ich ihm trauen und die Wahrheit erzählen? Was, wenn er an der Verschwörung gegen König Béoras beteiligt war?
Diesen Gedanken verwarf ich sofort wieder. Vielleicht wusste er aber etwas über den Angriff auf den Palast, was mir helfen würde, das Rätsel zu lösen. Auch dies schien unwahrscheinlich. Ich beschloss, so wenig wie möglich von mir preiszugeben.
»Ich war auf dem Weg von Mhâlon nach Gahírimh, als meine Kutsche von Wegelagerern überfallen wurde. Ich schaffte es gerade noch, mich in den Wald zu retten, während meine Bediensteten weniger Glück hatten. Auf der Flucht habe ich mich verlaufen und irre seitdem durch den Wald.«
Sollte er doch denken, ich wäre ein Edelfräulein auf Reisen.
Er drehte sich noch immer nicht zu mir um, und so konnte ich nicht sicher sein, ob er mir meine Geschichte glaubte.
»Es geschieht nicht oft, dass sich Menschen in den Wald hineinwagen«, bemerkte er.
»Und doch seid Ihr im Wald und scheint ihn wie Eure Westentasche zu kennen«, konterte ich, ärgerte mich jedoch sofort über meine spitze Zunge, da er sich daraufhin wieder in Schweigen hüllte.
»Wie kommt es, dass Ihr Euch im Wald auskennt? Seid Ihr ein Waldläufer?«, hakte ich nach.
Von diesen mutigen Männern, die ihr Leben dem Wald, seinen Tieren und Pflanzen und dem in ihm verborgenen Wissen widmeten, hatte ich in alten Geschichten gehört. Das war zu Zeiten gewesen, als die Menschen noch nicht begonnen hatten, den Wald zu fürchten. Als Panterra noch jung und ein wildes Land voller gefährlicher Magie war. Glücklicherweise hatte das Menschengeschlecht die Magie ausmerzen und die verbliebenen magischen Kreaturen in den Wald verbannen können, wo sie zu Sagengestalten wurden.
Doch auch auf diese Frage schien mein Reisegefährte mir keine Antwort geben zu wollen. Er schnaubte nur.
»Könnt Ihr mir denn den Weg nach Gahírimh zeigen? Ich habe dort dringende Geschäfte zu erledigen.« Wieder eine Lüge.
»Ich habe dir mein Wort gegeben, oder nicht?«, antwortete er schroff, und ich wich beinahe vor seiner abweisenden Art zurück.
»Dann bist du also ein Edelfräulein?«, fügte er nach kurzem Schweigen etwas versöhnlicher hinzu.
»Nicht direkt.«
»Das dachte ich auch nicht, so wie du fluchst.«
Ich wollte aufbrausen, besann mich aber eines Besseren.
»Und was ist das für ein geheimnisvoller Ort, an den Ihr mich jetzt führt, um mich neu einzukleiden?«, fragte ich stattdessen.
»Wie ich bereits sagte, wir besorgen dir neue Kleider.«
»Aber könnt Ihr mich danach auf direktem Weg aus dem Walhallad herausführen? Es ist wirklich wichtig.«
Er hielt abrupt an und fuhr zu mir herum.
»Was für ein Waldläufer wäre ich, wenn ich einer Dame in Not meine Hilfe verweigern würde?«, brummte er sarkastisch.
»Obwohl die Dame versucht hat, Euch zu beklauen?«
Ein Lächeln stahl sich unvermittelt auf seine Züge, und er nickte.
»Ich verspreche dir, dich auf schnellstem Weg nach Gahírimh zu führen. Dafür verlange ich keine Bezahlung. Ich habe nur eine Bedingung.«
»Und die wäre?«
»Keine Diebstahlversuche mehr. Ist das klar?«
Nun war es an mir zu lächeln.
»Abgemacht.«
Er hatte sich bereits wieder herumgedreht und war leichtfüßig weitergelaufen, sodass ich Mühe hatte, ihm zu folgen.
»Aber könnt Ihr auch versprechen, dass ich unversehrt in Gahírimh ankommen werde?«, rief ich hinter ihm her. »Dieser Wald ist schließlich der gefährlichste Ort in ganz Panterra.«
Im selben Moment stolperte ich über eine Wurzel und ging mit einem leisen Aufschrei zu Boden. Zu erschöpft, um mich aufzusetzen, blieb ich auf dem Waldboden liegen, und das Herz hämmerte mir vor Schreck in der Brust.
Er war sofort neben mir. So lautlos, wie er sich bewegte, bemerkte ich ihn erst, als er schon neben mir kniete.
»Hast du dich verletzt?«
Ich stöhnte, drehte mich auf den Rücken und schaute zu ihm auf. Er sah aus wie ein verwunschenes Waldwesen, ein Bein angewinkelt, ein Knie auf dem Boden. Silbriges Mondlicht sickerte durch die Äste und ließ seine dunklen Augen wie zwei schwarze, schimmernde Seen erscheinen, die besorgt auf mich herabsahen. Im Mondlicht wirkte seine sonst gebräunte Haut milchig weiß, wie die marmorne Haut einer Statue, und die Schatten, die die vom Wind bewegten Bäume warfen, schienen über seine Haut zu tanzen.
In diesem Moment wurde mir bewusst, wie ich in seinen Augen aussehen musste. Abgerissen und heruntergekommen war ich für ihn sicher nicht mehr als ein einfaches Mädchen vom Land oder sogar eine Bettlerin, die sich als Edelfräulein ausgab. Beschämt schloss ich die Augen und seufzte. Mein altes Leben im Überfluss schien mir unendlich weit entfernt.
Ich fuhr auf, als seine Hände vorsichtig meinen Knöchel betasteten. Erschrocken über seine unerwartete Berührung, krabbelte ich in Windeseile von ihm fort. Seine Augenbrauen zogen sich verärgert zusammen.
»Ich wollte nur sichergehen, dass du dich nicht verletzt hast.« Er klang genervt. »Ich werde versuchen, dich in einem Stück in Gahírimh abzuliefern. Es scheint aber keine leichte Aufgabe zu sein.«
Mit einer fließenden Bewegung erhob er sich und streckte mir eine Hand entgegen.
»Ich gehe heute Nacht keinen Schritt mehr durch diesen Wald! Seht Ihr denn nicht, dass ich am Ende meiner Kräfte bin?« Ich funkelte ihn wütend an, und er ließ seine Hand sinken.
»Ich dachte, wir würden es noch vor Mitternacht bis zum nächsten Unterschlupf schaffen, aber mit deinem Talent, dich durch den Wald zu bewegen, werden wir wohl an Ort und Stelle übernachten müssen.«
Mir lag eine zynische Antwort auf der Zunge, aber ich schluckte sie herunter, als ich erkannte, dass ich mein Ziel erreicht hatte. Wir würden heute Nacht nicht weitergehen.
Der Waldläufer hatte mir bereits den Rücken zugekehrt.
»Warte hier«, murmelte er.
Nach wenigen Minuten, die ich wartend allein in der Finsternis verbrachte, fühlte ich mich plötzlich wortlos von zwei starken Armen emporgehoben und ein Stück weit getragen. Er dachte also wirklich, ich hätte mir den Knöchel verstaucht. Ich ließ ihn gewähren und war schon fast in der warmen Umarmung eingenickt, als ich auf ein weiches Lager gebettet wurde.
Hinter einer Wand aus mannshohen Farnwedeln hatte er zwischen den Wurzeln eines riesigen Baumes ein Nachtlager errichtet.
Der Baum war so hoch, dass ich in der Dunkelheit sein Geäst nicht mehr ausmachen konnte. Ich lag auf einer grob gestrickten, warmen Decke, in die ich mich sogleich hineinkuschelte. Mein Begleiter warf mir einen Apfel aus seiner Tasche zu, den ich gierig verschlang. Dann nahm er einige Schritte von mir entfernt, an den Baumstamm gelehnt Platz.