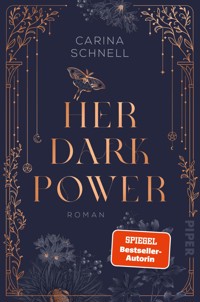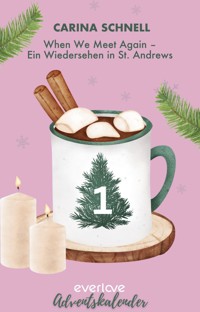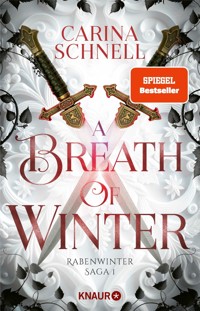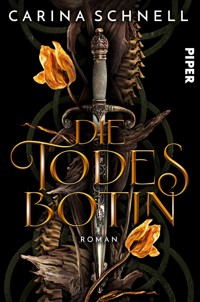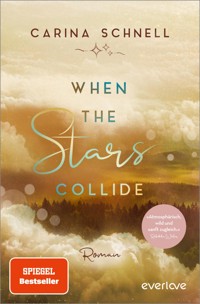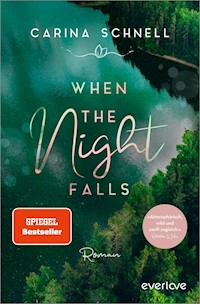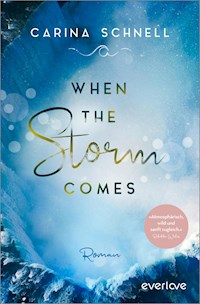3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Magische Leidenschaft
- Sprache: Deutsch
Wenn du alles verloren hast, wofür lohnt es sich zu kämpfen? Die ehemalige Kurtisane Méah wähnte sich in Sicherheit, und glaubte die Soldaten des brutalen roten Königs hinter sich gelassen zu haben. Doch die Vergangenheit holt sie immer weiter ein und erneut ist sie auf der Flucht. Ihr Ziel: Der Norden, wo es noch Magier gibt und wo sie nicht nur auf Schutz hofft, sondern auch zu erfahren, wer sie wirklich ist, ob auch sie magische Fähigkeiten besitzt. Aber Méah weiß wenig über die magische Welt, ihre Gesetze und Gefahren. Und so sieht sie einer ungewissen Zukunft und der schwersten Prüfung ihres Leben entgegen… Von Carina Schnell sind bei Forever erschienen: Die Kurtisane - Erwachen der Leidenschaft Die Magierin - Entscheidung aus Leidenschaft
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 542
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Die AutorinNach ihrem Abitur verbrachte Carina Schnell viel Zeit im Ausland. Da sie sich schon immer für fremde Länder, Kulturen und Sprachen interessierte, absolvierte sie ihr Bachelorstudium an der Universität Heidelberg und einen Master an der Uni Genf im Übersetzen. In den vielen Jahren, in denen sie als Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache tätig war, ist ihre Liebe zur deutschen Sprache wieder bewusst geworden. Zurzeit lebt und arbeitet sie als Übersetzerin in der Schweiz. Seit November 2016 ist sie Fernstudentin der Autorenschule der Textmanufaktur.
Das Buch
Wenn du alles verloren hast, wofür lohnt es sich zu kämpfen?
Die ehemalige Kurtisane Méah wähnte sich in Sicherheit, und glaubte die Soldaten des brutalen roten Königs hinter sich gelassen zu haben. Doch die Vergangenheit holt sie immer weiter ein und erneut ist sie auf der Flucht. Ihr Ziel: Der Norden, wo es noch Magier gibt und wo sie nicht nur auf Schutz hofft, sondern auch zu erfahren, wer sie wirklich ist, ob auch sie magische Fähigkeiten besitzt. Aber Méah weiß wenig über die magische Welt, ihre Gesetze und Gefahren. Und so sieht sie einer ungewissen Zukunft und der schwersten Prüfung ihres Leben entgegen…
Von Carina Schnell sind bei Forever erschienen:Die Kurtisane - Erwachen der LeidenschaftDie Magierin - Entscheidung aus Leidenschaft
Carina Schnell
Die Magierin
Entscheidung aus Leidenschaft
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Originalausgabe bei Forever Forever ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Juli 2017 (1) © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2017 Umschlaggestaltung: zero-media.net, München Titelabbildung: © FinePic® Autorenfoto: © privat ISBN 978-3-95818-193-9 Hinweis zu Urheberrechten Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Auf der Flucht
Als ich mich während des Reitens umwandte, konnte ich die Silhouetten Dutzender Reiter am Horizont ausmachen. Meine Verfolger passierten soeben das Eingangstor zum Besitz des Barons, von dem ich mich kurz zuvor verabschiedet hatte. Der Wind trug Fetzen verzerrten Hundegebells zu mir heran. Die Hetzjagd hatte also begonnen.
Ich wandte mich in die entgegengesetzte Richtung und ließ Kjelt das Herrenhaus umrunden. Dann spornte ich ihn zu einem wilden Galopp an. Wir preschten durch den Garten und wurden schließlich eins mit der Weite der leeren Felder, die sich vor uns erstreckten, soweit das Auge reichte.
Die weite Ebene barg jedoch eine große Gefahr. Es gab keine Möglichkeit, sich vor suchenden Augen zu verbergen – nur windgepeitschtes Gras, hier und dort gesprenkelt mit bunten Blumen, wilden Kräutern und halb verkümmerten Sträuchern, die die ersten purpurroten Herbstfrüchte trugen.
Während wir unter den wenigen Wolken am Himmel dahinjagten, versuchte ich, meine Augen nicht immer wieder zum Wald wandern zu lassen, der als ferne, düstere Silhouette bedrohlich zu unserer Rechten zu schweben schien.
Es wäre ein gefährlicher Trugschluss zu glauben, dass der Walhallad mir Schutz bieten könnte. Wie ich schon am eigenen Leib erfahren hatte, schreckten die Soldaten nicht davor zurück, ihn zu betreten, und ihre Bluthunde würden meine Spur auch dorthinein verfolgen können. Außerdem lauerten dort noch weit schrecklichere Gefahren, die ich ebenfalls schon mit eigenen Augen gesehen hatte. Nicht zuletzt barg der Walhallad meine eigenen schmerzvollen Erinnerungen. Trotzdem hielt ich in einem weiten Bogen immer weiter auf den Wald zu, der sich über den ganzen Osten Panterras und bis weit in den Norden erstreckte. Es wäre taktisch klug, sich nahe seiner Ausläufer zu halten, denn eine einzelne Reiterin war auf einer weiten Ebene vor dem Horizont allzu leicht zu entdecken, während ich am Waldrand mit den Bäumen verschmelzen würde. Außerdem hatte der Baron mir an einem der Abende, an denen wir eine seiner vielen Karten Panterras studiert hatten, erklärt, dass man den Norden nicht verfehlen konnte, wenn man immer am Waldrand entlangritt, dem Nordstern entgegen.
Da ich auf meiner überstürzten Flucht keine Karte hatte mitnehmen können, würde ich mich eben an meiner Umgebung und der Natur orientieren müssen. Ich musste unwillkürlich lächeln, als ich bemerkte, dass ich bereits wie eine Waldläuferin dachte. Érion wäre stolz auf mich gewesen. Beim Gedanken an meine überstürzte Flucht und die ausweglose Lage, in der ich mich befand, kamen mir aber gleich darauf beinahe die Tränen. Ich versuchte mich zusammenzureißen. Immerhin hatte ich einen Vorsprung, und den musste ich, so gut es ging, zu meinem Vorteil nutzen.
So flogen wir dahin, und ich verlor jegliches Zeitgefühl. Ich sah oft über die Schulter zurück, konnte aber die schwarz blitzenden Rüstungen noch nicht hinter uns ausmachen. Der Tag ging in eine wunderschöne, rot glühende Abenddämmerung und schließlich in eine kühle, sternklare Nacht über. Wir legten eine kurze Rast an einem Bachlauf ein, damit Kjelt sich stärken konnte, und ritten so schnell wie möglich weiter, wenn auch etwas langsamer. Selbst mein starker Hengst konnte das schnelle Tempo nicht ewig halten.
Die Nacht wich einem frischen, nebligen Morgen und einem wolkenverhangenen Tag, und noch immer ritten wir weiter. Wenn ich durstig wurde, trank ich das kühle Wasser aus der Feldflasche, die Leona für mich in der Satteltasche verstaut hatte. Wenn ich hungrig wurde, aß ich einzelne Stücke geräucherten Specks. Das alles tat ich, ohne anzuhalten, ohne Pause, immer mit dem unangenehmen Gefühl im Hinterkopf, dass ich mir keine Schwäche leisten konnte, wenn ich nicht gefangen werden wollte. Alles, was zählte, war, eine möglichst große Distanz zwischen mich und meine Verfolger zu bringen.
Anfangs grübelte ich noch über meinen Abschied vom Baron nach. Ich fragte mich, wie er mein plötzliches Verschwinden wohl aufgefasst haben mochte, ob er böse auf mich war und mich gar verraten hatte oder ob er meine Spuren verwischt hatte. Wie er sich den Soldaten gegenüber verhalten hatte und ob er für mich gelogen hatte. Hatten sie ihn festgenommen? Hielt er mein Andenken in Ehren? Verfluchte er mich? Hatten er und die Bediensteten meine Verfolger vielleicht sogar auf eine falsche Fährte führen können?
Nach einiger Zeit verblassten aber auch diese Fragen in meinem Kopf. Sie waren belanglos, da ich vermutlich niemals eine Antwort auf sie bekommen würde.
Die Umgebung veränderte sich nur leicht. Mal kamen wir an kleinen Bächen vorbei, die Kjelt einfach überqueren konnte, mal konnte ich in der Ferne kleine Häuseransammlungen oder Gehöfte ausmachen, die ich tunlichst mied. Oft kreuzten Tiere unseren Weg. Abgesehen von den Vögeln, Bienen, Schmetterlingen, Hasen und Maulwürfen, die auf den Wiesen lebten, begegneten uns hin und wieder auch Rehe, gelegentlich sogar ein Fuchs oder ein Dachs. Wir trafen jedoch nie auf Menschen, und dafür war ich sehr dankbar.
Am Abend des zweiten Tages auf der Flucht kroch mir die Kälte des schneidenden Windes unter die Haut, und die Müdigkeit ließ mich auf Kjelts Rücken schwanken. Kjelt hatte sein anfangs schnelles Tempo in den letzten Stunden bereits deutlich gedrosselt und schnaubte laut. Ich spürte seinen Schweiß unter meinen Schenkeln.
»Ich mache mir Sorgen um dich, mein Großer. Deine Kräfte sind auch nicht unerschöpflich.« Er wieherte empört. »Aber sie sind doch sehr beachtlich«, verbesserte ich mich mit einem Schmunzeln.
Mir blieb schließlich nichts anderes übrig, als erneut Schutz im nahen Wald zu suchen. Es war bereits stockfinster, und ich musste absteigen, um Kjelt am Zügel zwischen den tief hängenden Ästen hindurchzuführen.
Wenn meinem Reittier etwas passierte, wäre meine Flucht zum Scheitern verurteilt. Meine Beine und mein Hinterteil waren fürchterlich wund und schmerzten bei jeder Bewegung. Als wir in die schützende Dunkelheit zwischen den dicken Baumstämmen tauchten, schien es, als fiele eine schwere Last von meinen Schultern.
Ich vernahm das Rascheln der Äste im Wind und das Knacken der kleinen Zweige am Waldboden und wusste augenblicklich, dass ich nicht allein war. Dennoch verspürte ich keine Angst. Das Gefühl, zurück im Walhallad zu sein, war irgendwie tröstlich und vertraut und ließ mein Herz vor Wiedersehensfreude schneller schlagen.
Das Rauschen von Flügeln über mir, ein Knacken, Wispern und Knistern, rechts, links und über mir wurden zur Melodie des Waldes, die ich so schmerzlich vermisst hatte. Der Wald erwachte in der Nacht zu neuem Leben, und ich war endlich wieder ein Teil davon.
Ich achtete darauf, nicht zu stolpern, obwohl ich in der durchdringenden Dunkelheit nur wenig erkennen konnte, und ermahnte mich schließlich, dass ich nicht zu weit in den Walhallad vorstoßen durfte, um mich nicht zu verlaufen. Ein wenig Angst mischte sich nun doch unter mein anfängliches Heimatsgefühl.
Was wäre, wenn meine Verfolger bereits so nah wären, dass sie mich in der Nacht überraschten? Die Frage ließ mir keine Ruhe, doch ich brauchte Schlaf, und auch Kjelt benötigte eine längere Ruhepause. Ich tastete blind nach dem nächsten Baumstamm und stellte zufrieden fest, dass er stark und breit war.
Es war eine lange und schwierige Prozedur, Kjelt den Sattel sowie das Zaumzeug und die Satteltaschen im Dunkeln abzunehmen, doch hatte ich diese Griffe schon so oft geübt, dass ich sie wie von selbst ausführte. Schließlich ließ ich mich am Stamm herabgleiten und hüllte mich fest in den warmen Fellmantel, den ich mitgebracht hatte. Ich schaffte es gerade noch, Kjelt zuzuraunen, er solle in der Nähe bleiben, da war ich auch schon vor Erschöpfung eingeschlafen.
Ich wurde von den Geräuschen meines eigenen knurrenden Magens geweckt. In der Nacht hatte ich zwar tief, aber unruhig und wachsam geschlafen, und so war es noch sehr früh, als ich die Augen aufschlug.
Gerührt stellte ich fest, dass Kjelt sich direkt neben mir niedergelassen und mich mit seinem warmen Pferdekörper über Nacht gewärmt hatte. An eine Decke für uns beide hatte ich bei meiner überstürzten Flucht nicht gedacht.
Die Sonne war noch nicht über die Baumwipfel geklettert, und im ersten Licht des Tages stellte ich beunruhigt fest, dass es über Nacht deutlich kälter geworden war. Die meisten Blätter der Bäume in meiner näheren Umgebung begannen sich bereits goldgelb und rot zu färben.
Ich beschloss, mir ein ausgiebiges und sehr nahrhaftes Frühstück zu gönnen, damit ich wieder zu Kräften kam. Kjelt freute sich über den Apfel, den ich ihm gab, und ich verschlang gierig Brot und Speck. Am Waldrand fand ich einen kleinen Bach, zu dem ich Kjelt führte und an dem ich meine Feldflasche auffüllte. Eine Weile ließ ich Kjelt dort grasen, während ich sorgfältig die Spuren unseres Nachtlagers verwischte. Bevor die Sonne ganz aufgegangen war, ging es auch schon weiter. Wir waren beide frisch und ausgeruht, und so hatte Kjelt bald wieder ein zügiges Tempo erreicht.
In meinem Hinterkopf machte sich nun allerdings eine Angst breit, die unbegründet sein mochte, möglicherweise aber auch allzu real war. Ich fragte mich, ob die Soldaten in den schwarzen Rüstungen womöglich gar keine Pause eingelegt hatten und mich schon bald eingeholt haben würden. Wie viele Stunden hatte ich mit Schlafen vergeudet?
Ich war so in Gedanken versunken, dass ich gar nicht bemerkte, wie der Tag in Windeseile an uns vorbeiraste und wir ganze Landstriche hinter uns ließen. Es schien mir, als setzte auch die Dämmerung etwas früher ein als sonst. Ich kämpfte noch immer mit der Angst, eingeholt zu werden, und so beschloss ich, diese Nacht durchzureiten, bevor ich uns beiden wieder eine längere Pause gönnen würde.
Diese kräftezehrenden ersten Tage auf der Flucht, in denen wir eine sehr große Distanz zurücklegten, beruhigten mein Gewissen etwas, und so erlaubte ich Kjelt und mir in den kommenden Tagen längere Pausen und fühlte mich schon bald nicht mehr so unruhig wie zuvor.
Zwei Wochen lang ritten wir ohne größere Zwischenfälle im Schatten des Waldrands auf den Nordstern zu, dessen rötliches Funkeln ich am Nachthimmel immer genau im Blick behielt. Tag um Tag ging nahtlos ineinander über, doch nach diesen zwei Wochen musste ich feststellen, dass mein sorgfältig eingeteilter Proviant allmählich knapp wurde. Besorgt teilte ich mir die kläglichen Reste für die nächsten beiden Tage ein, doch dann musste ich mich im Wald nach Nahrung umsehen.
Außer ein paar Nüssen und Wurzeln, die ich am Waldboden fand, und etwas Wasser, wann immer ich welches bekommen konnte, nahm ich jedoch nichts zu mir. Érion hatte mich gelehrt, dass das meiste, das essbar aussah, ganz und gar nicht bekömmlich war, und ich erinnerte mich noch beunruhigt an die magischen Einflüsse, die von manchen Pflanzen ausgingen.
Viele Erinnerungen von früher stürmten in den Tagen meiner Flucht auf mich ein, und ich vergaß manchmal fast die Gefahr, in der ich immer noch schwebte, wenn ich in der Betrachtung der wilden Farbexplosion versank, zu der der Walhallad geworden war. Rot, Gelb, Orange und Braun hoben sich fröhlich vom dunklen Grün der vereinzelten Nadelhölzer ab, und wenn früh am Morgen oder in der Abenddämmerung ein geheimnisvoller Nebel über allem schwebte, glaubte ich fast, mich mitten in einer alten mystischen Sage wiederzufinden, wie ich sie beim Baron so gerne gelesen hatte.
In diesen melancholischen Augenblicken legte ich oft die Hand auf die Stelle an meiner Brust, wo die Sternblume in einer kleinen, eingenähten Tasche meiner Bluse ruhte. Diese Geste gab mir Kraft und Zuversicht.
Bald schon hatte ich mit der zunehmenden Kälte zu kämpfen, die über Nacht alles mit leichtem Raureif bedeckte und so ihre Puderzuckerspur durchs Land zog. Trotz der Schönheit der Natur um mich herum benötigte ich dringend ein Dorf, in dem ich mich mit neuer Verpflegung eindecken konnte und wo ich mir vielleicht eine warme Decke kaufen könnte, die mich in eisigen Nächten wärmen würde.
Fast hatte ich die Gefahr, die auch dort auf mich lauern würde, verdrängt. Ich war mir nicht sicher, wie weit ich bereits in den Norden vorgedrungen war, ich wusste nur, da ich mich immer am Waldrand gehalten und dabei den Nordstern nie aus dem Auge verloren hatte, dass ich stetig in Richtung Norden unterwegs war, wie es mir der Baron geraten hatte. In meiner Erinnerung versuchte ich, die Karten von Panterra heraufzubeschwören, die ich gemeinsam mit dem Baron studiert hatte, und so den Weg in den Norden im Geist nachzufahren.
Der Norden war nicht mehr nur das Ziel, das Érion einst für uns ausgesucht hatte, sondern nun der einzige Ort in Panterra, der mir noch Schutz bot. Denn wenn ich die Grenze zum Muîr-Gebirge, die das nördliche Gebiert markierte, das einen autonomen Teil Panterras darstellte, passiert hätte, dürfte ich auch meine Verfolger abgeschüttelt haben.
Der geheimnisumwitterte Norden nahm in meinen Gedanken immer mehr das märchenhafte Bild eines friedlichen Zufluchtsortes an. Eine rettende Bastion, die mich freundlich aufnehmen würde und deren starke Mauern mich vor meinen Feinden schützen würden. Es war ein Wunschgedanke, doch war mir nicht bewusst, wie sehr ich eigentlich darauf zählte, dass meine Flucht im Norden enden würde, dass ich dort irgendetwas zu finden hoffte, das mir weiterhelfen würde, und nicht nur eisige Kälte und ein einsames Gebirge.
Am Morgen des dritten Tages ohne Proviant, als ich schwach und hungrig aus dem Schutz des Waldes kroch, konnte ich am Horizont Rauchschwaden ausmachen, die ich gestern im schwindenden Licht des Abends nicht wahrgenommen hatte. Ein Dorf!
Vom Hunger getrieben, sprang ich auf Kjelts Rücken und wollte ihm schon die Sporen geben, um meinen Magen endlich wieder füllen und mich etwas aufwärmen zu können, doch dann hielt ich inne. Ich durfte jetzt nicht unvorsichtig werden. Ich war immer noch die meistgesuchte Verbrecherin im ganzen Land, und möglicherweise war mein Steckbrief auch schon bis zu diesem kleinen Dorf vorgedrungen, auch wenn mir das ziemlich unwahrscheinlich schien. Also machte ich kehrt und zog mich in den Wald zurück. Es wäre klug, erst in der Dämmerung dorthin zu gehen, dann würde ich weniger auffallen. Außerdem könnte mich eine Verkleidung vor neugierigen Blicken bewahren.
Ich führte Kjelt am Zügel am Waldrand entlang langsam Richtung Dorf und sann über eine angemessene Verkleidung nach. Dann verharrte ich etwa auf der Höhe des Dorfes im Wald und wartete ab.
Als es schließlich dämmerte, grub ich meine Hände in den Waldboden, den der Frost schon langsam fest werden ließ, und beschmierte mein Gesicht mit Erde. Auf meinem Fellmantel verteilte ich auch ein wenig, um ihm einen verschlissenen Anblick zu verleihen. Meine Haare waren sowieso wirr und zerzaust, und ich ließ sie so weit wie möglich ins Gesicht fallen. Zuerst wollte ich Kjelt nicht mitnehmen, um weniger aufzufallen, doch würde ich ihn im Fall einer schnellen Flucht brauchen.
Das Dorf befand sich nicht so nah am Wald, wie es den Anschein gehabt hatte, und bestand nur aus etwa zwei Dutzend Häusern, deren rauchende Schornsteine einladende Wärme versprachen. Im Näherkommen bemerkte ich jedoch die Ärmlichkeit der Häuser. Ihre Dächer waren nur mit Stroh gedeckt, die Wände bestanden aus locker übereinandergesetzten Steinen, durch die es bei dieser Kälte ziehen musste. Dennoch leuchtete in den wenigen Fenstern warmer Kerzenschein, und ich hatte das Gefühl, als herrschte in diesem kleinen Dorf, durch dessen Gassen sich nun der allabendliche Nebel zu schlängeln begann, eine tiefe Ruhe und Friedlichkeit.
Ich ließ Kjelt bei einer behelfsmäßig zusammengezimmerten, etwas abseits stehenden Scheune zurück, damit er von dem Hafer dort fressen konnte. Dann machte ich mich mit klopfendem Herzen auf den Weg.
Es gab einen öffentlichen Brunnen in der Mitte des Dorfes, an dem ich meine Feldflasche auffüllte. Auf der Straße war keine Menschenseele zu sehen. Ich fand nur einen einzigen kleinen Laden, der allerdings geschlossen war, und so sah ich mich gezwungen, an eine der Türen zu klopfen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, als ich daran dachte, dass ich die armen Dorfbewohner darum bitten musste, ihre hart erarbeitete Ernte mit mir zu teilen.
Doch wie erschrak ich, als ich an der Wand des von mir ausgesuchten Hauses meinen Steckbrief erkannte. Es war nicht zu fassen, dass die Boten des Königs tatsächlich schon vor mir hier vorbeigekommen waren. Wütend riss ich den Steckbrief mit zittrigen Fingern ab und zerknüllte ihn in meiner Faust, bevor ich kehrtmachte und an eine andere Tür klopfte. Jetzt gab es kein Zurück mehr und ich hoffte inständig, dass meine Verkleidung ausreichen würde.
Nachdem ich zweimal geklopft hatte, regte sich etwas im Haus. Ich hörte einen Hund bellen und das glockenhelle Lachen von Kindern, dann öffnete ein misstrauisch dreinschauender älterer Mann die grobe Holztür.
Ein warmer Lichtschein fiel von draußen auf die Straße, und ich spähte an dem schmächtigen Körper des Mannes vorbei ins Haus. Mehrere Generationen einer Familie hatten sich zum Essen um einen großen Tisch versammelt und spähten nun teils ungeduldig, teils neugierig zur Tür herüber, um einen Blick auf den unerwarteten Besucher zu erhaschen. Hinter ihnen prasselte ein Feuer in der offenen Feuerstelle, bei dessen Anblick mich ein starkes Verlangen nach Wärme überkam.
»Was gibt es zu so später Stunde?«, fragte der Mann mürrisch, sodass ich am liebsten gleich wieder umgekehrt wäre. Doch ich ließ mir wie beiläufig die Haare noch tiefer ins Gesicht fallen und bemühte mich freundlich zu klingen.
»Guter Mann, verzeiht diese späte Störung. Ich bin nur eine einfache Reisende, und das Glück war mir in letzter Zeit nicht hold.«
Ich hielt die Luft an, während er mich misstrauisch musterte.
»Und ist das mein Problem? Was wollt Ihr?«, fragte er unfreundlich. Anscheinend klopften nicht oft Fremde an seine Tür. Ich war mir meiner gefährlichen Lage wohl bewusst.
»Ich erbitte nur ein wenig Proviant von Euch, da mein Vorrat sich dem Ende neigt. Ich will Euch auch gut bezahlen«, fügte ich schnell hinzu.
Hastig zog ich ein paar kostbare Schmuckstücke aus meiner ledernen Umhängetasche, die ich bei der Flucht vom Baron mitgenommen hatte, und hielt sie ihm unter die Nase. Seine Augen funkelten gierig beim Anblick der teuren Stücke.
»Merthe!«, rief er plötzlich laut. »Merthe, komm schnell her und sieh dir das an!«
Eine faltige grauhaarige Frau erhob sich vom Esstisch und kam zur Tür. Sie lächelte freundlich, und ihre strahlenden Augen ließen sie viel jünger erscheinen, als ihr Körper den Anschein erweckte. Aber auch ihre Augen verharrten begierig auf dem Schmuck, den ich immer noch in der Hand hielt.
»Dies ist eine Reisende, die unserer Hilfe bedarf«, erklärte der Mann ihr eifrig. »Wir wollen ihr etwas zu essen geben und ihr anbieten, die Nacht bei uns zu verbringen. Lange hat niemand Bedürftiges mehr an unsere Tür geklopft.«
»Oh nein, das wird nicht nötig sein«, erwiderte ich hastig. »Ich muss noch heute weiterreisen und erbitte nur etwas zu essen von Euch.«
Die Frau nickte und huschte geschäftig davon. Der Mann bat mich freundlich einzutreten. Ein Dutzend Augen starrten mich über den großen Holztisch hinweg an, als ich in die warme Stube trat und der Mann die Tür hinter mir schloss. Er führte mich nahe an den Kamin heran.
»Hier könnt Ihr Euch aufwärmen, bis meine Frau Euch mit Proviant versorgt hat«, sagte er nun schon freundlicher. Er wollte mir seinen Stuhl anbieten, doch ich lehnte ab.
Dankbar wärmte ich meine klammen Hände am Feuer, während die ganze Familie mich neugierig musterte. Es waren Großvater und Großmutter sowie vier Kinder, davon zwei Jungen und zwei Mädchen. Eines der Kinder reichte mir plötzlich einen saftigen Lenthuhnschenkel von seinem Teller, und ich nahm dankend an. Während ich gierig aß, wurde das Schweigen immer unangenehmer. »Was führt Euch denn so weit in den Norden nach Fjordhus, wenn ich fragen darf?«, erkundigte sich schließlich der Großvater, ein noch runzligerer Mann. Ich verschluckte mich beinahe an dem heißen Fleisch.
»Ich fürchte, meine Gründe sind privat«, murmelte ich ausweichend, lächelte ihn aber freundlich an, da er mir den Namen des Dorfes verraten hatte. Er murmelte etwas in seinen weißen Bart und musterte mich misstrauisch.
Unter den prüfenden Blicken der Bauernfamilie zitterte ich vor Anspannung. Dies war ein gefährliches Spiel, das mein Glück herausforderte. Ich war mir ganz und gar nicht sicher, ob ich als Sieger daraus hervorgehen würde.
Endlich erschien die Frau im Zimmer mit einem prall gefüllten Bündel, das sie mir stolz überreichte. Angesichts des üppigen Inhalts hoffte ich, dass sie keine zu großen Opfer hatte bringen müssen.
Ich bedankte mich überschwänglich und drückte ihr eine kostbare Halskette sowie dazu passende Ohrringe aus meinem Bündel in die Hand und verabschiedete mich höflich bei der ganzen Familie. Der Mann brachte mich zur Tür. Er schien froh darüber, dass ich endlich ging. Ich entschuldigte mich erneut für die Störung und spürte, wie die Anspannung von meinen Schultern fiel, als die Tür hinter mir geschlossen wurde. Zufrieden lächelnd warf ich mir das Proviantbündel über die Schulter und machte mich in Richtung Scheune auf, wo ich Kjelt zurückgelassen hatte.
Ich hörte die eiligen Schritte hinter mir zu spät, und als ich mich umsah, erkannte ich in der zunehmenden Dunkelheit die Silhouetten dreier Männer. War das ein Hammer in der Hand des einen und dort eine Sense in der Hand des anderen?
Ich begann panisch zu rennen. Vielleicht würde ich es bis zur Scheune schaffen, die sich bereits vor mir aus der Dunkelheit schälte. Da traf mich plötzlich etwas hart am Kopf. Ich taumelte benommen und fiel hin. Ich prallte auf den harten Boden, und eine gnädige Schwärze empfing mich mit ihren kalten, tröstenden Armen.
Gefangen
Licht. Grelles Licht. Feuchte, alles durchdringende Kälte. Kalte, nasse Steine. Tropfendes Wasser. Blut.
Dann blendendes Licht. Macht doch das Licht aus! Klimpernde Schlüssel. Tropfendes Wasser. Schmerz.
Ich blinzelte. Meine Augen konnten sich nach der langen Dunkelheit nur schwer an das grelle Licht gewöhnen. Nur langsam vermochte ich die Schemen meiner Umgebung auszumachen. Das Licht flackerte unruhig. Eine Kerze.
Schatten tanzten an der dunklen Decke über mir. Da waren Steinwände, die mich von allen Seiten umgaben. Von den Steinen über mir tropften kalte Wassertropfen in stetem Rhythmus auf mich herab. Die Steine unter mir drückten unbequem in meinen Rücken. Diese Kälte.
Ich konnte meinen Körper nicht rühren, um ihn in eine angenehmere Position zu bringen. Schritte.
Ich konnte nicht schreien, da meine Kehle sich wie ausgedörrt anfühlte und schmerzte. Ich stöhnte. Die Schritte hielten inne. Da war wieder das metallene Geräusch aneinanderschlagender Schlüssel. Das Licht wurde heller. Es schmerzte in meinen Augen. Geblendet kniff ich sie zusammen, bemüht zu erkennen, was um mich herum geschah.
Jemand hob meinen Kopf an. Bei der fremden Berührung erstarrte mein ganzer Körper. Eiskaltes Wasser wurde auf meine Lippen geträufelt. Ich schluckte gierig. Die Kälte brannte in meiner Kehle, und ich musste husten. Das Wasser lief mir das Kinn herab. Die fremden Hände ließen von mir ab. Sie nahmen das Wasser mit sich fort. Ich krächzte unbeholfen, wollte protestieren. Ich brauchte mehr Wasser. Ich hörte, wie sich ein Schlüssel im Schloss drehte, dann entfernten sich die Schritte und mit ihnen das Licht. Ich sank zurück in meine Schwärze.
Laute Stimmen. Ich schlug die Augen auf. Das Licht war nur schwach, und endlich konnte ich Einzelheiten erkennen. Ich lag auf kalten Steinen in einer engen Zelle.
Eine Steinwand schraubte sich neben mir in die Höhe, und über mir wölbten sich ebenfalls Steine. Es roch feucht, nach Moder und Schimmel, und mein Magen rebellierte. Ich hatte einen metallenen Geschmack im Mund. Blut.
Mein Kopf dröhnte, und die Stimmen hallten schmerzhaft von den Wänden wider. Es waren mehrere Menschen, die da sprachen. Männerstimmen. Ich versuchte mich daran zu erinnern, wie ich hierhergekommen war, doch in meinem Kopf herrschte nur Leere. Ich musste niedergeschlagen worden sein.
Vorsichtig tastete ich mit eiskalten Händen nach meinem Hinterkopf. Ich fühlte eine blutige Kruste. Stöhnend zog ich die Hände zurück. Ich versuchte krampfhaft, mich daran zu erinnern, was geschehen war, als ich plötzlich erkannte, dass ich nicht nur nicht wusste, wie ich hierhergekommen war, sondern auch nicht, wer ich eigentlich war.
Eine lähmende Angst überkam mich, und ich schluckte schwer. Panik stieg langsam in mir auf und wollte wie eine düstere Wolke meine Gedanken vernebeln. Ich musste all meine Kräfte aufbringen, um sie niederzuringen und mich zu konzentrieren.
Ich begann vorsichtig meine Umgebung abzutasten. Rechts von mir befand sich eine Steinwand, gegen die mein Körper gepresst war. Die Feuchtigkeit der Steine war durch meine Kleidung gedrungen und ließ mich am ganzen Körper zittern. Auf meiner linken Seite ertastete ich etwas weiter entfernt kalte, glatte Gitterstäbe. Eine Gefängniszelle. Ich erschrak und fragte mich, ob ich womöglich etwas verbrochen hatte.
Da hörte ich Schritte näher kommen und presste mich angstvoll gegen die kalten Steine.
»Seht mal, das kleine Biest ist wach!«
»Vorsicht! Geht nicht näher ran. Sie ist eine Hexe!«
»Na dann wollen wir sie doch schnellstens wieder in den Schlaf befördern, bevor sie uns Schwierigkeiten macht!«
Ich hörte eine perverse Freude aus den Stimmen der Männer heraus, die sie angesichts meiner Hilflosigkeit und meines Schmerzes empfanden.
Ich vernahm, wie sich der Schlüssel im Schloss drehte, und dann krachte eine Faust mit solch einer Wucht auf mein Kinn herab, dass mein Kopf gegen die harten Steine schlug. Die vertraute Schwärze umfing mich erneut, begleitet von dem immer leiser werdenden Gelächter der Männer.
Kaltes Wasser in meinem Gesicht.
»Komm schon, Kleines, du musst aufwachen, sonst kann ich dir nichts zu essen geben. Du musst doch Hunger haben.«
Der zweite eiskalte Schwall Wasser ließ mich verwirrt die Augen öffnen. Ich blinzelte kurz, dann erkannte ich das Gesicht einer Frau, die sich über mich beugte.
»So ist es besser«, murmelte sie zufrieden und wandte sich um. Sie klapperte mit einer Schüssel und hielt mir dann lächelnd eine dampfende Holzschale samt Löffel unter die Nase. »Hast du denn keinen Hunger?«
Verwirrt versuchte ich mich aufzusetzen, aber meine Arme waren zu schwach. Ich fiel zurück auf die harten Steine.
Die Frau runzelte besorgt die Stirn, schob dann einen Arm unter meinen zitternden Körper und half mir, mich aufzurichten. Halt suchend lehnte ich mich gegen die Wand in meinem Rücken. Alles um mich herum drehte sich aufgrund der neuen, ungewohnten Position. Ich fragte mich, wie lange ich wohl in dieser Zelle gelegen haben mochte.
Misstrauisch musterte ich die Frau, die mir nun die Holzschale erneut hinhielt. Sie nickte auffordernd. Ich nahm ihr die Schale mit zitternden Fingern aus der Hand und schlang den körnigen Brei so schnell hinein, dass ich mir meine Zunge verbrannte. Mein misshandelter Kiefer schmerzte bei jedem Bissen.
»Nicht so hastig, Kleines. Ich habe hier auch Wasser für dich.«
Die Fremde goss Wasser aus einem Tonkrug in einen hölzernen Becher und reichte ihn mir. Als sich unsere Finger berührten, zuckte sie angstvoll zurück. Ich wunderte mich darüber und fragte mich, was ich ihr wohl in meinem geschwächten Zustand antun könnte. Hatte ich etwas so Schlimmes getan, dass diese Menschen große Angst vor mir hatten und ich es womöglich verdient hatte, hier eingesperrt zu sein?
Während ich gierig trank, ließ ich die Frau, die nun schweigend neben mir saß und meinen Blick mied, nicht aus den Augen. Irgendwie kam sie mir bekannt vor. Ihre Augen wirkten durch ein fast jugendliches Strahlen viel jünger als ihr faltiges Gesicht. Doch ich bemerkte frustriert, dass ich mich noch immer an nichts erinnern konnte. Als ich meine Mahlzeit beendet hatte, riss mir die Frau nervös das Geschirr aus der Hand und wollte sich zum Gehen wenden.
»Warum bin ich hier eingesperrt?«, platzte es aus mir heraus. Die Frau hielt in der Bewegung inne und warf einen verstohlenen Blick in das Halbdunkel hinter den Gitterstäben.
Erst in diesem Moment bemerkte ich den Mann, der vor der Zelle Wache stand. Er war mit einem Knüppel bewaffnet und warf mir drohende Blicke zu.
»Weißt du das denn nicht?«, murmelte sie halblaut. »Du bist eine gesuchte Hexe, eine Staatsverräterin. Dachtest du, wir würden dich einfach laufen lassen, als du an unsere Tür geklopft hast? Die Schätze, die du bei dir getragen hast, haben meinen Mann misstrauisch gemacht, obwohl du dich gut verkleidet hattest.«
»Das reicht jetzt!«
Die herrische Stimme der Wache ließ die Frau ängstlich zusammenfahren. »Merthe, du weißt, dass du nicht mit der Gefangenen sprechen darfst.«
Die Frau, Merthe, nickte unterwürfig. Sie wandte sich nicht noch einmal zu mir um. Als der Wärter ihr die Tür aufschloss, schlüpfte sie schnell durch den kleinen Spalt hindurch. Ihre Schritte entfernten sich eilig. Dann schloss der grimmige Wächter das Tor mit einem Krachen wieder.
Die Zeit in meinem steinernen Gefängnis rann mir langsam wie zähflüssiges Wachs durch die Finger. Ich hatte keinerlei Zeitgefühl, wusste weder, ob es Tag oder Nacht war, noch, wie lange ich hier schon festgehalten wurde.
Manchmal fragte ich mich, ob es wohl jemanden gab, der sich um mich sorgte und nach mir suchen würde. Die Dunkelheit, die Kälte und die alles durchdringende Feuchtigkeit blieben unverändert, die einzige Abwechslung bestand in der Ablösung der Wächter und wenn Merthe mir Essen brachte. Sie war die Einzige, die zu mir in die Zelle kam. Ihr Verhalten mir gegenüber hatte sich jedoch seit unserem ersten Treffen verändert. Unter den wachsamen Blicken der Wächter, streifte ihr Blick mich lediglich flüchtig, und sie sagte nur etwas zu mir, wenn es notwendig war, sich mit mir zu verständigen.
Gähnende Trostlosigkeit hatte mich erfasst, und so lag ich die meiste Zeit zusammengekrümmt auf dem feuchten Steinboden und starrte ins Halbdunkel. Oft befand ich mich in einem wirren, traumähnlichen Zustand zwischen Schlafen und Wachen, und manchmal fuhr ich erschrocken zusammen, wenn ich bemerkte, dass ich im Schlaf geredet hatte.
Leider konnte ich mich nie an meine Träume erinnern. Sie glichen verschwommenen Trugbildern, die mich in die Irre zu führen versuchten. Mal blitzten klar und deutlich kurze Bilder auf, dann verwandelten sie sich in einen Schwindel erregenden Strudel verschwommener, verzerrter Bilder von Fratzen und Stimmen, die ich nicht erkannte und die mich auszulachen schienen.
Immer wieder träumte ich von Feuer, von Todesschreien und dem gefährlichen Klirren von Waffen und eisernen Rüstungen. Besonders diese Bilder voller Rauch, heißer Glut und Flammenzungen, die an mir leckten, ließen mich schreiend erwachen, denn sie endeten jedes Mal mit dem Anblick eines toten Jungen, neben dem ich auf dem erhitzten Boden kniete, während die Flammen mich umzingelten. Seine leblosen Augen verfolgten mich auch nach dem Aufwachen noch, und nur dieser immer wiederkehrende Traum war es, der mich an der Hoffnung festhalten ließ, dass ich mein Gedächtnis irgendwann zurückgewinnen würde. Ich verbrachte Stunde um Stunde mit dem Versuch, mich daran zu erinnern, wer dieser Junge war, und mühte mich, herauszufinden, warum mich jedes Mal Entsetzen und unendliche Trauer erfassten, wenn ich ihn im Traum tot vor mir sah. Doch mein Gedächtnis schien weiterhin wie von dichtem Nebel umgeben, den ich nicht zu durchdringen vermochte.
Ich erwachte schreiend und vor Angst zitternd aus einem Traum. Wie von Sinnen schlug ich um mich. Es war heiß, so heiß! Ich brannte!
»Hilfe! Macht das Feuer aus!«, schrie ich verzweifelt und schlug immer heftiger um mich, um die Flammen, die mich umzingelten, zu löschen. Ich hatte das Gefühl, lichterloh zu brennen, und mein ganzer Körper zog sich zusammen vor Schmerz.
»Ja, ja, schon gut, du Hexe. Auf mich wirken deine erbärmlichen Zaubertricks nicht. Hier ist weit und breit keine einzige Flamme zu sehen.«
Ich vernahm die raue Stimme wie von weit her, und plötzlich wurde ein Schwall kalten Wassers über mich ausgeschüttet. »Das soll dir eine Lehre sein. Ich warne dich, mich noch einmal täuschen zu wollen.«
Das kalte Wasser brachte mich zur Besinnung, und als ich die Augen aufschlug, erkannte ich die inzwischen vertraute Steindecke über mir. Das innere Feuer war gelöscht, nun zitterte mein Körper vor Kälte. Doch als mich unerwartet erneut ein heißer Schmerz durchzuckte, schrie ich unwillkürlich auf.
Meine Brust schien zu brennen. Der Schmerz fraß sich durch den Stoff meiner Kleidung direkt in mein Herz, das Feuer schien mich zu verzehren. Von Schmerzkrämpfen geschüttelt zuckte mein ganzer Körper, bäumte sich auf und fiel wieder in sich zusammen. Trotzdem schafften es meine bebenden Hände irgendwie, sich hinauf zu meiner Brust zu tasten, während ich mich vor Schmerzen wand.
Ich ertastete die glühende Hitze direkt über meinem Herzen, und mit einem letzten Schrei riss ich meine Bluse entzwei, um mich davon zu befreien. Erleichtert atmete ich auf, als der Schmerz an meiner Brust nachließ. Doch im nächsten Moment bemerkte ich, wie nun meine rechte Hand glühte, da ich etwas Heißes umfasste. Hektisch warf ich es von mir und sah erschrocken, wie tatsächlich etwas in der Dunkelheit meiner Zelle glühte.
Ich zuckte zurück und presste mich fest an die Steinwand, so weit von dem Glühen entfernt wie möglich. Zu meinem Erstaunen bemerkte ich nach einiger Zeit, dass es keine Flammen waren, die dort auf den feuchten Steinen ihr Licht verbreiteten.
Das pulsierende Licht schien weiß und strahlend, nicht rötlich und flackernd wie Feuerschein. Misstrauisch warf ich einen Blick durch die Gitterstäbe zu meinem Wächter, um sicherzugehen, dass nicht er dahintersteckte. Der Platz, an dem der bewaffnete Mann Wache gehalten hatte, war allerdings leer. Das pulsierende Licht zog schnell wieder meine Aufmerksamkeit auf sich. Vorsichtig näherte ich mich ihm, bereit, mich sofort zurückzuziehen, sollte es sich ausbreiten. Was ich auf dem Kerkerboden vor mir entdeckte, ließ mich jedoch staunend alle Vorsicht vergessen.
Im Halbdunkel lag dort eine weiße Blume und verstrahlte ihr silbriges Licht. Irgendetwas an diesem Bild kam mir bekannt vor. Ohne jede Furcht streckte ich eine Hand aus und hob die sternförmige Blüte auf. Sie war nicht mehr heiß, doch das hatte ich auch nicht erwartet. Als ich sie berührte, schoss plötzlich ein Strom unbändiger Kraft und Energie durch mich hindurch, sodass ich keuchend zurückwich, meine Hand aber gleichzeitig fester um die Blüte schloss. Gleißendes Licht erfüllte die ganze Grotte, und ich musste meine Augen schließen.
Es war so schnell vorbei, wie es begonnen hatte, doch hatte sich etwas verändert. Ich riss die Augen auf, denn ich sah plötzlich klar. Der Nebel in meinem Kopf hatte sich verzogen, und ich erinnerte mich mit einem Schlag an alles. Die Erinnerungen stürmten auf mich ein, und ich konnte nur fassungslos auf die Blüte in meiner Hand starren, in deren Blütenkelch das silbrige Licht nun vertraut glomm.
Neben der Freude darüber, meine Erinnerungen zurückerhalten zu haben, schlich sich aber auch Angst in meinen Kopf. Ich wusste immer noch nicht, wie lange ich schon hier eingesperrt war. Die Soldaten waren mir bei meiner Flucht auf den Fersen gewesen, sicher mussten sie mich bald eingeholt haben. Die Angst fraß sich wie Kälte durch meine Adern und ließ mich erstarren. Ich wusste, dass es meinen sicheren Tod bedeutete, wenn mich die Dorfbewohner den Soldaten auslieferten. Ich musste von hier fliehen!
Plötzlich ertönten Schritte und Stimmen auf der Treppe. Ich zuckte zusammen und versteckte die Sternblume hastig in meiner Hosentasche. Als ich bemerkte, dass meine Bluse nur noch in Fetzen an mir herabhing, war es bereits zu spät.
Fackelschein erhellte meine Zelle, und zwei Männer blickten durch die Gitterstäbe auf mich herab. Der eine, mein Wächter, grinste angesichts meiner entblößten Brust anzüglich, während der andere rot anlief und verlegen zu Boden sah. Letzteren hatte ich noch nie zuvor gesehen. Er räusperte sich.
»Und was sagtest du noch gleich, was ihr fehlt?«, fragte er mit einer schwachen, nasalen Stimme.
»Na ja«, antwortete der andere. »Sie warf sich unter Qualen die ganze Zeit in ihrer Zelle hin und her und rief etwas von Feuer und Verbrennen und so. Obwohl hier wirklich kein Feuer war. Ich hab’ ihr den Eimer Wasser über den Kopf geschüttet, damit sie aufhört mit ihren Spielchen, aber sie hat immer weiter geschrien.«
Er fuhr sich nervös durch die Haare, während er meine Brust immer noch anstarrte.
»Und weißt du, da dachte ich, vielleicht ist doch was mit ihr, man weiß ja nie. Vielleicht hat sie Fieber oder so was. Und da bin ich losgelaufen, um Euch zu holen, Doktor.«
»Das war richtig von dir, Bartok. Ich werde sie mir mal ansehen.«
Sie sprachen von mir, als wäre ich gar nicht da oder als könnte ich sie nicht verstehen.
Als sich die Kerkertür öffnete, rutschte ich in die hinterste Ecke der Zelle und gab vor, ängstlich und verschreckt zu sein, während mein Verstand pfeilschnell arbeitete. Vielleicht war dies meine Chance zu entkommen.
Der Doktor war blass und schmächtig und wirkte nicht wie ein ernst zu nehmender Gegner. Wenn ich ihn ausschaltete, blieb nur noch Bartok übrig.
Der Arzt kniete sich vorsichtig vor mich. »Hab keine Angst, ich will nur nachsehen, ob dir etwas fehlt. Hast du Schmerzen? Bartok sagte, du hättest geschrien.«
Während ich mich weiter ängstlich gegen die Wand presste, musterte ich den Doktor unauffällig. Da fiel mein Blick auf ein kleines sichelförmiges Messer, das an seinem Gürtel hing. Ich versuchte, mir meine Entdeckung nicht anmerken zu lassen, und bereitete in Gedanken meinen Angriff vor. Ich könnte es nicht über mich bringen, den Doktor ernsthaft zu verletzen, er schien ein sanfter Mann zu sein. Dennoch musste ich ihn ausschalten. Als er beruhigend murmelnd ganz nah herangekommen war, schien mir plötzlich alles ganz klar. Mein Verstand war mit einem Mal geschärft, und die Zeit schien für einen kurzen Moment stillzustehen. Dann brauste ein Adrenalinstoß mit voller Wucht durch meinen ganzen Körper, und ich sprang vor.
Mit einer einzigen Bewegung zog ich das Messer aus dem Gürtel und schlug dem überraschten Doktor mit dem Knauf hart gegen die Schläfe.
Er stöhnte und sackte zusammen, doch da war ich bereits an ihm vorbei und durch die offen stehende Kerkertür hinaus. Ich konnte Bartok ansehen, wie verblüfft er war, und für einen kurzen Moment glaubte ich, ich könnte seine Verwirrung nutzen und auch ihn ausschalten, doch er fasste sich im selben Moment wieder und baute sich zwischen mir und der Treppe auf.
Blitzschnell wog ich meine Chancen ab. Ich schätzte ihn nicht als sonderlich schlau ein, doch hatte er breite Schultern und einen Knüppel in der Hand. In diesem Augenblick bemerkte ich den lüsternen Blick, den er mir zuwarf, und er gefiel mir ganz und gar nicht. Mit einem breiten Grinsen starrte er auf meine entblößte Brust und leckte sich immer wieder über die Lippen.
»Und was jetzt, kleine Hexe?«, fragte er höhnisch. »Willst du mich etwa auch flachlegen?« Auf einmal brach er in schallendes Gelächter aus. Ich runzelte die Stirn und machte mich bereit zum Angriff. »Haha, flachlegen, ich würde dich nur zu gerne flachlegen!« Er lachte über seinen eigenen Witz, bis ihm die Tränen kamen.
Genervt sprang ich vor und holte aus, um ihm das Messer in den Bauch zu rammen, doch er reagierte blitzschnell. Sein Lachen erstarb, er packte meinen ausgestreckten Arm und bog ihn mir so schmerzhaft auf den Rücken, dass ich das Messer fallen lassen musste. Ich schrie vor Schmerz und Wut auf.
»Ach, du willst schon gehen?« Bartoks Augen blitzten mich zornig an. »Aber nicht bevor ich meinen Spaß mit dir hatte!«
Er bog auch meinen anderen Arm nach hinten und presste mich an sich, während ich wild um mich trat und schrie.
»Sei still, du Hexe, du willst doch nicht, dass die anderen hier auftauchen, bevor ich mit dir fertig bin!«
Dann presste er seine Lippen so fest auf meine, dass ich keine Luft mehr bekam. Sein fauliger Atem ließ mich würgen, und ich biss ihm auf die Lippe. Er heulte vor Schmerz auf und prallte zurück. Blut troff von seiner aufgeplatzten Lippe. Ich fuhr herum und wollte an ihm vorbeischlüpfen, doch er packte mich um die Hüfte und schleuderte mich auf den Steinboden. Ich schlug hart auf meiner Brust auf und keuchte, als mir die Luft für einen Augenblick wegblieb. Da war er schon über mir. Genüsslich grinsend drehte er mich zu sich herum, packte meine Arme und presste sie über meinem Kopf auf den Boden.
»Und was willst du jetzt tun?«, grunzte er hämisch.
Ich spuckte ihm ins Gesicht. Lachend wischte er es weg. Während er weiterhin mit einer Hand meine Arme festhielt, versuchte er mit der anderen seine Hose zu öffnen. Verzweifelt wand ich mich unter ihm und blickte mich panisch nach etwas um, womit ich mich verteidigen könnte.
Mein Blick fiel auf das Messer, das nicht weit von mir entfernt auf dem Boden lag. Wenn ich einen Arm frei bekommen könnte, würde ich es erreichen.
Bartok hatte sich seiner Hose entledigt und riss nun ungeduldig an meiner. Er bekam sie mit einer Hand nicht auf und grunzte vor unbefriedigtem Verlangen. Er spreizte meine Beine und versuchte sich an mir zu reiben, doch da trat ich mit voller Wucht zu. Bartok stöhnte vor Schmerz auf, als ich ihn direkt zwischen die Beine traf. Er ging in die Knie und ließ meine Hände los.
Sofort griff ich nach dem Messer und rammte es ihm, ohne zu zögern, in den Bauch. Er erstarrte mitten in der Bewegung, und sein verblüffter Blick begegnete meinem.
Er starrte mich an und tastete nach dem Blut, das sich schnell über sein Hemd ausbreitete. Dann wurden seine Augen leer, und er fiel vornüber, direkt auf mich.
Angewidert schubste ich ihn von mir und sprang auf. Ich hielt nur einen Moment inne, um das Messer aus seinem schlaffen Körper zu ziehen, es an seinem Hemd abzuwischen und an meinem Gürtel zu befestigen.
Dann rannte ich, ohne mich umzusehen, die Treppe hinauf. Die wenigen Stufen führten mich direkt in ein Haus. Im Kamin brannte ein Feuer, und im Nebenzimmer hörte ich Kinderlachen. Diese Barbaren hatten mich einfach in ihrem Keller eingesperrt!
Meine Gedanken rasten, ich wollte keine Sekunde länger in diesem verfluchten Dorf verbringen. Vorsichtig spähte ich zur Eingangstür hinaus. Jetzt galt es, sich nicht erwischen zu lassen. Draußen hatte gerade die Dämmerung eingesetzt, und ich konnte nicht sehr weit sehen. Ich kniff meine Augen zusammen, um besser sehen zu können und um sicherzugehen, dass mein Fluchtweg frei war. Mit Schrecken erkannte ich plötzlich, dass ein Dutzend Pferde mit schwarzen Sätteln um den Dorfbrunnen herum angebunden waren. Mein Herz sank, als ich feststellte, dass schwarze Schwerter an ihren Sätteln befestigt waren. Meine Verfolger hatten das Dorf bereits erreicht!
Ich versuchte, die erneut aufsteigende Panik zu unterdrücken und mich ganz auf meine Umgebung zu konzentrieren, während die Sternblume in meiner Hosentasche zu vibrieren schien.
Erleichtert erkannte ich, dass sich das Haus, in dem ich eingesperrt gewesen war, näher am Waldrand befand als alle anderen. Ich nahm mir die Zeit, kurz durchzuatmen und meine Bluse notdürftig zusammenzuknoten, um meine Blöße zu bedecken, und rannte dann los. Mit wenigen Schritten hatte ich die Pferde der Soldaten erreicht, machte die Zügel los, mit denen sie angebunden waren, und scheuchte sie mit wilden Gesten auf, sodass sie davongaloppierten.
Dann fuhr ich herum. Noch immer war niemand zu sehen.
Ich dachte nicht daran, mich leise von Schatten zu Schatten zu schleichen, denn ich verspürte nur noch den Drang, so viel Distanz wie möglich zwischen mich und diesen Ort zu bringen. Auf meinem Weg zwischen den Häusern hindurch hielt ich nach Kjelt Ausschau, konnte ihn aber nirgendwo entdecken. Hoffentlich hatte er sich in Sicherheit gebracht.
Ich rannte und rannte und sah mich nicht um, bis ich den Waldrand erreicht hatte, und rannte dann noch tiefer in den Wald hinein. Meine Lungen brannten, und mein Herz schlug mir bis zum Hals. Als ich endlich stehen geblieben war, bemerkte ich, dass ich am ganzen Körper zitterte. Meine Beine gaben unter mir nach, und ich stürzte auf den gefrorenen Waldboden. Erst in diesem Moment, brach die schreckliche Erkenntnis über mich herein: Ich hatte soeben einen Menschen getötet.
***
Zur gleichen Zeit wurde der Rote im Königspalast bei seinem unruhigen Auf-und-ab-Gehen unterbrochen. Ein Diener näherte sich ihm vor Angst zitternd und verbeugte sich ehrfürchtig, bevor er sprach.
»Mein Herr, soeben hat uns ein Flug-Arac eine Nachricht überbracht. Sie stammt aus dem Dorf, in dem die gesuchte Hexe gefangen gehalten wird.«
Der Rote wirbelte bei diesen Worten augenblicklich herum, sodass sich sein purpurner Umhang um ihn herum bauschte. Er schnippte ungeduldig mit den Fingern.
»Nun sag schon, was gibt es Neues?«
Mit zitternden Händen entrollte der Diener das Pergament. Er überflog die wenigen Zeilen, wobei sein konzentrierter Gesichtsausdruck zunächst Unglauben erkennen ließ, dann blankes Entsetzen. Er hob zaghaft den Blick, wagte es jedoch nicht, in den schwarzen Schlund unter der Kapuze seines Gegenübers zu sehen. Er schluckte schwer, bevor er sprach, seine Stimme klang vor Angst dünn und zittrig. »Sie … sie ist entkommen, Herr.«
Der unbändige Wutschrei, der sich aus dem schwarzen Schlund heraus in den Himmel hinaufschraubte, ließ die Mauern des Palastes erzittern. Jeder, der sich in der Nähe befand, zuckte vor Grauen zusammen und erzitterte unwillkürlich unter dem grenzenlosen Hass, den der kalte Schrei in sich trug.
Die nördliche Grenze
Ein lautes Wiehern ließ mich aus meinen Schuldgefühlen aufschrecken. Ich riss den Kopf herum und strahlte vor Freude über das ganze Gesicht, als ich die Umrisse Kjelts erkannte, die sich aus dem Halbdunkel des Waldes schälten. Er trabte gemächlich auf mich zu und stupste mich freudig mit seiner warmen Nase an. Ich sprang auf und schlang die Arme fest um seinen Hals. Der vertraute Geruch und die Wärme des Pferdekörpers trieben mir die Tränen in die Augen. Der treue Kjelt hatte die ganze Zeit auf mich gewartet und war nicht davongelaufen.
»Ich danke dir«, flüsterte ich ihm ins Ohr, und er schnaubte freudig.
Erst allmählich bemerkte ich, wie sehr sich meine Umgebung verändert hatte. Das dichte Laub der Blätter, das ich immer als ein schützendes Dach über mir empfunden hatte, war beinahe vollständig verschwunden. Im schwindenden Licht des Tages ragten die kahlen Äste gespenstisch wie knorrige Finger über mir in den Himmel. Totes Laub, dessen bunte Farben schon verblasst waren, bedeckte den Waldboden. Mein Atem verwandelte sich vor meinen Lippen in kleine weiße Wölkchen, und erst jetzt bemerkte ich die Kälte, die langsam in meine Glieder kroch.
In meinem Schockzustand war mir völlig entgangen, wie weit der Herbst schon fortgeschritten war. Die alles verschlingende Kälte des nahenden Winters war auf dem Vormarsch. Ich musste mich mindestens eine Woche in Gefangenschaft befunden haben. Mein Herz schlug vor Besorgnis schneller, als ich erkannte, dass ich in der heraufziehenden Kälte nicht lange würde überleben können. Die Dorfbewohner hatten mir alle meine Habseligkeiten abgenommen. Mir war nichts geblieben als das, was ich am Leib trug: die nun zerfetzte Bluse und die einst kostbare Reiterhose mitsamt den Stiefeln.
Der Gedanke daran, dass sich die Soldaten in so unmittelbarer Nähe befanden, ließ mich schaudern, und ich musste mich einen Moment lang in Kjelts Mähne festkrallen, damit meine Beine nicht unter mir nachgaben. Anscheinend war ich keine Sekunde zu früh entkommen.
Ich sagte mir immer wieder, dass ich jetzt stark sein und das Beste aus meiner Situation machen musste. Egal, wie schlecht die Erfahrungen waren, die ich sammelte, ich konnte daraus lernen. Ich wusste jetzt sicher, dass ich in keinem Dorf mehr anhalten durfte, denn die Menschen standen, sei es aus Angst oder aus Loyalität, zu sehr unter dem Einfluss des falschen Königs, als dass sie mir helfen würden, und mein Gesicht schien sogar in diesem entlegenen Winkel Panterras bekannt zu sein.
Verzweiflung überkam mich, als ich das Ausmaß meiner Ächtung erkannte. Ich war nirgends mehr sicher. Meine einzige Rettung wäre es wahrhaftig, den Norden zu erreichen. Doch konnte ich auch nicht sicher wissen, was mich dort erwartete. Mein Leben wäre verwirkt, wenn sich die starke Festung aus meiner Vorstellung als eine Enttäuschung entpuppte, wenn dort gar keine Hilfe auf mich wartete, sondern weitere Verfolger oder sogar noch Schlimmeres. Ich konnte mich nicht darauf verlassen, dass man mir dort half. Nur eines war klar: Hier bleiben konnte ich nicht.
Ich fühlte mich unendlich einsam und schwach. Ich wusste noch nicht einmal, wie weit es noch bis zur nördlichen Grenze war, doch war ich sicher, dass ich angesichts der Witterungsverhältnisse nicht mehr lange durchhalten würde.
Irgendetwas musste ich tun, ermahnte ich mich, denn womöglich war mein Verschwinden bereits bemerkt worden. Es galt, keine Zeit zu verlieren. Ich entschied, dass wir nun innerhalb des Waldes weiterreiten müssten, denn das Risiko, am Waldrand entdeckt zu werden, war zu groß. Ich konnte nur hoffen, dass niemand es wagen würde, mir in den Wald zu folgen.
Mit grimmiger Entschlossenheit zog ich mich auf Kjelts Rücken, was meinem Körper mehr Anstrengung kostete, als ich mir eingestehen wollte.
»Komm mein Junge«, forderte ich Kjelt auf. »Es geht weiter Richtung Norden.«
Schon trabte Kjelt voran, wand sich geschickt zwischen Baumstämmen und Sträuchern hindurch und brachte schnell Distanz zwischen mich und das Dorf, in dem ich zum ersten Mal gemordet hatte.
Während der Reise redete ich mir oft ein, dass ich nur aus Notwehr heraus gehandelt hatte und dass es keinen anderen Weg zu entkommen gegeben hatte, doch immer wieder schlich sich eine unangenehme Stimme in meinen Kopf, die mir boshaft zuraunte, ich hätte sehr wohl eine Wahl gehabt. Ich hätte Bartok mit dem Messergriff lediglich außer Gefecht setzen können, hatte es jedoch nicht getan, da ich mich an ihm hätte rächen wollen, da er mich so grobschlächtig misshandelt hatte. Es war ein Akt der Rache, flüsterte die Stimme in meinem Kopf.
»Nein!«, rief ich oft laut und bemerkte erst dann, dass ich mit mir selbst gesprochen hatte. Nagende Schuldgefühle umgaben mich wie verpestete Luft, die meine Gedanken vergiftete und mich unsicher werden ließ. Ich wollte mich selbst davon überzeugen, dass es nur diese innere Stimme war, die mir das alles einreden wollte, und dass ich keine Genugtuung beim Töten Bartoks empfunden hatte. Trotzdem kamen noch stärkere Schuldgefühle aus der Vergangenheit in mir hoch, als hätten sie nur am Grunde meines Gedächtnisses auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, wie die Nixen damals am Wasserfall, die tückisch erst aus der Tiefe herangekommen waren, als ich mich so sicher gefühlt hatte.
Érion. War ich auch für seinen Tod verantwortlich? Hatte ich mich schuldig gemacht, als ich ihn im Augenblick größter Not allein gelassen hatte? Würde ich für meine Schwäche in diesem kurzen Augenblick mein ganzes Leben lang leiden müssen? Doch ich hatte ihn mit eigenen Augen fallen sehen. Was hätte ich in diesem Moment noch für ihn tun können? Er selbst hatte mir befohlen davonzulaufen.
Ich hoffte inständig, dass die Soldaten, nachdem sie meine Spur damals verloren hatten, nicht zu seinem Leichnam zurückgekehrt waren, um ihn zu schänden. Vielleicht hätte ich selbst zurückkehren sollen, um ihn zu begraben. Aber das Risiko war einfach zu groß gewesen.
Als hätte ich meine Selbstzweifel mit diesen Gedanken nicht schon genug geschürt, malte ich mir immer wieder aus, wie Érions Seele rastlos umherstrich und keinen Seelenfrieden finden konnte, auf der Suche nach seiner Zwillingsseele Mág, der, wie ich wusste, noch unter den Lebenden weilte. Das wiederum warf eine neue Frage auf: Was war mit Mág geschehen? Er hatte mich aufgesucht, und ich war damals so froh gewesen, ihn zu sehen. Wie aussichtslos mir damals meine Situation vorgekommen war. Doch das war nichts im Vergleich zu meiner jetzigen Verfassung. Gejagt, geächtet, auf der Flucht, ohne Ziel, ohne Halt im Leben, ohne einen Menschen, der mir zur Seite stand – der mich liebte. Selbstzweifel und Selbstmitleid schienen mich zu verschlingen. Auf die Frage, wo Mág steckte, fand ich keine Antwort. Er war verschwunden, als ich auf den Baron getroffen war, und seitdem nie wieder aufgetaucht. Ich wusste, dass er keine Menschen mochte, und Gahírimh war sicherlich kein schöner Ort für ihn gewesen.
Auf keine der bohrenden Fragen, die mich während meines Ritts durch den Wald beschäftigten, fand ich eine Antwort, denn ich war unfähig, klar zu denken. Die Kälte fraß sich langsam, aber stetig durch meinen ganzen Körper, und ich konnte mich nur wärmen, indem ich mich während des Reitens fest an Kjelts warmen Körper presste und mich hinter seine Mähne duckte. Wenigstens boten uns die Bäume auf unserer Rechten etwas Schutz vor dem schneidenden Wind.
Schon bald konnte ich nicht mehr genau sagen, wie lange ich geritten war. Es wurde immer schwieriger, die Nacht vom Tag zu unterscheiden, da es immer früher dunkel wurde und sich die Sonne tagsüber nur noch selten blicken ließ.
Bald bekam ich starken Husten, hatte das Gefühl, das Blut gefröre mir in den Adern und meine Haut könnte nie wieder warm werden. Die Kälte eroberte meinen Körper unaufhaltsam und stach wie tausend Nadeln auf mich ein. Ich konnte mich nach einiger Zeit kaum noch bewegen. Meine Finger waren bald nicht mehr zu gebrauchen, und so döste ich nur noch vor Schmerzen wimmernd auf dem Pferderücken, den Blick in wachen Momenten tagsüber immer auf den Horizont und nachts auf den Nordstern gerichtet.
Ich suchte den Horizont unaufhörlich nach einem Anzeichen auf das Muîr-Gebirge ab, das Ziel meiner Reise. Es war so gewaltig, dass es selbst aus weiter Ferne und durch den dichten Wald zu erkennen sein musste. Als ich Kjelt schließlich nach einer Rast wieder einmal ohne jeden Anflug von Hoffnung aus dem Wald führte, um mich zu orientieren, keuchte ich vor Erstaunen, als ich in der Ferne, halb im Nebel verborgen, die ersten Ausläufer des Gebirges ausmachte.
Ich war mir nicht sicher, ob meine Augen mir einen Streich spielten, doch hob sich wenig später deutlich eine gezackte Linie verschwommen vom Horizont ab. Schließlich lag das Gebirge vor mir, wie der Körper des schlafenden Riesen Pan. Die gigantischen Gipfel in weiter Ferne, deren Größe man von hier aus nur erahnen konnte, waren mit Schnee bedeckt. Kleinere Steinkrater, die nicht mehr allzu weit von mir entfernt aus dem Boden ragten, bildeten groteske Figuren, die aus dem Nebelmeer herausstachen. Erleichtert seufzte ich auf und wagte es, Kjelt vorsichtig aus dem Wald heraus und auf die weite, flache Ebene vor dem Gebirge zu lenken. Dann hielten wir in vollem Galopp auf die Ausläufer des Muîr-Gebirges zu, und das erste Mal seit sehr langer Zeit schöpfte ich wieder Hoffnung.
Im Näherkommen konnte ich zwei einsame Reiter an den äußersten Ausläufern des Gebirges ausmachen. Kjelt hielt direkt auf sie zu. Ich wollte protestieren, ihn in eine andere Richtung lenken, aber ich war zu schwach. Teilnahmslos hing ich auf seinem Rücken, klammerte mich nur noch mit letzter Kraft an seine Mähne und sah dabei zu, wie er uns ins Verderben führte.
Meine Augen fielen immer wieder zu, mein ganzer Körper kribbelte schmerzhaft vor Kälte, während ich einige meiner Körperteile bereits nicht mehr zu spüren vermochte. Als ich die Augen das nächste Mal öffnete, befanden wir uns nur noch wenige Schritte von den Reitern entfernt. Trugen sie schwarze Rüstungen? Würden sie uns töten?
Erstaunt erkannte ich, dass sie auf zwei wunderschönen geflügelten Pferden saßen. Meine geschwächten Sinne mussten mir etwas vorgaukeln. Die Fremden trugen Rüstungen, die eine golden, die andere silbern, die in der schwachen Wintersonne glänzten. Ich blinzelte verwirrt. Sie hatten kostbar verzierte Helme auf, an deren Seiten kleine weiße Flügel abstanden, und einer der beiden hielt ein Banner, das über ihren Köpfen im eisigen Wind flatterte. Ich konnte nicht genau erkennen, was darauf zu sehen war: weiße Flügel auf einem tiefblauen Grund, umrahmt von Gold und Silber … es war so anstrengend, die Augen offen zu halten. Endlich kam Kjelt direkt vor den Reitern zum Stehen. Sie sahen mich an, und die Ehrfurcht in ihren Blicken ließ mich ganz schwindelig werden.
»Wir haben Euch erwartet«, sagte der Bannerträger. In diesem Moment übermannte mich die Erschöpfung, und das Letzte, was ich spürte, war, wie mein Körper endgültig erschlaffte und ich seitwärts von Kjelts Rücken rutschte.
Norden
Ich fühlte mich sanft emporgetragen. Das leise Auf und Ab mächtiger Schwingen hallte in meinen Ohren, als käme es von weit her. Kalter Wind strich über mein Gesicht, und ich konnte meinen Körper immer noch nicht aus seiner Kältestarre herausbewegen, schaffte es jedoch für einen kurzen Augenblick, die Augen zu öffnen. Wie in einem Traum sah ich verschwommen weit unter mir steile Schluchten und spitze Bergkämme vorbeirauschen. Ein breiter stahlblauer Fluss wand sich zwischen den Felsen hindurch und glitzerte in der schwachen Sonne. Dann fielen meine Augen, in denen der eisige Wind brannte, wieder zu, und ich überließ mich der süßen Gleichgültigkeit des Schlafs.
Als ich meine Augen erneut aufschlug, brannte mein ganzer Körper vor Schmerz. Es tobte ein erbitterter Kampf auf meiner Haut – Wärme versuchte die Kälte zu vertreiben. Tausend Nadeln stachen unerbittlich auf mich ein, und mein Körper wurde immer wieder von starken Hustenkrämpfen geschüttelt.
Dicht vor mir erhellte ein rot glühendes Feuer die Dunkelheit, die mich umgab. Die Hitze der Flammen zog mich magisch an, ich wollte nichts sehnlicher, als dass die Wärme endlich den Sieg über meinen Körper davontrug.
Ich streckte eine Hand nach dem Feuer aus und bemerkte, dass ich unter einem Berg dicker Decken begraben lag. Unbeholfen kroch ich auf die wohlige Wärme zu. Da erst hörte ich zum ersten Mal die Stimmen. Es waren Männerstimmen, die sich gedämpft unterhielten. Ich erinnerte mich an die prunkvoll gewandeten Reiter und fragte mich, ob diese Erscheinung nur ein Traum gewesen war.
Ich krächzte kläglich, denn meine Stimme wollte mir nicht gehorchen. Das Gespräch der körperlosen Stimmen brach sofort ab, und ich hörte, wie sich eilige Schritte näherten. Ein freundliches Gesicht beugte sich über mich.
»Ihr seid wach«, bemerkte der fremde Mann freundlich. Er hatte ein breites Gesicht mit blaugrauen Augen, und sein langes blondes Haar war im Nacken zu einem Zopf zusammengebunden, der ihm über die Schulter fiel.
Ich bemühte mich, sein Lächeln zu erwidern, und versuchte mich aufzusetzen. Sofort waren helfende Arme zur Stelle, die mich behutsam hochzogen und mir Kissen in den Rücken legten, sodass ich mich anlehnen konnte. Ich lächelte dankbar und versuchte in dem Dämmerlicht, das um mich herum herrschte, etwas zu erkennen und mich nach meinem Helfer umzusehen. Ich musste mich in einer Höhle befinden, denn über mir wölbte sich eine unregelmäßige Steindecke. Sonst konnte ich nur das Feuer vor mir sehen. Doch dann traten drei Männer in mein Blickfeld. Beide lächelten und schienen mir freundlich gesinnt zu sein.
In dem Blonden mit dem Zopf erkannte ich den Reiter mit der silbernen Uniform wieder. Ein anderer reichte mir nun einen dampfenden Becher mit einer wohlriechenden, dampfenden Flüssigkeit. Er hatte kurze schwarze Locken, eisblaue Augen, und sein Gesicht wirkte ebenso offen und freundlich. Er trug die goldene Rüstung. Der Dritte war, wie ich nun erkannte, noch ein Junge. Er konnte höchstens vierzehn Jahre alt sein. Als mein Blick auf ihn fiel, wurde er rot und schaute zu Boden.
Ich nahm einen Schluck von dem warmen Tee, der sofort meinen ganzen Körper mit seiner Wärme durchdrang, und räusperte mich, bevor ich sprach.
»Ihr guten Männer, ich danke Euch für Eure Hilfe und meine Rettung, aber ich frage mich, was Euch dazu bewogen hat. Außerdem würde ich gern wissen, wo ich mich befinde und wer Ihr seid. Mein Leben ist in Gefahr, und ich fürchte, dass ich Euch ebenfalls gefährde, wenn ihr mir helft oder Euch zu lange in meiner Gegenwart aufhaltet.« Ich schloss mit einem besorgten Gesichtsausdruck, doch die Männer schien meine Warnung nicht im Geringsten zu beunruhigen. Auf dem Gesicht des Schwarzhaarigen breitete sich sogar ein breites Grinsen aus.
»Wie sie es prophezeit haben«, raunte er dem Blonden mit einer tiefen, rauen Stimme zu. »Sie weiß nicht, wer sie ist oder warum sie hier ist.«