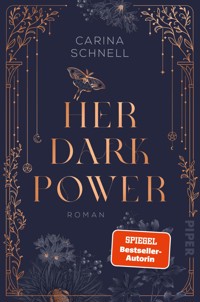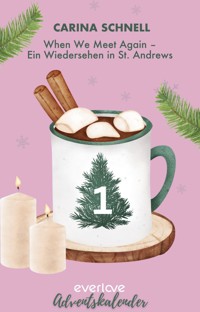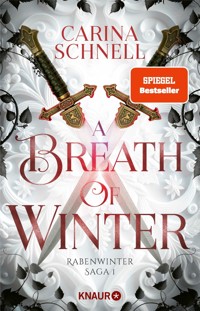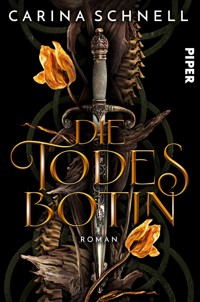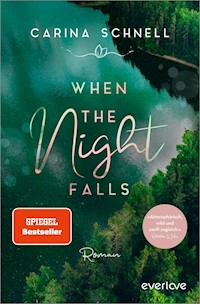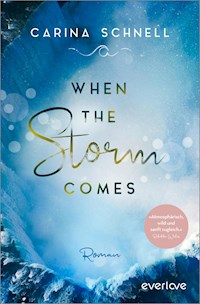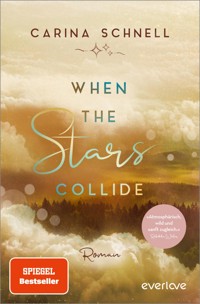
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Manchmal muss man Schwäche zugeben, um stark zu sein. Blake war auf dem Weg zum Profi-Footballer, bis er sich verletzte und alles verlor. Nun sitzt er in seinem Heimatort fest und hat sich selbst aufgegeben. Doch als die attraktive Touristin Rachel behauptet, St. Andrews sei ein langweiliges, verschlafenes Nest, wettet er, ihr das Gegenteil zu beweisen. Auf actiongeladenen Ausflügen lässt er ihren Puls höherschlagen – genau wie bei phänomenalem Sex. Dabei wird Blake klar, dass es doch noch Dinge gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Aber wie soll er die toughe Jurastudentin aus New York davon überzeugen, dass er mehr ist als nur ein Abenteuer? Eine wildromantische New-Adult-Reihe mit Kleinstadt-Setting in Kanada. »Liebenswerte Charaktere und ein bezauberndes Kleinstadtsetting. Perfekt für einen kuscheligen Abend auf der Couch!« SPIEGEL-Bestsellerautorin Lilly Lucas Band 3 der Sommer-in-Kanada-Reihe Carina Schnell schreibt am liebsten Geschichten mit einer ordentlichen Prise Romantik. Die Autorin und Übersetzerin hat selbst eine Weile im wunderschönen Kanada gelebt. Ihr Aufenthalt hat sie zu ihrer Sommer-in-Kanada-Reihe inspiriert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.everlove-verlag.de
Wenn dir dieser Roman gefallen hat, schreib uns unter Nennung des Titels »When the Stars Collide« an [email protected], und wir empfehlen dir gerne vergleichbare Bücher.
© everlove, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2022
Redaktion: Kerstin von Dobschütz
Sensitivity Reading: Jade S. Kye
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: FAVORITBUERO, München und Shutterstock.com
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Kapitel 1
Rachel
Kapitel 2
Blake
Kapitel 3
Rachel
Kapitel 4
Blake
Kapitel 5
Rachel
Kapitel 6
Blake
Kapitel 7
Rachel
Kapitel 8
Blake
Kapitel 9
Rachel
Kapitel 10
Blake
Kapitel 11
Rachel
Kapitel 12
Blake
Kapitel 13
Rachel
Kapitel 14
Blake
Kapitel 15
Rachel
Kapitel 16
Blake
Kapitel 17
Rachel
Kapitel 18
Blake
Kapitel 19
Rachel
Kapitel 20
Blake
Kapitel 21
Rachel
Kapitel 22
Blake
Kapitel 23
Rachel
Kapitel 24
Blake
Kapitel 25
Rachel
Kapitel 26
Blake
Kapitel 27
Rachel
Kapitel 28
Blake
Kapitel 29
Rachel
Kapitel 30
Blake
Kapitel 31
Rachel
Kapitel 32
Blake
Kapitel 33
Rachel
Kapitel 34
Blake
Ein Monat später
Kapitel 35
Rachel
Kapitel 36
Blake
Kapitel 37
Rachel
Kapitel 38
Blake
Kapitel 39
Rachel
Kapitel 40
Blake
Kapitel 41
Rachel
Kapitel 42
Blake
Kapitel 43
Rachel
Kapitel 44
Blake
Kapitel 45
Rachel
Epilog
Blake
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für alle, die selbst in der dunkelsten Nacht nach den Sternen greifen
Kapitel 1
Rachel
Mein Taxi hielt an der Ecke Yonge und Temperance Street. Nachdem ich dem Fahrer ein großzügiges Trinkgeld gegeben hatte, öffnete ich die Tür. Sofort drangen all die Geräusche der Großstadt auf mich ein – das Hupen der Autos, das Rattern der fernen Streetcars, das vibrierende Dröhnen einer nicht sichtbaren Baustelle und das Stimmengewirr einer Touristengruppe, die gerade um die Ecke bog. Endlich zu Hause. Endlich wieder in Toronto.
Kurz hielt ich die Luft an, genoss den Moment, bevor ich meinen Fuß aus der Tür schob. Vielleicht hatte ich als Kind zu viele romantische Komödien gesehen, aber dieser Moment würde für mich immer magisch sein. Der Augenblick, bevor die Hauptdarstellerin aus dem Auto stieg. Zuerst sah man nur ihren Fuß, der natürlich in einem wunderschönen Schuh steckte, als sie ihn vorsichtig aus der Tür schob. Sittsam achtete sie darauf, ihre Beine geschlossen zu halten, um keinen unfreiwilligen Blick auf ihre Unterwäsche freizugeben. Dann blickte sie auf, direkt in die Kamera, und sah sich mit fasziniertem Staunen um, während sie ausstieg, sodass man endlich ihr umwerfendes Outfit bewundern konnte.
Ich nannte diesen Augenblick meinen »Hollywood-Glitzer-Moment«. Bei mir war er nicht ganz so dramatisch, auch wenn ich ihn feierte. Meine Füße steckten in mit rosa Samt bezogenen High Heels, und ich trug an den Knien zerrissene Boyfriend-Jeans sowie mein schwarzes Lieblingstop mit Spitze am Ausschnitt. Die goldenen Armbänder an meinem Handgelenk klirrten aneinander, als ich die Tür weiter aufdrückte.
Ich schloss die Augen, spürte das konfettikanonenartige Kribbeln in meinem Magen, dann setzte ich einen Fuß auf die Yonge Street – die berühmteste Straße Kanadas, die früher als längste Straße der Welt gegolten hatte. Der zweite Fuß folgte, ich wackelte kurz mit den Zehen, dann stand ich auch schon mittendrin in dem lauten Chaos, das ich Zuhause nannte. Ich schlug die Tür hinter mir zu und winkte dem Taxifahrer, der sofort davonsauste.
Nach einem weiteren Schritt stand ich auf dem breiten Gehsteig. Langsam drehte ich mich einmal um mich selbst, betrachtete die aufragenden Gebäude, die jetzt am frühen Abend lange Schatten warfen. In der Ferne glitzerten ein paar verspiegelte Hochhäuser in der Abendsonne. Ein Stück die belebte Straße hinunter erkannte ich das rot-weiße Subway-Schild. Queen Station – an diese Haltestelle hatte ich so viele Erinnerungen, die nun augenblicklich meinen Geist fluteten. Wie ich betrunken huckepack auf Marlys Rücken die steile Treppe hinunterritt. Wie ich mich bückte, um meinem Lieblingsstraßenmusiker etwas in den Hut zu werfen, woraufhin er sich lächelnd bedankte. Wie ich Sam küsste, während eine Subway einfuhr und meine Haare aufgewirbelt wurden.
Bevor ich mich ganz in den Erinnerungen verlieren konnte, warf ich einen raschen Blick auf meine Armbanduhr. Ich war bereits spät dran, keine Zeit für Sentimentalitäten.
Das Edelrestaurant, in das mich meine Eltern eingeladen hatten, befand sich im historischen Dineen Building, einer architektonischen Perle der Stadt. Ich schob mir den Riemen meiner Handtasche über die Schulter und ging auf den Eingang zu. Meine hohen Absätze klickten bei jedem Schritt auf dem Asphalt – ein Geräusch, das mir schon seit meiner Jugend Selbstvertrauen gab.
Der Fahrstuhl brachte mich in die oberste Etage des gepflegten Gebäudes. Als ich durch Glastüren in das Restaurant trat, kam mir leise Klaviermusik entgegen. Durch die deckenhohen Fenster mit den schneeweißen Gardinen hatte man einen schönen Ausblick, auch wenn das Gebäude nicht besonders hoch war. Von der Decke hingen riesige gläserne Kugeln, in denen sich Kronleuchter befanden. Die Sitzecken waren mit lilafarbenem Samt bezogen, der weiche Teppich schluckte meine Schritte. Ich runzelte die Stirn. Dieses Restaurant war viel hipper als die Orte, an denen meine Eltern gewöhnlich aßen. Versuchten sie etwa, mich zu beeindrucken?
»Guten Abend, haben Sie eine Reservierung?«, begrüßte mich eine junge Frau mit bronzefarbener Haut und Smokey Eyes.
»Hi.« Ich reckte mich trotz meiner Absätze ein wenig, um nach meinen Eltern Ausschau zu halten. »Ich bin hier, um meine … Ah, da sind sie ja!« Ich deutete auf einen Platz am Fenster, von dem aus mir meine Mom diskret zunickte.
Die Frau lächelte. »Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend.«
»Danke.« Ich erwiderte ihr Lächeln und machte mich auf den Weg. Dabei widerstand ich dem allzu vertrauten Drang, an meinem Outfit herumzuzupfen oder meinen kleinen Handspiegel aus der Tasche zu holen, um zu prüfen, ob ich auch ja keinen Lippenstift auf den Zähnen hatte. Dabei handelte es sich nicht um einen nervösen Tick, sondern um eine notwendige Maßnahme, um in Gegenwart meiner Eltern zu überleben. Stattdessen ließ ich meine Arme bemüht locker herabhängen und konzentrierte mich darauf, ein strahlendes Lächeln aufzusetzen. Ich hatte es fast geschafft. Meine Zukunft war zum Greifen nah. Mein selbstbestimmtes Leben begann in wenigen Wochen. Nicht mehr lange, bis ich dem Einfluss meiner Eltern endlich entkommen würde.
Erst als ich den Tisch fast erreicht hatte, entdeckte ich, dass Mom und Dad nicht allein waren. Neben Dad saß ein mir unbekannter Mann, den Mom mit ihrem gewinnenden Lächeln zu bezirzen versuchte. Vor Überraschung strauchelte ich und wäre beinahe gegen den Nebentisch gestoßen. Was zum …? Ich dachte, das hier wäre nur ein schnelles Abendessen, gefolgt von einer Nacht in der Penthouse-Wohnung meiner Eltern, bevor ich morgen früh nach St. John weiterflog. So war es mir zumindest mitgeteilt worden. Am liebsten wäre ich wieder umgedreht, doch da legte sich Moms Blick auf mich. Zu spät …
Wut stieg in mir auf, als sie ihre braunen Augen zu dem für sie typischen Raubtierblick verengte. Meine Reaktion war ihr nicht entgangen. Es war, als würde sie mir eine telepathische Botschaft schicken: »Mach jetzt bloß keine Szene, Rachel.«
Ich schnaubte und schickte ihr ein süffisantes Grinsen zurück. »Mach dich auf was gefasst, Mutter.«
Wenn man mich vor vollendete Tatsachen stellte, konnte ich für nichts garantieren.
Im selben Moment blieb ich vor dem Tisch meiner Eltern stehen. »Rachel, Darling.« Mom erhob sich, um mich mit zwei gehauchten Wangenküsschen zu begrüßen. Ihr blondiertes Haar war zu einer Hochsteckfrisur drapiert, eine Perlenkette zierte ihren blassen Hals, und aufgrund ihres starken Chanel-Parfüms wurde mir ganz schwindelig. Dad schenkte mir nur ein halbherziges Lächeln.
»Das ist Mr Hamilton.« Mom deutete auf den Mann, der sich ebenfalls erhoben hatte, um mir die Hand zu schütteln.
»Freut mich sehr«, sagte er mit einem Zahnpastalächeln, wobei sich die Fältchen um seine ergrauten Augenbrauen vertieften.
»Mich, äh, auch.« Ich hatte immer noch keine Ahnung, wer der Kerl war und was das hier sollte.
»Mr Hamilton ist der Ehemann von … Ach, da kommt sie ja schon.«
Erst in diesem Moment fiel mir auf, dass es zwei freie Plätze am Tisch gab. Einer gehörte anscheinend der Frau mittleren Alters, die nun in Pumps mit praktisch breiten Absätzen auf uns zukam. Sie musste die Toilette aufgesucht haben, denn ihre teure Handtasche und ein Seidenschal hingen bereits über der Stuhllehne.
Hamilton, Hamilton, Hamilton. Irgendwie kam mir der Name bekannt vor, aber ich konnte die Erinnerung nicht ganz greifen.
»Darf ich dir Dekanin Hamilton vorstellen?« Mom hatte ihren würdevollen Tonfall angeschlagen, den sie sonst nur bei Stars und Politikern zum Einsatz brachte. Fehlte nur noch, dass sie einen Hofknicks machte. »Dekanin Hamilton, das ist unsere Tochter Rachel Montgomery.«
Ich hatte mich der dunkelhaarigen Frau zugewandt, um ihre Hand zu schütteln, doch als Moms Worte zu mir durchdrangen, fiel mein Arm schlaff herab. Dekanin Hamilton? Die Dekanin der Jurafakultät der University of Toronto?
Mein Blick flog zu meiner Mom. Ich musste ihr dazu gratulieren, dass sie aufgrund meines zornigen Funkelns nicht zusammenzuckte. Was für ein ausgeklügeltes Set-up! Es gefiel meinen Eltern nicht, dass ich in New York studieren würde. Sie wollten mich hier in Toronto haben, wo sie mich im Auge behalten konnten. Wie hatten sie nur glauben können, mich mit so einer Aktion dazu zu bewegen, meinen Traum aufzugeben? Ein letzter verzweifelter Akt, um mein Leben zurück in die Bahn zu lenken, die sie seit meiner Kindheit vorgaben.
»Wie schön, dich kennenzulernen, Rachel«, sagte Dekanin Hamilton. »Wir haben schon so viel von dir gehört.«
Zähneknirschend wandte ich mich ihr wieder zu. »Freut mich ebenfalls, auch wenn ich etwas überrascht bin, Sie heute hier zu treffen.«
Meine Mutter schnappte geräuschvoll nach Luft, doch Mrs Hamilton zuckte nicht einmal mit der Wimper. Stattdessen breitete sich ein anerkennendes Lächeln auf ihrem Gesicht aus. Sie nickte mir knapp zu, bevor sie sich an mir vorbeischob und auf ihrem Platz niederließ.
»Dad und Mr Hamilton gehen oft zusammen golfen.« Mom versuchte, die peinliche Situation mit ihrem Geplapper zu überspielen. »Als er hörte, dass du Jura studieren willst, war er sofort sehr angetan und wollte unbedingt, dass du seine Frau kennenlernst.«
»Natürlich«, antwortete ich trocken. Wie sollte dieses Treffen auch anders zustande gekommen sein? Sicher nicht durch das Einmischen meiner Mutter, die ihre seidenen Netze kunstvoll wie eine Spinne wob. Wenn man sich einmal darin verfing, gab es kein Entkommen mehr. Beinahe taten mir die Hamiltons leid.
Mom überging meinen Kommentar. »Setz dich doch, Darling. Wir haben schon für dich mitbestellt.« Weil du so spät dran bist, sagte ihr tadelnder Blick. »Gerösteter Heilbutt mit Kartoffeln in Estragonbutter mit einer getoasteten Brioche-Kruste und Pilzsoße. Ich habe gehört, dass der Fisch hier hervorragend sein soll.«
Ein weiterer Trick, um mich zum Bleiben zu bewegen. Doch ich machte keine Anstalten, mich an den Tisch zu setzen. Stattdessen warf ich mir das lange braune Haar über eine Schulter, streckte meine Hüfte raus und stemmte eine Hand darauf. Sollte Mom sich doch in ihrem eigenen Netz verfangen. Dad rutschte unbehaglich auf seinem Stuhl hin und her. Sein sonst blassrosa Gesicht war tiefrot angelaufen, und er warf seinem Golfkollegen peinlich berührte Blicke zu. »Danke, aber ich werde nicht zum Essen bleiben«, antwortete ich meiner Mutter.
Ihre Augen weiteten sich unmerklich, bevor sie sich wieder im Griff hatte. »Nun sei nicht albern, Rachel. Hast du etwas anderes vor?«
»Nein.« Das Wort hallte in der darauffolgenden Stille nach, während mich vier Augenpaare anstarrten.
»Dann setz dich jetzt hin, damit wir uns über deine Zukunft unterhalten können.«
Ich seufzte. Wollte sie dieses Spiel wirklich bis zum Ende spielen?
»Ich wurde unter dem Vorwand hergelockt, mit meinen Eltern zu Abend zu essen, die ich seit Wochen nicht gesehen habe, weil ich für ein Praktikum in New York war. Morgen früh sitze ich schon wieder im Flieger nach St. John, und, bei allem Respekt, ich sehe keinen Grund, heute Abend über meine Zukunft zu sprechen. Die steht nämlich längst fest.«
»Rachel«, zischte Mom kaum hörbar.
»Es tut mir wirklich leid, Ihre Zeit verschwendet zu haben«, wandte ich mich an die Hamiltons. »Aber ich werde ab September in New York studieren. Ich bin an der NYU eingeschrieben und habe mir bereits eine Wohnung gekauft.«
Meine Mutter schnappte hörbar nach Luft, doch ich ignorierte sie.
»Als meine Eltern Sie zu diesem Treffen« – ich malte Anführungszeichen in die Luft – »einluden, wussten sie, dass ich meine Entscheidung bereits vor Monaten getroffen habe. Ich fürchte, dass sie unumstößlich ist. Nicht, dass ich die University of Toronto nicht in Betracht gezogen hätte, schließlich ist es eine exzellente Schule.« Ich sah die Dekanin an, und sie schenkte mir ein Lächeln, was ich als Aufforderung auffasste weiterzusprechen. Sicher nahm sie mindestens dreimal im Monat an solchen Bewerbungsgesprächen für reiche, verwöhnte Studierende teil, die als Abendessen getarnt und von deren Eltern inszeniert worden waren.
»Bitte verzeihen Sie diese kolossale Verschwendung Ihrer Zeit. Hoffentlich haben Sie trotzdem einen schönen Abend. Ich habe gehört, der Fisch soll in diesem Restaurant ganz hervorragend sein.«
Ich verabschiedete mich mit einem flüchtigen Nicken von meinen Eltern und wollte auf dem Absatz kehrtmachen. Da sprang Mom so energisch auf, dass sich eine Strähne aus ihrer Hochsteckfrisur löste. Ich versuchte sie zu ignorieren und entfernte mich eilig vom Tisch. Doch sie kam mir hinterher. Selbst der weiche Teppich konnte das aggressive Donnern ihrer Absätze nicht abfangen. »Rachel«, zischte sie, als wir uns weit genug vom Tisch entfernt hatten, dass ihre Gäste uns nicht hören konnten. »Entschuldige dich sofort bei Mr und Mrs Hamilton. Das ist doch keine Art und Weise …«
Widerwillig fuhr ich zu ihr herum. »Das habe ich doch gerade schon«, unterbrach ich sie mit schneidendem Tonfall. »Ich habe mich für euren peinlichen Auftritt entschuldigt, obwohl der nicht auf meinem Mist gewachsen ist.«
»Und was soll das Gerede darüber, dass du eine Wohnung in New York gekauft hast? Darüber ist noch nicht das letzte Wort gefallen …«
»Ich werde ab September dort studieren, also brauche ich wohl eine Unterkunft.«
Sie öffnete den Mund, um ihre Schimpftirade fortzusetzen, aber ich gab ihr keine Zeit zu antworten. Ich ließ sie einfach stehen. Mein Haar peitschte hinter mir her, als ich mit großen, sicheren Schritten aus dem Restaurant stolzierte. Es war kein Walk-of-Shame, sondern ein Walk-of-Dignity. Denn ich fühlte mich so frei wie noch nie.
Meine Eltern hatten mir heute Abend einmal mehr ihren Willen aufzwingen wollen, aber ich hatte es satt, mich von ihnen manipulieren zu lassen. Mir ein schlechtes Gewissen einflüstern zu lassen und am Ende nachzugeben. Ich hatte es satt, ihre Träume zu leben statt meine.
Endlich hatte ich mir meine Würde zurückgeholt. In den letzten Monaten hatte ich einen großen Schritt nach vorn gemacht und würde keinen Rückzieher mehr zulassen.
Diesmal nicht.
Kapitel 2
Blake
Gleißende Lichter. Tosender Applaus. Donnernder Jubel aus vielen Tausend Kehlen.
Ich lasse alles über mich hinwegbranden, spüre dem Kribbeln nach, das durch meinen Körper jagt wie eine Million Volt.
Meine Nerven sind zum Zerreißen gespannt, ich bin hoch konzentriert. Bereit. Am liebsten würde ich auf der Stelle tänzeln, um meine überschüssige Energie loszuwerden. Nur noch wenige Minuten, bis ich sie auf dem Feld loswerden kann.
Ich mache einen Schritt, die Noppen unter meinen Sohlen versinken im kurz getrimmten Rasen. Der Brustpanzer liegt schwer auf meinen Schultern. Das Gitter meines Helms schränkt meine Sicht ein, sodass ich mich nur auf das Wesentliche konzentriere. Ich blende den Lärm und die Lichter aus, das Brüllen unseres Coaches, die letzten guten Wünsche meiner Mannschaftskameraden, die mir im Vorbeigehen auf den Rücken klopfen.
Das Leder unter meinen Fingern fühlt sich rau und vertraut an. Es wölbt sich mir entgegen, flüstert mir zu: »Du und ich, wir werden heute Großes vollbringen. Dein letztes Spiel auf diesem Rasen wird unvergesslich werden. Du wirst in die Geschichte eingehen.«
Grinsend schiebe ich mir den Mundschutz zwischen die Zähne, dann gebe ich den Ball ab und gehe in Position. Meine Jungs stellen sich vor mir auf. Ich mustere unsere Gegner, stelle mir vor, wie sie vor Angst zittern. Mein Ruf eilt mir voraus.
»Down!«, brülle ich. Meine Teamkollegen bücken sich in ihre Startstellung.
»Set!« Die erwartungsvolle Spannung ist in der Luft zu spüren.
»Hut!«
Es geht los.
Kiloweise Muskeln treffen mit einem ohrenbetäubenden Krachen aufeinander – Musik in meinen Ohren. Danach nehme ich kaum noch etwas wahr. Das Spiel zieht wie im Rausch an mir vorbei. Ich renne, springe, fange und werfe den Ball, laufe zur Höchstform auf. Unser Score auf der Anzeigetafel wächst und wächst. Die Gegenspieler grunzen frustriert, versuchen immer wieder, mich zu erwischen. Aber ich bin zu schnell. Mein Hochgefühl wächst ins Unermessliche.
Ich sehe ihn nicht kommen. Er rast aus meinem toten Winkel auf mich zu. Ich halte den Ball in der Hand, hole gerade zum Wurf aus. Meine Offensive ist nicht schnell genug, um mich zu schützen. Der Aufprall reißt mich von den Füßen. Ich fliege meterweit durch die Luft, lande hart auf dem Boden. Etwas reißt, etwas knackt, etwas bricht. Ich höre nichts als dieses Geräusch. Es hallt laut in meinen Ohren, übertönt das erschrockene Brüllen meiner Jungs, das triumphierende Jubeln der gegnerischen Fans. Ein scharfer Schmerz zuckt durch mein Knie. Und ich weiß, dass jetzt alles aus ist.
Keuchend schrak ich auf, schoss kerzengerade in die Höhe. Mein Atem klang viel zu laut in der nächtlichen Stille meines Zimmers. Ich riss die Augen auf, starrte in die Dunkelheit, nur erhellt vom Sternenhimmel vor dem Fenster. Es war stickig, obwohl sich die Gardinen im Nachtwind bewegten. Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn, lauschte auf meinen rasselnden Atem, das wild pochende Herz.
Beruhige dich, Mann. Es war nur ein Traum. Nur der Traum. Wie jede Nacht. Seit vier Jahren.
Ich warf einen Blick auf meine Nachttischuhr. 03:10.
Seufzend zog ich die Beine an, stützte die Ellbogen auf die Knie und vergrub mein Gesicht in den Handflächen. »Verdammte Scheiße.«
Obwohl ich nur enge Boxer-Briefs trug, schwitzte ich am ganzen Körper, also schlug ich die Bettdecke zurück. Doch als mein Blick auf die nicht mehr ganz so definierten Muskeln meines Bauchs und meiner Brust fiel, wurde mir schlecht.
Mein Körper schien mich zu verhöhnen. Je mehr ich mich in den letzten Jahren bemüht hatte, meine Gesundheit und Fitness zu untergraben, desto mehr hatte mein Körper mir gezeigt, dass er weitermachen wollte. Aber was für einen Sinn ergab das, wenn der Teil, den ich am dringendsten brauchte, nicht mehr wie früher funktionierte? Es war vorbei. Mein Körper war nutzlos geworden, und ich verfluchte ihn jeden Tag dafür.
Frustriert griff ich nach der Wasserflasche neben meinem Bett, doch auch das half nicht. Denn darauf prangte das Logo der Mannschaft, zu der ich nie gestoßen war. Ein großes gelbblaues M – das Symbol meiner verlorenen Zukunft. Es sprang mir ins Gesicht, schien mich laut auszulachen. Tief in meinem Schrank vergraben lag ein Kapuzenpulli mit demselben Logo und noch tiefer in meiner Schreibtischschublade der Brief, der mir ein Stipendium an der University of Michigan versprach.
Meine Augen brannten, und ich zwang mich, einen Schluck zu trinken. Das Wasser schmeckte warm und abgestanden, fast hätte ich es wieder ausgespuckt.
Ich ließ mich zurück in die Kissen sinken, wartete darauf, dass sich meine Atmung endlich beruhigte. Doch als ich statt meines Herzschlags schließlich die Geräusche der nicht allzu fernen Straße hörte, als ich tief Luft holte und endlich die Überreste des Albtraums abschüttelte, war da nichts als Leere. Dort, wo früher das Wichtigste der Welt mein Herz erfüllt hatte. Die Lichter. Der Jubel. Der Rasen. Das Leder. Mein Körper. Meine Leistung. Jetzt war da nur noch ein klaffendes Loch.
Wer war ich ohne diese Dinge?
Als ich drei Stunden später von meinem Wecker aus einem glücklicherweise traumlosen Schlaf gerissen wurde, fühlte ich mich wie zerschlagen. Das war jedoch nichts Neues. Ich konnte mich nicht erinnern, seit meinem Unfall auch nur eine Nacht durchgeschlafen zu haben. In den Wochen im Krankenhaus war es zwischen all den piependen Maschinen und den umhereilenden Pflegekräften unmöglich gewesen. Und als ich Wochen später endlich wieder in meinem eigenen Bett gelegen hatte, hatten mich die Scham- und Schuldgefühle überwältigt. Außerdem war es nicht leicht gewesen, mit dem Gips eine bequeme Position zu finden. Und jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, sah ich wieder diesen einen verhängnisvollen Moment vor mir. Zu sagen, ich hätte mich mittlerweile mit dem Schlafmangel abgefunden, wäre gelogen. Es war eher so, dass ich jeden Tag wie ein Zombie durch die Gegend tapste – und das seit vier Jahren.
Mühsam setzte ich mich auf und schob die Beine über die Bettkante. Dabei fiel mein Blick auf die lange Narbe an meinem rechten Knie. Rötlich und wulstig hob sie sich von meiner umbrabraunen Haut ab.
Ich seufzte, fuhr mir mit der Hand über das Gesicht, versuchte, die Kraft aufzubringen, mich aus dem Bett zu hieven.
Ein weiterer ereignisloser Tag lag vor mir. Die Hölle, die ich seit Jahren mein Leben nannte, bestand hauptsächlich aus einer Aneinanderreihung des immer gleichen Ablaufs: aufstehen, wenn der Wecker klingelte, arbeiten im einzigen Supermarkt von St. Andrews, auf der Couch gammeln und Trash-TV schauen, schlafen – oder es zumindest versuchen – und dann alles wieder von vorn. Unterbrochen wurde die Eintönigkeit nur von kleinen Lichtblicken wie meinen Geschwistern, Treffen mit meinen Freunden oder dem regelmäßigen Work-out mit Jack – auch wenn ich vor ihm nie zugeben würde, wie wichtig mir diese gemeinsame Zeit war.
Grummelnd erhob ich mich, öffnete das Fenster so weit wie möglich und ließ die Morgenluft herein. Ich hatte kein Ohr für die zwitschernden Vögel im Baum vor dem Haus und kein Auge für den glitzernd blauen Streifen Meer, den ich hier im vierten Stock gerade noch hinter einigen Hausdächern erkennen konnte.
Gähnend schlurfte ich aus meinem Zimmer. Den Weg in die Küche hätte ich mit verbundenen Augen gefunden, da mir bereits ein starker Geruch nach Kaffee und Rührei entgegenwehte.
»Morgen.«
»Guten Morgen, Blake«, begrüßten mich meine beiden kleinen Geschwister im Chor. Ich zuckte anhand ihrer lauten, fröhlichen Stimmen zusammen. Sie waren zehn und zwölf – ein Alter, in dem man anscheinend jeden Morgen nervtötend gut gelaunt war. Trotzdem gab ich beiden einen Kuss auf die Stirn.
Mom musterte mich mit hochgezogenen Augenbrauen, während sie meiner Schwester Lou einen Teller Rührei mit Toast reichte. Sie hatte sich einen bunten Seidenschal um den Kopf geschlungen, worunter sich ihre Bantu Knots abzeichneten. »Würde es dich umbringen, dir was überzuziehen?«, fragte sie. Ihre Stimme klang nach dem Aufwachen immer rau, wie Schmirgelpapier, bevor sie ihren ersten Kaffee intus hatte.
Ich zuckte mit den Schultern. »Ist zu heiß.« Ich kratzte mich am nackten Bauch und ließ mich auf den Stuhl neben Lou plumpsen. »Reich mir mal die Froot Loops, Davie.« Mein kleiner Bruder grinste mich an und schob die bunte Packung zu mir rüber.
Als die bunten Kringel klirrend in die Schüssel purzelten und mir der chemieartige Duft in die Nase stieg, wäre ich fast zurückgewichen. Vor einigen Jahren, als ich noch streng auf meine Ernährung geachtet und keinen industriellen Zucker zu mir genommen hatte, wäre ein solches Frühstück undenkbar gewesen. Doch der Mixer für meine allmorgendlichen Smoothies und Protein-Shakes stand schon lange unbenutzt in der Ecke neben dem Herd und setzte Staub an. Mittlerweile hätte ich mir am liebsten Tequila statt Milch über die Froot Loops gekippt. Wozu sollte ich mir noch die Mühe machen, auf meine Gesundheit zu achten?
»Guten Morgen, Daddy!«, krakeelten Davie und Lou im Chor.
»Guten Morgen!« Moms zweiter Ehemann Darrol kam in Jogginghose und weitem T-Shirt aus dem Bad. Die mahagonibraune Haut seines kahl rasierten Schädels glänzte feucht vom Duschen, seine nackten Füße tapsten laut auf den Fliesen. Er gab Mom einen Kuss auf die Wange, wuschelte meinen Geschwistern durchs Haar und klopfte mir auf die Schulter.
Mom sah ihn verliebt an. »Ich habe die besten Inserate schon markiert, und es gibt noch Rührei in der Pfanne.« Sie deutete erst auf die heutige Tageszeitung auf dem Küchentisch, dann zum Herd. Als ihr Blick daraufhin auf die Wanduhr fiel, eilte sie leise fluchend aus der Küche.
»Danke, mein Schatz«, rief Darrol ihr hinterher.
Ich betrachtete die Zeitung vor mir. Ganz oben lag die Seite mit den Immobilienanzeigen, auf der Mom sich mit pinkem Textmarker ausgelassen hatte. Die beiden suchten seit ein paar Wochen nach einem Haus in der Gegend. Mir war klar, was das bedeutete: Spätestens wenn sie eins gefunden hatten, wäre das mein Stichwort, mir endlich eine eigene Bleibe zu suchen. Wahrscheinlich wollten sie ein Haus mit nur drei Schlafzimmern, um noch deutlicher zu machen, dass ich ausziehen sollte. Die Mühe brauchten sie sich allerdings nicht zu machen. Ich wusste, wenn ich nicht erwünscht war.
Geräuschvoll kaute ich meine Froot Loops und stierte auf die Tischplatte. Auf die kleine Kerbe am Rand, die ich als Kind mit meinem Spielzeug-Power-Ranger aus Versehen hineingeschlagen hatte. Am liebsten wäre ich aufgesprungen, hätte den Tisch gepackt und ihn durch die Küche geschleudert, sodass die Müslischalen klirrend an der Wand zerschellten, die Milch auf den Boden tropfte und alle mich erschrocken ansähen. Irgendetwas, um diese ewig gleiche Routine zu durchbrechen. Irgendetwas, um meinem Schmerz Ausdruck zu verleihen. Stattdessen schluckte ich meine Wut hinunter, wie ich es immer tat. Hielt den Kopf gesenkt. Sagte nichts. Ertrug alles schweigend. Wie lange würde ich das noch schaffen?
»Spielst du das Spiel mit mir, Blake?« Lou legte ihren Kopf an meinen nackten Arm und blickte mit großen braunen Augen zu mir auf. Mit ihren beiden vom Kopf abstehenden Zöpfen sah sie beinahe aus wie eine Schwarze Pippi Langstrumpf. Sie deutete auf die Rückseite der Froot-Loops-Packung.
»Finde alle Papageien«, las ich laut vor. »Okay, hast du schon einen entdeckt?«
Konzentriert kniff sie die Augen zusammen, dann hellte sich ihre Miene auf. »Da ist einer!«
»Pah!« Ich stemmte die Hände in die Hüften und sah sie herausfordernd an. »Du musst dich ein bisschen mehr ins Zeug legen, ich hab schon drei gefunden!«
Sie quietschte vergnügt und riss die Packung an sich, sodass ich das Bild mit den in einem Dschungel versteckten Papageien nicht mehr sehen konnte. Wenn es eins gab, was Lou hatte, dann war es Ehrgeiz. So wie ich – früher mal.
Spielerisch versuchte ich, ihr die Packung abzunehmen, doch sie sprang auf und lief auf die andere Seite des Tisches. Ich schmunzelte in meine Müslischale, während sie lautstark jeden einzelnen Papagei aufzählte, den sie entdeckte.
Mom kam zurück in die Küche. Nun trug sie ihre Arbeitskleidung, eine weiße Hose, einen hellblauen Kittel und bequeme Sneakers. Rasch trug sie vor dem Spiegel im Flur etwas Wimperntusche auf. »Ich muss los, meine Babys!« Sie rauschte durch die Küche, nahm sich ihre Tupperdose mit Mittagessen aus dem Kühlschrank und stellte Lous und Davies auf den Tisch. »Ich hab euch lieb!«
Zuerst gab sie Darrol, dann meinen Geschwistern und schließlich auch mir einen Kuss auf den Scheitel, obwohl ich mich wegzuducken versuchte. Eigentlich war ich viel zu alt für solche Dinge. Nie hätte ich offen zugegeben, dass diese kurzen Momente mit meiner Familie die Highlights meines öden Lebens waren.
»Grüß Ellie von mir«, rief ich Mom hinterher. Ich wusste, dass sie heute im Krankenhaus eine gemeinsame Schicht mit der Frau meiner besten Freundin hatte.
»Mach ich, mein Schatz. Hab einen schönen Tag auf der Arbeit!«
Beinahe hätte ich laut geschnaubt, wenn ich mir damit keinen Klaps auf den Hinterkopf eingehandelt hätte. »Arbeit« war ein zu hochgestochenes Wort dafür, dass ich dreimal die Woche die Regale im Joey’s einräumte und sonst an der Kasse aushalf.
»Ach, und Blake!« Mom steckte noch mal ihren Kopf zur Küchentür herein. »Gestern hat Devon angerufen, weil er dich auf dem Handy nicht erreicht hat. Er freut sich so auf seine Hochzeit im Oktober. Ruf ihn doch mal zurück. Er will dich bestimmt über den Junggesellenabschied ausquetschen.«
»Hm.«
Mom eilte davon, während ich es mir verkniff, die Augen zu verdrehen. Lieber hätte ich ein zweistündiges Cardio-Workout durchgezogen, als meinen Cousin und erfolgreichen Investmentbanker zurückzurufen. Es war schon schlimm genug, dass er mich auf seinen Junggesellenabschied eingeladen hatte. Aus der Nummer kam ich leider nicht mehr raus.
Darrol lehnte sich mit einem Teller Rührei an die Küchentheke. Er musterte mich einen Moment und deutete dann mit dem Kinn in Richtung des Fensters. »Alles in Ordnung mit deinem Knie?«
Ich wusste sofort, dass er nicht den allgemeinen Zustand meines Beins meinte, das mittlerweile wieder in Ordnung war, sondern die dunklen Wolken, die sich in der Ferne zusammenbrauten. Seit meiner Verletzung war ich wetterempfindlich, sodass ich solche Umschwünge teils schon Tage zuvor als unangenehmes Ziehen im Knie spürte.
Ich schüttelte den Kopf, fühlte mich plötzlich zu nackt in meiner Unterhose. Die lange Narbe an meinem Bein war unübersehbar. »Das zieht bestimmt vorbei. Ich habe länger nichts gespürt.«
Er nickte nachdenklich und schenkte mir eins seiner warmen Darrol-Lächeln, von denen Mom meinte, sie könnten alles heilen. Das bezweifelte ich zwar, aber ich lächelte trotzdem leicht schief zurück. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu Darrol und damals kein Problem damit gehabt, nach der Scheidung meiner Eltern einen zweiten Vater zu bekommen. Allerdings erinnerte mich Darrols Anwesenheit regelmäßig daran, wie lange ich mich nicht mehr bei meinem leiblichen Dad gemeldet hatte, der auf der anderen Seite des Landes lebte.
»Du musst dir keine Sorgen um mich machen, Coach.«
Von allen meinen Freunden wurde Darrol nur liebevoll »Coach« genannt, da er Footballtrainer und Sportlehrer an unserer alten Highschool war. Ich hatte ihn allerdings schon sehr lange nicht mehr so genannt. Schließlich war meine Karriere vorbei. Er würde nie wieder mein Trainer sein. Sein Lächeln wurde sofort noch strahlender, und ich verspürte einen leisen Anflug von schlechtem Gewissen.
Ich wusste sehr wohl, dass ich in den letzten Jahren viele Leute vor den Kopf gestoßen hatte. Dass ich mich in mich selbst zurückgezogen und mit meinem schroffen Verhalten jene verletzt hatte, die ich am meisten liebte. Trotzdem konnte ich nicht anders. Der Schmerz und die Enttäuschung saßen einfach zu tief. Also trank ich die bunt gefärbte Milch in meiner Schüssel in einem Zug aus und stand auf, um so schnell wie möglich dieser neuen Nähe zwischen Darrol und mir zu entkommen. Es fühlte sich gut an und erinnerte mich gleichzeitig nur wieder an alles, was ich verloren hatte.
Fast wäre ich gegen Lou geprallt, die stolz verkündete, alle Papageien gefunden zu haben. Ich hörte sie kaum. Einmal mehr steckte ich in meinem eigenen Kopf fest. In dem zähen Nebel, der alles grau färbte, Farben und Geräusche dämpfte, sodass mein Leben einem Schwarz-Weiß-Film glich. So war es besser. So konnte ich nicht wieder verletzt werden.
»Das wird schon«, rief Darrol mir hinterher.
Hätte man mir in den letzten Jahren jedes Mal einen Loonie geschenkt, wenn jemand diesen Satz zu mir gesagt hatte, wäre ich jetzt Millionär. Ich drehte mich nicht um, sah und hörte nichts als den zähen Nebel, der zum Glück auch meine aufsteigende Traurigkeit verschluckte.
Als ich kurze Zeit später frisch geduscht aus der Haustür trat, seufzte ich tief. Ein weiterer belangloser Tag lag vor mir.
Nach meiner Schicht öffnete ich gerade meinen Spind im Pausenraum des Supermarkts, als ich mein Handy darin vibrieren hörte. Ich bückte mich, musste kurz in meiner Sporttasche herumkramen, bis ich es gefunden hatte. Der Name meines besten Freundes leuchtete auf dem Bildschirm auf. Ich sah auf die Uhr und runzelte die Stirn. Dann nahm ich den Anruf an. »Hey, Jack, was gibt’s?«
»Hey, Mann!« Jack klang weit entfernt, im Hintergrund knirschte und knackte es. Er musste sich auf Ministers Island befinden, einer Insel, die nur bei Ebbe zu erreichen war. Dort lebte er in einer Blockhütte. »Hörst du mich?« Er klang aufgewühlt, leicht außer Atem.
»Die Verbindung ist schlecht, aber es geht schon.«
»Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber heute kommt Marlys beste Freundin Rachel mit dem Flugzeug in St. John an. Ich wollte Marly eigentlich zum Flughafen begleiten, aber …«
Wieder knackte es, sodass ich seine nächsten Worte nur halb verstand. »Auf der Insel ist ein Baum umgestürzt … direkt auf die Straße, die nach Covenhoven führt … Niemand kommt mehr durch. Ich soll ihn mit meinem Pick-up wegziehen … werde ein paar Stunden beschäftigt sein.«
»Wurde jemand verletzt?«
»Nein, zum Glück ist es passiert, bevor die Ebbe eingesetzt hat. Niemand war auf der Insel unterwegs.«
»Puh, ist ja noch mal gut gegangen.«
»Ja. Also, ich wollte fragen, ob du an meiner Stelle mit Marly zum Flughafen fahren kannst. Will muss arbeiten, Fiona auch, und da dachte ich … Deine Schicht ist doch gerade zu Ende, oder?«
Natürlich hatte er zunächst alle anderen gefragt und sich erst als letzten Ausweg an mich gewandt. Obwohl mir seine Worte einen Stich versetzten, konnte ich es Jack nicht verübeln. Schließlich war ich in den letzten Monaten nicht gerade zuverlässig gewesen.
»Klar, Mann«, antwortete ich eine Spur zu unbeschwert. »Ich begleite Marly. Gar kein Problem.«
Ich hörte Jack erleichtert seufzen. »Danke, du rettest mir echt den Hintern, Blake. Ich möchte sie nicht gern allein fahren lassen. Sie war noch nie am Flughafen in St. John und kennt sich in der Gegend nicht aus.«
»Kein Ding, ist ja nicht so, als hätte ich etwas Besseres vorgehabt.«
Jack überging meine sarkastische Bemerkung. »Ich sage Marly Bescheid. Sie kommt dich in einer halben Stunde zu Hause abholen, okay?«
»Geht klar.«
»Und Blake?«
»Ja?«
Jack zögerte. Ich konnte mir lebhaft vorstellen, wie er sich verlegen über den Nacken rieb. »Du hast doch heute noch nichts getrunken, oder?«
Ich stockte, während meine Wangen heiß wurden. Ob vor Scham oder vor Wut, konnte ich nicht sagen. »Was ist das denn für eine Frage? Natürlich nicht. Auf der Arbeit würden sie mich sofort feuern.«
Jack schwieg so lange, dass ich mir das Handy vors Gesicht hielt, um nachzusehen, ob die Verbindung unterbrochen worden war. »Okay, Mann. Danke, dass du so kurzfristig einspringst«, sagte er schließlich und legte auf.
Ich starrte das Handy einen Moment stirnrunzelnd an. In mir brodelte eine Mischung aus gefährlichen Gefühlen. Wut, Empörung, Scham, Enttäuschung. Mein Atem ging zu schnell, ich umklammerte das Handy so fest, dass es knirschte. Grunzend stopfte ich es in meine Hosentasche. Mein Blick fiel auf eine Dose, die in der Sporttasche lag. Ein Energydrink. Pure Chemie. Früher hätte ich so etwas niemals angerührt. Jetzt kam es mir gerade recht.
Mit fliegenden Fingern öffnete ich die Dose und nahm einen großen Schluck. Ich keuchte, als sich der eklig süße Geschmack in meinem Mund ausbreitete. Dann trank ich die Dose in einem Zug aus. Auf dem Tisch fand ich einen Schokokaramellriegel, den ich direkt hinterherfutterte.
Als ich mir danach über den klebrigen Mund wischte, war meine Wut verflogen. Ersetzt von dem Nebel, der sich wie Watte über mich legte und all meine Gefühle abschwächte. Seufzend schloss ich den Reißverschluss der Sporttasche, schlug den Spind zu und flüchtete durch die Tür nach draußen.
Kapitel 3
Rachel
Ich lehnte mich auf dem Sitz zurück, nippte an meinem Tomatensaft und blickte aus dem kleinen Flugzeugfenster. Wir befanden uns im Landeanflug auf St. John. Unter mir war nichts als Grün. Dicht bewaldete Hügel, so weit das Auge reichte, hier und da durchzogen von einzelnen Straßen mit sehr wenigen Häusern und einem Fluss, der sich als glitzerndes Band durch die Landschaft zog. Die Landebahn lag mitten im Nirgendwo. Fast erwartete ich, einen Elch oder Grizzlybären zwischen den Bäumen hervortreten zu sehen.
Ich zog die Beine an und schlang die Arme darum. Mein Gurt schnitt mir in den Bauch, sodass ich ihn ein wenig lockerte. Ich trug bequeme Lederleggings und einen großmaschigen silbergrauen Strickpulli, der mir fast bis zu den Knien reichte. Darunter ein schwarzes Top. Meine silbernen Riemchensandalen hatte ich gegen Kuschelsocken getauscht, weil ich in Flugzeugen schnell fror.
Die Reise nach St. John war abenteuerlich gewesen. Anstatt den Flug auf den bequemen Ledersitzen der ersten Klasse wie von New York nach Toronto zu genießen, saß ich nun eingezwängt in einer kleinen klapprigen Maschine mit nur etwa zwanzig weiteren Fluggästen. Außerdem gab es keinen Direktflug zu dem winzigen Flughafen im Osten des Landes, weshalb ich über Ottawa geflogen und dort in den kleineren Flieger umgestiegen war.
Ich hatte gerade noch Zeit, einer vorbeieilenden Flugbegleiterin meinen leeren Plastikbecher zu reichen, da rumpelte und holperte es auch schon so heftig, dass ich fast mit dem Kopf an die niedrige Decke gestoßen wäre. Ein paar weitere Hüpfer später hatten wir es geschafft. Nun hoppelte der kleine Flieger über die Landebahn, die auf beiden Seiten von einer saftig grünen Wiese umgeben war. Unwillkürlich veranstaltete mein Magen eine Konfettiparty. Es sah aus, als wäre ich in eine Landschafts-Doku oder den Anfang eines Abenteuerfilms geraten. Noch nie war ich so fernab jeglicher Zivilisation gewesen. Doch irgendwie war es genau das, was ich nach dem Desaster mit meinen Eltern gestern Abend brauchte.
Nach dem Aussteigen wurde ich gemeinsam mit den wenigen anderen Passagieren in das winzige Flughafengebäude gelotst. Bei keinem Flug hatte ich mein Gepäck nach einer Landung bisher so schnell wiedergefunden – denn es gab hier nur ein einziges Gepäckband. Ich hievte meinen Koffer herunter und verfluchte mich dafür, so viel eingepackt zu haben. Aber schließlich würde ich einen ganzen Monat bleiben, bevor mein Studium in New York im September begann. Frau brauchte eben gewisse Dinge, um zu überleben. Ich konnte nicht ohne meinen heiß geliebten Lockenstab, verschiedene Lipgloss- und Lippenstiftfarben, alle meine Lieblingsoutfits und mehrere Paar Schuhe sein.
Vor mich hin grummelnd zerrte ich das Monstrum von einem Koffer hinter mir her in Richtung der Doppeltüren, die zum Glück automatisch aufschwangen.
Als ich aufblickte, entdeckte ich Marly sofort im Wartebereich. Sie war nicht zu übersehen. Ihre schwarzen Locken wippten, während sie aufgeregt auf und ab hüpfte und ein Schild über dem Kopf schwang. Darauf stand in riesigen bunten Lettern: Willkommen in St. Andrews, Rachel!
Augenblicklich verzogen sich meine Mundwinkel zu einem breiten Grinsen. Ich ließ den Koffer los, der scheppernd hinter mir zu Boden fiel, und rannte auf sie zu. Wir fielen uns laut quietschend in die Arme und verbrachten gefühlt mehrere Minuten damit, lachend herumzuhüpfen.
Schließlich schob Marly mich von sich, um mich eingehend zu betrachten. Ich stemmte die Hände in die Hüften und drehte mich einmal um mich selbst, als befände ich mich auf einem Laufsteg. »Gefällt dir, was du siehst?«
Sie grinste so breit, dass ihre weißen Zähne einen starken Kontrast zu ihrer rotbraunen Haut bildeten. »Du wirkst vielleicht nur ein klitzekleines bisschen fehl am Platz.« Mit dem Kinn deutete sie auf die anderen Fluggäste, die hinter mir durch die Türen kamen. Es handelte sich hauptsächlich um Leute mittleren Alters in Flanellhemden und praktischer Reisekleidung, die von ihren Familien abgeholt wurden.
»Tja, wenn das nicht so wäre, würde ich mir ernsthafte Sorgen machen.« Ich zwinkerte Marly zu, die sich lachend bei mir unterhakte.
»Du bist hier!« Meine beste Freundin aus Kindertagen strahlte über das ganze Gesicht, sodass sich ihre grauen Augen zu winzigen Schlitzen verzogen. »Ich kann es noch nicht ganz glauben. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?«
Ich schürzte die Lippen. »Hm. Das war, kurz bevor ich nach New York und du zu deinem Roadtrip aufgebrochen bist. Ende Mai?«
Marly runzelte erschrocken die Stirn. »Das ist eindeutig zu lange her.«
»Eindeutig. Aber es ist ja nicht so, als hätten wir nicht mindestens dreimal die Woche telefoniert.«
Sie wollte mich mit sich in Richtung Ausgang ziehen, doch ich drehte mich noch einmal um. »Warte kurz, ich hole noch meinen Koffer.«
Marly lachte. »Wie hatte ich glauben können, du wärst nur mit einer Handtasche angereist?«
In gespieltem Entsetzen griff ich mir an die Brust. »Undenkbar!«
Kurz darauf folgte ich Marly zum Ausgang. »Erzähl, wie lief es gestern mit deinen Eltern?«, fragte sie mit besorgter Miene. Sie wusste, dass die meisten Zusammentreffen mit mir und meinen Erzeugern bestenfalls frostig und schlimmstenfalls explosiv ausfielen.
Ich verdrehte die Augen. »Du wirst mir nicht glauben, was sie diesmal für eine Shitshow abgezogen haben.«
Marly sah mich halb gespannt, halb entsetzt an. »Schlimmer als das eine Mal, als sie dir verboten haben, zu dem Billie-Eilish-Konzert zu gehen und ich dich durch den Dienstboteneingang eurer Wohnung rausschleusen musste?«
»Ich glaube, ich hatte noch nie so lange Hausarrest wie nach dieser Aktion«, gluckste ich. »Aber nein, diesmal ist es tatsächlich schlimmer.«
Marlys Augen weiteten sich. »Erzähl schon!«
Meine Kehle war plötzlich wie zugeschnürt, und ich schluckte ärgerlich. Der Abend hatte noch eine weitere böse Überraschung für mich bereitgehalten. Das Ganze ging mir tatsächlich näher als gedacht. Näher, als ich es mir bis zu Marlys Frage eingestanden hatte. Doch das hätte ich nie offen zugegeben, denn mein Motto war: aufstehen, Krönchen richten und weitermachen.
»Sie haben mir den Geldhahn zugedreht.« Meine Stimme klang leiser als sonst, ich hauchte die Worte eher, als dass ich sie aussprach.
Marly blieb so abrupt stehen, dass ein älteres Pärchen, das hinter uns kam, beinahe in uns hineingelaufen wäre. Sie entschuldigte sich und zog mich zu ein paar Sitzen in einer Ecke der Ankunftshalle. »Was hast du gerade gesagt?«
Ich seufzte. Natürlich machte sie ein Riesending daraus, während ich die Sache einfach nur vergessen wollte. »Sie haben mich gestern Abend in ein Edelrestaurant eingeladen, um mir dort die Dekanin der Jurafakultät der University of Toronto vorzustellen. Ich hatte keine Ahnung. Sie haben mich einfach so vor vollendete Tatsachen gestellt.«
Marly zog die Brauen vor Verwirrung zusammen. »Aber dein Semester an der NYU beginnt doch im September.«
»Genau! Wer hätte denn erwartet, dass sie jetzt noch versuchen würden, mich zum Bleiben zu zwingen?«
Marly hob eine Augenbraue, ihre Mundwinkel zuckten. »Wer hätte es erwartet?« Sie sah mich zweifelnd an.
Ich warf die Arme in die Luft, sodass meine Armbänder klirrten. »Okay, okay, wir sprechen hier von meinen Eltern. Ich hätte es vorhersehen müssen.«
»Und wie hast du reagiert?«, fragte Marly nun mit unheilschwangerem Tonfall.
»Du hättest mich sehen sollen! Ich bin total ruhig geblieben und habe mich bei der Dekanin und ihrem Mann dafür entschuldigt, dass meine Eltern sie umsonst herbestellt haben.«
Marly lachte. »Genial!«
»Dann habe ich erklärt, dass ich auf gar keinen Fall in Toronto studieren werde, weil ich an der NYU angenommen wurde und sowieso nach New York ziehen werde, weil ich schon eine Wohnung gekauft habe, und dann bin ich einfach gegangen. Stell es dir bildlich vor, Marly! Ich habe mich umgedreht und bin davonstolziert, so richtig Samantha-Jones-mäßig. Vielleicht hätte ich meiner Mom vorher noch ihren Drink ins Gesicht schütten sollen.«
Marly starrte mich mit offenem Mund an.
»Ziemlich cool, ich weiß. War so eine Art Kurzschlussreaktion. Ich war einfach so wütend auf sie und …«
»Du hast was gekauft?«, unterbrach sie mich mit schriller Stimme. Einen Moment sah ich sie verblüfft an. Ihre Reaktion erinnerte mich so sehr an die meiner Mutter, dass ich laut losprustete. »So ähnlich hat Mom auch reagiert. Etwa mit demselben Gesichtsausdruck.«
Marly verschränkte die Arme vor der Brust. »Rachel Montgomery, du hast dir eine Wohnung gekauft und mir nichts davon erzählt?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ist noch ganz frisch. Den Vertrag habe ich an meinem letzten Tag in New York unterschrieben, also vorgestern. Vorher hatte ich mir schon ein paar Bleiben in Manhattan angeschaut, aber die war es. Ich musste sofort zuschlagen. Sie ist einfach atemberaubend, Marly. Ich zeig dir nachher Fotos.«
Marlys Miene hellte sich auf, aber sie nahm die Arme noch nicht herunter. »Und ich nehme an, das hat deinen Eltern gar nicht gefallen?«
»Ganz und gar nicht.« Ich lächelte selbstzufrieden, viel selbstzufriedener, als ich mich fühlte. »Zum Glück war ich so geistesgegenwärtig, die Wohnung zu kaufen und nicht zu mieten. Meine Eltern haben mir nach meinem Abgang gestern Abend nämlich verkündet, dass sie mir jetzt endgültig den Geldhahn zudrehen. Per SMS. Ich habe in einem Hotel übernachtet, weil ich nicht nach Hause wollte, um mir noch mehr Vorwürfe von ihnen anzuhören.«
»Oh, Rach.« Marly zog mich in eine feste Umarmung. Als ich mein Gesicht in ihre weichen schwarzen Locken drückte und ihren vertrauten Duft einatmete, kratzte meine Kehle auf einmal verräterisch. Ich blinzelte mehrmals, während ich versuchte, meinen Körper wieder unter Kontrolle zu bekommen. Verdammt! Ich weinte nicht. Niemals. Ich richtete mein Krönchen und …
Hastig atmete ich mehrmals tief durch. Nachdem ich mich wieder gesammelt hatte, zuckte ich leichtfertig mit den Schultern. »Wenigstens habe ich jetzt, da sie mich auf die Straße setzen, ein Dach über dem Kopf.«
Ich spürte, wie Marly an meinem Hals lächelte. »Aber, Rach, du wirst nie auf der Straße sitzen. Du weißt doch, dass du immer zu mir kommen kannst. Zur Not würden dich auch meine Großeltern in Toronto aufnehmen.«
»Tja, aber das wird nicht nötig sein«, trällerte ich eine Spur zu fröhlich. »Schließlich bin ich jetzt stolze Immobilienbesitzerin.«
Marly löste sich von mir und sah zu mir auf. Nur wenn ich wie heute meine höchsten Absätze trug, war ich größer als sie. »Und was ist mit all den Nebenkosten der Wohnung, Studiengebühren, Essen, Trinken und so weiter?«
»Ich werde mir einen Job suchen. Ist ja nicht so, als hätte ich plötzlich gar kein Geld mehr. Das, was ich schon auf dem Konto habe, können meine Eltern nicht anrühren. Sie haben nur den Zugang zu meinem Trust Fund eingefroren.«
»Und dein Sommerpraktikum in der Kanzlei war auch bezahlt, oder?«
Ich nickte. »Mach dir um mich keine Sorgen.«
Sie lächelte, sah allerdings nur mäßig überzeugt aus. »Ich weiß nur, dass du dir in den letzten Jahren einen ziemlich teuren Lebensstil angeeignet hast.«
»Ja, ich werde ein bisschen kürzertreten müssen. Gut, dass ich mir gerade letzte Woche erst einen riesigen Vorrat Oreos angelegt habe, was?« Mit meinem halbherzigen Versuch, einen Witz zu reißen, traf ich ins Schwarze.
Marly lachte und drückte noch einmal meinen Arm. »Wow, das sind riesige News, Rach. Muss ich erst mal verarbeiten.«
»Frag mich mal.« Ich hakte mich bei ihr unter, und wir gingen gemeinsam nach draußen.
Als wir aus der klimatisierten Luft der Eingangshalle ins Freie traten, keuchte ich überrascht auf. Es war warm, fast schon heiß. Doch es war eine ganz andere Hitze als in Toronto oder New York. Hier, wo ich nicht von Asphalt und Wolkenkratzern eingeschlossen wurde, war es wirklich erträglich. Ich zog mir den Wollpulli über den Kopf, sodass meine Haare kurz elektrisch knisterten und mir wahrscheinlich vom Kopf abstanden. Mein Top wurde von einer sanften Brise bewegt, und die Anhänger der Ketten um meinen Hals klirrten leise aneinander. Ich atmete tief durch, genoss die frische Luft und die Stille. Selbst hier vor dem Flughafen gab es keinen Verkehrs- oder Baustellenlärm, kein ungeduldiges Hupen und keine lauten Beleidigungen aus heruntergelassenen Scheiben. Das war also diese Idylle, von der immer alle sprachen.
»Brauchst du Hilfe mit deinem Koffer?«, fragte Marly. »Grandpas Auto steht gleich da drüben.« Sie winkte einem Typen, der an dem alten Chevrolet ihres Grandpas lehnte.
»Ach, geht schon.« Meine Absätze klickten laut auf dem Bürgersteig, als ich loslief und den Koffer hinter mir herzog. »Ich will deinen armen Jack ja nicht gleich mit diesem Monstrum in die Flucht schlagen. Außerdem: Selbst ist die Frau.«
Marly verdrehte die Augen. »Ich weiß nicht, wie oft ich dir das schon gesagt habe, aber es ist okay, sich helfen zu lassen, Rach. Ab und zu brauchen wir alle mal etwas Unterstützung.«
»Ach, Quatsch. Ich nicht.« Ich knuffte sie in die Seite und wollte schon etwas erwidern, doch da fiel mein Blick auf den Mann, der nun auf uns zueilte. Ich blieb abrupt stehen. Er trug tief hängende Jeans und ein enges, graues T-Shirt, unter dem seine Brust- und Armmuskeln perfekt zur Geltung kamen. Die Sonne brachte seine umbrabraune Haut zum Glänzen. Sein Lächeln war breit und strahlend. Hatte ich schon jemals so schöne Lippen gesehen?
»Das ist Jack?«, platzte es aus mir heraus. »Du hast nie erwähnt, dass er so heiß ist!«
Verblüfft sah Marly erst mich und dann den Typen an. Oder sollte ich eher sagen, den feuchten Traum einer jeden an Männern interessierten Person?
»Nein, das ist nicht Jack.« Marly riss mich aus meiner Starre. »Das ist Blake. Jack hatte einen Notfall auf der Insel und konnte nicht mitkommen. Blake ist netterweise eingesprungen.«
Ich schluckte meine Verwirrung herunter und ignorierte die Hitze, die mir in die Wangen stieg, als besagter feuchter Traum vor uns stehen blieb.
»Hi, ich bin Blake«, sagte er mit tiefer, rauer Stimme, und plötzlich nahm der Sommer in St. Andrews in meiner Vorstellung eine ganz neue Gestalt an.
Kapitel 4
Blake
Ich blickte in Augen, die wie flüssiger Bernstein wirkten, und wusste plötzlich nicht mehr, wie man einen zusammenhängenden Satz formulierte.
Das war Marlys Freundin Rachel? Niemand hatte mir gesagt, wie heiß sie war.
Ich hielt mitten in der Bewegung inne und strich mir verwirrt über die kurzen Stoppeln meines Buzz Cuts.
Reiß dich zusammen!
Mein Gehirn war immer noch wie leer gefegt. Lag es an ihren langen braunen Haaren mit den dezenten Highlights, den beerenfarbenen, leicht geöffneten Lippen oder daran, dass sie mich musterte, als wollte sie mich hier und jetzt mit Blicken ausziehen? Vielleicht war es das Zusammenspiel von alldem.
Wenn du das jetzt nicht vermasselst, kannst du demnächst vielleicht mal wieder ein bisschen Spaß haben.
Ich erinnerte mich, dass Rachel einen ganzen Monat bleiben würde. Ziemlich viel Spaß, verbesserte ich mich in Gedanken.
Endlich hatte ich meine Fassung wiedererlangt und setzte mein Schlafzimmerlächeln auf. »Hi, ich bin Blake.«
»Rachel.« Sie reichte mir eine manikürte Hand, an deren Fingern mehrere dünne Goldringe funkelten. Ich drückte sie, ohne unseren Augenkontakt zu unterbrechen.
Rachel beugte sich so dicht zu mir vor, dass ich ihren frischen Duft nach Orangenblüten und Jasmin riechen konnte. So verharrten wir eine Weile, ihre Hand in meiner, während sich unser Atem mischte und wir uns tief in die Augen sahen. Wenn ich eben noch sprachlos gewesen war, war ich jetzt geradezu bezaubert.
»Sehen etwa alle Männer in St. Andrews aus wie du?«, raunte Rachel, während ein sexy Lächeln ihre Mundwinkel umspielte.
Mein Herz trommelte gegen meine Rippen, mein Grinsen wurde breiter, siegessicherer. »Ich würde sagen, ich bin das Vorzeigeexemplar.«
Rachels Augen funkelten – herausfordernd und verwegen. Es war, als stünden wir abgeschirmt vom Rest der Welt. Da waren nur sie und ich, ihre Augen, ihre Lippen, ihr Duft. Ja, es würde definitiv ein guter Monat werden.
»Warum hat mir das denn vorher keiner gesagt?« Ihr Lächeln wurde breiter, verheißungsvoller. Ich hatte sie genau da, wo ich sie haben wollte. Wie hatte sich dieser Tag so schnell in einen verdammten Glückstag verwandelt?
Ich zögerte den Moment genüsslich hinaus, bevor ich ihr eine volle Dosis meines unwiderstehlichen Charmes gab. »Und warum hat mir keiner gesagt, dass ich heute einen Engel vom Flughafen abholen würde?«
Rachel blinzelte mehrmals. Volltreffer! Dieser Spruch hatte schon immer funktioniert. »Kann ich dir deinen Koffer abnehmen, Babe?«, fragte ich mit meinem gewinnendsten Lächeln.
Im selben Moment verdüsterte sich Rachels Miene, und eine steile Falte zeigte sich zwischen ihren Augenbrauen.
Kapitel 5
Rachel
»Und warum hat mir keiner gesagt, dass ich heute einen Engel vom Flughafen abholen würde?«
Ich wurde jäh aus meiner Betrachtung der beiden Grübchen gerissen, die sich an Blakes Mundwinkeln zeigten, wenn er lächelte. Verdutzt blinzelte ich ihn an.
Hatte der Kerl gerade wirklich den schlechtesten Anmachspruch aller Zeiten losgelassen? Bis eben hatten wir diese unglaubliche Chemie zwischen uns gehabt. Ich sah uns bereits schwitzend und keuchend in seinem Bett. Seine Haut an meiner, seine Finger in meinen Haaren, zwischen meinen Beinen … Er hätte mir genauso gut einen Eimer Eiswasser über den Kopf schütten können. Seine Stimme war tief und leicht rau, was etwas in mir zum Klingen brachte, doch seine Worte standen in krassem Kontrast dazu.
Gerade wollte ich den Mund öffnen, um ihm eine passende Antwort zu geben, doch da sprach er schon weiter. »Kann ich dir deinen Koffer abnehmen, Babe?«
Bitte was? Damit törnte er mich endgültig ab. Nun stellte ich mir nicht mehr vor, wie wir uns auf seinen Laken rekelten, sondern wie ich ihm eine schallende Ohrfeige verpasste. Wenn ich eins nicht leiden konnte, dann war es, wenn Leute sich verstellten. Und dieser Aufreißerspruch war das Falscheste, was ich seit Langem gehört hatte. Ganz zu schweigen davon, dass Blake den Macho spielte und davon ausging, dass ich nicht allein mit meinem Koffer zurechtkam.
Schade. Ich stand zwar auf keinen bestimmten Typ Mann oder Frau, doch Blake strahlte diese lässige, selbstbewusste Aura aus, die ich besonders sexy fand. Und diese Grübchen …
Doch jetzt würde ich allein aus Prinzip nichts mit ihm anfangen, um ihm nicht die Genugtuung zu verschaffen. Hatte dieser Spruch etwa schon mal bei irgendeiner Frau funktioniert? Ich durfte ihn auf keinen Fall in dem Glauben lassen, dass sein plumper Flirtversuch bei mir ankam. Das war ich allen Frauen dieser Welt schuldig.
»Ach, komm schon«, sagte ich. »Das kannst du doch bestimmt besser.«
Blake starrte mich kurz verwirrt an, dann schlich sich das selbstsichere Grinsen wieder auf sein Gesicht. »Alles, was du willst, Prinzessin. Was soll ich besser machen?«
Ich schnaubte. »Dir fällt echt nichts Schlagfertigeres ein? Wie wär’s denn mit: ›Hat es wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist?‹ Oder: ›Du musst der Grund für die globale Erderwärmung sein‹?«
Blakes Lächeln gefror ihm auf dem Gesicht. Ich verkniff es mir, seine Grübchen anzusehen. Oder seine tiefbraunen Augen. Oder die dichten Wimpern. Die vollen Lippen.
Marly musste meinen schneidenden Tonfall mitbekommen haben, denn sie räusperte sich hinter mir. »Okay, ihr habt euch einander vorgestellt, damit wäre das also abgehakt. Blake reißt gerne semilustige Sprüche, und Rachel hat einen beißend sarkastischen Humor. Jetzt kennt ihr euch, und wir können endlich losfahren.«
Unbemerkt hatte sie meinen Koffer an Blake und mir vorbeigeschoben und war bereits dabei, ihn in den Kofferraum zu hieven. Blake sah mich noch einen Wimpernschlag länger an, dann fuhr er zu Marly herum. »Lass mich das doch machen.«
Natürlich … wie sollte es auch möglich sein, dass eine Frau ganz allein ein Gepäckstück anhob? Eine Schande! Ein Skandal!
Marly hatte es bereits geschafft, den gigantischen Koffer in dem begrenzten Stauraum unterzubringen. Ganz ohne männliche Hilfe.
»Danke, Marly«, sagte ich zu ihr, sah dabei allerdings demonstrativ Blake an. Ich ging an ihm vorbei zum Auto, während mir sein Blick folgte. Blake gefiel, was er sah. Das war offensichtlich. Ich konnte nicht leugnen, dass ich mich körperlich ebenso zu ihm hingezogen fühlte, aber das musste er ja nicht erfahren.
»Wollt ihr beiden hinten sitzen?« Er beeilte sich, die Tür für mich zu öffnen, wollte plötzlich den perfekten Gentleman geben, nachdem sein Macho-Alter-Ego abgeblitzt war. »Dann könnt ihr euch in Ruhe unterhalten.«
Ende der Leseprobe