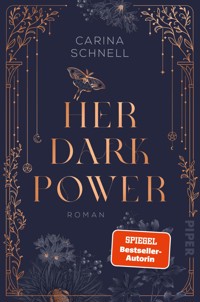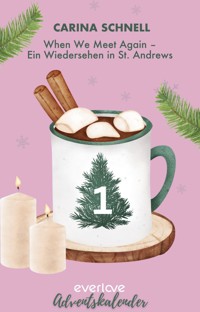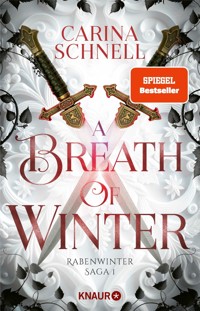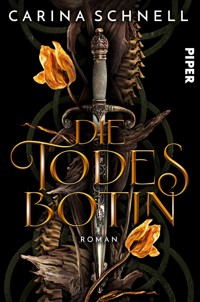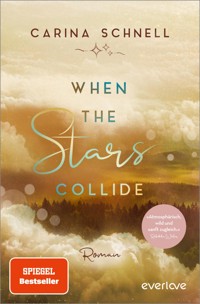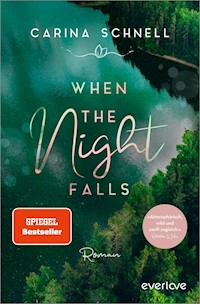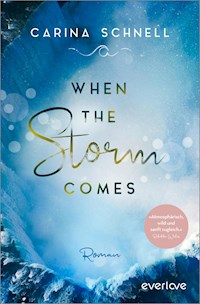
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Weite Kanadas und ein kleines Küstenstädtchen – zwischen Tierarztpraxis, Ausflügen in die Natur und Lagerfeuerabenden sprühen in dieser New-Adult-Romance die Funken! »Liebenswerte Charaktere und ein bezauberndes Kleinstadtsetting. Perfekt für einen kuscheligen Abend auf der Couch!« SPIEGEL-Bestsellerautorin Lilly Lucas Auf ihrem Roadtrip durch Kanada strandet Marly nach einer Panne im verschlafenen Küstenort St. Andrews. Um ihr Reisebudget aufzustocken, hilft sie in der Tierarztpraxis aus. Dort trifft sie den attraktiven, wortkargen Jack mit den seegrünen Augen und dem süßen Golden Retriever. Zunächst hält er wenig von der quirligen Großstädterin, aber als die beiden während eines Sturms in einer entlegenen Hütte festsitzen, sprühen nicht mehr nur die Gewitterfunken. Wäre da nicht Marlys Vergangenheit, die sie an diesem idyllischen Ort mehr denn je einzuholen droht, könnte sie fast für immer bleiben ... »Eine ganz besondere Geschichte – leicht, beflügelnd und eine wohlige Wärme im Herzen auslösend. Einfach perfekt!« Berenikes Bücherhimmel »Für alle, die bereit sind, ihr Herz in und an Kanada zu verlieren.« Justine Pust »Eine herzerwärmende Liebesgeschichte, die Mut macht, sich dem Sturm des Lebens hinzugeben und in eigenem Licht zu erstrahlen.« @elenaannamayr Band 1 der Sommer-in-Kanada-Reihe Carina Schnell schreibt am liebsten Geschichten mit einer ordentlichen Prise Romantik. Die Autorin und Übersetzerin hat selbst eine Weile im wunderschönen Kanada gelebt. Ihr Aufenthalt hat sie zu ihrer Sommer-in-Kanada-Reihe inspiriert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.everlove-verlag.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »When the Storm Comes« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© everlove, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2022
Redaktion: Kerstin von Dobschütz
Sensitivity Reading: Nora Bendzko
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Coverabbildung: FAVORITBUERO, München und Shutterstock.com
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Hinweis
Widmung
Kapitel 1
Marly
Kapitel 2
Jack
Kapitel 3
Marly
Kapitel 4
Marly
Kapitel 5
Jack
Kapitel 6
Marly
Kapitel 7
Jack
Kapitel 8
Marly
Kapitel 9
Jack
Kapitel 10
Marly
Kapitel 11
Marly
Kapitel 12
Jack
Kapitel 13
Marly
Kapitel 14
Jack
Kapitel 15
Marly
Kapitel 16
Marly
Kapitel 17
Marly
Kapitel 18
Jack
Kapitel 19
Marly
Kapitel 20
Marly
Kapitel 21
Marly
Kapitel 22
Jack
Kapitel 23
Marly
Kapitel 24
Marly
Kapitel 25
Jack
Kapitel 26
Marly
Kapitel 27
Marly
Kapitel 28
Jack
Kapitel 29
Marly
Kapitel 30
Jack
Kapitel 31
Marly
Kapitel 32
Jack
Kapitel 33
Marly
Kapitel 34
Marly
Kapitel 35
Marly
Kapitel 36
Jack
Kapitel 37
Marly
Kapitel 38
Jack
Kapitel 39
Marly
Kapitel 40
Jack
Kapitel 41
Marly
Danksagung
Triggerwarnung
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Liebe Leser*innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Um euch das bestmögliche Leseerlebnis zu ermöglichen, findet ihr deshalb am Buchende eine Triggerwarnung[1].
Carina Schnell und das everlove-Team
Für alle, die auf der Suche sind
Kapitel 1
Marly
»Fuck!« Ich riss das Lenkrad herum und trat auf die Bremse, um nicht in die Leitplanke zu krachen. Holpernd kam der uralte Chevrolet meines Großvaters zum Stehen. Dunkler Rauch drang aus der Motorhaube, der Grund, warum ich so abrupt angehalten hatte. Nun stand ich fluchend am Straßenrand, kurz vor dem mich freundlich begrüßenden Ortsschild: St. Andrews by-the-Sea. Est. 1783.
Hastig schaltete ich den Motor aus, schnallte mich ab und sprang aus dem roten Wagen. Der Rauch war eindeutig kein gutes Zeichen. Wenn mir die alte Karre gleich um die Ohren flog, wollte ich lieber nicht mehr drinsitzen.
Zögernd näherte ich mich der Motorhaube, aus der es munter qualmte, blieb dann aber abrupt stehen. Sollte ich sie öffnen? Oder mich lieber so schnell wie möglich in Sicherheit bringen? Aber wem machte ich schon etwas vor? Selbst wenn ich einen Blick in den Motor warf, würde ich nie erkennen, was da nicht stimmte. Ich hatte keine Ahnung von Autos.
Frustriert trat ich gegen einen Stein am Boden, der in hohem Bogen durch die Luft flog und klirrend auf die Leitplanke traf. Das hatte mir gerade noch gefehlt. Auf diesem Roadtrip war bisher so ziemlich alles schiefgelaufen, was hätte schiefgehen können.
Ich raufte mir die dunklen Locken und holte dann mein Handy aus der Hosentasche. Grandpa hatte darauf bestanden, dass ich vor meinem Aufbruch die Notfallnummer der Canadian Automobile Association speicherte. »Nur für den Fall«, hatte er gesagt. Tja, dieser Fall war gerade eingetreten. Nachdem ich noch keine zweitausend Kilometer gefahren war.
Auf dem Sperrbildschirm wartete eine Nachricht von Rachel auf mich:
Denk an dich, Süße! Lass es krachen, das kannst du auch ohne mich. Freu mich auf alle versauten Details aus Montreal. Gleich Bewerbungsgespräch. Wünsch mir Glück.
XOXO
Ich musste lächeln, obwohl ich keine versauten Details zu berichten hatte. In Montreal, dem ersten Stopp auf meinem Roadtrip, hatte ich entgegen meinem Plan nur eine Nacht verbracht. Die Großstadt war zu laut, zu hektisch und viel zu überlaufen mit jungen Männern. Wenn ich das wollte, hätte ich auch in Toronto bleiben können. Und nun war ich hier, mitten im Nirgendwo. Ach nein, kurz vor St. Andrews by-the-Sea, einer Kleinstadt in New Brunswick.
Diese Gegend war zwar mein Ziel, und der Grund meiner Reise, aber die Autopanne hatte ich definitiv nicht eingeplant.
Ich seufzte, entsperrte mein Handy, tippte auf die Nummer der Pannenhilfe und bereitete mich innerlich auf das peinliche Gespräch vor, da ich absolut unfähig zu erklären war, wieso es aus dem Motor qualmte.
Eine halbe Stunde später tauchte ein Abschleppwagen auf, der schon bessere Tage gesehen hatte. Nachdem er rumpelnd zum Stehen gekommen war, stieg ein etwa sechzigjähriger Mann aus. Er schob sich die Baseballkappe aus der sonnengebräunten Stirn und bedachte mich mit einem misstrauischen Blick aus blaugrauen Augen. »Hey, ich bin Donald. Hast du den Abschleppdienst gerufen?«
Nein, ich stehe hier nur so zum Spaß neben einem qualmenden Auto, hätte ich fast geantwortet, bekam meine scharfe Zunge aber gerade noch rechtzeitig in den Griff. »Ja, es raucht aus dem Motor«, sagte ich stattdessen.
Während der Mann grummelnd die Motorhaube öffnete und sich darüberbeugte, ließ ich den Blick über die Straße schweifen. Es war Mitte Juni, die Büsche und Bäume blühten, ihr süßer Duft hüllte mich ein. Vom nicht weit entfernten Meer wehte eine sanfte Brise heran. Der Himmel war strahlend blau, einige Möwen zogen kreischend dahin. Idylle pur.
Ein dunkelblauer Pick-up-Truck näherte sich uns aus der Ferne. Als er nicht mehr weit weg war, erkannte ich, dass alle Scheiben heruntergelassen waren. Aus dem Beifahrerfenster schaute ein Golden Retriever mit hängender Zunge neugierig heraus. Ich musste unwillkürlich lachen. Es sah einfach zu komisch aus. Da traf mein Blick kurz den des jungen Mannes am Steuer. Seegrüne Augen, helle, sonnengebräunte Haut, ein energisches Kinn, vom Wind zerzauste, honigblonde Haare. Mein Herz machte einen unerwarteten Sprung. Im nächsten Moment war der Truck auch schon an mir vorbeigefahren, und ich starrte ihm verdutzt hinterher. Erst nachdem er um die nächste Kurve gebogen war, wandte ich mich ab.
Meine Reaktion auf den gut aussehenden Fremden versetzte mir einen Stich. Ich sah wieder Dans verletztes Gesicht vor mir. Die Tränen, die er wütend fortzublinzeln versuchte, die aber trotzdem glitzernde Spuren auf seiner goldbraunen Haut hinterließen. Sein Adamsapfel hüpfte auf und ab, als er schwer schluckte. Seine Worte hallten in meinem Kopf nach: »Es war nur eine Frage der Zeit …«
Ich schloss die Augen, atmete tief durch. Spürte Meersalz auf meinen Lippen, den Wind im Haar. Kam wieder im Hier und Jetzt an. »Es ist reine Zeitverschwendung, in der Vergangenheit zu leben«, murmelte ich. Das war ein Spruch, den mir meine Grandma von klein auf eingebläut hatte.
»Wie bitte?«, kam es von hinter der geöffneten Motorhaube.
»Ach, äh, nichts«, antwortete ich und stellte mich neben den Mechaniker – Donald. »Wie sieht’s denn aus?«
»Na ja …« Abermals schob er sich die Baseballkappe aus dem Gesicht. Er kratzte sich an der Schläfe und runzelte die Stirn. Das war eindeutig kein gutes Zeichen. »Wie’s aussieht, bist du schon länger mit defektem Kühler gefahren. Wasser ist ausgetreten, sodass der Motor nicht mehr richtig gekühlt werden konnte und sich überhitzt hat. Das wäre an sich ja noch nicht dramatisch, aber bei diesem alten Auto« – er tätschelte die Motorhaube beinahe zärtlich – »und aufgrund der Tatsache, dass das Problem lange unentdeckt blieb, stehst du kurz vor einem Motorschaden.« Ich starrte ihn fassungslos an. »Hast du kein Licht aufleuchten sehen? Irgendein Warnsignal?«
Ich schüttelte den Kopf. »Das Auto ist wirklich alt.«
»Ich weiß.« Erneut musterte er die Karre mit einem liebevollen Blick. »Ein Chevrolet Chevelle Malibu. Von 1976. Wirklich eine Schande.«
»Was?«
»Es würde sich kaum lohnen, ihn reparieren zu lassen.«
Meine Augen wurden groß. »Aber können Sie es nicht wenigstens versuchen? Ich komme aus Toronto. Irgendwie muss ich ja wieder zurück.« Von meinem nun abrupt beendeten Roadtrip ganz zu schweigen. Er sah mich zweifelnd an. »Der Wagen gehört meinem Grandpa«, fügte ich mit flehendem Blick hinzu.
Donald hob kapitulierend die ölverschmierten Hände. »Na schön, ich nehme ihn mal mit. Ich und meine Jungs in der Werkstatt sehen, was wir tun können. Aber das wird dauern. Wir steuern mitten auf die Hochsaison zu.« Ich sah ihn verständnislos an. »Hier in St. Andrews verdoppelt sich die Bevölkerung im Sommer«, erklärte er. »Dann kommen Scharen von Touristen und Leute, die hier eine Sommerresidenz haben. Das heißt, wir haben viel mehr zu tun als sonst.«
»Okay. Wie lange wird es ungefähr dauern?« Ich machte mich auf das Schlimmste gefasst.
»Mindestens zwei Wochen.«
Mein Herz sank. Am liebsten hätte ich gegen das nutzlose Auto getreten, aber dann hätte Donald mich wahrscheinlich gesteinigt. Ich fuhr mir durch die widerspenstigen Locken, verhedderte meine Finger wie immer darin und zog sie fluchend wieder heraus. »Na, dann … werde ich mir hier wohl eine Bleibe suchen müssen.«
Donald rückte seine Kappe zurecht und sah mich mitleidig an. »Ach ja, richtig, Hochsaison«, grummelte ich.
»Ich kenne da aber jemanden, der sicher noch ein Plätzchen für eine nette junge Dame aus Toronto frei hat.« Donald schenkte mir ein freundliches Lächeln, und ich erwiderte es dankbar.
Kurz darauf sah ich dabei zu, wie er den heiß geliebten Chevrolet meines Grandpas auf seinen Abschleppwagen lud. Und damit auch meine Pläne für den Sommer.
»Fuck«, wiederholte ich noch einmal, als ich neben Donald auf den Beifahrersitz kletterte und mich nach St. Andrews, meinem neuen Zuhause für mindestens zwei Wochen, fahren ließ.
Wir kamen an einem Golfplatz, einer Feuerwache, einem Tim Hortons und vereinzelten Häuschen mit gepflegten Vorgärten vorbei, bevor wir das Städtchen erreichten. Hin und wieder erhaschte ich zwischen Gebäuden und Bäumen hindurch einen Blick auf das glitzernde Meer. Ich musterte jedoch vor allem die holzverkleideten Wohnhäuser mit großen Gärten. Hatte sie hier mal irgendwo gewohnt? Befand sie sich vielleicht in diesem Moment hinter einem dieser Fenster? War sie hier einkaufen gegangen? Oder dort am Meer entlanggeschlendert?
Um mich von dem nervösen Kribbeln in meinem Magen abzulenken, kniff ich mir so fest in den Handrücken, dass meine Fingernägel einen Abdruck auf meiner rotbraunen Haut hinterließen. Es reichte schon, dass mein Herz immer schneller schlug, je näher wir dem Ortskern kamen.
Im Zentrum begrüßte uns eine bunte Häuserfront mit vielen Geschäften und Restaurants. Die einladenden roten, blauen und gelben Holzfassaden schienen einem Reisemagazin zu entstammen. Von mehreren Vordächern und Fahnenmasten wehte die kanadische Flagge.
»Willkommen in St. Andrews!« Donald sah so stolz aus, dass ich unwillkürlich grinsen musste. Das hier war wirklich ein schönes Fleckchen Erde. Fröhlich zeigte Donald auf verschiedene Gebäude und erklärte mir, wo es das beste Essen oder die schönsten Souvenirs gab. Natürlich konnte ich mir auf die Schnelle nichts davon merken, also nickte ich nur höflich.
»Da ist der Pier«, verkündete er. »Von dort aus kannst du zum Beispiel Whale-Watching-Touren machen. In ein paar Tagen ist die Saison wieder eröffnet.«
Ich starrte auf die breite Öffnung zwischen der Häuserfront, die einen atemberaubenden Blick auf das Meer und einen weit hinausführenden Holzsteg freigab. Mein Herz flatterte aufgeregt. Schon seit ich klein war, hatte ich eine stetig wachsende Liste mit Dingen, die ich in meinem Leben unbedingt tun wollte. Wale aus nächster Nähe zu beobachten stand darauf ziemlich weit oben.
Als Donald schließlich abbog und die Straße am Meer verließ, fiel mir auf, dass er absichtlich durchs Zentrum gefahren sein musste, um mir den Ortskern zu zeigen. Nun ging es wieder in die entgegengesetzte Richtung. Kurz darauf hielten wir vor einem Haus, das ich mit seinem schneeweißen Anstrich und spitzen Giebeldächern nur als typisches Bed and Breakfast bezeichnen konnte. »Cory Cottage«, verkündete Donald, als wäre er ein Busfahrer und dies die nächste Haltestelle.
Ich sah ihn skeptisch an. »Da soll ich wohnen?« Das würde ich mir selbst mit dem besten Nebenjob der Welt nicht leisten können.
Donald schob sich die Kappe aus der Stirn und kratzte sich hinter dem Ohr. Dabei hinterließ er einen schwarzen Schmierstreifen an seinem Hals. »Glaub mir, sie werden sich freuen, dich zu sehen.«
Zweifelnd blickte ich zu dem großen, weißen Haus, dann wieder zu Donald.
»Geh nur.« Er nickte mit dem Kopf in Richtung der dunkelgrün gestrichenen Tür. »Sag einfach, dass Donald Loiterman dich geschickt hat. Ich rufe später die Rezeption an, wenn ich dir mehr über dein Auto sagen kann.«
Ich nickte, schnappte mir meine Reisetasche vom Rücksitz und öffnete die Beifahrertür des Abschleppwagens. Bevor ich ausstieg, drehte ich mich noch einmal zu ihm um. »Danke, Donald. Sie haben mir echt das Leben gerettet.«
»Na, so würde ich es nicht nennen.« Er grinste breit. »Aber wir unterhalten uns noch mal, wenn du dein Zimmer gesehen hast.«
Ich fragte erst gar nicht nach, was seine Anspielung zu bedeuten hatte. Wenn wirklich bald so viele Touristen die Stadt fluteten, konnte ich froh sein, überhaupt eine Bleibe zu finden.
Donald schrieb sich meinen Namen auf, dann tippte er sich zum Abschied an die Mütze, und ich stieg aus. Zögernd trat ich durch die schneeweiße Gartentür und folgte dem gefliesten Steinweg durch einen ordentlich angelegten Vorgarten. Die Hausfassade war makellos weiß, die Fensterläden in demselben Dunkelgrün gehalten wie die Haustür. Rechts und links neben dem Eingang hingen zwei Laternen, die abends sicher einladendes Licht verströmten. Noch nie in meinem Leben hatte ich ein so elegantes Gebäude betreten.
Ich war eher löchrige Dächer, klapprige Türen und Stromausfälle gewohnt.
Es gab keine Klingel, und die Tür öffnete sich von selbst, als ich dagegendrückte. Dahinter wartete eine Farbexplosion auf mich. Die holzvertäfelten Wände des Eingangsbereichs waren in einem warmen Orangeton gehalten. Eine einladende Sitzecke mit blau gemusterter Couch und passenden Sesseln lud vor einem Kamin, auf dessen Sims eine Vase mit frischen Sommerblumen stand, zum Verweilen ein. Eine Treppe führte in die obere Etage.
»Willkommen im Cory Cottage«, flötete eine Stimme. »Ich bin Janet, wie kann ich Ihnen helfen?«
Ich war so erschlagen von all der ländlichen Eleganz und dem frischen Lavendelduft, dass ich einen Augenblick brauchte, um die Sprecherin ausfindig zu machen. Sie winkte mir fröhlich von ihrem Platz hinter der Rezeptionstheke rechts von mir zu.
Die Frau war wie das Cottage: elegant, wenn auch vielleicht eine Spur too much. Ich schätzte sie auf Mitte fünfzig. Ihre Nägel waren in Koralle lackiert, derselbe Farbton wie ihr Lippenstift. Sie trug eine geblümte Bluse und hatte sonnengebräunte Haut, wie anscheinend alle in dieser Stadt.
Ich schob mir eine vorwitzige schwarze Locke aus dem Gesicht und ging auf sie zu. Es war klar, dass Donald mich nur auf den Arm genommen hatte. Nicht in einer Million Jahren hätten sie in einem derart exklusiven Bed and Breakfast so kurz vor der Hauptsaison noch ein Zimmer für mich frei.
Als ich an die Rezeptionstheke trat, reichte Janet nur ein kurzer Blick in mein Gesicht, bevor sie fragte: »Schlechter Tag, Liebes?«
Ich nickte. Dann erinnerte ich mich an so etwas wie Manieren und setzte ein Lächeln auf. »Ich bin Marly Macpherson. Mein Auto ist kurz vor dem Ortseingang liegen geblieben, und Donald Loiterman hat gesagt, dass ich hier nach einem Zimmer fragen soll.«
»Ach, du liebe Güte!« Janet schürzte die Korallenlippen und hob die makellos gezupften Augenbrauen, sodass ihr blondierter Pony ihre Wimpern kitzelte. »Wie lange möchtest du denn bleiben, Liebes?«
Ich traute mich fast nicht, es laut auszusprechen. »Äh, mindestens zwei Wochen?« Es klang wie eine Frage.
»Oh, das ist ja fabelhaft, einfach wunderbar.«
»Ist es das?«
Sie nickte so heftig, dass ihre goldenen Ohrringe leise klirrten. »Dieses Cottage gehört meinem Mann Joseph und mir. Jeden Sommer kommt unsere Tochter zu Besuch, deshalb ist immer ein Zimmer für sie reserviert.« Ihr Gesicht fiel in sich zusammen. »Leider kann Liza dieses Jahr nicht kommen, weil sie eine Kreuzfahrt in den Bahamas macht.« Es war offensichtlich, wie nahe es Janet ging, dass ihre Tochter eine Liege am Pool, eisgekühlte Piña coladas und eine Außenkabine mit Blick aufs Meer dem Besuch bei ihren Eltern vorzog. Sie räusperte sich. »Du kannst gerne ihr Zimmer haben, Liebes, es steht sechs Wochen leer.«
»Sechs Wochen?« Ich hatte jetzt schon Mitleid mit der armen Liza, die jedes Jahr fast zwei Monate hier versauerte. St. Andrews war hübsch, keine Frage, aber was gab es in so einer Kleinstadt schon zu tun?
»Oder auch nur zwei«, fügte Janet eilig hinzu. »Ganz, wie du möchtest.«
»Und wie viel kostet das pro Nacht?«
Sie schenkte mir ein verschwörerisches Lächeln und beugte sich über die Theke zu mir vor, sodass ich einen unfreiwilligen Einblick in ihr faltiges Dekolleté bekam. »Da Donald dich geschickt hat und du armes Ding so einen schlechten Tag hattest, biete ich dir einen Sonderpreis an. Fünfundzwanzig Dollar pro Nacht.«
Fünfundzwanzig Dollar? Das war wirklich ein Spottpreis, wenn die Zimmer auch nur annähernd so schön eingerichtet waren wie der Empfangsbereich des Cottage. Aber da Janet und Joseph normalerweise gar kein Geld mit diesem Zimmer verdienten, war es wohl in Ordnung.
Ich rechnete schnell im Kopf durch. Bei vierzehn Nächten wären das dreihundertfünfzig Dollar. So viel gab mein Budget geradeso her. Ich hatte ursprünglich geplant, nur kurz in St. Andrews zu halten, auf meiner Reise stets in billigen Hostels unterzukommen und nur das Nötigste zu shoppen. Diesen Plan konnte ich nun zwangsläufig über den Haufen werfen. Nach den zwei Wochen hier würde mein Geld knapp werden, da ich ja noch zurück nach Toronto fahren musste und – nur, wenn ich Glück hatte – zuvor meinen Roadtrip fortsetzen wollte. Außerdem musste ich Benzin, Essen und Trinken sowie die Werkstattkosten bedenken, die ich noch überhaupt nicht abschätzen konnte.
Doch ich musste zugeben, dass ich mit Sicherheit kein besseres Angebot als dieses bekommen würde. Das Städtchen machte nicht den Eindruck, als würde es hier spottbillige Hostels für junge Leute geben. Es stand also fest: Ich würde mir für die nächsten zwei Wochen einen Job suchen müssen.
Widerwillig zückte ich meinen Geldbeutel. »Kann ich mit Kreditkarte zahlen?«
»Nur keine Eile, Liebes. Komm erst einmal richtig an. Es reicht, wenn du jetzt die ersten beiden Nächte bezahlst. Dann sehen wir weiter.«
Plötzlich war ich gerührt von der Freundlichkeit der Leute hier. Ich hatte erst zwei Einheimische getroffen, und beide hatten mir buchstäblich den Tag gerettet. In Toronto hätte ich nie so kurzfristig eine so billige Bleibe gefunden, die nicht kurz vor dem Abriss stand.
Ich nickte und schob fünfzig Dollar und meinen Führerschein über den Tresen, damit Janet meine Daten aufnehmen konnte.
»Setz dich doch einen Moment auf das Sofa, Liebes. Joseph wird gleich dein Gepäck hochtragen.«
Joseph stellte sich als ebenso braun gebrannter, netter älterer Herr heraus, der mich die Treppe hoch- und einen geschmackvoll dekorierten Flur entlangführte.
»Du bist wohl aus der Großstadt, was, junge Dame?«, fragte er mit einem vielsagenden Blick auf meine Nike Air Jordans.
»Ja, Toronto.«
»Und du möchtest hier ein bisschen Ruhe und Frieden genießen?« Seine Neugier verwandelte sich augenblicklich in Mitleid. Wahrscheinlich glaubten diese Kleinstadtmenschen, dass es in Metropolen keinerlei Rückzugsmöglichkeiten, dafür aber Lärm rund um die Uhr und hohe Kriminalitätsraten gab. Wo sie recht hatten …
»Ich wollte eigentlich einen Roadtrip mit meiner besten Freundin machen«, erklärte ich, um nicht schon wieder die Geschichte mit dem liegen gebliebenen Auto erzählen zu müssen. »Aber sie hatte spontan geschäftlich zu tun, also bin ich allein losgezogen.«
Nun hob Joseph die Augenbrauen, als wollte er sagen, dass ich als junge Frau lieber nicht ganz allein unterwegs sein sollte. Dabei erinnerte er mich sehr an meinen Grandpa, der mir genau dasselbe gesagt hatte.
»Da wären wir.« Joseph öffnete die Tür am Ende des Gangs und machte eine einladende Handbewegung. Er stellte meine Tasche auf dem Boden ab und verabschiedete sich höflich. »Einen schönen Aufenthalt in unserem Haus.«
»Danke, den werde ich sicher haben.«
Als ich die Tür hinter mir schloss, atmete ich hörbar aus. Ich brauchte dringend ein bisschen Zeit für mich, um alles zu verarbeiten. Doch als ich den Blick durch mein neues Zuhause für zwei Wochen schweifen ließ, blieb mir vor Staunen der Mund offen stehen.
Das Zimmer war zwar sehr klein – wahrscheinlich das kleinste, das sie hatten –, doch das tat seiner Schönheit keinen Abbruch. Es trug sogar noch zur Gemütlichkeit bei.
Das Bett aus dunklem Holz stand unter einer steilen Dachschräge, daneben ein kleiner Nachttisch mit einer alten Messinglampe. Die Tagesdecke war weiß und mit blauen Stickereien verziert. Es roch nach frischen Blumen, die in einer Vase neben dem Fernseher auf einer Kommode standen. Es gab einen Kleiderschrank aus demselben Holz wie Bett und Kommode und sogar einen kleinen Kühlschrank. Eine Tür führte ins angrenzende Badezimmer. Ich stieß sie auf und sah mich neugierig um. Meine grauen Augen blickten mir aus dem Spiegel über dem Waschbecken entgegen. Wie angewurzelt blieb ich stehen, als mein Blick auf die große, frei stehende Badewanne im Retrostil fiel, die den kleinen Raum dominierte. Beinahe wäre ich vor Freude auf und ab gehüpft. Im Haus meiner Großeltern gab es nur eine Dusche, die nach zwei Minuten kalt wurde. In den nächsten zwei Wochen würde ich baden, was das Zeug hielt.
Voller Tatendrang packte ich meine Tasche aus, hängte meine Klamotten in den Kleiderschrank und stellte meine beachtliche Sneaker-Sammlung ordentlich daneben auf. Zum Glück gab es in Grandpas Auto mehr als genug Platz für meine heiß geliebten Schuhe, denn davon konnte ich mich selbst auf Reisen nicht trennen.
Die Sonne fiel durch das kleine Dachfenster, und ich öffnete es. In der Ferne hörte ich das Meer rauschen und die Möwen kreischen. Sonst war da nichts als Stille. Der blaue Streifen am Horizont glitzerte einladend, die Wipfel der Bäume wiegten sich in der warmen Brise. Ich atmete tief durch, sog die salzige Luft ein.
Wider Willen musste ich zugeben, dass dies der perfekte Ort war, um zu stranden. Schließlich war ich aus einem bestimmten Grund in diese Richtung aufgebrochen und nicht etwa in die Rocky Mountains oder nach Vancouver gefahren. Allerdings war ich mir nach wie vor nicht sicher, was ich mir eigentlich von diesem Roadtrip erhoffte. Als ich den Blick abermals über die Bäume, die gepflegten Rasenflächen und den blau glitzernden Streifen am Horizont schweifen ließ, überkam mich wieder diese kribbelige Nervosität. Ich strich mit den Fingern über das Portemonnaie in meiner Hosentasche. Darin befand sich mein wertvollster Besitz. Das einzige Foto meiner Mom, das ich besaß. Eine vergilbte, zerknitterte Aufnahme von ihr und mir am Strand. Grandma hatte es mir vor vielen Jahren gegeben, und ich hatte es seitdem gehütet, als hinge mein Leben davon ab.
Sofort bildete sich der altbekannte Kloß in meinem Hals. Was, wenn ich umsonst hergekommen war? Was, wenn hier alle Spuren im Sand verliefen?
Rasch schüttelte ich den Kopf und versuchte, die aufwallende Traurigkeit zu vertreiben. Ich durfte mich jetzt nicht runterziehen lassen. Ja, es hatte sich einiges an Ballast angestaut, den ich nicht verarbeitet hatte. Oder nie verarbeiten würde? Aber nun, da ich hier zwei Wochen festsaß, würde ich in diesem idyllischen Städtchen vielleicht erst mal abschalten und neue Kraft tanken können, bevor ich darüber nachdachte, wie ich weiter vorgehen sollte.
Ich war hier. Der erste Schritt war getan. Ein Schritt, mit dem ich einem Teil meiner Vergangenheit näher kam, als ich es in den letzten siebzehn Jahren geschafft hatte.
Bevor Tränen fließen konnten, schloss ich das Fenster und wandte mich ab. Später gäbe es noch genug Zeit dafür, mich mit mir selbst und meinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Jetzt galt es erst einmal, ein Problem zu lösen, und darin war ich normalerweise wirklich gut. Ich musste mir einen Job suchen.
Ich ließ mich aufs Bett fallen und tauschte meine blendend weißen Nike Air Jordan 1 Milan gegen gemütlichere Air Max Infinity Sneakers in Schwarz und Hellrosa. Wer wusste schon, wie sauber die Straßen hier waren? Bei meinen geliebten Sneakers ging ich lieber auf Nummer sicher.
Wenige Augenblicke später war ich schon auf dem Weg in die Innenstadt.
Während ich durch die Straßen von St. Andrews schlenderte, war die Stille allgegenwärtig, was für mich völlig ungewohnt war. Kaum Verkehr, keine Sirenen, keine Streetcars. Ich kam nur an einigen Spaziergängern vorbei, die mich alle freundlich grüßten. Ein Lächeln zupfte an meinen Mundwinkeln. Die gute Laune der Kleinstädter war wirklich ansteckend. Irgendwo bellte ein Hund, in der Hecke am Straßenrand zwitscherten ein paar Vögel. Ab und an trug der Wind fernes Kinderlachen von einem Spielplatz an meine Ohren. Der Wind rauschte in den Baumkronen, und ich ertappte mich dabei, wie ich einen Moment stehen blieb und die Augen schloss, um alles auf mich wirken zu lassen. Eine Locke kitzelte meine Nasenspitze, meine Jeansjacke blähte sich leicht in der Brise.
Ja, es war die richtige Entscheidung gewesen hierherzukommen. Weg von der Hektik und dem Gestank der Großstadt. Aber vor allem von dem Lärm in meinem Kopf. Selbst wenn meine Suche hier in einer Sackgasse endete, würde ich wenigstens ein bisschen Urlaub machen können.
Es dauerte nicht lange, bis ich wieder in der Water Street, der Hauptstraße mit der bunten Häuserfront, ankam. Anscheinend war das hier der einzige Ort, an dem etwas los war. Es gab unzählige Restaurants, Souvenirläden und kleine Boutiquen. Ich schlenderte die Straße entlang und bestaunte die gepflegten Fassaden, den blitzsauberen Gehweg und die Straßenlaternen, die einem längst vergangenen Jahrhundert zu entspringen schienen.
Im Kopf machte ich mir eine Liste der Geschäfte und Restaurants, bei denen ich nach einer Aushilfsstelle fragen könnte. Doch als ich anfing, die Liste abzuklappern, hielt mein neu gefundener Tatendrang nicht lange an. Denn mit jedem Laden, in dem ich mich nach einem Job erkundigte, mit jedem Coffeeshop und jedem Restaurant verschlechterte sich meine Laune. Die Antwort war immer dieselbe: So kurz vor der Hochsaison waren alle Stellen vergeben. Und einige Blicke der Ladenbesitzer sagten mir, dass sie sowieso keine fremde Person eingestellt hätten. In so einer Kleinstadt kannten sich alle, eine Hand wusch die andere. Nur ich kannte niemanden.
Nach jeder weiteren Absage wünschte ich mir dringlicher, dass Rachel bei mir wäre. Mit ihren Überredungs- und Flirtkünsten hätte sie sicher irgendeinen Barkeeper beschwatzt, uns einen Job in einer hippen Bar mit besonders viel Trinkgeld zu geben.
Als schließlich die Sonne immer tiefer sank und ich in meiner dünnen Jeansjacke zu frösteln begann, war meine Laune am Tiefpunkt angekommen. Wie sollte ich für die Autoreparatur und meine Bleibe bezahlen, wenn es hier weit und breit keine Jobs gab?
Ich kaufte mir einen Hotdog und spazierte zum Pier. Ein breiter Holzsteg führte weit aufs Meer hinaus, doch das Wasser stand tief. Es musste Ebbe sein. Die alten Holzbohlen ächzten leise unter meinen Füßen. Ich setzte mich an den Rand des Stegs und ließ die Beine baumeln. Auf der anderen Seite lagen ein paar kleine Boote vor Anker, die sanft schaukelten. Die Takelage knarzte, die Wellen platschten leise gegen die Schiffsrümpfe. In der Ferne kreischten ein paar Möwen, sonst war alles still. Doch selbst diese friedliche Atmosphäre, die Abendsonne in meinem Gesicht und das Rauschen der Wellen konnten meine trübe Stimmung nicht vertreiben. Ich fühlte mich einsamer denn je. In diesem Moment wäre ich am liebsten sofort aus diesem Kaff verschwunden. Was hatte ich mir nur dabei gedacht, allein auf den Roadtrip aufzubrechen? Was erhoffte ich mir schon, hier zu erreichen? Das ganze Vorhaben kam mir mit einem Mal lächerlich vor.
Ich zückte mein Handy und antwortete auf Rachels letzte Nachricht:
Bin nicht mehr in Montreal, sondern in St. Andrews, der klischeehaftesten Kleinstadt aller Zeiten. Stecke mindestens zwei Wochen hier fest. Motorschaden. Später mehr. Wie lief das Bewerbungsgespräch? Telefonieren wir bald?
XOXO
Nachdem ich den Hotdog aufgegessen hatte, schlenderte ich zur Water Street zurück. Ich hatte kein Ziel. Mein Plan war königlich in die Hose gegangen. Ich ließ den Blick über die bunten Häuser und altmodischen Straßenlaternen schweifen und fragte mich einmal mehr, ob sie früher einmal diese Straße entlanggegangen war. Ob sie wohl in diesem Restaurant gegessen oder die bestickten Kissen in jenem Schaufenster bewundert hatte. Sofort bildete sich wieder der vermaledeite Kloß in meinem Hals.
»Fuck«, fluchte ich, zum gefühlt hundertsten Mal an diesem Tag. Ich schluckte und sah mich nach einer Ablenkung um.
Da fiel mein Blick auf den dunkelblauen Pick-up-Truck, der früher am Tag an mir vorbeigefahren war. Nun parkte er vor einem Souvenirshop namens The Whale Store. Der Hund, der zuvor so lustig aus dem Fenster geschaut hatte, sprang aufgeregt auf dem Bürgersteig herum. Versuchte er etwa, seinen eigenen Schwanz zu fangen?
Trotz meiner grimmigen Laune musste ich lächeln. Ich ging neben dem wunderschönen Golden Retriever in die Hocke, um sein glänzendes karamellfarbenes Fell zu streicheln.
»Hallo, mein Hübscher, wo ist denn dein Herrchen?« Ich erinnerte mich an seegrüne Augen und zerzaustes blondes Haar.
»Reggie!«, ertönte es gedämpft aus der offenen Ladentür hinter mir. Ich fuhr herum. Besagte grüne Augen musterten mich eingehend durch das Schaufenster. Ich erhob mich langsam und ließ den Blick dabei nicht von Reggies Herrchen.
Der Hund stürmte an mir vorbei und in den Laden hinein. Sein Besitzer tätschelte ihm den Kopf, ohne mich aus den Augen zu lassen. Er bohrte seinen Blick in meinen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, starrte nur zurück. War er wütend, weil ich seinen Hund einfach so gestreichelt hatte? Auf seinen hübschen Zügen zeigte sich keine Regung.
Plötzlich sprach ihn eine junge Frau von hinten an, und er drehte sich zu ihr um. Sie hatte langes schwarzes Haar und einen rötlich braunen Hautton, der meinem ähnelte. Mit einer vertrauten Geste legte sie ihm eine Hand auf den Arm. Ich seufzte. Natürlich war so ein gut aussehender Typ wie er vergeben.
Mir fiel auf, dass ich die Frau ziemlich unhöflich anstarrte, was unter anderem daran lag, dass ich nicht oft Leute mit einer ähnlichen Hautfarbe wie meiner sah. Peinlich berührt wandte ich mich ab und machte mich auf den Rückweg zum Cottage.
Die Rezeption war leer, was mir gerade recht kam. Nach dem langen Tag voller Pannen und Misserfolge hatte ich keine Lust, mich mit jemandem zu unterhalten. Ich sehnte mich nach einem heißen Bad und einem hoffentlich traumlosen Schlaf.
Kapitel 2
Jack
Ich stand hinter dem Schaufenster des Whale Stores und wartete auf Debbie. Gerade bediente sie eine junge Familie. Deren zwei Kinder tollten aufgeregt durch den Laden und blieben schließlich bei den Büchern hängen. Sie blätterten durch die typische Lektüre wie Anne of Green Gables und Winnie Puuh. Dann kamen sie zu den Geschichten von First-Nation-Autoren. Als sie nach dem Bilderbuch mit den vielen Tieren auf dem Cover griffen, lächelte ich. Thanks to the animals, eins von Maras Lieblingsbüchern.
»Das ist eine schöne Geschichte«, rief ich den beiden zu. »Meine Nichte ist in eurem Alter, und ich lese sie ihr oft vor.«
Die Kleinen sahen mich mit großen Augen an. Dann setzten sie sich auf den Boden und blätterten neugierig in dem Buch herum. Kurz darauf hatten sie alles um sich herum vergessen. Das kannte ich nur zu gut, da ich selbst oft zwischen den Seiten eines Buchs versank.
Immer noch lächelnd drehte ich mich wieder zur Fensterscheibe, um nach Reggie zu sehen, den ich im Auto gelassen hatte. Natürlich war er mal wieder aus dem offenen Fenster gesprungen und jagte auf dem Gehsteig fröhlich bellend seinem Schwanz hinterher. Ich konnte es ihm nicht verdenken. Das Wetter war herrlich. Endlich hatten wir die eisigen Temperaturen hinter uns gelassen, die hier in New Brunswick bis in den Mai anhalten konnten. Ich würde Reggie seinen Spaß lassen und durch die Scheibe ein Auge auf ihn haben. Er war zwar jung und übermütig, aber nicht gefährlich. In der Stadt bestand eine Leinenpflicht, aber um ehrlich zu sein, konnte Reggie nicht mal einer Fliege etwas zuleide tun. Nur Möwen, die waren eine ganz andere Geschichte. Ich grinste, als ich an seine letzte Begegnung mit einem Schwarm in der Nähe des Piers dachte. Er hatte den Vögeln und einigen Touristen einen gehörigen Schrecken eingejagt, als er wie ein Kugelblitz in sie hineingerannt war.
Das Lächeln erstarb auf meinen Lippen, als jemand über den Gehweg auf Reggie zusteuerte. Im Ernst? Es hatte keine fünf Minuten gedauert, bis sich jemand beschweren kam, weil er nicht angeleint war?
Ich erstarrte, als ich die junge Frau wiedererkannte, die mir früher am Tag am Straßenrand aufgefallen war. Den Rauch aus dem Motor hatte ich schon von Weitem gesehen und anhalten wollen, um meine Hilfe anzubieten. Allerdings hatte ich im Näherkommen Donalds Abschleppwagen entdeckt, sodass ich weitergefahren war.
Die Frau strich sich ein paar widerspenstige dunkle Locken aus dem Gesicht und ging neben Reggie in die Hocke. Er hörte sofort auf, seinen Schwanz zu jagen, legte den Kopf schief und blickte interessiert zu ihr auf. Als sie etwas zu ihm sagte und vorsichtig eine Hand ausstreckte, wäre ich am liebsten nach draußen gelaufen. Es war wirklich nicht in Ordnung, wenn Fremde – meistens Touristen – ständig anderer Leute Hunde betatschten, ohne vorher zu fragen. Kein Wunder, wenn sich die Tiere das nicht immer gefallen ließen.
Zu meiner Überraschung ließ Reggie die Frau gewähren. Er schmiegte sogar seinen Kopf an ihre Hand. Aber ich hatte den Mund schon geöffnet. Das Wort war heraus, bevor ich es zurückhalten konnte. »Reggie!«
Sein Kopf zuckte sofort in meine Richtung, er ließ die Frau stehen und raste durch die offene Tür in den Laden. Die beiden Kinder quietschten vor Vergnügen, als er an ihnen vorbeihuschte. Im nächsten Moment strich er schwanzwedelnd um meine Beine. Den Eltern schien der Hund im Laden allerdings weniger zu gefallen. Sie bezahlten schnell und scheuchten die Kleinen nach draußen.
Ich bekam das Ganze nur am Rande mit, denn die Frau hatte mich hinter der Scheibe entdeckt. Der Blick aus ihren sturmgrauen Augen lag auf mir, und ich konnte nicht anders, als ihn zu erwidern. Abwesend tätschelte ich Reggie, damit er sich beruhigte, ohne unseren Blickkontakt abzubrechen. Ich konnte mich nicht mehr regen, hatte das Gefühl, als würde die Zeit einen Moment stillstehen. Der Sturm in ihren Augen zog mich zu sich, verschlang mich und wirbelte mich hin und her, während ich wie angewurzelt dastand. Meine Verärgerung darüber, dass sie Reggie einfach so gestreichelt hatte, war verpufft.
Wer war sie? Ich hatte sie noch nie in St. Andrews gesehen, so viel war sicher. Eine Touristin? Möglich, auch wenn sie etwas früher als die anderen dran war. Vielleicht war sie nur auf der Durchreise. Vermutlich auf dem Weg nach Prince Edward Island, wie viele Leute, die hier durchkamen. Auf jeden Fall hatte sie es geschafft, dass ich alles um mich herum vergaß. Das schafften sonst nur Bücher. Oder Postkarten.
Als Debbie mich ansprach, musste sie eine Hand auf meinen Arm legen, damit ich sie wahrnahm.
»Sorry, Debbie, was hast du gesagt?« Ich drehte mich mit zerknirschtem Gesichtsausdruck zu ihr um.
Die Frau meines ältesten Freundes lächelte. Belustigung blitzte in ihren warmen braunen Augen auf, als sie einen wissenden Blick über meine Schulter warf. »Ich wollte mich nur noch mal für deine Hilfe bedanken. Nach dem Wasserrohrbruch drüben im Coffeeshop hätten wir es diese Woche ohne dich nicht geschafft, den Laden zu führen.«
»Überhaupt kein Problem.« Ich versuchte, meine Verlegenheit zu überspielen, indem ich mir über den Nacken rieb. »Ich springe immer gern ein, wenn es nötig ist.«
Sie nickte. »Das weiß ich.« Dann bückte sie sich und hob das Buch auf, das die beiden Kinder auf dem Boden liegen gelassen hatten. »Hier, nimm das mit. Für deine Mühen.«
Ich starrte sie an. »Was? Nein, das kann ich nicht annehmen. Ich möchte, wenn schon, dafür bezahlen.«
»Ich weiß, dass du es Mara gern vorliest, wenn du bei deiner Schwester bist, und habe gehört, wie du es den beiden Kindern empfohlen hast. Nimm es mit. Dann hast du es wenigstens bei dir, wenn Mara und Nelly dich das nächste Mal besuchen kommen.«
Unschlüssig streckte ich eine Hand nach dem Buch aus, das sie mir entgegenhielt. Auf dem Cover kuschelten sich viele Tiere an einen kleinen Jungen, um ihn warm zu halten, so wie ich gerne meine beiden Nichten knuddelte. »Danke, Debbie.«
Sie holte noch eine Retro-Postkarte von dem Ständer neben ihr und legte sie auf das Buch. »Ich weiß doch, wie gern du die hast.« Als ich protestieren wollte, schnitt sie mir mit einer Handbewegung das Wort ab. »Das ist das Mindeste, was ich dir als Dankeschön geben kann.«
Sie wandte sich um und ging wieder zum Tresen, gerade als die nächsten Kunden hereinkamen.
»Bestell Ed einen schönen Gruß«, rief ich ihr hinterher, und sie winkte lächelnd zum Abschied.
Ich drückte mir das Buch und die Postkarte an die Brust. Als ich mir vorstellte, wie Mara vor Vergnügen quietschen würde, wenn sie das nächste Mal zu mir kam, musste ich grinsen. Gedankenverloren strich ich Reggie über den Kopf, der brav neben mir Platz gemacht hatte.
»Wir müssen gleich los, Buddy, bevor die Flut einsetzt und wir nicht mehr auf die Insel kommen.« Schon wollte ich zur Tür gehen, da fiel mir die Frau vor dem Schaufenster wieder ein.
Als ich herumfuhr, war sie verschwunden. Keine Spur von grauen Augen, ungezähmten schwarzen Locken und diesem intensiven Blick. Sie hatte einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, den ich noch nicht recht deuten konnte.
Das Mädchen mit den Sturmaugen.
Kapitel 3
Marly
Als ich am nächsten Morgen den Frühstücksraum des Cottage betrat, erwartete mich ein riesiges Büfett.
Ich grüßte die anderen Gäste – ein Ehepaar mittleren Alters und ein Mann, der aufgrund seines The-North-Face-Outfits entweder Wanderer oder Vogelbeobachter sein musste – und nahm mir einen Teller.
Es gab Cornflakes, frisches Obst, Joghurt, verschiedene Brotsorten, Käse, Wurst, gebratenen Speck, Rührei und sogar selbst gemachten Porridge.
Ich lud meinen Teller voll und wollte mich gerade allein an einen Tisch setzen, da eilte Janet auf mich zu. »Guten Morgen, Liebes«, flötete sie. »Ich habe gehört, dass du gestern kein Glück bei der Jobsuche hattest.«
Ich hob die Augenbrauen. Woher wusste sie das? Die Antwort lag auf der Hand: Kleinstadt. Ich, die Newcomerin aus Toronto, war anscheinend Gesprächsthema Nummer eins.
»Darf ich?« Sie deutete auf den Stuhl mir gegenüber. Ich nickte zähneknirschend. Eigentlich wollte ich einfach nur in Ruhe mein Frühstück verspeisen und mich weiter in Selbstmitleid suhlen, denn meine Laune hatte sich seit gestern Abend nicht gebessert.
»Keine Sorge, Liebes, ich habe gute Neuigkeiten.« Sie lächelte so breit, dass mich ihre gebleachten Zähne beinahe blendeten. »Linda, Dr. Sues Rezeptionistin, hat sich gestern Abend ein Bein gebrochen, und jetzt sucht Sue dringend Ersatz.«
Das nannte sie gute Neuigkeiten? Ich bemühte mich, nicht allzu verwundert auszusehen. »Wer ist Dr. Sue?«
»Ach ja, natürlich, entschuldige.« Janet kicherte. »Dr. Sue ist die einzige Tierärztin in der Stadt und eine verdammt gute noch dazu. Eine ganz wunderbare Frau, wenn du mich fragst. Sie hat unseren Timmy behandelt, als er noch am Leben war.«
Traurig seufzend deutete sie auf ein gerahmtes Foto an der Wand, auf dem ein Jack Russel Terrier in die Kamera hechelte. »Hat alles für den armen Kleinen getan, aber am Ende hat nichts geholfen.«
Ich räusperte mich hastig, bevor sie noch in Tränen ausbrach. »Ich habe früher mal ehrenamtlich im Tierheim ausgeholfen. Allerdings habe ich keine Erfahrung mit Arztpraxen«, sagte ich nachdenklich. »Aber einen Versuch ist es wert. Wo finde ich Dr. Sue?«
Janet nannte mir die Adresse. »Sag einfach, dass ich dich geschickt habe, dann weiß Sue Bescheid.« Sie lächelte mir zu und wollte schon aufstehen. »Ach ja, bevor ich es vergesse. Donald hat gestern Abend angerufen.«
Ich horchte auf.
»Er hat bestätigt, dass es ziemlich schlimm um deinen Motor steht. Außerdem haben er und seine Jungs sowieso schon alle Hände voll zu tun. Die Reparatur wird um die zweitausend Dollar kosten.«
Die Luft entwich mir mit einem Stöhnen. Das sprengte meine Ersparnisse für den Roadtrip bei Weitem. Bis jetzt hatte ich den Job bei der Tierärztin nicht wirklich in Betracht gezogen, da ich dafür nicht genug Erfahrung mitbrachte, aber nun blieb mir keine Wahl.
Ich war zu schockiert, um zu sprechen, also winkte ich Janet nur zu, als sie sich verabschiedete.
Da vibrierte mein Handy. Es war eine Nachricht von Rachel:
Süße, wir müssen unbedingt telefonieren! Ich hab den Job! Jetzt ist Feiern angesagt. Ist doch super, dass du zwei Wochen in St. Andrews bleibst. Genug Zeit, um etwas herauszufinden. Wünschte, ich wäre mit dir da.
XOXO
Mein Herz machte einen aufgeregten Satz. Ich wäre beinahe aufgesprungen und hätte laut gejubelt. Wenigstens eine von uns war erfolgreich. Ich stellte mir Rachel in ihrer New Yorker Bleibe vor, wie sie vor Freude auf und ab hüpfte, als sie die Zusage für ihren Traumjob bekam. Doch das hieß auch, dass sie nun bald ihr Praktikum in einer der Topkanzleien von New York beginnen würde. Sie würde sich eine Wohnung suchen und nach Amerika ziehen müssen. Weg von Toronto. Weg von mir. Plötzlich gab es einen Grund weniger, schnell nach Hause zurückzukehren. Auf einen Schlag war mir der Appetit vergangen.
Auf dem Weg zur Tierarztpraxis rief ich meine Großeltern an. Sie würden sich nur unnötig Sorgen machen, wenn sie von dem Motorschaden erfuhren, aber es wäre unfair, ihnen nicht zu erzählen, wo ich mich in den nächsten zwei Wochen aufhalten würde. Sie ahnten nicht, weshalb ich wirklich in dieser Gegend war. Ich hatte ihnen nur gesagt, dass ich einen Roadtrip durch Kanada machte.
»Hey, Grandma. Wie geht’s euch beiden?«
»Marly! Wie schön, von dir zu hören. Darling, komm schnell her, Marly ist am Telefon!« Ich musste mir das Handy vom Ohr weghalten, als sie lautstark nach Grandpa rief. Im Hintergrund hörte ich ihn antworten, dann seine schlurfenden Schritte, die sich näherten. Ein Lächeln breitete sich auf meinem Gesicht aus. Es tat gut, ihre Stimmen zu hören.
»Marly? Hörst du mich? Wir haben den Lautsprecher eingeschaltet.«
»Ja. Hi, Grandpa.«
»Wo bist du denn gerade?«, fragte Grandma.
Ich atmete einmal tief durch. »Ich bin in St. Andrews, einer Kleinstadt in New Brunswick. Ich habe hier Aussichten auf einen Job, also werde ich ein bisschen bleiben.«
»Ein Job? Hab ich das richtig gehört?«, schrie Grandpa in den Hörer.
»Ja, in einer Tierarztpraxis.«
»Marly, ist alles in Ordnung?«, fragte Grandma sofort besorgt. »Brauchst du Geld?«
»Nein, nein, alles okay. Ich dachte nur, ich verdiene mir ein bisschen was dazu. Und ein paar Wochen Erholung am Meer können ja auch nicht schaden. Es ist wirklich schön hier.«
»Du hast recht, du verdienst ein bisschen Urlaub«, pflichtete Grandma mir bei. »Immerhin schließt man nicht alle Tage seinen Bachelor mit Honours ab. Du hast so hart gearbeitet in den letzten Monaten.«
»Aber du sagst Bescheid, wenn du Hilfe brauchst«, wandte Grandpa ein. Er klang nicht überzeugt, der alte Fuchs. Mir war allerdings klar, dass meine Großeltern mir kaum würden helfen können. Sie lebten selbst nur gerade so von ihrer mageren Rente, während das Haus um uns herum halb in sich zusammenfiel. Das wenige Geld, das ich angespart hatte, kam von den drei Nebenjobs, die ich während meines Bachelorstudiums gehabt hatte. Es war nicht viel, da ich mit dem Großteil meines Gehalts die horrenden Studiengebühren bezahlt und mir zugegebenermaßen ein paar Sneakers gegönnt hatte, natürlich alle secondhand. Trotzdem stand bei den Studiengebühren noch eine beträchtliche Summe aus, wie bei allen jungen Studierenden in Kanada.
»Wie geht es Rachel?«, fragte Grandma. »Hat sie den Job?« Meine älteste Freundin aus Kindertagen war für meine Großeltern, bei denen ich aufgewachsen war, so etwas wie eine zweite Enkeltochter.
»Ja!« Wieder breitete sich das Grinsen auf meinem Gesicht aus. »Rachel hat das Praktikum in New York bekommen.«
»Das ist ja grandios. Sie kann sehr stolz auf sich sein.« Ich hörte Grandpa im Hintergrund klatschen.
»Du aber auch auf dich«, fügte Grandma hastig hinzu.
Bei mir stand nichts dergleichen in Aussicht. Ich hatte zwar mein Studium abgeschlossen, mir aber diesen Sommer ein paar Monate gönnen wollen, um mal rauszukommen, bevor der Ernst des Lebens wirklich begann. Doch als Rachel das Jobangebot ihrer Träume bekommen hatte, hatte sie mir für unseren lange geplanten Roadtrip absagen müssen. Um genau zu sein, war ich diejenige gewesen, die sie dazu gedrängt hatte, nicht mit mir durch Kanada zu fahren, sondern stattdessen der Einladung zum Vorstellungsgespräch nachzukommen. Diese Chance war einfach zu gut, um sie ungenutzt verstreichen zu lassen. Roadtrip hin oder her. Ich war stolz auf Rachel. Und nun hatte ich immerhin auch einen Job in Aussicht – auch wenn es keiner war, für den ich mich mit meinem Geschichtsstudium qualifizierte.
Wir plauderten noch ein bisschen, dann verabschiedete ich mich und legte auf. Google Maps sagte mir, dass ich an meinem Ziel angekommen war. Wieder einmal hatte ich vom Cottage keine fünfzehn Minuten hierher gebraucht. Wahrscheinlich konnte man ganz St. Andrews in einer knappen Stunde durchqueren.
Bei der Tierarztpraxis handelte es sich um ein süßes Einfamilienhaus mit blauen Fensterläden, das von einem leicht verwilderten Garten umgeben war. Die Holzfassade war weiß gestrichen, auch wenn die Farbe an einigen Stellen abblätterte. Vom Verandageländer rankten sich lila Blüten, neben der blauen Haustür stand eine große Vase mit den ersten Sommerblumen. Das ganze Gebäude strahlte eine entspannte Gemütlichkeit aus.
Ich straffte die Schultern, legte mir noch mal zurecht, was ich sagen wollte, und erklomm die Stufen der Veranda. Ich trug die schickste Jeans, die meine Reisegarderobe hergegeben hatte, ein einigermaßen elegantes T-Shirt und meine vorzeigbarsten Sneakers: weiße Adidas Originals Continental Vulc.
Vor Aufregung wischte ich mir die feuchten Handflächen an meiner Jeans ab und trat ein. In der Praxis herrschte Hochbetrieb. Das Wartezimmer war brechend voll mit Hunden, Katzen, einem Meerschweinchen, einem Wellensittich und deren Besitzern. Die Wände waren in einem fröhlichen Gelb gestrichen. Es roch nach Desinfektionsmittel, Hundefutter und feuchten Tierhaaren. Die Rezeptionstheke war nicht besetzt, eine Frau stand davor und betätigte ungeduldig die Tischklingel. Neben ihr saß ein Labrador mit Halskrause, der verwirrt von all dem Trubel hin und her blickte.
Ich blieb erst einmal in der Tür stehen und wartete, ob jemand kommen würde, der hier arbeitete. Eine Frau in einem weißen Kittel – wahrscheinlich die Tierärztin – eilte über einen Gang neben der Rezeption, von dem rechts und links mehrere Türen abgingen. Das mussten die Behandlungszimmer sein. Rasch verschwand sie in einem davon.
»Das kann doch nicht wahr sein«, beschwerte sich die Frau an der Rezeption. »Ich warte jetzt schon seit zehn Minuten.«
Ich wollte sie gerade fragen, ob sie nicht sehen konnte, dass das Praxisteam unterbesetzt war, da rauschte eine junge Frau in meinem Alter heran.
»Entschuldigen Sie, Mrs Meyer«, rief sie. »Was kann ich für Sie tun?«
Während sie die Daten der Frau aufnahm und etwas in den Computer tippte, musterte ich die Rezeptionistin, meine potenzielle zukünftige Kollegin. Ihre Haut war von einem satten Umbrabraun, das schwarze Haar hatte sie zu vielen langen Zöpfen geflochten, die sie auf ihrem Kopf zu einer eleganten Frisur aufgetürmt hatte. Und auch ihre Sneakers, auf die ich einen Blick erhascht hatte, bevor sie hinter dem Tresen verschwunden war, waren nicht zu verachten: weiße Chucks.
Nachdem Mrs Meyer im Wartezimmer Platz genommen hatte, trat ich an die Theke.
»Kleinen Moment«, sagte die junge Frau, den Blick weiter auf den Bildschirm gerichtet. »Ich bin sofort für Sie da. Heute geht es wirklich drunter und drüber hier.«
Das war die perfekte Vorlage für mich. »Deshalb bin ich hier. Um auszuhelfen.«
Ihr Blick schoss zu mir, sie musterte mich eindringlich, und ihr schien aufzufallen, dass ich kaum älter als sie war.
»Wie cool ist das denn«, rief sie und sprang auf. »Du willst hier arbeiten?«
»Ja, hi, ich bin Marly.«
»Hey, Sue«, brüllte sie so laut, dass sich einige Köpfe aus dem Wartezimmer schoben, um zu sehen, was der Tumult zu bedeuten hatte. »Unsere Gebete wurden erhört!«
»Na ja, also ich würde mich nicht unbedingt als von Gott gesandt bezeichnen, aber …«
Sie lachte. »Du bist witzig. Ich mag dich.«
Ich deutete einen Knicks an. »Ich tue, was ich kann.«
Da kam die Ärztin, Dr. Sue, um die Ecke. Sie musste Mitte vierzig sein, ihre helle Haut war mit Sommersprossen übersät, ihre pinkfarbene Retrobrille saß ihr schief auf der Nase, und ihr dünnes, mausbraunes Haar war zu einem lockeren Knoten zusammengebunden, aus dem sich ständig neue Strähnen lösten. Sie schob sich die Brille zurecht, um mich eingehend zu betrachten.
»Sie ist hier für den Job«, erklärte die junge Arzthelferin.
»Oh, wie wunderbar.« Dr. Sues Augen wurden groß. Sie stürmte auf mich zu und schüttelte mir die Hand. »Sie möchten für Linda einspringen? So kurzfristig?«
»Vergraul sie doch nicht gleich wieder«, warf die Arzthelferin mit hochgezogenen Augenbrauen ein.
»Ich heiße Marly Macpherson. Janet vom Cory Cottage schickt mich«, sagte ich. »Ich brauche dringend einen Job, und sie hat gesagt, es sei kein Problem, dass ich noch keine Erfahrung mit Tierarztpraxen oder Medizin im Allgemeinen habe. Ich habe aber früher in einem Tierheim gearbeitet.«
»Janet? Was für ein Engel!«
Ich schmunzelte, heute war anscheinend ein Tag voller göttlicher Wunder.
»Nein, das macht überhaupt nichts«, erwiderte Dr. Sue, die meine Hand immer noch umklammert hielt. »Wir brauchen jemanden für die Rezeption. Fiona« – sie deutete auf die Rezeptionistin – »muss mir assistieren, und deshalb bleibt der ganze administrative Kram liegen. Du müsstest das Telefon beantworten, Termine machen, Bezahlungen entgegennehmen und Rechnungen erstellen. So was halt.«
»Das kriege ich hin.«
Fiona und Dr. Sue warfen sich einen überglücklichen Blick zu.
»Also … äh, wie war noch gleich dein Name?«
»Marly.«
»Marly, du bist angestellt. Kannst du gleich anfangen? Den Papierkram erledigen wir später.«
Ich folgte ihrem Blick zum übervollen Wartezimmer. »Na klar. Ich habe bis vor Kurzem im Uni-Sekretariat gejobbt. Administrative Aufgaben sollten kein Problem sein.«
Sie nickte zufrieden. »Fiona wird dir alles Wichtige erklären. Wenn es in Ordnung ist, würdest du jeweils ein paar Stunden am Morgen und am Nachmittag arbeiten. Wir öffnen um neun Uhr. Am Wochenende haben wir geschlossen, und mittwochs nur den halben Tag …«
»Ist okay, Sue, geh schon«, unterbrach Fiona ihre Chefin. »Ich übernehme Marlys Einweisung.«
Dr. Sue nickte ihr dankbar zu. Anscheinend waren die beiden ein eingespieltes Team. Ich schenkte meiner neuen Vorgesetzten ein aufmunterndes Lächeln, und sie eilte zum Wartezimmer, um den nächsten tierischen Patienten aufzurufen.
In meinem Kopf hörte ich ein lautes Platschen, als sie mich einfach so ins kalte Wasser warf.
Kapitel 4
Marly
Ich verbrachte den ganzen Vormittag damit, mich von Fiona anlernen zu lassen. Ab und zu verschwand meine neue Kollegin mit Dr. Sue in einem der fünf Behandlungszimmer, um ihr zu assistieren, doch die meiste Zeit saß sie neben mir an der Rezeption, erklärte mir das Computerprogramm, wie man Anrufe entgegennahm und Termine eintrug, wie Rechnungen zu erstellen und abzulegen sowie Zahlungen entgegenzunehmen waren. Wir verstanden uns auf Anhieb gut, waren beide nicht auf den Mund gefallen und hatten denselben Humor.
Als die Praxis über Mittag zwei Stunden schloss, fragte Fiona mich, ob ich mit ihr essen gehen wollte. Dankbar willigte ich ein.
»Du kennst St. Andrews nicht, wenn du noch nicht im The Gables gegessen hast«, sagte sie mit einem verschwörerischen Zwinkern, hakte sich bei mir unter und führte mich zurück zur Water Street.
Das rote Haus mit dem schwarzen Dach war mir schon am Vortag aufgefallen. Draußen begrüßte uns eine fröhlich grinsende Hummerfigur. Der Duft von gebratenem Fisch stieg mir in die Nase, sodass mein Magen laut grummelte. Das Innere des Restaurants war ganz in rustikalem Holz gehalten, beinahe wie eine Schiffskombüse. Von einem Balken an der Decke hingen Bojen und Schiffsanker. Wir gingen jedoch direkt durch den gemütlichen Raum und kamen am anderen Ende auf einer großzügigen Terrasse mit Blick aufs Meer raus.
»Wow!« Ich rannte zum Holzgeländer, legte die Hände darauf und bewunderte die Aussicht. Die Mittagssonne brachte das Meer zum Funkeln, sodass ich blinzeln musste. In der Ferne erhoben sich zu beiden Seiten bewaldete Hügel, die die Bucht einrahmten. Die endlose Weite der Bucht, der Hügel und Wälder raubte mir den Atem.
»Cool, was?« Fiona freute sich offensichtlich über meine Reaktion.
Wir setzten uns und warfen einen Blick in die Speisekarten. Als der schnuckelige junge Kellner kam, bestellte Fiona einen Teller Miesmuscheln mit Brotbeilage, während ich mich für einen Schellfisch-Wrap mit Pommes und Dip entschied.
»Du lernst echt schnell«, sagte Fiona zwischen zwei Muscheln. »Wo hast du noch mal vorher gearbeitet?«
Es war wohl an der Zeit, mit der Sprache herauszurücken. »Ich habe eigentlich gerade erst meinen Bachelor in Toronto gemacht. Bisher hatte ich immer nur Studentenjobs, zuletzt im Uni-Sekretariat, in einer Bibliothek und im Kiosk um die Ecke.«
»Wow, drei Jobs auf einmal?«
Ich nickte kauend und nahm einen Schluck Cola. »Im Tierheim habe ich früher nur ehrenamtlich in den Sommerferien ausgeholfen.«
Fiona nippte an ihrem alkoholfreien Bier. »Was hast du denn studiert?«, fragte sie dann.
»Geschichte. Französisch und Indigene Sprachen im Nebenfach.«
»Oh, je parle français aussi.«
»C’est pas vrai!«
Sie freute sich wie eine Schneekönigin, als ich bewundernd einen Daumen hob.
»Das ist der Vorteil, wenn man in einer offiziell zweisprachigen Provinz lebt«, lachte sie. »Außerdem kommt meine Mom aus Quebec.«
»Dann bist du zweisprachig aufgewachsen?«, fragte ich fasziniert und ein wenig neidisch.
Sie nickte. »Meine Brüder und ich, ja. Hast du auch Geschwister?«
»Nein.« Und da war es wieder, das mir so vertraute, beklemmende Gefühl. Als ob sich etwas Schweres auf meine Brust legte und mir den Atem raubte. Wie immer zog ich mich in mich selbst zurück, wenn es um meine Familie ging, und gab nur noch einsilbige Antworten.
Fiona schien meine Unsicherheit zu bemerken und wechselte elegant das Thema. »Was verschlägt dich Großstadtmädchen eigentlich ins schöne St. Andrews?«
Ich lächelte ihr dankbar zu. Dieses Thema war zwar ebenso delikat, aber ich musste meiner neuen Kollegin ja nicht gleich die ganze Wahrheit verraten. »Ich war auf einem Roadtrip, und mein Auto ist liegen geblieben.«
Sie hob überrascht die schwarzen Augenbrauen. »Was? Das ist ja furchtbar.«
Ich sah in ihr aufrichtig interessiertes Gesicht, musterte die braunen Augen, die vollen, vor Schreck leicht geöffneten Lippen, und plötzlich fiel die Unsicherheit von mir ab. Es tat gut, sich mit jemandem wie ihr zu unterhalten. Das Gespräch war leicht, unbefangen, genau wie wenn ich mit Rachel zusammen war. Ich durfte mir nicht immer so viele Sorgen machen, anderen Leuten könnte auffallen, dass mit mir etwas nicht stimmte.
Ich atmete einmal tief durch, dann erzählte ich Fiona zumindest einen Teil der Geschichte. Dass Rachel und ich seit Monaten unsere Reise durch Kanada geplant hatten. Dass Rachel in Vorbereitung auf ihr Jurastudium unbedingt ein Sommerpraktikum machen wollte und sich bei verschiedenen Firmen beworben hatte. Wie sie bei einer der prestigeträchtigsten Kanzleien der ganzen Ostküste zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden war und deshalb doch nicht wie geplant mit mir reisen konnte.
Fiona hörte mir aufmerksam zu. »Wow, du bist echt eine gute Freundin«, sagte sie, als ich geendet hatte. »Ich glaube, ich hätte ihr die Hölle heißgemacht, wenn sie mich so kurz vorher hängen lassen hätte.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Nein, sie hat mir wirklich angeboten, das Praktikum sausen zu lassen und stattdessen mit mir zu kommen. Ich habe sie gedrängt, es anzunehmen. Sie ist meine beste Freundin, wir kennen uns schon, seit wir ganz klein waren.«
Fiona nickte verständnisvoll. »Und jetzt ist sie in New York und fehlt dir schrecklich.«
Plötzlich wurde meine Kehle eng, und ich konnte erst einmal nur nicken. Dennoch meinte ich es ernst, als ich mit belegter Stimme hinzufügte: »Aber ich freue mich auch riesig für sie. Vielleicht kann ich sie dort besuchen.«
»Oder sie dich hier. Wie lange hast du vor zu bleiben?«
»Circa zwei Wochen. Dann müsste mein Auto repariert sein.«
»Oh.« Fionas Mundwinkel fielen nach unten. »Wir suchen eigentlich jemanden, der uns mindestens sechs Wochen aushelfen kann. Linda, die sonst deinen Job macht, muss ihr gebrochenes Bein so lange schonen.«
»Das tut mir leid.« Ich schämte mich, es nicht früher angesprochen zu haben. Doch am Morgen war alles so schnell gegangen. Dr. Sue hatte mir kaum Fragen gestellt.
»Ist schon okay.« Fiona strahlte schon wieder. »Wir sind froh, überhaupt so schnell jemanden gefunden zu haben. In zwei Wochen sehen wir weiter.«
»Gut.« Ich atmete erleichtert auf. »Der Job macht mir nämlich bisher echt Spaß, und ich brauche dringend das Geld.«
»Keine Sorge.« Wieder zwinkerte Fiona mir zu. »Wir kriegen das schon hin.«
Als wir zur Praxis zurückgingen, hatte ich das Gefühl, eine neue Freundin gewonnen zu haben. Fiona erzählte fröhlich von ihrem kleinen Haus in St. Andrews, ihrer Familie und ihren Freunden, wobei Letztere einen besonders großen Platz in ihrem Leben einzunehmen schienen.
Am Nachmittag ließ Fiona mich allein an der Rezeption, um sich gemeinsam mit Dr. Sue um ein paar schwierigere Fälle zu kümmern. »Hol mich einfach, wenn du eine Frage hast oder es ein Problem gibt. Du packst das schon«, rief sie mir noch über die Schulter zu, dann war sie auch schon mit einem Schäferhundwelpen in einem der Behandlungsräume verschwunden.
Ich nahm mir erst gar nicht die Zeit, in Panik zu verfallen, sondern stürzte mich in die Arbeit. Eine Stunde verging ohne große Zwischenfälle. Ich nahm Anrufe entgegen und trug neue Termine ins Programm ein.
Irgendwann watschelte eine ältere Dame in einem geblümten Kleid und einem Strohhut auf dem Kopf herein. Sie führte eine behäbige, rötlich getigerte Katze an der Leine.
»Oh«, sagte sie, als sie mich sah. »Ist Linda heute nicht da?« Ihre Wangen waren feuerrot, ein starker Kontrast zu ihrer blassrosa Haut.
»Guten Tag«, begrüßte ich sie. »Linda hat sich leider ein Bein gebrochen. Deshalb helfe ich für eine Weile aus. Ich bin Marly.«
»Elisabeth Crawford.« Die Frau stützte sich schwer atmend auf die Rezeptionstheke. »Puh, diese Hitze. Sie macht mir und Princess Purrfect sehr zu schaffen.«
Princess Purrfect musste die stark übergewichtige Katze mit dem pinken Rüschenhalsband sein, die die Frau nun auf die Theke hievte. Das Tier ließ sich sofort mit einem lauten Plopp fallen und begann seelenruhig, ihre rechte Pfote zu lecken. »Äh, hallo Princess Purrfect«, sagte ich. »Schön, Sie beide kennenzulernen.«
Mrs Crawford sah mich erwartungsvoll an, während sie sich mit ihrem Strohhut Luft zufächelte. »Linda gibt meiner Prinzessin sonst immer ein Leckerli.«
Ich starrte ein paar Sekunden verblüfft zurück. Von Leckerlis für Patienten hatte Fiona nichts erwähnt. »Oh, entschuldigen Sie bitte.« Verwirrt setzte ich mich in Bewegung, zog ein paar Schubladen auf, fand jedoch keine Spur von Katzenfutter.
Nach wie vor keuchend deutete Mrs Crawford mit einem dicken, goldberingten Finger auf den Schrank neben der Rezeption. Als ich ihn öffnete, entdeckte ich darin tatsächlich ein beschriftetes Glas. Auf dem Schild stand: Diät-Cookies für Princess Purrfect.
Schmunzelnd griff ich hinein und nahm ein Diätplätzchen heraus. Als ich es Princess Purrfect hinhielt, begann sie augenblicklich zu schnurren. Sie regte sich jedoch kein Stück, sodass ich ihr das Leckerli förmlich in den Mund schieben musste. Sie verschlang es im Liegen.
»Und was kann ich sonst für Sie und Princess Purrfect tun?«, fragte ich ihre Besitzerin.
»Ich habe seit gestern so ein starkes Müdigkeitsgefühl«, erklärte Mrs Crawford. Mit hochgezogenen Augenbrauen fragte ich mich, was das mit ihrer Katze zu tun hatte, doch sie fuhr schon fort. »Und, Sie werden es nicht glauben, Princess Purrfect geht es ebenso. Sie liegt nur noch träge in ihrem Körbchen und spielt nicht einmal mehr mit dem Glitzerbällchen. Das ist ihr Lieblingsspielzeug, müssen Sie wissen. Heute konnte ich sie kaum zu unserem alltäglichen Spaziergang überreden.«
Das lag wohl eher daran, dass die Katze so ein beachtliches Gewicht mit sich herumtrug, doch diesen Gedanken behielt ich lieber für mich. Ich hatte das Gefühl, dass Mrs Crawford eine Stammkundin war, die hier besondere Privilegien genoss.
Ende der Leseprobe