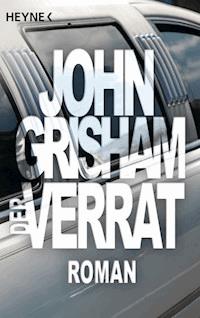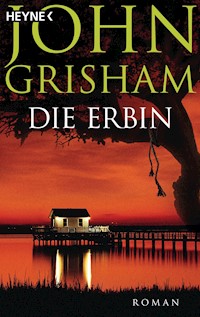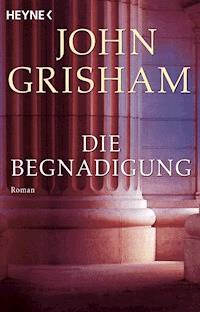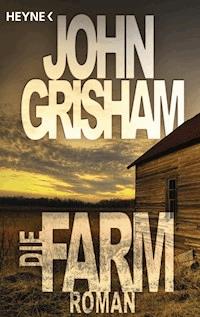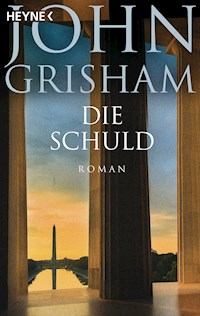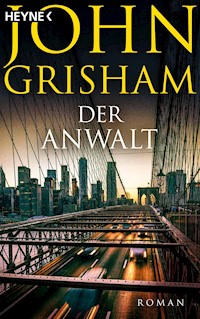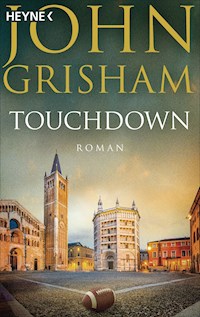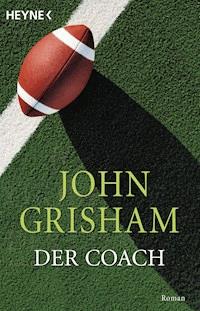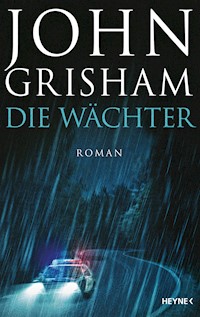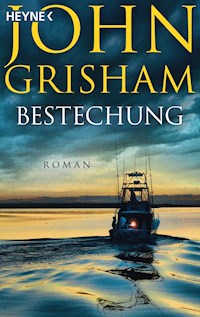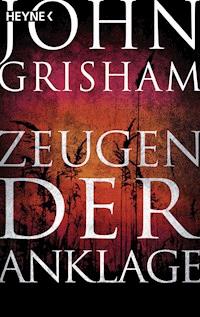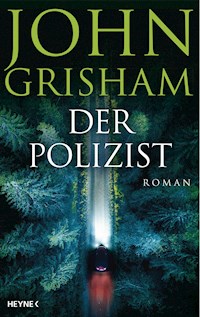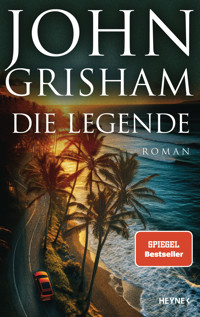
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Camino-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die Schriftstellerin Mercer Mann sucht nach einer packenden Geschichte für ihren nächsten Roman. Da macht sie Bruce Cable, der charmante Buchhändler von Camino Island, auf ein Drama aufmerksam, das sich quasi direkt vor ihren Augen abspielt: Ein skrupelloses Bauunternehmen will sich eine verlassene Insel zwischen Florida und Georgia unter den Nagel reißen. Nur die letzte Bewohnerin der Insel, Lovely Jackson, stellt sich ihm in den Weg. Sie ist die Nachfahrin entflohener Sklaven, die dort seit Jahrhunderten gelebt haben, und will die Insel niemals profitgierigen Weißen überlassen. Mit Bruce Cables Hilfe nimmt sie den Kampf vor Gericht auf. Und vielleicht hilft ihr ja auch die alte Legende, dass jeder Weiße, der die Insel böswillig betritt, mit einem tödlichen Fluch belegt ist. Denn schon bald gibt es die ersten Toten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Die Schriftstellerin Mercer Mann sucht nach einer packenden Geschichte für ihren nächsten Roman. Da macht sie Bruce Cable, der charmante Buchhändler von Camino Island, auf ein Drama aufmerksam, das sich quasi direkt vor ihren Augen abspielt: Ein skrupelloses Bauunternehmen will sich eine verlassene Insel zwischen Florida und Georgia unter den Nagel reißen. Nur die letzte Bewohnerin der Insel, Lovely Jackson, stellt sich ihm in den Weg. Sie ist die Nachfahrin entflohener Sklaven, die dort seit Jahrhunderten gelebt haben, und will die Insel niemals profitgierigen Weißen überlassen. Mit Bruce Cables Hilfe nimmt sie den Kampf vor Gericht auf. Und vielleicht hilft ihr ja auch die alte Legende, dass jeder Weiße, der die Insel böswillig betritt, mit einem tödlichen Fluch belegt ist. Denn schon bald gibt es die ersten Toten …
Der Autor
John Grisham ist einer der erfolgreichsten amerikanischen Schriftsteller. Seine Romane sind ausnahmslos Bestseller. Zudem hat er ein weiteres Sachbuch, einen Erzählband und Jugendbücher veröffentlicht. Seine Bücher werden in mehr als vierzig Sprachen übersetzt. Er lebt in Virginia. Sein Werk erscheint in deutscher Übersetzung im Heyne-Verlag.
»Die Legende« ist nach »Das Manuskript« und »Das Original« der dritte Band in seiner New-York-Times-Bestsellerserie um Camino Island und den Buchhändler Bruce Cable.
JOHN GRISHAM
DIE LEGENDE
ROMAN
Aus dem Amerikanischenvon Bea Reiterund Imke Walsh-Araya
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Camino Ghosts bei Doubleday, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 by Belfry Holdings, Inc.
Copyright © 2025 der deutschsprachigen Ausgabe byWilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Redaktion: Oliver Neumann
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-26626-4V002
www.heyne.de
Kapitel 1
Die Überfahrt
1.
Keiner der rund fünfzig Gäste trug Schuhe. In der Einladung war ausdrücklich darum gebeten worden, darauf zu verzichten. Schließlich war es eine Strandhochzeit, und Mercer Mann, die Braut, wollte den Sand zwischen ihren Zehen spüren. Der Dresscode war Beach Chic, was in Palm Beach nicht dasselbe bedeuten mochte wie in Malibu und was in den Hamptons wahrscheinlich wieder ganz anders aufgefasst wurde. Doch auf Camino Island verstand man darunter: Alles ist erlaubt. Nur keine Schuhe.
Die Braut hatte sich für ein rückenfreies, tief ausgeschnittenes weißes Leinenkleid entschieden und war braun gebrannt und bestens in Form, da sie bereits zwei Wochen zuvor auf die Insel gekommen war. Sie sah umwerfend aus. Thomas, der Bräutigam, war genauso schlank und gebräunt. Er trug einen nagelneuen taubenblauen Seersucker-Anzug, dazu ein gestärktes weißes Hemd, keine Krawatte. Und selbstverständlich keine Schuhe.
Thomas gab sich damit zufrieden, bei der Hochzeit dabei zu sein. Er und Mercer waren seit drei Jahren ein Paar und lebten seit zwei Jahren zusammen. Vor drei Monaten, als Mercer keine Lust mehr darauf gehabt hatte, auf einen Heiratsantrag von ihm zu warten, hatte sie ihn gefragt: »Hast du am Samstag, dem 6. Juni, um neunzehn Uhr schon etwas vor?«
»Keine Ahnung. Ich müsste schauen, was in meinem Terminkalender steht.«
»Sag: nichts.«
»Wie bitte?«
»Sag, dass du nichts vorhast.«
»Okay, ich habe nichts vor. Warum?«
»Weil wir heiraten. Am Strand.«
Thomas kam es nicht auf Details an, daher hatte er nicht viel zu den Hochzeitsvorbereitungen beizutragen. Wäre es anders gewesen, hätte das auch kaum eine Rolle gespielt. Das Leben mit Mercer war wunderbar und hatte unter anderem den Vorteil, dass sie nicht von ihm erwartete, Entscheidungen zu treffen. Es gab keinen Druck.
Während die Gäste Champagner tranken, spielte eine junge Frau Liebeslieder auf der Gitarre. Sie hatte Mercers Kurs für kreatives Schreiben an der University of Mississippi belegt und sich bereit erklärt, für die musikalische Untermalung der Hochzeit zu sorgen. Ein Kellner mit Strohhut ging herum und füllte die Gläser auf. Auch er war einer von Mercers Studenten, aber sie musste ihm noch schonend beibringen, dass seine Texte zu bizarr waren. Wenn sie etwas direkter gewesen wäre, hätte sie ihm gesagt, dass er als Barkeeper bei kleinen Hochzeiten wahrscheinlich mehr Geld verdienen würde als mit dem Versuch, Romane zu schreiben. Allerdings brauchte sie erst eine Festanstellung und mehr Geschick dabei, wenig talentierten Studenten von einer Karriere als Schriftsteller abzuraten.
Mercer unterrichtete, weil sie ein Gehalt brauchte. Sie hatte einen Band mit Kurzgeschichten und zwei Romane veröffentlicht. Und im Moment war sie auf der Suche nach der Inspiration für einen dritten. Ihr letzter, Tessa, war ein Bestseller gewesen, und der Erfolg hatte Viking Press veranlasst, ihr einen Vertrag über zwei weitere Bücher anzubieten. Ihre Lektorin wartete auf die Idee für die nächste Geschichte. Mercer auch. Sie hatte etwas Geld auf dem Konto liegen, doch nicht genug, als dass sie ihre Stelle an der Ole Miss aufgeben könnte, nicht genug, sich die Freiheit zu erkaufen, ohne finanzielle Sorgen in Vollzeit zu schreiben.
Einige ihrer Gäste hatten diese Freiheit. Myra und Leigh, die beiden Grandes Dames der literarischen Mafia auf der Insel und seit Jahrzehnten ein Paar, lebten von den Tantiemen ihrer Bücher. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere hatten sie an die hundert schlüpfrige Liebesromane unter einem Dutzend Pseudonymen herausgehauen. Bob Cobb, der vorbestraft war und ein paar Jahre wegen Bankbetrugs gesessen hatte, schrieb harte Kriminalromane und hatte ein Faible für Knastgewalt. Wenn er getrunken hatte, was eigentlich rund um die Uhr der Fall war, behauptete er, seit zwanzig Jahren keiner ehrlichen Arbeit mehr nachgegangen zu sein. Er sei Schriftsteller! Die vielleicht reichste Autorin der Gruppe war Amy Slater, Mutter von drei Kindern, die mit ihrer Serie über Vampire auf eine Goldgrube gestoßen war.
Amy und ihr Mann Dan hatten einen dicken Batzen der Tantiemen dafür verwendet, eine große Villa am Meer zu bauen, etwa einen Kilometer von Mercers Strandhaus entfernt. Nachdem sie von der Hochzeit gehört hatten, bestanden sie darauf, die Trauung und den anschließenden Empfang bei sich auszurichten.
Wie jede Braut hatte sich Mercer vorgestellt, von ihrem Vater zum Altar geführt zu werden. Allerdings war er aus der Zeremonie herausgestrichen worden, zusammen mit dem Traualtar. Mr. Mann war ein komplizierter Mensch, der nie viel Zeit mit seiner Frau und seinen Töchtern verbracht hatte. Als er sich darüber beschwerte, dass die Hochzeit mit seinem vollgestopften Terminkalender in Konflikt geraten könnte, sagte Mercer, das sei überhaupt kein Problem. Ohne ihn würde es sowieso lustiger sein.
Mercers Schwester Connie – immer ein Garant für ein Familiendrama – war der Einladung gefolgt. Die beiden verzogenen Teenagertöchter von Connie saßen in einer der hinteren Reihen und starrten auf ihre Smartphones. Ihr Mann schüttete Champagner in sich hinein. Erfreulicher war, dass Mercers Literaturagentin Etta Shuttleworth und deren Mann gekommen waren, ebenso ihre Lektorin, die mit Sicherheit einen günstigen Moment nutzen würde, um nach Mercers nächstem Roman zu fragen, der seit einem Jahr überfällig war. Mercer war fest entschlossen, nicht über Geschäftliches zu reden. Es war ihre Hochzeit, und falls die Lektorin zu penetrant werden sollte, war mit Etta abgesprochen, dass sie eingreifen würde. Drei ehemalige Kommilitoninnen aus ihrer Studentinnenverbindung waren anwesend, zwei davon mit Ehemann. Die dritte hatte gerade eine schmutzige Scheidung hinter sich, über die Mercer entschieden zu viel gehört hatte. Alle drei waren scharf auf Thomas, und Mercer behielt sie genau im Auge. Die Tatsache, dass er fünf Jahre jünger war als die Braut, machte ihn noch attraktiver. Zwei Kollegen von ihrer Fakultät an der Ole Miss hatten die letzte Kürzung der Gästeliste überlebt und verbrachten eine Woche auf der Insel. Mercer verstand sich recht gut mit ihnen, war aber vorsichtig. Sie hatte die beiden nur aus Höflichkeit eingeladen. In den letzten sechs Jahren hatte sie an zwei weiteren Universitäten gelehrt und viel über Campus-Politik gelernt. Sie war die einzige Professorin in der Geschichte der Fakultät für Anglistik an der Ole Miss, die mit einem Roman auf den Bestsellerlisten gelandet war, und manchmal konnte sie die Eifersucht regelrecht spüren. Ein alter Freund aus Chapel Hill war eingeladen worden, hatte aber abgelehnt. Zwei Freundinnen von der Highschool und eine aus dem Kindergarten waren gekommen.
Thomas hatte ein besseres Verhältnis zu seiner Familie. Seine Eltern und seine Geschwister mit ihren kleinen Kindern füllten eine ganze Reihe. Hinter ihnen saßen mehrere Studienfreunde aus seiner Zeit am Grinnell College, die sich lautstark unterhielten.
Der falsche Geistliche war Bruce Cable, Besitzer der Buchhandlung Bay Books und ehemaliger Liebhaber der Braut. Er bat die Gäste, Platz zu nehmen und nach vorn zu kommen, wo ein Bogen aus weißem Weidengeflecht errichtet worden war. Er war mit Rosen und Nelken in Rot und Weiß geschmückt und wurde auf beiden Seiten von Spalieren flankiert. Dahinter erstreckten sich dreißig Meter weißer Sand, dann kam nichts mehr bis auf den Atlantik bei Flut, eine traumhaft schöne Aussicht, die sich kilometerweit bis zum Horizont erstreckte. Nordafrika war sechstausendfünfhundert Kilometer entfernt, Luftlinie.
Die Gitarristin spielte, bis Mercer und Thomas auf dem Holzsteg zum Strand erschienen. Die beiden gingen Hand in Hand die Treppe hinunter zu dem Weidenbogen, wo sie von dem falschen Geistlichen erwartet wurden.
Es war nicht die erste Hochzeit von Bruce Cable. Aus irgendeinem vagen Grund war es in Florida fast jedem erlaubt, sich bei der Geschäftsstelle des Gerichts für wenig Geld eine Erlaubnis zu kaufen, »Offiziant« zu werden und eine standesamtliche Trauung durchzuführen. Bruce hatte das nicht gewusst und auch absolut kein Interesse daran gehabt, bis eine Ex-Freundin von ihm auf Camino Island heiraten wollte und darauf bestand, dass er die Zeremonie übernahm.
Das war seine erste Trauung gewesen. Mercers war die zweite. Er fragte sich manchmal, wie viele Offizianten wohl mit den Bräuten im Bett gewesen waren. Ja, einmal, vor gar nicht langer Zeit, hatte er mit Mercer geschlafen, damals, als sie ihm nachspioniert hatte, aber das war Schnee von gestern. Noelle, seine Frau, wusste davon. Auch Thomas war informiert worden. Sämtliche Beteiligten konnten damit leben. Alles war ausgesprochen harmonisch.
Mercer, die wusste, dass Bruce gern einmal abschweifte, hatte ihr Ehegelübde selbst geschrieben. Thomas war erstaunlicherweise gefragt worden und hatte sogar ein paar eigene Formulierungen hinzugefügt. Ein ehemaliger Student der University of North Carolina erhob sich und trug ein Gedicht vor, ein unverständlicher Mischmasch aus freien Versen, der zur romantischen Atmosphäre beitragen sollte, aber dazu führte, dass sämtliche Gäste auf die Wellen starrten, die sich sanft am Strand brachen. Bruce gelang es, die Aufmerksamkeit wieder auf den eigentlichen Anlass zu lenken, indem er Bräutigam und Braut mithilfe kurzer Biografien vorstellte und einige Lacher dafür erntete. Die Gitarrenspielerin konnte auch singen und gab eine beeindruckende Version von »This Will Be (An Everlasting Love)« von Natalie Cole zum Besten. Connie las eine Szene aus Tessa vor, für die ihre Großmutter die Inspiration gewesen war. In der Geschichte ging Tessa jeden Morgen am selben Strandabschnitt spazieren und suchte nach Schildkröteneiern, die in der Nacht gelegt worden waren. Sie hütete die Brandung und die Dünen, als würden sie ihr gehören. Einige der Gäste konnten sich gut an das Vorbild erinnern. Der Roman war das ergreifende Porträt eines Menschen, der Mercer stark beeinflusst hatte.
Dann ließ Bruce Braut und Bräutigam das Gelübde sprechen, das seiner wohl fundierten Ansicht nach etwas zu langatmig ausgefallen war, ein immer wiederkehrendes Problem bei Mercers Texten, das er zu korrigieren gedachte. Er schätzte seine Autoren sehr und kümmerte sich hingebungsvoll um sie, aber er war auch ein scharfer Kritiker. Egal, es war ja nicht seine Hochzeit.
Sie tauschten die Ringe, küssten sich und verbeugten sich als Mann und Frau vor der Menge. Die Gäste standen auf und applaudierten.
Nach genau zweiundzwanzig Minuten war die Trauung vorbei.
Der Fotograf brauchte länger, dann gingen alle zum Holzsteg und folgten Mercer und Thomas durch die Dünen zum Pool, wo noch mehr Champagner bereitstand. Für ihren ersten Tanz hatten sie sich »My Girl« ausgesucht. Danach legte der DJ noch mehr Motown auf, und die Tanzfläche füllte sich. Es dauerte keine zehn Minuten, bis der erste betrunkene Gast – Connies Mann – in den Pool stürzte.
Das beliebteste Catering-Unternehmen der Insel gehörte Claude, einem echten Cajun aus dem Süden von Louisiana. Er und sein Team waren auf der Terrasse zugange, während Noelle ein Auge auf die Tisch- und Blumendekoration hatte. Ihre Mutter war Französin, und was gehobene Küche und das ganze Drumherum anging, konnte niemand Noelle das Wasser reichen. Amy hatte sie gebeten, sich um Blumen, Geschirr, Platzgedecke, Gläser und Besteck zu kümmern, außerdem um den Wein. Noelle und Bruce hatten ihn bei ihrem Händler ausgesucht und bestellt. Auf der Terrasse waren zwei lange, mit einem Baldachin versehene Tische eingedeckt worden.
Bei Sonnenuntergang flüsterte Claude Amy zu, dass das Essen fertig sei, und die Gäste wurden zu ihren Plätzen dirigiert. In die angeregten Gespräche mischten sich Gelächter und lautstarke Bewunderung für das frischgebackene Ehepaar. Als die erste Flasche Chablis geöffnet wurde, bat Bruce wie immer um Ruhe, damit er den Wein gebührend beschreiben konnte. Dann wurden große Platten mit Austern gebracht und auf den Tisch gestellt. Beim zweiten Gang – Krabbensalat – ging es mit den Reden los, und von da an lief einiges aus dem Ruder. Der Bruder von Thomas machte seine Sache recht gut, war aber kein großer Redner. Eine von Mercers Freundinnen aus der Studentinnenverbindung spielte die obligatorische Rolle der weinenden Brautjungfer, was sich entschieden zu lange hinzog. Bruce gelang es, sie zum Schweigen zu bringen, indem er zu seiner eigenen, selbstverständlich brillanten Rede ansetzte. Anschließend stellte er den nächsten Wein vor, einen hervorragenden Sancerre. Peinlich wurde es, als Mercers Schwager, der nach seinem Sturz in den Pool noch nicht wieder trocken und schon seit geraumer Zeit betrunken war, aufstand und heftig schwankend versuchte, eine lustige Geschichte über einen von Mercers Ex-Freunden zu erzählen. Sein Timing war schlecht. Zum Glück fand sein Gestammel schnell ein Ende, weil Connie ihm laut zurief: »Carl, das reicht!«
Carl brüllte vor Lachen, als er sich auf seinen Stuhl fallen ließ, und brauchte ein paar Sekunden, bis ihm klar wurde, dass er der Einzige war, der es lustig fand. Um die Stimmung aufzulockern, sprang einer von Thomas’ ehemaligen Kommilitonen vom Grinnell College auf und trug ein schlüpfriges Gedicht über Thomas vor. Während er es vorlas, wurde der Hauptgang serviert, gegrillte Flunder. Das Gedicht wurde mit jedem Vers anzüglicher und lustiger, und als es zu Ende war, lachten sich alle kaputt.
Amy hatte sich bereits vor der Feier Gedanken um den Lärm gemacht. Die Häuser am Strand standen dicht aneinander und waren sehr hellhörig. Daher hatten sie die Nachbarn auf beiden Seiten zu der Hochzeit eingeladen und Mercer vor einer Woche vorgestellt. Sie lachten und tranken mehr als alle anderen.
Myra ergriff das Wort und schilderte, wie sie und Leigh Mercer vor fünf Jahren kennengelernt hatten, als diese auf die Insel zurückgekehrt war, um dort den Sommer zu verbringen: »Ihre Schönheit eilte ihr voraus, ihr Charme erwies sich als ansteckend, ihre Manieren waren einwandfrei. Aber wir haben uns gefragt: Kann sie schreiben? Insgeheim haben wir gehofft, dass sie es nicht kann. Mit ihrem letzten Roman, der meiner Meinung nach ein Meisterwerk ist, hat sie der Welt bewiesen, dass sie tatsächlich eine großartige Geschichte erzählen kann. Warum haben manche Menschen nur so ein Glück?«
»Myra, bitte«, flüsterte Leigh.
Bis dahin hatten die meisten Reden noch ein gewisses Maß an Vorbereitung erkennen lassen. Danach wurden sie spontan und aus dem Stegreif heraus gehalten und waren stark vom Wein beeinflusst.
Das Essen war lang und köstlich, und als es zu Ende war, brachen die älteren Gäste auf. Die jüngeren kehrten auf die Tanzfläche zurück, wo der DJ Musikwünsche entgegennahm und die Lautstärke herunterdrehte.
Um Mitternacht herum ging Bruce zu Mercer und Thomas, die mit den Füßen im Wasser am Rand des Pools saßen, und sagte nicht zum ersten Mal, was für eine schöne Hochzeit es gewesen sei.
»Wann reist ihr nach Schottland ab?«
»Morgen um vierzehn Uhr«, erwiderte Mercer. »Wir fliegen von Jacksonville nach Washington und dann nonstop nach London.« Für die Flitterwochen waren zwei Wochen in den Highlands geplant.
»Könnt ihr morgen früh kurz in der Buchhandlung vorbeischauen? Ich halte Kaffee bereit. Wir werden ihn brauchen.«
Thomas nickte, und Mercer meinte: »Na klar. Worum geht’s?«
Bruce wurde plötzlich ernst. Er sah sie selbstzufrieden an. »Ich habe die Geschichte, Mercer. Vielleicht die beste, die ich je gehört habe.«
2.
Am Sonntagmorgen öffnete Bay Books immer um neun Uhr. Bruce schloss die Eingangstür von innen auf und begrüßte die üblichen Besucher. Die Demografie war zwar unklar, aber er vermutete, dass etwa die Hälfte der ständigen Bewohner von Camino Island Ruheständler aus kälteren Gegenden des Landes waren. Die andere Hälfte waren Einheimische aus dem Norden Floridas und dem südlichen Teil von Georgia. Die Touristen kamen von überall her, doch vor allem aus dem Süden und dem Osten.
Jedenfalls gab es eine Menge Leute aus »dem Norden«, die ihre Lieblingszeitungen vermissten. Bruce hatte vor Jahren damit begonnen, die Sonntagsausgaben von Times, Post, Enquirer, Tribune, Baltimore Sun, Pittsburgh Post-Gazette und Boston Globe zu verkaufen. Außer den Zeitungen gab es die legendären warmen Butterbrötchen aus dem Restaurant um die Ecke, nur sonntags. Um 9.30 Uhr waren das Café im oberen Stockwerk und der Lesebereich im Erdgeschoss voll mit Yankees, die Neuigkeiten von zu Hause verschlangen. Es war eine Art Ritual geworden, und viele der Stammkunden verpassten keinen Sonntagmorgen in der Buchhandlung. Bruce hatte schon vor langer Zeit die Erfahrung gemacht, dass die meisten Bücher von Frauen gekauft wurden, doch am Sonntagmorgen waren ausnahmslos Männer da, und die Diskussionen über Politik und Sport waren häufig laut und hitzig. Auf dem Balkon des Cafés war das Rauchen gestattet, und für gewöhnlich hing dichter Zigarrenqualm über der Main Street.
Mercer und Thomas kamen am späten Vormittag, rechtmäßig verheiratet, bemerkenswert wach und reisefertig. Bruce führte sie in sein Büro im Erdgeschoss, den Raum mit den Erstausgaben, wo er einige seiner wertvollsten Raritäten ausstellte. Er schenkte Kaffee ein, dann sprachen sie über den gestrigen Abend. Die Frischvermählten konnten es allerdings kaum erwarten, dass ihre Flitterwochen begannen. Ein langes Abenteuer lag vor ihnen.
»Du hast gestern von der besten Geschichte aller Zeiten gesprochen«, sagte Mercer mit einem Lächeln.
»So ist es. Ich werde mich kurzfassen. Es ist eine wahre Geschichte, aus der sich aber auch ein Roman machen ließe. Ihr habt sicher schon von Dark Isle gehört, unmittelbar nördlich von hier.«
»Kann sein, ich bin mir nicht sicher.«
»Die Insel ist unbewohnt, oder?«, sagte Thomas.
»Vermutlich, aber es gibt auch Zweifel daran. Dark Isle ist eine von zwei kleineren Barriereinseln zwischen Florida und Georgia und wurde nie richtig besiedelt. Sie ist etwa fünf Kilometer lang und nicht ganz zwei Kilometer breit, mit unberührten Stränden.«
Mercer nickte. »Jetzt erinnere ich mich. Tessa hat vor Jahren von der Insel gesprochen. Angeblich spukt es dort oder so.«
»Oder so. Vor Jahrhunderten, irgendwann um 1750 herum, wurde sie zu einem sicheren Ort für entflohene Sklaven aus Georgia, das damals noch von den Briten regiert wurde und Sklaverei erlaubte. Florida war unter spanischer Flagge, und obwohl die Sklaverei nicht gegen das Gesetz verstieß, wurde Sklaven Zuflucht gewährt. Zwischen den beiden Ländern gab es lange Streit darüber, was mit den Sklaven geschehen solle, die nach Florida entkamen. Georgia wollte sie zurückhaben. Die Spanier wollten sie beschützen, einzig und allein deshalb, um die Briten und ihre amerikanischen Kolonien zu ärgern. Um 1760 wollte ein Sklavenschiff, das aus Westafrika zurückkehrte, in Savannah anlegen, als es von einem heftigen Sturm aus dem Norden, den wir heute Nor’easter nennen, gedreht, nach Süden abgedrängt und schwer beschädigt wurde. Das Schiff namens Venus war aus Virginia und hatte etwa vierhundert Sklaven an Bord, die zusammengepfercht waren wie die Sardinen in der Büchse. Es hatte in Afrika mit vierhundert Sklaven abgelegt, aber viele waren auf See gestorben. An Bord herrschten unvorstellbare Zustände, um es milde auszudrücken. Jedenfalls sank die Venus etwa eineinhalb Kilometer vor Cumberland Island. Da die Sklaven in Ketten waren, ertranken fast alle. Einige klammerten sich an Wrackteile und wurden von dem Sturm auf Dark Island angeschwemmt, wie die Insel später genannt wurde. Oder Dark Isle. 1760 hatte sie jedenfalls noch keinen Namen. Die Überlebenden wurden von den entflohenen Sklaven aus Georgia aufgenommen, und zusammen bauten sie eine kleine Gemeinde auf. Zweihundert Jahre vergingen, alle starben oder zogen weg, und heute ist die Insel verlassen.«
Bruce trank einen Schluck Kaffee und wartete auf eine Reaktion.
»Klingt gut, aber ich schreibe nicht über historische Themen«, sagte Mercer.
»Was ist der Aufhänger?«, fragte Thomas. »Gibt es so etwas wie eine Handlung?«
Bruce lächelte und nahm etwas in die Hand, was wie ein dünnes Taschenbuch aussah. Er zeigte ihnen den Titel: Die dunkle Geschichte von Dark Isle. Von Lovely Jackson.
Keiner von beiden griff danach, was Bruce nicht weiter störte. »Das ist ein selbst veröffentlichtes Buch, von dem vielleicht dreißig Exemplare verkauft wurden«, sagte er. »Es wurde von der letzten noch lebenden Erbin von Dark Isle geschrieben, jedenfalls behauptet sie das. Lovely Jackson wohnt hier auf Camino, in der Nähe der alten Konservenfabriken, in einem Viertel, das The Docks genannt wird.«
»Ich weiß, wo das ist«, warf Mercer ein.
»Sie behauptet, 1940 auf Dark Isle geboren worden zu sein und die Insel mit ihrer Mutter zusammen verlassen zu haben, als sie fünfzehn war.«
»Woher kennst du sie?«, fragte Mercer.
»Sie ist vor ein paar Jahren hier reingekommen, eine Tasche voll mit diesen Büchern unterm Arm, und wollte eine Signierstunde veranstalten. Wie ihr wisst, habe ich mich mehr als einmal darüber beschwert, dass die Selbstverleger einen Buchhändler in den Wahnsinn treiben können. Sie war sehr aufdringlich, sehr fordernd. Ich versuche, solche Leute zu meiden, aber Lovely war mir sympathisch, und ihre Geschichte ist faszinierend. Ich war geradezu begeistert von ihr. Wir haben also eine Signierstunde organisiert. Ich habe Druck auf unsere Freunde ausgeübt, von denen die meisten fast alles tun, wenn sie dafür ein Glas Wein umsonst bekommen, und hinterher gab es eine schöne Party. Lovely war mir sehr dankbar.«
»Ich warte immer noch auf eine Handlung«, sagte Thomas trocken.
»Die Handlung wäre folgende: Wie in Florida eben so üblich, haben die Immobilienhaie auf der Suche nach einem unberührten Strand jeden Quadratzentimeter des Staates abgeklopft. Dark Isle haben sie schon vor Jahren gefunden, aber es gab ein großes Problem. Die Insel ist so klein, dass der Bau einer Brücke nicht gerechtfertigt wäre. Die Bauunternehmer hätten nie genug Eigentumswohnungen, Hotels, Wasserparks, T-Shirt-Läden und so weiter planen können, dass der Staat überzeugt gewesen wäre, die Kosten für eine Brücke zu übernehmen. Dark Isle wurde also vergessen. Hurrikan Leo hat das geändert. Er hat sich mit seinem Auge direkt über die Insel bewegt, die Nordspitze abgeschnitten und Tonnen von Sand zu einem gigantischen Riff zusammengeschoben, das das südliche Ende mit einer Stelle in der Nähe von Dick’s Harbor auf dem Festland verbindet. Die Ingenieure sagen, dass der Bau einer Brücke jetzt viel billiger wäre. Und die Bauunternehmer haben sich wie die Geier darauf gestürzt und üben Druck auf ihre Freunde in Tallahassee aus.«
»Dann ist also Lovely Jackson die Handlung«, stellte Thomas fest.
»Du hast es erfasst. Sie behauptet, die alleinige Eigentümerin der Insel zu sein.«
»Wenn sie nicht dort lebt, warum verkauft sie dann nicht einfach alles an die Bauunternehmer?«, fragte Mercer.
Bruce warf das Buch auf einen Haufen mit anderen und trank Kaffee. Er lächelte. »Weil es geheiligter Boden ist. Ihre Familie ist dort begraben. Eine ihrer Vorfahrinnen, eine Frau namens Nalla, war auf der Venus. Lovely wird nicht verkaufen. Basta.«
»Wie stehen die Bauunternehmer zu dem Ganzen?«, fragte Thomas.
»Sie haben Anwälte und sind ein zäher Haufen. Sie behaupten, es gäbe keine Aufzeichnungen darüber, dass Lovely überhaupt auf der Insel geboren wurde. Vergesst nicht, dass sie die einzige lebende Zeugin ist. Alle anderen Verwandten sind seit Jahrzehnten tot.«
»Und die bösen Jungs haben da wohl große Pläne, ja?«, sagte Mercer.
»Soll das ein Witz sein? Reihenweise Eigentumswohnungen, Hotelanlagen, Golfplätze. Es geht sogar das Gerücht um, dass sie sich mit den Seminolen zusammengetan haben und ein Spielcasino bauen wollen. Von hier aus muss man zwei Stunden fahren, wenn man in einer etwas gepflegteren Umgebung spielen will. In drei Jahren wird die ganze Insel asphaltiert sein.«
»Und Lovely kann sich keine Anwälte leisten?«
»Natürlich nicht. Sie ist über achtzig und bekommt nur eine kleine Rente.«
»Über achtzig?«, wiederholte Mercer. »Weißt du das ganz sicher?«
»Nein. Es gibt keine Geburtsurkunde, keine offiziellen Einträge oder dergleichen. Nirgends. Wenn du ihr Buch liest – und ich schlage vor, dass du sofort damit anfängst –, wird dir klar werden, wie isoliert diese Leute jahrhundertelang gelebt haben.«
»Ich habe schon genug Bücher für die Reise eingepackt«, sagte Mercer.
»Okay, es ist deine Karriere, nicht meine. Aber vielleicht macht dich das hier neugierig. Einer der Gründe, warum die Leute dort so zurückgezogen gelebt haben, ist, dass Nalla eine afrikanische Heilerin war, eine Art Voodoo-Priesterin oder so. Eine eindrückliche Szene im Buch beschreibt, wie sie die Insel mit einem Fluch belegt, um sie vor Außenstehenden zu schützen.«
Thomas wiegte bedächtig den Kopf. »Jetzt wittere ich eine Handlung.«
»Gefällt sie dir?«
»O ja.«
»Ich fange gleich zu lesen an, wenn wir im Flugzeug sitzen«, sagte Mercer.
»Schreib mir aus Schottland, wenn du fertig bist«, meinte Bruce.
3.
Als das Flugzeug irgendwo über South Carolina auf seiner endgültigen Flughöhe war, holte Mercer das Buch aus der Reisetasche und sah sich das Cover an. Die Illustration war nicht schlecht. Sie zeigte eine schmale, unbefestigte Straße, gesäumt von großen Eichen, an denen Spanisches Moos bis fast zum Boden wuchs. Die Bäume wurden allmählich tiefschwarz und gingen dann in den Titel über: Die dunkle Geschichte von Dark Isle. Am unteren Rand stand der Name der Autorin: Lovely Jackson. Bei dem Verlag handelte es sich um einen kleinen Bezahlverlag in Orlando. Keine Widmung, kein Autorinnenfoto, keine Zusammenfassung des Inhalts auf der Umschlagrückseite. Und offenbar keinerlei Lektorat.
Mercer erwartete einen schlichten Schreibstil mit höchstens Dreisilbenwörtern. Kurze, direkte Sätze, wenige Kommas. Mit Sicherheit keine literarischen Schnörkel. Der Text war jedoch gut zu lesen und die Geschichte derart packend, dass sie ihre ziemlich arroganten Einwände aus dem Blickwinkel einer Autorin und Professorin verdrängte und sich in dem Buch verlor. Nachdem sie das erste Kapitel ohne eine Pause beendet hatte, wurde ihr klar, dass die Schreibweise weitaus wirkungsvoller und fesselnder war als der größte Teil der Texte, die sie von ihren Studenten zu sehen bekam, und Stil und Handlung waren interessanter als die meisten der gehypten Debütromane, die im letzten Jahr auf der Beststellerliste gelandet waren.
Ihr fiel auf, dass Thomas sie beobachtete. »Hm?«
»Du scheinst schnell voranzukommen«, sagte er. »Wie ist es?«
»Ziemlich gut.«
»Wann kann ich es lesen?«
»Wenn ich fertig bin?«
»Wie wäre es, wenn wir uns abwechseln? Du liest ein Kapitel, ich lese das nächste, dann bist du wieder an der Reihe.«
»Ich habe ein Buch noch nie so gelesen und nicht vor, jetzt damit anzufangen.«
»Es ist ganz einfach, schließlich lese ich zweimal so schnell wie du.«
»Versuchst du etwa, mich zu provozieren?«
»Andauernd. Wir sind seit etwa zwanzig Stunden verheiratet. Es wird Zeit für unseren ersten Ehekrach.«
»Den Köder schlucke ich nicht, mein Lieber. Und jetzt steck deine Nase in dein eigenes Buch, und lass mich in Ruhe.«
»Okay, aber beeil dich.«
Sie sah ihn an, lächelte und schüttelte den Kopf. »Wir haben letzte Nacht vergessen, unsere Ehe zu vollziehen«, sagte sie schließlich.
Thomas blickte sich um und vergewisserte sich, dass keiner der anderen Passagiere sie hören konnte. »Wir vollziehen seit drei Jahren.«
»Nein, Romeo, zumindest im biblischen Sinn ist eine Ehe erst dann offiziell, wenn wir unser Gelübde gesprochen, zu Mann und Frau erklärt wurden und den Akt vollzogen haben.«
»Dann bist du im biblischen Sinn also noch Jungfrau?«
»So weit würde ich nicht gehen.«
»Ich war müde und hatte zu viel getrunken. Tut mir leid. Wir holen das in Schottland nach.«
»Wenn ich so lange warten kann.«
»Merk dir, wo wir stehen geblieben sind.«
4.
Nalla war neunzehn, als sich ihr kurzes, glückliches Leben für immer veränderte. Sie und ihr Mann Mosi hatten ein Kind, einen drei Jahre alten Jungen. Sie gehörten dem Stamm der Luba an und lebten in einem Dorf im südlichen Teil des Königreichs Kongo.
Das Dorf schlief. Die Nacht war ruhig. Plötzlich drangen panische Stimmen durch die Dunkelheit. Eine Hütte brannte, Menschen schrien. Nalla wurde als Erste wach und schüttelte Mosi. Ihr Sohn lag auf einer Matte zwischen ihnen. Wie alle anderen rannten sie auf die Flammen zu, um zu helfen, aber das Ganze war weitaus schlimmer als nur ein Feuer. Es war ein Überfall. Die Hütte war von mordlüsternen Angehörigen eines anderen Stammes angezündet worden, der sich bis vor Kurzem um seine eigenen Angelegenheiten gekümmert hatte, doch inzwischen waren die Stammesmitglieder Sklavenjäger. Sie kamen mit Knüppeln und Peitschen aus dem Dschungel und begannen, auf die Menschen einzuprügeln. Als erfahrene Plünderer wussten sie, dass ihre Opfer zu überrascht und verwirrt sein würden, als dass sie sich groß wehrten. Sie schlugen sie, überwältigten sie und legten sie in Ketten, achteten aber darauf, so wenige wie möglich umzubringen. Die Dorfbewohner waren zu wertvoll, tot brachten sie nichts. Die Älteren wurden zurückgelassen, damit sie sich um die Kinder sorgen konnten, die innerhalb weniger Minuten zu Waisen wurden. Die Frauen schrien und riefen nach ihren Kindern, die plötzlich verschwunden waren. Man hatte sie in den Dschungel geführt, wo sie am nächsten Tag freigelassen werden würden. Kleine Kinder hatten für die Sklavenhändler nur einen geringen Wert.
Nalla schrie nach Mosi, bekam aber keine Antwort. In der Dunkelheit wurden die Männer von den Frauen getrennt. Sie rief nach ihrem Jungen, und weil sie nicht aufhörte zu schreien, wurde sie von einem der Angreifer mit einem Knüppel geschlagen. Sie stürzte zu Boden und spürte Blut an ihrem Kinn. Im Feuerschein sah sie, wie die mit großen Macheten und Messern bewaffneten Männer die Dorfbewohner, Nallas Freunde und Nachbarn, zusammentrieben. Sie brüllten Befehle und drohten, jeden zu töten, der sich widersetzte. Das Feuer breitete sich aus und wurde immer tosender. Nalla wurde wieder zu Boden gestoßen, dann wies man sie an, aufzustehen und in den Dschungel zu gehen. Etwa ein Dutzend Frauen waren aneinandergekettet, fast alles junge Mütter, die weinend nach ihren Kindern riefen. Die Angreifer herrschten sie an, still zu sein. Weil sie sich nicht beruhigten, hieb ein Mann mit einer Peitsche auf sie ein.
Tief im Dschungel, weit weg vom Dorf, mussten sie auf einer Lichtung stehen bleiben, wo ein Ochsenkarren auf sie wartete. Er war mit Ketten, Handschellen und Fußfesseln beladen. Die Frauen trugen nur die üblichen Lendenschurze. Sie wurden ihnen abgenommen, sodass sie ganz nackt waren. Die Angreifer legten ihnen Halseisen an, die durch Ketten miteinander verbunden wurden. Aneinandergefesselt wurden die Frauen im Gänsemarsch weitergetrieben. Sollte eine von ihnen einen Fluchtversuch unternehmen, würden die anderen mitgerissen werden und zu Boden stürzen.
Die Frauen hatten jedoch zu viel Angst, als dass sie weglaufen wollten. Es war stockdunkel im Dschungel. Sie kannten ihn gut und wussten um seine Gefahren, vor allem nachts. Der Ochsenkarren fuhr voraus, mit einem Jungen auf dem Bock, der in der einen Hand eine Fackel und in der anderen die Zügel hielt. Die Frauen wurden von zwei bewaffneten Sklavenjägern begleitet, der eine vorn, der andere hinten, beide mit einer Peitsche. Als sie keine Kraft zum Weinen mehr hatten, schleppten sie sich stumm weiter. Das Klirren der Ketten war meist das einzige Geräusch.
Sie bemerkten, dass in der Nähe andere Menschen waren. Vielleicht wurden weitere Nachbarn aus ihrem Dorf weggeführt, ihre Ehemänner, Väter und Brüder. Als sie die Stimmen von Männern hörten, begannen die Frauen sofort, die Namen ihrer Angehörigen zu rufen. Die Sklavenfänger fluchten und ließen die Peitschen knallen. Die Stimmen der Männer verstummten allmählich.
Der Ochsenkarren blieb an einem Bach stehen, den die Frauen gut kannten, weil sie sonst dort badeten und die Wäsche wuschen. Die Sklavenfänger sagten, sie würden die Nacht hier verbringen, und befahlen den Frauen, sich neben dem Ochsenkarren zu versammeln. Sie waren immer noch aneinandergekettet, und eine Stunde später war ihre Haut von den Halseisen wund gerieben. Die Gefangenen wurden für die Nacht zusätzlich gefesselt.
Der Junge fachte ein kleines Feuer an und kochte in einem Topf roten Reis. Er warf Maniokblätter und Okra hinein, und als alles fertig war, aßen er und die beiden Männer zu Abend, alle mit demselben Holzlöffel. Die Frauen waren so müde und verängstigt, dass sie keinen Hunger verspürten, aber sie beobachteten die Männer, weil es nichts anderes zu sehen gab. Sie drängten sich zusammen, ihre Ketten rasselten bei jeder noch so kleinen Bewegung. Sie flüsterten miteinander und trauerten um ihre Kinder und Männer.
Würden sie je wieder nach Hause kommen?
Es hatte Gerüchte gegeben, nach denen im Norden des Landes Sklavenjäger unterwegs seien, aber das war weit weg gewesen, sodass sie sich keine Sorgen gemacht hatten. Der Anführer ihres Dorfs hatte sich mit anderen Stämmen getroffen und von den Warnungen gehört. Er hatte den Männern befohlen, ihre Waffen nachts stets griffbereit zu halten und auf der Jagd und beim Fischfang vorsichtig zu sein.
Als das Feuer erlosch, wurde die Nacht noch dunkler. Das Flüstern der Frauen würde von den Männern gehört werden, daher behielten sie ihre Gedanken für sich. Der Junge schlief neben dem Feuer ein. Die beiden Männer verschwanden. Eine der Frauen raunte, dass sie einen Fluchtversuch unternehmen sollten, aber das schien unmöglich zu sein. Selbst beim Atmen rasselten die Ketten, mit denen sie aneinandergefesselt waren.
Plötzlich waren die beiden Männer wieder da. Sie packten Sanu, die jüngste Gefangene, ein vierzehnjähriges Mädchen, dessen Mutter zurückgelassen worden war. Sie nahmen ihr das Halseisen ab und lösten die Ketten. Sanu wehrte sich und schrie, woraufhin die Männer sie schlugen und beschimpften. Sie verschwanden mit ihr im Dschungel. Die Frauen konnten über lange Zeit hören, wie die Männer sich abwechselnd an ihr vergingen. Als das Mädchen zurückkehrte, schluchzte und zitterte es, als hätte es einen Anfall. Die Männer legten Sanu wieder in Ketten und drohten den Frauen die gleiche Behandlung an, falls sie miteinander redeten oder zu fliehen versuchten. Vor Angst drängten sie sich noch enger zusammen. Nalla blieb bei Sanu und flüsterte ihr beruhigend zu, aber das Zittern hörte nicht auf.
Die Männer waren müde und erschöpft und schliefen bald ein. Für die Gefangenen war Schlaf undenkbar. Sie waren körperlich und seelisch am Ende. Die Fesseln und Ketten waren grauenvoll, und sie wollten nach Hause zu ihren Kindern und Männern.
Bei Tagesanbruch ging es weiter, und sie entfernten sich immer mehr von ihrem Dorf. Der Dschungel lichtete sich, die Sonne stieg höher und brannte vom Himmel. Am späten Vormittag erreichten sie ein Tal, das die meisten von ihnen noch nie zu Gesicht bekommen hatten. Der Ochsenkarren blieb stehen, und die Frauen wurden zu einem Baum geführt, wo sie sich hinsetzen sollten. Der Junge entfachte ein Feuer und kochte wieder roten Reis mit Okra. Die Männer aßen zuerst, wieder alle mit demselben Holzlöffel. Was übrig war, wurde unter den Frauen verteilt, die Sanu als Erste essen ließen. Sie wollte nicht, hatte keinen Appetit. Der kleine Rest Reis wurde von den anderen sorgsam aufgeteilt, jede nahm ein paar Bissen zu sich. Sie hatten Hunger und brauchten Wasser.
Im Gänsemarsch gingen sie niedergedrückt weiter. Die einzigen Geräusche waren die quietschende Achse des Ochsenkarrens und das Klirren der Ketten. Die Männer legten sich abwechselnd hinten in den Ochsenkarren, um ein Schläfchen zu machen. Sie beobachteten die Frauen die ganze Zeit, als überlegten sie, welche von ihnen sie sich für die Nacht vornehmen wollten. Bei einem Bach hielten sie an, um Wasser zu trinken, dann ruhten sie sich etwa eine Stunde lang im Schatten eines Baumwollbaums aus. Das Mittagessen bestand aus einem kleinen Apfel und einem Stück hartes Brot. Nachdem die Frauen gegessen und genug Wasser zum Trinken bekommen hatten, durften sie in den Bach waten und sich waschen.
Nach Einbruch der Dunkelheit wurde eine Frau namens Shara ausgewählt. Als die Männer ihr das Halseisen abnahmen, versuchte sie, sich loszureißen, und ging auf sie los. Die Männer verprügelten sie mit einem großen Stock, dann banden sie sie an einen Baum und schlugen so lange mit einer Peitsche auf sie ein, bis sie bewusstlos war. Sie beschimpften die anderen Frauen und drohten jeder, die sich wehrte, die gleiche Bestrafung an. Die Frauen hatten schreckliche Angst. Weinend klammerten sie sich aneinander.
Einer der Männer kam zu ihnen und deutete auf Nalla. Sie war nicht so dumm, sich zu widersetzen. Shara hatte sich gewehrt, und jetzt war sie so gut wie tot. Die Männer zerrten Nalla zwischen die Bäume und vergewaltigten sie.
Die Frauen konnten auch in dieser Nacht kaum schlafen, obwohl sie erschöpft, ausgetrocknet und verängstigt waren und Schmerzen und Hunger sie plagten. Die arme Shara machte alles noch schlimmer. Sie war immer noch an den Baum gebunden und stöhnte die ganze Zeit über. Irgendwann in der Nacht hörte das Stöhnen auf.
5.
Bei Tagesanbruch begannen die Männer zu streiten. Shara war in der Nacht gestorben, und sie gaben sich gegenseitig die Schuld daran. Als sie aufbrachen, zwangen sie die Frauen, dicht an dem Baum mit der Leiche vorbeizugehen. Alle verabschiedeten sich weinend von ihrer Freundin. Die Halseisen machten es unmöglich, den Kopf zu drehen, aber Nalla gelang es, einen Blick zurückzuwerfen. Shara umarmte immer noch den Baum, die Hände mit einem Seil zusammengebunden, der nackte Körper mit getrocknetem Blut bedeckt.
Tagelang schleppten sie sich auf den heißen Dschungelpfaden weiter und wurden immer schwächer. Sie wussten, dass sie sich nach Westen bewegten und das Meer näher kam, obwohl sie es nie gesehen hatten. Es war Teil der Überlieferungen, der Legende Afrikas. Das Dorf war weit weg, und ihnen war klar, dass sie nicht nach Hause zurückkehren würden. Seit über zwei Jahrhunderten wurden die Kongolesen und andere Westafrikaner überfallen, in Ketten gelegt, verschleppt und in die Sklaverei verkauft, an die Kolonisten in der Neuen Welt. Die Frauen wussten, was sie erwartete. Nallas einzige Hoffnung war, Mosi wiederzusehen.
Die Tage verschwammen zu einer grauen Masse, und Zeit bedeutete nichts mehr. Überleben war alles, was ihnen durch den Kopf ging, wenn sie einmal zur Ruhe kamen. Die unerbittlich vom Himmel brennende Sonne machte alles noch schlimmer. Hunger und Wassermangel zermürbten sie Stunde um Stunde. Nachts, wenn der Wind von Norden blies, drängten sich die Frauen enger zusammen, um sich gegenseitig zu wärmen, während die Aufseher an einem kleinen Feuer schliefen.
Als sie nichts mehr zu essen hatten, begannen die Männer zu streiten. Sie befahlen dem Jungen, den Ochsenkarren auf einen anderen Pfad in Richtung Süden zu lenken. Bei Einbruch der Dämmerung konnten sie den Rauch von Feuerstellen riechen und erreichten ein kleines Dorf am Rand des Dschungels. Zäune aus Brettern und Draht umgaben einen Hof, auf dem Gefangene wie sie selbst zusammengepfercht waren. Dutzende von ihnen, Männer und Frauen voneinander getrennt. Ein Sklavengehege. Mehrere der Aufseher trugen ein Gewehr. Sie starrten die sich nähernden Frauen an. Ein Tor wurde geöffnet, sie gingen hinein, dann nahm man ihnen Halseisen und Ketten ab. Eine grauhaarige Afrikanerin in einem Sackkleid schmierte Tierfett aus einer Schale auf ihre Blasen und offenen Wunden. Sie gab ihnen Bohnen und gutes Brot, und die Frauen aßen, bis sie satt waren. Die Farm gehörte der Frau und ihrem Mann, und die beiden bekamen ein wenig Geld von durchziehenden Sklavenhändlern. Die Frau erklärte den Gefangenen, dass sie vermutlich an andere Händler verkauft und weggebracht würden. Sie taten ihr leid, doch an ihrer misslichen Lage konnte sie wenig ändern.
In dem eingezäunten Hof gab es auch ein paar Kinder. Nalla und die anderen Mütter aus ihrem Dorf starrten sie voller Trauer und Mitleid an. Sie sehnten sich nach ihren eigenen, doch waren die nicht besser dran, weil sie zurückgelassen worden waren? Die älteren Dorfbewohner würden sich um sie kümmern. Die armen Kinder im Sklavengehege wirkten geschwächt und hungrig. Viele wiesen offene Wunden und Insektenstiche auf. Sie spielten nicht und hüpften nicht herum, wie normale Kinder es taten.
Das Gehege war durch einen hohen Drahtzaun in zwei Hälften getrennt. Dort trafen sich die Männer und Frauen, um nach einem bekannten Gesicht zu suchen. Mosi war nicht da, aber Nalla entdeckte einen anderen Mann aus ihrem Dorf, mit dem sie sprechen konnte. Er sagte, sie seien am ersten Tag in drei Gruppen aufgeteilt worden. Mosi sei mit einigen anderen zusammen weggeführt worden. Nalla wiederum sagte, dass sie weder seine Frau noch seine beiden Töchter gesehen habe.
In der Nacht fiel heftiger Regen, begleitet von Blitzen und starkem Wind. Das Sklavengehege besaß kein Dach. Sie drängten sich zwischen den Stelzen einer kleinen Hütte zusammen und schliefen im Schlamm. Am nächsten Morgen brachte die grauhaarige Frau Brot und roten Reis. Während sie das Essen verteilte, bemerkte sie bei einem der Kinder einen Hautausschlag. Sie befürchtete, dass es die Masern waren, und brachte das Kind in eine Hütte. Sie sagte, dass vor einem Monat drei Kinder an Pocken gestorben seien.
Nach einer Woche im Sklavengehege wurden die Frauen wieder voneinander getrennt, und man sagte ihnen, dass sie aufbrechen würden. Eine andere Gruppe von Aufsehern trieb zwanzig Frauen und drei Kinder zusammen und brachte Ketten und eiserne Fesseln. Nalla und ihre Freundinnen waren gerade zum ersten Mal verkauft worden.
Es gab eine neue Vorrichtung, eine neue Form der Folter: ein massives, knapp zwei Meter langes Holzbrett mit Schlaufen aus Metall an beiden Enden, eine für jede Gefangene. Die Schlaufen wurden ihnen um den Hals gelegt, sodass zwei Frauen nicht nur aneinandergefesselt waren, sondern bei jedem Schritt auch noch das schwere Brett tragen mussten. Um ihre Taille wurde eine Kette geschlungen, die durch das Halseisen eines Kindes geführt wurde, das zwischen den beiden Frauen unter dem Brett einherging. Und um das Ganze noch schlimmer zu machen, stellten die Männer Wasser und Essensvorräte auf die Bretter, damit ihre Gefangenen noch mehr Gewicht auf den Schultern hatten.
Nach ein paar Minuten auf dem Pfad bedauerte Nalla fast, dass sie nicht wieder das Halseisen trug. Im Grunde genommen war es jedoch egal. Die beiden Foltermethoden nahmen sich nicht viel.
Die Tage vergingen, und die Sonne brannte immer heißer vom Himmel. Die Frauen wurden schwächer und aufgrund der Hitze häufig ohnmächtig. Wegen des Holzbretts auf ihren Schultern sanken beide Frauen zu Boden, wenn eine von ihnen bewusstlos wurde. Die Aufseher gaben der Ohnmächtigen Wasser. Wenn sie das nicht wieder zur Besinnung brachte, zückten sie die Peitsche.
Der Gerechtigkeit wurde zumindest ein wenig Genüge getan, als der Aufseher, der die Frauen am meisten quälte, auf eine große Grüne Mamba trat und schreiend zusammenbrach. Die Schlange konnte flüchten, als die Gefangenen vor Angst auseinanderstoben. Sie wurden wieder zusammengetrieben und unter einen Baum gedrängt, wo sie sich im Schatten ausruhten und zufrieden und entsetzt zugleich beobachteten, wie sich der Mann unter heftigen Zuckungen übergab und stöhnte, bis er schließlich starb. Es war nicht schade um ihn.
Einmal waren sie oben auf einem Hügel und sahen in der Ferne das Meer. Das blaue Wasser hatte etwas Tröstliches an sich, bedeutete es doch das Ende ihrer beschwerlichen Reise. Das Meer machte sie aber auch tieftraurig, weil sie wussten, dass es sie für immer von hier fortbringen würde.
Zwei Stunden später näherten sie sich wieder einem Dorf. Kleine Boote lagen in der Bucht vor Anker. Der Ochsenkarren fuhr quietschend weiter und hielt schließlich an einem Lager, das als »Fort« bezeichnet wurde. Die Frauen wurden zu einem Schattenbaum geführt, und man befahl ihnen zu warten. Durch den Zaun konnten sie weitere Gefangene im Innern des Forts sehen, Frauen und Kinder ganz in der Nähe und Männer in einem zweiten großen Sklavengehege. Sie suchten vergeblich nach einem bekannten Gesicht.
Schließlich kam der Boss, ein Afrikaner, der jedoch westliche Kleidung und Armeestiefel trug. Er blaffte die Frauen an und befahl ihnen aufzustehen. Dann begann er damit, jede von ihnen zu untersuchen. Er begrapschte bemüht gelangweilt ihre Brüste, betastete ihren Schambereich und zwickte sie ins Gesäß. Er ließ sich Zeit, und als er fertig war, sagte er zu den beiden Aufsehern, dass sie ihm eine gute Auswahl gebracht hätten. Zwanzig Frauen, alle jung, einigermaßen gesund und vermutlich fähig, viele Nachkommen zu gebären. Außerdem drei hungrige Kinder, die nicht viel wert waren. Der Boss und die Aufseher fingen an zu feilschen, und das Gespräch wurde lebhafter. Häufiges Händeschütteln, hin und wieder ein paar heftige Worte. Es war offensichtlich, dass die Männer sich kannten und nicht zum ersten Mal Geschäfte miteinander machten. Als sie sich schließlich einig waren, zog der Boss einen kleinen Beutel mit Münzen hervor und zahlte für die Gefangenen.
Damit wurden Nalla und die anderen zum zweiten Mal verkauft.
Die Gefangenen wurden durch ein Tor auf einen ungepflasterten Hof geführt, wo man ihnen die Holzbretter und Ketten abnahm. Danach durften sie sich frei bewegen. Sie entdeckten weitere Frauen ihres Stammes, und alle erzählten einander, was sie Schreckliches erlebt hatten. Ein paar der Frauen hatten offene Wunden am Rücken, da sie ausgepeitscht worden waren. Fast alle waren junge Mütter, die sich nach ihren verlorenen Kindern sehnten.
Auf der anderen Seite des Forts gab es ein größeres Sklavengehege mit mehreren Dutzend Männern, die sich bemühten, einen Blick auf die Frauen zu erhaschen. Nalla und die anderen gingen so nah wie möglich an die Umzäunung heran, konnten aber kein bekanntes Gesicht entdecken.
Die Frauen bekamen Brot und Wasser und zogen sich in den Schatten hinter einer der Hütten zurück. Drei Tage zuvor hatte ein Schiff mit fast zweihundert Gefangenen an Bord abgelegt, aber das Fort füllte sich bereits wieder. Der Sklavenhandel florierte. Niemand wusste, wann das nächste Sklavenschiff ankam und sie abholte. Sicher war nur, dass sie nie wieder nach Hause kommen würden. Alle Frauen hatten entweder einen Ehemann oder ein Kind oder beides verloren. Nalla offenbarte, dass sie vergewaltigt worden war, und einige der anderen sagten, ihnen sei es ebenso ergangen. Alle Frauen waren ausgemergelt, unterernährt und gänzlich nackt.
Der Schrecken begann jeden Abend nach Einbruch der Dunkelheit, wenn die Soldaten kamen. Für ein paar Münzen gewährte ihnen der Boss Zutritt zum Fort, wo sie sich an den Frauen vergingen, die allesamt Freiwild waren.
Die Zustände im Fort waren erbärmlich. Die meisten Gefangenen hatten nicht einmal ein Dach über dem Kopf und schliefen auf dem nackten Boden. Die wenigen Hütten waren für jene reserviert, die an der Ruhr und Skorbut litten. Ein kurzes Gewitter verwandelte den roten Staub in Schlamm. Essen gab es nur sporadisch und bestand dann aus alten, harten Brotlaiben und irgendwelchen Früchten, die der Boss aufgetrieben hatte. Als Latrine diente ein großes Loch in der Ecke, das mit Abwasser gefüllt war. Sie zu benutzen war tückisch. Die Wände der Grube waren mit Fäkalien überzogen, und mindestens einmal am Tag fiel jemand hinein. Das Fort war eine Brutstätte für Ratten und Moskitos, von denen einige so groß wie Hornissen waren. Nachts beschützte niemand die Frauen. Die Aufseher fielen genauso über sie her wie die Soldaten, die ständig in der Nähe herumlungerten.
Und so warteten sie, tagaus, tagein. Das Fort füllte sich zusehends, und mehr Menschen hieß weniger Essen für alle. Die Blicke der Frauen wanderten immer öfter zum Hafen. Voller Verzweiflung hofften sie, dass bald ein Sklavenschiff kam und sie fortbrachte.
6.
Eines Morgens, etwa zwei Wochen nach ihrer Ankunft – sie hatten keine Ahnung, was für ein Wochentag gerade war –, wurde Nalla wach und stand auf. Zwei Frauen deuteten auf den Hafen. Dort war endlich ein Schiff vor Anker gegangen. Stunden vergingen, und nichts geschah, dann bot sich ihnen ein seltsamer Anblick. Zum ersten Mal sahen sie einen Weißen. Er und der Boss setzten sich vor eine der Hütten und verhandelten.
Nachdem der Weiße wieder gegangen war, änderte sich die Stimmung im Fort schlagartig. Die Aufseher holten Ketten und Hals- und Fußeisen aus einer der Hütten. Sie befahlen den Frauen, sich in einer Reihe aufzustellen, und legten ihnen dann wieder Fesseln an. Wer sich wehrte, wurde ausgepeitscht, und die andern mussten dabei zuschauen. Nalla war in der ersten Gruppe von dreißig Gefangenen, die aus dem Fort geführt wurden, verfolgt von den Blicken aller anderen Männer und Frauen. Sie würden schon bald selbst an der Reihe sein.
Die Frauen wurden auf einem Pfad zur Bucht hinuntergeführt. Die Dorfbewohner ließen alles stehen und liegen und sahen voller Mitleid zu, wie die Gefangenen weggebracht wurden. Am Hafenbecken wurden Nalla und die anderen über einen schmalen Steg zu einem Boot geführt, neben dem ein paar Weiße standen, die ihnen in einer fremden Sprache etwas zuriefen.
Es war Englisch. Die Männer waren Amerikaner.
Die Frauen wurden auf das Deck gestoßen, dann mussten sie über eine schwankende Leiter in einen Laderaum mit geschlossenen Bullaugen klettern. Mit dem Lastenboot konnten fünfzig Sklaven auf einmal befördert werden. Es dauerte einige Zeit, bis die Fracht an Bord war. Nalla und die Frauen warteten in der Dunkelheit unten in der stickigen, übel riechenden Luft. Manchmal konnten sie kaum noch atmen. Sie rangen keuchend nach Luft und weinten vor lauter Angst. Einer der Aufseher öffnete eines der Bullaugen und ließ frische Luft herein. Schließlich legten sie ab, und das Boot begann leicht zu schaukeln. Luft strömte durch den Laderaum. Die Frauen waren noch nie auf dem Meer gewesen, und von den Bootsbewegungen wurde ihnen schlecht.
Eine halbe Stunde später befahl man ihnen, aus dem Laderaum herauszukommen. Über eine steile Laufplanke kletterten sie an Deck der Venus.
Was sie dort sahen, erschütterte sie zutiefst. Selbst für Menschen, die bereits entsetzliche Grausamkeiten erfahren hatten, war der Anblick nicht weniger verstörend. Dutzende Afrikaner hockten dicht zusammengedrängt an Deck und warteten auf Befehle. Sie beobachteten, wie die Frauen an Bord kamen. Um sie herum standen bewaffnete Weiße, die ihre Gefangenen hasserfüllt anstarrten. In der Mitte des Decks war ein Afrikaner an einen Mast gebunden und wurde gerade ausgepeitscht. Sein Blut tropfte auf die Holzplanken. Neben ihm am nächsten Mast war ein Weißer angebunden, auch er nackt und blutüberströmt. Der Unmensch mit der Peitsche lachte und brüllte etwas in der fremden Sprache. Ein Hieb für den Afrikaner. Der nächste für den Matrosen. Er hatte es nicht eilig.
7.
Mercer war schon einmal vom Dulles International Airport abgeflogen. Es war ein großer Flughafen, eine wichtige Drehscheibe, die Menschen aus allen Ecken der Welt willkommen hieß. Auf den Anzeigetafeln mit den Starts und Landungen im Hauptterminal standen mehrere Hundert Flüge. Jede bedeutende Airline war vertreten. Fasziniert starrte Mercer auf die Tafeln und träumte von den Orten, die sie alle noch besuchen wollte. Die Welt war zum Greifen nah, und Fluglinien wie Icelandair, All Nippon Airways, Royal Air Maroc und Lufthansa würden sie von hier wegbringen.
Ihr Flug nach London sollte in drei Stunden gehen. Thomas vertrat sich gerade die Beine und war auf der Suche nach Kaffee. Mercer legte das Dark-Isle-Buch aus der Hand. Sie hatte es zur Hälfte gelesen und brauchte eine Pause. Irgendwo in ihrem Hinterkopf fand sie eine Erinnerung daran, dass sie während ihrer Schulzeit einmal von einem wohlmeinenden Lehrer angehalten worden war, etwas über versklavte Menschen in Amerika zu lesen. Sie wusste in etwa, worum es ging, doch Geschichte hatte sie nie sonderlich interessiert. Sie hatte Onkel Toms Hütte und Die Abenteuer des Huckleberry Finn gelesen und eine ungefähre Vorstellung davon, wie furchtbar es damals gewesen war, jedoch nie die Zeit gefunden, sich ausführlich damit zu beschäftigen. Ihr Lesegeschmack hatte immer zu moderner englischer und französischer Literatur tendiert.
Eine Gruppe Afrikaner kam auf sie zu. Die Frauen waren in farbenfrohe fließende Gewänder und Kopftücher gehüllt. Die Männer trugen schicke dunkle Anzüge zu weißen Hemden und Krawatten in grellen Farben. Sie unterhielten sich lautstark und angeregt in einem Englisch mit starkem Akzent. Andere Passagiere blickten ihnen nach, wenn sie vorbeigingen, oder machten einen Bogen um sie. Sie rollten mit ihren Koffern zum Schalter von Nigerian Air und stellten sich an.
Mercer musste an Nallas eindringliche Geschichte und die schrecklichen Zustände auf ihrer ersten und einzigen Schiffsreise über den Atlantik denken. Sie lächelte die Nigerianer an. Wie, fragte sie sich, hatten ihre Vorfahren solche Grausamkeiten an den Vorfahren dieser Menschen nur zulassen können. Schon der Gedanke daran war zu viel für sie.
Thomas kam zurück und reichte ihr einen Pappbecher mit Kaffee. »Du hast seit unserer Abreise kaum ein Wort mit mir geredet.«
»Und?«
»Wir sind frisch verheiratet und sollten bis über beide Ohren ineinander verliebt sein.«
»Bist du verliebt?«
»Natürlich, und ich denke an nichts anderes mehr als daran, unsere Ehe zu vollziehen.«
»Tut mir leid, dass ich damit angefangen habe. Ich bin auch verliebt. Geht’s dir jetzt besser?«
»Halbwegs. Nein, eigentlich gar nicht. Wie ist das Buch?«
»Erstaunlich gut. Die Leute, die sich auf Dark Isle niedergelassen haben, waren Sklaven aus Westafrika. Bist du schon mal in Westafrika gewesen?«
»Nein. Nur in Kapstadt und Nairobi.«
»Ich auch nicht. Die Geschichte ist jedenfalls unglaublich spannend.«
»Hat sich schon eine Romanhandlung für dich aufgetan, die du weiterverfolgen willst?«
»Vielleicht. Es geht um die Versklavung einer Vorfahrin der Autorin, einer jungen Mutter namens Nalla, die von Sklavenhändlern entführt wird. Sie hat alles verloren, ihr Kind, ihren Mann, ihre Familie.«
»Wann war das?«
»Um 1760 herum.«
»Wie ist sie letztlich nach Dark Isle gekommen?«
»Das weiß ich nicht. So weit bin ich noch nicht.«
»Willst du mich den ganzen Flug über den Atlantik weiter ignorieren?«
»Vermutlich. Jedenfalls bis ich das Buch zu Ende gelesen habe.«
»Ich weiß nicht, ob mir das Eheleben behagt.«
»Zu spät. Du hast dein Ja schon gegeben. Lies einfach selbst ein Buch.«
8.
Lovely hatte sich für eine seltsame Wendung in ihrer Erzählung entschieden. Als Nalla auf dem Schiff war, hielt die Autorin inne und konfrontierte die Leser mit historischen Fakten, um die Dimensionen des Sklavenhandels deutlich zu machen. Ihre Recherchen waren beeindruckend. Sie schrieb:
Die Venus