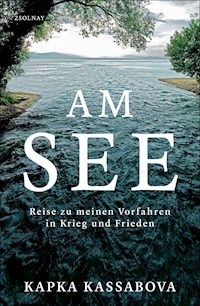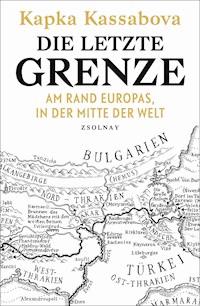
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Um die verbotenen Orte ihrer Kindheit zu sehen, unternahm Kapka Kassabova eine Reise in ihre Heimat. Was sie entdeckte, waren Wälder, Gebirge und Landschaften, die ihr Herz stehenbleiben ließen, so schön sind sie. Dort, wo Bulgarien, Griechenland und die Türkei aufeinandertreffen, das alte Thrakien. Bis 1989 war dieses Gebiet eine „verdunkelte, bewaldete Berliner Mauer“. Und jetzt? Sie sieht die Wälder des Strandscha-Gebirges und menschenleere Dörfer in den Rhodopen, sie trifft Schmuggler, Wilderer und ganz normale Leute, die ihr Geschichten erzählen über Liebe und Tod, das Einst und das Jetzt und wie es ist, vom Rand plötzlich in die Mitte der Welt gerückt worden zu sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Man schlägt dieses Buch auf, liest und spürt: Hier tritt man eine Reise an, die in ein neues Land führt. Dieses Land befindet sich dort, wo Bulgarien, Griechenland und die Türkei aufeinandertreffen, das alte Thrakien – »wo etwas wie Europa beginnt und etwas endet, das nicht ganz Asien ist«. Bis 1989 war dieses Gebiet eine »verdunkelte, bewaldete Berliner Mauer«, schreibt die in Schottland lebende, in Sofia geborene Kapka Kassabova, unzugänglich für Generationen. Und jetzt? Sie sieht die Wälder des Strandscha-Gebirges und menschenleere Dörfer in den Rhodopen, sie trifft Schmuggler, Wilderer und ganz normale Leute, die ihr Geschichten erzählen über Liebe und Tod, das Einst und das Jetzt und wie es ist, vom Rand plötzlich in die Mitte der Welt gerückt worden zu sein.
Zsolnay E-Book
Kapka Kassabova
Die letzte Grenze
Am Rand Europas, in der Mitte der Welt
Aus dem Englischen von Brigitte Hilzensauer
Paul Zsolnay Verlag
Jenen gewidmet, die es, damals wie heute, nicht über die Grenze geschafft haben
Mit der Bitte, die Wälder zu erhalten
Die Leute vergessen, dass wir nur Gäste auf dieser Erde sind, dass wir nackt kommen und mit leeren Händen gehen.
Esma Redžepova, Roma-Sängerin
INHALT
Vorwort 13
Grenze
Berg des Wahnsinns, I
Teil eins
STERNHELLES STRANDSCHA
Via Pontica
Die Rote Riviera
Strandscha
Das Dorf im Tal
Agiasma
Alles beginnt mit einer Quelle
Tscheschma
Ein Müßiggänger
415
Draht im Herzen
Klyon (1961 bis 1990)
Das Grabmal von Bastet
Kaltes Wasser
Pilger
Sühne
Einhundertundzwanzig Sünden
Sozialistische Persönlichkeit
Der Ritt auf dem Eisernen Vorhang
Smei
Ball aus Feuer
Teil zwei
THRAKISCHE KORRIDORE
Thrakien
Der Freund mit den Tauben
Memleket
Mädchen zwischen den Sprachen
Komschulak
Den tanzenden Priester vor Augen
Rosa damascena
Wenn du treu bist
Korridore
Alle kommen zu Ali
Via antica
Geschichten von der Brücke
Geister
Eine kurdische Liebesgeschichte
Die Quelle des Mädchens mit den weißen Beinen
Der Hühnerstall
Teil drei
DIE PÄSSE DER RHODOPEN
Rhodopaea, rhodopaeum, rhodopensis
Das Dorf des ewigen Lebens
Das Urteil
Auf der Straße zur Freiheit
Die Geschichte von den zwei Königreichen
Drama
Die Metaxas-Linie
Berg des Wahnsinns, II
Agonia
Hotel Über der Welt
Ursus arctos
Göttin des Waldes
Tabak
Die Frau, die eine Woche lang ging
Teil vier
STERNENBESETZTES STRANDSCHA
Lodos
Hin zum Fluss
Kaynarca
Der Mönch des Glücks
Ewige Wiederkehr
Die gute Meerjungfrau
Muhhabet
Der letzte Schäfer
Uroki
Wie man eine Verwünschung aufhebt
Dank und Quellen
VORWORT
Dieses Buch erzählt die Menschengeschichte der letzten Grenze Europas. Sie befindet sich dort, wo Bulgarien, Griechenland und die Türkei zusammentreffen und sich wieder trennen, da nun Grenzen einmal so sind, wie sie sind. Es ist auch der Ort, wo etwas wie Europa beginnt und etwas endet, das nicht ganz Asien ist.
Das umreißt im Großen und Ganzen die geografischen Gegebenheiten, aber die Landkarte führt einen nur so weit, bis man sich in einem uralten Wald wiederfindet, strotzend vor Schatten und Leben jenseits aller Zeit. Jedenfalls war das der Ort, an dem ich schließlich landete. Kann sein, dass alle Grenzgebiete in den Frequenzen des Unbewussten summen; schließlich befinden sich Grenzen dort, wo das Gewebe dünn ist. Diese Grenzregion jedoch summt in einem ganz besonderen, sirenengleichen Ton und ist aus drei besonderen Gründen etwas Besonderes. Erstens wegen unvollendeter Angelegenheiten aus dem Kalten Krieg; zweitens, weil sie eine der großen Wildnisse Europas ist; drittens, weil sich hier ein Sammelbecken des gesamten Erdteils befindet, und das, seit es Kontinente gibt.
Meine Generation in Osteuropa wurde erwachsen, als die Berliner Mauer fiel. Diese Grenze überschattete meine bulgarische Kindheit in der letzten Phase des »Sozialismus mit menschlichem Antlitz«, wie die unglückliche Phrase lautete. So war es natürlich, dass eine Reise entlang der Grenzlinie mich rasch in den Bann zog.
Befindet man sich einmal nahe an einer Grenze, ist es unmöglich, nicht in einen solchen Bann gezogen zu werden, nicht etwas exorzieren oder überschreiten zu wollen. Allein schon durch ihre Existenz ist die Grenze eine Einladung. Nun mach schon, flüstert sie, überschreite diese Linie. Wenn du es wagst. Die Linie zu überschreiten, im Sonnenschein oder unter dem Schutz der Nacht, bedeutet Angst und Hoffnung zugleich. Und irgendwo wartet ein Fährmann, dessen Gesicht nicht zu erkennen ist. Menschen sterben, wenn sie Grenzen überqueren, manchmal auch bloß, weil sie in der Nähe sind. Die Glücklichen werden auf der anderen Seite wiedergeboren.
Eine aktiv polizeilich überwachte Grenze ist immer aggressiv; sie ist die Stelle, wo die Macht plötzlich einen Körper bekommt, wenn nicht ein menschliches Gesicht, und eine Ideologie. Eine Ideologie, die offenkundig mit Grenzen zu tun hat, ist der Nationalismus; die Grenze ist da, um einen Nationalstaat vom anderen zu trennen. Aber eine heimtückischere Ideologie ist in ihrer Praxis zentristisch; der Glaube, dass das Machtzentrum aus der Entfernung ungestraft Befehle erlassen und die Peripherie opfern kann; dass das, was sich außerhalb der allgemeinen Wahrnehmung befindet, auch außerhalb des Gedächtnisses ist. Und Grenzgebiete sind immer Peripherie, immer außerhalb des Blickwinkels der Allgemeinheit.
Seltsamerweise war es der Umstand, dass ich in einem Land ohne Grenzen lebte, der mich zu dieser Grenzreise bewog. Ich lebe im ländlichen Schottland, das als eine Art Peripherie gelten mag, falls das Zentrum der Zentralgürtel zwischen Edinburgh und Glasgow ist, und noch mehr als Peripherie, wenn das Zentrum London ist. Schottland war traditionell immer ein Land der Diversität und Freiheit, der Inseln und Exzentrizitäten. Aber in Schottland dämmert das Zeitalter des Körperschafts-Bürokraten mit menschlichem Antlitz heran, und jeden Tag greift ein weiteres zentralistisches Gesetz in entlegenen Gemeinden durch, wieder ein Wald wird umgelegt, um einem Steinbruch zu weichen, Windrädern, die sich nicht zu drehen, gigantischen Strommasten, die keine Elektrizität weiterzuleiten scheinen. Ödnisse von subventioniertem Profit tauchen dort auf, wo früher verschrobene Wildnis war. Während ich die rücksichtslose Einebnung des schottischen Hochlandes beobachtete, wuchs meine Neugier über meine heimatlichen balkanischen Peripherien. Ich wollte wissen, was dort vor sich ging, 25 Jahre, nachdem ich fortgezogen war.
Wenn wir politische Grenzen in harte und weiche unterteilen, dann besitzt die Grenze in diesem Buch ein halbes Jahrhundert Kalter-Krieg-Härte: Bulgarien im Norden gegen Griechenland und im Süden gegen die Türkei markierten die Grenzlinie zwischen den Staaten des Warschauer Pakts im Sowjetblock und den Mitgliedstaaten der Nato in der westlichen Einflusssphäre. Kurz, es war der südlichste Abschnitt des Eisernen Vorhangs in Europa, eine von den Armeen dreier Länder verdunkelte, bewaldete Berliner Mauer. Sie war tödlich, und sie blieb dornig vor Angst bis zum heutigen Tag.
Heute ist die Grenze zwischen Griechenland und Bulgarien durch die Mitgliedschaft beider Länder in der Europäischen Union aufgeweicht. Die türkisch-bulgarische und türkisch-griechische Grenze haben ihre alte Festigkeit verloren, aber eine neue gewonnen: Ihr Symptom sind die neuen Drahtzäune, errichtet, um den Strom an Menschen aus dem Nahen Osten aufzuhalten.
Ich war zufällig dort, als aus dem Strom ein Blutsturz wurde. Globale Bewegungen und globales Verbarrikadieren, neuer Internationalismus und alte Nationalismen – das ist die systemische Krankheit im Herzen unserer Welt, und sie hat sich von einer Peripherie zur anderen ausgebreitet, denn nirgendwo ist es noch entlegen. Das heißt, bis man sich im Wald verirrt.
Aber der ursprüngliche emotionale Anstoß zu meiner Reise war einfach: Ich wollte die verbotenen Orte meiner Kindheit sehen, die ehemals militarisierten Grenzdörfer und -städte, Flüsse und Wälder, die zwei Generationen lang unzugänglich gewesen waren. Ich fuhr mit meiner Auflehnung dagegen hin, dass wir so lange wie ungeliebte Hunde hinter dem Eisernen Vorhang angekettet gewesen waren. Und mit meiner Neugier, die Menschen einer Terra incognita kennenzulernen. Als Herodot im 5. Jahrhundert vor Christus schrieb: »Von Europa aber weiß offenbar niemand etwas Genaues, weder über den Osten noch über den Norden, ob es da vom Meer umgeben ist«, hätte er diesen Teil des Kontinents im frühen 21. Jahrhundert meinen können. Als ich mich auf den Weg machte, teilte ich die allgemeine Unwissenheit über diese Region nicht nur mit den weiter entfernt lebenden Europäern, sondern auch mit den urbanen Eliten der drei aneinandergrenzenden Länder. Im Geist derjenigen, die dort nicht leben oder zu Besuch hinkommen, ist dieses Grenzgebiet ein anderes Land, ein wenig wie die Vergangenheit, wo Dinge anders gemacht werden.
Wann immer man über den Balkan spricht, ist das abgedroschene alte Bild von der Brücke unvermeidlich, aber nirgendwo ist es deutlicher zu beobachten als am Südostbalkan, dem alltäglichen Durchgang zwischen dem, was Ost und West zu nennen wir uns angewöhnt haben.
Paradoxerweise ist dies nach wie vor eine verborgene Falte der globalen Matrix. Einige der Gebiete, die ich durchquerte, waren so schön, dass einem das Herz hätte stehenbleiben mögen, aber nur Botaniker und Ornithologen kommen dorthin, Schmuggler und Wilderer, die Heroischen und die Verlorenen. Und dann sind da die Einheimischen.
Die Geschichte werde von den Siegern geschrieben, heißt es, mir aber scheint, dass Geschichte vor allem von denen geschrieben wird, die nicht dort waren, was dasselbe sein mag. Ich verspürte einen Hunger: in die Gesichter derjenigen zu schauen, die dort sind, ihre Geschichten zu hören, mit ihnen zu essen, neue Wörter zu lernen. Was braucht es, um in einem so sehr von alten und modernen Mythen durchdrungenen, derart psychologisch aufgeladenen Grenzland zu leben? Niemand von uns kann Begrenzungen entkommen: zwischen dem Selbst und dem anderen, Vorhaben und Tat, Träumen und Wachen, Leben und Sterben. Vielleicht können uns die Leute an der Grenze etwas über Schwellenräume erzählen.
Die Reise, die ich hier beschreibe, verläuft im Kreis und folgt den Umrissen natürlicher Regionen innerhalb der Grenzzone. Ich begann am Schwarzen Meer, am Rand des rätselhaften Strandscha-Gebirges, wo mediterrane und balkanische Strömungen aufeinandertreffen; fuhr abwärts in die Grenzebenen Thrakiens mit seinen Korridoren für Verkehr und Handel; drang in die Pässe der Rhodopen vor, wo jeder Gipfel eine Legende und kein Dorf das ist, was es zu sein scheint, und endete auf der spiegelbildlichen Seite des Anfangs – Strandscha und das Schwarze Meer.
Mit wenigen Ausnahmen wurden die Namen verändert, und manchmal habe ich individueller Privatheit und erzählerischer Ökonomie zuliebe topografische oder biografische Details zusammengezogen. Der Naturreichtum der Region würde mehr Raum verdienen, aber mein Fokus war die Geschichte der Menschen. In der Menschengeschichte sind Grenzen allgegenwärtig – sichtbar und unsichtbar, weich und hart –, aber die uralte Wildnis, die vor ihnen war, ist endlich. Vielleicht fühle ich mich deshalb, weil diese Grenze immer noch eine Wildnis ist, bei ihren Menschen und Geistern zugegen.
Kapka Kassabova
In den schottischen Highlands
– Grenze –
Laut Oxford English Dictionary
1. eine Linie, die zwei Länder voneinander trennt
2. ein Band oder ein Streifen, üblicherweise dekorativ, um den Rand eines Gegenstandes
BERG DES WAHNSINNS, I
Der Moment kam auf der halben Strecke der Reise. Hoch oben in den Rhodopen an der bulgarisch-griechischen Grenze führte eine Serpentinenstraße die Bachschlucht hinauf, und wo die Straße oben endete, lag ein letztes Phantomdorf mit ausgehöhlten Fenstern und einem steinernen Brunnen ohne Wasser. Niemand lebte mehr dort. Jenseits der Straße und des Dorfes – die Eichenwälder des Niemandslandes. Wir meinen durchs Leben zu gehen und das Unheimliche – außer in Filmen – nie kennenzulernen, aber in diesem Dorf habe ich etwas erlebt, das den Schrecken in mein Herz brachte. Ich weiß immer noch nicht, ob es »real« war, aber die Gefühle, die es begleiteten, sind bis heute in meinem Körper.
Ich war in diese vergessene Falte des Berges gekommen, um etwas zu suchen, und war in das da hineingeraten. Vielleicht war es das, wonach ich gesucht hatte. Wie auch immer, nun sah ich mich diese Schlucht mit struppigem Wald voller Wildschweine und Felsklippen hinunterrennen, zwanzig Kilometer ohne einen Menschen, die unbarmherzige Sonne hämmerte auf meinen Kopf wie ein Urteil für irgendein Verbrechen, das lange zurücklag.
Oben zwischen den Gipfeln gab es tatsächlich eine Felsspitze namens »Urteil«, eine Stelle, von der Körper in den Schlund der Zeit geworfen worden waren, der zwischen den ersten Menschenopfern der Thraker und den letzten Jahren des Kalten Krieges klaffte. Aber ich lief in die entgegengesetzte Richtung – bergabwärts zum nächsten bewohnten Dorf, das weit weg war, und weit weg war auch alles andere, das mir verständlich war.
Das Gefühl, dies sei nichts Persönliches, dies sei nicht nur mein Schrecken, erwies sich im Rückblick als richtig. Ich nahm Schwingungen von Ereignissen auf, die der Berg in sich trug. Es waren keine natürlichen, sondern Grenzschwingungen, Schwingungen eines Waldes, in dessen Bäume die Initialen jener eingekratzt waren, die im 20. Jahrhundert jung und verzweifelt gewesen waren. Ihrer Geschichten wegen war ich gekommen, aber war ich der Aufgabe gewachsen?
Die Leute hatten mir erzählt, hier würden Menschen und Dinge verschwinden, aber nichts geht wirklich weg. Das fühlte ich jetzt, wie eine Anwesenheit hinter mir. Obwohl es Mittag war, hatten sich die Berge des Orpheus dunkel verfärbt. Ich kam an einen Seitenarm des Flusses und blieb stehen, um etwas zu trinken. Das eisige Wasser brannte in der Kehle. Ich wusste, dass die Quelle der Mesta (griechisch: des Nestos) jenseits der Grenze oben in der höchsten Bergkette der Balkanhalbinsel lag und dass die Länge des Flusses 234 Kilometer betrug, bevor er in die Ägäis mündete – aber was haben Tatsachen schon je für die Hilfsbedürftigen getan? Das hier war kein normaler Fluss. Auf der anderen Seite der Grenze lag eine bodenlose Höhle mit einem donnernden Wasserfall, genannt die Teufelsschlucht. Dort, so hieß es, sei Orpheus in die Unterwelt hinabgestiegen. Nichts, was hineingeht, kommt jemals wieder heraus, inklusive der letzten Höhlenforscher, ein Mann und eine Frau, die in den 1970er Jahren dort verschwanden. Sogar Orpheus, das einzige Lebewesen, das aus dem chthonischen Reich wiederkehrte, wurde schließlich von den rasenden Mänaden zerfleischt; seinen Kopf warfen sie in den Hebrus, der über 480 Kilometer weit fließt, bevor er zur Ägäis wird. Sein Verbrechen? Er hatte am Ende seines Lebens die Seiten gewechselt und zwei gefährliche Grenzen überquert: von Dionysos, seinem früheren Mentor, dem Gott der nächtlichen Mysterien, zum Sonnengott Apollo und von der Liebe zu Frauen zur Liebe zu Männern. Grenzlinien zu überschreiten ist nicht einmal für Götter sicher, ganz zu schweigen von menschlichen Wesen.
Etwas weiter flussabwärts traf ich auf eine Frau und zwei Männer, die ein kleines Boot mit Brotlaiben beluden. Dutzenden Brotlaiben. Sie hatten lange Haare und Gesichter, die froh waren über irgendetwas. Mein Schreck löste sich in Bezauberung auf. Sie luden mich ein, mit ihnen den Fluss zu überqueren. Und dort, auf der anderen Seite …
Aber das ist für später.
Was ist eine Grenze, wenn die Definitionen aus den Lexika nicht ausreichen? Es ist etwas, was man, ohne es zu wissen, in sich trägt, bis man an einen Ort wie diesen kommt. Du rufst in eine Schlucht hinein, deren eine Seite in der Sonne liegt, die andere im Dämmer, und das Echo vervielfältigt deinen Wunsch, verzerrt deine Stimme, führt sie fort in ein fernes Land, wo du einmal gewesen sein magst.
Teil eins
STERNHELLES STRANDSCHA
Auch du wirst fortlaufen, sagte der Hirte.
Und wenn ich bleibe?
Wenn du bleibst … Ich geb dir einen Monat. Siehst du die Eiche dort?
Dort wirst du dich erhängen.
Georgi Markow, Die Frauen von Warschau
– Via Pontica –
Auf dem Land war sie einst eine Römerstraße, die Donau und Bosporus verband. In der Luft ist sie immer noch eine Migrationsroute für Vögel. Die Via Pontica hat ihren Namen vom Schwarzen Meer, dessen Name einst Pontus Euxinus lautete, das gastliche Meer. Allerdings hieß es, bevor Griechen aus Milet daran siedelten, Pontus Axinus, das unwirtliche Meer, denn es war tückisch zu befahren, und die Ufer waren von Piraten und Barbaren (sprich: Nichtgriechen) bevölkert. Ovid verbrachte sein Exil am Westufer dieses Meeres, verfasste seine »Tristia« und tat sich selber leid unter den Geten, einem thrakischen Stamm von Barbaren (sprich: Nichtrömern).
Hier am frostigen Ufer des Euxinus verweile ich.
Axinus ist sein Name, wie die weisen Alten sagen.
Der arme Ovid, zu würdevoll, um zu genießen. Seit seiner Zeit sind Barbaren und Zivilisationen gekommen und gegangen, einige sind geblieben, aber etwas Pontisches hat sich nicht geändert. Wenn man an die südwestlichen Strände des Schwarzen Meeres kommt, wo sich Bulgarien und die Türkei im Wasser eine unsichtbare Grenze teilen, wo die Schiffe zwischen dem Bosporus und Odessa hin und her gleiten, kann man an einem einzigen Septembertag immer noch den Himmel von fünfzigtausend Störchen verdunkelt sehen, die nach Afrika unterwegs sind.
Aber damals war es noch Sommer.
DIE ROTE RIVIERA
Sommer 1984, die südlichen Strände Bulgariens. Alle Vögel waren schon da, auch die Urlauber: solche, die wie wir aussahen, und die exotischen mit ihrem prächtigen Gefieder, ihren bunten Strandtüchern und ihrer Aura sexueller Freizügigkeit. Das Einzige, was den heißen Himmel verdunkelte, waren die räuberischen Möwen, die sich auf die kleinen Plastikbehälter mit salzigen frittierten Sprotten stürzten, die wir alle mampften.
Ich sah auf von den sandigen Seiten meines Buches, geschrieben von dem spannenden amerikanischen Schriftsteller Jack London, dessen Held Martin Eden sich ertränkt, weil es in der kapitalistischen Welt ohne jede moralische Bedeutung ist, ein erfolgreicher Schriftsteller zu sein. Mein Lieblingsbuch von ihm war »Der Ruf der Wildnis«, ein Abenteuer, das fehlschlägt – aber was für ein Abenteuer! Ich sehnte mich nach einem Abenteuer, gleich welcher Art. Wenn man an diesem Strand zu schwimmen begann und immer weiter südwärts schwamm, wie mein Vater, der stundenlang im Meer verschwand, vorbei an den Schwärmen riesiger Quallen, vorbei am Campingplatz und dem wegen seiner Nudisten und Künstlertypen, nicht wegen zahmer Familien, wie wir eine waren, berühmten Strand, dann landete man in der Türkei.
Obwohl die Türkei auf derselben Seite des Schwarzen Meeres lag, befand sie sich auf der anderen Seite der Grenze, und Dinge, die das Wort Grenze, graniza, enthielten – sogar der Klang war schartig, wie das gra-gra der Möwen –, mied man am besten, das wusste sogar ich. Zum Beispiel bedeutete ins Ausland zu reisen »über die Grenze« zu gehen, also jenseits der Grenzen des Erlaubten, von wo es keine Wiederkehr gab. Tatsächlich wurden diejenigen, die fortgingen und nicht mehr wiederkehrten, Nicht-Rückkehrer genannt. Sie wurden in Abwesenheit verurteilt, und an ihrer Stelle hatten ihre Familien zu leiden. Die einzige solche Person, von der ich wusste, war der Mann meiner Klavierlehrerin, den ich nie kennengelernt hatte – er war jenseits der Grenzen des Erlaubten. Er war einer der Hunderten bulgarischen Musiker, die zu Konzerten ins Ausland fuhren und zu Nicht-Rückkehrern wurden. Der Preis, den sie bezahlten, bestand darin, ihre Heimat vielleicht nie mehr wiederzusehen.
Während es einem langsam dämmerte, warum die Grenze existierte (damit Leute wie wir nicht fortgehen konnten), entwickelte man langsam eine Art innerliches Grenzgefühl, wie eine Magenverstimmung. Ich war in diesem Sommer zehn Jahre alt, alt genug, um von Leidenschaft geschüttelt zu werden. Das Objekt meiner Begierde war ein älterer blonder Junge, auf Urlaub mit seinen Eltern. Wir waren aus Sofia gekommen, sie aus Berlin, und für zwei Wochen voller köstlicher Qual belauerten wir einander von unseren Badetüchern aus, umgeben von einem Hauch von Niveacreme und präpubertärer Sehnsucht. Aber der Mangel an Erfahrung wurde deutlich, und wenn er in der Schlange um Eiscreme hinter mir stand, groß und golden wie ein Apoll, vergaß ich jedes Wort Russisch – unsere gemeinsame Sprache –, das ich in der Schule gelernt hatte. Als seine Familie abreiste, weinte ich einen Tag lang. Wir waren doch so offenkundig füreinander bestimmt gewesen.
Was niemand von uns wissen konnte: Am Strand wimmelte es von spähenden Augen. Am stärksten konzentriert und in der prachtvollsten Umgebung im nahe gelegenen legendären Internationalen Jugendzentrum, wo dreißig Jahre lang die Hautevolee der Ostblock-Jugend zum Feiern hinkam und bei Schönheitswettbewerben, Neptunfesten und Musikabenden am Strand herumstolzierte. Das waren keine gewöhnlichen Strände. Das war die Rote Riviera, in den väterlichen Worten Chruschtschows das Schaufenster des kommunistischen Blocks; er war überzeugt, dass »die Freundschaft der Bulgaren zu uns besonders innig« sei. Hierher kamen Ost- und Westdeutsche, Norweger, Schweden, Ungarn, Polen und Tschechoslowaken, um sich am Goldstrand und Sonnenstrand, die in den 1960er Jahren entstanden waren und bald zur einträglichsten Einkommensquelle für den Staat wurden, zu vergnügen. Denn dies war totalitärer Tourismus, und alles hier gehörte dem Staat, sogar der Sand. Wir wohnten in einem illegal gemieteten Zimmer im Haus eines Einheimischen – illegal, weil nur staatliche Hotels reguläre Geschäfte tätigen konnten. Unser verschlafener Küstenort hieß Mitschurin, nach dem russischen Biologen, der das Saatgut revolutioniert hatte. In Mitschurin mit seinem Mittelmeerklima wurde ein durchgeknalltes landwirtschaftliches Experiment im Sowjetstil durchgeführt, bei dem Wissenschaftler versuchten, Eukalyptus und Gummibäume, Teepflanzen und Mandarinen zu züchten. Nun, das fruchtbare Land brachte bereits Walnüsse und Mandeln, Feigen und Weinreben hervor, aber es ging darum zu beweisen, dass der entwickelte Sozialismus alles kontrollieren konnte, vom Lauf der Geschichte bis zum Verhalten von Mikroorganismen.
Es war ein Ort, an dem jeder zweite Barkeeper im Dienst der bulgarischen Staatssicherheit stand, während eine speziell geschulte »Operationsgruppe« von KGB-, tschechischen und Stasi-Agenten, als Urlauber verkleidet, ein Auge auf die Hedonisten hatte. Bei den Einheimischen waren die Ostdeutschen als »Sandalen« bekannt, da sie sich in ihren Sandalen und in Strandkleidung nachts vom Strand und in den dunklen Wald der gra-gra-graniza davonzustehlen pflegten, deren Name Strandscha lautete.
Wer sich nicht für den Wald entschied, wandte sich zur Küste; in Taucheranzügen, mit Schlauchbooten und Luftmatratzen paddelten sie südwärts in Richtung der so nahe scheinenden türkischen Küste, bis sie ins Meer hinausgetrieben wurden. Auf der anderen Seite des gezeitenlosen Schwarzen Meeres mit seinen neunzig Prozent anoxidem Wasser unter der sauerstoffführenden oberen Schicht lag die Sowjetunion.
Ich vermisste meinen deutschen Schwarm, ohne zu ahnen, dass mein Sehnen von anderen Körpern am Strand, ebenfalls auf der Suche nach Partnern, repliziert wurde – für Abenteuer einer Nacht, für Handel, Geldwechsel, Ehe. Für eine Möglichkeit, die Grenze zu überqueren. Seit ihren Anfängen in den 1960er Jahren war die Rote Riviera ein Menschenmarkt gewesen, wo das Bestgebot nicht für Liebe abgegeben wurde, sondern für Freiheit. Und der höchste Preis, den man entrichten konnte, war das Leben. Viele taten das.
Es war ein langer Weg vom Strand zur türkischen Grenze, und dieser Weg führte durch die bewaldeten Hügel von Strandscha, die einen mitternächtlichen Schatten über die sonnigen Badeorte warfen. Über Strandscha wussten wir bloß, dass es voller Bäche, Rhododendren und Reptilien war und dass in seinen Dörfern Feuerriten heimisch waren, bei denen die Leute auf glühenden Kohlen gingen. Verwirrenderweise war die Ausübung dieses Rituals vom Staat verboten – außer an offiziellen Orten wie dem Internationalen Jugendzentrum, wo die Feuergeher staatlich approbiert waren, ebenso wie die Tanzbären an Ketten, die dorthin gebracht wurden, um die Besucher zu unterhalten; das waren offizielle Bären. Wollte man Strandscha besuchen, benötigte man eine behördliche Genehmigung vom Innenministerium. In anderen Worten: Man durfte nicht hin.
»Warum dürfen wir nicht nach Strandscha?«, fragte ich, als der deutsche Junge fort war und die Eiscreme ihren Geschmack verloren hatte.
»Wir haben dort nichts zu suchen«, sagte mein Vater.
»Der Wald ist voller Soldaten«, sagte meine Mutter.
Es gab eine Wand aus stromführendem Stacheldraht, so lang wie die Grenze. Wer den Wald betrat, konnte das für ihn bestimmte Warnsignal in den zwei Sprachen der Verzweiflung lesen:
ВНИМАНИ ГРАНИЧНА ЗОНА!
ACHTUNG GRENZZONE!
War man aber weit genug gegangen, um dieses Schild zu lesen, nach Tagen und Nächten im Reptilienwald, weshalb hätte man dann umkehren sollen?
Wenn Unschuld das Gefühl ist, die Welt sei ein sicherer und gerechter Ort, dann begann ich in jenem Sommer die meine zu verlieren. Warum durften wir nicht der deutschen Familie nach Berlin nachreisen? Warum durften wir – oder, wenn wir schon dabei waren, die deutsche Familie – nicht in die Türkei fahren, die bloß ein Stück weiter küstenabwärts lag? Warum musste ein Deutscher in einem Heißluftballon über die Grenze fliegen, wie man munkelte, außer es stimmte wirklich? Weil wir in einem Freiluftgefängnis lebten. Ein Gefühl melancholischer Revolte begann aufzukeimen.
Sechs Jahre später mussten die »Sandalen« nicht so weit fahren, um zu entkommen, denn die Berliner Mauer war gefallen. Unsere Familie überquerte die Grenze – wenn auch nicht diese, sondern irgendeine andere imaginäre Grenze über dem Pazifik, auf dem Weg zu einem neuen Leben in Neuseeland, einem Ort, der von Stränden anderer Art geprägt war.
Es war neuerlich Sommer, als ich dreißig Jahre später wiederkam.
Am Flughafen in Burgas säumten Weingärten die Landebahnen, die Luft roch nach Benzin und baldigem Sex. Ich war mit einem Urlaubscharterflug aus Edinburgh gekommen, das Flugzeug war voller tätowierter Männer und Frauen mit grellem Lachen und Make-up. In Gesellschaft schwitzender, aufgeregter Russen, junger Skandinavier, pickelig vor Hormonen, blasshäutiger Familien aus anderen nördlichen Breiten betrat ich bulgarischen Boden. Aus dieser lebhaften Hafenstadt wurden die Konsumententouristen Europas wie Dosenfleisch in die pulsierenden Strandorte von Goldsand und Sonnenstrand verschickt. Meine Rote Riviera war zu einem heiteren Inferno des globalen Kapitalismus geworden.
Ich nahm einen Mietwagen und fuhr vorbei an den vielfarbigen Salzseen des Golfs von Burgas. Die erstickten Schreie von Pelikanen, Kormoranen und Eisvögeln, der Geruch nach reifenden Feigen, nach sandigem, lüsternem Niveasommer, die Kräne am Hafen, die Riesenschiffe wie bewegungslose Städte. Hier begannen die dunklen Berge von Strandscha.
Ich nahm die ruhige Uferstraße, die ich zuletzt vor dreißig Jahren aus dem Fond des Familien-Skoda gesehen hatte. Bevor die Straße sich landeinwärts wandte, blieb ich in der letzten Küstenstadt stehen: dem verschlafenen Mitschurin meiner Kindheit. Aber es hatte seinen alten Namen Zarewo wieder angenommen, und einen Moment lang konnte ich es auf der Karte nicht finden, denn für mich bleibt es für immer Mitschurin. Die Versuche, Eukalyptus und Gummibäume anzubauen, waren lange vorüber, man war wieder bei den einheimischen Feigen und Weinreben, Mandeln und Walnüssen gelandet. An der Straße in die Stadt saßen kurzbehoste Männer und Frauen auf Hockern und hielten handgeschriebene Tafeln: »Zimmer zu vermieten«. In den Tagen der Roten Riviera hätten sie als »Freibeuter« festgenommen werden können.
Am Hafen aß ich einen Teller gegrillte Sprotten. Kinder hüpften kreischend ins Wasser, und alles schmeckte nach Tränen. Aber ich war wegen des lange verbotenen Strandscha gekommen, nicht wegen des Meeres. Ich riss mich zusammen und fuhr weiter.
Strandscha: Man wusste, dass man drinnen war, wenn der Verkehr plötzlich aufhörte und der Wald einen umfing. Die Straße wurde löchrig und in Dschungelgrün gehüllt, das Grün war voller moosiger Lagunen und megalithischer Steinheiligtümer, die einst dionysischen Kulten gedient hatten. Die einzigen Verkehrsteilnehmer, die ich sah, waren ein Zigeunerpaar, das sich auf einem Pferdekarren vorbeizwängte und strahlend goldzahnlächelte, als sei alles gut.
Vier schwarze sattellose Pferde trotteten vor mir her und begannen zu galoppieren, als sie den Motor hörten. Sie trennten sich, um meinen Wagen durchzulassen, und schlossen sich hinter mir zusammen wie in einem Stummfilm.
Mein Ziel war ein Grenzdorf in einem Tal, wo ich einige Zeit verbringen und die Gegend erkunden wollte. Verwirrt vom unübersichtlichen Straßennetz und schief stehenden Wegweisern, die in die Wildnis zeigten, verirrte ich mich. Als ich auf der verlassenen Straße anhielt, um im Kofferraum eine Wasserflasche zu suchen, hörte ich das Knacken von Zweigen und ging nachschauen – immer eine schlechte Idee. Im Wald spürte ich, wie von allen Seiten etwas näher rückte. Mückenartige Fliegen krochen mir in Nase und Mund, und als ich zum Auto zurücklief, trat ich beinahe in ein Nest mit quicklebendigen Kreuzottern. Mit klammen Händen fuhr ich weiter.
Unter der Bergstraße öffneten sich weite, nackte Ausblicke, wie ein Schlag, der einen taumeln lässt. Schwindelweiten aus Samt, eine gefaltete Welt, als müsse man hineinspringen, um auf der anderen Seite eines Abgrunds wieder aufzutauchen.
– Strandscha –
Die letzte Gebirgskette Südosteuropas. Fläche: 10.000 Quadratkilometer. Alter: 300 Millionen Jahre. Sie beginnt im Osten am Schwarzen Meer und läuft in den thrakischen Ebenen im Westen aus. Sie wurde nach und nach durch das Zusammentreffen und Auseinanderdriften der eurasischen Platten gebildet, deren letztes drastisches Ergebnis der Bosporus ist. Die Flusstäler des Strandscha werden durch das kontinuierliche Absinken der Küste des Schwarzen Meeres gebildet. Obwohl der höchste Gipfel des Strandscha nur 1031 Meter hoch ist, fühlt man sich dort oben den Sternen nahe, zu nahe. Auf der türkischen Seite nennt man das Gebirge Yildiz, das Sternenbesetzte.
Da Strandscha die letzte Eiszeit nicht mitmachte, haben sich in diesem Habitat Pflanzen aus dem Tertiär erhalten, ein veritables Freiluftmuseum für Reliktpflanzen, darunter der gute alte Rhododendron ponticum, der in anderen Teilen der Welt angepflanzt wird, hier aber seit dem Tertiär ununterbrochen heimisch ist. Mehr als zwanzig Reptilienarten vermehren sich in diesem ornithologischen, herpetischen und Säugetier-Himmel, wo eines sicher ist: Obwohl Menschen selten sind, ist man im Wald nie allein.
In Strandscha gibt es immer noch megalithische Kultstätten und andere geheimnisvolle Orte der alten Thraker, die schriftlose Spuren ihrer Existenz hinterlassen haben. Ihre wenigen schriftlichen Hinterlassenschaften waren rätselhaft, etwa diese freundliche Inschrift auf einem Stein aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, auf Griechisch: »Fremder, der du hierher kommst, möge es dir gut ergehen!« Für die alten Griechen hingegen waren es die Thraker, welche die Fremden waren – »dort am Ende des Heeres sind neu ankommende Thraker«, schrieb Homer in der »Ilias« –, wenn man Stämme, die um 4000 vor Christus in diesen Ländern bereits fest ansässig waren, als Neuankömmlinge bezeichnen kann. Sie wurden allerdings erst um die Mitte des zweiten Jahrtausends vor Christus eine ethnisch zusammenhängende Population. Homer erwähnte als Erster die Thraker und schrieb von ihrem König Rhesus, dessen Heere neben den Griechen im griechisch-trojanischen Krieg auftauchten, mit seinen schneeweißen Pferden, »im Lauf so schnell wie eilende Winde«, und seinen Waffen aus Gold und Silber: »Fürwahr, nicht sterblichem Manne gebührt es, solche zu tragen, sie sind bestimmt für ewige Götter.«
Wir kommen zum Gold zurück.
Vor dem 14. Jahrhundert nach Christus, als die türkischen Seldschuken auftauchten, war Strandscha mit einer unklaren Grenze zwischen Bulgarien und Byzanz getüpfelt, und irgendwo in Strandscha lag Paroria, die Klosteranlage des großen Eremiten Gregor vom Sinai. Seine einflussreiche quietistische Philosophie des Hesychasmus vertrat als erste eine Art psychosomatisches Gebet, eine Art ekstatische Meditation. Aber Paroria ist spurlos verschwunden.
Traditionell sprachen die Dörfler in Strandscha Bulgarisch und Griechisch und lebten von der Müllerei, der Holzgewinnung, Köhlerei und vom Bootsbau; die zwei großen Reichtümer der Berge aber waren Gold und Vieh. Im Osmanischen Reich (14. bis 20. Jahrhundert) genoss Strandscha einen Sonderstatus: Es gehörte der Familie des Sultans, war beinahe völlig von Steuern befreit, und es gab keine Siedler von außerhalb. Tatsächlich war die Bevölkerung im Strandscha-Gebirge sehr isoliert. Heute durchschneidet die bulgarisch-türkische Grenze die Gebirgskette. Zählt man alle auf beiden Seiten zusammen, dann leben nur etwa achttausend Menschen in Strandscha.
Nun zum Gold. Die Thraker, die das Zeug sehr liebten, bauten es in Strandscha in großem Stil ab, Schatzjäger und Archäologen graben immer noch erstaunliche Artefakte aus reinem Gold aus. An diesen pontischen Ufern war es, dass 4600 vor Christus ein Leichnam, der den ersten Goldschmuck der Menschheit trug, in einem Gräberfeld (dem Gräberfeld von Warna) bestattet wurde. Uralte Minen zeigen auch umfangreiche Entnahmen von Silber, Kupfer, Eisen und Marmor, besonders im Gefolge des Trojanischen Krieges. Manche meinen, Strandscha sei ein gigantischer Schweizer Käse aus uralten Tunneln und verschlossenen unterirdischen Geheimnissen.
Dass ich solche Fakten über Strandscha kannte, fühlte sich wie ein guter Beginn an – bis ich im Dorf im Tal eintraf.
DAS DORF IM TAL
Das Dorf im Tal bildete das Ende der Straße. Man kam durch einen Mischwald hinunter, das älteste Naturschutzgebiet auf dem Balkan. Die Gesichter von Rotwild erschienen im grünen Licht und verschwanden wieder, und Spechte klopften verschlüsselte Botschaften.
Ich mietete ein einstöckiges Haus in der letzten Gasse, die Besitzer waren im Ausland und hatten es eben erst gebaut. Die benachbarten zwei Häuser waren verlassen, die Gärten ein Dickicht von verwilderten Obstbäumen, die goldene Birnen in meinen Hof regnen ließen. Am Morgen überquerte eine Schildkröte die Wiese, in der Abenddämmerung kam sie zurück. Die verlassenen Häuser waren drei Jahrhunderte alt und holzverkleidet, im Dach gab es eine eigenartige entfernbare Schindel, um Licht einfallen zu lassen oder vielleicht auch die Nachbarn auszuspionieren.
Bis in die 1990er Jahre hatten zweitausend Seelen hier gelebt; sie waren auf zweihundert geschrumpft. Die Schule mit ihren zerbrochenen Fenstern stand leer, ebenso die Bäckerei, der Gemischtwarenladen, die Militärkasernen. Die Mäander des Flusses traten zweimal im Jahr über die Ufer, überschwemmten dabei das Dorf, und bis ins 20. Jahrhundert hatten die Leute eine Tradition aus dem alten Ägypten bewahrt: Sie sammelten mit an den Walnussbäumen am Ufer befestigten, aus Zweigen geflochtenen Vorrichtungen die fruchtbaren Rückstände des angeschwollenen Flusses. Die Walnussbäume standen immer noch da, schwer von bitteren grünen Früchten.
Das Dorf war nach dem griechischen Kaufmann benannt, der es gegründet hatte, denn dies war bis zu den Balkankriegen, als Millionen ihre Heimat verloren oder Schlimmeres erlitten und in einem fremden Land ein leeres Haus mit noch warmen Kochtöpfen zugewiesen bekamen, ein griechischsprachiges Dorf gewesen. In dem trübseligen, »Bevölkerungsaustausch« genannten Ringelreihen waren die Griechischsprachigen aus Dörfern am Schwarzen Meer, Dörfern wie diesem hier, in die Dörfer um Thessaloniki geflohen, und an ihrer Stelle kamen bulgarische Flüchtlinge aus der Türkei. Muslime aus beiden Ländern wurden in die Türkei vertrieben. Diese zivile Katastrophe war nur ein Refrain in der langen Elegie des Osmanischen Reiches.
Eine atemberaubende orthodoxe Kirche, ehemals nach den lokalen Schutzheiligen Konstantin und Helena benannt, unterbrach die Dorfsilhouette mit ihrem hölzernen Glockenturm. Die Ikonen waren seit jenem Augenblick hundert Jahre zuvor intakt geblieben, als die Griechen davongelaufen waren und den bulgarischen Ankömmlingen ein unbeabsichtigtes Geschenk hinterlassen hatten. Bald danach brannte die Kirche. Die Dörfler sahen zu, bis sie Schreie von Menschen hörten, und stürzten dann in die Flammen, aber es war niemand drinnen; es waren die Ikonen, die schrien.
Jenseits meiner Gasse gab es bis zur Türkei nur noch alte Karrenwege und bewaldete Anhöhen. Nachts kamen Schakale bis an den Rand des Dorfes und heulten, und die Dorfhunde jaulten zurück, ein Höllenkonzert. Ich konnte nicht schlafen und saß auf meinem Balkon, beobachtete die gelben Augen am Waldrand. Spatzengroße Hornissen drangen ins Haus ein, und ich erschlug sie mit gebundenen russischen Büchern von den Regalen, denn ein Hornissenstich kann einen umbringen, wie es hieß. »Krieg und Frieden« erwies sich als ideal. Mein nächster Nachbar auf der gegenüberliegenden Straßenseite war ein baumlanger ehemaliger Basketball-Champion. Er hatte seine Frau und seinen Sohn verloren und verbrachte die Sommer hier, im alten Haus der Familie, obwohl sein Garten so heruntergekommen aussah wie alles andere. Er strahlte, als er mich sah: »Haben Sie sich auch in Strandscha verliebt?«
Eine Antwort wartete er nicht ab.
»Sie werden sehen. Bleiben Sie noch eine Woche, und Sie werden nicht mehr fortkönnen. Oder Sie fahren und werden krank. Das ist so mit den Bergen.«
Ich lachte zu rasch.
Der Dorfplatz war aus zwei Gründen bemerkenswert. Erstens, ein in den Boden eingelassener steinerner Ring, in dem einmal im Jahr während des panagyr oder Dorfmarkts ein Feuer angezündet wurde und Feueranbeter, die nestinari, auf den glühenden Kohlen herumtanzten, Ikonen in den Händen. Zweitens, eine Café-Bar, das zentrale Klatsch-Hauptquartier. Hier wurden Neuankömmlinge in Augenschein genommen, darunter Touristen auf dem Weg nach Istanbul, deren Navis sie hierhergeführt hatten, denn es war dem Vogelflug nach die kürzeste Strecke. Die Leute nannten das Lokal Die Disco, da unten im Keller eine Eisenstange in den als Tanzfläche dienenden Boden gerammt war; ich sah allerdings nie jemanden tanzen.
Die Besitzer waren ein Paar aus der Gegend: ein schwatzhafter fetter Mann mit feinen Gesichtszügen namens Blago und die schlanke Minka, eine Frau weniger Worte. Mit einem schroffen, fatalistischen »Mahlzeit« stellte sie einem das Bestellte auf den Tisch. Hinter ihren grauen Augen schien sie monolithischen Träumen nachzuhängen, als wäre ihr Gesicht aus den Hügeln gehauen, jung, doch uralt.
Blago saß den ganzen Tag rauchend da, sein rasierter Schädel wie eine Signallampe. Er erzählte mir, wie in seiner Kindheit, die auch die meine war, Griechen gekommen waren, um die Häuser ihrer Vorfahren zu sehen, und die Volksmiliz nachher die Kinder zusammengetrommelt und gefragt hatte: »Hast du was von den Griechen genommen?« Die Kinder konnten nicht lügen, und so konfiszierte die Miliz die Kaugummis, die Kugelschreiber, die Schokolade, und schor ihnen dann die Haare.
»Um uns eine Lehre zu erteilen, weil wir etwas von den Kapitalisten angenommen hatten«, schnaubte Blago. »Schauen Sie nicht so entsetzt. Das war normal. Genauso, als sie alle auf dem Platz zusammenriefen, wenn sie am Draht ›Sandalen‹ erwischt hatten. Wir mussten zusehen.«
Wobei zusehen?
»Sie haben sie zusammengeschlagen«, sagte er. »Ich sehe sie noch vor mir, als wäre es gestern gewesen. Jung. In Handschellen. In Sandalen. Manchmal blutig, von den Hunden. Ich erinnere mich an ihre dunkle Kleidung, als Tarnung im Wald. Das sei der Feind, sagten unsere Bullen. Und wir glaubten es. Sonst hätten sie sich ja nicht in diese furchtbare Scheiße geritten, oder?«
Blago drückte seine Zigarette aus.
»Mahlzeit.« Minka stellte einen Salat vor mich hin und setzte sich, sah auf die Berge.
Minka hatte den »Fall und Niedergang«, wie sie es nannte, ihres hübschen Dorfes mitangesehen. Es gab zwei Gründe: den Kalten Krieg und die Grenze, was auf dasselbe hinauslief.
Im Herbst 1944 marschierte die Rote Armee ein, und Bulgarien, bis dahin in einer mörderischen Allianz mit Nazi-Deutschland, wurde nun von einem selbstmörderischen Staatsstreich erschüttert, inklusive Volksgerichtshöfen, die mit sowjetischer Hemmungslosigkeit Todesurteile austeilten. Es war eine Agrarwirtschaft gewesen (die Nationale Agrarunion war die größte politische Partei, und etwa siebzig Prozent der Menschen arbeiteten auf dem Land), aber als die Kommunistische Partei erst einmal die absolute Macht ergriffen hatte, begann die Kollektivierung. Kollektivierung war natürlich ein Euphemismus für staatlichen Diebstahl, aber wer darauf hinwies, wurde umgebracht, ins Exil getrieben, ins Arbeitslager gesteckt oder sonst wie zum Schweigen gebracht. Die Nationale Agrarunion wurde verboten, ebenso wie die Sozialdemokratische Partei und alle anderen Parteien. Wer sein Land verloren hatte – und das waren alle, die Land besaßen –, hatte zwei Wahlmöglichkeiten: zu den Fabriken in den neuen Fünfjahresplan-Städten auswandern oder weiter auf dem Land arbeiten, das nun nicht mehr seines war, um die unmöglichen Quoten des Fünfjahresplans zu erfüllen, der 45 Jahre lang galt.
Mein Urgroßvater war einer der modernen Winzer des Landes und Mitbegründer von Gamza, einer blühenden Wein-Kooperative nördlich des Balkangebirges. Über Nacht wurde er ein »Feind des Volkes«, entging nur knapp der Hinrichtung und verlor seine Rente; sein letztes Jahrzehnt verbrachte er in einer winzigen Wohnung in Sofia, zusammen mit seiner Tochter, die ihn unterstützte; trotzdem verlor er nie das Funkeln in seinen Augen oder den Geschmack am Wein. Seltsamerweise blieben trotz dieser raschen und wüsten Industrialisierung die Hauptausfuhrgüter dieselben: Tabak, Obst und Gemüse, die Bulgarien in den Ostblock exportierte.
Schließlich lieferte die Industrialisierung die Resultate, welche der Antrieb der Revolution hätten sein sollen, die keine war: Aus dem bodenreichen Land erwuchs eine Gesellschaft, in der ländliche wie städtische Menschen gleich besitzlos waren.
»Ein bisschen ironisch«, meinte ich.
»So ist eben die Geschichte«, grinste Blago. »Alles, was sie tut, ist Ironien zu produzieren.«
»Hier zu leben ist wie ein Witz ohne Pointe«, sagte Minka.
Minkas Familie hatte immer im Dorf gelebt; wie alle anderen in den Tagen des Kalten Krieges durften sie nicht anderswo wohnen oder arbeiten. Aber wenn man hier lebte, benötigte man auch einen besonderen Stempel vom Innenministerium, denn dies hier war Grenzgebiet.
»Arbeitsverpflichtet. Gebrandmarkt«, sagte Minka mit unbewegter Miene. »Trotzdem, es war besser damals. Einfach weil Leute da waren. Und jetzt?«
Bis in die 1970er Jahre war die Industrialisierung ein Erfolg gewesen, in dem Sinn, dass viele riesige Bauwerke errichtet worden waren, darunter Dämme wie jener, dessen Stausee die antike Stadt Seuthopolis überflutete, die größte jemals ausgegrabene thrakische Fundstätte. Na gut, der Kommunismus hatte es eilig, er hatte nichts übrig für bourgeoise Angelegenheiten wie Vergangenheit oder Umwelt. Aber durch all die industriellen Aktivitäten wurde den Grenzdörfern und -städten das Lebensblut abgezapft. Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre versuchte der Staat der lokalen Wirtschaft einen Anstoß zu geben, indem er Kupferbergwerke eröffnete und die Häuser praktisch umsonst anbot. Aber es war zu wenig, zu spät.
Dann, im brutalen Abwärtsstrudel des Postkommunismus der 1990er Jahre, walzte der freie Markt über Nacht die veralteten Strukturen der Planwirtschaft nieder. Die Grenzsoldaten machten sich davon. Die Leute emigrierten in Scharen. Wie nach einer Apokalypse überwucherte die Wildnis das Land.
»Es gibt kein Auskommen mehr«, sagte Minka. »Die einzige Hoffnung ist der Ökotourismus.«
»Aber schauen Sie sich die Straßen an«, meinte Blago.
Die Straßen waren so voller Schlaglöcher, dass man sich nach jeder Autofahrt in einem abgedunkelten Raum hinlegen musste.
Im Garten des Bürgermeisters lag in einer Ecke achtlos weggeworfen ein altes handgeschriebenes Schild:
LANG LEBE DIE INTERNATIONALE GEMEINSCHAFT DER ARBEITERKLASSE, ALLER FORTSCHRITTLICHEN KRÄFTE, VEREINT IM KAMPF GEGEN DEN IMPERIALISMUS FÜR FRIEDEN, DEMOKRATIE UND FORTSCHRITT!
Ein Utopia, das auf genau die Art fehlgeschlagen ist, in der es hätte gelingen sollen, verdient eine Schweigeminute und viel Nachdenken, und hier war es noch ärger schiefgegangen als sonst irgendwo; deshalb hatten die Einheimischen einen Einblick in etwas, das gewöhnlich im Krieg erlebt wird: kollektives Herzeleid. Im Dorf im Tal gab es keine Salonsozialisten, keine Globalisierungsgegner, keine Antikommunisten, keine Antikapitalisten. Nur Überlebende. Die Frauen waren alt, die Männer einsam, und die Kinder waren weg. Vergessen von der Gerechtigkeit, feierten die Überlebenden kleine Erfolge, und das Leben im Dorf war süß und brüchig.
»Ich bin für ein sterbendes Dorf, einen angekündigten Tod zuständig«, sagte der Bürgermeister. Er hatte sich zu uns an einen Tisch im Freien gesetzt und Kaffee bestellt. »Wie meine Großtante zu sagen pflegte, wenn die Glut nichts Gutes voraussagte: das Schwärzeste vom Schwarzen. Ich kann bloß den Leuten das Leben so gut wie möglich machen, was nicht schwer ist – sie sind mit so wenig zufrieden.«
Seine Großtante war Wahrsagerin gewesen, aber der Bürgermeister war Pragmatiker. Ein Automechaniker, der sein Leben in Burgas verbracht hatte, Schmieröl bis zu den Ellbogen, ging er in Flipflops und kurzen Hosen herum und reparierte gratis jedem das Auto. Aber sogar ein Pragmatiker konnte sich nicht gegen einen gelegentlichen Traum wehren, und er liebte sein Dorf so sehr, dass er einen Spielplatz für die nicht vorhandenen Kinder hatte anlegen lassen.
Früh und spät war ich in Der Disco und beobachtete die Adler, die reglos über den Hügeln schwebten, wartete, dass irgendein Wunder geschah. Wunder fühlten sich hier so unvermeidlich an wie Katastrophen. An den Nachmittagen stöberte ich in der Dorfbücherei herum, wo die in meiner Jugend veröffentlichte Literatur alphabetisch aufgereiht war; die Bibliothekarin schloss die Schränke ab und auf, auch wenn nur drei weitere Leute die Bücherei regelmäßig nutzten: ein sanfter neunzigjähriger ehemaliger Schafhirt, der mir anvertraute, ein Leben mit Büchern und Bergen sei das Einzige von Bedeutung; die schöne Russin und Nedko.
Die schöne Russin arbeitete für die Forstverwaltung, mit zwei anderen Leuten markierte sie Bäume und hielt die Wege instand. Einer von ihnen war ein bekannter Dudelsackspieler, ein rundlicher Mann mit gerötetem Gesicht, der von seinem Dudelsack nicht zu trennen war. Er nahm ihn mit zur Arbeit, und während der Essenspausen holte er seinen kleinen Flachmann mit Raki heraus, setzte sich auf einen Baumstumpf und spielte die uralten, bittersüßen Melodien von Strandscha.
»Wenn der Dudelsack seine Kehle auftut, vergessen wir all unseren Kummer«, sagte die schöne Russin. »Und Bäume sind ohnehin eine weit angenehmere Gesellschaft als Menschen.«
Sie war mit einem ehemals brillanten Mathematiker verheiratet, einem Mann, der nun bis zum Mittagessen eine halbe Flasche Raki leerte. Sie waren so pleite, dass sie dreißig Jahre lang nicht in Russland gewesen war. Eines Morgens beugte sie sich über ihren Kaffee zu mir und flüsterte:
»Lassen Sie die Wäsche nicht über Nacht im Garten hängen.«
»Ja«, sagte Nedko. »Das sagt meine Mutter auch.«
Nedko war ihr Freund. Er war ein gutaussehender Kerl mit blauen Augen und einem sonnenverbrannten Gesicht. Ehemals Chefkoch, war er gezwungen gewesen, ein Jahrzehnt lang seine kranken Eltern zu pflegen. Seine Dreißiger waren vorüber, seine Mutter war immer noch bettlägerig, und obwohl er sie offenbar sehr liebte, hatte er das gehetzte Aussehen der Pflichtbewussten. Er wohnte in einem Haus ganz oben im Dorf mit einem grenzenlosen Blick über die bewaldeten Anhöhen, die einen mit schwerem Glück erfüllten.
»Es gibt Frauen, die nachts im Dorf herumstreifen und die Kleider der Leute mit verwünschtem Wasser und Friedhofserde bespritzen. Du ziehst dein Gewand an und bist verflucht«, sagte er.
»Lachen Sie nicht«, sagte die schöne Russin. »Einmal habe ich vor meiner Tür ein schwarzes Kruzifix gefunden. In meiner Unwissenheit habe ich es aufgehoben. Das war vor zwanzig Jahren. Seit damals habe ich nur Pech. Man sollte nie ein Kruzifix mit bloßen Händen aufheben.«
»Es gibt Frauen hier«, sagte Nedko, »die haben den bösen Blick. Sie können nichts dafür.«
»Wer sind sie?« Ich sah mich um, lachte nicht mehr. Um die Wahrheit zu sagen, eine der alten Frauen sah mich auf eine Art an, dass es mir ganz kalt wurde.
Nedko schüttelte den Kopf. »Man kann sie nicht benennen. Aber alle wissen es.«
An einem anderen Tisch saß S., ein soignierter pensionierter Emigrant, der seit dreißig Jahren in Polen lebte, aber jeden Sommer sein Elternhaus besuchte.
»Ich weiß nicht, warum«, meinte er. »Hier bin ich so einsam wie ein Kuckuck.«
Er fuhr einen schimmernden Land Rover und prahlte, er habe ebenso viele Kinder wie Enkel, so viele Autos wie Häuser und seit seiner frühen Jugend unglaubliches Glück bei den Frauen. Er war in den Kasernen hinter dem Stacheldraht bei seinem Vater aufgewachsen, der Grenzpolizist war. Er hatte alles mit seinen Kinderaugen gesehen. Zum Beispiel den Deutschen, der einen Metalldetektor benutzt hatte, um den Drahtzaun mit den Alarmmeldern zu überlisten; die Wachen hatten von ihm durch den nächsten Deutschen erfahren, der es mit weniger Erfolg probiert hatte.
Die Soldaten langweilten sich zu Tode, sagte der Emigrant, und unterhielten sich mit der Jagd auf Wildschweine, aus denen sie Würste fabrizierten. Und, großes Problem – der Emigrant schüttelte den Kopf –, keine Frauen. Gelegentlich Besuch von einer Ehefrau oder einer Hure. Er hätte es nicht ausgehalten, er wäre abgehauen.
»Wenn man’s recht bedenkt, hab ich das ja auch getan, nicht?« Er lachte bitter. »Bin vor den gottverdammten Kommunisten weggelaufen, die alles mit ihrem Blick vergiftet haben. Der böse Blick, genau das! Egal, wie viel Spaß man hatte. Und ich hatte unglaubliches Glück bei den Frauen.«
Ich mochte S. und fragte mich, warum seine polnische Frau nie mitkam.
Eines Sonntags gab es eine Party in Der Disco. Irgendjemand hatte bei seinem Haus einen betonierten Vorplatz angelegt, ein kleiner Erfolg, der gefeiert werden sollte. Minka kochte im Keller, draußen saßen alle um einen langen Tisch.
Die alten Mütterchen kauten an Brocken Schweinefleisch, kippten Gläschen mit Raki hinunter und lachten zahnlückig. Sie hatten Ehemänner begraben und mehr; sie konnten es sich leisten zu lachen.
In der Mitte saß ein Akkordeonspieler; sein Spitzname lautete Winzling, obwohl er gar nicht winzig war, sondern von normaler Größe. Neben ihm saß sein Sohn, ein Kerl mit gemeißelten Wangen und argwöhnischem Blick, der sich für sich hielt. Anders als der Große Stamen, dessen Körper so groß war, dass er aus seinen Flipflops barst, sein Gelächter hallte wie Gewehrschüsse in meinen Ohren. Sein Lächeln war gierig, wie das eines freundlichen jungen Kannibalen. Der Tisch, das Bierglas, dieses Dorf – alles war zu klein für ihn. Unter der Woche bediente er im Wald eine Holzbringungsmaschine, wie es zu einem Riesen passt. Wie alle hier stammte der Große Stamen von Flüchtlingen aus den türkischen Dörfern jenseits der Grenze ab, wo die aufgelassenen Familienhäuser durch die Jahreszeiten vor sich hin verwitterten.
»He, Winzling«, sagte einer zum Akkordeonspieler, »was ist dein Lieblingslied?«
»›Der Kommunismus ist weg!‹«, dröhnte Stamen, und alle lachten – außer ein paar Leute, denen die alten Zeiten abgingen, weil die neuen so schlecht waren.
»Nein«, sagte der Winzling, »mein Lieblingslied ist das da.«
Und er spielte ein Lied über einen Schäfer, der ein Geheimnis hat, es aber nur den Bergen anvertrauen kann. Der Winzling war einmal Schweinehirt gewesen, und bevor er seinen Bauernhof verloren hatte und Angestellter der staatlichen Forstverwaltung geworden war, war seine Stimme jeden Tag über den Bergen erklungen.
»Ich singe immer noch jeden Abend, o ja«, sagte er. »Weil ich trinke, und ich kann nicht trinken, wenn ich nicht singe.«
Jedes Mal, wenn er sein altes deutsches Akkordeon auspackte, die Adern an seinem Hals schwollen und er mit seiner emphysematischen Stimme sang, hatte ich Angst, es könnte sein letztes Lied sein. Alle tranken eine Menge. Alle außer D., der am anderen Ende saß und Fanta trank. D. war vierzig, hatte eine sanfte, langsame Art. Er war in Seebädern Chefkoch gewesen, bevor er eines Nachts im Dorf im Suff ausrastete und einen Mann zu Matsch prügelte. Bald nach seinem Gefängnisaufenthalt hatte er unlängst einen Bienenstock aufgestellt, und in diesem Sommer hatte er zum ersten Mal Manov-Honig geerntet, eine wertvolle Art, welche die Bienen in Eichenwäldern produzieren. Bevor ich abreiste, gab er mir eine Wabe mit sirupartigem schwarzem Honig. Er selbst rührte den Honig nicht an, als halte ihn die Sühne von zu viel Genuss ab.
Der nächste Wunsch nach einem Lied kam von einem jungen Polizisten. Er ging in den Städten und Seebädern am südlichen Schwarzen Meer auf Streife. »Wie ist die Arbeit?«, fragte ich ihn.
»Ein Wahnsinn im Sommer«, meinte er, »und ruhig im Winter. Meist Besoffene. Die Briten sind die Ärgsten, wenn sie betrunken sind. Ihre Frauen sind wie rasende Elefanten.«
Die bulgarische Polizei arbeitete, ein Widerhall früherer Zeiten, an diesem letzten Außenposten Europas mit deutschen Polizeistreifen zusammen, denn hier lag die Endstation für alle möglichen gesuchten internationalen Flüchtigen, Schmuggler, Desperados.
»Sie kommen hierher, um sich zu verstecken«, sagte er und wies auf die rundum aufragenden dunklen Anhöhen. »Und sehen Sie sich das an: perfekt!«
Bald würde er sein Gewehr nehmen und durch den Wald zu seiner nächtlichen Streife nach Zarewo fahren. Aber jetzt trommelte er noch auf einer riesigen Ziegenhauttrommel, und seine Schlägel waren zwei abgebrochene Autoantennen.
Irgendjemand verlangte eine volkstümliche Ballade, sie hieß »Neun Jahre« und erzählte von einem Mann, der sich in eine Frau verliebt hat, welche jeden verzaubert, der verrückt genug ist, mit ihr leben zu wollen. Nach neun Jahren siechen die Männer dahin und sterben. Die Mutter des Helden bittet ihn, nicht zu der Frau zu gehen. »Aber was sind neun Jahre, Mutter?«, sagt er. »Ich habe schon ein ganzes Leben ohne sie vergeudet!«
Einige Männer hatten Freundinnen in anderen Städten, manche waren geschieden, und wieder andere hatten niemanden. Die Frauen waren entweder verwitwet oder verheiratet wie Minka und die schöne Russin. »Neun Jahre« war ein Dauerbrenner, und die Stimmung änderte sich, wurde drückend vor Bedauern, als würden jedermanns Verluste herandrängen. Die Berge verdunkelten sich unter Gewitterwolken.
Ivan regte sich in der Ecke und langte nach seinem Gewehr. Er war der Jüngste hier, ein Grenzwächter mit vollkommen ausdruckslosem Gesichtsausdruck. Als der letzte Akkord verklang, schritt er entschlossen über den leeren Platz. Angst packte mich am Hals; er legte das Gewehr an, zielte auf den sich nähernden Sturm und feuerte ein, zwei, drei, vier, fünf Mal. Die leeren Patronenhülsen fielen in den Betonring für das Feuer.
Er kam zurück und lehnte das Gewehr an die Wand.
»So ist’s besser«, sagte er und setzte sich.
»Ich müsste noch mehr trinken, um mich besser zu fühlen, aber jetzt ist es an der Zeit«, witzelte Stamen, und die Spannung löste sich. Der Akkordeonspieler wischte sich das Gesicht mit einem Taschentuch. Ich war mir sicher, dass meine Trommelfelle nie mehr dieselben sein würden.
»Es ist das Junggesellenleben, das uns ganz durcheinanderbringt«, sagte Stamen und schob einen Teller mit Schweinefleisch vor mich hin. »Essen Sie auf. Was wir brauchen, sind Frauen, nette Frauen, die singen können. Warum bleiben Sie nicht?«
»Oder kommen zumindest einmal im Jahr her, wie ich«, sagte der polnische Emigrant.
»Die vielen großen, leeren Häuser«, meinte die schöne Russin. »Sie jammern nach Leuten.«
»Unsere Kirche hat seit zwanzig Jahren keine Hochzeit erlebt«, sagte Stamens Mutter.
Dann tat sich der Himmel auf, und Vorhänge aus Regen schlappten auf den leeren Platz nieder. Die Tischrunde löste sich auf. Ich ging heim und nahm meine Wäsche von der Leine, bevor die Nacht hereinbrach. Ich glaubte nicht an den bösen Blick, aber man wusste ja nie.
Nachdem der Regen aufgehört hatte, saß ich auf dem Balkon und wartete, dass die Schakale aus dem Dunst kamen, und der Gedanke, früher oder später, so wie alle anderen, dieses Dorf verlassen zu müssen, durchfuhr mich mit einem solchen Bedauern, dass ich hätte heulen mögen.
– Agiasma –
Griechisches Wort für eine Quelle mit geweihtem Heilwasser. Quellen waren einst Kultplätze für die Thraker, deren Verehrung der Muttergottheit sich in den gebärmutterartigen heiligen Stätten und feuchten Höhlenspalten Strandschas verkörperte, wo die Strahlen des Sonnengottes, Sohn und Geliebter der Göttin, empfangen wurden.
Tausende Jahre später dauert die Beziehung der Menschen zu den Agiasmas an, vielleicht weil das Agiasma ein Vermittler zwischen den materiellen und magischen Reichen, zwischen der Nacht von Winter und Brutzeit (Chaos) und der Sonne von Sommer und Wiedergeburt (Kosmos) ist.
Ab Mai beginnt das Wasser heftig zu strömen. Die Agiasmas haben sich geöffnet, sagen die Leute. Man geht zu einem Agiasma, um sein Gesicht und sein Gewissen zu reinigen, von Beschwerden und Flüchen geheilt zu werden und die neue Jahreszeit zu begrüßen. Hänge einen Streifen deiner Kleidung an einen nahen Baum, und deine Krankheit wird dortbleiben, oder ein klein wenig von deinem Kummer. Die Bäume sind so schwer von Stoff, dass im Winter, wenn die Quellen versiegen, die mürrischen Gemeindebeamten kommen, um das Durcheinander aufzuräumen.
Eines Morgens führte man mich zu einem tief im Grenzwald verborgenen Ort. Er wurde Großes Agiasma genannt.
ALLES BEGINNT MIT EINER QUELLE
Es war von Der Disco aus, dass die Reise zum Großen Agiasma begann. Ich schloss mich dem Konvoi an, der die Talschlucht entlang zu einem nicht auf der Landkarte verzeichneten Ort kroch. Diese Stelle war eine Lichtung im Grenzwald, durchkreuzt von Jagdpfaden und Güterwegen. Vorbei an den nicht mehr gebrauchten, von Schlangen bevölkerten Zollbaracken, wo der soignierte polnische Emigrant seine Kindheit verbracht hatte und ein gespensterhafter Slogan den Eingang mit seinen zerbrochenen Kacheln zierte:
AN DER NATIONALEN GRENZE NATIONALE ORDNUNG
Ich fuhr zusammen mit Frauen aus dem Dorf in einem Minivan aus der Sowjetzeit. Der Fahrer tat sein Bestes auf der aufgesprungenen Straße, aber trotzdem hüpften wir auf den harten Sitzen auf und nieder, bis die verbliebenen Zähne im kollektiven Mund klapperten. Die Frauen trugen Ikonen wie Kinder auf dem Schoß, »gekleidet« in Spitzen und roten Stoff, aber als ich darunterlugte, war ich erschrocken ob der menschlichen Gesichter mit den ausdrucksvollen Augen.
»Einige von denen sind sehr alt«, sagte eine Frau mit derben, männlichen Gesichtszügen. Die ältesten Ikonen reichten drei Jahrhunderte zurück. Die Frauen betreuten sie, als wären es Waisenkinder.
»Deshalb holen wir sie nur am Tag der Heiligen Konstantin und Helena aus der Kirche«, sagte eine Frau namens Despina. Sie wohnte in meiner Straße, hatte einen üppigen Garten und einen bettlägerigen Mann.
»Wie gefällt Ihnen unser Dorf, meine Liebe?«, fragte eine andere Frau, die ständig Kaugummi kaute. Ich mochte sie; sie hatte ein offenes Gesicht, das ausdrückte: So ist das Leben. »Die Kirschen sind bald so weit. Solche Kirschen kriegen Sie in der Stadt nicht.«
»Vielleicht gibt es in Schottland auch Kirschen«, meinte Despina.
»Nein, in Schottland haben sie Whisky«, korrigierte die Frau mit dem Kaugummi und blinzelte mir zu. »Und die Männer tragen Schottenröcke. Stimmt’s?«
Sie kicherten. Als Zeichen, dass ich zum inneren Kreis gehörte, gaben sie mir eine Ikone, die ich auf dem Schoß halten sollte. Ich vermied es, die Frau mit der unheimlichen blauen Iris anzusehen, die nichts sagte und vielleicht den bösen Blick hatte, oder auch nicht.
»Zu uns kommen nicht viele Besucher, meine Liebe«, sagte eine andere Frau, die einmal Köchin in der Schulkantine gewesen war. »Sie hätten das Dorf früher sehen sollen.«
»Die Schule, die Bücherei«, sagte Despina. »Die Obstgärten, die Felder, die Herden. Tausende Stück Vieh. Unser Dorf war wohlhabend.«
»Lass die Vergangenheit ruhen«, sagte die Frau mit dem Kaugummi.
»Vor ein paar Jahren sind wir nach Meliki gefahren«, sagte die Frau mit dem Männergesicht, »auf Besuch zu den Griechen. Nette Leute.«
»Nette Leute«, stimmten alle zu. Die Griechen in Meliki waren Nachkommen derjenigen, die vor hundert Jahren die Ikonen zurückgelassen hatten. Sie praktizierten immer noch das Ritual des Feuerlaufs, auf Griechisch anastenaria genannt, auf Bulgarisch nestinarstvo.
»Wir waren auch im türkischen Strandscha«, sagte die Frau mit dem Kaugummi, »in unseren alten Dörfern. Wollten das Haus von Mama und Papa sehen. Aber dort wohnt jetzt keiner mehr. Nur Ruinen.«
»Leere Dörfer«, sagte die Frau mit dem Männergesicht. Sie war Straßenkehrerin, die Leute nannten sie Das Ohr, weil sie ein phänomenales Hörvermögen hatte und einer geflüsterten Unterhaltung Straßen weiter, innerhalb eines Hauses, vielleicht sogar im Kopf der Menschen, folgen konnte. Ich sah sie jeden Tag mit ihrem Besen unsichtbaren Schmutz vom leeren Platz fegen, eingestimmt auf irgendeine Schwingung quer über die Hügel. Wenn ich an ihr vorbeiging, versuchte ich nichts zu denken, aber sie sah mich immer aus zusammengekniffenen Augen scharf an, und ich schauderte.
Schließlich hielt der Kleinbus an. Auf der Lichtung versammelten sich die Leute.
Die Lichtung hieß Die Heimat, eine echte Leistung der Metonymie. Sie hatte seit Hunderten, ja vielleicht Tausenden Jahren Zusammenkünfte von Feueranbetern erlebt, von Musikern, Nachtschwärmern, mystischen Sehern und gewöhnlichen Trunkenbolden, bis in die späten 1940er Jahre, als der Kult der Natur vom Kult Stalins unterbrochen wurde. Meine Generation war im letzten Blinzeln dieser Unterbrechung aufgewachsen.
Über den Feuern blubberte in Kesseln Lammsuppe, und die Frauen aus dem Kleinbus machten sich daran, die Brühe umzurühren. Es gab fünf hölzerne Plattformen, odarche, eine Plattform für jedes der fünf Feueranbeter-Dörfer an der Grenze. Leer sahen sie aus wie Hinrichtungsgerüste. Jetzt kamen die Leute in kleinen Prozessionen vom Fluss herangeschritten und stellten Ikonen auf die Plattformen. Es wirkte wie eine Szene aus »The Wicker Man«. Statt zu beten vollführten die Leute, welche die Ikonen hielten, einen rituellen Reigentanz auf der Stelle, mit kurzen Schritten und sparsamen Gebärden. Unter dem glosenden Weihrauch der Orthodoxie lag unverkennbar ein Hauch von Heidentum.
Beim Klang eines Dudelsacks und einer Trommel, genannt tupan oder tapan, gesellte ich mich zu der kleinen Prozession hinunter zum Bach, wo die Frauen, ohne mit dem Wasser in Kontakt zu kommen, die Ikonen entkleideten und wuschen, dann kleideten sie sie wieder an und stellten sie auf die Plattformen.
Die hölzernen Tische waren wie die Plattformen fest montiert, der ganze Ort war ein ständiger Schauplatz für Feste. Schon zu Mittag lagen orgiastische Schwingungen in der Luft. Es fühlte sich an, als hätte das Ikonenritual eine Bedeutung jenseits von Glauben, Festlichkeit oder Kultur – da war etwas anderes, das hier nachgespielt wurde. Ich spürte es, konnte es aber nicht benennen; es hatte etwas mit der Grenze zu tun.
Griechische Besucher waren da, die ihre eigenen Ikonen mitgebracht hatten, und über den Bach beugte sich eine Gruppe griechischer Frauen. Das war die Heimat ihrer Vorfahren gewesen, ihre Großeltern lagen im Dorf im Tal begraben. So war die Heimat auch Schauplatz einer speziellen Art Tourismus: Ahnentourismus.
Ich kletterte den hügeligen Weg zum Großen Agiasma hinauf, das sich eben geöffnet hatte – eine bedeutende Sache, denn hatte sich das Große Agiasma einmal geöffnet, dann flossen alle Quellen Strandschas. Ein Mädchen kam zu mir und berührte mich an der Schulter. Sie war weiß gekleidet, wie eine Nymphe.
»Hallo«, sagte sie. »Ich bin Iglika.« Iglika bedeutet Primel. »Wie heißt du?«
Ich blieb stehen. Ihre Haut war eine goldene Galaxie, ihr Haar ein Strom aus Weizen. Sie gehörte in ein Lied. Ich empfand eine abergläubische Sorge: Wie kann man so durchs Leben gehen, ohne dass einen jemand mit dem bösen Blick ansieht? Ich nannte ihr meinen Namen. Sie lachte mit Perlenzähnen.
»Dein Name bedeutet Wassertropfen!«, sagte sie und legte meine Hand auf ihre kalte Handfläche. »Du hast eine Verwandtschaft mit dem Wasser. Ich glaube, wir sind ziemlich ähnlich. Weißt du, ich habe zwei Jahre an der Universität Manchester studiert. Aber ich kann in Manchester nicht leben. Niemand kann in Manchester leben. Ich bin zurückgekommen.«
Sie redete auf dem ganzen Weg zum Großen Agiasma, sprudelte wie ein Bächlein, aber als wir in der Schlange der Leute an die Reihe kamen, flatterte sie davon. Iglika stammte aus einem Dorf namens Überfuhr, denn es liegt in der Nähe eines der wenigen existierenden Übergänge über den 147 Kilometer langen Fluss Veleka, der aus einem türkischen Berg tritt und Flusstäler durch Strandscha einkerbt, bevor er sich dem Schwarzen Meer zugesellt, ohne einen Gedanken an Grenzen zu verschwenden. Flüsse sind in einem mythologischen Sinn Grenzen – und deswegen wurden die Ikonen hier »gewaschen«.
An diesem Tag sah ich Iglika nicht mehr. Die Leute aus meinem Dorf im Tal hießen mich an ihrem Tisch willkommen. Die Lammsuppe wurde in Schüsseln gegossen und herumgereicht; es war kurban, aus einem früh am selben Morgen geschlachteten Lamm gekocht. Kurban (vom arabischen qurban) bedeutet die Opferung eines Tieres, manchmal zum Klang von Trommel und Dudelsack, die im ländlichen Griechenland und Bulgarien noch immer größere Feste, christliche wie muslimische, begleiten; bis dahin hatte ich noch nie ein kurban gesehen. In den alten Zeiten hatte jedes Feueranbeter-Dorf seine eigenen Opfermesser, -beile und -Baumstümpfe gehabt. Sie waren weg, aber geblieben waren die kleinen Kapellen oder konaks