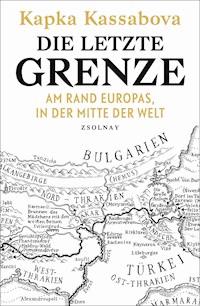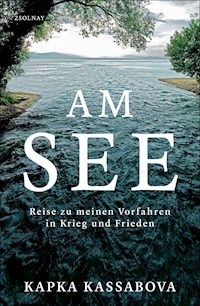
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Kapka Kassabova folgt am Ohridsee den Spuren ihrer Familie. Wie in „Die letzte Grenze“ reist sie in ihrem neuen Buch auf den Weg in den Osten und in ihre eigene Vergangenheit. Fischer, Hausierer, Witwen, Waisen – Opfer, Täter und jene, denen es gelungen ist, sich aus den Verstrickungen zu befreien. Wie in einem Brennglas werden die Konflikte und Tragödien von Nationalstaaten in jenem Winkel Europas sichtbar, in den uns Kapka Kassabova führt: das zwischen Nordmazedonien, Albanien und Griechenland aufgeteilte Gebiet um den Ohrid- und Prespasee. Es ist verbunden mit ihrer eigenen Familiengeschichte, und so wird aus der Erkundung einer wunderschönen Gegend, ihrer Historie und politischen Verwerfungen eine Reise in die eigene Vergangenheit. Kassabova versteht es, die Zusammenhänge zwischen Topografie und Biografie bloßzulegen und Menschen zum Erzählen zu bringen, deren Schicksale die Zerrissenheit der Jahrhunderte spiegeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Kapka Kassabova folgt am Ohridsee den Spuren ihrer Familie. Wie in »Die letzte Grenze« reist sie in ihrem neuen Buch auf den Weg in den Osten und in ihre eigene Vergangenheit.Fischer, Hausierer, Witwen, Waisen — Opfer, Täter und jene, denen es gelungen ist, sich aus den Verstrickungen zu befreien. Wie in einem Brennglas werden die Konflikte und Tragödien von Nationalstaaten in jenem Winkel Europas sichtbar, in den uns Kapka Kassabova führt: das zwischen Nordmazedonien, Albanien und Griechenland aufgeteilte Gebiet um den Ohrid- und Prespasee. Es ist verbunden mit ihrer eigenen Familiengeschichte, und so wird aus der Erkundung einer wunderschönen Gegend, ihrer Historie und politischen Verwerfungen eine Reise in die eigene Vergangenheit. Kassabova versteht es, die Zusammenhänge zwischen Topografie und Biografie bloßzulegen und Menschen zum Erzählen zu bringen, deren Schicksale die Zerrissenheit der Jahrhunderte spiegeln.
Kapka Kassabova
Am See
Reise zu meinen Vorfahren in Krieg und Frieden
Aus dem Englischen von Brigitte Hilzensauer
Paul Zsolnay Verlag
Inhalt
Einleitung
Sehnsucht nach dem Süden
Teil Eins: Frühling
Teil Zwei: Herbst
Danksagung
Glossar
Mottos
Literatur
Meiner Mutter und den Kindern der Exilierten und Flüchtlinge in aller Welt —
Mögt ihr euren Weg zur Quelle finden.
Die Toten öffnen den Lebenden die Augen.
Und den Seen.
Ihrer uferlosen Großzügigkeit.
Ein See ist der schönste und ausdrucksvollste Zug einer Landschaft. Er ist das Auge der Erde. Wer hineinblickt, ermisst an ihm die Tiefe seiner eigenen Natur.
Henry David Thoreau
Einleitung
Dieses Buch erzählt von zwei uralten Seen. Manche Orte sind in unsere DNA eingeschrieben, benötigen aber eine lange Zeit, um ihre Konturen zu enthüllen, so wie manche Reisen in die Landschaft unserer Biographie eingeätzt sind, doch die Spanne eines Lebens benötigen, um vollendet zu werden. So geht es mir mit diesen Seen.
Der Ohridsee hat mich seit meiner frühen Kindheit angezogen, denn meine Großmutter mütterlicherseits stammte von dort, und sie war in den Anfangsjahren meines Lebens eine einflussreiche Gestalt. Als Erwachsene dachte ich oft daran, einmal wirklich an den See zurückzukehren, spürte aber, dass ich nicht dazu bereit war. Will man zu den Orten seiner Ahnen gehen, muss man gewappnet sein, das zu sehen, was zu verleugnen leichter fällt.
Den Anstoß gab mir schließlich die Befürchtung, dass im Laufe der Zeit auf heimtückische Weise etwas geschehen könnte. Dass ich, falls ich nicht die existenzielle Landschaft meiner Familie auf Mutters Seite verstand, alte Muster wiederholen könnte. Dass wir, während wir in diesem Jahrhundert immer noch Zeugen sind von Bürger- und Bruderkriegen, von spalterischer Politik zwischen und in den Nationen, von patriarchaler Autokratie und Revisionismus, massenhafter Emigration und Vertreibung — dass auch wir beim Miterleben, falls wir nicht begreifen, wie wir unsere eigenen Vermächtnisse tragen, selbst unwillentlich Erfüllungsgehilfen der Zerstörung werden könnten.
Generationen meiner Vorfahren haben am See gelebt. Ich hatte gehofft, sie könnten als Pforte zu ihm und zu diesem erstaunlich unbekannten Winkel Europas dienen. Die Gegend um den See birgt epische Landschaften und eine reiche Geschichte. Es ist ein Reich der Höhen und der hypnotischen Tiefen, der Adler und der Weinberge, Obstgärten und alten Zivilisationen, ein Land, dem unerzählte Geschichten eintätowiert sind. Einige Jahre zuvor hatte ich den äußersten Südosten Europas bereist, um die Geschichten der Menschen in der dreifachen Grenzzone zwischen Bulgarien, der Türkei und Griechenland zu erkunden. Die Seen liegen im Südwesten der Balkanhalbinsel, und auch an ihnen haben drei Staaten Anteil.
Die Zwillingsseen von Ohrid und Prespa sind wie Diamanten in die Gebirgsfalten des westlichen Mazedonien und östlichen Albanien eingebettet. Sie liegen relativ nahe an der Adria und der Ägäis, aber woher auch immer man sich ihnen nähert, sie fühlen sich nicht nahe zu irgendetwas an, nicht einmal zueinander. Es heißt abschreckende Gebirgsketten überwinden und auf einsamen Straßen unterwegs sein. Hier verlief die strategisch angelegte römische Via Egnatia von Dyrrachium (Durrës) an der Adria nach Konstantinopel am Bosporus. Später wurden orthodoxe Einsiedeleien und Kirchen in die Kalkfelsen gehauen, noch später existierten hier islamische Karawansereien und Derwischklöster. Dank der Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus angelegten Via Egnatia, die die römische Welt verbinden sollte und nahezu zwanzig Jahrhunderte in Gebrauch stand, wurde die Seenregion für eine Weile — in den Worten des Historikers Alain Ducellier — »das Nervenzentrum des Balkans«.
Die Via formte die Geschichte, wurde aber auch selbst von der Geographie geformt. Sie folgte dem Tal des Shkumbin zwischen den großen Bergen Illyriens, führte vorbei an den Zwillingsseen, schlängelte sich zwischen Gebirgsketten hindurch, entlang derer heute die Grenze zwischen (Nord-)Mazedonien und Griechenland verläuft, bevor sie hinunterführte in die Ebenen Pelagoniens; dann erreichte sie die Ägäis und verlief parallel zur Küste weiter bis zum Bosporus.
Die Seen werden von Quellen gespeist, sind von Quellen umgeben und durch unterirdische Flüsse miteinander verbunden. Sie liegen an der Verbindungsstelle zweier, mancherorts dreier Staaten — Griechenland knabbert am Südende des Prespasees und schluckt beinahe vollständig den an seinem unteren Ende liegenden tränenförmigen Mikri Prespa, den Kleinen Prespasee. Hier, am Zusammenfluss mächtiger zivilisatorischer Kräfte von der Antike bis in die Gegenwart, vermischen sich die Strömungen zweier warmer Meere und die eisigen Winde von den beinahe dreitausend Meter hohen Bergen.
Ohrid und Prespa sind die beiden ältesten Seen Europas. Ohrid könnte sogar der zweitälteste See der Erde sein. Normale Seen haben nur eine Lebensdauer von etwa höchstens 100.000 Jahren, bevor sie durch Sediment aufgefüllt sind, doch einige wenige — der Tanganjikasee, der Baikalsee, Ohrid und Prespa — bestehen schon seit einer Million Jahren. Obwohl in jüngster Zeit wieder Bodenproben entnommen wurden, sind sich die Wissenschaftler uneins über das Alter des Ohrid- und Prespasees; sie könnten tatsächlich an die drei Millionen Jahre alt sein.
Der Ohridsee wird von Zuflüssen gespeist, von sublakustrischen Quellen (Unterwasserquellen) und, was am bemerkenswertesten ist, von unterirdischen Flüssen aus dem Prespasee, die sich durch den Kalkstein des 2255 Meter hohen Galičica-Gebirges graben. Diese Geschwister-Quellen liefern etwa ein Viertel des zufließenden Wassers im See. Der poröse Karst sorgt dafür, dass das eisige Wasser auf natürliche Weise gefiltert im Ohridsee ankommt. Diese außerordentliche Transfusion, zusammen mit den sprudelnden lakustrischen Quellen, sieht man bei den Quellen von Sveti Naum in Mazedonien und bei den Teichen von Drilon in Albanien sozusagen Sekunde für Sekunde.
Der Prespasee liegt 180 Meter höher als der Ohridsee; vom Flugzeug aus gesehen wirken die beiden wie die Augen in einem uralten Gesicht. Die Gegend um die Seen und das Galičica-Gebirge dazwischen bilden ein Reservat mit einer äußerst reichen Biosphäre. In den höheren Regionen leben Braunbären, Wölfe und Steinadler. Einige behaupten, die geomagnetische Lage der Seen löse sehr starke Schwingungen aus. Manche glauben sogar, der Ohridsee befinde sich innerhalb eines »Energiewirbels«, und eine, wenn auch wissenschaftlich wertlose, lokale Übertreibung phantasiert von einem weiteren See unter dem Berg — einem »vergrabenen« See. Die Rede geht zudem von einem Unterwassergebirge, entstanden durch permanente tektonische Verschiebungen in der Region, was nicht so unwahrscheinlich klingt. Sicher jedenfalls ist, dass das unterirdische Kommunikationssystem der beiden Seen in seiner Art in Eurasien einzigartig ist.
Vor zehn Jahren traf ich auf einer Reise zum See einen jungen Mönch, der mich fragte, wo meine Großmutter begraben sei. Ich sagte, in Sofia. Er meinte, das bedeute nichts, ihr Geist sei hierher zurückgekehrt, denn der Ohridsee sei ein »Sammelpunkt«.
Bei diesem selben Besuch wurde ich Zeugin eines tragischen Unfalls. Es war an einem warmen Septembertag. Ich stand auf den Klippen von Kaneo oberhalb von Ohrid. Von dort überblickte man das gesamte Ufer. Ich fotografierte ein Touristenschiff, das über den Spiegel des Sees glitt. Eine halbe Stunde danach kenterte das Schiff und sank, ohne eine Spur zu hinterlassen, als hätte der See es verschluckt. Die Passagiere waren Gäste aus Bulgarien. Fünfzehn ertranken, die anderen wurden von Einheimischen gerettet. Mit unheimlicher Symbolik hatte das Boot den Namen Ilinden getragen, nach dem tragischen Ilinden-Aufstand (am Tag des heiligen Elias) 1903, der Mazedonien vom osmanischen Joch befreien sollte. Dieses Ilinden-Tages wird in Bulgarien und in der Republik Nordmazedonien jedes Jahr gedacht, obwohl beide Regierungen, ein Beispiel für retrospektiven Nationalismus, in regelmäßigen Abständen darüber streiten, wer daran beteiligt war — Mazedonier oder Bulgaren, oder beide, und ob und in welchem Ausmaß ein Unterschied zwischen ihnen bestand.
Touristen kommen jeden Sommer an den Ohridsee, die untergründigen Strömungen der Region aber bleiben verborgen. Der Balkan ist ein kompliziertes Gewebe der Zivilisationen, aus dem die Einheimischen verschiedene und manchmal widersprüchliche Versionen der Wirklichkeit heraus- und Fremde hineinlesen. Dieses Rorschach-Test-artige Phänomen hat mehr als einen apokalyptischen Krieg hervorgerufen und erdulden lassen. Auf dem Balkan wie an vielen Orten der Welt, wo ein neu-alter Nativismus wieder im Aufwind ist, sind die Schmelztiegel gefährdet. Das lakustrine Reich, das sich heute drei Länder teilen, ist einer der ältesten überlebenden Schmelztiegel der Zivilisationen in Europa und im Nahen Osten.
Auf Französisch ist eine Macédoine der ultimative »gemischte Salat«. »Mit einigem Glück kann der Reisende in Mazedonien auf demselben Markt sechs verschiedene Sprachen und vier dazugehörige Dialekte hören«, schrieb der britische Journalist Henry Noel Brailsford 1905, als die Region Mazedonien zu einem zerbröckelnden Imperium gehörte und meine Urgroßeltern Untertanen der Osmanen waren. Ein Jahrhundert später war die ehemalige jugoslawische Teilrepublik Mazedonien als indirektes Resultat dieses Turm-von-Babel-Effekts mit Griechenland in einen generationenlangen Patrimonialstreit verstrickt. Während ich dort unterwegs war, kam es schließlich durch das Prespa-Abkommen zu einer formellen Lösung, wodurch der Name der Republik — ziemlich rasch und für manche schmerzhaft — in Republik Nordmazedonien geändert wurde. Obwohl in der Region die alte Tradition der Verwirrung, der Komplikationen und Verschwörungen weiterbesteht, halten Nordmazedonien und Albanien mit knapper Not an der alten Gewohnheit der Toleranz fest.
Seit dem Ende der Jugoslawien-Kriege (1991 bis 2001) wird »der Balkan« irrigerweise mit dem ehemaligen Jugoslawien in eins gesetzt, das nur den westlichen Balkan umfasste, und der Begriff wurde in der internationalen Bürokratie weitgehend durch »Südosteuropa« ersetzt, in diesem Buch aber bleibe ich bei Balkan. Das geschieht in einem Geist, der den natürlichen, ehemals neutralen Namen der Halbinsel, benannt nach dem Balkangebirge in Bulgarien, wieder für sich beansprucht. Obwohl das Toponym ursprünglich von außen aufgezwungen wurde, ist es doch über die Jahrhunderte ein selbstgewähltes kulturelles Kennzeichen geworden, das den verschiedenen Völkern eine Art transnationale Staatsbürgerschaft verleiht, auch wenn sie sich in anderer Hinsicht uneinig sein mögen.
»Der Balkan, das sind wir«, pflegte meine Großmutter zu sagen — sie meinte damit ihre Familie. Aber insofern »der Balkan« mit der Fragilität von Frieden und Toleranz gleichgesetzt wurde, bewies sie damit eine tiefere Einsicht in die menschliche Verfasstheit. Unsere Welt ist unaufhaltbar miteinander verbunden, doch zunehmend fragmentiert sie sich selbst. Manche würden das »balkanisiert« nennen. Mit einem jetzt ein Jahrhundert alten Terminus — er wurde 1918 in der New York Times erstmals benutzt — bedeutet Balkanisieren »eine Region oder ein Land in kleinere, untereinander feindselig eingestellte Staaten oder Gruppen aufteilen«. Das französische se balcaniser ist selbstreflexiv, es impliziert volle Handlungsfähigkeit, was es kaum besser macht. Aber bevor »der Balkan« als politische Funktionsbezeichnung eine negative Färbung annahm und im Gegensatz zum denkfaulen und ungenauen Stereotyp vom »uralten Hass« hat die Halbinsel lange Zeit eine polyphone, manchmal kakophone Diversität beherbergt. Und sie tut es nach wie vor.
In einem weiteren Kontext sehen die zwei großen gegensätzlichen Kräfte derzeit, und ich glaube, in allen kritischen Phasen der Menschheitsgeschichte, so aus: Streitsucht und Harmonie, Krieg und Frieden, Ignoranz und Verständnis. Wegen seiner transkontinentalen, transkulturellen Geographie war der südliche Balkan ein strategisches Theater, wo diese Dichotomien mit besonderer Heftigkeit, ja Wildheit ausgetragen wurden. Die geographische Region Mazedonien liegt in einem höchst seismischen Gebiet einer ohnehin seismischen Halbinsel. 1963 wurde die Hauptstadt Skopje durch ein heftiges Erdbeben zerstört. Tausende wurden getötet oder verwundet. Meine Großeltern fuhren mit Vorräten und Feldbetten aus Sofia nach Skopje; die Brüder meiner Großmutter und ihre Familien hatten keine Wohnung mehr, und meine Großeltern campierten mit ihnen in den Parks der zerstörten Stadt. Nachts lagen sie wach in ihren Zelten, hörten, wie die Erde unter ihnen dröhnte. Bis zum heutigen Tag ist der Zeiger der Uhr am Hauptbahnhof von Skopje auf der Stunde des Erdbebens festgefroren.
Manchmal komme ich mir vor wie diese Uhr. Es ist ein irrationales Gefühl, aus den Fugen mit der Gegenwart: umgeben von Ruinen, feststeckend in einem lange vergangenen Augenblick des Unheils. Ich weiß, dass dieses Vermächtnis der stehengebliebenen Uhr von meiner Mutter auf mich gekommen ist, aber ich wollte herausfinden, wo das herkam und wie andere es trugen. Ich wollte erfahren, was ein kulturelles und psychologisches Erbe ausmacht und wie wir damit weiterkommen, anstatt wie Schlafwandler zurück in den geopolitischen Abgrund zu tappen. Der Abgrund beherbergt die Gebeine unserer Vorgänger, die dunklen Kräften nicht entkommen konnten. Einige dieser Kräfte sind noch vorhanden — sie waren niemals fort —, um uns wissen zu lassen, dass der Abgrund immer offen und aufnahmebereit ist.
Die Geographie formt die Geschichte, das akzeptieren wir für gewöhnlich als Faktum. Aber weniger oft untersuchen wir, wie Familien die großen Historio-Geographien verdauen, wie diese unsere innere Landschaft formen und wie wir als Individuen den Lauf der Geschichte auf unsichtbare, doch bedeutsame Weise beeinflussen — ist doch das Lokale vom Globalen nicht zu trennen. Ich fuhr zu den Seen, um nach einer Erklärung für solche Kräfte zu suchen. Aus meiner Reise an »Die letzte Grenze« wusste ich, das manchmal die Durchgangsstraßen der Geschichte als geographische Außenposten verkleidet sind, um uns besser damit narren zu können, die Vergangenheit sei ein anderes Land.
Ungefähr seit der Zeit von Herodot, dem »Vater der Geschichtsschreibung« (im fünften vorchristlichen Jahrhundert), und in den darauf folgenden etwa zwanzig Jahrhunderten bedeutete das griechische Wort Historia die facettenreiche, multidisziplinäre, oft narrative Erkundung eines Gegenstandes in einem Geist umfassender Nachforschung. Das Thema von Herodots »Historien« waren vordergründig die Perserkriege, doch eigentlich geht es darum, wie das menschliche Schicksal sich über lange Zeiträume, vor Erinnerung und Geographie und vor der dauernd in Bewegung befindlichen Leinwand der Welt abspielt. Erst im Spätmittelalter wurde »Geschichte« spezifisch mit der Vergangenheit assoziiert und allmählich, als sich die Disziplin dort festsetzte, festgelegt und abgesondert vom Rest der irdischen Erfahrung, die in der Essenz grenzenlos und nicht immer linear ist. Es war die ursprüngliche Auffassung von Historia, der ich in dieser Reise nachging.
Es war unmöglich, auf diesen uralten Wegen zu reisen, ohne frühere Autoren aufzusuchen, die über die Seen und die Region geschrieben haben. Sie waren beglückende Gefährten. Die Namen einiger Privatpersonen wurden geändert. Was Ortsnamen und Bezeichnungen für nationale und regionale Identitäten betrifft, habe ich mich besonders bemüht, unvoreingenommene Quellen und Berichte aus erster Hand zu Rate zu ziehen, wenn ich über die Vergangenheit, sowie Selbstidentifizierer, wenn ich über die Gegenwart schreibe. Die ehemals jugoslawische Republik Mazedonien wurde im Februar 2019 in Republik Nordmazedonien umbenannt, ich verwende die neue Bezeichnung nur im Kontext der Gegenwart. Davor war das Land lokal wie international als Mazedonien oder als Republik Mazedonien bekannt, und die verschiedenen Bezeichnungen in diesem Buch reflektieren diese Situation. Auch bei anderen Ortsnamen, die sich im Laufe der Geschichte geändert haben, gehe ich so vor.
Manche hier angesprochene Themen sind komplex und heikel; falls jemand das Gefühl haben sollte, sein besonderer Standpunkt sei trotz meiner Bemühungen um Inklusivität und Fairness unterrepräsentiert, dann bitte ich um Verzeihung.
Kapka Kassabova In den schottischen Highlands
Gib mir Flügel, und ich schwebe
Heim zu unsern Ländern, unsern Küsten,
Sehe wieder unsre Orte,
Ohrids, Strugas Angesicht,
Wo der See weiß ist und wahr,
Dunkel blau beim Windeswehn.
Konstantin Miladinov, 1861
Sehnsucht nach dem Süden
Zufällig bin ich in einer weiblichen Abstammungslinie die Vierte, die emigriert ist. Vor hundert Jahren wanderte meine Urgroßmutter aus dem Königreich Jugoslawien ins Königreich Bulgarien aus. Ihre einzige Tochter, meine Großmutter, emigrierte aus der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien in die Volksrepublik Bulgarien. Meine Mutter, ein Einzelkind, ging mit ihrer Familie aus Bulgarien nach Neuseeland und ich aus Neuseeland nach Schottland. Auch meine Schwester ging zurück nach Europa. Für uns alle bedeutete die Emigration die Trennung von unseren Eltern.
Wie man schon aus den wechselnden Ländernamen sieht, wurden die Entwurzelungen in dieser Familie wie in zahllosen anderen von kataklysmischen historischen Kräften ausgelöst: dem Sturz des Osmanischen Reichs und der österreichisch-ungarischen Monarchie, der Entkolonisierung und dem Aufstieg der Nationalstaaten auf dem Balkan; den Balkankriegen (1912 /13) und den zwei Weltkriegen, dem Kalten Krieg, seinem Ende und der Globalisierung.
In einem persönlicheren Sinn erinnert mich dieses Muster wiederholter Fluchten daran, dass das Verlangen zu reisen, zu entdecken und, ja, zu entkommen seit meiner frühen Kindheit in mir war. Oder sogar noch früher — im Mutterleib drehte ich mich endlos um und um und kam beinahe erstickt von der Nabelschnur, die sich verknotet hatte, aus dem Mutterleib.
Schon früh fühlte ich mich von Geschichten über Abenteuer und die Hochsee angezogen. Ich sehnte mich nach einem Ort, der mich befreien würde — aus dem Druckkochtopf unserer kleinen Wohnung, aus der Schule mit ihren erzwungenen patriotischen Aufmärschen, von der unterschwelligen Bedrücktheit, die von Zuhause und Vaterland nicht zu unterscheiden war. Ich sehnte mich nach Freiheit, bevor ich wusste, was Freiheit bedeutete oder wer ich war.
Anastassia, meine Großmutter mütterlicherseits, sehnte sich ebenfalls danach, oder jedenfalls sehnte sie sich nach irgendetwas. Dreizehn Jahre lang war sie in meinem Leben, die letzten fünf litt sie an Brustkrebs. Ich liebte sie über die Maßen. Sie war in ihren Fünfzigern, als sie krank wurde. Obwohl sie eine Perücke trug und Lippenstift verwendete, geschah unter ihren Kleidern Schreckliches. Auch ihre Sehkraft schwand. Manchmal las ich ihr vor, so wie sie mir vorgelesen hatte. Es war in der Wohnung meiner Großeltern in Sofia, wo ich mit fünf Jahren mein erstes Buch las, umrahmt vom Fenster zeichneten sich die blauen Umrisse eines Berges ab.
Meine Großmutter hatte ein Kultbuch mit Texten Hunderter Volkslieder. Es war das Werk zweier Volkskundler und Linguisten, der Brüder Miladinov, die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts durch die mazedonischen und bulgarischen Länder — also den Südbalkan — gereist waren und eine monumentale Sammlung von Volksliedern zusammengetragen hatten. Die Brüder stammten aus Struga unweit von Ohrid, von wo meine Großmutter kam, der Stadt, die den gleichen Namen trug wie der See. Sie erzählte mir die Geschichte der Miladinovs, und ich erkannte, dass sie wie alle »unsere« Geschichten mit einer brutalen Ungerechtigkeit endete, im Rückblick aber durch die Macht ihres Ideals Erlösung erfuhr — Freiheit durch Lernen und Bildung. Aber der wichtigste Punkt hier ist, dass der jüngere Bruder, Lyriker, ein Gedicht namens »Sehnsucht nach dem Süden« schrieb, T’ga za jug. Es war von seinem heimatlichen See inspiriert, während er im kalten, fernen Moskau weilte.
»Geht dort die Sonne dunkel auf,
wie sie hier so dunkel steigt?«
Den nachfolgenden Generationen wurde das Gedicht symbolisch für den See, für Exil und Verlust, für irgendeinen undefinierbaren Kummer, der mit Mazedonien zu tun hatte, mit »unseren Orten«, mit dem Balkan und dem Süden. Es saß tief in unseren Knochen, wie das Wetter. Interessanterweise bedeutet das Wort t’ga gleichzeitig »Sehnsucht« und »Kummer«.
Die letzten Zeilen lauten:
»Dort (am See) würd ich sitzen, ein Weilchen auf der Flöte spielen.
Dann würd die Sonne sinken, und es käm ein süßes Sterben.«
Ein süßes Sterben. Das war einer meiner ersten Kontakte mit Poesie. Schon damals empfand ich in der Atmosphäre um mich die Gegenwart von etwas Schwerem, Verworrenem, etwas, das von meiner Mutter ausstrahlte, die eine Erweiterung meiner Großmutter war, und die kam vom See. Wie war sie hierhergekommen (urban und unvollständig) und redete doch so oft von dort (wässrig und vollständig), wo ihre Verwandtschaft geblieben war und wo sie ein bisschen anders redeten als wir, als verwendeten sie einen alten Dialekt, aber aussahen wie wir. Es gab eine harte Grenze zwischen uns. Oft hatte ich mich in einen schweren sowjetischen Weltatlas vertieft, wo unsere sowjetische Welt in Rosa abgebildet war und aus dem man die geodätischen Besonderheiten ferner Länder ersehen konnte. Auf der mittleren Doppelseite erschien Europa als ein schlampiges Durcheinander ineinander verfließender Farben, beengt und beschwert durch vielfache Bedeutungen.
In der offiziellen Geschichte hieß es, unsere südlichen Nachbarn seien nicht dieselben wie wir, sie seien anders — historisch gesehen waren es Agenten der Niedertracht (die Griechen) und Tyrannei (die Türken). Wir wiederum waren leidgeprüfte duldende Märtyrer, leidenschaftlich, poetisch, schuldlos ungerecht behandelt. Doch die Nachbarn meiner Großeltern von gegenüber auf dem Stockwerk, die Vassilopoulovs, waren nicht wie alle anderen. Die Mutter, Bulgarin, verprügelte ihre Töchter und sperrte sie auf den Treppenabsatz, und der Vater, Grieche, versuchte zu vermitteln. Er stand in Verbindung mit etwas, das mysteriöserweise »die Ereignisse in Griechenland« hieß. Mein Vater, ein Universitätsprofessor, hatte einen griechischen Studenten, für den ich schwärmte. Und was die Türken betraf: Meine Großmutter erinnerte sich gerne an die Jahre bei einer türkischen Vermieterin in Ohrid, und mein Vater war mit heißgeliebten türkischen Nachbarn aufgewachsen. Außerdem wurde in dem Gedicht Istanbul als einer »unserer Orte« erwähnt. Moskau andererseits und im Gegensatz zu dem, was man uns offiziell sagte, war keiner unserer Orte. Ja, das Gedicht war mehr als ein Jahrhundert alt, und die Dinge hatten sich geändert, aber seine schwermütige Stimmung von Trennung und Sehnsucht hatte einen starken Widerhall, wie unberührt von der Zeit.
Auf dem runden, mit einer gefransten Samtdecke bedeckten Wohnzimmertisch meiner Großeltern stand ein Krug mit Kieseln vom See. Es waren glatte Kiesel wie andere auch, rosa und weiß, zugleich aber auch Objekte wie ein Talisman, die die Brise einer helleren, geräumigeren Welt mit sich brachten.
Anastassia ist ein griechischer Name und bedeutet Auferstehung. Mit meinem Mädcheninstinkt konnte ich sagen, dass meine Großmutter nicht nur eine Schönheit, sondern auch ein großer Geist war, eine Kombination, die in dieser Familie seit Menschengedenken nur zweimal vorgekommen war: bei Anastassia und bei ihrer geliebten Nichte Tatjana, die eben erst mit sechsunddreißig Jahren in Ohrid an einem Gehirntumor gestorben war.
In den letzten Jahren ihres Lebens war es schwer, bei meiner Großmutter zu sein. Im kommunistischen Bulgarien gab es keine Hospize, man verließ sich auf die Barmherzigkeit der Familie. Anspruchsvoll von Natur, wurde meine Großmutter regelrecht tyrannisch gegenüber ihrem Mann und ihrer Tochter, die nicht genug tun konnte, obwohl sie mehr als genug tat: Kleider nähen, die genau so und nicht anders sein mussten, Geburtstagsfeste organisieren, denn Anastassia war immer eine stolze Gastgeberin gewesen. In ihrem Leiden schien meine Großmutter zu wollen, dass das Leben auch für ihre Liebsten, ein bevorzugter Ausdruck für die Frauen der Familie, verdorben sein solle.
Unterdessen versagte sich meine Mutter die kleinen Freuden, die ihr noch zur Verfügung standen. In den schrecklichen letzten Wochen des Lebens meiner Großmutter konnte sie nicht essen und wurde ausgemergelt von Infektionen, ein Schatten, bereit, ihrer Mutter in die Unterwelt zu folgen. Und wenn meine Mutter starb, dann würde auch ich sterben müssen, denn wir waren dieselbe Person. Wir hatten dieselben Gefühle und dieselben Ansichten. Ich spiegelte jede ihrer Bewegungen, spürte jede ihrer Stimmungen, nahm jedes Übersprudeln von Emotionen auf, begierig, sie lächeln zu sehen. Mit zehn redete ich mit der Grabesstimme meiner Mutter und hatte ihr verhärmtes Gesicht. Ich schob meinem Vater die Schuld an unserem Unglücklichsein zu, verbog meine natürliche Liebe zu ihm. Wie mein Großvater war er zahlenmäßig unterlegen, musste täglich Rechenschaft ablegen und versuchen, für irgendein unspezifisches Versagen zu büßen. Die emotionale Bilanz war ständig unausgeglichen.
Es gibt eine bleibende Erinnerung aus diesen Jahren. Meine Mutter und ich saßen im Bus nachhause, nachdem wir meine Großeltern am Fuß des Blauen Berges besucht hatten. Aus dem Busfenster winkten wir hinauf zu ihnen, winzigen Figürchen auf ihrem Balkon im siebten Stock. Aber meine Großmutter hatte sich in die falsche Richtung gedreht, da sie nichts sah, und mein Großvater korrigierte sanft ihr Winken. Meine Mutter weinte, und ich begann mit ihr zu weinen.
Sie hatte ihr Bestes getan, um mich zu beschützen. Ich hatte mein Bestes getan, um sie zu beschützen, aber so war es nun einmal — der Verlust war nicht aufzuhalten. Wir klammerten uns aneinander fest, hielten die Köpfe über Wasser, wie auf den Fresken in orthodoxen Kirchen, wo die Verdammten in einer feurigen Suppe ertrinken und nur ihre Köpfe herausragen. Und obwohl wir in einer strikt atheistischen Kultur lebten und ich das Wort Verdammnis nie gelernt hatte, fühlte ich es körperlich. Mit zehn schrieb ich Gedichte voller herzzerreißender Abschiede an Bahnhöfen, zum Scheitern verurteilter Sehnsüchte und Nimmermehrs. Als schriebe sie irgendjemand anderer durch mich.
Es war nicht so sehr das Sterben meiner Großmutter — Auslöschung konnte ich akzeptieren, Kinder können das —, es war das unerträgliche Gefühl der Trennung, das ich in meiner Mutter spürte. Meine Mutter sagte, sie habe immer in der Angst gelebt, ihren Eltern könnte etwas zustoßen. Ich lebte mit derselben Angst. Im Jahr des Atomunfalls von Tschernobyl nahmen wir im Spätsommer in Sofia Abschied von Anastassia. Zwischen den rot-goldenen, vom Wind weggeblasenen Blättern steht meine Mutter, ein in durchscheinendes Violett-Schwarz gekleideter Schatten. Ein heftiger Windstoß könnte sie wegwehen wie ein Blatt. Für mich wirkte sie immer nur prekär mit dem Leben verbunden, wie wurzellos geboren, als brauche sie eine äußerliche Kraft, um sich zu erden.
Im Sommer darauf bekam ich eine Autoimmunkrankheit und verbrachte Wochen in einem desolaten Krankenhaus mit verstopften Toiletten, wo ich Gedichte schrieb, Baudelaires »Fleurs du Mal« übersetzte und mich nach dem Süden sehnte. Mein Vater hatte ein Forschungsstipendium erhalten und war nicht da, doch meine Mutter kam jeden Tag nach ihrer Arbeit als Datenanalystin mit den verstaubten öffentlichen Verkehrsmitteln und führte mich zu einem langsamen Spaziergang auf dem Krankenhausgelände. Im Krankenhaus gab es einen Roma-Jungen, der mir gefiel; und so war ich verblüfft, als ich die Gedichte vor kurzem wieder las, waren sie doch an meine Mutter gerichtet. Bestürzend war auch meine Entdeckung von Liebesbriefen, die Großmutter Anastassia geschrieben hatte — schön formuliert, voller Verlangen, mit dem geliebten Wesen zu verschmelzen, dessen grüne Augen und seidenes Haar im Meer, im Himmel zu erblicken. Dann würd die Sonne sinken, und es käm ein süßes Sterben. Sie sind an ihre halbwüchsige Tochter gerichtet.
Obwohl ich alle zwischen Mutter und Tochter gewechselten Briefe aus der Schachtel lesen wollte, schaffte ich es nicht, weiterzumachen. Diese romantischen Gefühle, die Liebhaber-Intensität, die sie verzehrten, waren mir sehr vertraut: Sie waren unverdünnt an mich gekommen, ebenso wie das Bedürfnis, sie durch Sprache auszudrücken. Meine Großmutter schrieb Gedichte anlässlich von Geburtstagen von Verwandten und Freunden, und ich besitze immer noch eines, das sie mir zu meinem zehnten Geburtstag schrieb, fünf Zeilen für die fünf Buchstaben meines Vornamens, obwohl sie damals nicht mehr tippen und kaum sehen konnte; sie hatte sie meinem Großvater diktiert. Sie war Journalistin und Moderatorin für die Radioprogramme für Bulgaren im Ausland — eine Art BBC World Service, aber in kommunistischem Kontext, und ihre Stimme erklang wie ein Zauberspruch über die Ätherwellen.
»Liebe Landsleute«, begann dann ihr verführerischer Alt, »dieses Lied ist für euch.«
Und dann drückte irgendeine herzzerreißende Melodie auf die Tränendrüsen der bulgarischen Diaspora rund um die Welt. Natürlich konnten viele von ihnen nicht zurückkehren, weil sie aus politischen Gründen emigriert waren und auf schwarzen Listen standen. Manchmal besuchte ich Großmutter im Bauhaus-Gebäude des bulgarischen Rundfunks. Dann wartete ich im Verschlag des Wachmanns in der Vorhalle und betrachtete das Wandmosaik. Es hatte die Form eines proletarischen Sonnenrads, oder vielleicht einer Landkarte von Bulgarien, es sah aber auch aus wie Marx und Engels im Profil und Lenin, denn sie erschienen oft als Dreiheit. Dann platzte sie aus dem Aufzug wie der erste Sommertag. Sie nahm allen verfügbaren Raum ein und hatte ein ungehemmtes Lachen, das sich in Wellen ausbreitete. Umgeben von der Mittelmäßigkeit, Konformität und Verlogenheit, auf denen ein totalitäres Regime gedeiht, lebte Anastassia mit Begeisterung und äußerte offen ihre Meinung in einer Gesellschaft, wo die Hälfte der Bevölkerung keine hatte und die andere sie für sich behielt.
Bevor sie krank wurde, war sie wie Demeter, die Erntegöttin, die Quelle aller üppigen und köstlichen Dinge: Regale voller Bücher, ein Kleiderschrank voller Leder- und Pelzmäntel, die mein Großvater für sie aus den staatlichen Betrieben besorgte, wo er als Chefbuchhalter arbeitete. Aber dann wurde sie zu krank, um sie anzuziehen. Einen nahm ich mit nach Schottland, getragen habe ich ihn allerdings nie. Er sieht aus wie die Haut eines Selkies, jenes mythischen nordischen Wesens, das seine seehundartige Haut abwirft, um an Land menschliche Gestalt anzunehmen und zu heiraten, dem es aber bestimmt ist, in sein wässriges Zuhause zurückzukehren.
Ich habe versucht, die Rezepte meiner Großmutter nachzukochen. Die spinatgefüllten Filo-Pastetchen aus selbstgezogenem Strudelteig, der überbackene Lammauflauf mit Joghurt, Tavë Elbasani genannt, Imam bayıldı, gefüllte und geschmorte Auberginen. Wissen Sie, was das auf Türkisch bedeutet? Es heißt: Der Imam ist in Ohnmacht gefallen (weil es so gut geschmeckt hat). Und wie der Imam haben wir uns gemeinsam überessen. Manchmal schliefen wir auch zusammen, mein Großvater blieb im Nebenzimmer allein. Sie aß bis zum Exzess, rauchte viel, fühlte tief, und was sie angenehm fand, wurde bis zu einem Punkt exquisiten Schmerzes getrieben. Neutralität war keine Option. Ihre Gesundheit war, wie ihre Gefühle, schon lange vor dem Krebs instabil, und auch die meiner Mutter war labil. Ich tat es ihnen gleich: Als ich zur Frau wurde, befiel mich eine allumfassende Malaise. Ich wusste nicht, wie ich mich gut fühlen sollte. Als Halbwüchsige, wir waren eben nach Neuseeland gezogen, verfiel ich in Angststörungen, jede Erfahrung wurde zum Tiefpunkt. Wenn meine Eltern nicht da waren, stellte ich sie mir in einem tödlichen Unfall vor und hetzte mich selbst in vorzeitige Verzweiflung. Ich beurteilte mich selbst und alle anderen streng wegen eingebildeter Unvollkommenheiten. Die Literatur rettete mich vor der absoluten Selbstzerstörung. Dann wurde meine Mutter von einer rasenden Depression niedergedrückt, die sie auf ihre Liebsten projizierte. Schließlich war es an uns, sie glücklich zu machen. Im Rückblick erkenne ich, dass meine Großmutter, meine Mutter und ich uns in einem vorgezeichneten Drama bewegten. Obwohl wir uns und einander vor irgendeiner ungenannten Bedrohung zu schützen versuchten, half dieser Schutz nicht. Im Gegenteil, er schien genau dasjenige anzuziehen, das abzuwehren er vorgab. Etwas zerrte uns zu Boden und zwang uns, uns schlecht zu fühlen. Die Patientinnen wechselten sich ab, die Krankheit aber blieb.
Auf Kindheitsfotografien mit meiner Großmutter haben wir die Hände aufeinandergelegt, besitzergreifend. Dasselbe auf Fotos von ihr und meiner Mutter, eine Generation früher, und mit ihren Nichten in Ohrid, den See im Hintergrund: Du bist eine Verlängerung von mir. Aber auch: Lass mich niemals gehen.
Wen hast du lieber, Mama oder Papa?, lautete die heimtückische Frage, die einem die Erwachsenen stellten. Großmama oder Großpapa? Großmama oder Mama? Insgeheim mochte ich Jungen. Noch bevor ich zehn war, warnte mich Großmutter Anastassia, die mein Interesse spürte: Geh niemals mit einem Jungen, der Füße wie ein Bauer hat oder — den Rest habe ich vergessen, aber es war eine Liste, die signalisierte, dass sie nicht wollte, dass ich überhaupt an Jungen Gefallen fand. Nicht ohne sie, denn ich war ihr Augapfel. Ihr Augapfel zu sein fühlte sich an, als würde ich angestrahlt. Es ließ einen glühen und machte zugleich müde. Man wollte die Tür schließen. Aber sie hatte den Schlüssel zur Tür.
Irgendwo in ihr drinnen war ein Abgrund, der nicht aufgefüllt werden konnte. Er schien seinen Ursprung in Mazedonien und am See zu haben. Es war, als wäre sie mehr als eine Person, eine ganze Nation von Seelen, ein lautstarkes Hinterland von Vorgeschichte. Sie trug eine ursprüngliche Matrix in sich, in der die Landmassen sich immer noch verschoben, die Bruchlinien sich unter der Oberfläche bewegten, der Wasserspiegel stieg und fiel; etwas war aus dem Gleichgewicht und konnte nicht ausgeglichen werden.
Als ich ein Kind war, schickten uns die Verwandten in Jugoslawien eine 3-D-Karte eines blauen Sees und einer Stadt auf einem Hügel. Drehte man die Karte hin und her, enthüllten sich verschiedene Blicke auf die Stadt. Das war faszinierend. Stundenlang konnte ich das tun, verzaubert vom Blau des Sees — groß wie ein Meer — und den Möglichkeiten, die er verkörperte. Es war unklar, warum meine Großmutter solch einen magischen Ort verlassen hatte. Warum sie die Liebsten zurückgelassen hatte. Aber jetzt seid ihr meine Liebsten, meinte sie. Es lag an uns Liebsten, sie glücklich zu machen.
»Ich lebe zwischen zwei Welten«, sagte sie. »Wenn ich in Ohrid bin, sehne ich mich nach Sofia. Wenn ich in Sofia bin, sehne ich mich nach Ohrid.«
Immer sehnte sie sich nach irgendetwas, so wie meine Mutter, so wie ich. Eine Frau zu sein, das bedeutete, eine Abwesenheit zu beklagen, einen Mangel, einen drohenden Verlust. Kurz, Schmerz zu empfinden. Schon früh war ich mir sicher, dass ich niemandes Frau oder Mutter sein wollte. Ich wollte in ferne Länder reisen, nicht schon wieder ans Schultor, wollte in Frieden leben und sterben, nicht von Verwandten umringt. Aber manche Dinge folgen uns, wohin wir auch gehen.
Der Wassertraum begann mich als Jugendliche heimzusuchen, kurz nachdem unsere Familie am Pazifik angekommen war und gerade als Jugoslawien zu zerfallen begann. Im Traum sehe ich, wie eine riesige Wassermasse sich am Horizont auftürmt. Ich muss weglaufen, aber etwas hält mich zurück. Ich muss Zeugnis ablegen. Nun überflutet das Wasser den Strand, dann Gebäude, Strommasten, Menschen. Ausgestorbene Arten treiben darin. Die Berge sind uralt wie die Pyramiden, aber auch sie versinken. Dies sind die Wasser der Erde, unvorstellbar alt — und aufgewühlt. Sie umschließen die bekannte Welt. Mit pochendem Herzen schwimme ich durch die Trümmer und suche nach noch Lebenden, versuche zu helfen.
In der Jung’schen Psychologie bedeutet Wasser das kollektive Unbewusste, und das in diesem Traum vorhergesagte Unheil fühlt sich unpersönlich an. Ich mag diesen Traum nicht und möchte, dass er aufhört, aber in den letzten Jahren ist er nur noch häufiger geworden.
Drei Jahre nach Großmutter Anastassias Tod, im drückenden Sommer 1989, fuhren wir an den Ohridsee: meine Eltern, meine jüngere Schwester und mein Großvater, adrett im Anzug. Es herrschte eine Stimmung, als löse sich etwas auf. Im Rückblick waren das unsere zwei Länder, obwohl es sich damals so anfühlte, als wäre es unsere Familie. Jetzt, wo Anastassia und ihre Nichte Tatjana nicht mehr da waren, würde es nie mehr dasselbe sein. Wir absolvierten einen beklommenen Besuch bei einem Mann mit zwei Söhnen: Tatjanas Witwer und seine Jungen, meine Cousins zweiten Grades. Es gab Schweigen und in Goldfolie gewickelte jugoslawische Schokolade, die in der Hitze schmolz. Meine Faszination von Tatjanas tragischem Trio fühlte sich wie Liebe an. Fünfzehn und Jungfrau, verstand ich bereits die ganze Sache mit Sex und Tod. Der See wallte hoch mit reifenden Feigen und unerträglichem Sehnen. Mein ganzes Leben lang würde ich mich zu versehrten Menschen und Orten hingezogen fühlen.
Die Familie meiner Großmutter hatte seit Menschengedenken Obstgärten besessen. Ihr väterlicher Familienname lautete Bahčevandčiev, Gärtner (vom persischen Wort für Garten, bāġ). Und nun brachte man meine Schwester und mich ebenfalls hin, um die Pfirsichgärten zu sehen, die nach wie vor unseren Onkeln gehörten. Da war der See — südlich, großzügig, dekadent, voller Licht und auch voll einer Malaise, die nicht zu benennen war. Ein paar Jahre später lag Jugoslawien in Trümmern. Zum ersten Mal war Mazedonien der Name eines unabhängigen Nationalstaats. Von allen jugoslawischen Teilrepubliken entkam es als einzige, ohne dass auf seinem Gebiet auch nur ein Schuss abgefeuert worden wäre, obwohl der Krieg mit dem Lynchmord an einem jugendlichen Mazedonier begonnen hatte, dessen Unglück es gewesen war, in einem Panzer der Jugoslawischen Volksarmee (JNA) in Split zu sitzen. Als die Musterungsoffiziere der JNA in die Häuser in Ohrid kamen, um Freiwillige anzuwerben, wartete eine Überraschung auf sie: »Nicht da«, lautete die Antwort an jeder Tür. Die Familien der jungen Männer in Ohrid, die merkten, woher der Wind wehte, hatten ihre Söhne weggeschickt, zu Verwandten in anderen Städten, oder in den Keller. Später, ein Jahr nach dem Kosovokrieg, kam neues Ungemach, als die Gewalt auf Mazedonien überschwappte. Und wieder lautete die Antwort: »Nicht da.«
Das Mazedonien vom See hatte keine Lust auf Krieg. Es hatte herausgefunden, wie man mit Ach und Krach überlebte.
Bald nach dem Besuch am See wanderten wir nach Neuseeland aus. Meine Eltern schlugen dort feste Wurzeln. Meine Schwester und ich versuchten das auch, aber schließlich verließ ich als Dreißigjährige Neuseeland und ließ mich in Schottland nieder, und sie tat dasselbe in der Schweiz. Aber als das Leben für unsere Familie schließlich leichter wurde und der Kampf der mehrfachen Emigration nachgelassen hatte, immer wieder an neuen Orten, wo sie unseren Namen nicht buchstabieren konnten, von vorne zu beginnen, entzog sich der Friede auf perverse Weise. Immer wenn wir uns trafen, wurde etwas verbogen, kam an einen schmerzhaften Punkt, und all unsere Energie ging darauf, das wieder in Ordnung zu bringen. Familientreffen wurden Krisen, die es zu überleben galt.
Repetitive, erdrückende Zustände brauchen nicht immer ein aktuelles Objekt, wie es sich herausstellt: In der generationenübergreifenden Psychologie wird das als Resultat eines unbewältigten Traumas gesehen und als »Einbruch der Zeit« bezeichnet, und so fühlt es sich auch an. Die Zeit bricht ein. Meine Mutter steht unter Ruinen — schon wieder —, und ich laufe zu ihr hin. Dann würde ich ihren bitteren Klagen lauschen und mit ihr weinen, als wären wir erst jüngst Leidtragende geworden. Sigmund Freud nannte den masochistischen Zwang, schmerzliche Erfahrungen neu durchzuagieren, »teuflisch«, weil er uns vom Leben abschneidet, und so ist es auch: In solchen Momenten überlebt man gerade noch. Dieser auszehrende Zyklus wurde lange genug wiederholt, bis ich schließlich aufhörte, meinen Part zu spielen, und aus Gründen der Selbsterhaltung Grenzen zu ziehen begann. Meine Mutter und ich entfernten uns voneinander. Das Niemandsland zwischen uns lag öde da. Wie in einem Albtraum blickte ich immer und immer wieder in ihre Augen und sah nicht meine Mutter, sondern eine Maske aus einer antiken Tragödie.
Dreißig Jahre nach dem Tod meiner Großmutter und kurz bevor ich mich auf diese Reise begab, hatte ich mit einer gesundheitlichen Krise zu kämpfen, die sich in diffusen Schmerzen am ganzen Körper und in Mattigkeit äußerte. Wie in dem Traum vom steigenden Wasser fühlte es sich sonderbar unpersönlich an. Als wäre ich in einen Teich mit negativer Energie getappt, und er übermittelte mir seine Wellen aus Gründen, die ich nicht ermessen konnte. Ich fühlte die Anwesenheit universalen Todes. Aber langsam heilte ich mich selbst. Im Rückblick bin ich mir sicher, dass ich, hätte ich nicht diese wassergetränkte Nacht der Seele erlebt, nicht den Mut der Verzweiflung aufgebracht hätte, der mich zum See führte.
Ungefähr zur selben Zeit wurde meine Mutter von einer unheilbaren Krankheit befallen. Eines der Symptome waren schwere Neuralgien, die sie Schmerzen nannte, und bald waren es Die Schmerzen. Über Nacht wurde das Leben meiner Eltern darunter zusammengefasst. Es wurde das Einzige, was noch da war. Ja, etwas erhob sich wie eine dunkle Woge, immer und immer wieder, versuchte sich jenseits allen Zweifels erkennbar zu machen, eine gestaltwandelnde Präsenz, die sich uralt anfühlte. Sie war niemals wirklich angesprochen worden, und mit der Diagnose meiner Mutter wurde sie zum legitimen Familienmitglied befördert. Aber inzwischen hing mir das alles so sehr zum Hals heraus — der Ausdruck wirkte plötzlich passend —, dass ich es nicht mehr aushielt. Ich wollte bloß, dass das alles aufhörte.
Bei meinem letzten Besuch bei den Eltern in Auckland fand ich es beklemmender als sonst, mit meiner Mutter in einem Haus zu sein. Keine Ärzte oder Heiler konnten Die Schmerzen lindern, sie waren widerstandsfähig und narzisstisch und hatten ihr gesamtes Wesen übernommen. Ich hatte dasselbe bedrückende Gefühl wie bei meiner Großmutter: das Gefühl subversiver unterirdischer Kräfte, die eine Landschaft entstellten. Mir fiel die geologische Einsicht James Huttons aus der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts ein, wie Erosion, Sedimentbildung und Ablagerungen über Äonen hinweg stattgefunden hatten, jenseits aller menschlichen Begriffe, mit »keiner Spur eines Beginns, keiner Aussicht auf ein Ende«. Ein ernüchternder Gedanke.
Nicht zum ersten Mal verspürte ich den Drang, einfach wegzugehen. Aber ich wusste, dass ich das nicht tun konnte, und außerdem hätte Weggehen nicht genügt. Unter der Sonne der Antipoden, die meine Mutter wie immer hinter geschlossenen Fensterläden mied, sah ich es deutlich: Wenn ich nicht verstand, warum aus den zwei Frauen, die ich geliebt hatte und die so viel Gutes gehabt hatten (inklusive liebende Ehemänner), tragische Furien geworden waren, warum sie Märtyrerinnen einer unbekannten Sache geworden waren — dann war ich als Nächste dran. Die Maske lauerte hinter meinem eigenen Gesicht.
Als ich meinen Eltern am Abflug-Gate in Auckland zuwinke und sie dastehen sehe, nach fünfzig Jahren immer noch zusammen — meine geisterhafte Mutter eingehüllt in Die Schmerzen, mein stämmiger Vater, der sie stützt —, winke ich und lächle. Das Gesicht meiner Mutter ist eingefallen, die Augen meines Vaters glänzen vor Tränen, aber er lächelt ermutigend; zwei Menschen, die mir mehr bedeuten, als in Worte zu fassen ist, denn es geht allen Worten voraus. Bald werden wir ozeanweit voneinander entfernt sein. Winke und lächle. Erst als ich das Gate passiert habe, weine ich.
Ich bin in ferne Länder gereist. Ich habe mich für die Freiheit entschieden. Doch hier bin ich nun, am See, und suche nach Antworten.
Teil Eins
Frühling
Ohrida (sic) hängt an einem Abhang und rankt sich die Ufer eines Sees entlang, den zu sehen halb Europa herbeieilen würde, wäre er nicht in diesem gequälten Land — ein See von unermesslicher Anmut, der an wilder Pracht keinem nachsteht. Die purpur-silberne Schönheit seiner schneebedeckten Berge verschwimmt jenseits des Glitzerns seiner kristallenen Gewässer in malvenfarbenen Dunst. Seine schreckliche Pracht ergreift die Vorstellungskraft, und in verrückten Augenblicken erwacht ein Schauer der Sympathie für die unbekannten Männer, die mühevoll winzige Kapellen in die Klippen an seinen Flanken hieben und über seinen magischen Wassern einsam lebten und starben. Es gab Zeiten, da wäre ich nicht überrascht gewesen, die weiße Vila aus den Balladen von den Bergen kreischen zu hören.
Edith Durham, 1905
Mazedonisches Mädchen
Über die Alpen flogen wir, über adriatische Inseln aller Größen und Formen und über das Hochland Albaniens, das sich jäh aus den Flussniederungen der Küste erhob — Berg um Berg, die Haut des Landes wie stark abgenutzter Samt. Flüsse verdickten und verdünnten sich in Bergschluchten, und die Straßen wanden sich zwischen in Schnee und Nebel verlorenen Kämmen. Die Sonne sank über den schwarz werdenden Falten, eine mythische Landschaft. Dann plötzlich das blaue Licht des Sees.
Der Ohridsee ist einer jener Orte auf der Erde, die einem das Gefühl geben, als erwarte einen etwas Schicksalhaftes. Als hätte man immer schon kommen sollen, und man kann nicht glauben, dass es so lange gedauert hat. Als unten der See auftauchte, wurde es im ganzen Flugzeug still.
Es war noch keine Touristensaison, und außer der Frau des britischen Botschafters in Skopje und ein paar Besuchern waren die meisten Passagiere redselige Auslands-Mazedonier und -Albaner auf Heimaturlaub. Damals stand die ehemalige jugoslawische Teilrepublik kurz vor dem zivilen Zusammenbruch. Der neugewählte Ministerpräsident und sein Kabinett waren im Parlament von Aufrührern, einige davon Mitglieder der früheren Regierung, attackiert und verletzt worden. Das Land befand sich in einem zwei Jahre andauernden Patt-Zustand, alles war zum Stillstand gekommen. Der Papst »betete für Mazedonien«, und wenn der Papst einmal anfängt, für jemanden oder etwas zu beten, dann weiß man, dass es arg ist.
Ich betrachtete die Gesichter im Flugzeug — den warmen Teint der Frauen, die unscheinbaren runden Gesichter der Männer. Beginnt so die zivile Kernschmelze? In einem Moment plaudert man und knabbert etwas, im nächsten attackiert man die Person neben sich mit einem Plastikmesser. Die Person neben mir war ein seit zwanzig Jahren in London lebender albanischer Hydroingenieur. Er war mit seinen alten Eltern unterwegs; von Ohrid wollten sie ein Taxi an die Grenze nehmen, wo ihr Auto wartete, und dann nach Tirana weiterfahren. Auch er machte sich Sorgen, nicht wegen des Konflikts, sondern wegen der »bodenlosen Korruption« in Albanien und Mazedonien, die den Fortschritt sabotierte.
»Politik sollte eigentlich das Leben besser machen«, meinte er. »Auf dem Balkan macht sie es schlechter. Es ist eine Tradition. Sonst sind wir reich«, sagte er. »Sehen Sie sich dieses Wasser an!«
Auf dem kleinen Flugplatz drängelten Männer mit gebräunten Gesichtern sich am Ausgang, um ein Geschäft zu machen, keine Frau war in Sicht. Man wähnte sich im Nahen Osten. Ich war in eine Genotyp-Suppe eingetaucht. Alle Männer sahen aus wie meine Cousins.
Ich suchte mir einen Chauffeur mit einem netten Lächeln, und wir verließen den Terminal. Der ehemalige Militärflughafen war nach dem Apostel Paulus benannt, der erste Hinweis darauf, dass wir uns an der ehemaligen Via Egnatia befanden; Paulus war einer der Reisenden auf der antiken Straße gewesen. Und auf der schlaglöchrigen Straße in die Stadt, die der Egnatia wie ein Schatten folgte, passierten wir die Höhlenkirche zum heiligen Erasmus, eine Erinnerung an einen weiteren Reisenden aus der jordanischen Wüste, der eine Botschaft mit sich trug.
Dann Kilometer um Kilometer Obstgärten, wild, prachtvoll. Und es war erst Mai.
»Bavčas«, sagte der Chauffeur, Gärten. Ja, ich erinnerte mich daran.
Das Flachland außerhalb von Ohrid sah für mich gleich aus wie in den 1980ern und in den 1860ern für einen deutschen Schriftsteller: »ein riesiger verlassener Garten«.
Wir fuhren in die Neustadt am Fuß des Berges, obwohl hier nichts »neu« war. Das Erste, das mir auffiel, war das dünne weiße Minarett einer kleinen mittelalterlichen Moschee. Es roch nach Holzrauch. Der Ruf zum Abendgebet begann: »Allahu Akbar«, ein staubiger, nasaler orientalischer Singsang von schneidender Melancholie. Eine halbe Stunde später erklang von der ummauerten Stadt auf der Anhöhe das musikalische Geläut von Kirchenglocken. Es war eine Tradition von Ohrid, sagte der Taxifahrer. Die Moschee und die Kirche wechselten sich ab, nie prallten sie aufeinander.
»Denn wir leben in Frieden. Wenn uns bloß die Politiker nicht mehr aufhetzen würden.«
Wir fuhren die Serpentinenstraße zum Oberen Tor der Altstadt hinauf, beherrscht von der wiedererbauten Festung von Zar Samuil, auch als Kalé bekannt, türkisch für Festung. Jahrhunderte nach dem dramatischen Ende Samuils Anfang des elften Jahrhunderts hatten Herrscher, die verschiedene Sprachen sprachen und verschiedene Kopfbedeckungen trugen, hier ihren Sitz.
Dann kamen wir in die Innenstadt und zu den für Autos schlecht geeigneten steilen Gassen mit Katzenkopfpflaster. Halb levantinisch mit den Ausblicken auf den blauen See und den durch Läden verschlossenen Fenstern, halb balkanisch mit den vorspringenden, holzverkleideten oberen Stockwerken und üppigen Gärten, war der Geist der ummauerten Stadt nach wie vor vorhanden. Es war ein Geist des Stoizismus und der sturen Selbstgewissheit. Die Innenstadt hieß Varoš, im Gegensatz zur Außenstadt, Mesokastro, und der Varoš schaute auf das Mesokastro hinunter, und das bis zum heutigen Tag.
Für einige Zeit war hier Griechisch die offizielle Sprache, da die griechische Episkopalkirche ab 1767 bis in die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts das osmanische Mazedonien dominierte und das Erzbistum von Ohrid verdrängte; doch der uralte slawonische Einfluss behauptete sich so lange, bis er in einem seit tausend Jahren währenden Kulturkrieg wieder die Oberhand gewann. Verwirrenderweise bedeutete Mesokastro nicht wirklich »außen«, sondern »innen«, was vermuten lässt, dass derjenige, der den Begriff prägte, entweder nicht lesen oder nicht gut Griechisch konnte. Aber schließlich ist die Innenstadt des einen die Vorstadt des anderen.
Im Oberen Tor war immer noch ein mittelalterlich wirkender Einlass angebracht, und das Taxi fuhr hindurch: eine massive hölzerne Platte, mit Schmiedeeisen behämmert und mit eisernen Schlingen wie bei einem Kettenhemd besetzt. In alten Zeiten war das Obere Tor nur an Montagen geöffnet, das sind auch heute noch die Markttage. In Pestzeiten wurde das Tor verschlossen und die Bewegungsfreiheit bis auf weiteres eingeschränkt. Die wohlhabenderen muslimischen Familien in der Unterstadt packten dann ihren Besitz zusammen und warteten die Seuche in den Häusern christlicher Freunde innerhalb der Stadttore ab. Unterdessen wurden am Untertor am See Reisende und Rückkehrer von langen Fahrten aufgehalten und in zwei aneinandergebauten Kirchen in Quarantäne gesteckt: der Kirche zur heiligen Jungfrau Bolnicka und zum heiligen Nikola Bolnicki, medizinische Stationen in der Form von Kirchen. Daher ihr Name: heilige Jungfrau und heiliger Nikolaus zu den Leidenden. Als ich mir später die lebensnahen mittelalterlichen Gesichter auf den Grabfresken ansah, blickten sie mit einem Ausdruck zurück, den man nur als heilend beschreiben kann. Dutzende Geheimnisse bergende Kirchen tüpfelten die Gassen der Altstadt, versteckt in Gärten, verkleidet als kleine Häuser. Die Kirche der heiligen Jungfrau Peripleva, der »Glorreichen«, mit einem herrlichen Ausblick über den See ist die einzige immer in Funktion stehende der Diözese Ohrid seit tausend Jahren. Dort gab es Unterkünfte für jene, die »an Melancholie litten«.
Die Pest wurde als weibliche Panukla (griechisch für Seuche) anthropomorphisiert, sie klopfte mit todbringenden Fingerknöcheln an die Tür. Die Panukla hat das Haus von dem und dem betreten, sagten dann die Leute und erschauderten. Wenn es wirklich arg wurde und die Panukla nicht gehen wollte, veranstalteten die Bewohner der Altstadt eine Prozession hinunter zum See.
»Heiliger Klemens, unser Goldener«, wurde dann gefleht, »erlöse uns von der Panukla.«
Die Priester trugen große, langgriffige Ikonen von Kliment und Naum und der Jungfrau Maria, doppelgesichtig, sodass immer ein Heiliger der Pest zugewandt war. Die früheste Prozessionsikone, die in der Galerie der heiligen Jungfrau Peripleva überlebt hat, datiert aus dem Jahr 1045 und zeigt auf der einen Seite Basilius von Kappadokien mit asiatisch anmutenden Augen und auf der anderen den heiligen Nikolaus, Beschützer der Fischer; Letzteren hatten die Leute am See besonders nötig. Durch die Jahrhunderte nahmen auch die Muslime an diesen Prozessionen teil, denn die mittelalterlichen Mönche Kliment und Naum hatten weniger mit Monotheismus als mit talismanischem Schutz zu tun.
Leiden und Heilen war offensichtlich ein Motiv des Sees.
Die Besitzer der Villa Ohrid, wo ich eine Erdgeschoßwohnung mit Garten gemietet hatte, sahen vertraut aus; aber es wirkte ja alles hier vertraut. Nach einem kurzen Plaudern mit meinen Gastgebern stellte sich heraus, dass wir tatsächlich verwandt waren. So war die Stadt beschaffen.
Im Garten unter uns hackte ein Mann die Äste von einem Zwetschkenbaum mit einer Rachsucht, die an einem so friedlichen Abend fehl am Platz schien, bis beinahe nichts mehr da war als der Stamm, denn — so sagte der Mann — er habe einen Schatten geworfen.
Er hatte einen Schatten geworfen.
Die Töchter meiner Wirtsleute arbeiteten in Dubai, seufzte ihre Mutter. Die Jungen gehen halt überallhin, wo sie ein Visum ergattern, meinte sie, und wir anderen bleiben hier und vermieten unsere Häuser an Besucher. Tourismus ist die Haupteinnahmequelle geworden.
In den Vororten von Ohrid befanden sich einst einige der größten Industrieunternehmen Jugoslawiens — darunter die ikonischen Zastava-Autos —, und insgesamt beschäftigte die Fabrikarbeit Zehntausende. Das alles brach in den 1990ern zusammen, als die Zeit der dubiosen Privatisierung und der Mafia-Barone kam, verschlimmert durch Kriegsgewinnlertum für einige und Embargos für den Rest, während Jugoslawien in sich zusammenbrach. Die schon in den 1980ern begonnene Abwanderung verschärfte sich um die Jahrtausendwende, als der Kosovo-Konflikt über die Grenzen schwappte, und ist im letzten Jahrzehnt durch eine zynische, zersetzende Kultur extremer Parteipolitik beschleunigt worden. Ohrid hat in einer Generation fünfzig Prozent seiner Bevölkerung verloren. Einer meiner Cousins, ein Arzt, ist vor kurzem nach Deutschland gezogen, nachdem er seine Stelle am Krankenhaus verloren hatte, weil er nicht zu einem der obligatorischen Parteiaufmärsche erschienen war. Loyalität zur Partei ließ einen aufsteigen oder fallen.
Immer wieder hörte ich Leute sagen, es sei »schlimmer als unter Tito«. Der allgemeine Zustand der Moral und Kultur war durch Jahre von gnadenlosem Nepotismus, Kleptokratie und einer großsprecherischen ethno-nationalistischen Propaganda fadenscheinig geworden. Die abgetretene Regierung hatte das kleine Land in den Bankrott geführt. Anstatt die Wasserwerke in Ohrid zu sanieren, die dringend Investitionen benötigten, hatte sie vergoldete Statuen von Alexander dem Großen aufstellen lassen und das Zentrum von Skopje in ein weltweit verlachtes Monument des Gangsterbarocks verwandelt. Einige Einheimische schämten sich so sehr für das Geschehene, dass sie gar nicht mehr in die Hauptstadt fuhren.
Das Restaurant Gladiator in meiner Straße, oberhalb des antiken Theaters, hatte eben für die Saison geöffnet. Wenn die Nacht hereinbrach, kamen die Leute mit ihren Hunden und die betrunkenen Philosophen, und nachdem die Hunde auf die riesigen Steinstufen gepinkelt hatten, saßen die Männer unter den blütentropfenden Linden und den noch grünen Feigenbäumen und machten Bierflaschen auf.
Ich bestellte Imam bayıldı und einen Mazedonischen Salat, obwohl ich in der Gefühlsaufwallung, hier zu sein, kaum schlucken konnte. Der Kellner sah mein Notizbuch und fragte, ob ich Schriftstellerin sei.
»Es ist ungewöhnlich, heutzutage Schriftsteller anzutreffen«, meinte er ernsthaft. Er sah aus wie ungefähr zwanzig. »Bedauerlicherweise lesen die jungen Leute in diesem Land nicht.«
Er schrieb Gedichte, und wir waren uns einig, jemand, der mit Literatur lebe, sei gut dran (obwohl das offenkundig nicht stimmte). Ich war der einzige Gast, abgesehen von einem holländischen Trio. Irgendetwas war da mit den Holländern, en masse kamen sie an den See, Jahr für Jahr. Es stellte sich heraus, dass sie durch einen kultigen holländischen Roman hierher gezogen wurden, der in den 1930ern in Ohrid spielte: »Die Hochzeit der sieben Zigeuner« von A. den Doolaard, einem Schriftsteller und Journalisten, der sich in Mazedonien verliebt und lange Zeit hier verbracht hatte.
»Ich hoffe, Sie finden Inspiration in unserer Stadt«, sagte der Kellner mit einem üblicherweise für Amtspersonen und ältere Leute vorbehaltenen Respekt. Und ich fühlte mich plötzlich stark gealtert an meinem Tisch mit den weißen Servietten, mit meinem Glas mazedonischem Roten und meinen Erinnerungen wie eine Zeitreisende. Als ich das Etikett auf der Weinflasche betrachtete, sah ich, dass er »Sehnsucht nach dem Süden« hieß, nach dem Gedicht. Ein stiller Willkommensgruß.
Ohrid ließ einen das Gewicht der Welt spüren, selbst an einem friedlichen Abend wie diesem, wo nur die Zikaden schrillten und alte Frauen in Pantoffeln herumschlurften. Unter mir lag die Erinnerung daran, dass hier bloß zweitausend Jahre zuvor Gladiatoren gekämpft hatten. Das Amphitheater war von Philipp II. für Theateraufführungen der Makedonier erbaut, dann von den Römern in eine Gladiatorenarena umgewandelt worden und war nun Aufführungsort für sommerliche Konzerte. Man hatte es erst vor ein paar Jahrzehnten entdeckt. Als Kind war ich gern auf dem teilweise freigelegten Hügel herumgeklettert, die Häuser auf der Anhöhe mussten erst noch abgerissen werden.
Aber was für ein kultivierter Ort, wo Kellner Literatur lieben, Taxifahrer sich Frieden wünschen und Weine nach Gedichten benannt sind! Die Stille war vollkommen, als hätte der See nicht nur Lärm absorbiert, sondern die Zeit selbst. Es war wie die Stille eines tiefen Waldes, von etwas vom Menschen Unberührtem — ein sonderbarer Eindruck angesichts dessen, dass hier seit achttausend Jahren Menschen lebten. Die ältesten bekannten Siedler an den Ufern des Sees waren Angehörige zweier Stämme: der Dassareten und der illyrischen Encheler. Im frühen Altertum hatte es fünf Städte am See gegeben, und von denen hat nur eine bis heute überdauert, wenn auch unter späteren Schichten verborgen: Lychnidos. Eine Inschrift auf einer Steintafel aus dem dritten vorchristlichen Jahrhundert — LYCHNEIDION HE POLIS — erinnert an sie, auf Griechisch »Stadt des Lichts«, und sie war einflussreich genug, um ihre eigene Polis zu bilden.
Der Schöpfungsmythos hallt wider von einer Symbolträchtigkeit, die nicht verschwunden ist. Der Phönizier Kadmos, König von Theben und Bruder der entführten Europa, gründete Lychnidos, nachdem er aus Theben und vor dem dortigen Unglück ins Land der Illyrer und Makedonier geflohen war. Hier erbaute er eine Stadt, die blühte und gedieh, obwohl es seit dem sechsten Jahrhundert immer wieder Unterbrechungen gab — lange Seuchen wie die Pest zur Zeit Justinians, die die Hälfte der Bevölkerung des Römischen Reiches dahinraffte; Einfälle der Goten, Hunnen, Awaren und Slawen, die blieben und die Stadt in Oh-rid umbenannten, »auf dem Hügel«, und heftige Erdbeben, verursacht durch dieselben Bruchlinien im nahegelegenen Kosel, die in den Wochen nach meinem Eintreffen Tausende Erderschütterungen verursachen sollten.
Doch das Unglück verfolgte Kadmos und seine samothrakische Frau Harmonia. Sie verloren alle ihre Kinder und Enkelkinder, und allmählich wuchsen ihnen Schuppen, und sie wurden von den Göttern in Schlangen verwandelt, um leichter ihrem irdischen Leid zu entkommen. Zufällig sind die beiden Seen voller Wasserschlangen, die ich schaudernd oft in den Untiefen in sich windenden Knoten sah.
Die weißen Häuser und fleischfarbenen mittelalterlichen Kirchen ergossen sich die steilen Gassen entlang hinunter zum See, Tausende Fenster glitzerten im Sonnenuntergang. Es war etwas Archetypisches an der hügeligen alten Stadt am See, etwas, das man schon hundert Mal zuvor gesehen hatte, dennoch war es unwiederholbar Ohrid. Was ich zu suchen gekommen war, war ebenso einfach wie flüchtig — eine Kontinuität des Seins mittels einer Kontinuität des Ortes. Meine Großmutter hatte jede einzelne Gasse gekannt, jede versteckte Kapelle. Einiges von dieser Intimität wollte ich neu entfachen.
Deswegen fühlte sich an diesem ersten Abend alles zu üppig, voller versteckter Bedeutungen an, um es mit dem Verstand aufzunehmen. Die Dunkelheit brach herein. Der See war hart geworden wie Obsidian und wirkte wie die Oberfläche einer riesigen Katakombe. Ganz und gar nicht wie der blaue See von der 3-D-Karte, der mir in der Wohnung meiner Großmutter zugezwinkert hatte. Ganz und gar nicht einladend. Einen Moment lang fühlte ich mich abgeschreckt vom enormen Ausmaß der Reise, die vor mir lag.
Direkt gegenüber am Wasser blinkten die Lichter von Bergdörfern. Ein gigantisches neonerleuchtetes Kreuz stand so weit oben in den Anhöhen, dass es wie eine Erscheinung in der Dunkelheit schwebte. Kleinere erleuchtete Kreuze saßen auf den alten Kirchen in der Stadt. Diese Fluoreszenz war neu, eine territoriale Antwort auf den Bau neuer Moscheen in der Gegend. Praktisch gesehen war das nicht sehr sinnvoll, denn weder Christentum noch Islam waren hier im Aufstieg, aber Kulturkriege und Geldwäsche sehr wohl, nahm ich an. Hier wie überall auf dem Balkan und in der ganzen Welt waren die neue Kirche und die neue Moschee Teil des frisch entfachten Ethno-Nationalismus, dieses flotten Produzenten neuer Ruinen, neuer mittelalterlicher Könige, neuer Altertümer und neuen jahrhundertealten Hasses.
Vom Kirschbaum in meinem Garten aus konnte ich den Anlegesteg und die erleuchtete Strandpromenade sehen. Sie sahen klein aus, in meiner Kindheit aber waren sie majestätisch gewesen. Am Pier beherrschte ein hoher totemischer Pfahl mit einer übergroßen mazedonischen Fahne mit der aufgehenden Sonne, Gelb auf Rot, den Hafen. Die sechzehn Strahlen der Sonne, welche die abtrünnige Republik ursprünglich gewählt hatte, waren auf acht reduziert worden, allerdings zu spät. In ihrer kurzen Lebenszeit als Nationalflagge seit 1995 hatte der Sonnenaufgang einen Streit mit Griechenland provoziert. Flaggenmaste wie dieser waren von der abtretenden nationalistischen Regierung in jeder Stadt (außer solchen mit albanischer Mehrheit) aufgestellt worden. Wie die Neonkreuze war die Flagge eine territoriale Markierung in einem kleinen, verwundbaren Land, dessen Identität noch ein Work in Progress war — sofern es die Nachbarn betraf. Aber die Nachbarn hatten erhebliche blinde Flecke.
Die Bulgaren erkannten Mazedonisch immer noch nicht als von der eigenen unterschiedene Sprache an, Nationalisten nannten sie nach wie vor herablassend einen westbulgarischen Dialekt. Das Standard-Mazedonisch wurde tatsächlich erst 1945 formalisiert, und in gewisser Weise beginnt die offizielle mazedonische Literatur ab diesem Zeitpunkt, was sie zur jüngsten europäischen Literatur macht, obwohl natürlich Autoren seit Generationen in diversen regionalen Dialekten geschrieben haben. Wie auch immer, es ist jetzt eine Literatur- und auch eine Nationalsprache. Die bulgarische Leugnung verdankt sich einem historischen Trauma, das mit wiederholten Operationen ohne Anästhesie an Grenzen (und an der Bevölkerung) zu tun hat, und dieser Widerhall erinnert an den Phantomschmerz an einem amputierten Glied. Obwohl auf der Landkarte der Körper für immer verändert ist, bleibt eine Empfindung. Zugleich war Bulgarien das erste Land, das die unabhängige Republik anerkannte, damals, als Jugoslawien auseinanderbrach und kleinere Nationalstaaten gebar, an die sich die Welt erst gewöhnen musste.
Im Gegensatz dazu erhoben die Griechen Einwand gegen die schiere Existenz des Landes unter seinem derzeitigen Namen. So manifestierte sich der Ärger um die Flagge am stärksten im sogenannten Namensstreit, den Griechenland mit der kleinen Republik ausfocht. Nach der Ansicht des modernen griechischen Nationalismus gehört der heraldische Sonnenaufgang des Hauses der Makedonier ausschließlich Griechenland, denn das königliche Siegel Philipps von Makedonien befand sich im Dorf Vergina in Griechenland, und das »originale« Makedonien war für immer und ausschließlich hellenisch. Heißt griechisch.
In diesem wie in vielen penibel konstruierten nationalen Narrativen hat man tief gegraben, um den kostbaren Beweis einer historischen Vorläuferschaft zu finden, musste aber vorsorglich innehalten, bevor noch tiefere Schichten die Sache komplizierter machten. Nicht lange vor Philipp und Alexander und ihrem Imperialismus betrachteten die eigentlichen Griechen ihre Nachbarn im Norden, die Makednoi, verächtlich als betrunkene Barbaren. Anfang des fünften vorchristlichen Jahrhunderts wurde das makedonische Königshaus bei den Olympischen Spielen als griechisch anerkannt, aber es blieb am entfernten nördlichen Rand. Die Makedonier sprachen eine nicht mehr existierende Sprache, welche die Griechen nicht verstanden, und ihr politisches System glich mehr dem ihrer unmittelbaren Nachbarn, der Illyrer im Westen und der Thraker im Osten, denn jenem der griechischen Stadtstaaten im Süden.
Während ich das gigantische Sonnenrad betrachtete, das friedlich im Wind flatterte, fragte ich mich: Was ist Mazedonien? Eine Frage, die eigentlich so lautet: Was ist Nation, was ist Geographie? Bedeutet: Was ist Geschichte? Herodot verbrachte sein Leben damit, das zu beantworten, aber seine langfristige Herangehensweise ließ erkennen, dass er ein tiefes Verständnis dafür hatte, warum »der Mensch ganz und gar ein Geschöpf des Zufalls ist«. Er gelobte, »gleichermaßen kleine und große Städte der Menschen zu behandeln«. »Denn Städte, die früher groß waren, sind zum größten Teil klein geworden. Städte aber, die zu meiner Zeit groß waren, waren zuvor klein. In dem Wissen also, dass das menschliche Glück keinesfalls stabil im selben Zustand verharrt, werde ich beide gleichermaßen erwähnen.«