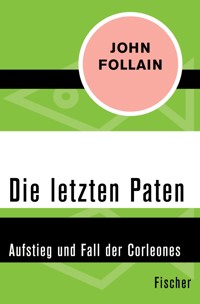
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
John Follain erzählt die wahre, blutige Geschichte des legendären und berüchtigtsten aller Mafia-Clans, der mächtigsten und reichsten Familie der sizilianischen Mafia, die Mario Puzos Roman ›Der Pate‹ inspirierte. Basierend auf Tausenden von Seiten von Gerichtsunterlagen, auf Zeugenaussagen, Tonbandmitschnitten und Interviews ist dies die definitive Darstellung der drei mächtigsten Paten des Corleone-Clans: Luciano »der Professor« Leggio, Salvatore »die Bestie« Riina und Bernardo »der Traktor« Provenzano. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
John Follain
Die letzten Paten
Aufstieg und Fall der Corleones
Über dieses Buch
John Follain erzählt die wahre, blutige Geschichte des legendären und berüchtigtsten aller Mafia-Clans, der mächtigsten und reichsten Familie der sizilianischen Mafia, die Mario Puzos Roman ›Der Pate‹ inspirierte.
Basierend auf Tausenden von Seiten von Gerichtsunterlagen, auf Zeugenaussagen, Tonbandmitschnitten und Interviews ist dies die definitive Darstellung der drei mächtigsten Paten des Corleone-Clans: Luciano »der Professor« Leggio, Salvatore »die Bestie« Riina und Bernardo »der Traktor« Provenzano.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
John Follain ist seit zehn Jahren Italienkorrespondent für die Sunday Times und das Sunday Times Magazine. Er ist Autor mehrerer Bücher, u.a. des Bestsellers ›Zoya. Mein Schicksal heißt Afghanistan‹.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Für Sébastien
Prolog 23. Mai 1992
1 Corleone 1905–1963
Dr. Michele Navarra, »Unser Vater«
Luciano Leggio
Placido Rizzotto, »der Nordwind«
»Unser Vater« tritt ab
Leggio, Salvatore Riina und Bernardo Provenzano – »die Heilige Dreifaltigkeit«
Gewehrkugeln und das Gesetz des Schweigens
2 Der Aufstieg der »Bauern« 1963–1974
Palermo: die etablierte Macht herausfordern
»Seid schlau« – Justiz nach Mafia-Art
Tod der »Kobra«
Über das Triumvirat
»Ich liebe Riina« – Ninetta geht vor Gericht
3 Aufbau einer Diktatur 1974–1983
Freunde und Feinde
Der letzte Schachzug des »Tigers«
Tommaso Buscetta, der »Boss zweier Welten«
Säuberungsaktionen und Bankette
General Dalla Chiesa
Buscetta setzt auf Zeit
Corleone Inc.
4 Die »Diener« des Staates schlagen zurück 1983–1992
Richter Falcone auf »feindlichem Terrain«
Der Mammutprozess
»Eine Frage der Höflichkeit« – Riina hat Mühe, Wort zu halten
5 Mafia-Terror 1992–1996
Giovanni Brusca ist »einsatzbereit«
»Im Wettlauf mit der Zeit« – Richter Borsellino
Die ersten Verräter des Clans
»Wer war der Judas?« – Riinas Ende
Gebete, Politik und der Kampf um Riinas Nachfolge
Die Entführung des zwölfjährigen Giuseppe Di Matteo
6 Die Mafia wird »leise« 1995–2002
»Schluss mit den Massakern; Schluss mit den Morden« – Provenzanos Herrschaft
Brusca gesteht
Jagd nach einem Gespenst
7 Das Ende der Corleoneser 2002–2008
Provenzano und sein Schutzpatron
Team Cathedral und das Rätsel um die Wäsche
Auf dem Monte de’ Cavalli
[Bildteil]
Danksagung
Bildnachweise
Quellenangaben
Prolog: 23. Mai 1992
1 Corleone 1905–1963
Dr. Michele Navarra, »Unser Vater«
Luciano Leggio
Placido Rizzotto, »der Nordwind«
Leggio, Salvatore Riina and Bernardo Provenzano – »Die Heilige Dreifaltigkeit«
Gewehrkugeln und das Gesetz des Schweigens
2 Der Aufstieg der »Bauern« 1963–1974
Palermo: Die etablierte Macht herausfordern
»Seid schlau« – Justiz nach Mafia-Art
Tod der »Kobra«
Über das Triumvirat
»Ich liebe Riina« – Ninetta geht vor Gericht
3 Aufbau einer Diktatur 1974–1983
Freunde und Feinde
Der letzte Schachzug des »Tigers«
Tommaso Buscetta, der »Boss zweier Welten«
Säuberungsaktionen und Bankette
General Dalla Chiesa
Buscetta setzt auf Zeit
Corleone Inc.
4 Die »Diener« des Staates schlagen zurück 1983–1992
Richter Falcone auf »feindlichem Terrain«
Der Mammutprozess
»Eine Frage der Höflichkeit« – Riina hat Mühe, Wort zu halten
5 Mafia-Terror 1992–1996
Giovanni Brusca ist »einsatzbereit«
»Im Wettlauf mit der Zeit« – Richter Borsellino
Die ersten Verräter des Clans
»Wer war der Judas?« – Riinas Ende
Gebete, Politik und der Kampf um Riinas Nachfolge
Die Entführung des 12-jährigen Giuseppe Di Matteo
6 Die Mafia wird »leise« 1995–2002
»Schluss mit den Massakern; Schluss mit den Morden« – Provenzanos Herrschaft
Brusca gesteht
Jagd nach einem Gespenst
7 Das Ende der Corleoneser 2002–2008
Provenzano und sein Schutzpatron
Team Cathedral und das Rätsel um die Wäsche
Auf dem Monte de’ Cavalli
Bibliographie
Archivmaterial
Allgemein
Bruno Contrada
Rosario Spatola, Drogenhandel
Die Ermordung Rocco Chinnicis
Giulio Andreotti
Der Mordfall Carlo Alberto Dalla Chiesa
Mammutprozess
Marcello Dell’Utri
Mordfall Salvo Lima
Mordfall Giovanni Falcone
Mordfall Paolo Borsellino
Mordfall Ignazio Salvo
Baldassare Di Maggio
Festnahme der Familie Salvatore Riinas
Bombenanschläge in Florenz, Mailand und Rom
Mord an Pfarrer Giuseppe Puglisi
Entführungsfall Giuseppe di Matteo
Bernardo Provenzano
Zeugenaussagen durch Informanten
Zeitungen
Interviews
Bücher
Personenregister
Für Sébastien
Prolog
23. Mai 1992
Samstag, 23. Mai 1992, kurz nach vier Uhr nachmittags: Richter Giovanni Falcone, Italiens bekanntester Mafiajäger, und seine Frau Francesca bahnen sich einen Weg durch das römische Verkehrschaos, eskortiert von ihren Bodyguards. Unter Blaulicht und Sirenengeheul umrundet der Konvoi das Kolosseum, jenes baufällige Denkmal menschlicher Grausamkeit, ehe er gen Süden abschwenkt, in Richtung Flughafen und der Geburtsstadt Falcones – der sizilianischen Hauptstadt Palermo.
Nachdem er als Staatsanwalt in Palermo zahllose Siege errungen hatte – sein größter Triumph ein Prozess, der nicht weniger als 338 Mafiosi für insgesamt 2665 Jahre hinter Gitter brachte –, war der stämmige, schnurrbärtige Falcone ein Jahr zuvor nach Rom gezogen, wo er im Justizministerium für die Strafgerichtsbarkeit zuständig war. Mit typischer Entschlossenheit richtete der 53-Jährige, ein Arbeitssüchtiger, zwei neue Gremien ein, die die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen in ganz Italien aufeinander abstimmten. Damit erhielt der Staat endlich das notwendige Instrumentarium, um der Verbreitung des organisierten Verbrechens entgegenzuwirken – sofern dies in seiner Absicht lag.
Doch es gibt etwas, das Falcone den jüngsten Erfolg vergällt. Wie schon oft in seiner Karriere macht ihm wieder einmal der Neid seiner Kollegen und die Feindseligkeit derer zu schaffen, die die Mafia am liebsten stillschweigend ignorieren würden. Er ist gereizt. In einer bösartigen Hetzkampagne hat man ihm vorgeworfen, er habe das neue Amt des überregional tätigen Antimafia-Staatsanwalts – in der Presse ist von »Super-Staatsanwalt« die Rede – nur deshalb ins Leben gerufen, um es selbst bekleiden zu können. Der Richter hatte die Beschimpfungen einem Kollegen gegenüber mit den sarkastischen Worten kommentiert: »Was glauben die denn? Ich weiß doch, dass sie mich irgendwann ermorden, was kümmert mich da, ob ich Super-Staatsanwalt bin!«
Diese lakonische Haltung im Hinblick auf den eigenen Tod war typisch für Falcone, dem als Sizilianer der Fatalismus in die Wiege gelegt war. Der Mafiajäger stand rund um die Uhr unter massivem Polizeischutz – oft begleitete der Schatten eines Helikopters seinen Konvoi – und war dennoch schon zweimal nur knapp einem Mordanschlag entgangen. Die Mafia hatte ihm zunächst einen Killer ins Justizgebäude geschickt, um ihn dort zu erschießen, und nachdem dieses Attentat fehlgeschlagen war, legte man in unmittelbarer Nähe seiner Villa am Meer eine Tasche mit einer Bombe ab; doch auch dieser Versuch konnte im letzten Moment verhindert werden. Als der Autor den Richter vor sieben Jahren in seinem bunkerähnlichen Büro in Rom aufgesucht und zu den Risiken befragt hatte, denen er ständig ausgesetzt war, hatte Falcone nüchtern erwidert: »Menschen, die sich für die Gesellschaft starkmachen, leben nun einmal gefährlich, das liegt an der Trägheit, Feigheit und Ignoranz der anderen. Und am Ende werden sie ermordet – unerbittlich. So ist das eben.«
Während Falcones Konvoi an den alten Mauern der Ewigen Stadt entlangfährt, haben seine Frau und er allen Grund, sich zu freuen; Francesca, deren Arbeit als Richterin sie davon abgehalten hatte, zu ihrem Mann nach Rom zu ziehen, hat vor kurzem ihre Versetzung in die italienische Hauptstadt erhalten. Das Paar wird wieder zusammenleben, dann werden Falcones Wochenendtrips nach Sizilien nicht mehr nötig sein.
Um 16.30 Uhr telefoniert Falcone mit Giuseppe Costanza, seinem Fahrer in Palermo, um ihm seine Ankunft mitzuteilen. Costanza fährt zu Falcones Wohnung, um den gepanzerten Wagen des Richters zu holen. Eine halbe Stunde später startet auf dem römischen Flughafen Ciampino heimlich und außerplanmäßig ein Jet des italienischen Sicherheitsdienstes SISDE und bringt Falcone und Francesca nach Palermo.
Gut 480 Kilometer weiter südlich, an einer breiten, belebten Straße in Palermo, sitzt ein Mafiaboss und wohlhabender Geschäftsmann – er betreibt eine Schlachterei, eine Restaurantkette und eine Metzgerei – gegenüber von Falcones Häuserblock in Giros Bar und genehmigt sich ein Gläschen. Gegen 16.45 Uhr bemerkt der Boss ein weißes Auto, das er sofort wiedererkennt: Es ist Falcones gepanzerter Fiat Croma, der gerade die Garage gegenüber verlässt.
Da der Boss annimmt, dass der Wagen zum Flughafen von Palermo unterwegs ist, um Falcone abzuholen, eilt er in seine Metzgerei, gleich um die Ecke. Sein Sohn bedient gerade Kunden, und der Boss raunt ihm eindringlich zu: »Mach schnell, das Auto ist eben losgefahren, ihm nach!« Der Sohn springt auf seine Vespa, holt Falcones Wagen ein und folgt ihm bis zur Zufahrt auf die Schnellstraße, die zum Flughafen führt.
Von diesem Augenblick an läuft alles genau nach dem Plan, den der Pate Salvatore Riina, Oberhaupt der Corleoneser, ausgeklügelt hat.
Der Jet mit Falcone an Bord landet um 17.43 Uhr auf dem Flughafen Punta Raisi in Palermo, nur wenige Meter von der Mittelmeerküste entfernt. Drei gepanzerte Wagen erwarten ihn und seine Frau auf der Runway. Die Motoren laufen, und sechs Bodyguards halten ihre Waffen schussbereit unter den Jacken. Falcone bittet Costanza, ihn fahren zu lassen, und Costanza überlässt ihm die Schlüssel. Falcone fährt gern selbst, wenn Francesca bei ihm ist – um möglichst viel normales Leben zu erhaschen. Francesca nimmt auf dem Beifahrersitz Platz, Costanza setzt sich nach hinten. Die Wagen fahren im Konvoi los, nehmen Falcone in die Mitte.
An dem für Polizei und Justiz reservierten Gate wurde ein Beobachtungsposten platziert. Er hat von Giovanni Brusca, dem dicklichen Boss mit dem gutmütigen Gesicht, der ein Experte darin ist, Mordopfer in Schwefelsäure aufzulösen, strikte Anweisungen erhalten: »Schau in Falcones Wagen. Wir müssen sicher sein, dass auch wirklich er drin sitzt. Wir dürfen die Sache auf keinen Fall vermasseln, also schau genau hin«, hat Brusca zu ihm gesagt. Der Späher konzentriert sich so stark auf diese Anweisungen, dass er, als das Auto vorbeifährt, zwar Falcone am Steuer erkennt, aber weder Francesca neben ihm noch den Fahrer auf dem Rücksitz – was aber im Endeffekt auch nichts mehr geändert hätte. Um 17.48 Uhr ruft er einen Komplizen an, Gioacchino La Barbera, um ihm mit einem kurzen Signal, das sie zuvor arrangiert haben, grünes Licht zu geben: »Alles klar.«
Eine Minute später ruft La Barbera einen weiteren Boss an, Antonino Gioè, der von einem Hügel aus, etwa fünf Kilometer vom Flughafen entfernt, einen Streifen Autobahn beobachtet und dabei nervös eine nach der anderen raucht. Neben Gioè steht Brusca persönlich, der für den Mordplan verantwortlich ist. Er hat eine Fernsteuerung in den Händen, wie Kinder sie benutzen, um Modellflugzeuge fliegen zu lassen. Das simple Gerät zündet eine Bombe, die in einem schmalen Abflussrohr unter der Autobahn versteckt ist – etwa 770 Pfund Sprengstoff, verteilt auf 13 Metallzylinder. Die beiden Mafiosi stehen neben einem blühenden Mandelbaum. Von einem zweiten haben sie einen Zweig abgerissen, um freie Sicht auf die Autobahn zu haben. Sie setzen sich abwechselnd auf einen Hocker und spähen durch ein Fernglas.
Gioè unterhält sich per Mobiltelefon mit La Barbera. Während sie reden, fährt La Barbera eine Straße lang, die parallel zur Autobahn verläuft, und beschattet Falcones Konvoi. Aus Sorge, der Anruf könnte abgehört werden, plaudert er über dies und das und springt von einem Thema zum anderen.
Er hat den Konvoi so deutlich vor Augen, dass er die Maschinengewehre der Bodyguards ausmachen kann.
Vom Rücksitz aus fragt Falcones Fahrer Costanza den Richter, wann der ihn wieder brauche.
»Montagmorgen«, entgegnet Falcone.
»Würden Sie mir dann bitte die Autoschlüssel geben, wenn wir angekommen sind, damit ich am Montagmorgen den Wagen holen kann?«, fragt Costanza.
Zu seiner Verwunderung zieht Falcone abrupt die Schlüssel aus dem Zündschloss und reicht sie ihm. »Was tun Sie denn da? Sie bringen uns noch um!«, schimpft Costanza, der spürt, wie der Wagen, noch immer im vierten Gang, auf einmal langsamer wird.
Falcone hatte offenbar seinen Schlüsselbund, an dem auch die Wohnungsschlüssel hängen, auf der Stelle mit Costanzas Bund tauschen wollen. Falcone wendet sich Costanza zu, wobei er Francescas Blick begegnet. »Tut mir leid«, sagt er. »Tut mir leid.«
La Barbera, der den Konvoi noch immer beschattet, fällt auf, dass der nur noch 80 km/h fährt – halb so schnell, wie das Todeskommando angenommen hat –, und führt sein Telefongespräch weiter. Er hofft, die zwei Männer auf dem Hügel werden an der Länge des Telefonats erkennen, dass die Kolonne nicht so schnell heranfährt wie erwartet.
»Was hast du heute Abend vor?«, fragt La Barbera.
»Nichts. Wenn du Zeit hast, gehen wir ’ne Pizza essen«, erwidert Gioè, während er durch sein Fernglas starrt.
»Geht klar«, sagt La Barbera.
Kurz darauf meint La Barbera plötzlich: »Wir reden später weiter, ciao.« Das fünfminütige Telefonat bricht um 17.54 Uhr abrupt ab.
Gioè hat begriffen. Er sieht, wie der Konvoi sich der Bombe nähert. Brusca hat die Absicht, den Schalter auf der Fernsteuerung umzulegen, sobald Falcones Wagen einen Kühlschrank passiert, den jemand am Straßenrand entsorgt hat und der ihm nun als Markierung dient. Brusca hat den Wagen noch nicht gesehen, als Gioè ihn drängt: »Vai! (Na los!)«
Brusca regt sich nicht.
»Vai!«, sagt Gioè noch einmal.
Brusca regt sich noch immer nicht. Er fühlt sich wie zur Salzsäule erstarrt. Kurz darauf entdeckt Brusca endlich Falcones weißen Croma und stellt überrascht fest, wie langsam der Wagen fährt, als er den Kühlschrank passiert. Wieder zögert Brusca.
»Vai!«, drängt ihn Gioè ein drittes und letztes Mal.
Da betätigt Brusca den Schalter.
1 Corleone 1905–1963
Dr. Michele Navarra, »Unser Vater«
Zwischen Hügeln und karstigen Hochebenen südlich von Palermo duckt sich das Städtchen Corleone mit seinen grauen Dächern, als habe es Angst, von der gewaltigen schwarzen Felsklippe zermalmt zu werden, die steil zu den schmutzigen Steinbauten unter ihr abfällt. Ein verlassenes Gefängnis, ursprünglich als Festung erbaut, und ein paar verstreute Krähen kauern auf der Klippe. Auf einem zweiten Felsen erhebt sich ein sarazenischer Aussichtsturm, Relikt einer Zeit, als der Ort Corleone, an der Straße gelegen, die von der sizilianischen Hauptstadt Palermo zur Südküste der Insel führte, von strategischer Bedeutung war. Seine steilen Gassen, in den Berghang geschlagen, sind so schmal und verschlungen wie Gedärm, und wenn von der Sahara her der feuchtheiße Schirokko weht, herrscht darin eine Gluthitze wie in einem Backofen.
In seinem Klassiker Der Leopard beschrieb Giuseppe Tomasi di Lampedusa die raue Umgebung, in der Bauern wie die aus Corleone ihr Leben bestreiten mussten: »Diese Landschaft, die keine Mitte kennt zwischen üppiger Weiche und vermaledeiter Wüste; die niemals eng ist, nie nur bescheidene Erde, ohne Spannung, wie ein Land sein müßte, das vernünftigen Wesen zum Aufenthalt dienen soll; … dieses Klima, das uns sechs Fiebermonate von vierzig Grad auferlegt.«
Noch einen Nachteil weist die Landschaft um Corleone auf: Sie hat Kriminellen einiges zu bieten: Der dichte Wald von Ficuzza, wo früher einmal die Bourbonen-Könige zu jagen pflegten, eignet sich in geradezu idealer Weise als Versteck für Viehdiebe und ist seit langem bei all jenen beliebt, die einen entlegenen Fleck brauchen, um die Leichen ihrer Opfer zu verscharren. Die Rocca Busambra, ein 1700 Meter hoher Berg, von Kalksteinhöhlen und schmalen Schluchten durchzogen, bietet Flüchtigen viele Möglichkeiten, unterzutauchen.
Die Ortschaft Corleone verdankt ihren Namen angeblich dem arabischen Krieger Kurliyun (Löwenherz), der die Insel 840 nach Christus erobert hat, und blickt auf die stolze Tradition zurück, für ihr Recht einzustehen, nötigenfalls auch mit Gewalt; im Zuge der Sizilianischen Vesper im Jahre 1282, als die Insel sich gegen die französischen Belagerer auflehnte, kamen in Corleone mehr Invasoren zu Tode als in jeder anderen Stadt der Gegend; seitdem trug sie den Beinamen »die Feurige«. Hoch verehrt von den 14000 Einwohnern der Stadt wird der heilige Bernhard von Corleone, der nicht nur sanftmütig war, sondern auch Kampfgeist besaß. Vom Flickschuster brachte er es im 17. Jahrhundert zum berüchtigten Raufbold, der reiche Aristokraten zum Duell forderte, um arme Leute und schwache Frauen zu verteidigen; später trat er dann in den Kapuzinerorden ein und tat Buße für das viele Blut, das seinetwegen geflossen war.
Der katholische Glaube spielt von jeher eine bedeutende Rolle im Leben der Stadt, in der es einmal an die sechzig Kirchen und ein gutes Dutzend Klöster gab; zu Fronleichnam zogen sage und schreibe 74 Prozessionen durch Corleones Gassen. Die Schar der Gläubigen hinter jedem Heiligen, der in Schulterhöhe durch den Ort getragen wurde, war so groß, dass der Dekan und der Bürgermeister im Voraus die Ordnung festlegten, in der man durch die Straßen schritt, und einen Priester bestimmten, der den heiligen Verkehr zu regeln hatte.
Es ist kein Zufall, dass die Stadtbewohner Don Michele Navarra, den Begründer der Corleoneser-Sippe, die über die Mafia wie keine zweite in der Geschichte herrschen sollte, wie ihren Herrgott »U Patri Nostru« (Unser Vater) nannten. Wie Gott besaß auch der Doktor, ein untersetzter, beleibter Mensch mit einem Stiernacken und einem breiten, scheinbar freundlichen Gesicht, die Macht über Leben und Tod eines jeden seiner Anhänger.
Als Navarra 1905 auf die Welt kam, eines von acht Kindern eines Vermessungsingenieurs, war das Leben in Corleone seit Jahrzehnten, in einigen Aspekten gar seit Jahrhunderten unverändert geblieben. Seine Familie genoss ein hohes Ansehen in diesem Ort, der hauptsächlich aus Bauern, Hirten und Tagelöhnern bestand. So bitter war hier die Armut, dass Landarbeiter, die anstatt des einen zwei Maulesel besaßen, schon als »borghesi«, als Bürger, galten. Die meisten Bauern lebten zu ebener Erde im selben Raum mit ihren Tieren, auch dem einen oder anderen Schwein oder Huhn. Oft trennte sie nur ein Vorhang vom Vieh, so dass sich der Geruch von menschlichem Schweiß ohne weiteres mit dem Gestank der Tiere vermischte. Die Familien kochten ihre Nudeln und die Suppe aus wilden Kräutern im Wasserzuber, in dem sie sich auch die Füße wuschen. Eine Ziege durfte ungehindert durchs Haus spazieren, als wäre sie ein heiliges Tier, weil ihre Milch die Kinder davor bewahrte, an der Schwindsucht zu sterben.
Bei Sonnenaufgang konnte man die Männer in langer Reihe auf den Straßen aus lehmiger, hellbrauner Erde aus der Stadt pilgern sehen. Die einen gingen zu Fuß, die anderen ritten auf Mauleseln. Oft trotteten sie zwei oder drei Stunden durch die zerklüftete Landschaft, bis sie ihre gepachteten steinigen Äcker erreichten, die sie mit Weizen, Weinreben oder Olivenbäumen bepflanzten. Die Felder waren höchstens vier oder fünf Hektar groß und über die gelben Hügel verstreut, die dunkelbraun wurden, wenn die Bauern das gemeine Rispengras in Brand setzten. Abends pflegten die Männer mit ihren Mauleseln rechtzeitig zum Ave-Maria heimzukehren, hielten davor an den Tränken am Ortsrand inne, wo sie den Tieren den Schmutz von Beinen und Hufen wuschen.
Navarra galt von Geburt an als privilegiert, nicht nur wegen der Stellung seines Vaters, sondern auch wegen der Verbindungen seiner Familie zu einer geheimen kriminellen Vereinigung in Corleone. Sein Onkel nämlich war ein Mitglied der Fratuzzi, der »Brüder«, eine irreführend freundliche Bezeichnung für die ersten Mafiosi der Stadt. Seit diese Bruderschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Erscheinung getreten war, zählten zu ihren Mitgliedern herrische Aufseher, die während der Abwesenheit der Großgrundbesitzer, die lieber im weiter nördlich gelegenen Palermo lebten, deren Ländereien verwalteten. Auch bewaffnete Wächter, die auf den Gütern für Ordnung sorgten und dabei selbst vor Gewalt nicht zurückschreckten, gehörten der Bruderschaft an.
Navarras Onkel nahm an dem Aufnahmeritual der Fratuzzi teil, das in Gegenwart der Bosse der Bruderschaft durchgeführt wurde. Mit einem Dolch wurde dem neuen Rekruten eine Kerbe in den Unterarm geritzt, bis sein Blut auf ein Blatt Papier tropfte, auf das ein Totenkopf aufgemalt war. Nun hatte der Neue den Fratuzzi den Treueeid zu leisten. Mitglieder gaben sich einander entweder mittels eines Passworts zu erkennen oder indem sie die oberen Schneidezähne berührten, als hätten sie Zahnschmerzen. Dergleichen Rituale könnten komisch anmuten, hätten die Fratuzzi nicht so viel Leid über die Stadt gebracht. Sie stahlen das Vieh, kontrollierten das Einstellen von Landarbeitern und erpressten von Grundbesitzern und Ladeninhabern sogenannte Schutzgelder. Entführung und Brandstiftung waren die üblichen Strafen für jeden, der es wagte, sich gegen sie aufzulehnen.
Wann und ob die Fratuzzi mit der sizilianischen Mafia verschmolzen, die selbst um 1860 entstanden war, bleibt ein Geheimnis. Sogar der Ursprung des Wortes »Mafia« ist ungewiss. Manche glauben, seine Wurzeln reichten bis zur Invasion der Araber zurück, die Sizilien von 827 bis 1061 beherrschten, und seien in dem arabischen Wort mahias (kühn) oder dem Namen Ma áfir (ein Sarazenenstamm) zu suchen. 1658 gab man einer Hexe, wie in einem amtlichen Dokument der Stadt Palermo erwähnt, den Beinamen Maffia, um auf ihren aufbrausenden Charakter zu verweisen. 1863 strömten die Einwohner Palermos in Scharen zum Sant’Anna-Theater, um sich eine neue Komödie mit dem Titel I mafiusi di La Vicaria anzusehen, die im städtischen Gefängnis spielte und von den Mitgliedern einer Geheimverbindung – im Stück nie namentlich genannt – erzählte, die unter den Häftlingen das Sagen hatten.
Zwei Jahre später beschrieb der italienische Gesandte in Palermo, Marchese Filippo Antonio Gualtiero, die »sogenannte Maffia oder kriminelle Vereinigung« als eine »große, offene Wunde«. Von da an war das Wort im allgemeinen Sprachgebrauch angelangt. 1875 verfassten zwei toskanische Soziologen eine erste Forschungsarbeit über die Geheimgesellschaft. Einer von ihnen, Leopoldo Franchetti, bestaunte zunächst die Schönheit der sizilianischen Landschaft, doch Geschichten von entsetzlichen Gräueltaten brachten ihn dazu, dass er seine Umgebung allmählich mit anderen Augen betrachtete: »Die Farben wandeln sich, die Dinge verändern ihre Gestalt … Nach einer Reihe solcher Schauergeschichten haftet all den Orangen- und Zitronenblüten der Geruch des Todes an.«
Navarra war erst zehn Jahre alt, als 1915 sein Onkel den ersten ortsansässigen Helden ermordete, der es gewagt hatte, gegen die Mafia aufzubegehren. Corleone hat eine ganze Reihe solcher mutiger Männer hervorgebracht – mehr als jede andere sizilianische Kleinstadt –, als stünde ihre Zahl im Verhältnis zum Einfluss der ortsansässigen Mafiosi. Bernardino Verro war ein Begründer der sozialistischen Bauernbewegung Siziliens, die Streiks und symbolische Landbesetzungen organisierte, um die Macht der Großgrundbesitzer zu brechen. Im Jahre 1893, in einem vorübergehenden Moment der Schwäche, hatte er sich von den Fratuzzi einreden lassen, jemand habe es auf ihn abgesehen. Da man ihm glaubhaft versicherte, die Vereinigung würde ihm das Leben retten, unterzog er sich ihrem Initiationsritual.
Dies war ein großer Triumph für die Fratuzzi, die sorgsam auf den Erhalt der etablierten Ordnung bedacht waren, weil sie ihnen so gut zupasskam, und denen deshalb viel daran gelegen war, rebellische Bauern zur Räson zu bringen. Doch der Schuss ging bald nach hinten los, als Verro sah, welcher Methoden sich die »Brüder« bedienten. Er kehrte der Vereinigung den Rücken und schrieb nieder, wie sie funktionierte und was es mit dem geheimen Initiationsritual auf sich hatte. Verro war der Erste, der die Mafia als Geheimorganisation mit eigenen Regeln darstellte. Auf einem öffentlichen Platz in Corleone, vor einer versammelten Menge, klagte er die Mafiosi mutig an, sie würden aus Corleone die »armseligste aller sizilianischen Städte« machen. Nachdem man ihn mit großer Mehrheit zum Bürgermeister gewählt hatte, wurde er ein Jahr später ermordet.
Seine mutmaßlichen Mörder, darunter auch Navarras Onkel, wurden allesamt freigesprochen. Gerichtssaal-Siege wie dieser sollten zum triumphierenden Markenzeichen der Fratuzzi-Erben werden – der Corleoneser.
Navarras Eltern haben allem Anschein nach getan, was sie konnten, um ihren Sohn davon abzuhalten, in die Fußstapfen des Onkels zu treten. Sie ermöglichten ihm eine gute Schulbildung in Corleone und ließen ihn dann in Palermo Medizin studieren. Nachdem Navarra sein Examen bestanden hatte, bemühte er sich in Corleone um das Amt des Bezirksarztes. Damals hatten Benito Mussolini und sein faschistisches Regime der Malaria und Tuberkulose lautstark den Kampf angesagt. Per Dekret wurde veranlasst, dass in allen öffentlichen Büros und Schulhäusern Spucknäpfe aufgestellt wurden, doch weil ihm die Mittel fehlten, konnte das Rathaus sich nur sieben leisten.
Der junge Arzt kam gerade zur rechten Zeit nach Corleone zurück, um Zeuge einer weiteren, noch viel ehrgeizigeren Kampagne Mussolinis zu werden. Weil er keinerlei Infragestellung seiner Autorität dulden konnte, gelobte der Duce, er werde Sizilien ein für allemal von der Mafia befreien, diesem Staat im Staate, der im Widerspruch stand zu seiner totalitären Macht. »Wir dürfen nicht länger zulassen, dass wenige hundert Schufte so ein herrliches Volk wie das eure unterjochen, auszehren und schädigen«, donnerte er während eines Kurzbesuchs in Sizilien in die Menge.
Mussolini ernannte Cesare Mori, seiner brutalen Methoden wegen der »Eiserne Präfekt« genannt (ein Präfekt ist der höchste Verwaltungsbeamte einer Provinz), zu seinem obersten Befehlshaber im Kampf gegen die Mafia. Wenn er auf der Jagd nach Banditen durchs Land galoppierte, brachte er gern eigenhändig welche zur Strecke. Er werde die Mafia, dieses Eitergeschwür, »mit glühenden Eisen« ausbrennen, versprach er. 1926, fünf Tage vor dem Dreikönigsfest, entsandte Mori bei Tagesanbruch ein Polizeikommando in die Ortschaft Gangi, nicht weit von Corleone entfernt, um sie abzuriegeln und 150 Verdächtige aufzustöbern. Mit einer Namenliste ausgestattet und angeführt von einem enthusiastischen städtischen Polizeichef, klopften Moris Carabinieri an die Türen der Mafiosi. Sobald sie einen der Gesuchten aufgestöbert hatten, wurden ihm Handschellen angelegt, woraufhin der Kommandant die rituellen Worte sprach: »Auf Befehl Seiner Exzellenz, des Präfekten Cesare Mori, erkläre ich Sie für verhaftet!«
In einer Inszenierung, die typisch war für den Eisernen Präfekten, wurden die Gefangenen, an Händen und Füßen gefesselt, in einem langen Zug mitten durch den Ort getrieben und dann weiter nach Palermo, wo man sie hinter Gitter brachte. Die Inszenierung fiel allerdings nicht ganz so eindrucksvoll aus, wie Mori es sich gewünscht hätte. Die Polizei hatte über die Hälfte der auf der Liste Genannten nicht zu Hause angetroffen. Viele Banditen waren in die Berge geflüchtet, und als sich Moris Maßnahmen herumsprachen, wanderten etliche sogar nach Amerika aus; einer dieser Mörder, der mehr Erfahrung mit dem Tod hatte als die meisten seiner neuen Landsleute, gründete dort ein lukratives Bestattungsunternehmen.
Überall in Sizilien nutzte Mori den sogenannten »Ehrenkodex« der Mafia für seine Zwecke, um ihre Mitglieder unter Druck zu setzen: Gefangene sollten zu einem Geständnis bewegt, Flüchtige dazu gebracht werden, sich zu stellen. Mori schickte Polizeitruppen in ihre Häuser, die in Abwesenheit des Familienoberhaupts oft nur von Frauen und Kindern bewohnt waren. Die Polizisten blieben so lange, bis der Mafioso, verzweifelt, weil seine Ehre durch den erzwungenen Geschlechtsverkehr seiner Frau mit den Polizisten besudelt war, gestand oder sich stellte. Gefangene wurden gefoltert, indem man sie zwang, Krüge voller Salzwasser zu trinken, mit Totschlägern auf sie einprügelte oder sie auspeitschte, sie wiederholt auf die Genitalien schlug oder Stromschlägen aussetzte. Die Ehefrauen von Flüchtigen wurden vergewaltigt.
Trotz alledem stand Dr. Navarras Entschluss, der Mafia beizutreten, unumstößlich fest. Was mochte einen jungen Kleinstadtarzt, der doch in eine gesicherte, behagliche Zukunft blickte, zu diesem Schritt bewogen haben? Schließlich war der Beruf des Mediziners dem Erhalt von Leben gewidmet und stand damit in schärfstem Widerspruch zu dem des Kriminellen, der Leben vernichtete. Eine mögliche Erklärung – nach seinen späteren Aktionen zu urteilen – wäre, dass es Navarra hauptsächlich um Macht zu tun war. Und den schnellsten Weg zur Macht bot in Corleone nun einmal die Mafia. Diskret zunächst, dann mit zunehmender Selbstsicherheit, wobei er die Kontakte seines Onkels nutzte, verschaffte Navarra sich bei den Bossen der ortsansässigen kriminellen Vereinigung eine Lobby und damit Einfluss.
In einer frühen Demonstration gewissenloser Durchtriebenheit informierte Navarra die faschistischen Machthaber über mehrere Bosse und »Soldaten« (Mafiamitglieder niederen Ranges) benachbarter Ortschaften. Mit diesem Schachzug räumte er nicht nur potentielle Rivalen aus dem Weg, sondern schmeichelte sich außerdem bei führenden Politikern ein. Um seine Position zu stärken, gründete Navarra seinen eigenen Clan, indem er Kleinkriminelle und Exsträflinge anwarb, die Mussolini durch die Lappen gegangen waren.
Die Planung seiner kriminellen Laufbahn hielt Navarra jedoch nicht davon ab, seinen ehrenvolleren Pflichten mit Professionalität und Höflichkeit nachzukommen. Er erwies seinen Patienten manch einen Gefallen, überstellte sie bereitwillig in die Klinik in Palermo oder behandelte sie gar umsonst. Wem er besondere Ehre zuteil werden ließ, dem stellte er sich als Tauf- oder Firmpate für seine Kinder zur Verfügung. Mit dem gesellschaftlichen Prestige, das ihm sein Beruf in einer so kleinen und ärmlichen Stadt wie Corleone einbrachte, wusste er sich auch im Rathaus Freunde zu sichern und Geistliche für sich zu gewinnen, deren Einfluss nicht zu unterschätzen war.
Die Aufmerksamkeiten des Doktors hatten freilich ihren Preis. Obwohl er dies nie offen aussprach, wusste doch ein jeder, dass er im Gegenzug für seine Gefälligkeiten unbedingte Loyalität erwartete. Er hatte schon früh begriffen, dass es, wollte man innerhalb der Mafia eine Machtposition erlangen, nicht nur der aktiven Unterstützung – oder wenigstens des schweigenden Rückhalts – ihrer Mitglieder bedurfte, sondern dass man sich auch mit Außenstehenden, vorzugsweise den Honoratioren des Ortes, gutstellen musste. Jeder Spaziergang, den Navarra in der Stadt unternahm, wurde zum Maßstab seines wachsenden Einflusses; wenn er durch die saubergefegte Hauptstraße oder die kleineren Gassen schlenderte, wo Kinder zwischen den Hinterlassenschaften von Mauleseln und Tauben Fangen spielten, ignorierten ihn nur die Tiere. Bekannte bezeigten ihm ihren Respekt, indem sie ihn grüßten und dann ehrerbietig seinen Ring küssten. Die Leute munkelten, er könne sciusciare, ein Dialektwort, das von der geheimnisvollen Aura kündete, die die Luft um ihn her zu bewegen schien – eine Eigenschaft, die man üblicherweise nur einem Mafioso zuschrieb.
Trotz des verräterischen Beitrags, den Navarra zu Mussolinis Säuberungsaktion leistete, erholte sich die Mafia in Corleone erstaunlich schnell. Dank einer Amnestie und eines Dekrets, das diverse Gerichtsurteile aufhob, kehrten viele Mafiosi aus dem Gefängnis und der Verbannung heim. Als Mussolini während einer Reise nach Sizilien im Jahre 1937 auch Corleone besuchte, beschwor die Polizei den faschistischen Parteisekretär vor Ort, er möge doch pro forma ein paar Bosse wieder einsperren, wenigstens für den Tag des Besuchs. Die Bitte wurde abgelehnt. Stattdessen bildeten die Bosse hoch zu Ross ein Begrüßungskomitee und begleiteten den Duce die Hauptstraße entlang. Mussolini hatte sich wiederholt gerühmt, die Mafia in die Knie gezwungen zu haben, doch zumindest in Corleone, das zeigte ihm die gönnerhafte Geste der Bosse, war ihm das gründlich misslungen. Corleone gehörte der Mafia, und er war ihr Gast.
In ganz Sizilien sollte Moris Skalpell sich als stumpf erweisen. Obwohl er viele tausend Verhaftungen veranlasste, waren davon meist nur Kleinkriminelle betroffen. Der »eiserne Präfekt« erkannte, dass er höher zielen und die etablierte Gesellschaft Siziliens, die Freunde der Mafia, einer Säuberungsaktion unterziehen musste. Wie er in seinen Memoiren schrieb: »Die Mafia ist eine alte Hure, die sich gern umständlich und unterwürfig an der Obrigkeit reibt, um sie durch Schmeichelei und Täuschung in falsche Sicherheit zu wiegen.« Doch als Mori Politiker und Aristokraten zu verfolgen begann, schickte Mussolini ihm ein Telegramm, das ihn kurzerhand nach Norditalien zurückpfiff – der Diktator hatte kein Interesse daran, die Schwarzhemden der eigenen Partei zu attackieren.
Die 460000 alliierten Soldaten, die 1943 Sizilien befreiten – im »kürzesten Blitzkrieg der Geschichte«, wie der amerikanische General George S. Patton stolz anzumerken pflegte –, sind die letzten auf einer verblüffend langen Liste von Eroberern. Man bereitete ihnen einen ungewohnt warmen Empfang. Die Sizilianer säumten die Straßen, bejubelten, beklatschten und umarmten die ausländischen Soldaten. Als größte Insel im Mittelmeer, nur einen Steinwurf von Afrika und dem Nahen Osten entfernt, hatte Sizilien nur höchst widerwillig den Gastgeber für Phönizier, Griechen, Karthager, Römer, Vandalen, Araber, Normannen, Spanier, Bourbonen und, im Zweiten Weltkrieg, die deutschen Streitkräfte gespielt.
Die meisten dieser Fremdherrscher regierten die Insel vom Ausland aus, ohne Rücksicht auf die Interessen der Insulaner, oder verschacherten sie für andere Gebiete. Der italienische Schriftsteller Luigi Barzini beschrieb, wie das Vermächtnis dieser ausländischen Belagerungen etwas herausgebildet hatte, das er als »eine Lebensphilosophie … einen moralischen Code« bezeichnet hatte, der angeblich allen Sizilianern gemein sei – obwohl man fairerweise einwenden sollte, dass eine so starre Gesinnung nur auf eine bestimmte Anzahl von ihnen zutrifft:
Sie lernen schon in der Wiege oder werden gar schon mit dem Wissen geboren, dass sie einander helfen, sich mit ihren Freunden zusammentun und die gemeinsamen Feinde bekämpfen müssen, selbst wenn die Freunde im Unrecht und die Feinde im Recht wären; jeder muss – koste es, was es wolle – die eigene Ehre verteidigen und darf niemals zulassen, dass auch nur die kleinste Kränkung oder Schmähung ungesühnt bleibt; sie müssen Geheimnisse bewahren und sich stets vor offiziellen Autoritäten und Gesetzen hüten.
Die chaotischen Zustände nach der Befreiung Siziliens erwiesen sich als Mussolinis Niedergang – er wurde von der eigenen Partei gestürzt – und als Dr. Navarras einmalige Chance. Wie vielerorts in Sizilien ernannte die alliierte Militärverwaltung AMGOT auch in Corleone zunächst einen Mafioso aus vorfaschistischer Zeit zum stellvertretenden Bürgermeister und holte zwei weitere Mafiosi in den Stadtrat. In ihrer Bemühung, sämtliche Machtpositionen mit geeigneten Antifaschisten zu besetzen, ignorierten die Befreier kurzsichtig und in fataler Unkenntnis der örtlichen Verhältnisse bestehende Verbindungen zur Mafia. Und so kam es, dass neunzig Prozent der 352 neu ernannten Bürgermeister entweder der Mafia angehörten oder Separatisten waren, die ihr nahestanden.
Lord Rennel, Oberbefehlshaber von AMGOT, meldete mit einem Hauch Bedauern nach London: »Ich fürchte, meine Offiziere haben in ihrem Eifer, die faschistischen podestà (Bürgermeister) und Würdenträger in den ländlichen Gemeinden aus den Ämtern zu entfernen, in Unkenntnis der örtlichen Gesellschaft eine Reihe von Mafiabossen ernannt oder zumindest in die Lage gebracht, fügsame Strohmänner vorzuschlagen, die ihnen zu Willen sind.« Dies machte den kleinen Erfolg, den Mussolinis Kampf gegen die Mafia erzielt hatte, zunichte und katapultierte die Organisation mitten ins Herz des staatlichen Systems. Mafiosi witterten Morgenluft und bezeichneten ihre Organisation von nun an als Cosa Nostra (Unsere Sache). Sizilien leidet bis heute unter den Folgen der Aktionen von AMGOT.
Navarra hatte keine antifaschistischen Empfehlungsschreiben, dafür verfügte er, dank seinem Cousin Angelo Di Carlo, einem Mafioso, der aus Corleone hatte fliehen müssen, als die faschistischen Polizeitruppen in den Ort einfielen, über privilegierte Beziehungen zu den Befreiern. Di Carlo war nach Amerika ausgereist, wo er sich der Marine und der amerikanischen Cosa Nostra angeschlossen hatte. Der Kapitän zur See galt als der verlässlichste Killer des berüchtigten Gangsters Charles »Lucky« Luciano. Er kontaktierte das Amt für strategische Dienste OSS (Office of Strategic Services, Vorläufer der CIA) und gelobte, bei seiner Rückkehr nach Corleone für einen friedlichen Übergang vom Faschismus in die Freiheit zu sorgen.
Wieder in Corleone, arrangierte Di Carlo für Navarra ein Treffen mit einem hochrangigen AMGOT-Offizier, mit dem Ergebnis, dass der Doktor, obwohl es ihm gänzlich an der entsprechenden Qualifikation fehlte, das exklusive Recht auf sämtliche Militärfahrzeuge erhielt, die die Alliierten auf Sizilien zurückließen. Da das Straßen- und Schienennetz der Insel noch immer unter den Folgen der Bombardierungen litt, machte sich Navarra unverzüglich daran, mit den Transportmitteln der Alliierten einen regionalen Busdienst einzurichten, dessen Verwaltung sein Bruder übernahm. Das Unternehmen existiert noch heute, unter dem Namen AST, und wird sowohl von Sizilianern wie auch von Touristen genutzt.
Kurz nach Kriegsende starb der Boss Caligero Lo Bue aus Corleone in seinem Bett eines natürlichen Todes. Beim Kampf um seine Nachfolge standen sich Navarra und Vincenzo Collura gegenüber, der in den 1920er Jahren nach Amerika ausgewandert war, wo er sich mit zwei führenden italo-amerikanischen Gangstern angefreundet hatte – Frank »Drei-Finger« Coppola, dessen Trauzeuge er gewesen war, und Joe Profaci, »dem Olivenölkönig«, dessen Kind er aus der Taufe gehoben hatte. Als Collura nach dem Tod seines Bosses eine Rückkehr nach Sizilien in Erwägung zog, bat er seine mächtigen Freunde, seine Nachfolge zu unterstützen. So bestieg Collura das Schiff, das ihn nach Hause bringen würde, in der festen Überzeugung, mit Hilfe seiner illustren amerikanischen Sponsoren werde ihm Corleone ohne große Mühe in die Hände fallen.
Doch bei seiner Rückkehr im Jahre 1944 wurde er durch Navarra sehr schnell eines Besseren belehrt. Der Arzt scharte einige einflussreiche Mafiosi um sich, ehe sein Gegner sich eine Machtbasis aufbauen konnte. Navarras Einfluss war so groß geworden, dass die Wiedergeburt des örtlichen Clans in seinem eleganten Heim stattfand, das an einer Piazza im historischen Ortskern der erst vor kurzem befreiten Stadt gelegen war. Navarra fand ausreichend Unterstützung und wurde zum neuen Boss ernannt; gleichzeitig suchte er seinen Gegner zu besänftigen, indem er ihm einen Stadtteil überließ, der allerdings von Navarras Gefolgsleuten flankiert war. Collura akzeptierte das Angebot, machte aber wenig Hehl aus seinem Groll gegen Navarra. Der reagierte nicht; er würde sich später mit dem Problem befassen.
Navarra war ein Meisterstück geglückt. Er, der Provinzarzt, gerade vierzig Jahre alt und außerhalb seiner Geburtsstadt kaum bekannt, hatte es geschafft, seinem Rivalen zum Trotz Clanchef zu werden. Seine Ernennung markierte nicht nur einen persönlichen Triumph, sondern war zugleich die Geburtsstunde des berüchtigten Corleoneser-Clans.
Navarra führte ein blutiges Regiment. In nur vier Jahren, von 1944 bis 1948, kamen in Corleone insgesamt 153 Menschen gewaltsam zu Tode; eine Atmosphäre der Angst breitete sich aus in der Stadt, in der, wie es hieß, »Menschen ohne jeden Grund ermordet wurden«. Oftmals war das Opfer Navarra einfach nur im Weg, wie beim Leiter des örtlichen Krankenhauses der Fall. Navarra ließ seine Männer wissen, dass er den Posten haben wollte, und sagte mit schlauem Grinsen: »Wir finden schon eine Lösung …« Kurz danach wurde der Direktor erschossen. Als der Verdacht auf Navarra fiel, tat er den Ermordeten als einen Don Juan ab, einen unverbesserlichen Frauenhelden. »Jeder hat doch längst gewusst, dass ihm sein Verhalten früher oder später zum Verhängnis werden würde«, sagte er und übernahm den Posten seines toten Kollegen.
Navarra achtete stets darauf, sich selbst so wenig wie möglich die Hände schmutzig zu machen. Raubüberfälle, Erpressungen oder Morde delegierte er an seine Handlanger. Eines seiner Opfer war der Polizist, der Mussolinis Carabinieri zu den Häusern der Mafiosi geführt hatte. Der Racheakt, die vendetta, wurde auf einer Piazza im Herzen der Stadt vollstreckt: Jemand jagte dem Mann drei Kugeln in den Bauch. Wie bei den meisten Morden, die Navarra in Auftrag gab, erwies es sich als Ding der Unmöglichkeit, die Mörder zu überführen. Die Opfer, wie Navarra zu scherzen pflegte, seien offenbar dem »Tritt eines Maulesels« erlegen.
Bald sprachen sich die kriminellen Machenschaften des Doktors herum, seine zahlreichen Patienten aber konnten nicht klagen, denn am Krankenbett zeigte er stets tadellose Manieren. Da es ihm nicht an Geld mangelte, ließ er viele Personen sogar in Privatkliniken behandeln, auf seine Kosten. Er war jederzeit bereit, einen Bekannten für einen freien Posten zu empfehlen, einem Mafioso den Anwalt zu bezahlen, wenn der sich keinen leisten konnte, oder jemanden aufzutreiben, der willens war, vor Gericht für einen Verdächtigen zu lügen, den es vom Haken zu holen galt.
Navarra war es weniger um das Geld zu tun, das er als Arzt oder Krimineller einnahm, ihm ging es vor allem um die Macht. Er besaß einen Teil des Hauses, in dem er lebte, und hatte einige Grundstücke von bescheidener Größe von seinem Vater geerbt, doch seine Leidenschaft galt dem Sammeln von Ämtern und Posten in und außerhalb der Gemeinde: Er war nicht nur Leiter des örtlichen Krankenhauses, sondern auch Präsident des Bauernverbands, Aufsichtsrat einer überregionalen Krankenversicherung, der staatlichen Eisenbahngesellschaft, eines Tuberkulosezentrums und einer Krankenversicherung für Kleinbauern. Doch dies alles genügte ihm nicht. Als es ihm trotz seiner vielen Beziehungen nicht gelang, die Leitung eines neuen Krankenhauses in Corleone zu übernehmen, verstand Navarra dies als Affront gegen seine Autorität und versicherte, dass dieses Krankenhaus, solange er am Leben sei, niemals seine Pforten öffnen werde.
Machtgier war es auch, die den Arzt dazu bewog, nicht nur vorübergehend in der Politik mitzumischen – allerdings erwies er sich als ein schamloser Opportunist: Er unterstützte zunächst eine Partei, die sich für die Unabhängigkeit Siziliens einsetzte, dann die Liberalen und schließlich die Christdemokraten. Um dafür zu sorgen, dass die Bürger auch wirklich in seinem Sinne wählten, stellte Navarra einige hundert Atteste aus, die ihnen Blindheit bescheinigten, damit seine Handlanger sie in die Wahlkabinen begleiten konnten. Als seine kommunistischen Gegner den Schwindel entdeckten und zur Anzeige brachten, stürmte ein erboster Navarra zusammen mit seiner Frau ins Wahllokal, wedelte mit einem Attest herum – natürlich von ihm selbst ausgestellt –, das die Gattin für stark sehbehindert erklärte, und führte sie demonstrativ in eine Wahlkabine. Jedermann wusste, dass ihre Augen völlig gesund waren, aber niemand wagte es, sich dem Doktor zu widersetzen. Als Gegenleistung für den unlauteren Stimmenfang erhielten Verwandte von Mafiosi einflussreiche Posten in örtlichen Behörden, während Politiker, die Kontakte zur Unterwelt pflegten, ins Landesparlament gewählt wurden.
Luciano Leggio
Luciano Leggio war der bei weitem loyalste und vielversprechendste unter Navarras jungen Leutnants. Seine Eltern waren verarmte Bauern und hatten Mühe, ihre zehn Söhne und Töchter durchzufüttern, also steckten sie den Jungen in ein Priesterseminar; der aber durchkreuzte ihre Pläne, weil er partout nicht lernen wollte, und brach bereits mit neun Jahren die Schule ab. Später, als Halbwüchsiger, holte er das Versäumte nach, indem er eine Lehrerin mit vorgehaltener Waffe zwang, ihm Lesen und Schreiben beizubringen. Ein Teil der religiösen Erziehung sollte aber an ihm haften bleiben: Angeblich kniete er jeden Abend betend vor einem Kruzifix und klagte über die »Ungerechtigkeit der Welt«, der er sich ausgeliefert sah.
Leggio mit dem runden, fleischigen Gesicht, den wulstigen Lippen und dem verächtlichen Blick war von aufbrausendem Wesen und trug den Beinamen »Scarlet Pimpernel« – allerdings nur, wenn er außer Hörweite war – oder »der Krüppel«, weil er ein wenig hinkte. Er litt an der Pott’schen Krankheit, einer tuberkulösen Wirbelentzündung, die ihm Rückenschmerzen, Fieber und heftigen Nachtschweiß verursachte. Während und nach dem Krieg scheffelte Leggio weit mehr Geld, als er je als Priester hätte verdienen können. Wie er später vor Gericht aussagte: »Wie ich zu so viel Geld gekommen bin? Na, wie wohl, mit Schwarzhandel! Für 200 Pfund Getreide, die man damals für 2000 bis 2500 Lire von der Bauerngenossenschaft kaufte, gab’s auf dem Schwarzmarkt 15000 Lire.«
Leggio fiel Dr. Navarra wahrscheinlich zum ersten Mal 1944 auf, mit 19 Jahren, als Aufseher ihn dabei erwischten, wie er nach der Ernte mit Hilfe eines Komplizen gestohlenes Getreide auf ein Maultier lud. Als die Aufseher die beiden Diebe zur Rede stellten, leistete Leggio keinerlei Widerstand. Doch als sie ihm obendrein ein paar Tritte in den Hintern versetzten, blitzten seine Augen vor Zorn. Er starrte finster in ihre Gesichter, als wollte er sich ihre Züge ins Gedächtnis brennen. Nach drei Monaten Untersuchungshaft wurde er zu einem Jahr und vier Monaten hinter Gittern verurteilt; allerdings wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt, und er kam frei. Auf Rache sinnend, heuerte Leggio den Mafiasoldaten Giovanni Pasqua an, der neben einem der Aufseher wohnte. »Hör zu, mein Freund«, sagte Leggio zu ihm, »die Kerle, die mich verpfiffen haben, dürfen nicht ungeschoren davonkommen. Als Erstes knöpfen wir uns deinen Nachbarn vor, diesen Calogero Comaianni.«
Im März des darauffolgenden Jahres war der 45-jährige Comaianni abends auf dem Weg nach Hause – er wohnte im östlichen Teil der Stadt, im Schatten der Felsklippe, die Corleone überragt –, als er zwei Männer bemerkte, die ihm in einigem Abstand folgten. Sie trugen blaue Wollumhänge und hatten sich die Kapuzen tief in die Stirn gezogen. Der Anblick genügte, um ihn aus der Fassung zu bringen, denn unter solchen Umhängen – das wusste jeder – wurden nicht selten Gewehre versteckt. Comaianni beschleunigte seine Schritte, die beiden Männer ebenso. Bevor sie ihn jedoch einholen konnten, war er zu Hause, schlüpfte durch die Tür und erzählte seiner Frau Maddalena von dem Vorfall; einen der Männer habe er erkannt, meinte er, es sei der Nachbar gewesen, Pasqua. »Was können die von mir wollen?«, fragte er sich laut. »Ich hab mir doch nie etwas zuschulden kommen lassen, immer nur meine Pflicht getan.«
Früh am darauffolgenden Morgen, einem Karfreitag, mistete Comaianni im Erdgeschoss den Pferdestall aus – seine Frau und die fünf Kinder schliefen im Stockwerk darüber – und karrte den Dung zum nächsten Misthaufen. Da sah er, dass dieselben vermummten Gestalten wie am Abend zuvor auf ihn warteten. Comaianni blickte um sich, entdeckte eine offen stehende Tür und lief darauf zu, doch sie wurde ihm vor der Nase zugeschlagen. Also machte er kehrt, rannte zu seinem Haus zurück und pochte frenetisch gegen die Tür; im selben Moment trafen ihn zwei Schüsse. Die Tür ging auf, Comaianni stürzte hinein und schleppte sich schwer verwundet ein paar Treppenstufen hinauf. Dann drehte er sich um und blickte den Angreifern entgegen. Als er seinen Nachbarn erkannte, rief er: »Giovanni, was tust du?« Die Killer aber eröffneten das Feuer und schossen ihn tot. Comaiannis Ältester, Anfang zwanzig, wollte rasch ein Gewehr holen, aber seine Mutter Maddalena hielt ihn zurück, und die Killer ergriffen die Flucht.
Während sie ihren toten Mann in den Armen wiegte, schrie Maddalena ihren Nachbarn zu, die sich erst jetzt allmählich heranwagten, dass sie beide Mörder erkannt habe – Giovanni Pasqua und Luciano Leggio. Damit verstieß sie gegen die omertà, das Schweigegebot der Mafia; ein sizilianisches Sprichwort besagt: »Sei blind, taub und stumm, dann wirst du hundert Jahre alt.« Maddalena wiederholte ihre Anschuldigungen vor der Polizei, aber vor Gericht hatte die Zeugenaussage einer Witwe keinerlei Gewicht, und so wurde das Verfahren eingestellt.
Wahrscheinlich trat Leggio etwa um dieselbe Zeit der Mafia bei. Neulinge werden üblicherweise zunächst einer Prüfung unterzogen, und Leggio hatte seinen Eifer bewiesen. Das Initiationsritual war seit Jahrzehnten in Stein gemeißelt, und vermutlich entschied Navarra persönlich über Leggios Aufnahme und enthüllte ihm den sogenannten »Ehrenkodex«, von dem Mafiosi behaupten, er basiere auf traditionellen sizilianischen Werten wie Ehre, Familienbande und Freundschaft, und dem sie sich ein Leben lang verpflichtet fühlen:
Höre die Gebote der Cosa Nostra: Lass die Finger von den Frauen anderer Ehrenmänner. Du sollst weder stehlen noch von der Prostitution profitieren. Du sollst keinen Ehrenmann töten, es sei denn in Fällen absoluter Notwendigkeit. Du darfst Belange der Cosa Nostra nie in Gegenwart von Außenstehenden besprechen oder dich eigenmächtig anderen Ehrenmännern zu erkennen geben.
Nach diesen Worten sticht der Boss den Rekruten mit dem Dorn eines Orangenbaumzweigs in den Zeigefinger und lässt sein Blut auf ein Bild der Jungfrau Maria tropfen, der Schutzpatronin der Geheimorganisation. Das Bild wird angezündet und dem Rekruten brennend in die Hand gelegt, der nun folgenden Eid leisten muss: »Als Papier verbrenne ich dich, als Heilige verehre ich dich; so wie dieses Papier brennt, soll mein Fleisch brennen, wenn ich die Cosa Nostra jemals verrate.« Mit diesem Ritual wurde Leggio zum niederen Soldaten; allerdings seien solche Soldaten, wie Richter Falcone bemerkte, »in Wahrheit Generäle. Oder vielmehr Kardinäle einer Kirche, die nicht so nachsichtig ist wie die der Katholiken.«
Als Soldat war Leggio zuallererst seiner kriminellen Familie in Corleone verpflichtet. An der Basis der äußerst hierarchisch strukturierten Mafiapyramide werden Gruppen von zehn oder mehr Soldaten – oder »Ehrenmännern«, wie sie sich selbst gern nennen – von einem capodecina (Chef von zehn) kommandiert, der wiederum dem gewählten Oberhaupt der Familie untersteht. Drei oder mehr benachbarte Familien erhalten ihre Befehle vom capomandamento (Bezirksboss), der mit seinesgleichen die Oberhäupter der gesamten Organisation bestimmt. Die Schilderung eines Kronzeugen lässt erahnen, was es für einen Kleinkriminellen wie Leggio bedeutet haben muss, Teil der etwa 5000 Mitglieder umfassenden Bruderschaft zu werden:
»Ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn ich zwischen der Mafia und dem gewöhnlichen Verbrechen unterscheide, aber dieser Unterschied ist mir wichtig. Er ist jedem Mafioso wichtig. Wir sind Mafiosi, die anderen nur Abschaum. Wir sind Ehrenmänner. Nicht nur, weil wir einen Eid geleistet haben, sondern weil wir die Elite sind. Wir stehen höher als gewöhnliche Kriminelle. Wir sind die übelsten von allen!«
Fünf Jahre nach dem Tod des Aufsehers, der Leggio erwischt hatte, verhaftete die Polizei Leggios Komplizen Pasqua und entlockte ihm ein Geständnis: »Leggio und ich versteckten uns in der Nähe von Comaiannis Haus, um ihn abzupassen«, erzählte Pasqua. »Als er auftauchte, haben wir ihn erschossen. Wir hatten es schon am Abend davor probiert.« Fest entschlossen, sich für seine Verhaftung zu rächen, hatte Leggio darauf bestanden, den Mann zu töten. Der Dieb, der zusammen mit Leggio beim Stehlen erwischt worden war, bestätigte: »Leggio gab einfach keine Ruhe mehr, redete von nichts anderem als seiner vendetta, fluchte und schwor, dass er es den Schweinen heimzahlen werde.«
Als der Fall vor Gericht kam, zog Pasqua sein Geständnis abrupt zurück. Die Kommissare hätten ihn gefoltert, so seine Begründung; das Gericht sprach daraufhin sowohl Leggio als auch Pasqua aus Mangel an Beweisen frei. Das Urteil wurde von einem Berufungsgericht bestätigt: Die Zeugenaussage der Witwe des Ermordeten, so die Richter, sei »zusammenhanglos« gewesen und Pasquas Geständnis das »Ergebnis von Einschüchterungsmaßnahmen«. Außerdem, fügten die Richter hinzu, habe der Mord zu lange – acht Monate – nach Leggios Verhaftung stattgefunden, als dass sich eine Verbindung zwischen den beiden Vorfällen erkennen lasse. Nachdem das Urteil verkündet worden war, sagte Maddalena nur: »Jetzt haben sie meinen Calogero ein zweites Mal getötet.«
Zum ersten Mal hatten die Corleoneser es geschafft, der italienischen Justiz zu trotzen, sie in die Knie zu zwingen, ein Meisterstück, das ihnen in den nachfolgenden Jahrzehnten noch des Öfteren gelingen sollte. Leggios Sieg brachte ihm viel Ansehen ein in Corleone. Er hatte nicht nur bewiesen, dass ihm »keine Fliege auf der Nase herumkrabbeln« konnte, wie es auf Sizilien anerkennend von einem heißt, der sich nicht verschaukeln lässt. In den Augen vieler war Leggio unantastbar.
Er nutzte diesen Ruf, um sich Arbeit zu beschaffen. Nachdem er sich ein hübsches Landgut ausgesucht hatte, erschoss er den Aufseher von hinten und sprach dann mit dem Gutsbesitzer: »Von nun an werde ich den Platz des teuren Verstorbenen einnehmen.« Niemand erhob Einspruch – die raue Beförderungsmethode hatte sich schon bei Navarra bewährt –, und so wurde Leggio zum jüngsten Aufseher in ganz Sizilien. Leggio war einer von Navarras zehn Unterbossen, die als bewaffnete Miliz auf ebenso vielen Gütern verteilt waren, einschließlich des Ficuzza-Waldes, in dem sowohl gewöhnliche Banditen wie auch Mafiosi ihre Opfer verscharrten. Auf diese Weise hatte der Doktor nicht nur Corleone, sondern auch die größten Güter ringsum unter seine Kontrolle gebracht.
Navarra ließ verlauten, Leggio sei cosa sua personale (seine persönliche Sache) – ein Widerhall des Namens Cosa Nostra. In der Hand eine Reitpeitsche und über der Schulter ein Jagdgewehr, ritt Leggio durch die Ländereien und tat, was die Mafia von jeher getan hatte: Er bewachte den Besitz eines reichen Landeigentümers und setzte nötigenfalls auch Gewalt ein, um jeden Anspruch der Bauern auf das Land, das sie beackerten, schon im Keim zu ersticken.
Der Kampf um die Bewahrung der bestehenden Verhältnisse sollte sich in Corleone schon bald zuspitzen, denn ein junger Idealist und ehemaliger Partisan nahm es mit dem Doktor und seinem skrupellosesten Gefolgsmann auf.
Placido Rizzotto, »der Nordwind«
Wie Dr. Navarra kam auch der schmächtig gebaute Placido Rizzotto aus einem mafiosen Umfeld. Doch im Unterschied zu dem Arzt war Rizzotto ein Rebell und dachte nicht im Traum daran, seinem Vater, einem Aufseher und Mafioso, der unter Mussolini ins Gefängnis gewandert war, in die Bruderschaft zu folgen; Placido war damals erst elf Jahre alt gewesen. Im Zweiten Weltkrieg wurde Rizzotto, der kaum lesen und schreiben konnte, in die Armee eingezogen, um auf der Seite der Faschisten zu kämpfen, doch als Italien nach der erfolgreichen Invasion Siziliens am 8. September 1943 kapituliert hatte, zog Rizzotto seine Soldatenuniform aus und schloss sich den Partisanen an, die in den Alpen im Nordosten einen Guerillakrieg gegen Truppen der deutschen Wehrmacht führten. Die jungen Männer der Brigade Garibaldi mit ihren roten Halstüchern lehrten ihn, Kälte und Hunger zu ertragen, und führten lange Gespräche mit ihm über die Ideale von Freiheit und Gleichheit.
Als er 1945 nach Corleone zurückkam, brachte ihm sein neuer leidenschaftlicher Glaube an revolutionäre Ideen den Beinamen »Nordwind« ein. Rizzotto prangerte die Rinderdiebstähle der Mafia an und beschwor die Bauern, nur ja nicht vor den adeligen Großgrundbesitzern klein beizugeben. Sie sollten sich auf die neuen Gesetze berufen, die die Regierung in Rom erlassen hatte und die den Bauerngenossenschaften das Recht zugestanden, Konzessionen auf Land zu erwerben, das seine Besitzer hatten brachliegen lassen.
In einer Art und Weise, die nicht nur die Landeigentümer herausforderte, sondern auch die Mafia, die deren Güter verwaltete und bewachte, organisierte Rizzotto provokante Landbesetzungen: Bei Tagesanbruch erlebte Corleone dann einen fröhlicheren Zug als den jahrzehntealten Trott der Bauern und Maultiere zu weitentfernten Parzellen. Oft fuhren die Bauern, rote Fahnen schwenkend, in den buntbemalten Karren, die man auf Sizilien noch heute hie und da entdeckt, hinter Rizzotto her, den brachliegenden Feldern zu, die sie sich für ihren Protest ausgesucht hatten. Dort angekommen, rammten sie eine rote Fahne in den Boden, um das Land, wenn auch nur symbolisch, in Besitz zu nehmen. Anschließend hielt Rizzotto eine Ansprache. Er war ein begnadeter Redner und verstand es, seine Zuhörer zu begeistern: Es sei an der Zeit, rief er ihnen zu, ein für allemal ein System zu zerstören, das von jeher nichts anderes getan hatte, als die Bauern auszubeuten. Jetzt sei ihre Chance gekommen, beschwor er sie; da das Land brachliege, sollten sie es für sich selbst einfordern, denn sie wüssten es besser zu bewirtschaften als jeder andere.
Navarra suchte dergleichen Proteste möglichst im Keim zu ersticken. Auf einem der Güter schossen Wächter mit Gewehren auf die Bauern, und in derselben Nacht fielen noch mehr Schüsse, nämlich auf das Heim des kommunistischen Parteisekretärs. Der brutalste Angriff erfolgte am 1. Mai 1947, als der legendäre Bandit Salvatore Giuliano und seine Männer auf Bauern in Portella della Ginestra schossen, nördlich von Corleone, dabei elf Männer töteten und 27 verwundeten. In Corleone ging Leggio mit roher Gewalt gegen die Bauern vor: Hunderte von Maultieren und Eseln wurden mit aufgeschlitzter Kehle gefunden, Scheunen und Schober gingen in Flammen auf. Kein Mensch wagte es, Leggio anzuzeigen.
Rizzotto aber ließ sich nicht beirren. Immer wieder hielt er Ansprachen, in denen er Leggio und seine Hintermänner attackierte und die Bauern aufforderte, den Behörden preiszugeben, was sie wussten. Navarra versuchte, ihm die Streitlust auszureden, aber Rizzotto wies ihn zurück. Zu Beginn des Jahres 1948 gerieten die beiden Männer aus einem banaleren Grund aneinander. Um seine beachtliche Titelsammlung noch zu erweitern, wollte der Doktor dem Veteranenverein des Ortes beitreten, als Ehrenmitglied. Rizzotto, der dem Verein vorstand, bat ihn um eine detaillierte Auflistung seiner Verdienste. Die Papiere des Doktors bezeugten, dass er in der Tat als Unterleutnant der Reserve in einem Artilleriebataillon gedient hatte, wenn auch nur ein Jahr. Als er kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs den Einberufungsbefehl erhalten hatte, ließ er sich sofort für kampfuntauglich erklären und ging nach Hause. Rizzotto wies Navarra ab, was der Doktor als persönliche Kränkung auffasste.
Bald schon erregte Rizzotto erneut Navarras Unwillen. Um ein Exempel zu statuieren, führte der junge Bauer seine Anhänger auf ein von Leggio bewachtes Landgut. Die Rebellen jagten Leggio davon und hissten auf dem Schloss, das inmitten seiner Ländereien stand, die rote Fahne. Danach gingen sie symbolisch daran, das Land zu beackern, um zu zeigen, dass es denen Nutzen bringen sollte, die es bewirtschafteten.
Und noch einmal würde Leggio gegen Rizzotto den Kürzeren ziehen, nämlich als die beiden Männer vor dem Stadtpark am Ortseingang von Corleone aneinandergerieten. Leggio und seine Mafiosi-Freunde zogen über die roten Halstücher von ein paar ehemaligen Partisanen her, die durch die Stadt fuhren. Die Partisanen blieben ihnen nichts schuldig, und prompt artete das Geplänkel in eine Schlägerei aus. Jemand holte Rizzotto, damit er die Rauferei beende. Der Bauernführer rief zur Ruhe auf, jedoch vergebens. Erbost über die Spötteleien der Mafiosi – auch er hatte in seiner Partisanenzeit ein rotes Halstuch getragen –, kam er den Fremden zu Hilfe. Er packte den schmächtigen Leggio, hob ihn in die Höhe und hängte ihn mit dem Mantelkragen an die Spitzen der schmiedeeisernen Parkumzäunung.
Aufgestachelt von einem wütenden Leggio, erzählte Navarra überall herum, der junge Rizzotto stecke seine Nase in Dinge, die ihn nichts angingen – eine Aussage, die mehr war als eine leise Drohung. Rizzotto kannte die Gepflogenheiten der Mafia gut genug, um zu begreifen, dass er in Gefahr war. Doch als seine Freunde ihn zur Vorsicht mahnten, entgegnete er: »Sie können mich umbringen, aber damit ist nichts gelöst. Nach mir werden andere kommen!« Rizzottos alter Vater, der selbst der Mafia angehört hatte und den die Sorge um den Sohn schier um den Schlaf brachte, schärfte ihm ein: »Wenn jemand mit dir reden will, dann bitte ihn, eine halbe Stunde zu warten; in der Zwischenzeit kommst du zu mir und sagst mir Bescheid.«
Rizzotto aber nahm die Drohung auf die leichte Schulter und entgegnete dem Vater: »Sie respektieren mich, sogar Dr. Navarra!«
Rizzotto ignorierte den Rat seines Vaters, als man ihn ungefähr drei Wochen nach der Rauferei vor dem Park wissen ließ, dass Navarra ihn sprechen wolle. Er solle sich am Abend des 10. März auf der Hauptstraße einfinden, nicht weit von Navarras Haus. Es war ein klarer, kühler Abend, und viele Leute waren unterwegs, um nach dem Abendessen noch ein wenig durch die Straßen zu schlendern. Navarra jedoch tauchte nicht auf; während Rizzotto vergeblich auf ihn wartete, sprach sein alter Freund Pasquale Criscione ihn an, einer von Navarras Männern und der Pächter einer Parzelle, die sich die Bauernbewegung geholt hatte. Er müsse mit ihm reden, sagte Criscione, und so schlenderten die beiden die Hauptstraße entlang, bis zur Kirche San Leonardo. Dort hätten sie sich verabschiedet, behauptete Criscione später.
Der 33-jährige Rizzotto kam nicht mehr nach Hause. Nach einer schlaflosen Nacht, in der sie vergeblich auf ihren Sohn gewartet hatte und immer wieder hinaus auf die Straße gelaufen war, um nach ihm Ausschau zu halten, erfuhr Rizzottos Mutter, dass er zuletzt mit Criscione gesehen worden war.
Sie sprach daher Criscione auf der Straße an: »Um welche Uhrzeit habt ihr euch getrennt?«, fragte sie.
»Um zehn nach zehn«, antwortete er.
»Und was hat er zu dir gesagt?«
»Dass ich mal zum Essen kommen soll«, sagte Criscione.
Während Criscione mit ihr geredet habe, erzählte Rizzottos Mutter, sei seine widerwärtige Visage kreideweiß gewesen, außerdem habe er gezittert. Am selben Abend habe sie ihren Sohn bei den Carabinieri als vermisst gemeldet.
In der Nacht, in der Rizzotto verschwand, wurde ein 13-jähriger Hirtenjunge ganz plötzlich von einem rätselhaften Leiden befallen. Der Junge hatte vor der Stadt die Schafe seines Vaters gehütet, als er unversehens krank geworden war. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo Navarra sich seiner annahm. Im Fieber beschrieb der Junge, er habe beobachtet, wie auf einem Feldweg unterhalb der Rocca Busambra ein Bauer ermordet wurde. Daraufhin verlor der Junge das Bewusstsein und starb gleich darauf. Die Obduktion ergab, dass er vergiftet worden war. Polizeiliche Ermittler fanden heraus, dass nicht näher identifizierte »Freunde« den Jungen zu Navarra ins Krankenhaus gebracht hatten, konnten aber nicht beweisen, dass der kleine Hirte, wie die Lokalzeitung berichtete und viele Leute glaubten, den Mord an Rizzotto mit angesehen und Navarra ihm deshalb eine tödliche Spritze verpasst hatte.
Während Rizzottos Verschwinden weiterhin Rätsel aufgab, kam das Gerücht auf, dass er beim »Streit um eine Frau« ermordet worden sei, Leoluchina Sorisi. »Demjenigen, der meinen Placido auf dem Gewissen hat, werde ich das Herz herausreißen«, soll sie an seinem Grab geschworen haben. Fast sechs Jahrzehnte später würde die 86-jährige Leoluchina ihr lebenslanges Schweigen brechen und bestreiten, jemals einen Eid dieser Art geleistet zu haben. Rizzotto sei nur ein Bekannter gewesen, erklärte sie; er sei oft zu ihr nach Hause gekommen, weil er ein Freund ihres Neffen gewesen sei. In Wirklichkeit sei sie nicht mit Rizzotto gegangen, sondern mit Criscione – mit dem Rizzotto kurz vor seinem Verschwinden noch gesehen worden war.
Die »Liaison« zwischen Leoluchina und Criscione habe, wie damals üblich, aus scheuen Blicken bestanden und ein paar flüchtigen Worten im Vorübergehen. Wie sie sich in einen Mafioso verlieben konnte, wurde Leoluchina gefragt. »Aber ich war doch gar nicht in ihn verliebt«, widersprach sie. »Ich wusste, dass ich heiraten musste, ich war auch im richtigen Alter, und er galt als gute Partie. So dachte man damals. Mädchen wurden von klein auf zur Ehe erzogen. Außerdem wusste nicht jeder, dass er ein Mafioso war. Er gab sich den Anschein, das schon, aber das taten damals viele in Corleone.«
Kurz nach Rizzottos Verschwinden hatte Criscione sie aufgefordert, für ihn zu lügen und der Polizei zu erzählen, sie wäre die ganze Nacht mit ihm zusammen gewesen. Sie hatte sich geweigert und vermutet, dass er sich nur um sie bemüht hatte, um an Rizzotto heranzukommen. »Bösen Menschen ist so etwas zuzutrauen«, meinte sie.
Sieben Tage nach Rizzottos Verschwinden erreichte die Ermittler ein anonymes Schreiben mit fehlerhafter Grammatik: »Hütet euch vor den Leuten, die wo Placido hingerichtet haben … vor allem die zwei Criscione-Brüder, Leggio …«, hieß es darin. Doch dieser Verstoß gegen die omertà, das Schweigegebot der Mafia – ein anonymer Brief war traditionellerweise die einzige Möglichkeit, die ein sizilianischer Bauer hatte, mit der Polizei zu kommunizieren, für den unwahrscheinlichen Fall, dass er das Risiko auf sich nehmen würde –, führte nirgendwohin, da man keine Beweise fand, mit deren Hilfe man die im Brief genannten »Mörder« hätte überführen können.
Die Ordnung war wiederhergestellt. Die nunmehr führerlose Bauernbewegung endete gleichsam über Nacht; keiner hatte mehr den Mut, die rote Flagge auf Felder zu pflanzen, die vom Clan kontrolliert wurden. Viele Bauern, die das Recht auf ein Stück Ackerland erworben hatten, verzichteten freiwillig darauf, aus Angst vor Repressalien. Nicht einmal die Entscheidung von Rizzottos Vater, das Gesetz des Schweigens zu brechen und der Polizei mutig alles zu erzählen, was er über die Mafia wusste, konnte dazu beitragen, das Rätsel um das Schicksal seines Sohnes zu lösen. Doch obwohl die Polizei wenig gegen Leggio in der Hand hatte, forderte sie neun Monate nach dem Mord seine Verbannung aufs Festland. Leggio erschien nicht zur Anhörung, die darüber entscheiden sollte, und war von nun an auf der Flucht.





























