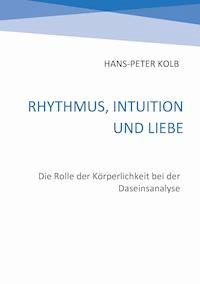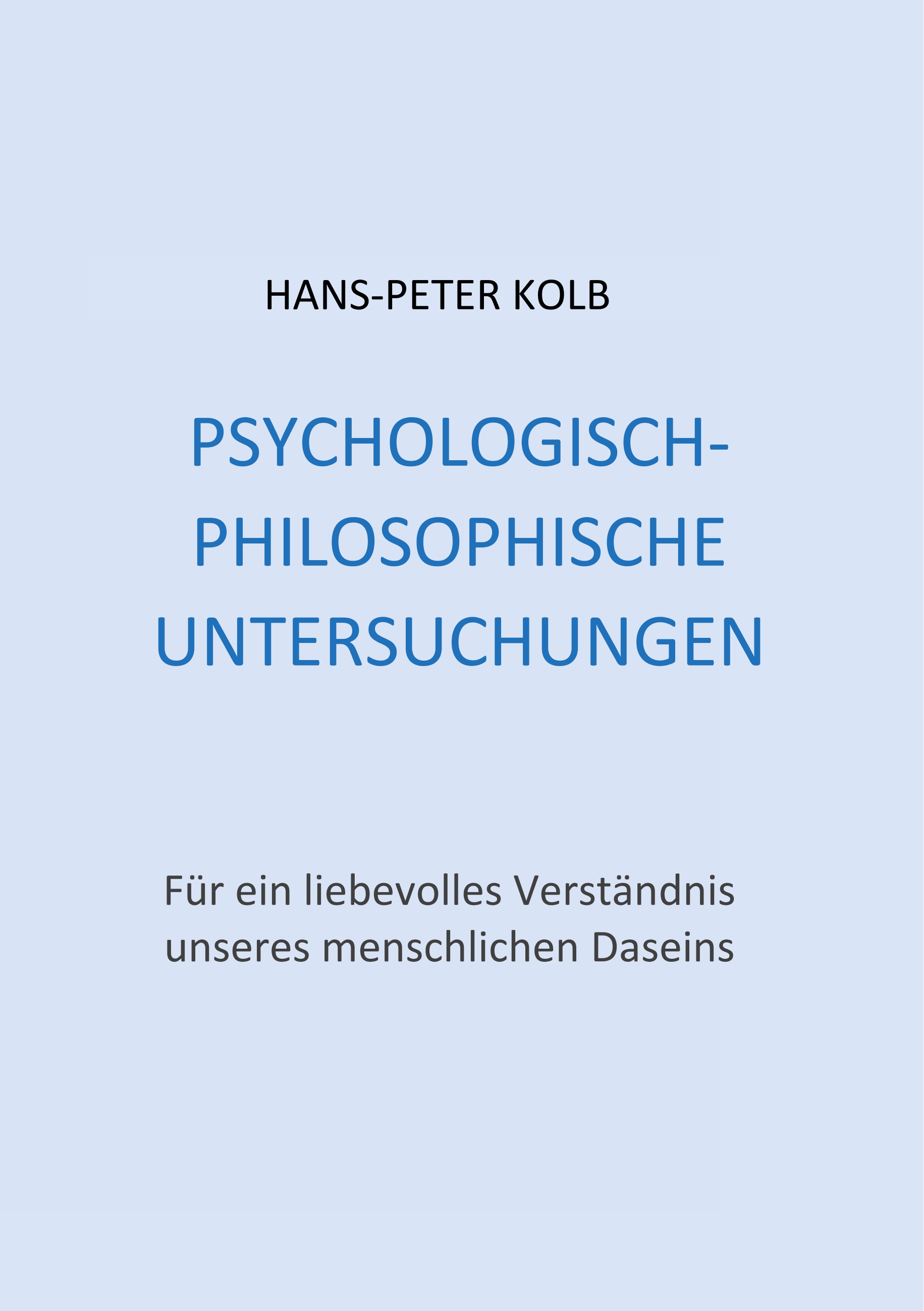Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Zentrum von Kants Werk stehen die drei Kritiken, die Kritik der reinen Vernunft, die der praktischen Vernunft und die der Urteilskraft. Der Begriff Kritik kommt aus dem Griechischen und bedeutet bei Kant Unterscheidung. Er will unterscheiden, was vernünftig ist anzunehmen, wenn wir über das hinausgehen, was wir sinnlich wahrnehmen und mit logischem Verständnis beweisen können. Hinausgehen heißt auf Lateinisch transcendere, und deshalb nennt Kant seine Philosophie Transzendentalphilosophie. Weil wir in der Psychologie als Wissenschaft und in der Praxis stets spekulativ vorgehen und mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten müssen, sind wir mit demselben Problem wie Kant konfrontiert, nämlich mit der Frage, was vernünftig ist anzunehmen, ohne dogmatisch oder zu skeptisch zu werden. Insofern halte ich es für sehr vernünftig, Kants Philosophie allen Psychologen, ob Wissenschaftler oder Praktiker, nahezubringen. Ferner geht es mir darum, Kants Transzendentalphilosophie im Licht eines Daseins, um zu lieben, mit dem Konzept der Mentalisierung zu verbinden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Heidi, Michaela und Daniel
„Denn da […] ein Geschöpf […] immer abhängig ist, so kann es niemals von Begierden und Neigungen ganz frei sein, die […] es jederzeit notwendig machen, […] die bloße Liebe zum Gesetze […] sich zum beständigen, obgleich unerreichbaren Ziele seiner Bestrebungen zu machen.“ (Kant, Critik der praktischen Vernunft, 1788, S. 206)
„… denn nur so viel sieht man vollständig ein, als man nach Begriffen selbst machen und zu Stande bringen kann.“ (Kant, Critik der Urteilskraft, 1790 (A), zweite Auflage 1793 (B), dritte Auflage 1799 (C), S. 498)
„Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir.“ (Kant, Critik der praktischen Vernunft, 1788, S. 300)
„Man sieht also, dass […] die Antinomien wider Willen nötigen, über das Sinnliche hinaus zu sehen, und im Übersinnlichen den Vereinigungspunkt aller unserer Vermögen a priori zu suchen: weil kein anderer Ausweg übrigbleibt, die Vernunft einstimmig mit sich selbst zu machen.“ (Kant, Critik der Urteilskraft, 1790 (A), zweite Auflage 1793 (B), dritte Auflage 1799 (C), S. 447)
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Von der Gehirnentwicklung zum Glauben an Gott
1.1. Die fünf Sinne und ihre Beziehungsmuster
1.2. Die Arten des Lernens und der Mathematik
1.3. Die zwölf Kategorien und ihre Entwicklung
1.4. Begriffsklärungen
1.5. Vernunftbegriffe und Existentiale
1.6. Die Antinomien der reinen Vernunft
1.7. Das Vater-Unser
1.8. Wie vernünftig ist der Gottesglaube?
2. Die Entwicklung der praktischen Vernunft
2.1. Der kategorische Imperativ
2.2. Die moralische Entwicklung
2.3. Die Dialektik oder Widersprüchlichkeit
3. Die Kritik der Urteilskraft
3.1. Bestimmende und reflektierende Urteile
3.2. Die Entwicklung der Urteilskraft
3.3. Urteilen und Begehren
3.4. Das Erhabene, profane oder religiöse Werte
3.5. Die Berechtigung ästhetischer Urteile
3.6. Widersprüchliches
3.7. Teleologie und Naturkonzeption
Verwendete Literatur
Alle Seitenzahlangaben der Kant-Zitate sind aus der Gesamtausgabe von Weischedel (Kant, Werke in sechs Bänden, 2011).
Vorwort
Im Zentrum von Kants Werk stehen die drei Kritiken, die Kritik der reinen Vernunft, die der praktischen Vernunft und die der Urteilskraft. Der Begriff Kritik kommt aus dem Griechischen und bedeutet bei Kant Unterscheidung. Er will unterscheiden, was vernünftig ist anzunehmen, wenn wir über das hinausgehen, was wir sinnlich wahrnehmen und mit logischem Verständnis beweisen können. „Hinausgehen über etwas“ heißt auf Lateinisch transcendere, und deshalb nennt Kant seine Philosophie Transzendentalphilosophie. Mir geht es hier zum einen darum, seine Kritiken im Licht eines Daseins, um zu lieben, zu betrachten, und zum andern darum, die Philosophie von Immanuel Kant der Psychologie zugänglich zu machen, indem ich seine drei Kritiken aus entwicklungspsychologischer Sicht erläutere und mit dem Konzept des Mentalisierens verbinde. Weil wir in der Psychologie stets spekulativ vorgehen und mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten müssen, sind wir mit demselben Problem wie Kant konfrontiert, nämlich mit der Frage, was vernünftig ist anzunehmen, ohne dogmatisch oder zu skeptisch zu werden. Insofern halte ich es für sehr vernünftig, Kants Philosophie allen Psychologen, ob Wissenschaftler oder Praktiker, nahezubringen.
Es gibt Bereiche, über die wir nichts wissen und über die wir wahrscheinlich auch prinzipiell nichts wissen können. Mit dieser Feststellung rückt Kant in die Nähe von Sokrates: „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ Trotzdem kann es wichtig sein, Annahmen zu machen, sofern sie vernünftig sind, um unser Leben zu gestalten. Um diese Art Vernunft geht es Kant. Ich z.B. finde es vernünftig, sich um die Steigerung der eigenen Liebesfähigkeit und der von anderen zu bemühen. Dadurch kann unser Zusammenleben immer friedvoller gestaltet werden. Ich weiß natürlich nicht, ob bedingungslose oder vollkommene Liebe erreichbar ist. Trotzdem halte ich es für vernünftig, danach zu streben, eine bedingte Zuneigung in eine unbedingte Liebe zu verwandeln, indem wir dem konfuzianischen Motto folgen: „Der Weg ist das Ziel.“
Beim Lesen von Kants Kritik der reinen Vernunft konnte ich seine Kategorien mit den ersten vier Ebenen der mentalen Entwicklung bei Kindern nach Fonagy et al. in Verbindung bringen. Auf der fünften Ebene stellt sich dann die Vernunft ein, und ein Kind fängt an, über sich selbst hinauszugehen und sich in andere hineinzuversetzen. Hier fängt das Mentalisieren an. So betrachtet beginnt hier die Transzendenz und die Entwicklung der Vernunft.
Wie ich in einem Buch von Willaschek1 gelesen habe, gibt es Einwände, z.B. von Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819), der fragt, woher die Ursache der „Affektion“ unserer Sinnlichkeit kommt, auf die unsere Sinneseindrücke zurückgehen. Ferner ist umstritten, welche Rolle Begriffe in der Wahrnehmung spielen2. Hier hilft die Beobachtung kleiner Kinder, die nicht von Dingen affiziert werden, sondern von der Wiederholung von Sinneseindrücken unabhängig von den Eindrücken selbst. Durch Wiederholungen prägt sich zuerst etwas im Gedächtnis ein, und wenn sich dies erneut wiederholt, erregt es die Aufmerksamkeit und wird wiedererkannt – das Kind hat auf diese Weise begriffen, dass es Entgegenstehendes bzw. Gegenstände gibt, die es so herausgreifen kann. Während bis zum Alter von drei Monaten nur die Wiederholung perfekt ähnlicher Gegenstände affizierend wirkt, d.h. während anfänglich die Quantität die größte Rolle spielt, dass es überhaupt Gegenstände gibt, ist es nach drei Monaten attraktiver, wenn geringe Unterschiede bzw. gewisse Qualitäten auftreten. Da Wiederholungen allgemein essenziell für Lernen und Entwicklung sind, entwickeln sich entsprechende Gehirnstrukturen, indem gewisse Nervenbahnen verstärkt und ausgebaut werden und andere abgebaut oder ganz gelöscht werden. So entstehen die apriori Begriffe sowie Verstand und zum Schluss die Vernunft. Dass Wiederholungen affizieren und sogar Lust bereiten und Ängste abbauen können, hat schon Kierkegaard3 festgestellt.
Man könnte jetzt sagen, dass nur die Erfahrung uns auf die verschiedenen apriori Begriffe bringt. Hier muss man verschiedene Arten der Erfahrung unterscheiden. Es gibt spezifische Erfahrungen mit konkreten Sinneseindrücken und allgemeine Erfahrungen, bei denen viele unterschiedliche Sinneseindrücke eine Rolle spielen. Wenn sich mehrfach jeweils verschiedene Eindrücke wiederholen, bildet sich der apriori Begriff des Gegenstands und die ersten drei Kategorien von Kant heraus, und so geht das immer weiter, d.h. allgemeine Erfahrungen regen zu Zusammenfassungen und damit zur Bildung von apriori Begriffen an, die dann erst konkrete Erfahrungen ermöglichen. Wie dies jeweils vonstattengeht, zeige ich dann im ersten Kapitel.
Bei der praktischen Vernunft war Kant die Idee der Freiheit am wichtigsten, und im Zentrum seiner Moral stand das durch den kategorischen Imperativ begründete sittliche Gesetz, das ein Gesetz der Freiheit ist. Das Ziel seiner Moral, die „bloße Liebe zum Gesetze“, meint dasselbe wie das Streben nach der vollkommenen Liebe, wie ich es in meinem Buch „Dasein, um zu lieben“4 dargestellt habe. Moral und Sitte haben bei uns teilweise negative Konnotationen im Sinne von sittsam und moralisierend. Was Kant damit meinte, würde ich heute als zwischenmenschliche Regeln und sozial-verantwortungsvolle Einstellung bezeichnen.
Die ästhetischen Urteile und ihre Entwicklung lassen sich wiederum den fünf Sinnen und den entsprechenden fünf Entwicklungsebenen nach Fonagy et al. zuordnen, wobei beim Gesichtssinn und der Entwicklungsebene des Kindes als repräsentationaler Akteur neben dem Schönen das Erhabene, wie Kant es nennt, zum Vorschein kommt und im Unermesslichen die Spannung zwischen Vernunft und Einbildungskraft hervortreten lässt. Im Erhabenen steckt auch so etwas wie Religiosität. Alle drei Kritiken von Kant lassen sich übrigens mit dem Konzept der Mentalisierung auf den fünf Entwicklungsebenen nach Fonagy et al.5 verknüpfen: mit den Kategorien und den reinen Vernunftbegriffen der Kritik der reinen Vernunft, mit der aus dem kategorischen Imperativ abgeleiteten allgemeinen moralischen Entwicklung und mit der Entwicklung und den Charakteristika der ästhetischen und teleologischen Urteilskraft. Damit wird Kants Transzendentalphilosophie in den Rahmen einer entwicklungspsychologischen Bewusstseinstheorie gestellt.
Beim teleologischen Urteil mit dem Prinzip der inneren und äußeren Zweckmäßigkeit der Natur entwickelt Kant eine teleologische Naturkonzeption. In „Natur und Liebe“6 habe ich erörtert, wie eine solche Konzeption die Entstehung von Bewusstsein, Denken und Werten herleiten kann. Im Zusammenhang mit den sogenannten Endursachen, wenn zukünftige Ziele das gegenwärtige Geschehen beeinflussen, entwickelt Kant die Idee eines intuitiven Verstandes. Er löst damit die Antinomie der Urteilskraft zwischen der mechanischen Kausalität und der durch Endursachen zumindest theoretisch auf, versäumt aber, diese Möglichkeit methodisch weiterzuverfolgen, um zu besseren Urteilen und Entscheidungen zu kommen. Durch Pluralität und Meinungsvielfalt im öffentlichen Raum, also in der Politik, können wir uns einem intuitiven bzw. ganzheitlichen Verstehen immer mehr annähern, sodass unsere gemeinsame Urteilskraft deutlich verbessert wird. Notwendige Voraussetzung dafür ist das Vermeiden und Auflösen von Feindseligkeiten. In diesem Zusammenhang spreche ich auch das sog. Demokratische Trilemma an, welches durch ganzheitliches Verstehen aufgelöst wird. Kants „sensus communis“ auf Gemeinschaften bezogen würde dieses Trilemma ebenfalls beseitigen. Leider wurde in bisherigen Kant- Rezeptionen seine teleologische Naturkonzeption kaum behandelt.
Hier in diesem Buch will ich wieder mit meinem Alter-Ego, den ich K getauft habe (ich bin dabei H-P), diskutieren und dabei über Kants Kritiken und über Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit meiner Idee der vollkommenen Liebe reden. Zuerst geht es um die Gehirnentwicklung durch die fünf Sinne und damit verbundene Emotionen. Das schafft die Basis, um konkrete Erkenntnisse zu gewinnen.
Es folgt eine Verknüpfung mit psychologischen Lerntheorien, mathematischen Modellen, den Kategorien von Kant7 und Existentialen analog zu Heidegger8, den fünf mentalen Entwick-lungsebenen von Fonagy et al.9 und den dianoetischen Tugenden von Aristoteles10. Ferner lassen sich fünf Gegensatzpaare hier einflechten, die Nishida11, ein Mitbegründer der Kyoto-Schule in Japan, in einer philosophischen Schrift über Selbstidentität aufführt. Der Umgang mit den Spannungen dieser Gegensätze sei wichtig für die menschliche Identitätsfindung, meint er, denn wie sonst können wir dieselben bleiben, obwohl wir uns doch ständig ändern.
Beim Gesichtssinn verbunden mit Emotionen der Enttäuschung und Verunsicherung, dem Modelllernen und Mentalisieren und der Tugend der Weisheit geht es um das Thema der Existenz, wenn es schließlich jedem um unser aller Dasein geht, um Leben und Tod, sodass die Vernunft und von Heidegger sogenannte Existentiale an die Stelle der Kategorien und des Verstandes treten.
Bei der Erklärung der Kant´schen Begriffe „kategorisch“, „hypothetisch“ und „disjunktiv“ bemerkte ich, dass innerhalb der vier Gruppen der Kategorien die erste Kategorie jeweils kategorisch, die zweite hypothetisch und die dritte disjunktiv ist. Dasselbe gilt für die drei Existentiale Sorge, Verantwortung und Liebe, die als reine Vernunftbegriffe der Idee des denkenden Ichs, der Idee der Freiheit und der Idee Gottes bei Kant entsprechen. Somit haben wir bei den Kategorien als den reinen Verstandesbegriffen und diesen drei Existentialen als den wichtigsten reinen Vernunftbegriffen dasselbe Ordnungsschema, und die Kategorien und Existentiale gehen auseinander hervor bei der mentalen Entwicklung von Kindern, die bei Fonagy und anderen beschrieben ist.
Im Kapitel über die Entwicklung der praktischen Vernunft wird zuerst der kategorische Imperativ von Kant hergeleitet. Dann wird mehr praxisbezogen die moralische bzw. zwischenmenschliche Entwicklung von Menschen anhand eines idealtypischen Beispiels demonstriert, wie aus einer bedingten Zuneigung sich immer mehr eine unbedingte Liebe entwickeln kann und sich so das Gesetz der Freiheit, der kategorische Imperativ herauskristallisiert. Als formales Gesetz liegt er vor jeder Erfahrung, ermöglicht aber tiefere menschliche Beziehungen. Um dann Erkenntnisse und begehrte Vernunftideen in Einklang zu bringen, braucht es notwendigerweise die Urteilskraft, die sich am Prinzip dieser Zweckmäßigkeit ausrichten muss, wie immer mehr menschliche Beziehungen immer moralischer bzw. liebevoller gestaltet werden können.
Auch die Urteilskraft entwickelt sich, und zwar erst die ästhetische, die ohne Begriffe zuerst nur von den Sinnen und der Einbildungskraft bzw. dem Vorstellungsvermögen abhängt, bis sie sich beim Gesichtssinn mithilfe von Ideen zum Erhabenen „erhebt“, und die Vernunft, die mithilfe des Gesichtssinns über die Grenzen des Horizonts hinaussieht, mit der Einbildungskraft in Konflikt gerät. Wer sich in andere hineinversetzt, überschreitet auch eine Horizontgrenze und sollte möglichst vernünftig spekulieren. Hier zeigt sich der Konflikt zwischen Vernunft und Einbildung auf der Beziehungsebene zu anderen und zur Natur bzw. auf der mentalen Ebene als repräsentationaler Akteur. Die Bedeutung der ästhetischen Urteilskraft, die immer bestimmend ist, zeigt sich mithilfe der Kategorien und Existentiale, und Erkenntnisse ermöglichen schließlich teleologische Urteile, die sowohl bestimmend wie die ästhetischen Urteile als auch reflektierend sein können. Reflektierend sind sie, wenn sie nur allgemein von unseren Affekten bzw. Interessen her unsere Lebensgestaltung gemäß vernünftiger Prinzipien regulieren. Bestimmende teleologische Urteile haben immer mit konkreten Erwartungen zu tun, die unsere Gefühle bestimmen. Empfindungen entsprechen den ästhetischen, Affekte den reflektierenden und Gefühle den bestimmenden teleologischen Urteilen.
Zum Schluss wende ich mich der Teleologie zu, die ich im letzten Abschnitt des Kapitels über die Kritik der Urteilskraft behandle. Dabei vergleiche ich insbesondere die Kant´sche Naturkonzeption mit der von mir, die ich in „Natur und Liebe“ beschrieben habe. Übrigens vertritt ein zeitgenössischer amerikanischer Philosoph, Thomas Nagel12, ebenfalls die Meinung wie Kant und ich, dass eine teleologische, auf ein nur durch Kriterien bestimmtes utopisches Ziel ausgerichtete Naturkonzeption die vernünftigste ist, und nicht eine neodarwinistische oder eine intentionale.
Da alles Wissen aller Menschen zusammengenommen immer beschränkt ist und trotz allem Zuwachs an Wissen beschränkt bleiben wird, manche jedoch, so wie ich selbst, über derartige Grenzen hinausgehen wollen, ergänzen sie Wissen durch Annahmen. Kant unterscheidet hier Meinungen, die prinzipiell der Erfahrung zugänglich sind, Erkenntnisse vom Verstand her und Vernunfterkenntnisse, von denen man glaubt bzw. darauf vertraut, dass sie das Miteinander harmonisch bzw. moralisch, wie Kant es nennt, gestalten helfen, und hier ist es sinnvoll, sich mit anderen über die Sinnhaftigkeit derartiger Erkenntnisse auszutauschen, da sie ja das Zusammenleben mit ihnen betreffen.
K: Da fühle ich mich angesprochen: Wenn du dich mit mir austauschen willst, was gibt es da für wichtige Vernunfterkenntnisse?
H-P: Da ist beispielsweise die Frage, ob wir Menschen einen freien Willen haben. Ist es vernünftig, so etwas anzunehmen?
K: Wieso ist das wichtig? Wenn ich etwas will, dann mache ich es eben, sobald die Gelegenheit da ist.
H-P: So einfach ist das leider nicht, denn einerseits kannst du dir nicht sicher sein, ob das, was du willst, wirklich dein eigener Wille ist. Es gibt so viele Einflüsse, unter denen du stehst, Werbung, die Meinung anderer, ein Geltungsbedürfnis, das du nicht wahrhaben willst, usw. Andererseits ist es die Frage, ob dein Wille überhaupt etwas ausrichten kann. Vielleicht bildest du dir das alles nur ein, und alles ist rein mechanisch aus Naturgesetzen erklärbar. Manchmal geschieht, was du willst, manchmal nicht. Möglicherweise geht es nur dann nach deinem Willen, wenn etwas aus vollkommen anderen Gründen passiert. Kant jedenfalls kommt nach reiflicher Überlegung zu dem Ergebnis, dass Freiheit weder beweisbar noch widerlegbar ist. Sie ist nur möglich, wenn möglichst viele sich verantwortungsvoll verhalten, und verantwortungsvolles Verhalten ist nur sinnvoll bzw. vernünftig, wenn es Freiheit gibt.
K: Gut, aber wieso ist die Annahme, dass Freiheit möglich ist, so wichtig und sinnvoll für unser Zusammenleben?
H-P: Weil Menschen immer egoistischer werden und die betreffende Gemeinschaft immer mehr zersetzt wird und zerfällt, wenn die meisten nicht an diese Möglichkeit glauben. Sie verhalten sich dann immer verantwortungsloser und bestätigen damit die Unmöglichkeit von Freiheit, ein Teufelskreis und eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.
K: Dann ist die Idee der Freiheit doch ganz real.
H-P: Da hast du allerdings recht, und auch Kant zählt sie unter die von der Vernunft her erkennbaren Tatsachen. Es ist übrigens die einzige Idee, meint er, die er als eine Tatsache annimmt bzw. für eine Realität hält. Aber bevor wir hier weitermachen, lass uns doch erst einmal mit Kants Kritik der reinen Vernunft beginnen, wobei ich deren Thematik des Erkenntnisgewinns mit der Gehirnentwicklung und der mentalen Entwicklung bzw. der des Verstandes und der Vernunft bis zum Glauben an Gott verknüpfen will.
1 (Wikkaschek, 3. Auflage 2024, S. 337)
2 (Wikkaschek, 3. Auflage 2024, S. 391)
3 (Kierkegaard, 2005)
4 (Kolb, Dasein, um zu lieben. Daseinsanalytische Grundlagen für Psychologie und Psychotherapie (2018 überarbeitete Fassung), 2017a)
5 (Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 2008)
6 (Kolb, Natur und Liebe. Eine teleologische Konzeption der Konstitution und Entwicklung der Natur (2018 überarbeitete Fassung), 2017e)
7 (Kant, Critik der reinen Vernunft, 1781 (A), zweite Auflage 1787 (B))
8 (Heidegger, 2006)
9 (Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 2008)
10 (Aristoteles, 1985)
11 (Nishida, 2011a)
12 (Nagel, 2016)
1. Von der Gehirnentwicklung zum Glauben an Gott
(Sachkonflikte lösen sich durch Erkenntnisgewinn auf.)
K: Du willst also von der Gehirnentwicklung zum Glauben an Gott kommen. Beides soll deiner Meinung nach etwas miteinander zu tun haben, oder?
H-P: Stimmt, wir beginnen zuerst mit der Entwicklung unseres Gehirns, wie sich dort nach und nach Strukturen bilden, die uns immer besser in die Lage versetzen, mit uns und unserer Umwelt zurecht zu kommen.
K: Und ein Glaube an ein höheres Wesen oder Gott rundet das ab.
H-P: So ungefähr. Fangen wir also an:
1.1. Die fünf Sinne und ihre Beziehungsmuster
H-P: Unser Gehirn entwickelt sich während der Verarbeitung der Daten, die von unseren Sinnen kommen. Der erste Sinn, der dabei Bedeutung hat, ist der Geschmackssinn, wenn ein Neugeborenes die Muttermilch mit dem Fruchtwasser geschmacklich vergleichen kann, da es durch Prägung im Uterus den Geschmack des Fruchtwassers zu erkennen gelernt hat. Es kennt den Geschmack des Fruchtwassers, und vor jeder weiteren Erfahrung wird es vom Schmecken dieses Geschmacks lustvoll ergriffen. Während das Gehirn alle Sinnesdaten verarbeitet, werden wir durch bestimmte Sinne und damit verbundene Emotionen angeregt, aufmerksam zu sein, uns selbst zu finden und zu empfinden und bestimmte Erwartungshaltungen zu bilden, sodass unser Gehirn entsprechende Strukturen anlegt, die bestimmte Erfahrungen und eine bestimmte Art des Lernens ermöglichen. Wie schon Piaget feststellte, lassen sich derartige Reifungsprozesse nicht durch Training bzw. Erfahrung ersetzen oder gar erzwingen.
K: Die Sinne regen also die Entwicklung des Gehirns an, sodass diese Entwicklung sinnvoll im doppelten Sinne ist. Mit den Sinnen meinst du die fünf Sinne unserer Wahrnehmung.
H-P: Stimmt. Nach dem Geschmackssinn kommen in der Reihenfolge ihrer Bedeutung der Geruchssinn, der Tastsinn, der Gehörsinn und der Gesichtssinn. Wenn ich Sinnesdaten vergleiche, ordne ich die Daten nach Mustern, wie ich diese Daten in Beziehung setze. Das erste Beziehungsmuster ist die Äquivalenz: entweder sind zwei Geschmacksdaten gleich wie die der Muttermilch und des Fruchtwassers oder nicht. Das zweite Beziehungsmuster ist die Induktion: ein allgemeiner Geschmack, ob es schmeckt oder nicht, wird z.B. durch einen bestimmten Geruch induziert.
K: Moment mal! Beim ersten Vergleich hast du Daten desselben Sinnes von zwei verschiedenen Objekten aufeinander bezogen, dann aber von demselben Objekt die Daten von zwei verschiedenen Sinnen.
H-P: Ja, das Muster der Gleichheit bezüglich einer Eigenschaft bezieht zwei verschiedene Objekte mit ein, und das Muster der Induktion bedeutet, von einer besonderen Eigenart eines Objekts wird auf eine allgemeingültige und damit reale Eigenschaft bzw. Qualität dieses Objekts geschlossen. Wenn das bei zwei verschiedenen Objekten jeweils so ist, sind sie sich zumindest ähnlich.
K: Dann bezieht sich das erste Muster auf Quantitäten, was gleich ist und wie viele verschieden sind, das zweite dagegen auf reale Qualitäten eines einzelnen Objekts. Dabei muss ein Kind anhand der Sinnesdaten aber etwas als Objekt herausgreifen können, und zwar unabhängig von Erfahrungen etwas als einheitliches Objekt begreifen, sich überhaupt einen Begriff davon machen, was eine Einheit ist. Erst wenn ein Kind das begriffen hat, kann es ein Objekt herausgreifen, damit Erfahrungen machen und sich daraus neue Begriffe bilden. Das sind dann empirische Begriffe. Die ersten Begriffe müssen vor jeder Erfahrung sein, da sie ja erst Erfahrungen ermöglichen. Kant13 nennt solche Begriffe apriori oder reine Begriffe. Die ersten reinen Begriffe beziehen sich auf Quantitäten, die nächsten auf Qualitäten.
H-P: Indem ein Kind Kontingenzen entdeckt zwischen eigenen Regungen und Bewegungen samt bestimmten Effekten einerseits und Bewegungen mit Effekten von der Mutter andererseits, kann es diese Bewegungen, Effekte und eigene Regungen als Einheiten aus der Menge aller Sinnesdaten herausgreifen und sich so immer mehr einen Begriff von ihr und von sich selbst als ihre Erweiterung machen, bis es sich selbst und die Mutter als voneinander immer verschiedenere Akteure begreifen und verstehen kann. Die Kontingenzentdeckungsfähigkeit, die laut Fonagy und anderen14 schon bei der Geburt entwickelt ist, befähigt ein Kind, sinnliche Eindrücke in den Vordergrund zu rücken, auf diese Weise herauszugreifen, zu begreifen und sich so Begriffe zu bilden. Ohne Begriffe kann es nichts wahrnehmen bzw. als wahr annehmen.
K: Stimmt. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass die Eingeborenen in Amerika die Schiffe von Kolumbus nicht wahrnehmen konnten, weil sie sich noch keinen Begriff von Schiffen gemacht hatten. Erst nachdem Kolumbus mit ihnen in einem Boot zu einem der Schiffe hingefahren war, konnten sie allmählich begreifen, was ein Schiff war, und erst ab diesem Zeitpunkt die Schiffe vom Ufer aus wahrnehmen. Doch welches Beziehungsmuster kommt nun?
H-P: Das dritte Muster ist die Deduktion: ein besonderer Geruch z.B., der an etwas mehr oder weniger bleibend anhaftet, wird abgeleitet aus allgemeinen Qualitäten des Tastsinns.
K: Ja, feste, getrocknete Hundekacke stinkt nicht so sehr wie weiche, und der Geruch verfliegt schnell.
H-P: Du hast ja drastische Beispiele.
K: Aber sie passen. Hab´ ich selbst als Kind ausprobiert mit dem Geruch. Hart und weich sind allgemeine Qualitäten und ein Zeichen für die besondere Intensität eines bestimmten Geruchs.
H-P: Also gut. Wenn das bei mehreren Objekten derart abgeleitet werden kann, dann besteht auch bei ihnen eine Ähnlichkeit. Hier werden Qualitäten in Beziehung gesetzt. Das Begreifen in der dritten Gruppe reiner Begriffe ist daher relational. Insgesamt betrachten Kinder die Dinge, auf die sich die verschiedenen Daten bisher beziehen, als einander ähnlich oder unähnlich. Das vierte Beziehungsmuster ist die räumliche Anordnung über gehörte Nähe und Distanz. Vertikale und horizontale Drehbewegungen des Kopfes lassen uns die drei Dimensionen, aber auch Eigenschaften wie z.B. die Akustik eines Raumes über das Gehör wahrnehmen. Hier spielen Umstände und Modalitäten eine Rolle. Die vierte Gruppe reiner Begriffe hat also mit Modalitäten zu tun. Das fünfte Beziehungsmuster schließlich ist das der zeitlichen Entwicklung räumlicher Gegebenheiten, also das der Evolution, was uns durch den Gesichtssinn gegeben ist. Hier geht es auch um Existenz, um die eigene und die von anderen Menschen. Die entsprechenden reinen Begriffe sind dann Existentiale, wie Heidegger15 sie nennt.
K: In seinem Buch „Die Ordnung der Dinge“ beschreibt Michel Foucault die Entwicklung der Wissenschaften seit der Renaissance so, dass zuerst nach Ähnlichkeit eine Ordnung bestimmt wurde, dann räumlich wie auf einem Tableau, z.B. das System nach Linné in der Biologie, und schließlich seit Darwins Evolutionstheorie nach der Zeit16.
H-P: Bei der mentalen Entwicklung von Kindern spielen ihre Kontingenzentdeckungsfähigkeit und das soziale Spiegeln der Mutter, wenn sie ihr Kind nachahmt, die entscheidende Rolle. Es entdeckt zuerst Kontingenzen und Regeln, die ein näheres Verständnis von Zusammenhängen vermitteln. Mithilfe des sozialen Spiegelns bekommt es allmählich ein Bewusstsein von sich selbst als Akteur. Ferner kann es so Sinnesdaten zusammenfassen, vor sich hinstellen bzw. sich vorstellen und begreifen bzw. sich Begriffe bilden, die dann weitere Erfahrungen ermöglichen. Von den Regeln bzw. reinen Begriffen entwickeln sich zuerst die quantitativen, dann darauf aufbauend die qualitativen, anschließend die relationalen, sodann diejenigen, die mit den Modalitäten zu tun haben, und schließlich als krönenden Abschluss die existenziellen Daseinsbegriffe.
K: Wie Kinder das alles so nach und nach lernen, ist schon eine Leistung. Sie verstehen sich immer besser darauf, etwas in eine raum-zeitliche und begriffliche Ordnung zu bringen, und so entwickeln sich ihre eigene Anschauung, Einbildung, Ordnung, ihr eigener Verstand und ihr eigenes Selbstbewusstsein. Was an Sinneseindrücken gleichzeitig auf das Kind eingestürmt ist und einen undifferenzierten Gesamteindruck gemacht hat, wird immer mehr ausdifferenziert und verstandesmäßig analysiert.
1.2. Die Arten des Lernens und der Mathematik
H-P: Dem durch den Geschmackssinn ermöglichten Lernen durch affektive Prägung entspricht eine Gehirnstruktur, die durch den Geschmackssinn mit einer Lustempfindung hervorgerufen wird. Diese Struktur kann Lust und Unlust bzw. Ja und Nein unterscheiden, es schmeckt, oder es schmeckt nicht, oder nach dem Muster der Gleichheit, es ist gleich oder ungleich. Mathematisch entspricht diese Struktur den beiden Zahlen 1 und 0. Griechisch mathēmatikē téchnē heißt übrigens „Kunst des Lernens“.
K: Von der Mathematik kommst du als Diplommathematiker wohl nie ganz los. Aber wie kommst du genau auf Prägung?
H-P: Einem Kind hat sich der Geschmack des Fruchtwassers eingeprägt. Wenn sich uns etwas eingeprägt hat, sind wir vor weiterer Erfahrung geneigt, Lust zu empfinden, wenn irgendetwas dem Eingeprägten gleich ist. Da ist diese Freude an Wiederholungen, die wir später mit der Erfahrung aufmerksam suchen, wenn wir das Eingeprägte öfter wiederentdecken. Dies bewirkt eine rudimentäre Raum- und Zeitvorstellung von diskreten Lust-Orten bzw. Lust-Zeitpunkten, die zwar identifiziert werden können, aber ansonsten völlig unabhängig voneinander sind. Die hier angesprochene Gehirnstruktur befähigt uns, Kontingenzen zu entdecken, und wird bereits im Uterus entwickelt. Das meinen jedenfalls wie schon erwähnt Fonagy und andere17. Grundlegende Prinzipien, dass es etwas von uns Unabhängiges, uns Entgegenstehendes und Gegenständliches geben muss, können schon verstanden werden. Mental entwickeln sich Kinder in der Folge als physische Akteure, die an bestimmten Orten zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte Wirkungen erreichen können. Sie werden aktiv und nehmen dann passiv die Wirkung der Aktivität sinnlich wahr. Dabei empfinden sie immer mehr Lust, was daran erkennbar ist, dass sie ihre Aktivitäten oft wiederholen, ohne ein Ende zu finden, sozusagen stundenlang mit wachsender Begeisterung. Sie scheinen Geschmack daran gefunden zu haben, sagen wir dann. In der lustvollen Spannung zwischen aktiv und passiv wird ihnen ihre Identität als physische Akteure18 bewusst, und sie können auch andere, z.B. ihre Mutter, als solche identifizieren.
K: So fangen sie also an, sich langsam von der Mutter zu emanzipieren.
H-P: Genau, das geht mit jeder Entwicklungsebene weiter. Der nächste Sinn, der eine Strukturerweiterung des Gehirns anregt, ist der Geruchssinn mit der Empfindung des Gereiztseins bei einem als unangenehm empfundenen Geruch. Diese Struktur ermöglicht Lernen durch empfindungsmäßige Gewöhnung. Vor jeglicher Erfahrung lässt ein Geruch uns etwas empfinden, sodass wir damit einen Begriff von Qualitäten haben, bevor wir entsprechende Erfahrungen machen. Wir finden und empfinden etwas bei uns und werden dabei fähig, uns an etwas allmählich durch Steigerung der tolerierten Reize zu gewöhnen. Da die Intensität unserer Sinneseindrücke stufenweise wahrgenommen wird, ist jede Steigerung und damit jede Gewöhnung stufenförmig. Mathematisch entspricht das dem stetigen Hinzufügen eines spezifischen Nachfolgers nach einer allgemeinen Regel. Von der Folge wird auf die Regel geschlossen.
K: Jede Reizsteigerung ist besonders bzw. spezifisch, aber die Regel der stufenweisen Steigerung ist eine allgemeine.
H-P: Per Induktion lassen sich mit dieser Gehirnstruktur die natürlichen Zahlen erschließen. Es sind Ordnungszahlen, die den Steigerungen jeweils zugeordnet werden, und jeder Zahl folgt natürlicherweise die nächstgrößere. Induktives Denken wird möglich, und Kinder verstehen Wenn-Dann-Regeln. Wenn ein Kind einen Ball wegwirft und dann schreit, holt ihn die Mutter manchmal auch ein zweites Mal, aber nach dem fünften Mal ist endgültig Schluss. Papa holt ihn vielleicht noch ein zehntes Mal. Wenn dann wirklich Ende ist und das Kind schreit und sich nicht beruhigt, scheint es dem Kind zu stinken, d.h. wir bringen diese Reaktion des Kindes mit dem Geruchssinn in Verbindung. Zeitlich und räumlich können so Cluster von Orten und Zeitpunkten sich vorgestellt werden. Es gibt entsprechende Mengen und Teilmengen, Vereinigungen von Mengen und Schnittmengen, mathematisch gesprochen also schon eine gewisse Mengentheorie. In der Folge entwickeln sich Kinder zu sozialen Akteuren19, die sich daran gewöhnt haben, dass sie unter bestimmten räumlichen und zeitlichen Umständen, die von ihren Mitmenschen bzw. sozialen Verhältnissen abhängig sind, aktiv sein können und unter anderen Umständen nicht. Ihrem subjektiven Empfinden stehen objektive Gegebenheiten gegenüber, und in dieser teilweise gereizten Spannung zwischen objektiv und subjektiv können sie sich und andere als soziale Akteure identifizieren. Durch Prägung und Habituation rufen wir Dinge in den Bereich unserer Wahrnehmung, wir drücken ihnen einen affektiven Stempel auf und gewöhnen uns empfindungsmäßig an ihre Eigenarten.
K: Objektiv und subjektiv, das hat doch auch etwas mit der Relativitätstheorie zu tun: Wenn du deine Nase in meinen Hintern steckst, dann hat objektiv betrachtet jeder eine Nase im Hintern, aber subjektiv betrachtet bin ich relativ besser dran und vielleicht nicht ganz so gereizt wie du.
H-P: Mit deinen Witzen willst du mich wohl aus dem Konzept bringen. Trotzdem taste ich mich jetzt vorsichtig vor zum Tastsinn verbunden mit dem Affekt der Überraschung oder des Schrecks, den man bei deinen plötzlich hereinbrechenden Witzen bekommen kann, was insgesamt eine Erweiterung der Gehirnstruktur anregt, die Lernen durch klassische Konditionierung möglich macht, d.h. wir fühlen vor, um vor Überraschungen geschützt zu sein, und erwarten vor jeder Erfahrung, dass etwas Bestimmtes, was wir wahrnehmen, ein Zeichen für etwas anderes ist.
K: Oh, tut mir leid, dass ich dich erschreckt und deine Erwartungen empfindlich jäh zerstört habe, aber immerhin habe ich jetzt deine Gehirnstruktur erweitert.
H-P: Die Erweiterung geht eher wieder in die Richtung einer Gewöhnung wie vorhin, dass ich mich allmählich abhärte gegenüber deinen Einwürfen und nichts mehr empfinde. Übrigens, die bisherigen Arten des Lernens entsprechen unseren Arten von Emotionen, Prägung den Affekten, Habituation den Empfindungen und die klassische Konditionierung den durch Erwartungen bestimmten Gefühlen (von vorfühlen). Doch weiter: Wir kommen in die Lage, zu begreifen und zu erfassen, dass z.B. ein Klingelton ein Zeichen dafür sein kann, dass es bald Nahrung gibt, wie beim Pawlowschen Hund. Bevor wir jedoch solche Erfahrungen machen können, müssen wir uns zuerst einen Begriff von Relationen gemacht haben. Das besondere Ereignis, dass es gleich Essen gibt, wird aus dem allgemeinen Zeichen des Klingeltons abgeleitet. Das Zeichen ist deswegen allgemein, weil alles, was Aufmerksamkeit erregt, als Zeichen dienen kann. Vielleicht sind deine Witze ein Zeichen, dass du mehr Aufmerksamkeit willst, oder dass du dich etwas überfordert fühlst.
K: Oder fühlst du dich von meinen Witzen überfordert?
H-P: Die meisten davon kenne ich schon.
K: Na gut, dann mach weiter!
H-P: Danke! Kinder bilden auf dieser Entwicklungsebene vorsichtig Aktivitätsketten, bei denen das Ergebnis der einen Aktivität die Voraussetzung für die nächste ist, werden dabei immer geschickter und lernen so z.B. das Laufen.
K: Soweit ich weiß, beginnt diese Phase mit neun Monaten bei der sogenannten Neunmonatsrevolution, wenn Kinder überrascht oder vor Schreck zusammen mit ihrer Mutter die Aufmerksamkeit auf etwas Drittes richten. Reaktionen der Mutter auf etwas Drittes können nun als Zeichen gelernt werden, dass etwas Besonderes geschieht, und umgekehrt können Kinder jetzt durch allgemeine Gesten die Aufmerksamkeit der Mutter auf etwas Besonderes lenken. Das ist Deduktion bei beiden. Manche Forscher unterstellen Kindern hier schon Intentionalität, die sie mit ihren Müttern teilen würden. Nach Fonagy und anderen gibt es das erst auf der nächsten Entwicklungsebene. Zu diesem Zeitpunkt der Entwicklung gibt es nur gemeinsame Interessen, keine Absichten auf Seite der Kinder. Interesse heißt wörtlich Dazwischen-Sein: zwischen Mutter und Kind ist etwas Drittes, und dies ist ein Zeichen für die Kontinuität ihrer Beziehung. Bei einer Trennung gibt die Mutter ihrem Kind ein Kuscheltier mit, damit es sich nicht einsam fühlt. Das Kuscheltier ist wie eine Brücke zwischen Mutter und Kind. Die Kontinuität der Beziehung wird gewahrt. Psychoanalytiker wie Winnicott bezeichnen so etwas wie ein Kuscheltier auch als Übergangsobjekt.
H-P: Kinder merken jetzt, wo etwas herkommt, wo sie gerade angekommen sind und was auf sie zukommen kann bzw. worauf sie zukommen können. Was die Zeit betrifft, so gibt es schon Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wenn ich drei Äpfel hatte und jetzt zwei esse, dann werde ich nur noch einen Apfel haben. Sie können addieren und subtrahieren und damit prinzipiell sich die ganzen Zahlen, auch die negativen erschließen. Sie leihen sich einen Apfel und essen alle Äpfel auf, sodass sie einen Apfel schulden. Das ist dann -1. Räumlich kann etwas auf sie zukommen, oder sie können bei ihren Aktivitätsreihen vorwärtskommen, d.h. es gibt jetzt verschiedene Richtungen im Raum, und zwar auf sie zu und von ihnen weg. Es kommt immer mehr Bewegung ins Spiel. Kinder entwickeln sich immer mehr zu teleologischen Akteuren20, die je nach neuem Telos bzw. Zweck geschickt die Richtung wechseln können. Einerseits können sie kontinuierlich Schritt für Schritt teleologisch vorankommen, andererseits können ihre Aktivitätsketten plötzlich abbrechen, sodass sie sich und andere in dieser angstvollen Spannung zwischen kontinuierlich und diskontinuierlich als teleologische Akteure identifizieren können. Durch die klassische Konditionierung werden keine neuen Dinge oder Eigenschaften ins Leben der Kinder gerufen, die Eigenschaften und Dinge werden in gewissen Verhältnissen zueinander reguliert.
K: Man weiß ja, dass Kinder gerade in den ersten Lebensjahren viel Kontinuität brauchen, vor allem in ihren Beziehungen zu den wichtigen Versorgern (englisch Caregivers), meistens zu ihren Eltern. Sie erleben in ihrer Entwicklung schon genug Abbrüche bei ihren eigenen Aktivitäten. Wenn von außen zu viel davon dazukommt, bekommen sie zu starke Ängste, die sie in ihrer Entwicklung behindern.
H-P: Schön, dass du das Emotionale so betonst. Das bildet ein angenehmes Gegengewicht zu meinen doch eher funktionalen Ausführungen. Als Nächstes haben wir das Gehör und Emotionen der Sehnsucht mit einer Erweiterung der Gehirnstruktur, die Lernen durch operante Konditionierung zulässt, d.h. vor jeglicher Erfahrung achte und höre ich darauf, ob meine Vorhaben und Absichten auf Resonanz stoßen und so meine Sehnsucht erfüllt werden kann. Davor muss ich mir jedoch schon einen Begriff gemacht haben von günstigen und ungünstigen Modalitäten. Kinder wollen ihre Wünsche und Sehnsüchte erreichen und sind traurig, wenn sie das nicht schaffen. Räumlich und zeitlich können sie Entfernungen abschätzen, wie weit entfernt sie von ihrer Wunscherfüllung sind und wie lange es noch dauert, bis sie dahinkommen. Mathematisch wird der Raum zu einem dreidimensionalen Vektorraum, und die Zeit zu einer kontinuierlichen Zeitlinie. Da sie selbst der Mittelpunkt im Raum sind, gibt es noch keine richtige Geometrie, keinen affinen Raum mathematisch ausgedrückt. Sie können ihre Kräfte einteilen bzw. rationieren, sodass sie sich die rationalen Zahlen erschließen können und durch kontinuierliches Vervollständigen der Abstände zwischen den rationalen Zahlen schließlich auch die reellen Zahlen. Kinder handeln jetzt absichtsvoll bzw. intentional. Manchmal erreichen sie geradlinig ihr Ziel, und manchmal fangen sie immer wieder von vorne an. In dieser sehnsuchtsvoll-schmerzhaften Spannung zwischen linear und zirkulär können sie sich und andere als intentionale Akteure21 identifizieren. Durch operante Konditionierung wird nichts Neues zwischen den Dingen reguliert, es wird das Verhältnis der Menschen zu den Dingen moduliert.
K: Diese Entwicklungsphase dürfte spätestens mit 18 Monaten beginnen, wenn Kinder anfangen zu sprechen, sodass sie ihrer Mutter ihre Absichten immer deutlicher mitteilen können.
H-P: Als letztes kommen wir nun zum Gesichtssinn und Emotionen der verunsichernden Enttäuschung mit einer Erweiterung der Gehirnstruktur durch Spiegelneuronen, die Lernen durch Hinsehen ermöglicht, wie andere sich verhalten, indem wir uns in sie hineinversetzen. An den dadurch wahrnehmbaren Unterschieden zu anderen können wir etwas lernen bzw. uns von ihnen abkucken. Vor irgendeiner Erfahrung vergleichen wir uns. Kinder wollen etwas oder sich selbst darstellen, sowie als repräsentationale Akteure22 wertgeschätzt werden. Indem sie sich in andere hineinversetzen, sind sie nicht mehr der alleinige Mittelpunkt im Raum, sodass sie sich jetzt eine affine Geometrie erschließen können, d.h. mathematisch ausgedrückt können sie je zwei Punkten A und B im Raum zwei Vektoren eines dreidimensionalen Vektorraums von A nach B und von B nach A zuordnen. In diesem Ähnlichkeitsraum kommt an allen möglichen Stellen Bewegung auf, Bewegungen überlagern sich, auch rhythmische, die zu sich überlagernden Schwingungen führen. Im Mathematischen gibt es komplizierte Schwingungsgleichungen, die nur mit komplexen Zahlen lösbar sind, sodass diese prinzipiell erschließbar sind. In der Quantenphysik erhält die Zeit eine räumliche Struktur, indem sie mithilfe der komplexen Zahlen räumlich aufgespannt wird, um eine Superposition mehrerer Möglichkeiten theoretisch zu erfassen. Bei der entsprechenden quantenphysikalischen Zustandsgleichung, der Schrödingergleichung, entspricht dann der Hamiltonoperator des Systems der wirklichen bzw. wirksamen Zeitentwicklung, also dem, was gewesen ist bzw. woher ein Zustand kommt, die Herkunft, und die partielle Ableitung nach der Zeit multipliziert mit der imaginären Einheit dem, was aus der Zukunft für Möglichkeiten auf einen zukommen oder wohin man zukünftig kommen kann, das ist imaginär, nur vorstellbar. Indem beides in der Schrödingergleichung gleichgesetzt wird, hat man eine notwendige Bedingung für den Zustand, in dem man gerade angekommen ist, die Ankunft. Leider gibt es als Lösung der Schrödingergleichung nur Wahrscheinlichkeiten. Für Einstein war das so enttäuschend, dass er die Quantenphysik ablehnte mit den Worten: „Der liebe Gott würfelt nicht.“
K: Wow, dann hätte ich als Wunderkind schon mit vier Jahren Quantenphysik studieren können, oder? Aber nur mit Wahrscheinlichkeiten zu leben in einem so zarten Alter, ist nicht so prickelnd.
H-P: Da hast du allerdings recht. In der verunsichernd-enttäuschenden Spannung zwischen räumlich und zeitlich